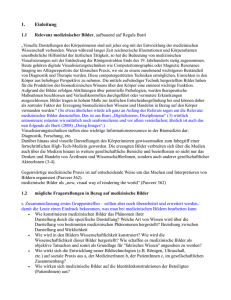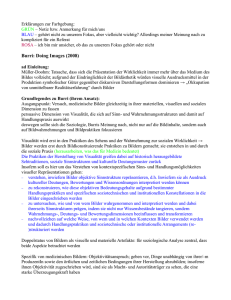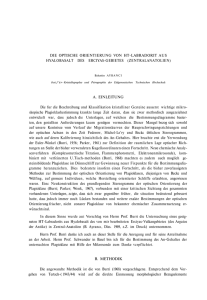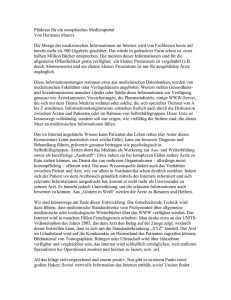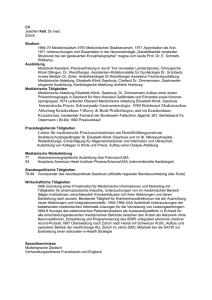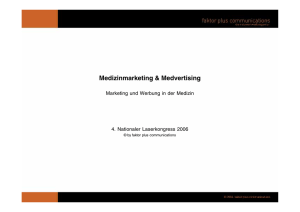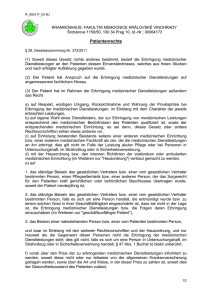12_Doing Images Bilder in der Medizin Folie: Einführung in das
Werbung

12_Doing Images.doc Bilder in der Medizin Folie: Einführung in das Thema Allgemeingesellschaftlich scheint es eine Tendenz zu geben, dass die Bedeutung von Visualität in unserer Gesellschaft immer mehr zuzunehmen scheint. Das betrifft auch die Medizin als gesellschaftlichen Teilbereich. Wir haben gelernt, in der medizinischen Praxis Visualisierungen durch bildgebende Technologien wie Röntgenbilder, Computertomographie und Magnetresonanz als selbstverständliche kulturelle Darstellungsformen zu betrachten, sogar als objektive wissenschaftliche Körperabbildungen. Dabei ist einem im Alltag selten bewusst, welche institutionellen Aspekte, Kontextwissen, Routinen, standardisierte Abläufe und kulturelle Normen wie auch ästhetische und moralische Prinzipien wirksam werden, welche kulturellen Sehtraditionen, individuelle Blicktechniken oder das Erfahrungswissen bei der Bildpraxis eine Rolle spielen. Es gibt eine Vielzahl an möglichen Blickwinkeln, aus denen man sich medizinischen Bildformen soziologisch nähern kann, wenn man sich überlegt, in welcher Weise medizinische Bilder in der Gesellschaft eine Rolle spielen. [Soziologische Analyse der Bildinhalte (inkorporiertes Wissen, kulturelle Vorstellungen / Körperbilder), Faktenproduktion durch Bilder (z.B. wie Bilder das produzieren, was sie darstellen), soziotechnische Herstellung von Bildern, historisch, etc., Identitätskonstruktion (US / Embryos, Umgang mit den Bildern im medizinischen Alltag und im gesellschaftlichen Alltag.] Wir interessieren uns für die spezifischen Wirkungen von medizinischen Bildern, die in der sozialen Bildpraxis zur Geltung kommen. Warum ist das für uns soziologisch relevant? Weil das Wissen, das durch und mit den Bildern hervorgebracht wird, in das aktuelle Verhalten von Individuen eingebracht wird. Und weil Erwartungen hinsichtlich imaginisierten Zukünften formuliert werden und dementsprechende Entscheidungen getroffen werden, die sozial wirksam werden. Die visuellen Darstellungen des Körperinneren wurden gewissermaßen zum Inbegriff einer fortschrittlichen HighTech-Medizin. Bernike Pasveer, eine Wissenschaftsforscherin aus den Niederlanden, spricht in diesem Zusammenhang von „a new, visual way of rendering the world“. Wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, dass Wissen und Praktiken sich immer wechselseitig mit der repräsentierten Welt verändern. Ärzte und Ärztinnen sind meist überzeugt, dass Bilder für die medizinische Diagnose in spezifischen Fällen wichtig sind oder aber, dass Patienten durch z.B. Röntgenbilder eine Diagnose eher annehmen. Medizinische Bilder werden oft wie Fotographien behandelt und somit als unverfälschte Abbildungen einer körperbezogenen Realität angesehen. Man kann hier natürlich Überlegungen zur sozialen Konstruktion von wissenschaftlichen Fakten anstellen, sich Fragen stellen zur Anfertigung oder zur Interpretation von medizinischen Bildern. Wir aber gehen einen Schritt weiter und wollten herausarbeiten, wie medizinische Bilder soziale Wirklichkeit in der Praxis konstruieren und welche Bedeutung sie in spezifischer Weise dabei haben. Eine Autorin, die sich intensiv mit der Bildpraxis befasst hat, ist Regula Valérie Burri, eine Soziologin und Wissenschaftsforscherin aus der Schweiz. In ihrer Ethnographie, einer Feldforschung in CH, DE, 12_Doing Images.doc USA, in der sie sich hauptsächlich mit der medizinischen Bildpraxis der Magnetresonanz beschäftigt hat, „Doing Images . Zur Praxis medizinischer Bilder“, publiziert 2008, arbeitet sie heraus, dass Bilder durch bildkonstituierende Praktiken zu Bildern gemacht werden. Bilder haben allgemein materielle, soziale und visuelle Dimensionen, die alle soziologisch relevant sind. Nach Burri sollte sich die Soziologie nicht nur auf die Analyse von Bildinhalten, sondern auch auf Bildwahrnehmung und Bildpraktiken konzentrieren. Sie fragt was die Bildpraxis von einer anderen wissenschaftlichen Praxis unterscheidet und was visuelle Repräsentationen so besonders macht. Sie entstehen also erst in und durch die soziale Praxis durch ein „Doing Images“, wie sie das nennt. Visualität entsteht erst in der Praxis und ist somit keine intrinsische Komponente von Bildern, sondern wird situativ hergestellt. Dabei geht sie davon aus, dass medizinische Bilder in bestimmten Kontexten eher ihre bildspezifische Wirkung entfalten können. Burri unterscheidet ein Doing Visuality von einem Undoing Visuality. Diese Unterscheidung trifft sie entlang dem Ausmaß an visueller Wirksamkeit der Bilder, was je nach Kontext und Setting unterschiedlich ausfallen kann. In manchen Momenten in der medizinischen Bildpraxis spielt die Visualität der Bilder keine oder nur ein untergeordnete Rolle. Das heißt dass sie dann z.B. eher als objektive wissenschaftliche Fakten angesehen werden. In diesem Fall handelt es sich um ein Undoing Visuality. Dabei formuliert sie ihre Thesen entlang drei relevanter Dimensionen: Folie: Drei Dimensionen von medizinischen Visualisierungen Burri befasst sich in ihrer Ethnographie „Doing Images“ mit der Frage, in welcher Weise medizinische Bilder es schaffen, ihre scheinbar objektive Wirkung zu entfalten. Nach ihr gibt es hier drei Dimensionen, die ineinander spielen. Sie nennt sie „Visual Value“, „Visual Performance“ und „Visual Persuasiveness“. Was meint sie nun damit? Unter visual value versteht sie den visuellen Eigenwert von Bildern: Der Unterschied zwischen Bild und Sprache liegt auch darin, dass Bilder gleichzeitig wahrgenommen werden, wohingegen Sprache nur sequentiell erfasst werden kann. Sie fragt, welchen Einfluss diese Gleichzeitigkeit der Wahrnehmung nun auf den Umgang mit Bildmaterial in der Medizin hat, also auf die sozialen Interaktionen. Wichtig ist bei Burri, dass es ihr ganz stark um die Praxis geht, also um die sozialen Handlungen aufgrund, mit und durch medizinische Bilder, sie vertritt also einen „praxeologischen Ansatz“. (Das Handlungsmoment drückt sich im Begriff „Doing Images“ aus.) Ein Beispiel für diesen Eigenwert der Bilder in der medizinischen Diganostik: Ein Radiologe kann einem Chirurgen durch ein Röntgenbild sehr viel kommunizieren, wobei ohne das Bild vier Seiten Text übermittelt werden müsste, wie zum Beispiel die genaue Lage und die Beschaffenheit des Tumors. Wichtig ist für die Autorin auch die Art der Darstellung – visual performance -, hier spricht sie die Bildpraxis an, die mit ihren Worten, „das Ergebnis bildherstellender und bildwahrnehmender Praktiken bzw. soziotechnischen Einschreibungen und interpretierende sinnliche Wahrnehmung“ ist. Hier haben wir das Wechselspiel zwischen Darstellung und Wahrnehmung, also die Aushandlungsprozesse in der sozialen Interaktion. Einerseits liegt eine manifeste sozio-technische Konstruktion vor, andererseits auch deren Interpretation. Sie sagt in diesem Zusammenhang auch, dass es sich bei medizinischen Bildern meisten um Abbildungen handelt, die ohne diese Bilder unsichtbar sind, was dazu führt, sie als direktes Abbild von Körperteilen zu verstehen. 12_Doing Images.doc Der Eigenwert medizinischer Bilder, zum Beispiel von Röntgenbildern - der visual value - gemeinsam mit der visual performance, spielen in die Wirkung, die diese Bilder in der Praxis haben, hinein. Burri nennt das visual persuasiveness, was sich als Überzeugungskraft oder Verführungskunst übersetzen lässt. Sie sagt, dass die visuell vermittelten Informationen und Botschaften viel einprägender wirken als sprachlich vermittelte. Dabei stellt sie eine Ambivalenz fest: Einerseits haben medizinische Bilder eine starke Überzeugungskraft und rhetorische Autorität, weil ihnen durch den wissenschaftlichtechnischen Kontext Objektivität zugeschrieben wird. Andererseits besitzen sie eine verführende – sie schreibt seduktive – Macht. Dazu kommen wir noch in anschließenden Teil. Die Autorin interessiert sich nun dafür, WIE sich diese visual persuasiveness durch bestimmte Praktiken und Kontexte der Verwendung von diesen Bildern AUSWIRKT und (inwiefern dabei ihre autorativen oder seduktiven Komponenten stärker aktualisiert werden, also) inwieweit die Autorität und die Verführungskraft medizinischer Bilder durch die Praxis verstärkt werden. Wir haben jetzt gehört, was Bilder tun, jetzt kommen wir zu der Frage, wie man Bilder tut, wie funktioniert ein „Doing Images“ bzw. ein „Doing Visuality“? Folie: Doing Visuality Burri fragt, inwiefern die Bildpraxis durch die – wie sie sagt - „visuelle Logik“ strukturiert wird, also wie werden die drei Dimensionen von Visualität, die wir gerade besprochen haben - Eigenwert, Darstellung und Wirkung - relevant? Ganz wichtig sind für Burri unter anderem zwei Aspekte: In der konkreten Situation, also in der medizinischen Praxis nämlich der Glaube an das Bild und die Ästhetik. Seeing is believing… Medizinische Bilder erhalten Autorität, sowohl für PatientInnen, als auch für ÄrztInnen. Die meisten von Burri befragten Ärzte glauben an das Bild, sie glauben an das was sie sehen. Das ist besonders interessant, wenn man die soziotechnische Konstruktion des manifesten Bildes und die Interpretation mitbedenkt. Diese visuelle Autorität nennt die Autorin auch den praktischen Glauben an das Bild, weil er in der Praxis und durch die Praxis hergestellt und relevant wird. Diese Überzeugung ist situativ gültig und je nach mehr oder weniger reflexiver Distanz zu medizinischen Bilder, die ein Arzt hat, wirksam. Diese Ambivalenzen werden besonders deutlich, wenn man sich so manche von den Transkriptausschnitten ansieht: So meint ein Mediziner: „Wenn ich ein Gehirn sehe, wo nur Wasser drin ist, (…) dann weiß ich klar, da ist wenig Hirn da.“. Ein anderer sagt aber wiederum: „Es ist eine Gefahr in den Bildern. Weil die Bilder manchmal so viel suggerieren, wie nicht drin ist. Durch das Bild wird viel Autorität vorgespielt, scheinbare Autorität, die absolut nicht vorhanden ist.“ Der Bilderglauben ist also kein absoluter, sonder ein praktischer, das begründet sich auch dadurch, dass medizinische Bilder in bestimmten Kontexten durch Beglaubigungsstrategien autorisiert werden. Vor allem dann, wenn eine reflexive Distanz gefragt ist, wie zum Beispiel in wissenschaftlichen Artikeln. Hier wird Bildern von Experten ein erklärender Text hinzugefügt, was zu einer Erhöhung der Autorität bzw. der „Überzeugungskraft“ führt. Ein anderes Setting wo diese Strategie der Beglaubigung zu Anwendung kommt, ist der Gerichtssaal. Wenn dort Fotografien und Röntgenbilder verwendet werden, dann muss ein Experte die Glaubwürdigkeit bestätigen. 12_Doing Images.doc Schönheit verführt… Was jetzt die Ästhetik von medizinischen Bildern betrifft, könnte man annehmen, dass sie als wissenschaftliches Datenmaterial betrachtet werden. Das trifft nur zum Teil zu. Interessanterweise sprechen einige von Burri befragte Mediziner dieses Thema ganz offen an. So sagt einer: „Diese Bilder, die eben schön aussehen, werden völlig irrational besonders gerne gemacht, auch wenn sie zur Fragestellung überhaupt nichts beitragen. Wenn man es rational überlegt, ist es nur verlorene Zeit.“. Auch für die PatientInnen sei die Ästhetik der Bilder faszinierend. Die Betrachtung von Bildern löst Emotionen aus, das trifft auch auf medizinische Bilder zu. Burri führt das auch auf die Bedeutung zurück, die abgebildeten Körperteilen kulturell zukommt. So lösen bspw. Bilder vom Gehirn weit mehr Emotionen aus als Bilder vom Herzen. Burri sagt, dass das darauf zurückzuführen ist, dass das Gehirn ein zentrales identitätsstiftendes Organ im Zuge der Entwicklungen in den Neurowissenschaften geworden ist. Weiters konstatiert sie eine libidinöse Beziehung zwischen Bild und Betrachter. Ganz besonders deutlich wird das in folgendem Interviewausschnitt: „Wir sind in einem medizinischen Voyeurismus drin. Die Lust, Verborgenes im Körper durch diese Maschinen, sprich Schlüssellöcher, zu sehen und eine virtuelle Befriedigung dabei zu empfinden, sodass ein […] signifikanter Teil von solchen MR- oder CT-Untersuchungen mehr der Befriedigung des Lustzentrums des Gehirns des Doktors dienen, als in der Patientengeschichte irgendwie hilfreich vorwärts zu kommen.“ Burri schließt daraus, dass die Ästhetik von Visualisierungen und ihre Inszenierung in einem bestimmten diskursiven und lokalen Kontext Emotionen ansprechen und dadurch die Wahrnehmung intuitiv erfolgt. ----Diese beispielhaften Ausführungen sollten gezeigt haben, welche Dimensionen die Wirkung von medizinischen Bildern haben können und durch welche sozialen Handlungen diese Wirkungen innerhalb eines komplexen gesellschaftlichen Feldes ein mehr oder weniger starkes Ausmaß annehmen können. Damit möchten wir vorerst schließen und in die Diskussion überleiten. Dabei haben wir uns folgende Fragestellung überlegt, die sich für uns nach der Auseinandersetzung mit Bildern in der Medizin im Zuge einer visuellen Soziologie stellt: Etwaige/r Diskussionspunkt/e: In welchen gesellschaftlichen Kontexten entwickeln medizinische Bilder ihre Wirkungen und welche Auswirkungen das haben kann? (Beispiel: Verständnis von gesund/krank - visuelle PETDarstellungen von „gesundem“ und „schizophrenem“ Gehirn im Profil oder so.)