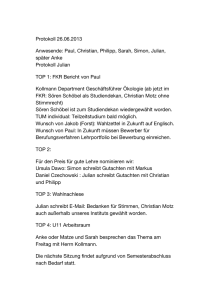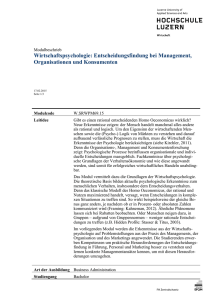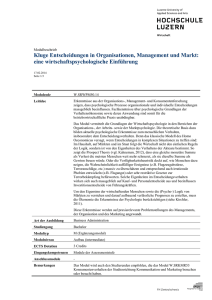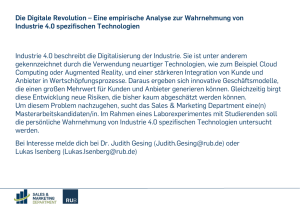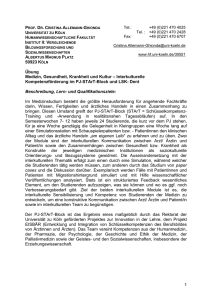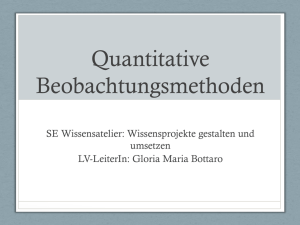Neue Technologien/Medien in der Pädagogik
Werbung

Evaluation des Modellprojekts Neue Technologien/Medien in psychosozialen und pädagogischen Handlungsfeldern am Institut für Erziehungswissenschaft der Philipps-Universität Marburg gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst Projektleiterin: Prof. Dr. Christina Schachtner Projektmitarbeiterinnen: Tanja Paulitz, Erziehungswissenschaftlerin, wissenschaftliche Hilfskraft m.A. Annette Allendorf, studentische Hilfskraft Lehrbeauftragte im Rahmen des Modellprojekts: Roland Bader, Diplompsychologe Rita Gerstenberger, EDV-Trainerin PD Dr. Christel Kumbruck, Diplompsychologin Kontaktadresse: Prof. Dr. Christina Schachtner Institut für Erziehungswissenschaft der Philipps-Universität Marburg Wilhelm-Röpke-Str. 6B, 35032 Marburg T. 06421/28-4703, FAX 06421/28-8946 E-Mail: [email protected] 2 Inhalt Einstimmung 5 1. Begründung und Anspruch des Modellprojekts 6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 Wer nimmt an den Veranstaltungen des Modellprojekts teil? Alter Interdisziplinäre Zusammensetzung Verteilung nach Geschlecht Entwicklungstendenzen 9 9 10 12 14 3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 Praxiserfahrungen und Technikkompetenz Vorerfahrung Zugang zu einem Computer Nutzung von Computern Zugang zum Internet Nutzung des Internet Theorie-Praxis-Vermittlung Praktische Erfahrung: "Selber ausprobieren" Theoretische Reflexion: "Detaillierter spekulieren" Erleben und Einschätzen von Technikkompetenz 15 15 16 17 19 21 22 22 25 28 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 Interessenstendenzen: Hochschuldidaktische Dimension Themen Die Welt im Zerrspiegel von Science Fiction Literatur Die Welt unter der Lupe dreidimensionaler Kartierung Didaktische Methoden 32 32 34 35 38 5. 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 Lernen aus der Differenz "Zunächst befremdend, dann eher anregend" Lernziel Virtuelle Welten Diskussion: "Wie so 'ne Kettenreaktion" Kontroverse: "Da prallen Welten aufeinander" Kooperation: "Da hatte er dann schon einen Stein im Brett" Toleranz: "Es kann ja jeder sein eigenes Zimmer haben" 42 43 46 46 49 50 52 3 5.3 Studienobjekt: Fremddisziplin - Lernziel: eigene Disziplin 53 5.3.1 Herangehensweise: "Die Art und Weise zu denken is' halt ganz anders" 53 5.3.2 Argumentationsweise: "Viele Pädagogen glauben irgend etwas. Ehm, bei uns glaubt niemand" 54 5.3.3 Fakten: "Man muß ja irgendwie 'en Maß haben" 57 5.3.4 Personen: "Da kann ich eigentlich nur von mir ausgehen" 58 Literatur 61 Anhang 59 4 Einstimmung Der elfjährige Alexandre führt mich durch den PC-Raum einer Grundschule in Porto Alegre im Süden Brasiliens. Auf den Bildschirmen sehe ich Texte und bunte Bilder, die von Mädchen und Jungen im Alter von Alexandre bearbeitet werden. Sie nehmen teil an dem Modellprojekt „Amora-Piaget“1, das ihnen die Möglichkeit eröffnet, selbst zu ForscherInnen zu werden. Das Projekt basiert auf der Annahme von Jean Piaget, derzufolge das Kind sich als aktives Wesen entwickelt, indem es in eine Auseinandersetzung mit der Welt eintritt, die Welt strukturiert und dabei diese und sich selbst verändert (vgl. Piaget 1983, S. 19). Zunächst haben die Kinder ihre eigenen Forschungsfragen formuliert z. B.: Wie kommt es, daß die Menschen nicht von der Erde fallen? Warum ist es hier Tag, wenn es in Tokio Nacht ist? Warum bricht die Erde da nicht ein, wo Vulkane sind? Anschließend begann die Suche nach Antworten; die Kinder sind zu zweit oder zu dritt in Bibliotheken gegangen, haben ältere SchülerInnen oder Erwachsene befragt und im Internet recherchiert. Am Tag meines Besuches sind sie gerade dabei, die Ergebnisse ihrer Untersuchungen ins Internet zu stellen. Alexandre hat zusammen mit einem Freund einen Forschungsbericht über jüdische Kultur erarbeitet; auf dem Bildschirm lese ich die Namen Albert Einstein und Arnold Schönberg. Ich frage Alexandre nach seinen Forschungsmotiven und er antwortet stolz: „I’m a jew“. Die Forschungsberichte werden in den nächsten Tagen über das Internet an argentinische Kinder geschickt, die die Berichte kommentieren. Die argentinischen Kinder haben ebenfalls geforscht und schicken ihre Ergebnisse nach Brasilien. Sie haben auch ein gemeinsames Logo kreiert: eine ‘Maus’, auf deren Oberfläche die Flaggen von Brasilien und von Argentinien zu sehen sind. Die Lerneffekte des Projekts sind vielfach: Die Kinder eignen sich eine neue 5 Kulturtechnik an, sie gestalten ihren Lernprozeß als AkteurInnen, üben sich in der Teamarbeit und im Aufbau interkultureller Beziehungen. Sie erleben ihre LehrerInnen in neuen Rollen als ModeratorInnen, KoordinatorInnen und BeraterInnen. 1. Begründung und Anspruch des Modellprojekts Die Bedeutung Neuer Medien (NM) für die Pädagogik ergibt sich aus deren Aufgabe, Perspektiven der Erziehung mit Perspektiven zu verknüpfen, die auf die Strukturen, Ressourcen und Behinderungen in sozialen Lebensräumen abstellen. Dies beinhaltet einerseits, Lern- und Sozialisationsprozesse zu initiieren und zu begleiten und andererseits Angebote zu entwickeln, die abzielen auf die Mitgestaltung sozialer Strukturen. Pädagogische Intentionen und Konzepte betreffen das Grundverhältnis zwischen Subjekt und Welt. Dieses formt sich zunehmend unter dem Einfluß der NM und ihrer Nutzung in Arbeit und Freizeit, im öffentlichen und im privaten Bereich (vgl. Merkert 1992, 53; Kübler 1993, 23). Die NM sind zu neuen Sozialisationsinstanzen geworden. Schon Kinder und Jugendliche, bewegen sich von klein auf in multimedialer Umgebung. Fernsehen, elektronische Kleinstinstrumente, Video- und Computerspiele sind selbstverständliche Bestandteile ihres Erfahrungsraumes geworden. Studien, die Ende der 80er Jahre in Bayern sowie in Städten des Ruhrgebiets durchgeführt wurden, ergaben, daß gut ein Drittel der befragten Jugendlichen einen eigenen Homecomputer besaß (Beierwaltes/Grebe/Neumann-Braun 1993, 99). Diejenigen, die keinen besaßen, wünschten sich meist einen. LehrerInnen, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen werden ihre AdressatInnen nicht mehr erreichen, wenn sie nicht wissen, welche Erfahrungshorizonte sich durch die NM erschließen, welche Wünsche diese ansprechen, welche Kompetenzen sie 1 Das Projekt wurde von der Professorin für Entwicklungspsychologie, Léa Fagundes/Staatl. Universität Porto Alegre konzipiert und wird an einer Reihe brasilianischer Schulen durchgeführt. Beteiligt sind Kinder aus Mittelschichts- und Unterschichtsfamilien. Ein wesentliches Projektziel ist, sozialen Ungleichheiten zu begegnen und ärmere Bevölkerungsschichten am Modernisierungsprozeß zu beteiligen. (http://www.cap.ufrgs.br/amora/1998/Amora-Piaget/concurso/) 6 freisetzen, was es heißt, in virtuelle Welten einzutauchen, welche Risiken damit verbunden sind. Nicht weniger entbehrlich ist es zu wissen, wie das Potential der NM zur Entwicklung zukunftseröffnender Handlungsperspektiven genutzt werden kann. Das seit dem SS 1997 von der Projektleiterin zusammen mit Mitarbeiterinnen, Lehrbeauftragten und KollegInnen anderer Fachbereiche durchgeführte Modellprojekt bindet Neue Technologien/Medien als Thema in das Studium der Diplompädagogik am Institut für Erziehungswissenschaft der Philipps-Universität Marburg ein. Im Rahmen des Modellprojekts finden jedes Semester Lehrveranstaltungen, Gastvorträge und Exkursionen zu ausgewählten Aspekten des Themenfeldes statt. Ziel des Modellprojekts ist die Vermittlung einer technik- und medienbezogenen Qualifikation auf der Wissens- und Handlungsebene in der universitären Ausbildung von PädagogInnen. Dazu gehört: 1. der Erwerb theoretischen und empirischen Wissens über neue Medien und Techniken und ihre soziokulturellen Implikationen 2. der Erwerb technischer Fertigkeiten, die einen kompetenten Gebrauch technischer/medialer Instrumente ermöglichen 3. der Erwerb methodischer Fähigkeiten, die zur empirischen Erforschung medialer Lebensfelder und computergestützter Arbeitsfelder erforderlich sind 4. der Erwerb medienbezogener und adressatInnenspezifischer Handlungskonzepte für die Arbeit in verschiedenen pädagogischen Praxisfeldern. Das Modellprojekt folgt einem lebensweltlich-interaktionistischen Ansatz in der Medienforschung (s. Schachtner i.E.). Der Begriff Lebenswelt bezeichnet die mit anderen geteilte, intersubjektive Welt in Gestalt von Werten, Leitbildern, Sinnzusammenhängen (vgl. Schütz/Luckmann 1975, 26). Lebenswelt ist die Welt, die immer schon da ist, in die man hineingeboren wird und die als Bezugsschema dient für die Aneignung neuer Erfahrungen. Doch unter den Bedingungen der Moderne sind die dem Subjekt Sicherheit verleihenden lebensweltlichen Strukturen brüchig geworden. Traditionelle Handlungsmuster und Lebensentwürfe verlieren an Gültigkeit (vgl. Giddens 1996, 182 f.). Dies produziert auf Subjektseite 7 Selbstverunsicherung, Selbstbefragung, Selbstzweifel, Krisen; aber es eröffnet auch Entwicklungspfade. Das Leben in der Moderne ist zu einem Experiment geworden, das nicht nur alle Lebensbereiche, sondern auch alle Lebensalter erfaßt, jedoch für die jeweiligen Alters- und Geschlechtsgruppen Spezifisches bedeutet. Ein lebensweltlich-interaktionistischer Ansatz berücksichtigt die gesellschaftlichen Umbrüche als Deutungs- und Handlungsrahmen, innerhalb dessen sich sowohl das mediale Angebot entwickelt als auch der Modus, in dem sich die Subjekte mit diesem Angebot auseinandersetzen. Es fragt nach dem Stellenwert der NM im Hinblick auf den an das Subjekt gestellten Anspruch, das Experiment der Moderne zu bestehen. Der Einsatz Neuer Medien in pädagogischen Arbeitsfeldern orientiert sich diesem theoretischen Ansatz entsprechend an Fragen wie: Fördert der Umgang mit NM Phantasie, Kreativität, Mut zur Neugestaltung von Lebensverhältnissen? Erlauben Computerspiele oder die Teilhabe an elektronischen Datennetzen das Experiment mit verschiedenen Identitäten sowie die Einübung in kontrastierende Handlungskompetenzen, um in einer nicht nur pluralen sondern auch widersprüchlichen Welt handlungsfähig zu sein? Bilden sich durch die globalen Kommunikationsstrukturen neue Gemeinschaftsformen, die die brüchig gewordenen alten ersetzen? Erfahren die Subjekte an den NM Anerkennung und Autonomie als Gegengewicht zu erlebter Ohnmacht in der Welt jenseits des Bildschirms. Welche Konsequenzen hat das Agieren in virtuellen Realitäten für die Auseinandersetzung mit Wirklichkeiten jenseits virtueller Begegnungen? Die Antworten auf diese Fragen bestimmen sich von zwei Seiten her: von seiten des Subjekts und seines Lebenskontextes, der trotz seiner Eingebundenheit in den gesellschaftlichen Wandel ein spezifischer bleibt und von seiten der Medien, die eine bestimmte gesellschaftlich geformte Logik in das Wechselspiel einbringen. Das Modellprojekt wird fortlaufend evaluiert, um feststellen zu können, inwieweit 8 die angestrebten Ziele erreicht werden bzw. verändert werden müssen. Einbezogen in die Untersuchungen werden neben den Lehrenden vor allem die Studierenden. Der Forschungsansatz orientiert sich an den Implikationen der von B. Glaser und A. Strauss konzipierten Grounded Theory, derzufolge wissenschaftliche Erkenntnisse induktiv, aus der Empirie heraus gewonnen werden sollen. Das benutzte methodische Repertoire umfaßt kontrastierende Forschungsinstrumente, die sich wechselseitig ergänzen und korrigieren können. Neben dem standardisierten Fragebogen kamen bislang das qualitative Interview sowie die Gruppendiskussion zur Anwendung. Der vorliegende Bericht enthält eine Zwischenbilanz, auf deren Basis das Modellprojekt weiterentwickelt werden soll. 2. Wer nimmt an den Veranstaltungen des Modellprojekts teil? Aufgrund der interdisziplinären Ausrichtung des Projekts werden die einzelnen Lehrveranstaltungen auch im Lehrangebot anderer Studiengänge angeboten, z.B. in den Studiengängen Soziologie, Politik, Ethnologie, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Theologie, Informatik und regelmäßig im Studiengang Neuere Deutsche Literatur/Medien. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich die Teilnehmenden der Lehrveranstaltungen zusammensetzen. Die Ergebnisse basieren auf soziodemographischen Daten, die mittels Fragebogen in 5 Seminaren über die ersten drei Semester der Laufzeit des Projekts hinweg (vom SS 1997 bis SS 1998) erhoben wurden. Im folgenden werden die wesentlichen Tendenzen, die sich aus diesen Daten herauskristallisieren, aufgezeigt. 2.1 Alter In den bisher angebotenen theoretisch ausgerichteten Seminaren liegt der ermittelte Altersdurchschnitt der TeilnehmerInnen bei etwa 24 Jahren. Beispielhaft können die Zahlen des Seminars "Virtuelle Welten und soziales Lernen" im WS 1997/98 betrachtet werden. In diesem Seminar überwiegt die Altersgruppe der 23-25jährigen, das statistische mittlere Alter beträgt 24,3 Jahre mit einer Streuung von 2,45 Jahren. Diese Verteilung deutet auf eine Gruppe von Lernenden hin, die wahrscheinlich direkt nach dem Abitur an die Hochschule 9 gekommen sind und hier ihre erste Ausbildung erhalten. Die Tatsache, daß fast keineR der Befragten vor Studienbeginn eine Berufsausbildung abgeschlossen hat, bestätigt diesen Eindruck. 2.2 Interdisziplinäre Zusammensetzung Die Vermutung, daß die interdisziplinäre Ausrichtung des Modellprojekts sich in der Teilnahme von Studierenden aus verschiedenen Fachbereichen niederschlägt, kann in der Tendenz bestätigt werden. 10 Zwar stellen die Studierenden der Pädagogik stets den größten Anteil der TeilnehmerInnen in allen Seminaren, jedoch differieren die Werte zwischen 42,9% und 79,5% der Gesamtzahl aller TeilnehmerInnen. Für diese Differenz scheinen zwei Faktoren verantwortlich: Zum einen erhöht sich der Anteil der Studierenden aus anderen Fachbereichen, wenn das Seminar von einem interdisziplinären Leitungsteam angeboten wird. Dies dokumentieren z.B. die Zahlen des in Kooperation mit der Informatik angebotenen Seminars "Virtuelle Welten und soziales Lernen" im WS 1997/98. 69,2 % der befragten StudentInnen gehören der Fachrichtung Pädagogik an, die anderen kommen aus der Neueren Deutschen Literatur/Medien sowie aus der Informatik2. Zum anderen zeigt sich folgender Entwicklungstrend. Während im SS 1997, in dem die erste Lehrveranstaltung des Modellprojekts stattfand, nur 20,5% der TeilnehmerInnen aus anderen Fachbereichen kamen, hat diese Gruppe im SS 1998 einen Anteil von 57,1%. Allein 32,1% der SeminarteilnehmerInnen studieren Neuere Deutsche Literatur/Medien als 1. Studienfach. Diese Zahlen deuten darauf hin, daß das Lehrangebot des Modellprojekts verstärkt für andere Fachbereiche attraktiv geworden ist. Eine andere Vermutung ist, daß Erziehungswissenschaft für diese Studiengänge als Nebenfach interessant wird, wenn der Themenkomplex Neue Technologien/Medien dabei vertieft und unter pädagogischen Fragestellungen betrachtet werden kann. 2 Allerdings ist die recht geringe Beteiligung von seiten der InformatikerInnen erklärungsbedürftig. Zum einen ist zu bemerken, daß der Rücklauf des Fragebogens vielleicht nicht die tatsächliche Beteiligung wiedergibt. Zum anderen war der Veranstaltungsort in den Räumen der Erziehungswissenschaft angesiedelt, was eventuell ebenfalls zu diesem Ergebnis beiträgt. Schließlich differieren die Studentenzahlen zwischen dem Studiengang Erziehungswissenschaft und dem Studiengang Informatik erheblich (im WS 97/98 betrug die Anzahl der StudienanfängerInnen im Diplomstudiengang Pädagogik 122, im Diplomstudiengang Informatik lag die Zahl der StudienanfängerInnen bei 61). 11 2.3 Verteilung nach Geschlecht Die Verteilung der TeilnehmerInnen nach Geschlecht ist vor dem Hintergrund interessant, daß in mehreren empirischen Studien der Marburger Studiengang Diplompädagogik als "Frauenstudiengang" bezeichnet worden ist.3 Es stellt sich die Frage, ob dieses Bild für Veranstaltungen des Modellprojekts stabil bleibt, da mit den Neuen Technologien/Medien ein neues und gesellschaftlich nach wie vor männlich konnotiertes Thema in die Pädagogik eingeführt wird. Zudem handelt es sich um ein explizit interdisziplinär angelegtes Lehrangebot, das sich ggf. mit den geschlechtsspezifisch geprägten Interessenstendenzen anderer Disziplinen überschneidet. Betrachtet man die Beteiligung von weiblichen Studierenden an den theoretisch ausgerichteten Seminaren des Projekts, so läßt sich zunächst eine nur geringe zahlenmäßige Dominanz feststellen. Exemplarisch können die Daten des Seminars "Modernisierung, Neue Technologien, Soziale Ungleichheit" im SS 1998 betrachtet werden: Von der Gesamtzahl von 28 Befragten sind 16 weiblich. Das entspricht einer prozentualen Verteilung von 57,1% Frauen und 42,9% Männern. Der Vergleich mit der statistisch erhobenen Anzahl an Studierenden am gesamten Institut für Erziehungswissenschaft ergibt ein deutlich anderes Bild: Für den Untersuchungszeitraum der Bestandsaufnahme steigt der Anteil der Studentinnen von ca. 60% im WS 1992/93 auf ca. 76% im WS 1993/94 mit einem eindeutig linearen Trend nach oben. Der Schluß, daß das "techniklastige" inhaltliche Arrangement der Lehrveranstaltungen des Modellprojekts mehr männliche Studierende in die Seminare zieht und damit eine gesellschaftliche Rollenverteilung widerspiegelt, sollte jedoch nicht voreilig gezogen werden. Unter Berücksichtigung der heterogenen interdisziplinären Zusammensetzung der Seminare, deren steigende Tendenz im vorangegangenen Abschnitt dokumentiert wurde, verschiebt sich das Muster. Beispielsweise verdeutlicht die im WS 1997/98 zusammen mit dem Fachbereich Informatik durchgeführte Veranstaltung, wie Fach- und Geschlechtszugehörigkeit im Gesamtspiegel ineinandergreifen 12 können. Graphik 1 veranschaulicht die Verteilung: 14 12 10 8 6 4 te r e W2 te lu o s b A 0 Geschlecht weiblich männlich Pädagogik NDL-M edien Informatik Graphik 1 Studienfach Das zunächst recht ausgewogen scheinende Verhältnis von männlichen und weiblichen Studierenden (53,8% weiblich und 46,2% männlich) löst sich vor dem Hintergrund der Studienfächer auf. Die Graphik zeigt, daß aus dem Fach Informatik nur Männer am Seminar teilnahmen, während aus dem Fach Neuere Deutsche Literatur/Medien Männer und Frauen zu gleichen Anteilen erschienen. Der in der Gesamtschau sichtbare leichte "Frauen-Überhang" bezieht sich auf das Fach Pädagogik: Zwei Drittel der PädagogInnen sind Frauen. Zum einen gibt dieses Ergebnis sicherlich eine geschlechtsspezifische Frequentierung von Studienrichtungen wieder, wie sie an der Universität insgesamt beobachtet werden kann. Zum anderen stellt sich die Frage, wie sich die Beteiligung aus dem Fach Pädagogik über mehrere Semesterveranstaltungen hinweg im Rahmen des Modellprojekts entwickelt. Einen ersten Eindruck vermitteln die Zahlen aus dem SS 1998: Im Seminar "Modernisierung, Neue Medien, Soziale Ungleichheit" sind 8 der 12 PädagogInnen weiblich. Unter 9 Studierenden aus der Neueren Deutschen Literatur/Medien befinden sich 5 Männer und alle 3 Teilnehmer aus der Politikwissenschaft sind männlichen Geschlechts. Ein Trend zeichnet sich ab, nach dem das Lehrangebot des Modellprojekts von Studierenden des Fachs Pädagogik ohne geschlechtsspezifische Auffälligkeiten genutzt wird. Die o.g. These vom "Frauenstudiengang" kann bestätigt werden. Die Beteiligung weicht 3 Vgl. Friebertshäuser, 1992 sowie Diplom-Studiengang Erziehungswissenschaft, 1994 und Betz/Wins, 1995. 13 nur unwesentlich vom Durchschnitt ab. In der Tendenz kann die Schlußfolgerung gezogen werden, daß die Einbettung des Themenkomplexes Neue Technologien/Medien in den Studiengang Erziehungswissenschaft ohne nennenswerte geschlechtsspezifische Einschränkungen gelungen ist. Darüber hinaus ist festzustellen, daß die Seminare für männliche Studierende anderer Fachbereiche mit steigender Tendenz große Attraktivität besitzen. 2.4 Entwicklungstendenzen Auf der Basis der Daten des hier dokumentierten Projektabschnitts lassen sich zwei wichtige Trends markieren, die auf die Frage nach der Beteiligung an Seminaren Antwort geben. Erstens ist eine wachsende interdisziplinäre Popularität und Bekanntheit für die Veranstaltungen des Modellprojekts feststellbar. Die Zusammensetzung der Seminare weist ein deutlich zunehmendes Interesse von Studierenden anderer Fachbereiche auf. Es stellt sich die Frage, ob es für Studierende zu einer thematischen Schwerpunktbildung im Themenkomplex Neue Technologien/Medien kommt, der mit Lehrveranstaltungen aus unterschiedlichen Disziplinen bestückt wird. Zweitens deuten die Zahlen darauf hin, daß eine kleine Gruppe von Studierenden kontinuierlich an Veranstaltungen zu diesem Themengebiet belegt. Die vermutete Schwerpunktbildung ließe sich durch diesen Trend stützen. Hierzu informieren die Ergebnisse des Fragebogens aus dem WS 1997/98, in dem die Motivation der Studierenden zur Seminarteilnahme erhoben wurde: Auf die standardisierte Abfrage (Mehrfachantworten möglich) geben 41,7% der Befragten (10 Personen) an, zum Themengebiet bereits Veranstaltungen besucht zu haben. Die Teilnahme am Seminar dient gemäß dem Antwortverhalten im Fragebogen dazu, dieses thematische Interesse weiter auszubauen. In der genaueren Betrachtung zeigt sich, daß 7 dieser 10 Befragten Pädagogik studieren. Es ist naheliegend, daß sie bereits Veranstaltungen im Rahmen des Modellprojekts besucht haben. Dies könnte darauf hinweisen, daß eine Gruppe von Studierenden das Angebot des Projekts bereits kontinuierlich nutzt und thematische Interessen im Rahmen des Seminars vertiefen möchte. 14 Die Zahlen des Seminars im SS 1998 verfestigen dieses Bild: Wieder geben 10 TeilnehmerInnen des Seminars an, Motivation zum Veranstaltungsbesuch sei der Ausbau des Themengebietes. 7 von ihnen sind männlich. In diesem Fall studieren nur 4 von ihnen Pädagogik im Hauptfach. Weitere 4 stammen aus der NDL/Medien. Dies könnte darauf hinweisen, daß sich ebenfalls aus dieser Fachrichtung eine Art "Stammpublikum" etabliert hat. Bei der Abfrage von Ideen und Anregungen für weitere Seminare des Modellprojekts äußert eine Befragte den Wunsch, in Zukunft zwischen einführenden und vertiefenden Seminaren zu unterscheiden. Diese Antwort weist ebenfalls darauf hin, daß unter manchen Studierenden ein Bedürfnis vorhanden ist, auf der Basis des bereits gewonnenen Wissens intensiv weiterzuarbeiten. Die Antwort auf die im Fragebogen erhobene Veränderung im Verhältnis zu den Neuen Technologien gibt darüber Auskunft, welcher Effekt mit einem Seminar hinsichtlich des Themas Neue Technologien/Medien erzielt wurde. Im WS 1997/98 geben 9 Studierende der Pädagogik und 3 der Neueren Deutschen Literatur/Medien an, zur weiteren Beschäftigung mit dem Thema ermutigt worden zu sein. Dieses Ergebnis könnte die Vermutung stützen, daß eine kleine Gruppe von TeilnehmerInnen eine kontinuierliche Beschäftigung mit Neuen Technologien/Medien anstrebt. Das Ergebnis des Fragebogens im SS 1998 (18 von insgesamt 28 TeilnehmerInnen) stützt dies. Mit Blick in die Zukunft kann an dieser Stelle eine erste Prognose formuliert werden. Demnach wäre für die folgenden Semesterveranstaltungen zu erwarten, daß sich ein Kern von spezialisierten Studierenden stärker herausbildet und ggf. vergrößert. Darüber hinaus ist die Entwicklung von Di-plomarbeiten in diesem Themenkomplex zu erwarten. 3. Praxiserfahrungen und Technikkompetenz 3.1 Vorerfahrung Um eine Vorstellung davon zu gewinnen, welchen Stellenwert der in den Seminaren des Modellprojekts eingebrachte neue Themenkomplex für die 15 theoretische Reflexion der Studierenden besitzt, ist es wesentlich, Art und Umfang der Vorerfahrung mit Neuen Technologien/Medien zu betrachten. Wie stark der Zusammenhang zwischen eigener technischer Vorerfahrung und Metadiskussion für Studierende ist, läßt sich beispielhaft anhand einer Bemerkung der Pädagogikstudentin Anja4 in einem Interview zeigen. Ihre ablehnende Formulierung illustriert die enge Verzahnung: "Mein Papa wollte mir schon vor Jahren 'en Computer kaufen. Da hatte ich aber noch 'ne Schreibmaschine durchgesetzt, weil ich gesagt hab', oh nein, ich hab’ keine Zeit und keine Lust, mich mit der ganzen Thematik da auseinanderzusetzen" (2)5. Welche praktischen Kenntnisse TeilnehmerInnen der Veranstaltungen bereits besitzen, welche Selbstverständlichkeit im Umgang mit der neuen Technik vorausgesetzt werden kann, wurde ebenfalls im Fragebogen erhoben. Uns interessiert hier besonders die Verbreitung des Zugangs zu Computern im allgemeinen und zur InternetTechnologie im besonderen sowie die Art der Nutzung. Bislang lassen sich folgende Trends ablesen: 3.1.1 Zugang zu einem Computer Es geben durchwegs alle TeilnehmerInnen der Lehrveranstaltungen des Modellprojekts an, Zugang zu einem Computer zu besitzen. Dieses Ergebnis dokumentiert, daß man von der Existenz irgendeiner Erfahrung mit Informationstechnologie bei den SeminarteilnehmerInnen ausgehen kann. Die Intensität und Bandbreite dieser Erfahrung kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus der Art des Zugangs zum Computer geschlossen werden. Die Auswertung der Fragebögen zeigt, daß in jedem Seminar ein großer Teil der Studierenden über einen eigenen Computer zu Hause verfügt. Beispielhaft kann eine Größenordnung von ca. 77% aus dem WS 1997/98 genannt werden. Es ist anzunehmen, daß die Entscheidung für die Anschaffung eines Computers in erhöhtem Maße mit einer Bereitschaft für eine gewisse Auseinandersetzung mit dem Gegenstand einhergeht. Wie setzen sich nun - exemplarisch betrachtet - im Seminar "Virtuelle Welten" WS 1997/98, das zusammen mit dem Fachbereich 4 Sämtliche Namen von Befragten wurden für diesen Bericht geändert. 16 Informatik angeboten wurde, die übrigen ca. 23% der SeminarteilnehmerInnen zusammen, die keinen eigenen Rechner besitzen? Sie gehören alle (mit einer Ausnahme) der Fachrichtung Pädagogik an. Dagegen kann jeder der Informatikstudierenden auf einen häuslichen Computer zurückgreifen. Die Grafik verdeutlicht diese Verteilung unter Berücksichtigung der Kategorien ‘wissenschaftliche Disziplin’ und ‘Geschlecht’. kein PC Geschlecht weiblich männlich Studienfach Studienfach eigener PC Pädagogik Anzahl 2 10 NDL-Medien Anzahl 1 1 Pädagogik Anzahl 3 3 NDL-Medien Anzahl 2 Informatik Anzahl 4 Die Verteilung zeigt, daß Studierende, die keinen Computer auf dem eigenen Schreibtisch stehen haben, im interdisziplinären Vergleich mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Pädagogik studieren. Geschlechtsspezifische Besonderheiten sind nicht feststellbar. 3.1.2 Nutzung von Computern Für die Art und Weise der Nutzung von Computern können die Zahlen aus dem WS 1997/98 ebenfalls exemplarisch betrachtet werden. Sie haben den Vorteil, daß sie den Kontrast zwischen dem Profil von eher sozialwissenschaftlichen und informationswissenschaftlichen Disziplinen aufzeigen können. Bei der Abfrage der Computernutzung bot der Fragebogen verschiedene Optionen, von denen mehrere angekreuzt werden konnten. Alle Befragten geben an, den Computer für Textverarbeitung zu nutzen; 50% nutzen ihn auch zum Spielen. Lediglich 4 Personen programmieren am Computer; sie gehören der Fachrichtung Informatik an. Die Auswertung der Fragebögen im SS 1997 zeigt an dieser Stelle eine interessante Tendenz. Von den ca. 50% der Teilnehmenden, die den Computer für Hobby und Spiel nutzen, sind deutlich mehr Männer (60%) als Frauen. Auffällig 5 Zahlen am Ende von Zitaten bezeichnen die Seite im Interviewprotokoll. 17 ist ebenfalls, daß alle Frauen, für die der Computer eine Bedeutung im Hobbybereich hat, einen eigenen Computer besitzen. Dieses Ergebnis deutet auf einen Zusammenhang zwischen Computerbesitz und Nutzungsprofil hin. Es scheint, daß das Vorhandensein eines eigenen Rechners dazu führt, daß Informationstechnologie vielseitiger genutzt wird. Die Heterogenität der Nutzungsarten weist darauf hin, daß von einer umfassenden Integration in verschiedene Tätigkeitsbereiche des alltäglichen Lebens ausgegangen werden kann. Dies verdeutlicht auch das folgende Ergebnis: Im WS 1997/98 geben alle TeilnehmerInnen explizit an, den Computer für ihr Studium einzusetzen. Dies ist in Verbindung mit der üblich gewordenen computergestützten Erstellung von Texten für Lehrveranstaltungen zu sehen. Weit verbreitet (ca. 77% der Befragten) ist ebenso der Einsatz des Rechners im privaten Bereich. Für die Hälfte der Informatiker ist der Computer auch Instrument im Rahmen von Erwerbsarbeit, während dies nur für 3 der insgesamt 18 PädagogInnen der Fall ist. Bezogen auf Zugang und Nutzung von Computern zeigen die beispielhaft dargestellten Zahlen des Seminars im WS 1997/98 keine eindeutig feststellbare Benachteiligung aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit. Deutlich wirkt sich hingegen die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Fachrichtung aus. Während für die befragten Informatiker Besitz und vielfältige Nutzung des Rechners offenbar selbstverständlich sind, gehören diejenigen, die z.B. nicht programmieren, mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Fach Pädagogik bzw. Neuere Deutsche Literatur/Medien an. Als interessant ist festzuhalten, daß die männlichen Studierenden der Pädagogik seltener einen eigenen PC besitzen als ihre weiblichen Mitstudierenden. Es ist denkbar, daß weibliche Studierende sich tendenziell erst dann für den Besuch eines Seminars des Modellprojekts entschließen, wenn sie über Vorerfahrungen in bezug auf den Gegenstand verfügen. Für die männlichen Studierenden scheint die mangelnde praktische Vorerfahrung kein Ausschlußkriterium zu sein. Daneben findet sich eine andere bemerkenswerte, wenn auch sehr kleine Gruppe von SeminarteilnehmerInnen, die eine intensive und breitgefächerte Nutzung des 18 Computers vorweisen kann. Besonders deutlich läßt sich dies anhand der Zahlen aus dem SS 1997, also aus dem ersten Seminar des Modellprojekts, illustrieren. Nur 3 der Befragten wählten im Fragebogen die Nutzungsart "Programmieren". Alle 3 sind männlich und besitzen einen eigenen Computer sowie einen Internetanschluß. Die umfassende Nutzungsweise von Computern bei einigen wenigen männlichen Seminarbesuchern läßt die Vermutung zu, daß das Lehrangebot im Bereich Neue Technologien ein Anziehungspunkt für eine kleine Gruppe sog. "Poweruser" darstellt. Dies deutet daraufhin, daß praktische Computererfahrungen die theoretische Auseinandersetzung mit dieser Technik fördern können. Wir werden auf diesen Zusammenhang nach der Analyse der Internetnutzung zurückkommen. 3.1.3 Zugang zum Internet Da die neuen Kommunikationsnetze für das Themenspektrum der Seminare von besonderer Bedeutung sind, wurden sie im Fragebogen gesondert abgefragt. Im SS 1997 geben 56% der TeilnehmerInnen an, einen Zugang zum Internet, das als größtes und populärstes Kommunikationsnetz gilt und auch unter der Bezeichnung "Netz der Netze" bekannt ist, zu haben. Obwohl nur ein kleiner Teil der Befragten (15,4%) über einen eigenen Internetanschluß zu Hause verfügt, ist doch die Zahl derjenigen, die grundsätzlich einen Zugang besitzen, relativ hoch. Im Seminar "Virtuelle Welten" im WS 1997/98 ist der Anteil der Studierenden, die einen Zugang zum Internet aufweisen, mit knapp 85% deutlich höher. Hier wirkt sich die Präsenz der Informatiker aus. Sie verfügen ohne Ausnahme über einen entsprechenden Zugang. Von den verbleibenden 4 Studierenden ohne Internetzugang gehören 3 der Fachrichtung Pädagogik an und 3 sind weiblich. Die folgende Grafik verdeutlicht die Verteilung der Internet-Zugänge in diesem Seminar: 19 kein Internet Geschlecht weiblich männlich Studienfach Studienfach Internet Pädagogik Anzahl 2 10 NDL-Medien Anzahl 1 1 Pädagogik Anzahl 1 5 NDL-Medien Anzahl 2 Informatik Anzahl 4 Diese Zahlen bestätigen die oben geäußerte Vermutung, daß aus dem Fach Pädagogik einige sog. "PoweruserInnen" am Seminar teilgenommen haben, die über eine gute technische Ausstattung verfügen. Neben dem Einfluß, den die Präsenz der Informatiker hat, könnte in diesem Ergebnis ebenfalls eine Entwicklungstendenz gesehen werden. Zum einen wäre es möglich, daß mit steigender gesellschaftlicher Popularität des Internet, mehr Studierende von der Möglichkeit eines kostengünstigen Zugangs über die Universität Gebrauch machen. Zum anderen könnte es sich um einen Effekt der Lehrveranstaltungen des Modellprojekts handeln, der Studierende, die anfangs in das Thema "reinschnuppern" wollten, zur weiterreichenden Auseinandersetzung mit der Technik motiviert. Eine Betrachtung der Zahlen aus dem SS 1998 scheint diese Tendenz zu stützen: 64% aller SeminarteilnehmerInnen geben im Fragebogen an, einen Zugang zum Internet zu besitzen. Diese Zahl liegt bereits höher als die vergleichbare Zahl aus dem SS 1997. Die Auswertung des Fragebogens aus dem SS 1998 ergibt, daß 53,6% der Befragten nicht auf die Mitbenutzung bei einer anderen Person angewiesen sind, sondern über eine eigene E-Mail-Adresse verfügen und damit bei einem Anbieter als eigenständige NutzerInnen registriert sind. Ob diese Werte auch in den zukünftigen Lehrveranstaltungen noch weiter ansteigen werden, ist zu überprüfen. Ein weiteres Ergebnis der Fragebogenauswertung bleibt über die hier dokumentierten Semester hinweg konstant: Für den Zugang der Studierenden zum Internet spielen die Rechnerräume der Universität eine herausragende Rolle. Im SS 1997 geben 15 der 20 Studierenden mit Internetzugang die Universität als Zugangsort an. Die Tatsache, daß ein hoher Anteil von ihnen weiblich ist, kann als Hinweis auf die Relevanz dieser universitätsöffentlichen Räume mit ihren hierfür 20 eingerichteten Rechnern für die Förderung von Frauen-Zugängen interpretiert werden. 3.1.4 Nutzung des Internet Für die Nutzung des Internet zeigt sich ebenfalls eine sehr eindeutige Tendenz. Die Zahlen aus dem WS 1997/98 sprechen hierfür exemplarisch: 22 Studierende (95,7%) geben in der standardisierten Abfrage der Tätigkeiten an, das Internet zur Informationsrecherche zu nutzen. Weniger beliebt sind Anwendungsgebiete des Internet, die Diskussion und Austausch mit anderen ermöglichen. Hierbei ist bemerkenswert, daß alle NutzerInnen von OnlineDiskussionsräumen Studierende der Fachrichtung Pädagogik sind; Männer und Frauen sind in diesen Diskussionsräumen zu gleichen Teilen vertreten. Hinsichtlich der 5 Befragten, die mit eigenen Seiten im WWW vertreten sind, fällt auf, daß sich unter ihnen keine weibliche Studierende befindet (3 der 5 studieren Informatik). Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild: Die Studierenden der Informatik sind in allen abgefragten Anwendungsgebieten mit Ausnahme des Bereichs "Diskussion/Austausch" überproportional hoch vertreten. Studierende des Fachs Neuere Deutsche Literatur/Medien favorisieren die Informationsrecherche im Internet und sparen die übrigen Gebiete weitgehend aus. PädagogInnen interessieren sich neben der Informationsrecherche vorwiegend für die Kontaktpflege sowie Diskussion und Unterhaltung über das Internet. Dagegen spielt die Veröffentlichung von eigenen WWW-Seiten bei ihnen keine wesentliche Rolle. Die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht erzeugt - wie die Zahlen wiedergeben - hinsichtlich der Funktion des Internet als Rechercheinstrument und Medium des Austausches keinen Nachteil. Relevant scheint Geschlechtszugehörigkeit im Unterhaltungsbereich, wo von insgesamt 8 Studierenden nur 2 weibliche im Fragebogen ihr Kreuz gesetzt haben. Augenfällig ist ebenfalls, daß keine Frau mit eigenen Seiten im WWW präsent ist. Allgemein ist für das Seminar "Virtuelle Welten und soziales Lernen" im WS 1997/98 festzuhalten, daß ungeachtet der Fach- und Geschlechtszugehörigkeit, 21 eine recht große Gruppe der Studierenden des Seminars Zugänge zum und Vorerfahrungen mit dem Internet besitzt. Es ist wahrscheinlich, daß für diese Gruppe technische Ausstattung und Vorbildung Motivationsfaktoren für den Seminarbesuch sind. Dieses Ergebnis kann exemplarisch für die bisher abgehaltenen Seminare des Modellprojekts verstanden werden. Auch die Analyse der Nutzung von Kommunikationstechnologie deutet folglich darauf hin, daß bei einigen Teilnehmenden von einem relativ hohen Grad an Vorerfahrungen mit den Neuen Technologien/Medien ausgegangen werden kann. Zugang und Nutzung dieser Werkzeuge außerhalb des universitären Curriculums bilden wichtige Voraussetzungen für die theoretische Reflexion im Rahmen der Seminare des Modellprojekts. Sie sind der Erfahrungshintergrund für die Entwicklung einer Auseinandersetzung aus sozialwissenschaftlicher Perspektive. Die im Modellprojekt zu beobachtende Vermittlung zwischen Theorie und Praxis, die für die Aneignung Neuer Technologien als neuartige Gegenstände der Alltagswirklichkeit von besonderer Bedeutung ist, möchten wir deshalb gesondert darstellen. 3.2 Theorie-Praxis-Vermittlung In den Äußerungen der Befragten dazu, welche Themen sie im Seminar am stärksten interessiert haben sowie in ihren Anregungen für weitere Seminare ist der ausdrückliche Wunsch nach einer starken Anbindung an die Praxis besonders bemerkenswert. Hiermit meinen sie jedoch nicht die Einsatzorte Neuer Technologien in der Sozialen Arbeit, sondern zunächst die eigene Erfahrung mit der technischen Welt. Zeigt sich in dem Ruf nach Praxis ein Trend zur "Theoriefeindlichkeit"? So wünschen sich einige der Studierenden Lehrveranstaltungen, die ganz oder teilweise in Rechnerräumen der Universität abgehalten werden. Dies schließt jedoch das Nachdenken über das Erfahrene nicht aus. 3.2.1 Praktische Erfahrung: "Selber ausprobieren" Hierzu das Auswertungsergebnis des Fragebogens aus dem SS 1997: 22 Hervorstechendstes Bedürfnis in der Auseinandersetzung mit den Neuen Technologien ist die praktische Erfahrung mit und an diesen Technologien. Angeregt werden sowohl die Arbeit in Kleingruppen am PC, der Besuch eines Internetcafés als auch die Integration eines Praxis-Blockes in das Seminar. Gemeinsames "Ausprobieren" wird als wichtig eingestuft. Die Befragten äußern hierbei die Einschätzung, daß ohne ausreichendes Vorwissen eine Diskussion auf akzeptablem Niveau nicht zu führen sei. Mit der Anregung, mehr praktische Komponenten zu integrieren, ist ebenfalls die Idee einer Chancengleichheit in der Seminardiskussion verbunden. Alle sollen wissen, wovon gesprochen wird, um mitreden zu können. Im Fragebogen des WS 1997/98 kristallisieren sich auf die offene Frage, ob es Themen gibt, die die Befragten über das Seminar hinaus weiterverfolgen möchten, drei Aspekte heraus. Der erste läßt sich mit den Zitaten "selber ausprobieren" und "effektiv nutzen" überschreiben. Der zweite Aspekt bezieht sich auf das Nutzungsverhalten anderer Gruppen und ihrer Beteiligung an bestimmten elektronischen Räumen ("Diskussionsbeteiligung in Newsgroups"). Hierunter fällt auch das Interesse an einer frauenspezifischen Nutzung. Der dritte und am stärksten vertretene Aspekt ist die Beschäftigung mit den durch Erfahrungen in virtuellen Räumen ausgelösten Veränderungen und Problemen im sozialen Leben Offline. In diesem Zusammenhang wird der "Einfluß von Virtuellen Realitäten auf Kinder und Jugendliche" sowie auf "Persönlichkeit und Gesellschaft" genannt. Aber auch Konsequenzen für die Sprache und das Lernen sind Gegenstand des Interesses. Die Diskussion zu diesem Aspekt bewegt sich im Rahmen einer gesellschaftspolitischen Chancen-Risiken-Debatte und versucht, sowohl neue Möglichkeitsräume als auch "Gefahren" auszuloten. Der Blick der Befragten richtet sich dabei zudem auf die KlientInnen Sozialer Arbeit. In der Gesamtbetrachtung läßt sich aus unserer Sicht keine Ablehnung von Theorie konstatieren. Eher scheint es, daß praktische Nutzung und eigene experimentierende Erfahrung eine Grundlage für eine theoretische Reflexion bilden. Die Äußerungen könnten als ein Bedürfnis gedeutet werden, zu wissen, worüber man spricht. Zugleich soll die Integration von praxisorientierten 23 Sequenzen alle auf einen ähnlichen Wissensstand bringen und Unterschiede in den Voraussetzungen ausgleichen. An dieser Stelle erhebt sich die Frage, ob die deutlich hörbare Einforderung der Praxis auch andere pädagogische Themenschwerpunkte betrifft oder ob er mit der Spezifik des Themas Neue Technologien/Medien zusammenhängt. Zum einen wäre der laute Ruf nach Praxis als exemplarische Reaktion auf die allgemeine Forderung nach einem stärkeren Praxisbezug in der Hochschulausbildung zu deuten. Das Studium soll optimaler auf einen Berufseinstieg vorbereiten und hierzu gehören eben auch praxisrelevante EDVKenntnisse. Die Theorie wird dabei ausdrücklich verstanden als Metadiskussion, die auf die Praxis aufbaut. Das legitime Bedürfnis nach der Aufklärung über den Gegenstand theoretischer Reflexion könnte allerdings im Themengebiet der Neuen Informations- und Kommunikationstechnologien noch eine besondere Ausprägung haben. Technikwissen ist in der gesellschaftlichen Symbolik mit den Insignien von Fach- und Spezialwissen ausgestattet, dem ein hoher Wert beigemessen wird. Deshalb könnte man annehmen, daß für PädagogInnen eine möglichst genaue Kenntnis dieses Wissens unabdingbar für die Diskussion und letztlich für ihr Urteil ist. Der Respekt vor dem technologischen Bereich erscheint aus dieser Perspektive nicht exemplarisch und zufällig. Technik steht als Symbol für Fortschritt und damit für eine kapitalisierbare Zusatzqualifikation für die Zukunft. Darüber hinaus scheint technisches Wissen nicht aus alltäglichen Evidenzen ableitbar, wie es vielleicht für andere Gegenstände der Pädagogik zunächst aussieht. Es muß unterrichtet werden, bevor man darüber reden kann. Daher ist eine praktische Ausbildung in diesem Bereich auch zugleich eine begehrte Investition in die eigene Hochschulausbildung. Hierin spiegelt sich ebenfalls eine gesellschaftliche Situation wider, die Technik zu einem elitären und zumeist männlichen Fach-Know-How stilisiert. Das Anliegen des Modellprojekts, ein ineinander verschränktes Angebot aus praxisorientierten und theoretischen Lehrveranstaltungen zur Verfügung zu stellen, soll konzeptionell weiterentwickelt werden. Da die Studierenden, die an den Übungen "Einführung in das Internet" teilnehmen, voraussichtlich erst nach 24 einigen Semestern in die theoretisch-reflektierend ausgerichteten Seminare des Hauptstudiums kommen, entsteht eine Lücke für heutigen SeminarteilnehmerInnen. Es zeigt sich jedoch anhand der im WS 1997/98 erhobenen Daten, daß die Verbesserung der praktischen Vorkenntnisse auch von den Studierenden selbst organisiert wird. Offen bleibt im bisher Gesagten, ob die fundierte technische Vorerfahrung tatsächlich mit dem Bedürfnis nach Metadiskussion einhergeht oder ob die These, daß sich die "Computerkids" reflexionslos im Labyrinth der virtuellen Welten verlieren, eine Bestätigung erfährt. Wir möchten dieser Frage anhand eines Fallbeispiels nachgehen. 3.2.2 Theoretische Reflexion: "Detaillierter spekulieren" Die Motivation des Informatikstudenten Julian, das interdisziplinäre Seminar im WS 1997/98 zu besuchen, läßt erkennen, daß technisch-praktische Kompetenz theoretisch-soziale Interessen nicht ausschließt. Über sein Selbstverständnis als Fachmann in Sachen Informationstechnologie definiert er zunächst ein Segment der von ihm angestrebten Rolle innerhalb der Seminardiskussionen. Diese hat ihren Hintergrund in einer ungewöhnlich zusammengesetzten interdisziplinären Seminargruppe, in der neu ausgehandelt werden muß, welches Fach für welchen Bereich zuständig ist. Die Aufgaben der Disziplinen im Themenkomplex des Seminars macht Julian im Interview mittels zuteilender und selbstpositionierender Aussagen deutlich. Er gibt folgenden Überblick: "Ja, das is' schon, ja halt wirklich, so ganz nach Klischee, der technische Standpunkt auf der einen Seite und, eh, der andere Standpunkt, sich mit dem Menschen zu beschäftigen, sich in andre Menschen hineinzuversetzen. Das eine is' das Denken über den Menschen, der vor der Maschine sitzt, und der andere ist der Mensch, der vor der Maschine sitzt und über den Computer denkt" (13). Julian benennt die Technik und den Menschen als zwei polar aufeinander bezogene Einheiten. Er arrangiert diese in einer räumlichen Konfiguration: Der Mensch sitzt vor dem Computer. Die Konfiguration impliziert zwei einander 25 entgegengesetzte Objekte, bei der die pädagogische Perspektive einen Außenstandpunkt innehat. Die Perspektive der Informatik indessen ist in der Szene selbst lokalisiert. Der über den Computer nachdenkende Mensch ist Subjekt und Objekt zugleich. Er befindet sich in der Szene, die die Pädagogik betrachtet. Interessant ist auch, daß in dieser Konfiguration beide Objekte als eigenständige Entitäten dargestellt werden. Die aktive Kraft geht dabei nicht von beiden, sondern allein vom Menschen aus, dem beobachtenden bzw. dem programmierenden Menschen. Verwischungen dieser sauberen Trennung entstehen nach Aussage des befragten Informatikstudenten durch den Beitrag der Informatik im Seminar. "Sicherlich Anregungen. Anregungen finde ich relativ wichtig, weil bei den Pädagogen scheinbar der Computer noch keine zu große Rolle spielt. Die Anregung, einfach mal sich mit dem Thema zu beschäftigen, sich das Internet mal anzusehen" (11). Der Computer bzw. das Internet können durch das interdisziplinäre Seminar in das Blickfeld der Pädagogik rücken, die damit aus der distanzierten beobachtenden Perspektive in das Geschehen selbst hineingezogen wird. Er spitzt diesen Gedanken zu in der Bemerkung: "Das [Internet] hat für alle was zu bieten" (11). Aber auch der Informatik schreibt er die Rolle zu, anderen die Computertechnologie näherzubringen, wodurch sich einmal mehr die zunächst aufgemachte Polarität verwischt. Bezogen auf das Seminargeschehen nimmt Julian darüber hinaus die PädagogikstudentInnen als diejenigen wahr, die Diskussionen initiieren und Auseinandersetzung anstoßen. "Grade in den Kleingruppen haben sich die Pädagogen sehr oft unterhalten und, ehm, untereinander und haben das Gespräch begonnen" (10). Julian schreitet ein, wenn sein Fachgebiet berührt wird. Er informiert und erklärt. Dies hat einen Hintergrund in seiner eigenen Seminarerfahrung: "Meistens isses ja auch dann sehr sachlich begründet. Da gibt es dann nichts zu kommentieren zu bei uns im Seminar" (10). Allerdings füllt er diese Rolle in der interdisziplinären Gruppe nicht ganz freiwillig aus. Sie ist mit der Ambivalenz verbunden, denn die Dominanz der pädagogischen Meinungsbildung war für ihn Grund, weniger offensiv aufzutreten. "Wenn, wenn 26 mehr Informatiker dagewesen wären, wär’ ich vielleicht auch mutiger gewesen und hätte öfters, öfters irgendwas gesagt. Aber grade wenn sich die Pädagogen miteinander unterhalten, isses schwer dann, ehm, 'ne andre Meinung zu vertreten" (12). Darüber hinaus achtet er darauf, daß technische Fakten in korrekter Form in die Auseinandersetzung einfließen. In diesem Sinne sieht er sich sowohl als Lieferant der erforderlichen technischen Grundinformationen als auch als derjenige, der im Bedarfsfall korrigierend wirkt: "Also ich hab' dann eingegriffen, wenn ich der Ansicht war, daß das technisch jetzt unsinnig wird" (10). Daß er sich mit dieser Rolle allein nicht zufrieden geben kann, resultiert aus seinem anfänglichen Anliegen hinsichtlich des Seminarinhalts. Auf der Basis seines technischen Knowhows beunruhigt ihn besonders die "Welt der Zukunft" und das Veränderungspotential, welches die Technologie hierfür bereithält: "Es is' halt, eh, schon verbunden mit 'ner gesellschaftlichen Umwandlung der Zukunft durch den Computer, das Internet wird halt schon maßgeblich in das Leben einschneiden und zwar für jedermann" (2). Deshalb hält er eine Auseinandersetzung mit diesem Bereich wichtig. "Da ich ja selber das alleine nich' überblicke, 'en Ausmaß und Wirkung des Internets auf mich und meine Umgebung, ehm, hab' ich höchstens die Chance in der Diskussion mit anderen der Sache 'en bißchen näherzukommen." (19) Er möchte "detaillierter spekulieren", um die Frage zu klären, "wie sieht denn so ‘ne Zukunftsgesellschaft aus? Und, ehm, diese Risiken, Gefahren. [...] Weil die Technik ist keine Spekulation mehr, aber die Folgen, das is' noch Spekulation" (3 f.). Aus seiner Erfahrung und Kenntnis der technologischen Möglichkeiten heraus erwächst das Bedürfnis nach Prognosen über ihre Gestaltungskraft und ihr Potential, den Alltag von Menschen zu prägen. Aus der Präsentation von elektronischer Kommunikation durch eine Arbeitsgruppe bezieht er wichtige Anregungen darüber, welche Wirkungen computervermittelte Interaktion zeigen kann. Das im Seminarraum inszenierte Rollenspiel führt die Prinzipien der Kommunikation im Internet in einer Art und Weise vor, die zum Nachdenken auffordert. Durch die spielerische Verfremdung werden Julian Probleme deutlich, die er auf seine eigenen Online-Erfahrungen 27 zurückbeziehen kann. Er kann durch die distanzierte Betrachtung der Vorführung im Seminar, eigene Erfahrungen mit elektronischen Medien überdenken, neu einordnen und verstehen. Eine Sensibilisierung für die Probleme und Erfordernisse elektronischer Kommunikation findet dadurch statt, daß die unhinterfragte Erfahrung durch die Verfremdung im Seminar gebrochen und dadurch reflektiert werden kann. Die Inszenierung macht die Besonderheiten des Inszenierten deutlich: "Man konnte dort ungeheuer gut dieses Phänomen Newsgroup sehen. [...] Und auch die Probleme, auf die man da trifft. Darüber war ich mir vorher gar nich' so im klaren. Und hab' so dann, ja, wenn ich jetzt 'ne Newsgroup durchsehe, muß daran immer denken. Und verstehe dann eigentlich auch die ganzen Mißverständnisse und Probleme, die da auftreten" (6). Die informationstechnische Vorbildung und die Erfahrungen im Seminar scheinen seinen Blick für die Notwendigkeit zur kritischen Reflexion geschärft zu haben. Diese will er nicht den Gesellschaftswissenschaften überlassen. Gerade die Interdisziplinarität der Lehrveranstaltung hat ihn angesprochen. Allerdings wünscht auch er sich, schon um seiner reduzierten Rolle als Lieferant und Repräsentant technischer Grundlagen zu entschlüpfen, daß "’ne ungefähre Vorstellung, was nun möglich is’ und was nich’" (23) bei den PädagogInnen vorhanden ist. Die Erläuterung informationstechnischer Details betrachtet er für den Seminarzusammenhang als nicht fruchtbar und verzögernd. 3.3 Erleben und Einschätzen von Technikkompetenz Wie erleben PädagogInnen ihre eigene Techniksozialisation? Welche Einschätzung von Technikkompetenz nehmen sie vor und in welcher Weise soll diese in das Seminargeschehen einfließen? Die Studentin Anja kann als Fallbeispiel herangezogen werden. Anhand ihrer Äußerungen läßt sich sowohl die Entwicklung einer technik-distanzierten Perspektive als auch ihr Rollenverständnis im Seminar veranschaulichen. Anja unterstreicht an auffallend vielen verschiedenen Stellen des Interviews die Begrenztheit ihres eigenen technischen Könnens mit Formulierungen wie: "weil ich auf dem Gebiet überhaupt nicht soviel Ahnung habe, also ich kenn’ mich jetzt 28 gerade mit Word aus und kann meine Hausarbeiten selbständig schreiben. Aber das war’s dann auch grade" (1). Für die Zeit, in der sie noch keinen Computer hatte, erklärt sie flapsig, daß sie "damals eben noch ganz blöd" (2) gewesen sei. Daß sie bereits in der Schule mit dem Computer konfrontiert wurde, erwähnt sie beiläufig, fast zufällig, als sei diesem Faktum kaum Bedeutung beizumessen. Sie lehnt das Angebot des Vaters ab, der ihr einen Computer kaufen will. Anja schafft sich erst einige Jahre später ihren ersten eigenen Rechner an und zwar zu einem Zeitpunkt, als sie die damit verbundenen praktischen Vorteile nicht mehr von der Hand weisen kann. Doch auch ihre Erinnerungen an die erste Gewöhnungsphase an den Computer sind geprägt von abgrenzenden Äußerungen. Sie mischen sich unter Erklärungen, die ganz unspektakulär auch ihre Souveränität im Umgang mit der Technik verdeutlichen: sie habe sich "eigentlich dann ganz gut mit zurechtgefunden. Aber ich hab’ nich’ weiter experimentiert. Also ich kenn’ mein Windows, mein Word, und das war's dann" (2). In die Erläuterungen zu dieser Situation fließen Gründe ein, die ihre Distanz produziert haben. Sie sei "dafür überhaupt nie so offen" (2) gewesen und: "Das war mir irgendwo zu abstrakt" (2). Einige Zeit übernimmt ihr Freund für sie die im Rahmen ihres Studiums anfallenden Schreibarbeiten am Computer. Er ist auch derjenige, der ihren ersten eigenen PC einrichtet und sich kontinuierlich darum kümmert, daß alles funktioniert. Dennoch scheint in Anjas Erzählung auch einmal eine Situation auf, in der der Freund nicht in der Nähe ist, um die technischen Probleme zu beheben. Das Problem mit dem Drucker hat sie schließlich, weit davon entfernt, untätig auf einen Helfer zu warten, auch allein schon "ganz gut hingekriegt" (2). Trotzdem stellt sie folgende Überlegung in den Raum: "Vielleicht hab ich das Interesse einfach nich’ dafür, da richtig hinterzusteigen" (2). Diese Selbstbegrenzung läßt sich über eine lange Sozialisationsgeschichte verfolgen, in der die Auseinandersetzungssitutationen mit und die Angebote an Technologie allerdings unerwartet zahlreich sind. Deutlich wird, daß Anja sich und ihre Interessensgebiete entschieden außerhalb technischer Wissensgebiete lokalisiert und sich allenfalls aufgrund pragmatischer Notwendigkeiten im Zusammenhang mit dem eigenen Berufsweg emotionslos dem Computer als Werkzeug annähert. 29 Sie benutzt ihn ohne Begeisterung, aber auch ohne Angst. Sie behält sich vor, wo sie die eigenen Grenzen ziehen will. Sie wird nicht im geringsten dazu verleitet, eigene Ambitionen in bezug auf Technik zu entwickeln. Die Aufgabenteilung zwischen den TechnikerInnen und reinen AnwenderInnen klang bereits in Anjas Geschichte ihrer Computersozialisation an. Doch obwohl sie sich bereits über zwei Semester in ihrem Pädagogikstudium im Rahmen der Lehrveranstaltungen des Modellprojekts mit Technik befaßt, sieht sie ihre Aufgabe eindeutig nicht darin, auf dem Gebiet der technischen Kompetenz zu konkurrieren. Vielmehr sieht sie ihren Beitrag zur Thematik in der Entwicklung technikkritischer Positionen . "Und da bin ich eben auf die Idee gekommen, daß es problematisch sein kann" (4). Hierdurch gelingt zugleich die Überbrückung von divergierenden Interessenslagen im privaten Bereich, da die Informationstechnologie die berufliche Domäne des Freundes darstellt: Es "war total die Diskrepanz zwischen seinen und meinen Interessen und da kam das Seminar, und das hat beides so'n bißchen verknüpft" (1). Durch dieses gelingt es ihr, ein Stück privater Realität mit den eigenen beruflichen Vorstellungen zu verbinden. Neue Technologien/Medien erfahren als Herausforderung für die Soziale Arbeit eine konsequente Einbindung in ihr Studienprogramm: "Es ist ja auch ein pädagogisches Thema geworden, diese Medien und so, die Gefahren, die da drin stecken können" (3). Wie spiegelt sich Anjas Anliegen in ihren Äußerungen über das Seminargeschehen wider? Zu dem Zeitpunkt, an dem Technik als pädagogisches Thema in ihr Leben Einzug hält, nimmt Anja eine ambivalente Rolle zwischen kritischer Distanz und Begeisterung ein. Dies veranschaulicht eine Seminarsituation, die sie belustigt wie folgt beschreibt: "Der [ein Informatikstudent, d.V.] hat sich so eine Mühe gegeben, uns Dummerchen dann (lacht) aufzuklären, und, ähm, ich weiß nich’, irgendwie hat es mich auch begeistert, diese Technik, was da möglich ist. Ich hab mich dann zwar auch gefragt, ja, wozu brauche ich das?“ (4). Ein Student aus der Informatik vermittelt im Seminar den Mitgliedern einer Kleingruppe eine Vorstellung davon, was mit dem Begriff "Cybercity" (der virtualisierten Darstellung und Begehung von Städten) gemeint ist. Die PädagogInnen sehen ihre 30 Rolle darin, das Dargestellte kritisch zu hinterfragen. "Wie er dann erklärt hat, ja, zum Beispiel in der Architektur kann man das gebrauchen, daß man mit dem Computer eben, ähm, en Gebäude aufstellen kann, entwickeln kann, und kann da Statik mit berechnen, so, das ist ja wirklich einfacher als diese großen Zeichnungen und ähm die ganzen Miniaturbauten. Es ist ja wirklich ‘ne feine Sache. Ja, dann ja, braucht man’s wirklich?" (4 f.). Während sich die Rolle als "Dummerchen" durch die Begeisterung, die sie ergreift, nicht mehr bruchlos durchhalten läßt, endet jede ihrer Denkbewegungen dennoch wieder mit der kritischen Frage nach der Notwendigkeit technischer Produkte. Interessant ist an dieser Stelle darüber hinaus, daß beide, InformatikerInnen und PädagogInnen dem Paradigma der Zweckmäßigkeit und des Gebrauchswerts von Technologie verhaftet bleiben. Die Sinnhaftigkeit einer technischen Entwicklung wird über ihren Nutzen für eine Gesellschaft legitimiert. Der Informatikstudent scheint in dieser Konstellation - jenseits aller eigenen Ambitionen - tendenziell in die Rolle des Repräsentanten der Neuen Technologien und damit argumentativ in eine Pro-Position zur kritischen pädagogischen Perspektive zu geraten. Es mag naheliegend sein, daß er dabei zunächst die nutzbringenden Aspekte einer Sache, für die er sich im gegebenen Kontext als Fachmann begreift, deutlich machen möchte. Anja stellt die Unverzichtbarkeit der Technik für architektonische Planung in Frage. Der Einsatz von Computern kommt für sie bisher nur dann in Betracht, wenn daraus ein wirklich unersetzlicher praktischer Vorteil entsteht. Die lustvolle Dimension der Begeisterung am Machbaren und vielleicht auch Ästhetischen flackert allenfalls vorübergehend auf und ist für eine gesamtgesellschaftliche Betrachtung des Gegenstandes nicht zu berücksichtigen. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß durch das Lehrangebot des Modellprojekts ein Themenkomplex auf neue Art und Weise für PädagogInnen zugänglich gemacht wird. Die Verknüpfung von Technik und Sozialem zeigt eine aktuelle gesellschaftliche Brisanz auf, die zur sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung motiviert. Obwohl Anja Computertechnik lange Zeit als einen ihr fernen Gegenstand erlebt, zu dem sie weder einen Bezug entwickelt noch Kompetenzen entfaltet, kann sie sich dem Thema im Seminar in neuer Form 31 annähern. Trotzdem stellt sich damit bei ihr keine Begeisterung für technische Sachverhalte an sich oder ein Anspruch auf Fachwissen ein. Sie handelt vorwiegend aus dem Selbstverständnis der Kritikerin heraus. Entsprechend ihrer Haltung gegenüber dem Computer, die sie in der Vergangenheit erworben hat, weist sie auf die Grenzen technischer Produkte hin. Der Nutzen technischer Produkte muß sich an deren Gebrauchswert messen lassen. Nach der Höhe des Gebrauchswerts richtet sich der Umfang zu erlernender technischer Kompetenzen. In dieser Haltung erscheint eine gewisse Weigerung, sich mit einer Sache schon deswegen zu beschäftigen, weil sie existiert. Die Frage "wozu" kann als Kurzformel für diese Praxis verstanden werden. 4. Interessenstendenzen: Hochschuldidaktische Dimension Im folgenden möchten wir erste Tendenzaussagen darüber, auf welches Interesse die Lehrveranstaltungen des Modellprojekts bei den Studierenden stößt, bezogen auf den hier dokumentierten Projektabschnitt darstellen. Es wird darum gehen, beispielhaft zu zeigen, was die Zielgruppe der Seminare inhaltlich beschäftigt, welche Fragen sich stellen und wie die eingesetzten didaktischen Methoden aufgenommen werden. 4.1 Themen Für die Skizzierung der thematischen Interessensschwerpunkte von Studierenden, die an den Seminaren des Modellprojekts teilnehmen, ist an erster Stelle eine bemerkenswerte Beziehung zwischen dem Seminarthema und der Zusammensetzung der TeilnehmerInnen festzustellen. Dies tritt besonders stark im Seminar "Virtuelle Welten" hervor, das im WS 1997/98 in Kooperation mit einem Hochschullehrer aus der Informatik durchgeführt wurde. Beide TeilnehmerInnen des Seminars, Anja und Julian, bringen das in den Interviews in aller Deutlichkeit zur Sprache. Wie zwei rote Fäden ziehen sich die beiden o.g. Aspekte durch die Gespräche. Letztlich hat beides, die Interdisziplinarität der Veranstaltung sowie der im Seminar behandelte Themenkomplex, zur Teilnahme motiviert. Der interdisziplinäre Charakter entwickelt sich dabei ausdrücklich zum 32 eigenständigen Aspekt der Lernerfahrung, mit dem sich beide in hohem Maße im Verlauf des WS auseinandersetzen (vgl. Kapitel 5.3). Die beiden Aspekte befinden sich bei Julian überdies in einem Spannungsverhältnis: "Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um das Thema. Sondern das war schon mehr, daß es zusammen mit den Pädagogen gemacht wurde, grade die Zusammenarbeit, das fand ich, fand ich spannend" (1). Die Fremddisziplin erscheint in dieser sicherlich recht seltenen - interdisziplinären Konstellation als Studiengegenstand. Eine solche Veranstaltung gibt Gelegenheit, die Grenzen der eigenen Disziplin zu übertreten, "daß man nicht nur, ehm, in seinem eigenen Fach bleibt" (1). Der Gewinn dieser Grenzüberschreitung liegt für Julian vor allem in der neuen Art der Betrachtung der Neuen Technologien, die in der Informatik üblicherweise keinen Platz hat: "Weil, weil man sich, viele Informatiker sich im Vorfeld nie Gedanken gemacht haben. Das is' en völlig neues Thema. [...] Vermutlich geht aber der durchschnittliche Informatiker anschließend [nach dem Seminar, d.V.] in PC-Saal, weil er noch was programmieren muß, und vergißt darüber vollkommen, darüber jetzt nochmal nachzudenken. Es is' keine Sache, also, die, die wir halt lernen" (18). Allein dieses strukturelle Moment faßt Julian als spannendes "Experiment" auf (1). Dabei wird es für ihn wesentlich, diesen theoretischen Anspruch mit persönlicher Erfahrung aufzufüllen. Auch Anja nennt in der Rückschau auf das besuchte Seminar diesen Aspekt an erster Stelle: "Das bestand einfach so, einfach so das Kennenlernen von diesem Interdisziplinären. Also, das ist doch, ähm, im letzten Semester so'n Schlüsselbegriff geworden" (20). Julian äußert sich in ähnlicher Weise: "Gebracht hat es mir letztendlich, Pädagogen kennenzulernen, pädagogische Denkweise kennenzulernen" (21). Die Formulierung "kennenlernen", die beide in ihrem Resümee verwenden, deutet auf die Konfrontation mit etwas Neuem hin. Sie enthält auch die Konnotation einer ersten kurzen Begegnung mit einer Sache, die nicht selbstverständlicher Bestandteil des universitären Alltags ist. Julian konkretisiert dies folgendermaßen: "Ich glaube, daß man sich 'en bißchen beschnuppert hat" (13). Mit welchen konkreten thematischen Interessenslagen Studierende ein Seminar des Modellprojekts besucht haben, soll aus folgenden Beispielen deutlich werden. 33 Sie zeigen, welche Modelle sich die einzelnen heranziehen bzw. konstruieren, um konkrete aktuelle Veränderungen in der sozialen Welt reflektierbar zu machen. 4.1.1 Die Welt im Zerrspiegel von Science Fiction Literatur Julian wurde von dem Thema "Virtuelle Welten" besonders deshalb angesprochen, weil er Verbindungen zu seinen privaten Interessen sah: "Ich bin halt auch Science Fiction Fan, und da spielt es halt auch 'ne große Rolle, virtuelle Welten." (1) In dieser Literatur, vor allem bei William Gibson, der mit seinem Roman "Newromancer" den heute populären Begriff "Cyberspace" prägte, findet er Anregungen und "ein sehr klares Zukunftsbild" (19) gezeichnet. Die neue Welt erscheint plastisch vor seinem geistigen Auge: "Es gibt da erschreckende Teile und es gibt interessante Teile. Und vieles deutet sich an, daß des, daß er [William Gibson, d.V.] da 'en sehr guten Riecher für hatte. Daß es also, vieles so kommen wird, wie er sich das vorgestellt hat. Also es gibt 'en, meiner Ansicht nach viele, viele Ansätze, wo das schon ganz klar darauf hingeht" (20). Dieser Text stellt auch deshalb für ihn einen Gewinn dar, da aus seiner Sicht mit dem Thema "Virtuelle Welten" Neuland betreten wird. Die Visionen von Gibson lassen sich in der gegenwärtigen Welt wiederfinden. Auf der Grundlage dieser konkreten Bilder und sozialen Arrangements sieht er sich in der Lage, problemorientiert zu diskutieren. Was ist der Gewinn, den ein fiktionaler Text bietet? Bei seiner Lektüre tritt man gleichsam aus dem eigenen Alltag mit all seinen Selbstverständlichkeiten heraus. Im Science Fiction Roman schlüpft man explizit in eine künstliche Welt der Übertreibungen und Übersteigerungen hinein. Die Erzählung spielt in einer fremden Umgebung mit fremden Konventionen, die durch eine radikale technische Weiterentwicklung geprägt ist. Als Zukunftsszenarien bleiben sie jedoch immer mit der Gegenwart des Autors oder der Autorin verbunden und entfalten vor allem im Hinblick auf diese Gegenwart ihre Bedeutung. Sie halten dem Jetzt einen Spiegel vor, in dem eine Welt zu sehen ist, die eine logische Konsequenz des kulturell-technischen Schaffens der Gegenwart darstellt. Daher kann die fiktionale Inszenierung das Normale, Alltägliche und damit die sich in der heutigen Realität bereits andeutende zukünftige Welt, deren schleichende Veränderung uns nicht mehr auffällt, 34 veranschaulichen bzw. bewußt machen. Die technizistische Zukunftsvision wird damit zur Provokation, über die eigene Gegenwart und den Einfluß der Neuen Technologien auf diese Gegenwart kritisch nachzudenken und Entwicklungsmöglichkeiten zu diskutieren. Ein neues Bild der eigenen Alltagswirklichkeit könnte entstehen, für das die Science Fiction als Katalysator wirkt. 4.1.2 Die Welt unter der Lupe dreidimensionaler Kartierung Im Anschluß an das Seminar "Modernisierung, Neue Medien, soziale Ungleichheit" im SS 1998 ergab sich im Rahmen einer Gruppendiskussion, die von uns mit vier TeilnehmerInnen geführt wurde, ein Gespräch über elektronische Netze und die Machtverteilung in der modernisierten Welt. Die Pädagogikstudentin Mascha bringt das Modell einer Weltkarte ins Gespräch, anhand derer die gesellschaftlichen Veränderungen sichtbar gemacht werden können: "Was ich ganz, ganz spannend fand, war diese Idee von 'Global Cities', also daß das wirklich neben dem, was ich so sehe, also was ich so an Weltkarte kenne, gibt es schon 'ne andere Weltkarte und die is' zwar nich' aufgezeichnet, aber die is' real. [...] Und erst mal hat mich einfach erschreckt, also erschreckt, weil's mir fremd is' und weil ich's nich' kenne" (26). Die Landkarte ist eine Visualisierung der Welt, die sich auf die Darstellung nationalstaatlicher Grenzen konzentriert. Dieser kartierte Anblick der Welt, den sich alle mit dem Geographieunterricht in der Schule aneignen, scheint nun nicht mehr die Realität wiederzugeben. Die Weltordnung hat sich im Zuge globaler Informations- und Kommunikationsstrukturen verändert. Es existiert eine unsichtbare neue Weltkarte, die fremd ist und die einverleibte Ordnung des klassischen Globus bedroht. Die neue Welt muß anders visualisiert werden als die bisherige. Mascha führt dies weiter aus: "Ja, daß auch einfach wieder die Weltkarte sich anders strukturiert in dem Sinne, was, was ragt heraus und was, ehm, was ragt nich' heraus. [...] Und ich denke, da macht sich durch das Internet, ehm, gibt's nochmal ne' andere Struktur" (27). Die Neuen Technologien stellen letztlich kleine Erhebungen auf der Karte dar, die das Aussehen der Welt verändern. Sie wird mit einem Netz aus Knotenpunkten überzogen. Mascha stellt 35 sich das folgendermaßen vor: "Ja, ich denk', es wär' eher so wie, wie so'n Pickelgesicht, daß Du überall so einzelne Punkte hast" (27). Die zweidimensionale Karte wird um eine dritte Dimension erweitert. Die Fläche eines Nationalstaats verliert damit an Relevanz. Sie tritt in den Hintergrund der Wahrnehmung. Ihre Gedanken werden von dem Studenten der Medienwissenschaften Urs weitergeführt: "Aber wenn man nur diese Punkte aufzeichnen würde, würden die Grenzen, die politischen Grenzen arg verschwinden" (27). Eine solche Karte würde die Stärkung von den an verschiedenen Orten der Welt agierenden Unternehmen aufzeigen. Für Mascha wäre die neue Karte "ehrlicher", da sie die maßgeblichen Machtzentren aufzeigt. Der Unterschied zur "alten" Welt wird durch die Existenz eines weltweiten Computernetzes sichtbarer. Mascha betont diesen qualitativen Sprung: "Also, wenn ich mir große Unternehmen anschaue, die sind ins Ausland gegangen [...] oder ja, also, ham sich einfach an mehrere Punkte auf die Welt verteilt, also, für die gab's diese Grenzen schon zum bestimmten Punkt nich' mehr, ja, und das wird, denke ich, durch das Netz nur deutlicher" (29). Folglich "geht's nich' mehr um 'en Land, das als Nation stark is', sondern da geht's um 'ne Stadt, die als Stadt stark is'" (28). Das Resultat erklärt sich aus der Bedeutung der Neuen Technologien für die globalisierte Weltordnung. Nimmt man die Verteilung der Netzknotenpunkte über die Welt - ähnlich wie z.B. ehemals Bodenschatzkarten - in eine neue Weltkarte auf, so kann man damit eine neue und reale Dimension der Machtverteilung in der Welt der Diskussion zugänglich machen. Mascha baut diesen Gedanken bildhaft aus, indem sie einen Vergleich aus der Medizin heranzieht. "Also das, ich denke, ehm, das eben das Netz hat für mich auch was damit zu tun, also mit Kapital zu tun, und daß dadurch unglaublich sichtbar wird, also wie wenn man in 'en Körper irgend'ne Flüssigkeit reinspritzt, dann sieht man, wo irgendwelche Thrombosen sind" (32). Technologie funktioniert auf einer solchen Karte wie ein Kontrastmittel in der Medizin. Sie zeigt auf, wo sich die Macht auf dem Globus akkumuliert. Die neue Ordnung bringt es mit sich, daß die Aufteilung der Welt in eine erste, zweite und dritte nicht mehr so einfach zu bewerkstelligen ist. Der Politikstudent Dirk weist auf diese Verkomplizierung hin, "daß es jetzt Dritte Welt in der Ersten Welt gibt, 36 und Erste Welt in der Dritten, daß also durch Neue Medien etc., ähm, ja, sich das Ganze vermischt stärker. [...] Es is' dadurch jetzt nicht mehr so leicht zu sagen: 'Das is' Erste Welt, das is' Dritte Welt'" (30). Diese strukturellen Veränderungen veranlassen Urs dazu, das Verständnis der Punkte auf der Karte zu problematisieren: "Diese Karte würde z.B. auch dadurch verfälscht, jetzt z.B. so 'en armes, wirklich armes Land wie Französisch Guayana hätte auf der Karte 'en knallroten Punkt, weil 'en, 'en riesiger Backbone da liegt, wegen dem, äh, Raumfahrtzentrum in Courou und für die ganzen Forschungsmitarbeiter, die da wohnen, die hab'n ja auch noch wahrscheinlich, äh, jeder 'en Internetanschluß, verlangt einfach die, die, äh, Forschung da [...] aber die Einwohner, Ureinwohner, Einheimischen, äh, werden da kaum Zugriff drauf haben, aber auf der Karte würde es dann so aussehen, als wäre das, äh, gut abgedeckt" (30). Erfolgt die Interpretation der Punkte nach dem alten Schema, so wäre eine Bedeutung dieser Technologiekonzentration für den gesamten Staat gegeben. In der globalisierten Ordnung sind sie vielmehr Orte der Ersten Welt in Flächen der Dritten. Urs bemängelt deshalb: "Aber man sieht net, wer den Zugriff hat auf das Neue Medium" (30). Die dreidimensionale Kartierung gibt für ihn nicht den Effekt wieder, daß ganze Regionen an Bedeutung verlieren, die vormals im Rahmen des Nationalstaats in ein flächenhaft größer gefaßtes Machtgebiet eingebettet waren. Seine KommilitonInnen halten ihm entgegen, daß eine solche Karte die Verteilung von Ressourcen auf der Welt nur dann realistisch wiedergibt, wenn sie nicht im Denkmuster des Nationalstaats interpretiert wird. Dirk macht auf die Berücksichtigung geschlechtsspezifischer und anderer sozialer Ungleichheiten aufmerksam: "Deswegen is' die Frauendiskussion wichtig, da müßt' mer da nämlich z.B. gucken, wieviel Frauen, wieviel Männer hab'n Zugang, oder wieviel, ähm, Einwohner dort oder wieviel, wieviel Leute, Gastarbeiter in Mexiko, ja" (31). Die Provokation, die von der neuen Visualisierung der Welt ausgeht, erzeugt in der Diskussion schließlich ein detaillierteres Interesse für die Frage, welche sozialen Gruppen an der Neuverteilung der Macht partizipieren können. Der Blick durch die Lupe auf die "Pickel" des Globus kann ein feines Gewebe entdecken, dessen komplizierte und sicher teilweise widersprüchlichen Verflechtungen von Macht, Einfluß, Ohnmacht und Chance entlang gesellschaftlicher Differenzlinien diskutierbar werden. Die Neuen Technologien 37 haben in dieser Diskussion die Funktion, über Konzentration von technisch gestützten Vernetzungen auf dem Globus, die sozialen und ökonomischen Verhältnisse zu visualisieren. 4.2 Didaktische Methoden In allen Seminaren des Modellprojekts wurde mit heterogenen didaktischen Methoden gearbeitet. Daß diese praktisch angewandt und für den Unterricht auch an der Universität fruchtbar gemacht werden, findet bei der Pädagogikstudentin Anja sehr positive Resonanz und motiviert sie, weitere Seminare zu besuchen: "Also, war mal wieder was ganz anderes hier an der Uni, so wie sie [die Seminarleiterin, d.V.] mit Gruppenarbeit gearbeitet hat, mit Flipchart. [...] so eingebettet in so'n pädagogisches Thema. Also, das hab' ich so noch nich' erlebt, hier" (1). Die methodisch-didaktische Aufbereitung der Thematik verbessert ihrer Meinung nach aber nicht nur den Lernerfolg, sondern hat auch eine emotionale Komponente: "Dann hat mir das Seminar einfach soviel Spaß gemacht" (1). Um der Frage nachzugehen, welche Methoden in den Seminaren nun wie bewertet werden, wurden beide genannten Effekte, Spaß und Lernerfolg, quantitativ abgefragt. Das Ergebnis aus dem SS 1997 soll hier exemplarisch betrachtet werden. 38 Im Fragebogen wurden die TeilnehmerInnen aufgefordert, die einzelnen Methoden mit Rängen zu beurteilen. Rang 1 ist die positivste Beurteilung, Rang 8 die negativste. Bei der vergleichenden Betrachtung der Rangverteilung nach der Auswertung auf Ordinalskalenniveau je Methode ergibt sich folgendes Bild: Spaß 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 Q1 3,5 Median 2,5 Q3 1,5 39 Vortrag AG-Teilnahme Rollenspiel Fishbowl AG-Referat Kleingruppe Zweiergruppe -0,5 Plenum 0,5 Lernerfolg 8,5 7,5 6,5 5,5 Q1 4,5 Median 3,5 Q3 2,5 1,5 Vortrag AG-Teilnahme Rollenspiel Fishbowl AG-Referat Kleingruppe Zweiergruppe n -0,5 Plenum 0,5 Die besten Beurteilungen fanden die Arbeit im Plenum und die Kleingruppenarbeit. Sie weisen im Schnitt den höchsten Rang auf bei geringer Streuung der Bewertungen in den positiven oder negativen Bereich. Eindeutiger fallen die Antworten für die Kleingruppenarbeit mit der Note 2,3 (Median) in beiden Beurteilungsgängen aus. Es folgen die Methoden Arbeit in Zweiergruppen, Teilnahme an einer Arbeitsgruppe und Gastvortrag6, die alle im Schnitt mit Rang 3,5 bedacht wurden. Weniger gut bewertet wurden die Referate der Arbeitsgruppen mit einem Schnitt von ca. 4,1. Die ambivalenteste Beurteilung erfuhren das Rollenspiel und der Fishbowl7. Mit Rängen zwischen 5 und 6 im Schnitt gefielen die Methoden weniger gut, während 6 7 In das Seminarprogramm wurde ein Gastvortrag integriert, der von den TeilnehmerInnen gehört wurde, jedoch auch für die Öffentlichkeit zugänglich war. Ein Fishbowl ist eine Podiumsdiskussion mit dynamisch im Verlauf der Debatte wechselnder Besetzung. Je nach inhaltlicher Entwicklung in der Gesprächsrunde können einzelne aus dem Publikum auf das Podium steigen und mitdiskutieren bzw. sich wieder ins Publikum zurückziehen. 40 sich die Bewertung des Lernerfolgs für Fishbowl mit Rang 4,5 zum Positiven verschiebt. Die große Streuung zeigt, daß die Antworten sehr stark differieren: Die sehr positiven und die sehr negativen Beurteilungen durch die Befragten sind interpretationsbedürftig. Sie könnten darauf hinweisen, daß solche, im universitären Alltag eher ungewöhnlichen didaktischen Methoden sowohl Befremden und Abwehr auslösen als auch als besonders attraktiv erlebt werden können. Zusammenfassend betrachtet kann die These aufgestellt werden, daß der Einsatz klassischer hochschuldidaktischer Methoden, wie z.B. die Diskussion im Plenum, positiver erlebt werden als innovative, wie z.B. das Rollenspiel. Dies wirft die Frage auf, ob der Einsatz neuer, stark gruppendynamisch orientierter Methoden an der Universität sinnvoll ist. Gegen die Option, diese wieder aus dem Konzept zu streichen, läßt sich einwenden, daß neben sehr negativen auch extrem positive Beurteilungen zu finden sind. Die Uneindeutigkeit der Bewertung und damit die "Uneinigkeit" in der Seminargruppe könnte aus unserer Sicht eher auf einen anderen Grund hinweisen: Die Herstellung ungewohnter und uneingeübter Kommunikationssituationen durch innovative didaktische Methoden im Seminar kann unter den TeilnehmerInnen eher Verunsicherung und damit Ablehnung produzieren. Zugleich scheinen andere Studierende diese spielerische und experimentelle Art der Wissensbildung begeistert aufzunehmen und zu genießen. Eine breite Akzeptanz, die sich in einer gemäßigten und eindeutigeren Beurteilung niederschlagen würde, kann für den Fishbowl und das Rollenspiel nicht erwartet werden. Was sind mögliche Konsequenzen dieser Interpretation? Sollen neue Formen des Lernens eingeübt werden, so muß möglicherweise deren Einsatz noch behutsamer eingeführt werden. Dazu gehört, Sinn und Zweck neuer didaktischer Methoden ausführlich zu thematisieren, um eine Akzeptanz auf der kognitiven Ebene zu erreichen. Eine weitere Möglichkeit stellt die abschließende Auswertung dar, die intensiviert werden könnte. Reflexionen über den Lerneffekt könnten die Einschätzung einer didaktischen Methode nachträglich positiv beeinflussen. Diese 41 konzeptionellen Konsequenzen sollen bei der weiteren Gestaltung des Modellprojekts eingearbeitet werden. Unabhängig von dem Versuch, den Einsatz innovativer Methoden im Rahmen des Projekts zu optimieren, kann jedoch auch die zeitliche Dimension für die Beurteilung neuer didaktischer Instrumente eine Rolle spielen. Je öfter Studierende ein Rollenspiel ausprobieren, um so geläufiger und damit selbstverständlicher kann seine Anwendung im Seminar werden. Erst das Aushalten der Verunsicherung und die konsequente Wiederholung können die Erweiterung des Repertoires an Verhaltensweisen und damit Lernchancen aufzeigen. Da für zukünftige PädagogInnen spielerische, experimentelle und darstellende didaktische Methoden besonders relevant sind, sollte auf ihre Integration in der Hochschulausbildung nicht voreilig verzichtet werden. Gerade die Möglichkeit, Selbsterfahrung im Prozeß zu erleben, stellt einen wichtigen Bestandteil des erziehungswissenschaftlichen Studiums dar. Das Ergebnis der Beurteilung im Fragebogen, das zunächst einen recht diffusen Eindruck macht, weist auch darauf hin, daß experimentierende Lernsituationen sich sehr nachhaltig einprägten und intensiv erinnert wurden. Darin liegt eine Chance für eine zukünftige lebendige Auseinandersetzung mit neuen hochschuldidaktischen Konzepten. 5. Lernen aus der Differenz Auf die Frage, wodurch und wie Lernen in den Seminaren des Modellprojekts erfolgt, kristallisiert sich heraus, daß die Konfrontation mit der Technik als dem Fremden für die Pädagogik Relevanz gewinnt. Die Auseinandersetzung mit einem Gegenstand, der ein Novum in den Studieninhalten am Institut für Erziehungswissenschaft der Philipps-Universität Marburg darstellt, scheint irritierende und auch herausfordernde Denkbewegungen anzustoßen. Besonders wertvolle Hinweise sind deshalb aus dem Seminar "Virtuelle Welten" zu erhalten, in dem nicht nur das Thema, sondern auch die Seminargruppe und das ProfessorInnen-Team sowie das MitarbeiterInnen-Team eine äußerst seltene 42 interdisziplinäre Konstellation aufwies. Hervorstechend für dieses Seminar war, daß es im Lehrangebot der Informatik erschien und von Studenten dieses Fachbereichs besucht wurde. Damit kam der Dialog mit Studierenden einer Disziplin zustande, die den technisch-naturwissenschaftlichen Fächern zugeordnet wird. Er überschritt damit die Grenzen der geistes- und gesellschaftwissenschaftlichen Fächer. Studierende der Pädagogik sahen sich Personen gegenüber, die - gewollt oder ungewollt - als VertreterInnen der Neuen Technologien in Erscheinung traten. Umgekehrt erlebten die Studierenden der Informatik mit den PädagogInnen diskussionsfreudige KritikerInnen technischer Innovation. Selbst- und Fremdbilder wurden kontrastreicher als unter Geistes- und GesellschaftswissenschaftlerInnen konstruiert, Lernstile wurden bewußt gemacht und hochexplosiv diskutiert. In diesem Sinne folgten Lehrende und Studierende dem Gedanken "Lernen aus der Differenz". Im folgenden möchten wir im ersten Schritt die in diesem Seminar quantitativ erhobenen Einschätzungen zum Thema Interdisziplinarität skizzieren. Welche Differenzen werden dabei markiert? Im zweiten Schritt geht es darum, Lernerfahrungen in der interdisziplinären Gruppe bezogen auf den Gegenstand des Seminars herauszuarbeiten, wie sie in qualitativen Interviews formuliert werden. Im dritten Schritt schließlich zeichnen wir, ebenfalls auf Basis der Interviews, nach, was die Befragten über die fremde und letztlich vor allem über die eigene Disziplin gelernt haben. 5.1 "Zunächst befremdend, dann eher anregend" Die Wirkung der interdisziplinären Seminarkonstellation wurde zunächst mit einem Fragebogen abgefragt. Hierbei ging es neben deren Bewertung darum, herauszufinden, durch welche konkreten Phänomene die Studierenden Interdisziplinarität wahrgenommen haben. Die hier feststellbaren Trends lassen sich in den Interviews, auf die wir anschließend zu sprechen kommen, teilweise vertiefen und ausführen. Auf einer 5-wertigen Skala von sehr gut bis gar nicht (codiert mit 1 bis 5) konnten die TeilnehmerInnen bewerten, inwiefern ihnen der interdisziplinäre Charakter des 43 Seminars gefallen hat. Das Ergebnis ist in der Graphik wiedergegeben: Histogramm 12 10 8 6 4 2 Mittel = 2,7 N = 26,00 Häufigkeit 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Interdisziplinärer Charakter Das statistische Mittel liegt bei 2,7. Die Zahlen weisen dabei eine recht geringe Streuung (Quartile bei 2,0 und 3,4) auf. Die Kurve schlägt zwischen den Werten 2 und 3 steil nach oben aus und geht um den Wert 5 fast auf Null. Dies gibt eine recht positive bis indifferente Beurteilung des interdisziplinären Charakters der Veranstaltung wieder, die darüber hinaus relativ einstimmig abgegeben wird. Antworten im negativen Bereich sowie im sehr positiven Bereich sind selten. Die Motive der größten Gruppe (11 Personen), deren Antwortverhalten indifferent ausfällt, sind schwer zu interpretieren. Man könnte vermuten, daß dies aus einer Ambivalenz herrührt, die es nicht erlaubt, das im Seminar Erlebte insgesamt eindeutig der positiven oder der negativen Seite zuzuschlagen. Woher diese Ambivalenz rühren mag, bedarf einer Erklärung und ist im folgenden genauer herauszufinden. In den Antworten auf die folgenden drei offenen Fragen im Fragebogen wird das Bild differenzierter: Wie hat sich die interdisziplinäre Zusammensetzung gezeigt? Wie ist diese zu bewerten? Welche Vorschläge gibt es für die Gestaltung von weiteren Seminaren? Da die Grenzen zwischen den abgefragten Aspekten in den Antworten verschwimmen, fassen wir die Ergebnisse aus allen drei Einzelfragen weitgehend zusammen. Die Befragten benennen zahlreiche Unterschiede zwischen den beiden Fachbereichen Pädagogik und Informatik, die ihnen im Verlauf des Seminars aufgefallen sind. Die wichtigsten seien hier aufgeführt: Insgesamt besehen, werde die "gesellschaftliche Wertung der Fächer" durch das gemeinsame Seminar 44 sichtbar. Der deutlichste konkret benannte Unterschied jedoch scheint in dem Vorhandensein von technischen Vorkenntnissen zu liegen. Mehrere Antworten thematisieren entweder den Wissensvorsprung der Informatikstudierenden oder das Defizit der PädagogInnen. Die Erfahrung der Interdisziplinarität wird neben der Ungleichheit im Kenntnisstand über Neue Technologien vor allem im Bereich Kommunikation festgemacht. Die Aussagen beziehen sich vorwiegend auf den im Seminar praktizierten Diskussionsstil. Hierfür gibt es zahlreiche Spezifizierungen. Konkret ist damit zum einen gemeint, daß unterschiedliche Verständnisse und Definitionen von Sachverhalten vorliegen, zum anderen, daß Blickrichtungen und damit Herangehensweisen differieren. Es werden unterschiedliche Argumentationsweisen bemerkt. In den Diskussionen nehmen die Angehörigen der beiden Fachbereiche unterschiedliche Positionen ein und kommen zu divergierenden Einschätzungen des Gegenstandes. Hier wird auch von unterschiedlichen "Ebenen der Diskussion" gesprochen. Bei der Suche danach, was diese "Ebenen" ausmachen könnte, fällt auf, daß beide "Orte" der Differenz, technisches Vorwissen und Kommunikation, nicht ganz voneinander zu trennen sind. So fällt in den Antworten zunächst die bemängelte "Dominanz der informatikbezogenen Themen" ins Gewicht. Die Diskussion verlaufe "schlecht, wenn Erfahrung und Wissen" fehlen, wird von pädagogischer Seite angeführt. Es entsteht auf seiten der PädagogikstudentInnen das "Gefühl, im technischen Bereich unterbelichtet zu sein". An einigen Stellen wird auch bemängelt, daß "irrelevante technische Details" zuviel Raum eingenommen haben. Diese Ambivalenz, die z.T. mit emotionaler Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht wird, setzt sich in der Beschreibung dessen fort, wie die Kommunikation erlebt wurde. "Zunächst befremdend, dann eher anregend", ist eine knappe Formel dafür, daß für jedeN einzelneN TeilnehmerIn Hürden in der Diskussion zu überwinden waren. Es wird von einer "Distanziertheit im Umgang miteinander" gesprochen, bei der es erforderlich ist, aber "schwer, Vorurteile abzubauen". Einige Stimmen meinten auch, man hätte im Seminar "aneinander vorbei diskutiert" und zu wenig "Offenheit und Toleranz" füreinander aufgebracht. Auch differierende Lehrstile, 45 die als "Uneinigkeit der Seminarleitung" wahrgenommen wurden, können in diesen Zusammenhang gestellt werden. Andere Stimmen betonen den fördernden und gewinnenden Aspekt des interdisziplinären Geschehens. Ausgehend davon, daß für viele Befragte der Seminargegenstand keinen Bestandteil ihrer Alltagserfahrung darstellt, bietet das Seminar nach Ansicht befragter TeilnehmerInnen eine Möglichkeit zur Annäherung. Ein Gewinn liege darin, daß technische und gesellschaftliche Perspektiven zusammengebracht werden. Dies wird in einer Antwort als Kombination aus "pädagogischen Hintergründen" und "technischen Informationen" spezifiziert. Auf dieser Ebene könne voneinander profitiert werden. Ein Befragter gibt an, daß solche Diskussionen am Fachbereich Informatik nicht möglich gewesen wären. Diese Aussage weist auf den Gewinn hin, der unter dem Stichwort Kommunikation zu verzeichnen ist: Neben dem Wissenserwerb bringt Interdisziplinarität "neue Erfahrungen mit anderen 'Denkansätzen'" oder kann zu einer anderen Bewertung des Themas führen, zu der man nur gelangt, wenn verschiedene Blickrichtungen gehört und berücksichtigt werden. 5.2 Lernziel Virtuelle Welten Ausgehend von dem Eindruck, daß interdisziplinäre Lernprozesse in hohem Maße die kommunikative Landschaft eines Seminars verändern, kann aus den Interviews genauer herausgefiltert werden, wie die Kommunikation wahrgenommen wurde. Anhand des individuellen Erlebens der Pädagogikstudentin Anja und des Informatikstudenten Julian treten interessante Parallelen zutage, die sich in folgende Aspekte gliedern lassen: die Notwendigkeit von genügend Raum für Diskussion, die Fruchtbarkeit von Kontroversen, die Kooperation als wertvoller Katalysator zur Förderung des Dialogs und die Unentbehrlichkeit von Toleranz. Hierzu möchten wir einige prägnante Beispiele dokumentieren. 5.2.1 Diskussion: "Wie so 'ne Kettenreaktion" Diskussion wird von beiden InterviewpartnerInnen als zentrales Geschehen im Seminar betrachtet. Der hierfür bereitgestellte Zeitrahmen sollte großzügig 46 kalkuliert werden. Nicht die Referate, sondern die an einen Input anschließende diskursive Auseinandersetzung im Plenum oder in der Kleingruppe vermittelt das Wesentliche. "Aber, so allein die Diskussion find’ ich schon unheimlich wertvoll. (Pause) Und ich finde, die Diskussion ist im Laufe des Seminars zunehmend zu kurz gekommen" (9), bemängelt Anja. Was ist an Diskussionen wichtig? Für Anja geht es im ersten Schritt vorwiegend darum, einen Möglichkeitsraum zu eröffnen. In ihm setzt Diskussion eine Bewegung in Gang, die etwas entstehen läßt. "Aber naja, dann haben wir doch mit'n paar Leuten diskutiert da vor der Wand. 8 Und dann haben noch zwei, drei Leute was hingeschrieben. Und dann hat sich bei mir auch so'ne Veränderung ergeben" (17). Auf die Frage, wie eine Situation beschaffen sein muß, damit etwas in Bewegung gerät, antwortet Anja: "Offen. Also irgendwo 'ne Struktur und Eckpunkte, wo man 'ne Basis hat. Aber, ja, nicht so vorgefertigt. Und dann eben gucken, was ergibt sich jetzt aus der Basis. Also, daß dieses Mauerwerk steht" (18). Der Input von außen soll nur ein grobes Muster vorgeben, das anregt, selbständig weiterzudenken. Brillante und abgeschlossene Analysen können aus dieser Perspektive einen Lernprozeß nicht ausreichend anstoßen. Es geht nicht darum, sich ein perfektes, hermetisches Gedankengebäude anzueignen, sondern darum, es selbst zu bauen, mit allen Stolpersteinen, die sich dabei ergeben. Eigene Lösungen sind gefragt. Detailliert entwirft sie mit dem Bild des "Hauses", was bei der Entwicklung eines Gedankengebäudes in der Gruppe wichtig ist: "Aber wie das Haus dann im Endeffekt aussieht, ähm, das ist eben noch nicht von vornherein durchdacht. Daß ich zwar meine Stichpunkte habe, so soll das Wohnzimmer aussehen, so soll das aussehen, aber daß ich noch offen dafür bin, um das umzuwerfen und umzugestalten" (18). Es geht darum, gemeinsam in der Gruppe das beste Planungsergebnis zu ermitteln, zu dem alle ihre Ideen beitragen bzw. vielleicht auch einige Ideen wieder verwerfen müssen. Den Prozeß des Gestaltens und Modellierens beschreibt sie folgendermaßen: "Ich kann überlegen: Was ist gut dran? Was ist schlecht daran? Ein Für und Wieder. Welche 8 Die Aufgabe in dieser Sitzung war, über schriftliche Wortbeiträge an der Pinnwand miteinander in Diskussion zu treten. 47 Thesen gibt es? Einfach, daß ich mich damit auseinandersetzen und, und dann entwickeln sich ja weitere Punkte daraus, also, wie so, so'ne Kettenreaktion. Und wenn verschiedene Menschen noch über diesen Ecken drehen und auch eigene Gedanken, Ideen haben, und die mit einfließen. Ja, da entsteht ja ganz viel oder kann ganz viel entstehen. Und, ähm, das ist eben das Produkt von vielen" (19). Wichtig sind die Bewegungen des Bewertens, der Pro- und ContraArgumentation, die die gemeinsame Reflexion in Gang bringen. Bei jedem Bauteil soll abgewogen werden, ob es paßt oder die Stimmigkeit des Ganzen stört. Die Beiträge der einzelnen stehen dabei nicht unverbunden nebeneinander, sondern einer folgt in einer "Kettenreaktion" aus dem vorherigen und bewirkt seinerseits den nächsten. Der Einzelbeitrag ist nicht mehr herauszulösen aus diesem Gruppenprozeß und dem kollektiven Ergebnis. Julian hält die Diskussion speziell über das Seminarthema deshalb für wichtig, weil es bislang wenig erforscht ist: "Man muß ja erst mal sammeln eigentlich. Brainstorming im Prinzip machen, im globalen Stil. Alle möglichen, eh, Dinge mal andenken und dann sehen, wo lohnt sich's denn weiterzumachen. Und, ehm, auch Ideen zu bekommen" (19). Er möchte mit Hilfe dieser offenen Methoden einkreisen, welche Fragestellungen letztendlich weiter verfolgt werden. Für diese Form der Wissensbildung benutzt er auch das Wort "Spekulation" (4). Die Formulierung ist positiv gemeint: Es geht darum, ein Forschungsfeld zu eröffnen, wo keine Fakten abgesichert werden müssen. Dieselbe Wortwahl erfährt jedoch, wie wir später noch sehen werden, im Kontext der Erläuterung seines disziplinären Selbstverständnisses eine negative Konnotation. Im hier gegebenen Kontext allerdings betont er stark die Vorteile einer Atmosphäre, in der Diskussion und gemeinsame Reflexion möglich sind. Sie erlauben es, mehrere Möglichkeiten einzubeziehen, spontane Ideen auszusprechen und Ungeplantes zu integrieren. Vor allem sind diese Diskussionen ein Mittel, abgetretene Wege zugunsten der noch unbekannten zu verlassen: "Es kommen viele neue Ideen, innovativere Ideen dabei rum. Kreativer das Ganze" (9). Sowohl von Anja als auch von Julian wird die Offenheit unterstrichen, die für den Beginn einer Diskussion gewährleistet sein muß. Während Julian dies mit dem noch unerforschten Gegenstandsbereich begründet, steht bei Anja der Wunsch 48 nach Selbständigkeit beim Erkunden des Themas im Vordergrund. Eine offene Kommunikationssituation wird als erforderliche Ausgangslage formuliert, damit ein Lernprozeß in Gang kommen kann, damit "viele neue Ideen" heranwachsen können, die sich manchmal gegenseitig, wie in "Kettenreaktion", auslösen. 5.2.2 Kontroverse: "Da prallen Welten aufeinander" Anja berichtet von Situationen, in denen Kontroversen wichtige Lernerfahrungen für sie darstellten. Sie verwendet das Bild des Zusammenpralls: "Da prallten so richtig diese zwei Fachbereiche, diese, diese Fachverständnisse aufeinander. Und dann da, da denk’ ich, das kann fruchtbar sein" (8). Julian bedient sich derselben Worte, um die Diskussionen in seiner Arbeitsgruppe zu beschreiben: "Da prallen Welten aufeinander" (17). Er macht nicht nur die Erfahrung, "daß man einen anderen Standpunkt vertreten kann" (17), sondern auch, daß dieser ihm vollständig neu und sehr fremd sein kann. Dies fordert das eigene Selbstverständnis heraus. Julian hat für sich gelernt, daß solche interdisziplinären Auseinandersetzungen ein höheres Maß an gegenseitiger Akzeptanz voraussetzen und "auch das Stück weit sich einlassen auf den anderen" (18). Was eine Kontroverse letztlich fruchtbar machen kann, wird dann deutlich, wenn Störungen beschrieben werden. Anja erinnert sich an eine solche Situation: "da weiß ich noch, daß ein Informatiker wirklich alle Bedenken von vorneherein, also, total abgestritten hat" (8). Wie aus einer Polarisierung der Standpunkte hingegen Gewinn gezogen werden kann, beschreibt sie wie folgt: "Ja, nee, ich lerne ja auch, indem ich ‘ne Meinung habe, und, ähm, ich hör’ mir ‘ne andere Meinung an und versuch’ die zu akzeptieren. Also, nicht unbedingt zu übernehmen und meine zu verwerfen, sondern eben beide Meinungen zu integrieren und dann mein eigenes Modell neu zu überdenken. Und neu zu bauen. Das ist, ja, das ist für mich der Lerneffekt dabei. Aber der Lerneffekt ist auch, daß ich sehe, daß ein anderer sein Modell überdenkt. Ach, ich finde, das ist so 'ne Interaktion, müßte das, stattfinden" (8). In ähnlicher Weise wie Julian vermerkt sie, daß es zunächst darum geht, sich auf das Gegenüber einzulassen. Dies geschieht über das Zuhören und Akzeptieren der fremden Position. Ohne sich dieser einfach anzuschließen, geht es ihr jedoch wie Julian darum, den eigenen Standpunkt zu reflektieren. Wichtiges Moment an 49 diesem Prozeß ist, daß er reziprok verläuft, was sie mit der Formulierung "Interaktion", dem sich wechselseitig beeinflussenden Handeln, ausdrückt. Von beiden wird die kontroverse Diskussion zwischen den Disziplinen als etwas Neues charakterisiert, in das sie sich hineinbegeben. Die Fachbereiche stehen einander nicht mehr unverbunden gegenüber. Es kommt hingegen sogar zum Knall. Die Trennlinie zwischen den Disziplinen wird aufgehoben. Beide Seiten gehen verändert aus der Kontroverse hervor. Die Materie wird aufgemischt und aus diesem Verschwinden der Distanz entsteht im optimalen Fall etwas Gemeinsames. Im anderen Fall kommt es wenigstens zum Überdenken der eigenen Perspektive vor dem Hintergrund der Kenntnis und Akzeptanz des anderen. 5.2.3 Kooperation: "Da hatte er dann schon einen Stein im Brett" Julian erlebt in seiner Arbeitsgruppe zur Vorbereitung eines Referats zahlreiche kontroverse Auseinandersetzungen mit einer Pädagogikstudentin. Die konträren Standpunkte werden aneinander gerieben, es werden Argumente ausgetauscht und Meinungen gefestigt. Trotzdem berichtet Julian nur Positives aus dieser Zusammenarbeit, aus der für beide die erfolgreiche Vorbereitung eines Referats resultiert. Die Notwendigkeit, im Plenum etwas zu präsentieren, hat das Geschehen beeinflußt. Aufgabe der Arbeitsgruppe war, sich auseinanderzusetzen und ein Resultat, die Gestaltung einer Sitzung, zu erzielen. Dieses Erfordernis läßt die Gruppe von der Verschiedenheit der TeilnehmerInnen profitieren, die ihre jeweiligen Fähigkeiten und Perspektiven einbringen. Bezogen auf die didaktischmethodische Aufbereitung des Referats räumt Julian ein: "Und, ehm, muß ich sagen, hab' ich, ehm, mangels Erfahrung eigentlich das meiste von der Claudia übernommen, weil sie eindeutig mehr Erfahrung, ehm, Rangehensweise von diesem Seminar hat" (17). Umgekehrt: "Und ich glaube, die hat sich schon auch, ehm, letztendlich schon von meiner Rangehensweise, sich das angesehen und abgeguckt 'en bißchen, 'en Stück weit. Sofern's halt nützlich is' für sie" (17). Julian faßt die Form der Zusammenarbeit, in die beide etwas von sich selbst einfließen lassen, wie folgt zusammen: "So letztendlich, das Angenehmste an der Sache war, 50 daß, ehm, daß man gemeinsam was erarbeitet hat, daß jeder seinen Teil dazugegeben hat und daß was Gutes dabei rausgekommen is'" (18). Nicht nur auf der sachlichen Ebene, sondern auch emotional ist diese Erfahrung wichtig. Es ist "angenehm", wenn man gemeinsam produktiv ist. Nach den kooperativ verlaufenen Absprachen hat sowohl das Vorbereiten der individuellen Teile des Referats als auch das gemeinsame Agieren in der Seminarsitzung lustvolle Qualitäten aufzuweisen. "Das Gesamtbild, das macht dann, also ich hab' mich schon, das hat mir Spaß gemacht das Referat. Und auch das, die Ausarbeitung. Ich denke grade die Zusammenarbeit, daß die so gut funktionierte, das war das Positive an der ganzen Sache" (18). Das Gelingen dieser Zusammenarbeit ist auch Motivationsfaktor: "Wenn ich meinen Teil alleine und sie ihren Teil alleine gemacht hätte, wär’ die Motivation vielleicht gar nicht dagewesen" (18). Kooperation war bei Anja ebenfalls ein Thema. Sie hat von den technischen Kompetenzen eines Informatikstudenten profitiert, den sie im Seminar kennengelernt hat. Der im Seminar zustande gekommene Kontakt wird in einer Situation außerhalb des Seminars wieder aufgegriffen. "Der war nämlich auch, ähm, im Hochschulrechenzentrum. Also, er jobt da wohl auch als Hiwi. Da hatten wir unseren E-Mail-Anschluß beantragt und haben ihn an dem Tag bekommen. Und er hat uns dabei noch geholfen“ (20). Anja erlebt den Informatikstudenten nicht nur als kompetent, sondern darüber hinaus als hilfsbereit. "Und ja hat uns halt auch da super geholfen. Und von daher fand ich den dann halt auch sowieso ganz Klasse. Da hatte er dann schon einen Stein im Brett gehabt" (20). Seine Unterstützung stiftet Sympathie. Die Erfahrung von kooperativem Verhalten bedeutet bei ihr vielleicht auch, das Gegenüber nicht nur als technisch, sondern auch als sozial kompetent zu erleben. Vermutlich schafft hier nicht nur der persönliche Gewinn, den sie davon trägt, sondern auch der symbolische Wert der Handlung eine günstige emotionale Grundlage für die Seminararbeit. Hinter dem Techniker tritt der Mensch hervor. Die Erfahrung auf menschlicher Ebene erzeugt bei ihr ein höheres Maß an Akzeptanz, das die Interaktion im Seminar verbessert. 51 5.2.4 Toleranz: "Es kann ja jeder sein eigenes Zimmer haben" Kennenlernen und Akzeptieren einer fremden Perspektive waren für Julian entscheidende Entwicklungen im Rahmen des Seminars. "Das war sehr interessant, ehm. Da war'n halt also auch wirklich ganz fremde Meinungen für mich. Also ich, eh, war auf solche Argumente nie gefaßt" (17). In Auseinandersetzung mit dem Neuen will er jedoch nicht aushandeln, was wahr und richtig ist. Verschiedene Sichten können nebeneinander bestehen: "Ich hab' meinen Standpunkt nich' geändert, aber natürlich, ich sehe ein, daß man den anderen Standpunkt vertreten kann" (17). Sowohl das Wissen darum, daß es andere Positionen gibt als auch diese zu respektieren, werden als Erfordernisse interdisziplinärer Zusammenarbeit formuliert. Dies wird auch von Anja betont: "Ja, ich finde es gut, wenn man sich nicht einig ist. Aber ich finde diese Akzeptanz und diese Toleranz einfach wichtig. Also nicht, wie jetzt bei diesem einen Informatiker, also, der hat rechts und links nichts an sich rangelassen. Und er hatte seine Meinung. Und darauf beharrte er die ganze Zeit. Und da erwarte ich einfach, daß meine Meinung gehört wird, und auch irgendwo aufgenommen wird. Ob er dann trotzdem sagt, ähm, nee, ist nicht so, ich hab’ andere Argumente, und ich laß mich davon jetzt nicht so leicht runterbringen, ist in Ordnung. Aber von vornherein zumachen, das find’ ich einfach nicht, nicht in Ordnung. Also, das ist für mich dann nicht interdisziplinär" (9). Es geht also auch für sie nicht darum, daß man sich gegenseitig überzeugt, sondern zunächst, sich für andere Ansichten zu öffnen. Die von ihr gebrauchte Wendung "(nicht) in Ordnung" deutet auf ein implizites Regelwerk hin, was im interdisziplinären Geschehen Gültigkeit hat. Wichtige Verhaltensregeln sind dabei, positiv formuliert: etwas um sich herum wahrnehmen, zuhören, sich davon vielleicht irritieren, wenigstens in Bewegung bringen lassen, es aufnehmen, Argumente gegeneinander abwägen und zu eigenen Schlüssen kommen. In dem von ihr entwickelten Bild des Hauses erläutert sie, daß verschiedene Schlüsse einzelner Beteiligter etwas Gemeinsames nicht ausschließen müssen. "Ich mein, es kann ja jeder sein eigenes Zimmer haben. Aber das Produkt kann das gleiche sein oder kann miteinander vereinbar sein" (19). Das Einräumen einer gewissen Pluralität ist Voraussetzung für Zusammenarbeit. Interdisziplinarität erzeugt ein Spannungsverhältnis, in dem die einzelnen sich zurechtfinden müssen. 52 Sie ist der Versuch, zu einem kollektiven Resultat zu kommen, ohne dabei existierende Widersprüche aufzuheben. "Und wenn’s zwei Häuser werden, ist es auch nicht schlimm. Also man kann nicht immer alles, ähm, ja unter ein Dach bringen. Aber man kann unter diesem Dach ja auch noch Widersprüche zulassen. Ich denke, die gibt es immer. (Pause). Also, so Friede-FreudeEierkuchen soll das Haus dann auch nicht aussehen. Also, also so idealistisch stelle ich mir das auch nicht vor, aber einfach, daß, daß diese Möglichkeit gegeben wird, dieses Haus zu produzieren. Und dieses Dach, daß alle Meinungen eben akzeptiert werden, daß alle Meinungen da sind, daß, daß keiner rausgeworfen wird. Und eben dieses Dach als, nochmal ‘ne Zusammenfassung, also ‘en Abschluß finden" (20). Wichtig ist ihr die Integration von allen in einem Pool, in dem alle sichtbar sind und keine Perspektive dominiert. Nicht Toleranz im Sinne von Gleichgültigkeit und Isolation ist erforderlich, sondern Toleranz verbunden mit einer kritischen Auseinandersetzung, die Ecken und Kanten haben darf. 5.3 Studienobjekt: Fremddisziplin - Lernziel: eigene Disziplin Neben die Beschäftigung mit dem Thema "Virtuelle Welten" tritt die Konfrontation mit der Fremddisziplin. Die Irritation durch das Andere löst eine Suchbewegung aus, in der die Differenz ermittelt werden soll. Zugleich entsteht das Bedürfnis, sich der Spezifik des eigenen Fachs zu versichern. Der Versuch, eindeutige Unterschiede zu markieren, geht jedoch nicht immer reibungslos auf, sondern produziert ebenfalls Ambivalenz. Die entsprechenden Interviewpassagen beschäftigen sich mit der heterogenen Herangehensweise an einen gemeinsamen Seminargegenstand, den dabei festgestellten Unterschieden in der Argumentationsweise sowie mit dem voneinander abweichenden Anliegen, die eigenen Diskussionsbeiträge auf einer "objektiven" oder "subjektiven" Basis zu fundieren. Daß dies nicht exakt zu bewerkstelligen ist, tritt in den Reflexionsgängen der InterviewpartnerInnen auf eindrucksvolle Weise zutage. 5.3.1 Herangehensweise: "Die Art und Weise zu denken is' halt ganz anders" Besonders dann, wenn die Interviewten Irritationen, Störungen, angenehme Eindrücke, Wünsche etc. bezogen auf die Seminargruppe zum Thema machen, 53 bringen sie die differierenden Herangehensweisen der Disziplinen deutlich zum Ausdruck. Anja erlebt Interdisziplinarität deshalb als zentral, weil diese ihr den eigenen Blickwinkel als Sozialpädagogin besser verdeutlicht. Bei der Betrachtung desselben Gegenstands durch die Seminargruppe kann die Verschiedenheit der Zugänge sichtbar werden: "Also, daß es nicht nur Sozialpädagogen gibt, sondern daß es noch andere Berufsgruppen gibt, mit denen man zusammenarbeiten kann und soll, und daß es auch fruchtbar sein kann, von anderen zu lernen, die ‘ne andere Auffassung haben. Also, die, ähm, ‘ne andere Herangehensweise an ein und dieselbe Sache haben. Das find ich recht spannend" (21). Zum einen erscheint Anja neben der simplen Wahrnehmung, daß es auch andere Perspektiven gibt, der positive Effekt, voneinander zu lernen, als Argument zugunsten fachübergreifender Zusammenarbeit. Zum anderen reizt sie das Ungewisse, die Erfahrung, nicht voraussehen zu können, wie sich eine Diskussion entwickelt, wenn man nicht nur "unter sich" bleibt. Auch für Julian ist die Differenz in der Herangehensweise wichtig geworden: "Die Art und Weise zu denken is' halt ganz anders" (9). Er glaubt, daß Informatiker gewohnt sind, im allgemeinen "pragmatischer an die Sache ranzugehen" (11). Was pragmatisch heißt und was es bringt, erläutert er wie folgt: "Pragmatismus hat natürlich auch seine Vorteile. Nüchterner an 'ne Sache ranzugehen, vorurteilsfrei. Möglichst natürlich, ich meine, so ganz kann man das nie, aber, ehm, Mathematik lehrt einem das" (12). Worte wie "natürlich" oder "vorurteilsfrei" verweisen auf sein Anliegen, sich einer Sache voraussetzungsfrei zu nähern, einfach die "Sachean-sich" zu betrachten, ohne daß die betrachtende Person dabei eine Einflußgröße darstellt. Die Rückkopplung dieser Herangehensweise an den originären Studiengegenstand der Informatik zeigt sich, wenn Julian seine Beobachtungen über divergierende Argumentationsweisen formuliert. 5.3.2 Argumentationsweise: "Viele Pädagogen glauben irgend etwas. Ehm, bei uns glaubt niemand" Darüber, was in seinem Fach die übliche Art und Weise des Argumentierens ist, 54 bemerkt Julian: "Ich denke, daß wir, ehm, wir in der Informatik versuchen, Sachen möglichst auf 'en einfachen Nenner zu bringen. Halt so kurz und korrekt wie möglich" (9). Einschränkend fügt er selbst an: "Was man ja häufig finden kann bei uns, so'n Nenner" (9). In der Benennung dessen, was in der eigenen Disziplin zählt, sind die Dreh- und Angelpunkte seiner weiteren Reflexion angelegt: Einfachheit, der eine gemeinsame Nenner, Prägnanz und Exaktheit. Demgegenüber stehen diskursive Verhaltensweisen, von denen er sich durch die explizite Formulierung der eigenen abgrenzt. Man kann sie folgendermaßen umreißen: Problematisieren, Pluralität zulassen, unscharfe Aussagen treffen und Komplexität sowie Widersprüche erzeugen. Auf neuere Entwicklungen in der Informatik, die systematisch mit Unschärfen und Widersprüchen arbeiten, um Realität adäquater abbilden zu können, ist er offensichtlich in seinem Studium noch nicht gestoßen. Julians Ausführungen spiegeln folglich das wider, was im klassisch-naturwissenschaftlichen Kontext Usus ist. Dort gehorchen die Argumentation und die Entwicklung von Thesen strengen Regeln. "Ohne eine handfeste Begründung, ehm, gilt meine Behauptung gar nichts" (14). In der pädagogischen Herangehensweise findet er dieses Wissenschaftsideal nicht. Dort "wird schon mehr spekuliert" (9). "Spekulation" erscheint als Gegenbegriff zu "handfest", hinter dem sich das Wort "Fakten" verbirgt. Um letztere zu produzieren, ist eine spezielle Form des Denkens erforderlich, die aus seiner Sicht bloßen Meinungsaustausch übersteigt. "Grade dieses Ablehnen jeder, ehm, ja so, so Regeln. Das schematische Denken prinzipiell abzulehnen, ehm, wie das einige gemacht haben. Das verleitet natürlich dazu, ehm, ja daß man eigentlich nichts mehr begründen muß. Ich bin der Ansicht, also is' das so. So, so gehen da einige vor" (14). In seiner Kritik am Diskussionsverhalten der PädagogikstudentInnen wird deutlich, welche Form von Wissensbildung und Wahrheitsfindung er gewohnt ist. Zugespitzt formuliert er das wie folgt: "Viele Pädagogen glauben irgend etwas. Ehm, bei uns glaubt niemand" (15). Die Beschreibung dieser fachspezifischen Eigenheiten scheint nicht ohne Polarisierung auszukommen. In seiner Erinnerung an Seminardiskussionen kommt er immer wieder an einen Punkt, an dem er 55 fordert: "Dann müßten schon Fakten geliefert werden, warum ..." (17). Hieraus spricht das Bedürfnis, an einem bestimmten Punkt der Reflexion, Aussagen abzusichern. Alles andere wäre "Spekulation". Das Wort "Spekulation" verliert bei Julian jedoch in einem anderen Zusammenhang seinen negativen Beigeschmack. Dies geschieht dann, wenn er es in der Seminardiskussion als vorteilhaft erlebt, gedankliche Freiheit zu haben, die Kühnheit, etwas Unfundiertes in den Raum zu stellen. Befreiend ist es, sich der strengen Erkenntnisregeln der eigenen Wissenschaft zu entziehen. Dadurch entsteht die Möglichkeit zum Perspektivenwechsel und zum Neu- bzw. Umdenken. "Und ich find das, ehm, also das is' ja sehr, sehr anregend. Grade dieses Spekulieren und einfach nur mal en paar, paar Behauptungen in die Welt zu setzen. Unabhängig davon, ob ich sie auf jeder Linie belegen kann. Ehm, einfach nur mal in 'ner ganz andern Richtung zu denken. Und das gibt es bei uns natürlich nich'. Das is', das is' völlig anders" (9). Das "Spekulieren" eröffnet die Möglichkeit, eingefahrene Bahnen zu verlassen. Es erlaubt, ungewöhnliche Ideen, eigene Gedanken im Gespräch argumentativ zu erproben. Er kann dabei eher thematisieren, was ihn selbst in Zusammenhang mit einer Thematik beschäftigt, ohne sofort Beweise anführen zu müssen. Zugleich ist es ein emotional positives Erlebnis, da die regelgeleitete Debatte von den Beteiligten ein hohes Maß an Disziplinierung erfordert: "Es is’ ‘ne wesentlich angenehmere Atmosphäre, um zu reden und um sich zu unterhalten und Gedanken auszutauschen" (9). Auf die beiden, von Julian thematisierten Wissensarten, ermittelte Fakten und subjektivere Gedankengänge, möchten wir im folgenden näher eingehen. 56 5.3.3 Fakten: "Man muß ja irgendwie 'en Maß haben" Was Fakten sind und wie die Informatik diese ermittelt, beschreibt Julian wie folgt: "Es is' wissen oder nich' wissen. Entweder ich hab' en Beleg, dann weiß ich's. Oder ich hab' ein Programm, dann funktioniert's, oder ich hab' ne Fehlermeldung, dann funktioniert's nich'. Also schon irgendwo diese binäre Denkensweise der Maschine" (15). In der Reibung mit der pädagogischen Denkweise entsteht nicht nur die Notwendigkeit, die eigene genauer zu formulieren. Sie wird Julian auch stärker in ihrer Struktur transparent. Die Parallelität zwischen der Art der Wissensbildung und dem Gegenstand der Informatik wird ihm bewußt und läßt diese Logik als eine spezifische erscheinen. Fakten lassen sich aus der Empirie ermitteln. Hier rekurriert Julian auf die statistischen Verfahren, mit denen man versucht, sich Realität über Berechnungen zu nähern. „Über Umfragen, also wie das in der Psychologie üblich is'. Da wird ja alles statistisch erstmal erhoben und dann wird das durchgerechnet, ob das signifikant is', also nach statistischen Verfahren, und erst dann wird gesagt, 'Okay, das is' jetzt so'. Und ich denke, das is' schon notwendig“ (14). Sicherheit bieten wissenschaftliche Verfahren, die mit Zahlen hantieren. Mathematik liefert Größen, mit denen Signifikanz festgemacht und damit Aussagen getroffen werden, die einen Wahrheitsanspruch erheben können. Es geht darum, Beliebigkeit zu verringern und Wissen zu fundieren. Um das Bedürfnis nach Objektivität zu bedienen, "muß man ja irgendwie 'en Maß haben" (14). Die Suche nach einem "Maß" geht an Wirklichkeit, als an eine meßbare Sache heran. Letztlich verbirgt sich dahinter das Ringen nach Objektivität, nach einer Größe, die auf eine Wahrheit verweist. Allerdings muß Julian einschränkend feststellen, daß man auch in der Informatik, als praxisorientierter Disziplin mit Unschärfen leben muß. "Also, Fehler schleichen sich ganz schnell ein und dann isses vorbei mit der mathematischen Exaktheit" (15). Von Menschen Gemachtes birgt Fehler. Es gibt keine Garantie auf das perfekte Computerprogramm. Seine Funktionalität erweist sich erst im 57 Einsatz. An diesen Stellen läßt sich auch für einen Informatiker keine Sicherheit finden. "Da fangen wir auch an, zu glauben, 'Ich glaube, daß mein Programm fehlerfrei is' (lacht)" (15). Letztlich sind persönliche Urteilskompetenz und Vermutung Kategorien, mit denen auch im Informatik-Alltag hantiert werden muß. 5.3.4 Personen: "Da kann ich eigentlich nur von mir ausgehen" Anja bestätigt zum einen das Fremdbild, das Julian von den PädagogInnen zeichnet. Ihre Argumentation geht vom eigenen Selbst aus. Die Art, wie man selbst ist, erscheint als stabiler Bezugspunkt, der zu Einstellungen und Haltungen führt und diese erklärt. "Ja, da kann ich eigentlich nur von mir ausgehen, ich mein’, daß ich diese persönliche Meinung habe, ähm, ist ja auch mit meiner Person verbunden" (7). Dabei geht es jedoch nicht darum, eine eigene Haltung starr und ungebrochen zu fixieren. Sie muß stets in Diskussionen überdacht werden. Die eigene Meinung ist von außen anfechtbar. Provoziert wird das Umdenken durch Argumente. "Wenn jemand gut argumentiert, dann laß ich mich auch gerne, ja, was heißt davon überzeugen, oder, ich bau's zumindest in mein Modell mit ein, also, ich versuch’ das irgendwie zu integrieren und dann, mein Modell neu zu überdenken, beharr’ dann nicht auf meiner Meinung" (8). Meinung steht daher nicht unverbunden neben oder gegen Meinung. Die Vielfalt von Meinungen ist nicht beliebig. Sie ist Resultat von Auseinandersetzung und gleichzeitig eine Sache, die mit der eigenen Subjektivität zu tun hat. Allein auf den subjektiven Eindruck geworfen zu sein, erlebt Anja auch als einschränkend. In einer Meinungsverschiedenheit mit dem Seminarleiter aus der Informatik wagt sie es nicht, ihre kritische Haltung in der Feedback-Runde zu äußern, weil sie keine weitere Diskussion auslösen möchte und weil sie sich mit ihrer Kritik alleine fühlt. "Das bringt jetzt auch nichts. Das ist ja alles sehr subjektiv" (12). Später unterhält sie sich jedoch mit ihren KommilitonInnen über die fragliche Situation. Erst durch die Rückversicherung, der Fundierung ihrer Meinung in den bestätigenden Wahrnehmungen der anderen, wird sich 58 nachträglich aktiv. "Und daraufhin, wo ich dann so'n bißchen die Bestätigung hatte, daß es doch nicht so subjektiv sein kann, daß es zumindestens schon drei, vier Leute waren, die so empfunden haben und hab es dann nochmal zu Frau Schachtner gesagt" (12). Indizien dafür, daß ihre Sicht der Dinge nicht nur subjektiv ist, gewinnt also auch sie aus Häufigkeiten. Je öfter andere ihre Sicht der Dinge bestätigen, um so eher fühlt sie sich ermutigt, Kritik zu äußern. Man könnte vermuten, daß für die Auseinandersetzung mit Ranghöheren gesichertere Argumente erforderlich sind. Am Beispiel dieser Begebenheit zeigt sich, daß auch Anja zwischen spekulativen und empirisch fundierten Wissensbeständen unterscheidet. Eine nicht verifizierte These in den Raum zu stellen, ist riskanter, wenn man nicht von gleich zu gleich diskutiert bzw. wenn man das Verhalten einer anderen Person kritisiert. Hier glaubt sie, sich nicht nur auf ihren subjektiven Eindruck verlassen zu dürfen. Allerdings gibt es für Anja keine einzige Wahrheit. Auch sie beruft sich auf die Besonderheit ihres Studiengegenstands: "Also, es ist, ich finde, es gibt kein Richtig und kein Falsch. Also, beim PC okay. Wenn ich Enter drücke, dann drück' ich Enter, ne. Da kann nichts anderes dabei rauskommen. Ähm, aber in der Pädagogik, ich, ich muß doch verschiedene Handlungsweisen irgendwie zulassen können. Oder Gedanken" (13 f.). Auch ihre Selbstpositionierung erfolgt in Abgrenzung zur Fremddisziplin. Sie dient als Kontrastfolie, vor der die eigene Denk- und Handlungsweise differenzierter hervortritt. Verantwortlich für die Differenz erscheint ihr der jeweils unterschiedliche Gegenstand. "Ich denk', in der Mathematik geht’s um Zahlen und in der Pädagogik geht's um Menschen" (15). Ein deutlicher Trend schält sich aus dem Dargestellten heraus: Die interdisziplinäre Konstellation ist von zahlreichen Ambivalenzen durchzogen. Sie hat bei Julian den Wunsch erzeugt, etwas Neues und Fremdes - nämlich problemorientierte kontroverse Diskussion - kennenzulernen. Sie hat die Beteiligten stets auf ihre eigenen Selbstverständlichkeiten zurückgeworfen, die es auszuloten, zu begründen, zu verteidigen oder neu zu fassen galt. Vielleicht ist es kennzeichnend für das Eintauchen in einen interdisziplinären Lernzusammenhang, 59 daß erfüllte Bedürfnisse nach Differenz und Selbstpositionierung flankiert werden von Widerspruchserfahrungen. Die TeilnehmerInnen stoßen an die Grenzen ihres eigenen Fachs, erfahren aber auch dessen Stärken. Diese Erfahrung läßt das polarisierte Selbst- und Fremdbild aufweichen, ohne daß deshalb Differenzen aufgehoben oder unbedeutend werden. Anhang: Verzeichnis der Lehrveranstaltungen Gastvorträge Exkursionen 60 Literatur Beierwaltes, A./B. Grebe/K. Neumann-Braun (1993), Indizierte Computerspiele Markt und Spiele, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Computerspiele, Bonn, S. 89-104 Betz, J./C. Wins (1995), Der Eintritt in den Diplom-Studiengang Erziehungswissenschaft an der Philipps-Universität Marburg. Eine empirische Analyse. Marburg. Institut für Erziehungswissenschaft (1994), Diplom-Studiengang Erziehungswissenschaft am Fachbereich Erziehungswissenschaft der PhilippsUniversität Marburg, Versuche einer Bestandsaufnahme, Marburg Friebertshäuser, B. (1992), Übergangsphase Studienbeginn, Eine Feldstudie über Riten der Initiation in eine studentische Fachkultur, Weinheim Giddens, A. (1996), Leben in einer posttraditionalen Gesellschaft, in: Beck, U./A. Giddens/S. Lash (Hrsg.), Reflexive Modernisierung, Frankfurt/Main, S. 113-194 Kübler, H.-D. (1993), Jugendliche Medienwelten: Computerwelten?, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Computerspiele, Bonn, S. 21-36 Merkert, R. (1992), Medien und Erziehung, Darmstadt Paulitz, T. (i.E.), „Da prallen Welten aufeinander!“, Ergebnisse einer Evaluationsstudie zum Modellprojekt ‘Neue Technologien in psychosozialen und pädagogischen Handlungsfeldern’, in: Marburger Universitätszeitung Piaget, J. (1983), Meine Theorie der geistigen Entwicklung, Frankfurt Schachtner, Ch. (1998), Lernen für die Zukunft. Neue Medien als Herausforderung für die Schule, in: alma mater philippina, WS 1998/99, S. 44-48 Schachtner, Ch. (i.E.), Neue Medien und Soziale Arbeit, in: Otto, H.-U./H. Thiersch, Handbuch für Sozialarbeit/Sozialpädagogik Schachtner, Ch. (i.E.), Unterstützen Neue Medien die Entwicklung zukunftseröffnender Lebensperspektiven? Anforderungen an die Schule, in: Bildung und Erziehung Schütz, A./Th. Luckmann (1975), Strukturen der Lebenswelt, Neuwied 61 62 63 64