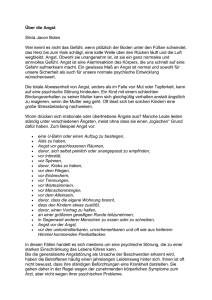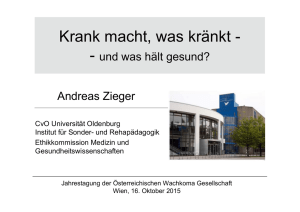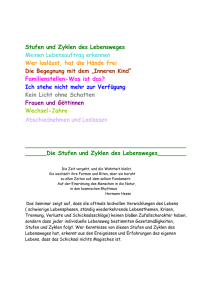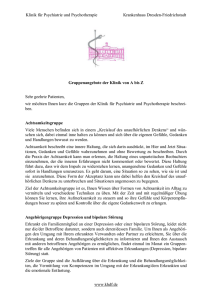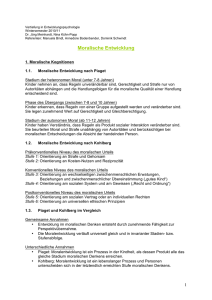Reader Gefühlsethik - Fachverband Ethik eV
Werbung

Fachverband Ethik Landestagung 2010 RENAISSANCE DER GEFÜHLE NEUE ANSÄTZE ZUR MORALBEGRÜNDUNG Haus auf der Alb - Bad Urach 07. + 08. Mai 2010 zusammengestellt von Klaus Goergen 1 INHALT DES READERS Geschichte des Gefühlsbegriffs E.M. Engelen: Gefühle S. Döring: Emotionen und Handlungsgründe D. Perler: Was uns mit der Welt verknüpft E. Weber-Guskar: Der Duft von frischem Gebäck... E. Weber-Guskar: Die Klarheit der Gefühle Argumente der Gefühlsethik Gefühlsethiker im Überblick 3 5 7 9 11 13 14 16 Francis Hutcheson: Moral sense David Hume: Affekte und Moral David Hume: Von den Motiven des Willens David Hume: Verstand, Gefühl und Moral Adam Smith: Von der Sympathie Adam Smith: Die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung J. J. Rousseau: Mitleid und Natur Arthur Schopenhauer: Egoismus und Mitleid Max Scheler: Grammatik der Gefühle Richard Rorty: Geborgenheit und Mitgefühl Christoph Fehige: Empathie a priori 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 31 Sigmund Freud: Schuld und Psyche Damasio: Descartes Irrtum Joachim Bauer: Biologische Gründe für Empathiefähigkeit Joachim Bauer: Warum ich fühle, was du fühlst Moral braucht Gefühl Moral steckt im Erbgut 32 33 34 35 36 37 Definitionen: Affekt bis Wunsch Arten von Gefühlen Ein Alphabet moralischer Gefühle Modell: Moralische Gefühle Im Dschungel der Gefühle 40 42 43 44 45 Philip Roth: Empörung (Auszug) Franz Kafka: Der Schlag ans Hoftor Theodor Fontane: Effi Briest (Auszug) Max v. d. Grün: Masken Günter Grass: Als Vater wieder heiraten wollte Kurt Marti: happyend Kurt Reding: Apotheke vita nova Ernst Bloch: Armer Teufel und reicher Teufel Emotionale Erschließung der literarischen Texte 46 47 48 49 52 53 54 55 56 Neuere Literatur zur Philosophie der Gefühle 57 2 Zur Geschichte des Gefühlsbegriffs Bereits im Altertum bezeichneten die Philosophen Aristippos von Kyrene (435–366 v. Chr.) und Epikur (341–270 v. Chr.) „Lust“, bzw. auch „Freude“, „Vergnügen“ (hêdonê) als wesentliches Charakteristikum des Fühlens. Als „unklare Erkenntnisse“ und vernunftlose und naturwidrige Gemütsbewegungen wurden die Gefühle von den Stoikern (etwa 350–258) bestimmt; das Lustprinzip der Epikureer wird in Frage gestellt. Die ältere Philosophie und Psychologie behandelt das Thema Emotionen und Gefühle vorzugsweise unter dem Begriff der „Affekte“ (lat. affectus: Zustand des Gemüts, griech.: pathos), bzw. auch der „Leidenschaften“ und hier vor allem unter dem Gesichtspunkt der Ethik und Lebensbewältigung. „Die Bestimmung des Begriffs der Affekte hat vielfach geschwankt. Bald sind die Affekte enger nur als Gemütsbewegungen gefasst worden, bald sind sie weiter auch als Willensvorgänge gedacht, bald sind sie als vorübergehende Zustände, bald auch als dauernde Zustände definiert und dann mit den Leidenschaften vermischt worden.“ (Friedrich Kirchner, 1848–1900). Für die Kyrenaiker (4. Jh. v. Chr.) sind zwei Affekte wesentlich: Unlust und Lust (ponos und hêdonê). Auch Aristoteles (384–322) versteht unter Affekten seelisches Erleben, dessen wesentliche Kennzeichen Lust und Unlust sind. Descartes (1596–1650) unterscheidet sechs Grundaffekte: Liebe, Hass, Verlangen, Freude, Traurigkeit, Bewunderung. Für Spinoza (1632–1677) sind es dagegen drei Grundaffekte: Freude, Traurigkeit und Verlangen. Auch Immanuel Kant (1724–1804) sah das Fühlen als seelisches Grundvermögen der Lust und Unlust: „Denn alle Seelenvermögen oder Fähigkeiten können auf die drei zurückgeführt werden, welche sich nicht ferner aus einem gemeinschaftlichen Grunde ableiten lassen: das Erkenntnis-vermögen, das Gefühl der Lust und Unlust und das Begehrungsvermögen“. Friedrich Nietzsche (1844–1900) trennte nicht zwischen emotionalem und kognitivem Aspekt: „Hinter den Gefühlen stehen Urteile und Wertschätzungen, welche in der Form von Gefühlen (Neigungen, Abneigungen) uns vererbt sind.“ Ein viel beachteter Versuch der Gegenwart war die mehrgliedrige Begründung der wesentlichen Faktoren des Gefühls von Wilhelm Wundt (1832–1920) durch sein System zur Beschreibung der Emotionen in drei Dimensionen Lust / Unlust, Erregung / Beruhigung, Spannung / Lösung. Ein anderer, einflussreicher Erklärungsversuch stammt von dem amerikanischen Psychologen und Philosophen William James (1842–1910). James glaubte, ohne körperliche Reaktionen entstünden Gefühle bzw. Emotionen gar nicht erst (ideomotorische Hypothese). Emotionen sind für ihn nichts anderes als das Empfinden körperlicher Veränderungen. Nach James weinen wir nicht, weil wir traurig sind, sondern wir sind traurig, weil wir weinen. Wir laufen nicht vor dem Bären weg, weil wir uns fürchten, sondern wir fürchten uns, weil wir weglaufen. Psychologen wie Hermann Ebbinghaus (1850–1909) und Oswald Külpe (1862–1915) vertraten das eindimensionale Modell aus Lust und Unlust. Der Psychologe Philipp Lersch (1898–1972) argumentierte dagegen: „Dass dieser Gesichtspunkt zur Banalität wird, wenn wir ihn etwa auf das Phänomen der künstlerischen Ergriffenheit anwenden, liegt auf der Hand. Die künstlerische Ergriffenheit wäre dann ebenso ein Gefühl der Lust wie das Vergnügen am Kartenspiel oder der Genuss eines guten Glases Wein. Andererseits würden Regungen wie Ärger und Reue in den einen Topf der Unlustgefühle geworfen. Beim religiösen Gefühl aber – ebenso auch bei Gefühlen wie Achtung und Verehrung – wird die Bestimmung nach Lust und Unlust überhaupt unmöglich.“ Franz Brentano (1838–1917) nahm an, die Zuordnung von Gefühl und Objekt sei nicht kontingent, sondern könne richtig sein („als richtig erkannte Liebe“). Ähnlich sahen Max Scheler (1874 – 1928) und Nicolai Hartmann (1852 – 1950) Gefühle im so genannten „Wertfühlen“ als zutreffende Charakterisierungen von Werterfahrungen an (vgl. „Materiale Wertethik“, „Werte als ideales Ansichsein“). 3 Auch für Sigmund Freud (1856–1939) sind Gefühle im Wesentlichen gleichzusetzen mit Lust und Unlust („Lust-Unlust-Prinzip“), mit der Variante, dass jede Lustempfindung im Kern sexuell ist. Freud war der Meinung: „Es ist einfach das Programm des Lustprinzips, das den Lebenszweck setzt – an seiner Zweckdienlichkeit kann kein Zweifel sein, und doch ist sein Programm im Hader mit der ganzen Welt.“ Carl Gustav Jung (1875–1961) betonte ebenfalls die Rolle von Lust und Unlust, bezweifelte jedoch, dass jemals eine Definition „in der Lage sein wird, das Spezifische des Gefühls in einer nur einigermaßen genügenden Weise wiederzugeben“. Der amerikanische Hirnforscher Damasio (geb. 1944) definiert Gefühle und Emotionen vorwiegend kognitiv und als Körperzustände: „Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Gefühl sich zusammensetzt aus einem geistigen Bewertungsprozess, der einfach oder komplex sein kann, und dispositionellen Reaktionen auf diesen Prozess“ (…). – „Nach meiner Ansicht liegt das Wesen des Gefühls in zahlreichen Veränderungen von Körperzuständen, die in unzähligen Organen durch Nervenendigungen hervorgerufen werden.“ In der Gegenwart ist die Situation hinsichtlich des Gefühls- und Emotionsbegriffs eher unübersichtlich: Zahlreiche Ansätze versuchen Charakter und Gesetzmäßigkeiten des Fühlens zu bestimmen, allerdings ohne eine Übereinkunft zu erzielen: z. B. Marañón 1924, Walter Cannon (1927), Woodworth (1938), Schlosberg (1954), Schachter und Singer (1962), Valins 1966, Burns und Beier (1973), Graham (1975), Marshall u. Philip Zimbardo 1979, Rosenthal (1979), Schmidt-Atzert (1981), Lange (1998). Der amerikanische Philosoph Robert C. Solomon stellte angesichts der Verschiedenartigkeit der Deutungen unlängst fest: „Was ist ein Gefühl? Man sollte vermuten, dass die Wissenschaft darauf längst eine Antwort gefunden hat, aber dem ist nicht so, wie die umfangreiche psychologische Fachliteratur zum Thema zeigt.“ (Robert C. Solomon: Gefühle und der Sinn des Lebens, Frankfurt am Main 2000, S. 109). (wikipedia-Stichwort: Emotion) 4 E.M. Engelen: Gefühle (E. M. Engelen: Gefühle. Stuttgart 2007. S. 7 ff.) Was ist Verliebtheit, was Liebe? Was Angst, was Weltschmerz? Wie unterscheiden sich Kältegefühl und Freude? Wie Nostalgie und Entsetzen? Und wie Scham und Schuld, Zorn und Trauer? Handelt es sich in allen Fällen um Emotionen? Um Gefühle oder Empfindungen? Stimmungen oder Affekte? Eine Begriffsklärung muss zunächst helfen, diese Fragen zu beantworten. Der Begriff des Gefühls kommt erst im 18. Jahrhundert als eine Übersetzung des französischen »sentiment« beziehungsweise des englischen »sentiment« in die deutsche Sprache. Er tritt damit neben die dort länger verwendeten Begriffe der Emotion und des Affekts. Im Deutschen wird »Gefühl« heut- zutage als ein Oberbegriff verwendet. Historisch betrachtet sind Emotionen oder Affekte seit AristoteIes dem so genannten Begehrungsvermögen - also dem, was begehrt oder nicht begehrt wird - der Lust oder Unlust zugeordnet. Bei Shaftesbury, Hume und Kant kommen dann Gefühle als Reaktionen auf Erlebnisse, aber auch auf Emo- tionen (als Gefühl der Lust oder Unlust) hinzu. Emotionen oder Affekte werden insofern bereits in dieser Tradition als die primäre, unmittelbarere oder ursprünglichere Reaktion auf ein Ereignis oder eine Situation konzipiert. Hier wird bereits deutlich, dass die etablierten begrifflichen Unterscheidungen auch systematischen Gesichtspunkten und nicht nur wortgeschichtlichen folgen. Diese Begriffsgeschichte hat auch in den gegenwärtigen Emotionstheorien Spuren hinterlassen, es lassen sich jedoch diesbezüglich auch einige Verschiebungen feststellen. So gelten Emotionen wie Angst, Wut oder Freude heute immer noch als unmittelbare Reaktionen auf Erlebnisse oder Situationen. während Gefühle wie Liebe oder Heimweh nicht mehr als unmittelbare Reaktionen auf bestimmte Erlebnisse oder Situationen verstanden werden. sondern als lang anhaltende Zustände, die nicht die ganze Zeit über von einem Erregungspotenzial begleitet sind. sondern nur gelegentlich durch ein solches ins Bewusstsein gelangen. In der Psychologie und der Philosophie wird zudem eine ganze Reihe weiterer Kriterien für Emotionen (emotions) genannt: Emotionen weisen eine Bewertungskomponente für Situationen oder Stimuli auf. Sie umfassen eine Erregungskomponente, messbar etwa an Schweißabsonderung, Erhöhung der Herztonfrequenz oder an der Zunahme der Aktivierungsintensität bestimmter Bereiche des Gehirns, die für die Verarbeitung emotionaler Zustände oder Prozesse bekannt sind. Zudem gehen sie mit einem motorischen Ausdruck einher, zum Beispiel einem Lächeln oder einer bestimmten Körperhaltung. Sie sind von kurzer Dauer. Sie treten bei einem signifikanten Wechsel der Lebenssituation auf. Darüber hinaus enthalten Emotionen eine motivationale Komponente: Die Freude über den gelungenen Kuchen veranlasst mich zum Beispiel. noch einen für meine Kollegen zu backen. oder die Angst vor Nachbars Hund veranlasst mich. mich nach dem Maulkorbzwang zu erkundigen. 5 Diese vor allem in der psychologischen Theoriebildung relevanten Kriterien werden in der Philosophie durch die folgenden ergänzt: Emotionen haben ein spezifisches intentionales Objekt, das heißt, sie sind auf etwas oder jemanden gerichtet: Ich freue mich über den gelungenen Kuchen oder den Anruf eines Freundes; meine Angst richtet sich auf die zu erwartende Stromrechnung oder den bissigen Hund des Nachbarn. Sie haben eine erkennbare Ursache: etwa die Nachricht, dass die Strompreise wieder erhöht wurden, oder, dass Nachbars Hund eine Passantin gebissen hat. Sie sind nicht das Resultat intellektueller Anstrengungen, können jedoch rational oder vernünftig beziehungsweise irrational oder unvernünftig sein. Letzteres lässt sich am besten anhand eines Beispiels erklären: Empfindet jemand Angst, weil ein Hund wütend kläffend auf ihn zurast, und will er fliehen, ist diese emotionale Reaktion insofern vernünftig zu nennen, als der Hund ihn verletzen könnte. Weiß er hingegen, dass der Hund zu alt für einen ernst zu nehmenden Angriff ist, wäre die Angst unvernünftig oder nicht angemessen. Oft werden Emotionen sowohl in der Psychologie als auch in der Biologie als anthropologische, universal auftretende Phänomene betrachtet, die keiner historischen oder kulturellen Variabilität unterliegen. Sie sind nach dieser Sicht angeboren und laufen nach sogenannten Affektprogrammen automatisch ab. Angst, Zorn, Wut, Trauer und Freude wären nach dieser Begriffsbestimmung also Emotionen (emo- tions). Affektprogramme sind demnach angeborene Mechanismen, die durch einen für sie spezifischen Reiz ausgelöst werden. Wir sehen eine Schlange, empfinden Angst und laufen weg. Für Gefühle (sentiments) wie Liebe, Vertrauen, Nostalgie- Weltschmerz oder Heimweh gilt hingegen: -Sie werden als latente Dispositionen (sogenannte Hintergrundgefühle) konzipiert. -Ihnen fehlt eine (direkt messbare) Erregungskomponente des Körpers. -Zudem handelt es sich um lang anhaltende Phänomene. -Sie stehen in keinem unmittelbaren Reaktionszusammenhang zu einem Erlebnis oder einer Situation. -Gefühle wie Weltschmerz oder Vertrauen müssen nicht intentional auf ein Objekt oder eine Situation gerichtet sein, andere Gefühle sind aber durchaus intentional gerichtet. Sie sind darüber hinaus nicht richtig oder falsch, vernünftig oder unvernünftig zu nennen. Man kann in diesem Sinne zumeist nicht über ihre Angemessenheit diskutieren. 6 Sabine Döring: Emotionen und Gründe (S. Döring: Hg.: Philosophie der Gefühle. Ffm. 2009. S. 43 ff) Eine Theorie der rationalen Motivation durch Emotionen ist nicht zuletzt deshalb ein Desiderat, weil Emotionen einen Ausweg aus einem Dilemma versprechen, das ich andernorts das 'internalistische Dilemma' getauft habe. Letztlich resultiert dieses Dilemma aus dem Versuch zu explizieren, wie ein normativer, eine Handlung objektiv rechtfertigender Grund zugleich ein "motivierender Grund" sein kann, der aus der Perspektive des Subjekts für die Handlung spricht - diese rationalisiert - und sie in dem Fall, daß das Subjekt aus dem Grund handelt, zugleich erklärt. Diese unter dem Namen "Internalismus" in die Literatur eingegangene Forderung ist für unser Selbstverständnis als animal rationale zentral, nach dem wir Wesen sind, die über normative Gründe (im Unterschied zu bloßen Ursachen) verfügen und zumindest manchmal aus Gründen handeln. Entbehrten normative Gründe jeglicher motivierender Kraft, könnte ihre faktische Handlungswirksamkeit immer nur unter Bezugnahme auf ein "externes", das heißt dem Grund bloß äußerliches Motiv erklärt werden. Das aber hieße, daß es Handeln aus Gründen nicht geben könnte, sondern immer bloß Handeln in (kontingenter) Übereinstimmung mit Gründen: Wir täten nie etwas genau aus dem Grund, daß wir es für richtig halten. Bei weitem die meisten heutigen Rationalitätstheoretiker und Ethiker sind Internalisten, so daß Jonathan Dancy Internalismus als eine "Maxime" einführt und Garrett Cullity und Berys Gaut ihn gar als einen »Gemeinplatz« der gegenwärtigen Debatte bezeichnen. Beim Internalismus setzt indes auch eine skeptische Herausforderung für die Ethik an. Diese ergibt sich, indem der Internalismus mit der oben skizzierten Humeschen Theorie der Motivation verbunden wird. Verbunden mit dem Internalismus folgt aus dieser Motivationstheorie, daß normative praktische Gründe immer nur »hypothetische« Gründe, das heißt relativ zu den jeweiligen Wünschen einer Person sein können. Denn wenn erstens ein rechtfertigender praktischer Grund sowohl motivieren können als auch in dem Fall, daß der Akteur tatsächlich aus ihm handelt, zugleich ein erklärender Grund sein muß, und wenn zweitens alle Erklärung von Motivation und Handlungen von den Wünschen des Akteurs ausgehen muß, dann folgt drittens, daß auch alle rechtfertigenden praktischen Gründe von den Wünschen der handelnden Person ausgehen müssen. Unter der zusätzlichen gängigen Prämisse, daß Wünsche ihrerseits nicht rational kritisierbar sind, ist diese Konklusion moralskeptisch, insofern ihr zufolge auch ein moralischer Grund nicht unabhängig von den beliebigen Wünschen einer Person Geltung hat. Mittlerweile sind die Einwände gegen die Humesche Theorie der praktischen Rationalität und Ethik Legion. Ein Haupteinwand ist dabei der oben bereits skizzierte, daß funktionale Wünsche Handlungen nicht rationalisieren können, so daß diese Motivationstheorie ihrem eigenen Anspruch nicht genügt, rationale Motivation zu erklären. Selbst wenn dieser 7 Einwand zutrifft, ist damit, wie oben ebenfalls schon erläutert, noch nicht umgekehrt gezeigt, wie rationale Motivation alternativ erklärt werden kann. Einmal angenommen, Anscombe, Scanlon, Johnston, Helm und andere plädierten in dieser Frage zu Recht für einen evaluativen Wunschbegriff, für den es konstitutiv ist, daß das Gewünschte als wünschenswert bzw. gut bewertet wird. Dann wäre eine Person nicht mehr deshalb zu einer Handlung motiviert, weil entweder diese selbst oder das, was sie herbeiführen würde, einen beliebigen Wunsch der Person erfüllt - Vielmehr würde die Handlungsmotivation umgekehrt darauf zurückgeführt, daß entweder die Handlung selbst oder das, was sie herbeiführen würde, von der Person für wünschenswert gehalten wird. Im gängigen Bild des menschlichen Geistes, das alle intentionalen mentalen Zustände entweder den kognitiven Überzeugungen oder den konativen Wünschen zuschlägt, scheint sich damit die Motivation einer kognitiven Überzeugung bzw. einem Werturteil zu verdanken. Urteile aber haben ja unter der (Humeschen) Standardinterpretation gerade keine motivierende Kraft. Hieraus resultiert das "internalistische Dilemma": Scheitern Humeaner daran, rationalisierende und unter idealen Bedingungen objektiv rechtfertigende Gründe zu etablieren, gelingt es umgekehrt ihren Gegnern nicht zu erklären, wie solche Gründe zum Handeln motivieren und unter idealen Bedingungen faktisch handlungswirksam werden können. Es scheint, daß Rationalisierung und Rechtfertigung durch praktische Gründe auf der einen und Motivation und Erklärung von Handlungen auf der anderen Seite einander wechselseitig ausschließen. Dann aber kann es das gesuchte Handeln aus Gründen nicht geben. Werden nun erstens evaluative Wünsche als Emotionen gedeutet und zweitens Emotionen nicht auf Werturteile reduziert, sondern als intrinsisch motivierende affektive Bewertungen analysiert, scheint sich ein Ausweg aus dem Dilemma abzuzeichnen. Indem Emotionen evaluative Repräsentationen der Welt beinhalten, ist die Möglichkeit eröffnet, daß ihr repräsentationaler Inhalt korrekt und das Subjekt dement- sprechend berechtigt sein kann, auf ihn zu bauen. Auf diese Weise könnten Emotionen ihr Subjekt mit objektiven Handlungsgründen ausstarten, sei es unmittelbar, indem sie selbst diese Gründe bereitstellen, oder sei es mittelbar, indem sie ein normatives Urteil rechtfertigen. Beispielsweise könnte sich jemand zu Recht über eine harte Bestrafung empören, aufgrund der Empörung urteilen, daß die Bestrafung ungerecht ist, um dann im Ausgang hiervon korrekt zu schlußfolgern, daß er etwas gegen die Bestrafung unternehmen sollte. In diesem Fall würde die Handlung durch das normative Urteil nicht nur aus der Perspektive des Subjekts rational gemacht (rationalisiert), sie wäre auch objektiv gerechtfertigt. Zudem hätte mit der Emotion selbst auch das auf sie gegründete normative Urteil notwendigerweise motivierende Kraft. Diese verdankt sich der zwischen Emotion und Urteil bestehenden Rechtfertigungsbeziehung, die zwischen beiden eine notwendige Verknüpfung herstellt und aufgrund deren die motivierende Kraft sich von der Emotion auf das Urteil überträgt. 8 Dominik Perler: Was uns mit der Welt verknüpft Gefühle liegen noch vor den Begriffen, doch gerade deshalb sind sie kognitiv von Bedeutung. Augustinus berichtet in seinen Bekenntnissen, er sei nach dem Tod des besten Freundes von tiefer Trauer erfasst worden. Sein Herz sei "von Gram verdüstert" worden, und überall habe er nur noch Zeichen des Todes gesehen. Empfand er in dieser Situation einfach ein körperliches Gefühl? Oder befand er sich auch in einem kognitiven Zustand? Nahm er die Welt plötzlich ganz anders wahr? Diese Fragen wurden bereits im Mittelalter intensiv diskutiert und stehen auch heute wieder im Zentrum philosophischer Debatten. Spätestens seit der "kognitiven Wende" ist deutlich geworden, dass es unangebracht wäre, Emotionen als irrationale Gefühle den rationalen Zuständen gegenüberzustellen. Emotionen bestimmen vielmehr, wie wir uns kognitiv verhalten - wie wir Gegenstände in der Welt sehen, aber auch, wie wir sie bewerten und einordnen. [...] Besonders anschaulich zeigt dies Jörg Tellkamp in seinem Beitrag zu Albert dem Großen. Er verdeutlicht, dass es bereits im 13. Jahrhundert einen naturalistischen Erklärungsansatz gab. Albert argumentierte nämlich, dass Emotionen durch natürliche Wahrnehmungsprozesse und Bewertungen zustande kommen, die sich auch bei Tieren finden. Wenn etwa ein Schaf einen Wolf als gefährliches Tier sieht, gerät es in Furcht. Dazu benötigt es keine Begriffe und keine Urteile. Es reicht, dass es den grimmigen Wolf in einer bestimmten Hinsicht erfasst und dadurch einen Zugang zu bestimmten Eigenschaften erhält. Alberts Beispiel ist faszinierend, weil es verdeutlicht, dass für eine Emotion zwar mehr als ein vages Gefühl erforderlich ist, aber weniger als ein vollständiges Urteil. Es ist, modern ausgedrückt, eine evaluative Wahrnehmung notwendig - nicht nur bei Tieren, sondern auch bei uns Menschen. Auch wir geraten häufig in Freude oder Furcht, weil wir Dinge als gut oder schlecht für uns wahrnehmen. Dies wiederum beeinflusst die Werturteile und Überzeugungen, die wir dann bilden. Daher sind Emotionen aufs engste mit unseren rationalen Einstellungen verbunden oder legen sogar die Grundlage für sie. [...] Wie Sabine Döring in ihrer Einleitung zu den siebzehn treffsicher ausgesuchten Beiträgen zeigt, suchen auch heutige Autoren einen Mittelweg zwischen zwei Extrempositionen. Einerseits distanzieren sie sich von der traditionellen "feeling"-Theorie, die auf William James zurückgeht. Emotionen sind nicht bloße Gefühle, die gleichsam tief im Körper stecken, aber keine Informationen über die Welt außerhalb des eigenen Körpers vermitteln. Sie beziehen sich meistens auf äußere Gegenstände und stellen sie auf eine bestimmte Weise dar. Andererseits verwerfen die meisten Gegenwartsautoren ebenso entschieden den starken Kognitivismus, der noch vor zwei bis drei Jahrzehnten die Debatten beherrschte. Emotionen dürfen nämlich nicht mit Urteilen gleichgesetzt werden. Sie können sich gelegentlich sogar Urteilen widersetzen. Selbst wer urteilt, dass Spinnen keine gefährlichen Insekten sind, kann sie spontan als etwas Widerliches wahrnehmen und sich vor ihnen fürchten. Wie sind Emotionen dann zu charakterisieren? Wohl am ehesten als "gefühlte Aspekt-Wahrnehmungen", wie Döring überzeugend argumentiert: Als Wahrnehmungen weisen sie eine objektive Dimension auf - die Furcht zeigt die Gefahr an, die tatsächlich vom Wolf ausgeht -, als Gefühle aber auch eine subjektive (uns wird unweigerlich mulmig zumute, wenn wir vor dem Wolf stehen). Eine Reihe von Beiträgen zeigt diese zweifache Dimension auf und verdeutlicht, dass Emotionen gleichsam janusköpfige Zustände sind. Indem sie auf Gegenstände und ihre besonderen Aspekte aufmerksam machen, richten sie unsere Aufmerksamkeit nach außen und ermöglichen uns einen besseren Zugang zur Welt. Würden wir uns nie fürchten oder freuen, wüssten wir viel weniger über die Dinge, denen wir täglich begegnen. Wir würden höchstens über Umwege in Erfahrung bringen, ob sie nützlich oder gefährlich, gut oder schlecht für uns sind. Indem uns Emotionen aber 9 auch auf die Wirkungen aufmerksam machen, die diese Dinge in uns auslösen, lenken sie uns auch nach innen und zeigen körperliche Veränderungen an. Der umfangreiche Sammelband bietet nicht nur eine Fülle von Detailuntersuchungen zum kognitiven Gehalt der Emotionen, zu ihrer Phänomenologie und ihrer Verankerung im Körper. Er zeigt auch auf anschauliche Weise, welche Fortschritte in den analytischen Debatten der letzten zwei Jahrzehnte erzielt wurden. Die lange Zeit beliebten, aber häufig ermüdenden Fingerübungen zum sprachlichen Gebrauch von Emotionsausdrücken sind ebenso verschwunden wie die reinen Begriffsanalysen. Auch vom Zwang zur Formalisierung haben sich die meisten Autoren befreit. Alle bemühen sich um eine genaue Phänomenbeschreibung und um einen Dialog mit den empirischen Wissenschaften. Resultate der neueren psychologischen Forschung fließen ebenso in die Analysen ein wie biologische und sozialwissenschaftliche Untersuchungen. Philosophie ist wieder mit den Wissenschaften vernetzt - nicht als Königsdisziplin über ihnen thronend, aber auch nicht als Hilfswissenschaft unter ihnen dienend. Erfreulicherweise ist auch das philosophische Lagerdenken verschwunden. Wer sich am analytischen Gespräch beteiligt, kann heute Sartre ebenso zitieren wie Wittgenstein, Thomas von Aquin genauso wie Frege, ohne von den Kollegen geächtet zu werden. Wichtig ist einzig und allein das erhellende Argument. Einige Autoren im Band, die untersuchen, was denn unter dem Guten oder Schlechten zu verstehen sei, das in einer Emotion wahrgenommen wird, stellen sogar einen Bezug zu klassischen Werttheoretikern wie Meinong und Scheler her. Es ist zu hoffen, dass diese Beschäftigung mit vernachlässigten Klassikern fortgesetzt wird und so ein weiteres Feld für die analytische Philosophie erschlossen wird. F.A.Z., 29.10.2009, Seite 36 10 E. Weber Guskar: Der Duft von frischem Gebäck hilft unserer Tugend Quelle: Süddeutsche Zeitung Nr.52, Donnerstag, den 04. März 2010 , Seite 14 Orte der direkten Vermittlung zwischen Wissenschaft und einem breiteren Publikum gibt es nicht viele, aber es gibt sie. Beispiele dafür sind öffentliche Vorlesungsreihen an Universitäten, wie sie insbesondere in den USA üblich sind, wo das Stiftungswesen für die Finanzierung sorgt. Das neue Buch des in Princeton lehrenden Professors Kwame Anthony Appiah basiert auf einer solchen Veranstaltung. In den "Mary Flexner Lectures" stellt er sich einem derzeit kursierenden Zweifel, der die gegenwärtige Moralphilosophie betrifft: Ob die Philosophie die Erkenntnisse der Naturwissenschaften genügend berücksichtige. Unter dem Titel "Ethische Experimente. Übungen zum guten Leben" hat er sich zum Ziel gesetzt, "die Arbeit des Moralphilosophen mit der Tätigkeit von Wissenschaftlern aus einigen anderen Fachgebieten und mit den Fragen ganz gewöhnlicher, nachdenklicher Menschen zu verknüpfen". Appiah untersucht also, wie viel die empirischen Wissenschaften (Psychologie, Sozialwissenschaften, Ökonomie) zu den Diskussion der Moralphilosophie beitragen können und sollten, auf dass man von ihnen gemeinsam von "moral sciences" sprechen könne - wie es im übrigen vor der Mitte des letzten Jahrhunderts üblich gewesen sei. Seine Antwort ist: mehr, als einige Philosophen des zwanzigsten Jahrhunderts zuzugeben bereit gewesen wären - aber doch nicht soviel, dass man ein "Ende der Ethik" - wie seine Vorlesung ursprünglich einmal hieß - ausrufen müsste. Dabei geht es vor allem darum zu klären, was eine philosophische Fragestellung ist und was eine rein empirische. Im Detail beschäftigt sich Appiah mit drei Einwänden, die von den traditionell experimentellen Wissenschaften gegen die Philosophie vorgebracht werden oder werden könnten. Und jedes Mal zeigt er, dass und warum solche Experimente zwar wichtige Hinweise geben, sie aber dennoch nie hinreichen für die Antworten, die wir in der Moralphilosophie suchen. Da ist zum einen die Kritik an einer These einer bestimmten Richtung der Moralphilosophie, der Appiah unter anderem zuneigt: der Tugendethik. Für die Tugendethik spielt das Konzept des Charakters des Menschen eine zentrale Rolle. Denn moralisch gut ist und handelt ein Mensch, der einen tugendhaften Charakter hat, das heißt einer, der die Tugenden der Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, des Muts besitzt, also über stabile Handlungsdispositionen dieser Art verfügt: Wenn er sieht, dass jemand Hilfe braucht, hilft er. Die moderne Psychologie aber hat aufgrund von Experimenten ein Bild des menschlichen Charakters entwickelt, das dieser Idee zu widerstreiten scheint. Statt aus grundsätzlicher Hilfsbereitschaft, so sagt sie, handeln die Menschen vielmehr abhängig davon, ob sie gerade selbst vorher eine positive Erfahrung gemacht haben, wozu aber auch moralisch so irrelevante gehören, wie großer Lärm oder der gute Duft von frischem Gebäck. Die Motivationen sind immer situationsbezogen, und nicht von einem einheitlichen stabilen Charakter abhängig, heißt es. Deshalb, so die Kritik, gebe die Tugendethik ein unerreichbares Ziel vor und könne nicht richtig sein, da sie ein falsches Bild vom Menschen habe. 11 Appiah vermittelt zwischen den Positionen auf vielerlei Weise und kommt zum Schluss, dass man von einem Ideal nicht einfach deshalb abrücken dürfe, weil es schwer zu erreichen sei. Dennoch müsse man die Hinweise ernst nehmen und die Bedeutung der Situation angemessen berücksichtigen. Das heißt zum Beispiel auch zu fordern, dass man "bessere Bedingungen dafür schaffe, dass wir nicht tun, was Mörder tun, und dass wir nicht sind, wie Mörder sind." Eine andere Diskussion dreht sich nicht um einen einzelnen Punkt, sondern betrifft eine Kritik an der Methode der Moralphilosophie überhaupt: Psychologen stellen die Rolle der Intuitionen in Frage, auf die die Philosophen angewiesen sind. Denn Intuitionen darüber, was gut oder schlecht ist, erwiesen sich in Untersuchungen als widersprüchlich und täuschungsanfällig. Der Framing-Effekt beispielsweise zeige, dass solche Intuitionen stark von der Weise abhängen, in der ein Entscheidungsszenario präsentiert wird: Ob etwa die Anzahl der wahrscheinlich Toten oder der wahrscheinlich Geretteten bei einer bestimmten Impfstrategie im Vordergrund stehen, je nachdem tendierten die Probanden zu einem anderen Vorgehen. Appiah schlägt wiederum vor, den Hinweis ernst zu nehmen, sieht aber wieder keinen Grund, die Methode deshalb aufzugeben. Mit Intuitionen müsse man einfach wie mit Wahrnehmungen umgehen, die uns ebenfalls täuschen können: Sobald etwas blau aussieht haben wir einen pro-tanto Grund dafür zu glauben, dass es blau sei. Genauso sollten wir zunächst für gut halten, was uns gut erscheint - auch wenn wir dies unter Umständen revidieren müssen. Insgesamt plädiert Appiah also immer für einen "dritten Weg" - den zwischen einer völligen Autonomie der Ethik auf der einen und einem reinen Naturalismus auf der anderen Seite. Er betont, dass "das Verhältnis zwischen der Erforschung der Moral und neuen empirischen Entdeckungen eine offene Frage bleiben" müsse, da es weder eine Ethik ohne Wissen um menschliche Fähigkeiten geben könne, noch eine Naturwissenschaft ganz ohne Wertung. [...] 12 Eva Weber-Guskar: Die Klarheit der Gefühle (E. Weber-Guskar: Die Klarheit der Gefühle. Berlin, New York. 2009. S. 258 f.) Einen letzten zusammenfassenden Blick noch einmal allein auf das Thema, diesseits des Ausblicks: Über die einzelnen im Detail ausgeführten Punkte, in denen ich das Verstehen von Gefühlen erläutert habe, die eigenen wie die anderer, zieht sich ein Merkmal hinweg. Etwas, das ich die Zerbrechlichkeit jedes Verstehenserfolgs in diesem Bereich nennen möchte. Erstens verläuft Verstehen hier über die Schritte der verschiedenen Hinsichten und in jeder selbst noch einmal immer in Graden. Manchmal merkt man, dass man erst am Anfang steht, dass das Verständnis noch recht vage ist und es noch tiefer werden könnte. Manchmal meint man, schon ganz verstanden zu haben, und plötzlich sieht man, das war noch nicht alles, es geht noch vielschichtiger. Für das Verstehen der Gefühle anderer hängt das besonders daran, dass es Ähnlichkeit und Phantasie braucht. Ähnlichkeit in den Gefühlserlebnissen und Phantasie zum Überwinden der Unterschiede. Beides sind Bausteine für eine zerbrechliche Brücke zum anderen, weil gewisse Unwägbarkeiten bleiben. Ist es wirklich das, was der andere fühlt? Für das Verstehen eigener Gefühle ergibt sich die Zerbrechlichkeit aus dem Einfluss, den man verstehend auf seine eigenen Gefühle nimmt. Es ist eine komplizierte Suche nach Kohärenz zwischen Authentizität, Aufrichtigkeit und eingreifender Selbstbestimmung. Einerseits dürfen und können wir unsere Prägung, die sich in den Gefühlen zeigt, nicht als Teil unserer selbst leugnen, andererseits tendieren wir dazu und ist es auch sinnvoll im Leben, Gefühle in Einklang mit Überzeugungen bzw. vor allem reflektierten Werten zu bringen, und so gehört diese Aktivität gegenüber den Gefühlen dazu. Das bedeutet aber auch, dass Emotionen zu haben und sie zu verstehen in einem ständigen, letztlich nie abgeschlossenen Prozess miteinander verbunden ist. Deshalb: Klarheit über die Gefühle eines anderen zu erhalten braucht nicht nur Entdeckung, sondern auch Phantasie. Klarheit in eigenen Gefühlen zu erreichen braucht nicht nur Entdeckung, sondern auch Gestaltung. In beiden Fällen sind gewisse Unwägbarkeiten enthalten - ob die Phantasie trifft, ob die Gestaltung nicht fehl geht und ob oder wo sie überhaupt an ein Ende kommt. So bleibt die Klarheit über Gefühle immer eine fragile. 13 Argumente der Gefühlsethik 1. Das erkenntnistheoretische Argument (Hume) Es gibt keine Erkenntnis a priori, die Welt ist uns nur über die Sinne zugänglich, alle Urteile beruhen auf Erfahrung. Es gibt keine "Kausalität aus Freiheit", denn weder sind wir frei, noch ist Kausalität eine Kategorie a priori, sie beruht nur auf Analogieschlüssen, gewohnheitsmäßiger Verbindung von Umständen, die stets gemeinsam auftreten. Ursachen und Wirkungen sind strukturell unterschiedlich: durch logisches Denken kann man nicht von Ursachen auf Wirkungen schließen. Bei allem Urteilen sind also Gefühle im Spiel. 2. Das motivationstheoretische Argument (Hutcheson, Hume, Schopenhauer) Zum Sollen muss ich gewillt sein und das Motiv des Wollens ist stets ein Gefühl. Die Vernunftethik kann nicht aus sich begründen, warum ich vernünftig handeln soll. Die Vernunft kann nur ZweckMittel-Beziehungen erkennen, Folgen abschätzen – aber die Bewertung als 'Gutes', Nützliches kann nur ein Gefühl leisten. Vernunft bewertet nicht, das tun nur Gefühle, aber Bewertung ist die Grundlage für moralisches Handeln. 3. Das nonkognitivistische sprachlogische Argument (Wittgenstein, Stevenson) Moralische Sätze sind Imperative, ohne Wahrheitsanspruch. Ob ich dem Imperativ folge, hängt von der emotionalen Einstellung und Verfassung desjenigen ab, dem der Imperativ gilt. Moralische Sätze sind nicht wahr, sie können nur wirken – und das hängt von einem Gefühl ab. 4. Das logische Argument (Moore) Nur eine Gefühlsethik vermeidet den naturalistischen Fehlschluss: wenn Sein und Sollen über ein moralisches Gefühl vermittelt sind, muss ich nicht behaupten, das Sollen ergebe sich 'logisch' aus dem Sein. 5. Das Argument des Altruismus (Frankfurt, Horster) Wenn nur das Vernünftige moralisch wäre, gäbe es keinen unvernünftigen Altruismus – der ist aber allgegenwärtig: Ständig tun Menschen Gutes, obwohl es jeder utilitaristischen Güterabwägung oder kategorischen Maximenethik widerspricht. Das unvernünftige Gute als nicht-moralisch zu qualifizieren, widerspricht jedem moralischen common-sense. Die supererogatorischen Handlungen sind das bekannteste Beispiel für unvernünftiges aber moralisches Handeln. Auch alles moralische Handeln aus Liebe gehört hierher, Liebe begründet unmittelbar Handlungen. 6. Das phänomenologische Argument Die große Bandbreite an positiven, negativen, selbst- und fremdbezüglichen, starken und schwachen moralischen Gefühlen legt es nahe, sie als hinreichendes, differenziertes moralisches Bewertungssystem zu betrachten, das ohne rationale Kognition auskommt. Moralische Gefühle sind charakterbildend: starke Scham- oder Stolz-Situationen werden lebenslang erinnert und prägen die Identität. 14 7. Das empirische Argument (Nunner-Winkler, Keller) Empirische Untersuchungen bestätigen, dass moralische Normkenntnis und ihre Begründungen noch nichts über moralische Bewertung aussagen. Kinder entwickeln Empathie mit Opfern und Empörung über Täter erst Jahre, nachdem sie die moralischen Normen kennen. Empirische Forschungen zeigen auch: Menschen handeln moralisch, wenn sie sich gut und sicher fühlen, eher nicht-moralisch bei negativer Gefühlslage. 8. Das Argument der Universalisierbarkeit (A. Smith, Fehige) Moralische Gefühle werden nicht nur gegenüber dem konkreten Anderen aktiviert, sondern, da sie Vorstellungen und nicht nur Affekte sind und Einstellungen prägen, gelten sie auch dem abstrakten Anderen. Der "unparteiische Beobachter" (Smith) in mir, bewertet meine Handlungen gegenüber Jedem. Wenn etwas alle Menschen verbindet, dann die Existenz moralischer Gefühle. Das Mitleidsgefühl ist so elementar in allen Menschen verankert, dass es als 'Gefühl a priori' gelten kann und damit jenen Status einnimmt, den Kant dem rationalen Urteil vorbehalten will. Die Erfahrung von "Empathie a priori" weist einen dritten Weg zwischen Kant – nur Vernunfturteile können a priori gefällt werden – und Hume – es gibt nur Urteile a posteriori. 9. Das Argument der Autonomie (Schopenhauer, Tugendhat) Eine moderne Moralbegründung darf sich nicht – heteronom – auf Autoritäten stützen, wie 'Gott' oder die 'reine Vernunft', an die man glauben muss, sondern muss – autonom – die Frage beantworten, warum ich selbst mich moralisch verhalten will. Das gelingt – neben dem Kontraktualismus - nur einer Mitleidsethik, die von einer natürlichen Empathiebereitschaft ausgeht. 10. Das psychologisch-naturalistische Argument (Freud, Damasio, J. Bauer) Die handlungssteuernde Wirkung von Scham-, Schuld- und Stolzgefühlen lassen sich psychologisch aus frühkindlichen Beziehungsmustern erklären. (Freud) Die Existenz einer natürlichen Veranlagung zur Empathiefähigkeit wird durch die Entdeckung der Spiegelneuronen neuronal erhärtet: Es 'feuern' bei mir die gleichen Neuronen wie beim anderen, der eine Gefühlsregung zeigt. (J. Bauer) Somatische Marker bilden ein gefühlsmäßiges Bewertungs- und Selektionssystem im Gehirn, das Handlungsalternativen neuronal steuert und aussiebt. Das gefühlsmäßig negativ Bewertete kommt in Entscheidungssituationen gar nicht zur 'Entscheidungsvorlage'. (A. Damasio) 11. Das entwicklungspsychologische Argument (Hoffman) Die Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit ist nicht nur ein Prozess der kognitiven Reifung, wie ihn Kohlberg in seinem Stufenmodell beschrieben hat, vielmehr läuft entsprechend, aber deutlich früher ansetzend, ein Prozess der emotionalen Reifung. Es entfaltet sich die Empathiefähigkeit des Menschen von einer elementaren symbiotischen Empathie, die schon das Neugeborene durch Körperkontakt empfindet, über mehrere Zwischenstufen bis zum Gefühl der Solidarität, das Jugendliche entwickeln. 15 EINIGE GEFÜHLSETHIKER Francis Hutcheson (1694--1747), wichtige Schrift: „Untersuchung über den Ursprung von Schönheit und Tugend“ (1733), versteht „moral sense“ als natürliche Empfindung der Billigung und Missbilligung von Handlungen; Behagen bei wohltätigen Handlungen anderer erzeugt Sympathiegefühl; der „moral sense“ dient Hutcheson als Argument gegen Hobbes’ Egoismus-Konzeption des Menschen. David Hume (1711-1776) Ein Traktat über die menschliche Natur (1739) Alle Erkenntnis beruht auf sinnlicher Wahrnehmung, Gewöhnung, Analogieschlüssen und Erfahrung; "synthetische Urteile a priori" (Kant) sind unmöglich; Vernunft als "Sklavin der Affekte" kann keine moralische Handlung a priori motivieren; Mensch lernt, aus Erfahrung, seine natürliche Sympathiefähigkeit richtig einzusetzen Jean-Jacques Rousseau (1712--1778), wichtige Schrift: „Abhandlung über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen“ (1755), nimmt Mitleidsfähigkeit als Naturgabe beim „edlen Wilden“ an, bei Tieren sei sie vorgebildet, durch Zivilisation irritiert und verschüttet; Mitleidsfähigkeit „passt“ zur Schwäche der menschlichen Natur; was für den modernen Menschen die moralischen Regeln, ist beim Naturmenschen das natürliche Mitleid. Adam Smith (1723--1790), wichtige Schrift: „Theorie der ethischen Gefühle“ (1759), erscheint natürliche „Sympathie“ als positives und negatives Mitfühlen mit der Lage des Anderen; Sympathie ist aber kein reflexhaftes Mitfühlen der Affekte, sondern Reaktion auf die Ursache für die Lage des anderen: Sympathie entspringt aus dem Anblick der Situation, die den Affekt auslöst. Der Mensch besitzt also die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung: Ich kann, wie ein „unparteiischer Zuschauer“ , auch eigene Handlungen emotional billigen oder missbilligen. Smith bietet damit eine Moralbegründung zwischen Vernunft und Gefühl: „Handle so, dass ein unparteiischer Betrachter deine Handlung gefühlsmäßig billigen könnte“ – so könnte ein „kategorischer Imperativ“ nach A. Smith lauten. Arthur Schopenhauer (1788-1860) Die Metaphysik der Sitten (1820) Fast alle scheinbar altruistischen Motive sind in Wahrheit egoistisch motiviert; Nur Handlungen aus Mitleid sind moralische Handlungen; Mitleid = Projektion eigener Befindlichkeit, = Identifikation mit dem "Wohl und Wehe" des anderen; einziges Korrektiv für extremen Egoismus; als Projektion eigenen Leids bleibt Mitleid kompatibel mit egoistischem Menschenbild. Vertrauen auf Pflichtbewusstsein und Vernunftappell als moralische Antriebe sind so wirkungslos wie eine "Klistierspritze gegen eine Feuersbrunst". Max Scheler (1874--1928), wichtige Schrift: „Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik“ (1913), meint, dass der Mensch im „intentionalen Fühlen“ unmittelbar ein System von Werten erlebt: sinnliche (angenehm – unangenehm), vitale (edel – gemein), geistige (recht – unrecht, wahr – falsch). Die Werte sind a priori gegeben, ihr Fühlen geschieht intuitiv und natürlich; Liebe und Hass bilden die emotionale Basis der Werterkenntnis. Die Objektivität der Werte beruht auf unserem Unbedingtheitsanspruch an ihre Gültigkeit, sie existieren damit nicht ohne menschliche Erkenntnis. Nicolai Hartmann (1882--1950), wichtige Schriften: „Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis“ (1921), „Ethik“ (1928). Werte sind von menschlicher Erkenntnis unabhängige Wesenheiten, sie existieren, wie mathematische Formeln, objektiv. In einer „Wesensschau“ erfasst der Mensch die Werte sinnlich, emotionalintuitiv und handelt entsprechend. Die Werte sind den Ideen Platons vergleichbar, sie gehören zur Welt und existieren auch ohne dass Menschen sie erkennen. Richard Rorty (1931--2007), wichtige Schriften: „Der Spiegel der Natur“ (1979), „Wahrheit und Fortschritt“ (2000), sieht eine pragmatische Verbindung von sozialer Lage und Fähigkeit zur Empathie: „Geborgenheit und Mitgefühl gehen miteinander einher.“ Normative Imperative bewirken keinen moralischen Fortschritt; die Menschenrechtskultur lässt sich nur durch Schulung der Empathiefähigkeit verbreiten: „Die Schule der Empfindsamkeit und des Mitgefühls funktioniert nur bei Leuten, die es sich lange genug bequem machen 16 können, um zuzuhören.“ Die Empathiefähigkeit wird durch Kunst und Medien – Romane, Filme – eher befördert als durch moraltheoretische Abhandlungen. Die Lektüre von „Onkel Toms Hütte“, so Rorty, habe mehr moralischen Fortschritt gebracht als 200 Jahre Kant-Lektüre. Carol Gilligan (* 1936), wichtige Schrift: „Die andere Stimme“ (1982), ist die Begründerin der Care-Ethik: Eine Ethik der (weiblichen) Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und des Einfühlens in den Anderen; reale Beziehungen sind oft asymmetrisch, dabei besteht keine Möglichkeit zur prinzipiengeleiteten, autonomen Entscheidung oder Reziprozität; die Bereitschaft zu helfen, den anderen als Bedürftigen zu achten ist oft wichtiger; da Frauen stärker zu Achtsamkeit, Umsicht und Wahrnehmen von Alternativen sozialisiert und disponiert sind, fallen ihnen „Care-Interaktionen“ leichter. 17 Francis Hutcheson: "Moral sense"(1726) (Francis Hutcheson, Über den Ursprung unserer Ideen von Schönheit und Tugend, Hamburg 1986, S. 29 f.) Wenn das Gesagte klarmacht, daß wir eine andere liebenswerte Idee von Handlungen haben als die unseres eigenen Vorteils, so können wir schließen, daß diese Wahrnehmung des moralisch Guten sich nicht aus Gewohnheit, Erziehung, Beispiel oder Übung herleitet. Diese vermitteln uns keine neuen Ideen. Durch einen sauberen Vernunftschluß oder auch durch ein unbesonnenes Vorurteil lassen sie uns bei Handlungen, deren Nützlichkeit nicht sofort sicht- bar wurde, unseren eigenen Vorteil sehen, oder vermitteln uns Auffassungen schädlicher Folgen von Handlungen, wenn wir der Tat auf den ersten Blick solches nicht angesehen haben sollten. Aber sie könnten uns niemals veranlassen, daß wir Handlungen ohne irgendwelche Erwägungen unseres Vorteils als liebenswert oder als häßlich auffassen. Damit bleibt übrig: So wie der Schöpfer der Natur uns bestimmt hat, durch unsere äußeren Sinne erfreuliche oder unangenehme Ideen von Objekten zu empfangen, je nachdem, ob sie für unseren Leib nützlich oder schädlich sind, und durch gleichmäßige Objekte die Freude der Schönheit und Harmonie zu empfangen, um unser Streben nach Erkenntnis anzuregen, oder zu belohnen, […] so hat er uns in gleicher Weise einen Moralsinn ("moral sense") gegeben, um unser Handeln zu lenken und uns noch edlere Freuden zu schenken, so daß wir unbeabsichtigt unser größtes persönliches Wohl fördern, in dem wir allein auf das Wohl anderer abzielen. Wir dürfen uns nicht vorstellen, daß dieser Moralsinn mehr als die anderen Sinne irgendwelche angeborenen Ideen voraussetzt. Wir verstehen unter ihm nur eine Veranlagung unseres Geistes, liebenswerte oder unangenehme Ideen von Handlungen zu empfangen, wenn diese zu unserer Beobachtung gelangen, unabhängig von irgendeiner Auffassung von Vorteil oder Verlust, den wir aus ihnen ernten könnten. 18 David Hume: Affekte und Moral (Aus: D. Hume: Über Moral. Kommentar v. H. Pauer-Studer. Ffm. 2007. S. 16 f) Vernunft ist die Erkenntnis von Wahrheit und Irrtum. Wahrheit und Irrtum aber besteht in der Übereinstimmung bzw. Nichtübereinstimmung entweder mit den wirklichen Beziehungen der Vorstellungen oder mit dem wirklichen Dasein und den Tatsachen. Was also einer solchen Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung überhaupt nicht fähig ist, kann weder wahr noch falsch und demnach niemals Gegenstand unserer Vernunft sein. Nun sind augenscheinlich unsere Affekte, unsere Willensentschließungen und unsere Handlungen einer solchen Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung nicht fähig; sie sind ursprüngliche Tatsachen und Wirklichkeiten, in sich selbst vollendet, ohne Hinweis auf andere Affekte, Willensentschließungen und Handlungen. Man kann also unmöglich von ihnen sagen, daß sie richtig oder falsch sind, der Vernunft entsprechen oder ihr widerstreiten. Diese Beweisführung hat eine doppelte Tragweite für unser gegenwärtiges Thema. Sie beweist direkt, daß der Wert unserer Handlungen nicht in ihrer Übereinstimmung mit der Vernunft und ihr Unwert nicht in ihrer Vernunftwidrigkeit besteht; sie beweist ferner dieselbe Wahrheit auch noch in etwas indirekterer Weise. Sie zeigt uns, daß die Vernunft nicht Quelle unserer Begriffe des moralisch Guten oder des moralisch Bösen sein kann, da sie durch ihren Widerspruch oder durch ihre Zustimmung niemals unmittelbar eine Handlung verhindern oder hervorrufen kann, während unser Bewußtsein des moralisch Guten und des moralisch Bösen diese Wirkung hat. Handlungen können lobenswert oder tadelnswert, nicht aber vernünftig oder unvernünftig sein. Lobenswert und tadelnswert ist also nicht gleichbedeutend mit vernünftig und unvernünftig. Das Bewußtsein des Wertes oder Unwertes von Handlungen widerspricht häufig unseren natürlichen Neigungen, und zuweilen hält es dieselben im Zaum. Die Vernunft aber hat keinen solchen Einfluß. Moralische Unterscheidungen sind daher keine Erzeugnisse der Vernunft. Die Vernunft ist gänzlich passiv und kann darum niemals die Quelle eines so aktiven Prinzips sein, wie es das Gewissen oder das moralische Bewußtsein sind. 19 David Hume: Von den Motiven des Willens (Aus: D. Hume: Traktat über die menschliche Natur. Bd. II. Hamburg 1978. S. 150 f) Keine Rede ist in der Philosophie und auch im eigentlichen Leben üblicher, als die Rede von dem Kampf zwischen Affekt und Vernunft. Dabei gibt man der Vernunft den Vorzug, und behauptet, daß die Menschen nur insoweit tugendhaft seien, als sie sich ihren Geboten fügen. Jedes vernünftige Geschöpf, sagt man, soll seine Handlungen nach seiner Vernunft ein- richten; wenn irgendein anderes Motiv oder Prinzip die Leitung seines Tuns beansprucht, so soll es dies Motiv so lange bekämpfen, bis dasselbe völlig unterdrückt ist oder wenigstens mit jenem höheren Prinzip sich in Einklang gesetzt hat. Auf dieser Denkweise scheint in der Regel die Moralphilosophie, die alte und die moderne, zu beruhen. Es gibt kein reicheres Feld, sowohl für metaphysische Argumente, als auch für populäre Deklamationen, als dieser angebliche Vorrang der Vernunft vor den Affekten. Dabei hat man die Ewigkeit, Unwandelbarkeit und den göttlichen Ursprung der Vernunft im hellsten Lichte erscheinen lassen. Ebenso stark ist die Blindheit, Verderblichkeit und das Irreführende der Affekte hervorgehoben worden. Um die Hinfälligkeit dieser ganzen Philosophie zu zeigen, werde ich versuchen, zu beweisen, erstens, daß die Vernunft allein niemals Motiv eines Willensaktes sein kann; zweitens, daß dieselbe auch niemals hinsichtlich der Richtung des Willens den Affekt bekämpfen kann. [...] Da die Vernunft allein niemals eine Handlung erzeugen oder ein Wollen auslösen kann, so schließe ich, daß dieses Vermögen auch nicht imstande ist, das Wollen zu hindern oder mit irgend einem Affekt oder einem Gefühl um die Herrschaft zu streiten. Dies ist eine notwendige Folge [des soeben Gesagten] Es ist ausgeschlossen, daß die Vernunft die letztere Wirkung, die Verhinderung unseres Wollens, anders vollbringe, als dadurch, daß sie uns einen Impuls nach der unserem Affekt entgegengesetzten Richtung gibt; wirkte dieser Impuls allein, so wäre er imstande, das Wollen hervorzurufen. Nichts aber kann den Impuls eines Affektes unterdrücken oder verzögern, als ein entgegengesetzter Impuls. Entspringt aber dieser entgegengesetzte Impuls aus der Vernunft, so muß dieses Vermögen auch einen ursprünglichen Einfluß auf den Willen haben und imstande sein, einen Willensakt ebenso wohl zu erzeugen wie zu verhindern. Umgekehrt, hat die Vernunft keinen solchen ursprünglichen Einfluß, so kann sie unmöglich einem Prinzip entgegenarbeiten, das eine solche Kraft besitzt und [sie kann] ebenso wenig den Geist auch nur einen Augenblick von der Entscheidung zurückhalten. Es erscheint demnach als das Prinzip, welches unserem Affekt entgegentritt, nicht die Vernunft selbst; dies Prinzip wird nur in uneigentlichem Sinne so genannt. Wir drücken uns nicht genau und philosophisch aus, wenn wir von einem Kampf zwischen Affekt und Vernunft reden. Die Vernunft ist nur der Sklave der Affekte und soll es sein; sie darf niemals eine andere Funktion beanspruchen, als die, denselben zu dienen und zu gehorchen. Da diese Ansicht etwas sonderbar klingen kann, mag es nicht unangebracht sein, wenn ich sie durch einige andere Betrachtungen bestätige. Ein Affekt ist ein originales Etwas, oder, wenn man will, eine Modifikation eines solchen, und besitzt keine repräsentative Eigenschaft, durch die er als Abbild eines anderen Etwas oder einer anderen Modifikation charakterisiert würde. Bin ich ärgerlich, so hat mich der Affekt tatsächlich ergriffen, und in dieser Gefühlserregung liegt so wenig eine Beziehung zu einem anderen [damit gemeinten oder dadurch repräsentierten] Gegenstand, als wenn ich durstig oder krank oder über fünf Fuß groß wäre. Es ist also unmöglich, daß dieser Affekt von der Vernunft bekämpft werden kann oder der Vernunft und der Wahrheit widerspricht. 20 David Hume: Verstand, Gefühl und Moral (Aus: D. Hume, Eine Untersuchung über die Prinzipien der Moral, Stuttgart (reclam) 1984, S. 222f.) Auch wenn der Verstand, falls er vollkommen ausgebildet und entwickelt ist, dafür ausreicht, um uns über die schädliche oder nützliche Tendenz von Eigenschaften oder Handlungen aufzuklären, genügt er dennoch nicht, um irgendeine moralische Ablehnung oder Zustimmung hervorzurufen. Nützlichkeit ist nichts anderes als eine Tendenz auf einen bestimmten Zweck hin; und wäre uns der Zweck gänzlich gleichgültig, so würden wir dieselbe Gleichgültigkeit auch gegenüber den Mitteln empfinden. Es ist erforderlich, daß sich hier ein Gefühl einstellt, damit den nützlichen gegenüber den schädlichen Tendenzen der Vorzug gegeben wird. Dieses Gefühl kann kein anderes sein als eine Sympathie mit dem Glück der Menschheit und eine Empörung über ihr Elend, da dies die verschiedenen Ziele sind, auf deren Förderung Tugend und Laster hinarbeiten. Hier gibt uns also der Verstand Aufschluß über die verschiedenen Tendenzen der Handlungen, und die Menschlichkeit macht eine Unterscheidung zugunsten derjenigen, die nützlich und wohltätig sind. [...] Da nun Tugend ein Endzweck und um ihrer selbst willen, ohne Entgelt oder Belohnung, lediglich um der unmittelbaren Befriedigung willen, die sie gewährt, erstrebenswert ist, so muß notwendigerweise irgendein Gefühl vorhanden sein, an welches sie rührt, eine innere Neigung oder ein inneres Empfinden, oder wie immer man es sonst nennen mag, das zwischen dem moralisch Guten und Bösen unterscheidet und das sich dem einen zuwendet und das andere verwirft. So sind also die getrennten Gebiete und Aufgaben des Verstandes und des Gefühls leicht zu bestimmen. Von jenem stammt das Wissen um Wahrheit und Falschheit; von diesem das Gefühl für Schönheit und Häßlichkeit, für Laster und Tugend. Der eine entdeckt Gegenstände, wie sie sich in Wirklichkeit in der Natur finden, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen; der andere besitzt eine produktive Kraft und bringt gleichsam eine neue Schöpfung hervor, indem er alle Gegenstände der Natur mit den Farben, die aus dem inneren Gefühl stammen, entweder vergoldet oder befleckt. Der Verstand, weil kühl und gleichgültig, liefert kein Handlungsmotiv und weist nur dem von Begierde oder Neigung empfangenen Impuls den Weg, indem er uns die Mittel zur Erreichung des Glücks und Vermeidung des Unglücks zeigt. Der Geschmack, da er Lust oder Unlust bringt und dadurch Glück oder Unglück schafft, wird zu einem Handlungsmotiv und ist der erste Antrieb oder Impuls zum Begehren oder Wollen. Von bekannten oder angenommenen Ereignissen und Relationen führt uns der erstere zur Entdeckung der verborgenen und unbekannten; nachdem alle Ereignisse und Relationen vorliegen, läßt uns der letztere aus dem Ganzen ein neues Gefühl des Tadels oder der Billigung empfinden. Der Maßstab des einen, weil auf der Natur der Dinge gegründet, ist ewig und unveränderlich, selbst für den Willen des höchsten Wesens; der Maßstab des anderen, weil aus der inneren Struktur und Beschaffenheit lebender Wesen entspringend, geht in letzter Instanz auf jenen höchsten Willen zurück, der jedem Wesen seine besondere Natur verliehen und die verschiedenen Klassen und Ordnungen des Seins eingerichtet hat. 21 Adam Smith: Von der Sympathie (1759) (Aus: A. Smith, Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 1926, 1. Teil, 1. Abs. Kap.1, S. 1 ff- Auszug) Mag man den Menschen für noch so egoistisch halten, es liegen doch offenbar gewisse Prinzipien in seiner Natur, die ihn dazu bestimmen, an dem Schicksal anderer Anteil zu nehmen, und die ihm selbst die Glückseligkeit dieser anderen zum Bedürfnis machen, obgleich er keinen anderen Vorteil daraus zieht, als das Vergnügen, Zeuge davon zu sein. Ein Prinzip dieser Art ist das Erbarmen oder das Mitleid, das Gefühl, das wir für das Elend anderer empfinden, sobald wir dieses entweder selbst sehen, oder sobald es uns so lebhaft geschildert wird, dass wir es nachfühlen können. Dass wir oft darum Kummer empfinden, weil andere Menschen von Kummer erfüllt sind, das ist eine Tatsache, die zu augenfällig ist, als dass es irgendwelcher Beispiele bedürfte, um sie zu beweisen; denn diese Empfindung ist wie alle anderen ursprünglichen Affekte des Menschen keineswegs auf die Tugendhaften und human Empfindenden beschränkt, obgleich diese sie vielleicht mit der höchsten Feinfühligkeit erleben mögen, sondern selbst der ärgste Rohling, der verhärtetste Verächter der Gemeinschaftsgesetze ist nicht vollständig dieses Gefühles bar. Da wir keine unmittelbare Erfahrung von den Gefühlen anderer Menschen besitzen, können wir uns nur so ein Bild von der Art und Weise machen, wie eine bestimmte Situation auf sie einwirken mag, dass wir uns vorzustellen suchen, was wir selbst wohl in der gleichen Lage fühlen würden. Mag auch unser eigener Bruder auf der Folterbank liegen - solange wir selbst uns wohl befinden, werden uns unsere Sinne niemals sagen, was er leidet. Sie konnten und können uns nie über die Schranken unserer eigenen Person hinaustragen und nur in der Phantasie können wir uns einen Begriff von der Art seiner Empfindungen machen. Auch dieses Seelenvermögen kann uns auf keine andere Weise davon Kunde verschaffen, als indem es uns zum Bewusstsein bringt, welches unsere eigenen Empfindungen sein würden, wenn wir uns in seiner Lage befänden. Es sind nur die Eindrücke unserer eigenen Sinne, nicht die der seinigen, welche unsere Phantasie nachbildet. Vermöge der Einbildungskraft versetzen wir uns in seine Lage, mit ihrer Hilfe stellen wir uns vor, dass wir selbst die gleichen Martern erlitten wie er, in unserer Phantasie treten wir gleichsam in seinen Körper ein und werden gewissermaßen eine Person mit ihm; von diesem Standpunkt aus bilden wir uns eine Vorstellung von seinen Empfindungen und erleben sogar selbst gewisse Gefühle, die zwar dem Grade nach schwächer, der Art nach aber den seinigen nicht ganz unähnlich sind. Wenn wir so seine Qualen gleichsam in uns aufnehmen, wenn wir sie ganz und gar zu unseren eigenen machen, dann werden sie schließlich anfangen, auf unser eigenes Gemüt einzuwirken und wir werden zittern und erschauern bei dem Gedanken an das, was er jetzt fühlen mag. [. ..] Dass dies die Quelle des Mitgefühls ist, welches wir gegenüber dem Elend anderer empfinden, dass wir erst dann, wenn wir mit dem Leidenden in der Fantasie den Platz tauschen, dazu gelangen seine Gefühle nachzuempfinden und durch sie innerlich berührt zu werden, das kann durch viele offenkundige Beobachtungen dargetan werden, wenn man es nicht schon an und für sich für genügend einleuchtend halten sollte. Wenn wir zusehen, wie jemand gegen das Bein oder den Arm eines anderen zum Schlage ausholt, und dieser Schlag eben auf den anderen niedersausen soll, dann zucken wir unwillkürlich zusammen und ziehen unser eigenes Bein oder unseren eigenen Arm zurück; und wenn der Schlag den anderen trifft, dann fühlen wir ihn in gewissem Maße selbst und er schmerzt uns ebenso wohl wie den Betroffenen. [. ..] Aber nicht nur solche Umstände, die Schmerz oder Kummer, hervorrufen, erwecken unser Mitgefühl. Der Affekt, der durch irgendeinen Gegenstand in der zunächst betroffenen Person erregt wird, mag vielmehr welcher immer sein, stets wird in der Brust eines jeden aufmerksamen Zuschauers bei dem Gedanken an die Lage des anderen eine ähnliche Gemütsbewegung entstehen. Unsere Freude über die Errettung jener Tragödien- oder Romanhelden, die unsere Anteilnahme erwecken, ist ebenso aufrichtig wie unser Kummer wegen ihrer Not, und das Mitgefühl mit ihrem Elend ist nicht wirklicher als das mit ihrem Glück. [. ..] Bei allen Affekten, deren das menschliche Gemüt fähig ist, entsprechen die Gemütsbewegungen des Zuschauers immer dem Bilde, das dieser sich von den Empfindungen 22 des Leidenden macht, indem er sich in dessen Fall hineindenkt. »Erbarmen« und »Mitleid« sind Wörter, die dazu bestimmt sind, unser Mitgefühl mit dem Kummer anderer zu bezeichnen. Das Wort »Sympathie«- kann dagegen, obgleich seine Bedeutung vielleicht ursprünglich die gleiche war, jetzt doch ohne Verstoß gegen den Sprachgebrauch dazu verwendet werden, um unser Mitgefühl mit jeder Art von Affekten zu bezeichnen. [. ..] Unsere Sympathie mit der Freude oder dem Kummer eines anderen wird immer äußerst unvollkommen sein, solange wir nicht mit den Ursachen dieser Affekte bekannt sind. Allgemeine Wehklagen, die nichts anderes zum Ausdruck bringen als die Qualen, die der Leidende empfindet, erwecken eher eine gewisse Neugierde in uns, den Wunsch, seine Lage kennen zu lernen, verbunden mit einer gewissen Geneigtheit, für ihn Sympathie zu empfinden, als ein wirklich deutlich erlebtes Gefühl der Sympathie. Die erste Frage, die wir stellen, ist: „Was ist dir widerfahren?“ Solange diese Frage nicht beantwortet ist, werden wir zwar ein gewisses Unbehagen fühlen, einerseits infolge der unklaren Vorstellung, die wir uns von seinem Unglück machen, noch mehr aber weil wir uns mit Vermutungen darüber quälen, was es wohl für ein Unglück gewesen sein mag - aber unser Mitgefühl für ihn wird nicht sehr beträchtlich sein. Sympathie entspringt also nicht so sehr aus dem Anblick des Affektes, als vielmehr aus dem Anblick der Situation, die den Affekt auslöst. 23 Adam Smith: Die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung (1759) (Adam Smith, Theorie der ethischen Gefühle, 3. Teil, 1. Kap. Hamburg (Meiner) 2004, S. 166 f) Das Prinzip, nach welchem wir unser eigenes Verhalten natürlicherweise billigen oder missbilligen, scheint ganz dasselbe zu sein wie dasjenige, nach dem wir die gleichen Urteile über das Betragen anderer Leute fällen. Wir billigen oder missbilligen das Verhalten eines anderen Menschen auf die Weise, dass wir uns in seine Lage hineindenken und nun unsere Gefühle darauf prüfen, ob wir mit den Empfindungen und Beweggründen, die es leiteten, sympathisieren können oder nicht. Und in gleicher Weise billigen oder missbilligen wir unser eigenes Betragen, indem wir uns in die Lage eines anderen Menschen versetzen und es gleichsam mit seinen Augen und von seinem Standort aus betrachten und nun zusehen, ob wir von da aus an den Empfindungen und Beweggründen, die auf unser Betragen einwirken, Anteil nehmen und mit ihnen sympathisieren könnten oder nicht. Niemals können wir unsere Empfindungen und Beweggründe überblicken, niemals können wir irgendein Urteil über sie fällen, wofern wir uns nicht gleichsam von unserem natürlichen Standort entfernen und sie aus einem gewissen Abstand von uns selbst anzusehen trachten. Wir können dies aber auf keine andere Weise tun, als indem wir uns bestreben, sie mit den Augen anderer Leute zu betrachten, das heißt so, wie andere Leute sie wohl betrachten würden. Demgemäß muss jedes Urteil, das wir über sie fällen können, stets eine gewisse unausgesprochene Bezugnahme auf die Urteile anderer haben, und zwar entweder auf diese Urteile, wie sie wirklich sind, oder, wie sie unter bestimmten Bedingungen sein würden, oder, wie sie unserer Meinung nach sein sollten. Wir bemühen uns, unser Verhalten so zu prüfen, wie es unserer Ansicht nach irgendein anderer gerechter und unparteiischer Zuschauer prüfen würde. Wenn wir uns erst in seine Lage versetzen und wir dann immer noch an allen Affekten und Beweggründen, die unser Verhalten bestimmten, durchaus inneren Anteil nehmen, dann billigen wir dieses Verhalten aus Sympathie mit der Billigung dieses gerechten Richters, den wir in Gedanken aufgestellt haben. Fällt die Prüfung anders aus, dann treten wir seiner Missbilligung bei und verurteilen unser Verhalten. Wäre es möglich, dass ein menschliches Wesen an einem einsamen Ort bis zum Mannesalter heranwachsen könnte ohne jede Gemeinschaft und Verbindung mit Angehörigen seiner Gattung, dann könnte es sich ebenso wenig über seinen Charakter, über die Schicklichkeit oder Verwerflichkeit seiner Empfindungen und seines Verhaltens Gedanken machen als über die Schönheit oder Hässlichkeit seines eigenen Gesichts. All das sind Gegenstände, die es nicht leicht erblicken kann, auf die es natürlicherweise nicht achtet und für die es doch auch nicht mit einem Spiegel ausgerüstet ist, der sie seinem Blicke darbieten könnte. Bringe jenen Menschen in Gesellschaft anderer und er ist sogleich mit dem Spiegel ausgerüstet, dessen er vorher entbehrte. Dieser Spiegel liegt in den Mienen und in dem Betragen derjenigen, mit denen er zusammenlebt, die es ihm stets zu erkennen geben, wenn sie seine Empfindungen teilen und wenn sie sie missbilligen; hier erst erblickt er zum ersten Mal die Schicklichkeit und Unschicklichkeit seiner eigenen Affekte, die Schönheit und Hässlichkeit seines eigenen Herzens. […] Er wird bemerken, dass die Menschen manche dieser Affekte billigen und gegen andere Widerwillen empfinden. Er wird in dem einen Falle erfreut, im anderen niedergeschlagen sein; seine Begierden und Abneigungen, seine Freuden und Leiden werden nun oft zu Ursachen neuer Begierden und neuer Abneigungen, neuer Freuden und neuer Leiden werden: Sie werden ihn darum jetzt aufs Tiefste berühren und oft seine aufmerksame Betrachtung wachrufen. [...] Wir stellen uns selbst als die Zuschauer unseres eigenen Verhaltens vor und trachten nun, uns auszudenken, welche Wirkung es in diesem Lichte auf uns machen würde. Dies ist der einzige Spiegel, der es uns ermöglicht, die Schicklichkeit unseres eigenen Verhaltens einigermaßen mit den Augen anderer Leute zu untersuchen. [. ..] Wenn ich mich bemühe, mein eigenes Verhalten zu prüfen, wenn ich mich bemühe, über dasselbe ein Urteil zu fällen und es entweder zu billigen oder zu verurteilen, dann teile ich mich offenbar in all 24 diesen Fällen gleichsam in zwei Personen. Es ist einleuchtend, dass ich, der Prüfer und Richter, eine Rolle spiele, die verschieden ist von jenem anderen Ich, nämlich von der Person, deren Verhalten geprüft und beurteilt wird. Die erste Person ist der Zuschauer, dessen Empfindungen in Bezug auf mein Verhalten ich nachzufühlen trachte, indem ich mich an seine Stelle versetze und überlege, wie dieses Verhalten mir wohl erscheinen würde, wenn ich es von diesem eigentümlichen Gesichtspunkt aus betrachte. Die zweite Person ist der Handelnde, die Person, die ich im eigentlichen Sinne mein Ich nennen kann und über deren Verhalten ich mir - in der Rolle eines Zuschauers - eine Meinung zu bilden suche. 25 Jean Jacques Rousseau: Mitleid und Natur (1755) (Aus J. J. Rousseau, Preisschriften und Erziehungsplan, Bad Heilbrunn 1983, S. 79 f) Es gibt übrigens ein anderes Prinzip, das Hobbes gar nicht bemerkt hat, und das - da es dem Menschen gegeben wurde, um unter gewissen Umständen die grausame Selbstsucht oder den Selbsterhaltungstrieb vor dem Entstehen dieser Sucht zu mildem - die Begierde, die er für sein Wohlergehen hegt, lindert durch eine angeborene Abscheu, seinesgleichen leiden zu sehen. Ich glaube keinen Widerspruch fürchten zu müssen, wenn ich dem Menschen die einzige natürliche Tugend zuspreche, die anzuerkennen der hartnäckigste Verleumder der menschlichen Tugenden gezwungen ist. Ich spreche vom Mitleid - einer Neigung, die zu solch schwachen und so vielen Leiden unterworfenen Wesen wie uns paßt; eine Tugend, die für den Menschen um so allgemeiner verbreitet und um so nützlicher ist, als sie bei ihm jeglicher Überlegung vorausgeht. und so natürlich, daß sogar die Tiere manchmal sichtbare Zeichen davon geben. Ohne von der Zärtlichkeit der Mütter zu ihren Kleinen zu reden und von den Gefahren, denen sie trotzen, um jene davor zu schützen, bemerkt man täglich den Abscheu, den die Pferde hegen, mit ihren Füßen auf einen lebenden Körper zu treten. Ein Tier geht nicht ohne Unruhe an einem toten Tier seiner Art vorbei: es gibt sogar welche, die ihnen eine Art Grab herrichten. Das traurige Brüllen der Tiere, die zur Schlachtbank geführt werden, gibt den Eindruck wieder, den das schreckliche Schauspiel, das sich ihnen bietet, auf sie ausübt. Das Wohlwollen und sogar die Freundschaft sind, genau genommen, Erzeugnisse eines ständigen Mitleids, das auf einen besonderen Gegenstand gerichtet ist: heißt denn wünschen, daß jemand nicht leidet, etwas anderes, als zu wünschen, daß er glücklich sei? Wenn es wahr wäre, daß das Mitleid nur ein Gefühl wäre, das uns an die Stelle des Leidenden versetzt, ein dunkles und lebhaftes Gefühl im Wilden, das beim bürgerlichen Menschen entwickelt, aber schwach ist - welche Bedeutung würde dieser Gedanke für die Wahrheit meiner Behauptung haben, wenn nicht die, ihr mehr Nachdruck zu verleihen? Tatsächlich wird das Mitleid umso stärker sein, je inniger sich das zuschauende Tier mit dem leidenden identifizieren wird. Es ist also sehr gewiß, daß das Mitleid ein natürliches Gefühl ist, das zu der gegenseitigen Erhaltung der gesamten Gattung beiträgt, weil es in jedem Lebewesen die Wirksamkeit der Eigenliebe mäßigt. Gerade das Mitleid treibt ohne Überlegung dazu, denen zu helfen, die wir leiden sehen; es vertritt im Naturzustand die Stelle der Gesetze, der Sitten und der Tugend, jedoch mit dem Vorteil, daß niemand versucht ist, seiner sanften Stimme nicht zu gehorchen: es wird jeden kräftigen Wilden da von abbringen, einem schwachen Kind oder einem gebrechlichen Greis seine mühsam erworbene Nahrung wegzunehmen, wenn er selbst hofft, seine woanders finden zu können. Das Mitleid flößt allen Menschen anstatt jener erhabenen Lebensregel von vernunftmäßiger Gerechtigkeit "Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu" jene andere erhabene Lebensregel der natürlichen Güte ein, die sehr viel weniger vollkommen, aber vielleicht viel nützlicher als die vorhergehende ist: "Sorge für Dein Wohl mit dem so weit wie möglich geringsten Schaden für die anderen." 26 A. Schopenhauer: Egoismus und Mitleid (Aus: Arthur Schopenhauer, Über die Grundlage der Moral, §§ 14-16, Auszug) Das Wohl und Wehe, welches [...] jeder Handlung oder Unterlassung als letzter Zweck zum Grunde liegen muss, ist entweder das des Handelnden selbst oder das irgendeines andern, bei der Handlung passiv Beteiligten. Im ersten Falle ist die Handlung notwendig egoistisch, weil ihr ein interessiertes Motiv zum Grunde liegt. Dies ist nicht bloß der Fall bei Handlungen, die man offenbar zu seinem eigenen Nutzen und Vorteil unternimmt, dergleichen die allermeisten sind; sondern es tritt ebenso wohl ein, sobald man von einer Handlung irgendeinen entfernten Erfolg, sei es in dieser oder einer andern Welt, für sich erwartet; oder wenn man dabei seine Ehre, seinen Ruf bei den Leuten, die Hochachtung irgend jemandes, die Sympathie der Zuschauer und dergleichen mehr im Auge hat; nicht weniger, wenn man durch diese Handlung eine Maxime aufrechtzuerhalten beabsichtigt, von deren allgemeiner Befolgung man eventualiter einen Vorteil für sich selbst erwartet wie etwa die Gerechtigkeit, des allgemeinen hilfreichen Beistandes […] Kurzum: Man setze zum letzten Beweggrund einer Handlung, was man wolle; immer wird sich ergeben, dass auf irgendeinem Umwege zuletzt das eigene Wohl und Wehe des Handelnden die eigentliche Triebfeder, mithin die Handlung egoistisch, folglich ohne moralischen Wert ist. Nur einen einzigen Fall gibt es, in welchem dies nicht statt hat: nämlich wenn der letzte Beweggrund zu einer Handlung oder Unterlassung geradezu und ausschließlich im Wohl und Wehe irgendeines dabei passiv beteiligten andern liegt, also der aktive Teil bei seinem Handeln oder Unterlassen ganz allein das Wohl und Wehe eines andern im Auge hat und durchaus nichts bezweckt, als dass jener andere unverletzt bleibe oder gar Hilfe, Beistand und Erleichterung erhalte. Dieser Zweck allein drückt einer Handlung oder Unterlassung den Stempel des moralischen Wertes auf; welcher demnach ausschließlich darauf beruht, dass die Handlung bloß zu Nutz und Frommen eines andern geschehe oder unterbleibe. Sobald nämlich dies nicht der Fall ist, so kann das Wohl und Wehe, welches zu jeder Handlung treibt oder von ihr abhält, nur das des Handelnden selbst sein: dann aber ist die Handlung oder Unterlassung allemal egoistisch, mithin ohne moralischen Wert. Wenn nun aber meine Handlung ganz allein des andern wegen geschehen soll; so muss sein Wohl und Wehe unmittelbar mein Motiv sein: so wie bei allen andern Handlungen das meinige es ist. Dies bringt unser Problem auf einen engern Ausdruck, nämlich diesen: Wie ist es irgend möglich, dass das Wohl und Wehe eines andern unmittelbar, d. h. ganz so wie sonst nur mein eigenes meinen Willen bewege, also direkt mein Motiv werde, und sogar es bisweilen in dem Grade werde, dass ich demselben mein eigenes Wohl und Wehe, diese sonst alleinige Quelle meiner Motive mehr oder weniger nachsetze? - Offenbar nur dadurch, dass jener andere der letzte Zweck meines Willens wird - ganz so, wie sonst ich selbst es bin: also dadurch, dass ich ganz unmittelbar sein Wohl will und sein Wehe nicht will, so unmittelbar wie sonst nur das meinige. Dies aber setzt notwendig voraus, dass ich bei seinem Wehe als solchem geradezu mitleide, sein Wehe fühle wie sonst nur meines und deshalb sein Wohl unmittelbar will wie sonst nur meines. Dies erfordert aber, dass ich auf irgendeine Weise mit ihm identifiziert sei, d. h. dass jener gänzliche Unterschied zwischen mir und jedem andern, auf welchem gerade mein Egoismus beruht, wenigstens in einem gewissen Grade aufgehoben sei. Da ich nun aber doch nicht in der Haut des andern stecke, so kann allein vermittelst der Erkenntnis, die ich von ihm habe, d. h. der Vorstellung von ihm in meinem Kopf, ich mich so weit mit ihm identifizieren, dass meine Tat jenen Unterschied als aufgehoben ankündigt. Der hier analysierte Vorgang aber ist kein erträumter oder aus der Luft gegriffener, sondern ein ganz wirklicher, ja keineswegs seltener: es ist das alltägliche Phänomen des Mitleids, d. h. der ganz unmittelbaren, von allen anderweitigen Rücksichten unabhängigen Teilnahme zunächst am Leiden eines andern und dadurch an der Verhinderung oder Aufhebung dieses Leidens, als worin zuletzt alle Befriedigung und alles Wohlsein und Glück besteht. 27 Max Scheler: Grammatik der Gefühle (Aus: Max Scheler, Grammatik der Gefühle, München 2000, S. 30 ff, Auszüge) Alle spezifisch sinnlichen Gefühle sind zuständlicher Natur. Sie mögen dabei durch einfache Inhalte des Empfindens, durch solche des Vorstellens oder des Wahrnehmens mit Objekten irgendwie »verknüpft« sein, oder mehr oder weniger »objektlos« da sein. Immer ist diese Verknüpfung, wo sie stattfindet, eine solche, die mittelbarer Natur ist. Immer sind es erst dem Gegebensein des Gefühls nachträgliche Akte des Beziehens, durch die die Gefühle mit dem Gegenstand verknüpft werden. So wenn ich mich z. B. selbst frage: Warum bin ich heute in dieser oder jener Stimmung? Was ist es, was diese Traurigkeit und Freudigkeit in mir verursacht hat? Völlig verschieden von diesen Verknüpfungen aber ist diejenige des intentionalen Fühlens mit dem, was darin gefühlt wird. Diese Verknüpfung aber ist bei allem Fühlen von Werten vorhanden. Lieben und Hassen endlich bilden die höchste Stufe unseres intentionalen emotionalen Lebens. Hier sind wir am weitesten von allem Zuständlichen entfernt. Schon die Sprache drückt das - sie von Antwortsreaktionen scheidend - aus, indem sie nicht lieben und hassen »über etwas« oder »an etwas«, sondern etwas lieben und hassen sagt. In Liebe und Haß tut unser Geist etwas viel Größeres als »antworten« auf schon gefühlte und eventuell vorgezogene Werte. Liebe und Haß sind vielmehr Akte, in denen das jeweilig dem Fühlen eines Wesens zugängliche Wertreich (an dessen Bestand auch das Vorziehen gebunden ist) eine Erweiterung resp. Verengerung erfährt (und dies natürlich ganz unabhängig von der vorhandenen Güterwelt, den realen wertvollen Dingen, die ja schon für die Mannigfaltigkeit, Fülle und Differenziertheit der gefühlten Werte nicht vorausgesetzt sind). Wenn ich von »Erweiterung« und » Verengerung« des Wertreiches spreche, das einem Wesen gegeben ist, so meine ich natürlich nicht im entferntesten ein Schaffen, Machen, resp. Vernichten der Werte durch Liebe und Haß. Werte können nicht geschaffen und vernichtet werden. Sie bestehen unabhängig von aller Organisation bestimmter Geisteswesen. Aber ich meine, daß dem Akt der Liebe nicht das wesenhaft ist, daß er nach gefühltem Wert oder nach vorgezogenem Wert sich auf diesen Wert »antwortend« richte, sondern daß dieser Akt vielmehr die eigentlich entdeckerische Rolle in unserem Werterfassen spielt -und daß nur er sie spielt - daß er gleichsam eine Bewegung darstellt, in deren Verlauf jeweilig neue und höhere, d. h. dem betreffenden Wesen noch völlig unbekannte Werte aufleuchten und aufblitzen. Er folgt also nicht dem Wertfühlen und Vorziehen, sondern schreitet ihm als sein Pionier und Führer voran. Insofern kommt ihm zwar nicht für die an sich bestehenden Werte überhaupt, aber doch für den Kreis und Inbegriff der jeweilig durch ein Wesen fühlbaren und vorziehbaren Werte eine »schöpferische« Leistung zu. In der Aufdeckung der Gesetze von Liebe und Haß, die hinsichtlich der Stufe der Absolutheit, der Apriorität und Ursprünglichkeit die Gesetze des Vorziehens und die Gesetze zwischen den ihnen korrespondierenden Wertqualitäten noch überragen, würde sich daher alle Ethik vollenden. 28 Richard Rorty: Geborgenheit und Mitgefühl (R. Rorty, Wahrheit und Fortschritt, Frankfurt/M. 2000, S. 258 f.) Nach Platons Ansicht kann man die Menschen dazu bringen netter zueinander zu sein, indem man sie auf eine Eigenschaft hinweist, die allen gemeinsam ist: ihre Vernunft. Es nutzt aber wenig, wenn man die eben geschilderten Leute darauf aufmerksam macht, daß viele Muslime und viele Frauen eine Menge von Mathematik, Technik oder Jura verstehen. Die aufgebrachten jungen Nazischläger waren sich durchaus im Klaren darüber, daß es viele kluge und gebildete Juden gab, doch das hat nur das Vergnügen gesteigert, mit dem sie solche Juden verprügelten. Es nutzt auch nicht viel, solche Leute dazu zu bringen, Kant zu lesen und zuzustimmen, daß man handelnde Vernunftwesen nicht als bloße Mittel behandeln sollte. Denn alles hängt davon ab, wer überhaupt als Mitmensch gilt: als handelndes Vernunftwesen im einzig relevanten Sinne, nämlich in dem Sinne, in dem vernünftiges Handeln gleichbedeutend ist mit der Zugehörigkeit des Betreffenden zu unserer moralischen Gemeinschaft. Die meisten Weißen waren bis vor ganz kurzer Zeit der Ansicht, daß die meisten Schwarzen nicht dazugehörten. Die meisten Christen waren bis ins 17. Jahrhundert etwa der Ansicht, daß die meisten Heiden nicht dazugehörten. Nach Ansicht der Nationalsozialisten gehörten die Juden nicht dazu. Nach Ansicht der meisten Männer in Ländern mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen unter dreitausend Euro gehören die meisten Frauen auch heute noch nicht dazu. Immer, wenn Rivalitäten zwischen Stämmen und Völkern wichtig werden, werden die Angehörigen der gegnerischen Stämme und Völker nicht dazugehören. Aus Kants Erklärung der gebührenden Achtung vor handelnden Vernunftwesen geht hervor, daß man die Achtung, die man vor Personen der eigenen Art empfindet, auf alle ungefiederten Zweifüßer übertragen sollte. Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag, eine gute Formel zur Verweltlichung der christlichen Lehre von der Brüderlichkeit der Menschen. Doch bisher ist dieser Vorschlag noch nie durch ein auf neutralen Prämissen beruhendes Argument begründet worden, und dies wird auch in Zukunft nicht gelingen. Außerhalb des europäischen Kulturkreises der Nachaufklärungszeit - also außerhalb des Kreises der verhältnismäßig ungefährdeten und geborgenen Personen, die seit zwei Jahrhunderten wechselseitig ihre Empfindungen manipulieren sind die meisten Leute einfach außerstande zu begreifen, wieso die Zugehörigkeit zu einer biologischen Spezies ausreichen soll, um einer moralischen Gemeinschaft zugerechnet zu werden. Das liegt nicht daran, daß sie nicht vernünftig genug sind, sondern im Regelfall liegt es daran, daß sie in einer Welt leben, in der es schlicht zu riskant, ja häufig irrsinnig gefährlich wäre, den Sinn für die moralische Gemeinschaft so weit zu fassen, daß er über die eigene Familie, die eigene Sippe oder den eigenen Stamm hinausreicht. Um dafür zu sorgen, daß die Weißen netter zu den Schwarzen sind, die Männer netter zu den Frauen, die Serben netter zu den Muslimen oder die Heterosexuellen netter zu den Homosexuellen, und um dazu beizutragen, daß sich unsere Spezies zu der von einer Menschenrechtskultur dominierten "planetarischen Gemeinschaft" verbindet, nutzt es gar nichts, im Anschluss an Kant zu sagen: Erkennt, daß das, was euch gemeinsam ist - eure Menschlichkeit - wichtiger ist als diese belanglosen Unterschiede. Denn die Leute, die wir zu überreden versuchen, werden erwidern, daß sie nichts dergleichen erkennen. Solche Leute fühlen sich moralisch gekränkt, wenn man vorschlägt, sie sollten jemanden, mit dem sie nicht verwandt sind, wie einen Bruder behandeln, einen Nigger wie einen Weißen, einen Schwulen wie einen Normalen oder eine Gottlose wie eine Gläubige. Was sie kränkt, ist das Ansinnen, sie sollten Leute, die nach ihrer Auffassung keine Menschen sind, wie Menschen behandeln. [...] Nach Ansicht der Anhänger des Fundierungsgedankens sind diese Leute insofern benachteiligt, als es ihnen an Wahrheit und moralischem Wissen gebricht. Es wäre jedoch besser konkreter, spezifischer und aufschlussreicher im Hinblick auf mögliche Abhilfe -, wenn man sie insofern als benachteiligt ansähe, als es ihnen an zwei konkreteren Dingen mangelt: Geborgenheit und Mitgefühl. Unter 'Geborgenheit' verstehe ich Lebensbedingungen, die derart risikofrei sind, daß die eigene Verschiedenheit von anderen unerheblich ist für die Selbstachtung, das Selbstwertgefühl. In den Genuss dieser Bedingungen sind Amerikaner und Europäer - also diejenigen, die den 29 Gedanken der Menschenrechtskultur ersonnen haben - bisher in weit höherem Maße gekommen als irgend jemand sonst. Unter 'Mitgefühl' verstehe ich Reaktionen derart, wie sie bei den Athenern nach dem Besuch der "Perser" des Aischylos weiter verbreitet waren als vorher und wie sie bei den weißen Amerikanern nach der Lektüre von "Onkel Toms Hütte" weiter verbreitet waren als vorher. Es sind Reaktionen, wie sie bei uns weiter verbreitet sind, nachdem wir Fernsehprogramme über den Völkermord in Bosnien gesehen haben. Geborgenheit und Mitgefühl gehen miteinander einher, und zwar aus denselben Gründen, aus denen Frieden und wirtschaftliche Produktivität miteinander einhergehen. Je schwieriger die Verhältnisse, je größer die Anzahl der Furcht erregenden Umstände, je gefährlicher die Situation, desto weniger kann man die Zeit oder die Mühe erübrigen, um darüber nachzudenken, wie es denjenigen ergehen mag, mit denen man sich nicht ohne weiteres identifiziert. Die Schule der Empfindsamkeit und des Mitgefühls funktioniert nur bei Leuten, die es sich lange genug bequem machen können, um zuzuhören. 30 Christoph Fehige: Empathie a priori (Aus: Chr. Fehige, Soll ich? Stuttgart (reclam) 2004, S. 32, 117, 198) Jeder wünscht, dass jeder glücklich ist - und das ist eine begriffliche Wahrheit. […] Entpuppte sich eine solche These als wahr, wären wir bei der Moralbegründung einen Schritt weiter. Denn Wünsche und Handlungsgründe liegen dicht beieinander. Die Handlung, von der ich glaube, dass sie meine Wünsche erfüllen würde, ist eine Handlung, die zu vollziehen ich einen Grund habe. Glaube ich beispielsweise, dass ich allen Glück wünsche und dass eine bestimmte Handlung diesen Wunsch erfüllen würde, so habe ich einen Grund, sie zu vollziehen. (S. 32) […] (R *) Folgendes ist eine begriffliche Wahrheit: a befindet sich, wenn sie sich zum Zeitpunkt t repräsentiert, dass b zum Zeitpunkt t' im hedonisch positiven Bewusstseinszustand s ist, selber zu t (im hedonisch positiven Bewusstseinszustand s und also) hedonisch positiv. (W*) Zu jedem Sachverhalt p gibt es, sofern es überhaupt begrifflich möglich ist, dass a ihn sich zum Zeitpunkt t repräsentiert und sich dabei hedonisch positiv befindet (d. h. froh ist), eine Menge M von Bedingungen dergestalt, dass Folgendes eine nichttriviale begriffliche Wahrheit ist: Falls gilt, dass, wenn die Bedingungen aus M erfüllt wären und a sich zu t p repräsentieren würde, dann a sich zu t hedonisch positiv befände (d. h. froh wäre), so wünscht a zu t, dass p. Ergo: (G*) Folgendes ist eine begriffliche Wahrheit: a wünscht zum Zeitpunkt t, dass b zum Zeitpunkt t' im hedonisch positiven Bewusstseinszustand s ist. (S. 117) […] Worin liegt der Ertrag für die Begründung der Moral? Die harte Nuss einer Moralbegründung ist der Nachweis, dass das moralische Sollen von der praktischen Vernunft seiner Adressaten gestützt wird. Da die praktische Vernunft wiederum ihre Empfehlungen an den Wünschen der Handelnden ausrichtet, ist der Vernunftnachweis fast erbracht, wenn gezeigt wird, dass die Handelnden das, was die Moral ihnen herbeizuführen heißt, selbst wünschen. Nur fast erbracht, weil alle praktische Rationalität und alles richtige Wünschen nicht helfen, wenn eine Handelnde falschen Meinungen darüber anhängt, was der Fall ist; wenn sie zum Beispiel glaubt, dass es allen Leuten große Lust bereitet, geprügelt zu werden. Klammern wir aber wie gehabt die schlichten Informationsdefizite aus. Mit der Anbindung des moralisch Wünschenswerten an wirkliche Wünsche, so können wir dann sagen, wäre von moralischen Geboten gezeigt, dass es vernünftig ist, sie zu befolgen - und das ist der entscheidende Teil der Moralbegründung im Gegensatz zur Moralpredigt. Damit ist klar: Empathie a priori leistet für einen beträchtlichen Teil der Moral einen beträchtlichen Teil der Begründung. Indem sie zeigt, dass jeder jedem zu jeder Zeit jedes hedonisch positive Quale (d.h. Freude) wünscht, zeigt sie […] dass wir wünschen, was wir sollen. Die Forderung der Moral, anderer Menschen Schmerzen zu lindern und Glück zu mehren, ist auch Forderung der Vernunft. (s. 198 f.) 31 Sigmund Freud: Schuld und Psyche (Aus: S. Freud, Das Unbehagen in der Kultur, Studienausgabe, Band IX, S. 231 f.) Über die Entstehung des Schuldgefühls denkt der Analytiker anders als sonst die Psychologen; auch ihm wird es nicht leicht, darüber Rechenschaft zu geben. Zunächst, wenn man fragt, wie kommt einer zu einem Schuldgefühl, erhält man eine Antwort, der man nicht widersprechen kann: man fühlt sich schuldig (Fromme sagen: sündig), wenn man etwas getan hat, was man als »böse« erkennt. Dann merkt man, wie wenig diese Antwort gibt. Vielleicht nach einigem Schwanken wird man hinzusetzen, auch wer dies Böse nicht getan hat, sondern bloß die Absicht, es zu tun, bei sich erkennt, kann sich für schuldig halten, und dann wird man die Frage aufwerfen, warum hier die Absicht der Ausführung gleichgeachtet wird. Beide Fälle setzen aber voraus, daß man das Böse bereits als verwerflich, als von der Ausführung auszuschließen erkannt hat. Wie kommt man zu dieser Entscheidung? Ein ursprüngliches, sozusagen natürliches Unterscheidungsvermögen für Gut und Böse darf man ablehnen. Das Böse ist oft gar nicht das dem Ich Schädliche oder Gefährliche, im Gegenteil auch etwas, was ihm erwünscht ist, ihm Vergnügen bereitet. Darin zeigt sich also fremder Einfluß; dieser bestimmt, was Gut und Böse heißen soll. Da eigene Empfindung den Menschen nicht auf denselben Weg geführt hätte, muß er ein Motiv haben, sich diesem fremden Einfluß zu unterwerfen. Es ist in seiner Hilflosigkeit und Abhängigkeit von anderen leicht zu entdecken, kann am besten als Angst vor dem Liebesverlust bezeichnet werden. Verliert er die Liebe des anderen, von dem er abhängig ist, so büßt er auch den Schutz vor mancherlei Gefahren ein, setzt sich vor allem der Gefahr aus, daß dieser übermächtige ihm in der Form der Bestrafung seine Überlegenheit erweist. Das Böse ist also anfänglich dasjenige, wofür man mit Liebesverlust bedroht wird; aus Angst vor diesem Verlust muß man es vermeiden. Darum macht es auch wenig aus, ob man das Böse bereits getan hat oder es erst tun will; in beiden Fällen tritt die Gefahr erst ein, wenn die Autorität es entdeckt, und diese würde sich in beiden Fällen ähnlich benehmen. Man heißt diesen Zustand »schlechtes Gewissen«, aber eigentlich verdient er diesen Namen nicht, denn auf dieser Stufe ist das Schuldbewußtsein offenbar nur Angst vor dem Liebesverlust, »soziale« Angst. Beim kleinen Kind kann es niemals etwas anderes sein, aber auch bei vielen Erwachsenen ändert sich nicht mehr daran, als daß an Stelle des Vaters oder beider Eltern die größere menschliche Gemeinschaft tritt. Darum gestatten sie sich regelmäßig, das Böse, das ihnen Annehmlichkeiten verspricht, auszuführen, wenn sie nur sicher sind, daß die Autorität nichts davon erfährt oder ihnen nichts anhaben kann, und ihre Angst gilt allein der Entdeckung. Mit diesem Zustand hat die Gesellschaft unserer Tage im Allgemeinen zu rechnen. Eine große Änderung tritt erst ein, wenn die Autorität durch die Aufrichtung eines Über-Ichs verinnerlicht wird. Damit werden die Gewissensphänomene auf eine neue Stufe gehoben, im Grunde sollte man erst jetzt von Gewissen und Schuldgefühl sprechen. Jetzt entfällt auch die Angst vor dem Entdeckt werden und vollends der Unterschied zwischen Böses tun und Böses wollen, denn vor dem Über- Ich kann sich nichts verbergen, auch Gedanken nicht. Der reale Ernst der Situation ist allerdings vergangen, denn die neue Autorität, das Über-Ich, hat kein Motiv, das Ich, mit dem es innig zusammengehört, zu mißhandeln. Aber der Einfluß der Genese, der das Vergangene und Überwundene weiterleben läßt, äußert sich darin, daß es im Grunde so bleibt, wie es zu Anfang war. Das Über-Ich peinigt das sündige Ich mit den nämlichen Angstempfindungen und lauert auf Gelegenheiten, es von der Außenwelt bestrafen zu lassen. Auf dieser zweiten Entwicklungsstufe zeigt das Gewissen eine Eigentümlichkeit, die der ersten fremd war und die nicht mehr leicht zu erklären ist. Es benimmt sich nämlich um so strenger und mißtrauischer, je tugendhafter der Mensch ist, so daß am Ende gerade die es in der Heiligkeit am weitesten gebracht, sich der ärgsten Sündhaftigkeit beschuldigen. 32 A. Damasio: Descartes Irrtum (Aus: Antonio R. Damasio, Descartes Irrtum, München 2001, S 328 f.) Worin bestand also Descartes' Irrtum? Oder noch besser, welchen von Descartes' Irrtümern greife ich hier unfreundlich und undankbar heraus? Man könnte mit einer Beschwerde beginnen und ihm vorwerfen, dass er die Biologen bis auf den heutigen Tag dazu bewogen hat, die Mechanik des Uhrwerks als Modell für Lebensprozesse zu übernehmen. Doch das wäre vielleicht nicht ganz gerecht, und so könnte man mit dem Satz "Ich denke, also bin ich" fortfahren. Dieser Satz, vielleicht der berühmteste in der Philosophiegeschichte, findet sich erstmals im vierten Abschnitt des Discours de la Methode ( 1637) in französischer Sprache ("Je pense donc je suis") und dann im ersten Teil der Prinzipien der Philosophie (1644) auf lateinisch ( »Cogito ergo sum«). Nimmt man ihn wörtlich, so beschreibt dieser Satz das Gegenteil meiner Ansicht von den Ursprüngen des Geistes und von der Beziehung zwischen Geist und Körper. Er besagt nämlich, dass Denken und das Bewusstsein vom Denken die eigentlichen Substrate des Seins sind. Und da Descartes das Denken bekanntlich für eine Tätigkeit hielt, die sich völlig losgelöst vom Körper vollzieht, behauptet er in dieser Äußerung die radikale Trennung von Geist, der "denkenden Substanz" (res cogitans), und dem nichtdenkenden Körper, der Ausdehnung besitzt und über mechanische Teile verfügt (res extensa). Doch lange bevor die Menschheit auf der Bildfläche erschien, gab es schon Lebewesen. An irgendeinem Punkt der Evolution hat ein elementares Bewusstsein seinen Anfang genommen. Mit diesem elementaren Bewusstsein kam auch ein einfacher Geist in die Welt. Als der Geist komplexer wurde, entwickelte sich die Möglichkeit des Denkens und noch später der Sprachverwendung zum Zwecke der Kommunikation und der besseren Organisation des Denkens. Für uns gab es also zuerst das Sein und erst später das Denken. Und auch heute noch beginnen wir, wenn wir auf die Welt kommen und uns entwickeln, zunächst mit dem Sein und fangen erst später mit dem Denken an. Wir sind, und dann erst denken wir, und wir denken nur insofern, als wir sind, da das Denken nun einmal durch die Strukturen und Funktionen des Seins verursacht wird. Darin liegt Descartes' Irrtum: in der abgrundtiefen Trennung von Körper und Geist, von greifbarem, ausgedehntem, mechanisch arbeitendem, unendlich teilbarem Körperstoff auf der einen Seite und dem ungreifbaren, ausdehnungslosen, nicht zu stoßenden und zu ziehenden, unteilbaren Geiststoff auf der anderen; in der Behauptung, dass Denken, moralisches Urteil, das Leiden, das aus körperlichem Schmerz oder seelischer Pein entsteht, unabhängig vom Körper existieren. Vor allem: in der Trennung der höchsten geistigen Tätigkeiten vom Aufbau und der Arbeitsweise des biologischen Organismus. 33 J. Bauer: Warum ich fühle, was Du fühlst (Aus: Joachim Bauer, Warum ich fühle, was du fühlst, Hamburg, 2005, S. 11 ff) Nicht nur der Ausdruck unserer Mimik, auch die mit ihr verbundenen Gefühle können sich von einem Menschen auf den anderen übertragen. Phänomene der Gefühlsübertragung sind uns derart vertraut, dass wir sie als selbstverständlich voraussetzen. Wir stutzen erst dann, wenn sie uns dadurch auffallen, dass sie, sagen wir bei einem Menschen ohne Anteilnahme, plötzlich ausbleiben. Menschen reagieren selbst wie unter Schmerz, wenn sie den Schmerz einer anderen Person miterleben. Sie verziehen unwillkürlich das Gesicht, wenn ein nahe stehender Mensch von einer empfindlichen medizinischen Prozedur, etwa der Entfernung eines Fingernagels, erzählt. Übertragungen dieser Art haben auch ihre amüsante Seite, zum Beispiel, wenn in der Boxkampfarena Zuschauer spontan aufspringen und mit der eigenen Faust den Schlag ausführen, den sie bei ihrem Helden sehen oder gern sehen wollen. Überall, wo Leute zusammen sind, passiert es mit größter Regelmäßigkeit: Menschen steigen auf Stimmungen und Situationen, in denen sich andere befinden, emotional ein und lassen dies durch verschiedene Formen der Körpersprache auch sichtbar werden, meist dadurch, dass sie die zu einem Gefühl gehörenden Verhaltensweisen unbewusst imitieren oder reproduzieren. Wie bei einer seltsamen Infektionskrankheit kann eine Person in anderen Personen spontan und unwillkürlich gleich gerichtete emotionale Reaktionen auslösen. […] Resonanz- und Spiegelphänomene können im Alltag auch bei ganz normalen körperlichen Bewegungen auftreten. So zeigen Menschen eine unbewusste Tendenz, Haltungen oder Bewegungen eines gegenübersitzenden Gesprächspartners spontan zu imitieren. Oft übernehmen sitzende Gesprächspartner, vor allem wenn sie in gutem Einvernehmen sind, unwillkürlich dieselbe Körperhaltung, die kurz zuvor der andere eingenommen hat. Am häufigsten zu beobachten ist, dass ein Gesprächspartner unbewusst einen Wechsel beim Überschlagen der Beine vollzieht, wenn das Gegenüber dies gerade ebenfalls getan hat. Einer von beiden hat sich gerade vorgelehnt, die Hand nachdenklich zum Kopf geführt und sich leicht aufgestützt, kurz darauf tut der andere exakt das Gleiche. Schaut der eine Gesprächspartner plötzlich zu einem bestimmten Punkt an die Decke, wird die andere Person diesem Blick in der Regel unwillkürlich folgen. […] Fütternde öffnen, im Blickkontakt mit dem Kleinkind, selbst den Mund, wenn sie den Löffel zum Mund des Kindes führen. Sie tun dies aus dem intuitiv richtigen Gefühl heraus, dass sich dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Kind ebenfalls den Mund öffnet. Was uns im Alltag kaum noch auffällt: Die Blicke anderer Personen, die einen gewaltigen Teil unserer Aufmerksamkeit binden, lösen erstaunliche, ohne jedes Nachdenken in Gang gesetzte Mitreaktionen aus. Das Ergebnis ist, dass zwischen Menschen, die miteinander in Kontakt stehen, eine kontinuierliche, in hohem Maße gleich laufende Aufmerksamkeit hergestellt wird - ein Phänomen, das in der neurobiologischen Fachsprache als »joint attention« bezeichnet wird. Auch hier sind wieder Spiegelneurone mit von der Partie. […] Resonanz heißt: Etwas wird zum Schwingen oder Erklingen gebracht. Die Fähigkeit des Menschen zu emotionalem Verständnis und Empathie beruht darauf, dass sozial verbindende Vorstellungen nicht nur untereinander ausgetauscht, sondern im Gehirn des jeweiligen Empfängers auch aktiviert und spürbar werden können. Es muss demnach ein System wirksam sein, das den Austausch von inneren Vorstellungen und Gefühlen bewerkstelligen und außerdem die ausgetauschten Vorstellungen im Empfänger zu einer Resonanz, also zum Erklingen, bringen kann. Dies erzeugt jenen gemeinsamen, zwischenmenschlichen Bedeutungsraum, von dem bereits die Rede war. Wie sich herausgestellt hat, ist das System der Spiegelneurone das neurobiologische Format, das diese Austausch- und Resonanzvorgänge möglich macht. (S. 11-13) […] Die Aufdeckung der neurobiologischen Aspekte des Spiegelungsgeschehens bestätigt, was zuvor bereits aus philosophischer Sicht erkannt worden war: Im Antlitz des anderen Menschen begegnet uns unser eigenes Menschsein. […] So spannt sich von der modernen Neurobiologie in 34 überraschender Weise ein Bogen zu Gedanken von Arthur Schopenhauer, Emmanuel Lévinas und Axel Honneth…" J. Bauer: Biologische Gründe für Empathiefähigkeit (Joachim Bauer, Prinzip Menschlichkeit, Hamburg 2006, S. 69 f) Die Argumente, die den Menschen aus biologischer Sicht als Beziehungswesen ausweisen, beziehen sich auf drei fundamentale biologische Kriterien: Zum einen sind die Motivationssysteme des Gehirns in entscheidender Weise auf Kooperation und Zuwendung ausgerichtet und stellen unter andauernder sozialer Isolation ihren Dienst ein. Zweitens führen schwere Störungen oder Verluste maßgeblicher zwischenmenschlicher Beziehungen zu einer Mobilmachung biologischer Stresssysteme. Aus beidem, sowohl aus der Deaktivierung der Motivations- als auch aus der Aktivierung der Stresssysteme, können sich gesundheitliche Störungen ergeben. Dies macht deutlich, dass Menschen nicht für eine Umwelt »gemacht« sind, die durch Isolation oder ständige Konflikte gekennzeichnet ist. Ein drittes, bislang nicht erwähntes neurobiologisches Kriterium, das den Menschen als Beziehungswesen kennzeichnet, ist das System der Spiegelnervenzellen: Nicht nur der Mensch, auch eine Reihe von Tierarten besitzt mit diesen Zellen ein neurobiologisches System, das eine intuitive wechselseitige soziale Einstimmung ermöglicht. Das System dieser besonderen Zellen sorgt dafür, dass ein Individuum das, was es bei einem anderen Individuum der gleichen Art wahrnimmt, im eigenen Organismus - im Sinne einer stillen inneren Simulation - nacherlebt (dies ist der Grund, warum wir zum Beispiel Schmerz empfinden, wenn wir zusehen müssen, wie sich eine andere Person heftig verletzt, oder warum emotionale Stimmungen ansteckend sind). Dadurch ergeben sich weit reichende - bislang noch nicht in ganzer Breite erforschte Möglichkeiten sozialer Resonanz. Im Falle des Menschen ermöglichen Spiegelnervenzellen eine besondere Form sozialer Verbundenheit: Mitgefühl, Empathie. Bei den Spiegelzellen verhält es sich wie bei den Motivationssystemen und den biologischen Stresssystemen: Sie funktionieren nur dann, wenn Menschen in der Prägungsphase ihres Lebens hinreichend gute Beziehungserfahrungen machen konnten und wenn spätere Traumatisierungen nicht zu einer psychischen und neurobiologischen Beschädigung dieser Systeme geführt haben. Damit lautet das Fazit dieses Kapitels: Falls sich zu der genetischen Ausstattung eines Menschen die notwendigen Umweltbedingungen hinzugesellen, ist er ein aufgrund mehrerer körpereigener Systeme in Richtung Kooperation und »Menschlichkeit« ausgerichtetes Wesen. 35 Moral braucht Gefühl Das Wesen der Moral zu erforschen, ist manchmal eine brutale Angelegenheit, wie folgendes Szenario zeigt: Als Soldaten ins Dorf kommen, versteckten sich einige Bewohner im Keller. Bald hören sie oben Uniformierte die Zimmer durchsuchen. Plötzlich fängt ein Baby im Arm seiner Mutter an zu schreien. Die Flüchtlinge wissen, dass sie getötet werden, wenn die Feinde sie entdecken. Ist es dann gerechtfertig, das Kind zu ersticken, um den Rest der Gruppe zu retten? Die zum Glück fiktive Situation ist Teil eines Experiments, das die Neurologen Michael Koenigs und Antonio Damasio von der University of Iowa und Liane Young von der Harvard University durchgeführt haben (Nature online). Sie wollten herausfinden, welche Rolle Emotionen spielen, wenn Menschen moralische Urteile fällen. Hintergrund ist ein jahrhundertealter Streit, ob die Ratio oder Emotionen das moralische Empfinden lenken. Während ethischer Entscheidungen leuchten auf Hirn-scan-Bildern sowohl kognitive Areale im präfrontalen Kortex als auch etliche Areale im limbischen System, dem Sitz der Emotionen, auf. Aber daraus werden die Beziehungen von Ursache und Wirkung nicht klar: Lenken die Gefühle moralische Urteile - oder sind sie nur eine Folge davon? Die Frage lässt sich beantworten, indem man Versuchspersonen untersucht, deren ventromedialer präfrontaler Cortex (VMPC) zerstört ist, eine Hirnregion hinter Nase und Stirn, die als Mittler zwischen Gefühl und Verstand gilt. Solche Menschen sind wenig einfühlsam und empfinden kaum Schuld oder Scham. Sollten Emotionen keine große Rolle bei moralischen Entscheidungen spielen, dürfte es wenig ausmachen, dass bei ihnen der Draht vom limbischen System zur kognitiven Kommandozentrale gekappt ist; die ethischen Bewertungen dieser Personen dürften nicht anders ausfallen als die der gesunden Kontrollgruppe. Falls Gefühle aber doch helfen, müssten sie wegen des Defekts zu anderen Schlüssen kommen. Sechs solcher Probanden testete das Forscherteam im Kernspintomografen - und konfrontierten sie mit diversen Szenarien, die sie beurteilen sollten. Etwa, ob es gerechtfertigt sei, einen Mann von einer Brücke auf Eisenbahngleise zu stoßen, um einen Waggon zu stoppen, der ansonsten fünf Gleisarbeiter töten würde. Oder einen Weichenhebel umzulegen, der einen Waggon umlenkt - und so auf dem Nebengleis eine Person tötet, auf der Hauptstrecke aber fünf verschont. Wer solche Situationen strikt utilitaristisch betrachtet, fragt nach den Konsequenzen - und muss folgern, dass eine Person zu opfern sei. Wer glaubt, dass es immer verkehrt ist, einen Menschen zu töten, sollte für Zurückhaltung plädieren. Studien des an diesem Forschungsprojekt ebenfalls beteiligten Kognitionspsychologen Marc Hauser von der Harvard University haben allerdings bereits gezeigt, dass Menschen davor zurückschrecken, direkte Gewaltanwendung gutzuheißen, jedoch bereit sind, unbeabsichtigte Nebeneffekte in Kauf zu nehmen - unter Umständen sogar, dass ein Mensch stirbt. Doch während Koenigs und Youngs normale Vergleichsgruppe diese Erkenntnisse bestätigte, verhielten sich die Probanden mit einem geschädigten VMPC deutlich anders. Ging es darum, direkte Gewalt anzuwenden, zögerten sie nicht und segneten diese Handlungen als rational gerechtfertigt ab. Der einzige Maßstab, der sie offenbar zu interessieren schien, waren die Folgen einer Aktion, nicht die Handlung selbst. Doch die scheinbar rein utilitaristisch Denkenden folgen dieser Logik nicht immer. Beim Ultimatumspiel bekommen zwei Spieler die Chance, sich etwas Geld zu teilen. Einer schlägt vor, wie viel jeder bekommt, der andere kann das Angebot annehmen oder ablehnen. Wer nur an die Folgen denkt, müsste jedes Angebot akzeptieren, auch kleine Summen sind ja besser als gar nichts. Ist der Betrag aber zu niedrig, rebelliert in der Regel das Gerechtigkeitsgefühl - die Probanden verzichten und keiner kriegt etwas. Ebenso reagierten im Versuch die Menschen mit dem lädierten VMPC-Areal. Zusätzlich zeigten sie sich offen verärgert. Das sei kein Widerspruch, schließt die Studie, sondern demonstriere nur zwei verschiedene Aspekte der VMPC-Funktion. Im Falle moralischer Urteile kann das Verbindungsstück keine Warnsignale senden. Im anderen scheitert es daran, Unmut über ein Erlebnis zu verbergen. "Zwischen einem distanziert-moralischen Urteil und unserem eigenen Handeln", sagt Hauser, "liegt ein tiefer Graben." HUBERTUS BREUER 36 Quelle: Süddeutsche Zeitung Nr.68, Donnerstag, den 22. März 2007 , Seite "Moral steckt im Erbgut" Der Psychologe Marc Hauser sagt, dass jeder Mensch mit einem ethischen Empfinden zur Welt kommt Als der Harvard-Professor Marc Hauser, 47, vor bald fünf Jahren gemeinsam mit dem Linguisten Noam Chomsky über den Sprachinstinkt des Menschen forschte, kam ihm der Einfall, Moral könnte ähnlich funktionieren. Denn beide basieren auf Regeln. Völker sprechen zudem verschiedene Sprachen, genauso wie sich von Land zu Land unterschiedlich ausgeprägte Wertvorstellungen finden. Und wie alle Sprachen grammatische Strukturen teilen, gibt es auch in der Moral Konstanten. Etwa das Gebot, nicht zu töten. Mit diesem schlichten Befund gewappnet, wandte sich der Experte für Tierintelligenz an seine Bostoner Kollegen und erkundigte sich, welche Naturwissenschaftler die Analogie bisher genauer unter die Lupe genommen hatten. Die Antwort: niemand. Und schon hatte er ein neues Projekt am Hals. Das vorläufige, viel diskutierte Ergebnis seiner Forschungen liegt jetzt mit dem Buch, "Moral Minds" vor. Die Idee ist neu, das letzte Wort noch nicht gesprochen. SZ: Das 20. Jahrhundert war die blutigste Epoche der Menschheit. Aber Sie behaupten, dass uns moralische Regeln angeboren sind. Kommen Ihnen da nicht manchmal Zweifel? Hauser: Nein. Es ist naiv zu behaupten, dass Moral allein zu einer besseren Welt führen müsse. In unserer Stammesgeschichte diente Moral dem Zweck, das soziale Leben einer Gruppe zu regeln. Weltfriede war nie das Ziel. SZ: Aber warum sollte Moral angeboren sein? Wenn mir meine Eltern erklären, ich solle meine Schokolade teilen oder nicht lügen, dann stammt das doch aus meiner Umwelt. Hauser: Sicher. Aber wir haben moralische Regeln entdeckt, derer sich die Menschen nicht bewusst sind - und die sie folglich auch nicht weitergeben können. Mein Vorschlag lautet, dass wir moralischen Sinn ähnlich wie Sprache erwerben. Nach Chomsky gibt es eine im Hirn verankerte Universalgrammatik, aus der Kinder je nach Umwelteinfluss ihre Muttersprache entwickeln. Wir erlernen die erste Sprache nicht, wir erwerben sie vielmehr, wie uns ein Arm wächst. Bei der Moral ist es offenbar ähnlich. Es gibt auch hier eine Art Tiefengrammatik, die hilft, uns die jeweilige Moral unseres sozialen Umfelds strukturiert anzueignen. SZ: Für den moralischen Kompass gibt es also eine unbekannte Mechanik? Hauser: Genau. Wir können meist ohne groß zu überlegen sagen, ob eine Handlung gut oder schlecht ist. Philosophen bewerten Handlungen meist auf zweierlei Weise: entweder utilitaristisch, da zählen allein die Konsequenzen, oder deontologisch, dann kommt es nur auf die Handlung, nicht auf die Folgen an. Aber bei genauerem Hinsehen stellt man fest, dass wir so nicht denken. Das sind nur nachträgliche Rekonstruktionen. Wir müssen aber die Regeln finden, die unsere primären ethischen Intuitionen leiten. SZ: Wie stellen Sie das an? Hauser: Wir betrachten moralische Dilemmas. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie stehen neben einem Bahngleis an einer Weiche. Außer Kontrolle geraten, rast ein Waggon heran. Auf der links abzweigenden Spur macht sich eine Gruppe von fünf Eisenbahnarbeitern zu schaffen, rechts ein einziger. Unternehmen sie nichts, schwenkt der Waggon links ab und tötet die fünf Männer. Indem sie den Weichenhebel umlegen, können sie die Fünf retten und nur einen opfern. Die meisten Menschen antworten, sie würden den Waggon umleiten. In einem anderen Szenario können sie einen schweren Mann von einer Brücke auf die Gleise stoßen, um den Waggon aufzuhalten. Diesmal geben fast alle an, das sei unvertretbar, obwohl das Ergebnis doch in beiden Fällen das gleiche wäre. SZ: Das könnte ein geschickter Philosoph vielleicht erklären. Hauser: Nicht mit dem gängigen Werkzeug. Ein Utilitarist würde nur auf das Ergebnis schauen, also beide Handlungen absegnen, ein Deontologe beide Möglichkeiten ablehnen, da Töten falsch ist. Es gibt also unterschwellig eine andere Regel, der unsere Intuition folgt. 37 SZ: Und die wäre? Hauser: Wir unterscheiden beabsichtigten und vorhergesehenen Schaden. Wer die Weiche umstellt, sieht voraus, dass der einzelne Arbeiter sterben wird, beabsichtigt das aber nicht. Wer den Mann von einer Brücke stößt, will ihn dagegen töten, um die anderen zu retten. SZ: Angenommen, Sie haben recht. Eine Regel macht noch keine Grammatik. Hauser: Sie müssen verstehen, dass wir in dieser Forschung noch am Anfang stehen. Als Steven Pinker zu Beginn der neunziger Jahre das Buch "Der Sprachinstinkt" schrieb, konnte er auf mehr als 100 Jahre Grammatikforschung zurückblicken. Als ich mich vor fünf Jahren an dieses Projekt setzte, war das Thema Neuland. Ich bin daher sicher, dass wir in 30 Jahren ebenfalls ein sehr komplexes Regelwerk der Moral vorliegen haben. SZ: Da müssen Sie mehr vorweisen. Hauser: Natürlich. Neben dem Unterschied zwischen beabsichtigten und vorhergesehenen Folgen haben wir andere Strukturen entdeckt. So halten Menschen Schaden, der durch Körperkontakt entsteht, für verwerflicher als den, bei dem es zu keiner Berührung kommt. Und eine Handlung mit negativen Folgen wirkt schlimmer als die Unterlassung einer Handlung, die dasselbe Ergebnis hat. Ein gutes Beispiel dafür ist die aktive und passive Sterbehilfe. In beiden Fällen ändert sich das Resultat nicht. In den Niederlanden und Belgien hat der Gesetzgeber deshalb die Unterscheidung aufgegeben. Dennoch erkennen die meisten Menschen hier intuitiv noch einen moralischen Unterschied. Das ergibt evolutionär auch Sinn: Wenn jemand eine Handlung unterlässt, können wir nicht sicher sein, ob er es absichtlich getan hat. Deshalb zögern wir auch, sie moralisch eindeutig zu bewerten. Doch wie das Euthanasiebeispiel zeigt, ist die ererbte Moral nicht immer für die moderne Welt geschaffen. Doch es hilft, die Quellen unserer Intuitionen zu kennen. SZ: Wie haben Sie ermittelt, dass diese Regeln allen Kulturen gemeinsam sind? Hauser: Wir führen seit einigen Jahren einen Online-Test durch, in dem wir Dilemmas von der Art des herrenlosen Waggons durchspielen. Rund 300 000 Personen haben bislang teilgenommen. Und wir stellen fest, dass ihre Antworten durchweg konstant sind - unabhängig von Religion, Alter, Geschlecht, Ausbildung, Herkunftsland. Sie verfügen offenbar alle über dasselbe Regelwerk und unbewusste Imperative wie "Sei fair", "Richte keinen Schaden an" oder "Verhalte dich friedlich". Internetsurfer repräsentieren zwar nicht unbedingt die Menschheit. Wir testen daher auch Nomadenvölker mit ähnlichen Ergebnissen. SZ: Wenn all das fest verdrahtet ist, wo sitzt die Moral dann im Gehirn? Hauser: Es wäre zu simpel, anzunehmen, wir könnten ein kleines Rechenzentrum in der Großhirnrinde ausfindig machen, das auf Kommando unsere moralischen Urteile ausdruckt. Es handelt sich vielmehr um ein Netzwerk verschiedener Areale. Bei moralischen Dilemmas sehen wir bislang für Gefühle, abstraktes Denken und zwischenmenschliche Beziehungen zuständige Bereiche am Werk. Wir wissen noch nicht, wie sie zeitlich und hierarchisch interagieren. Verfahren wie die Kernspintomographie liefern nur Momentaufnahmen, keinen Film. Ich vermute jedoch, dass primär die rationale Abschätzung, ob eine Handlung regelkonform ist, die moralische Intuition lenkt. SZ: Vielleicht regieren auch die Gefühle, wie David Hume meinte. Hauser: Sie müssen einen Unterschied beachten. Warum wir handeln, unterscheidet sich davon, wie wir eine Handlung moralisch beurteilen. Gefühle spielen - neben Absichten, Denken, Gewohnheit und anderen Dingen bei Handlungen zweifellos eine Rolle, aber wenn wir moralisch urteilen, scheint ihr Einfluss weit geringer auszufallen. Wir haben gerade eine Studie mit Soziopathen abgeschlossen, deren ventromedialer präfrontaler Cortex, eine Hirnregion hinter Nase und Stirn, zerstört ist. Wenn bei Szenarien wie dem Waggon-Beispiel zur Debatte steht, handgreiflich zu werden, entscheiden diese stets wie Utilitarier. Sie stoßen den Mann ohne zu zögern von der Brücke. Da bremsen die meisten anderen Menschen offenbar die Emotionen. Auf alle anderen moralischen Fragen jedoch geben diese Soziopathen völlig normale Antworten. Deshalb spielen Gefühle wohl nicht die große Rolle, die manche ihnen bisher zuschrieben. SZ: Wenn alle auf dieser Grundlage von Regeln und Werten stehen, verwundert es umso mehr, dass in den Kulturen so unterschiedliche Wertvorstellungen entstehen. Hauser: Die Regeln und Imperative sind universell. Ähnlich wie bei Sprachen, entstehen auf dieser Grundlage unterschiedliche Wertesysteme, indem sie unterschiedliche Akzente setzen. Alle Gesellschaften glauben zwar, 38 dass man nicht töten soll. Aber überall gibt es Ausnahmen. So gelten Ehrenmorde in westlichen Demokratien als verabscheuungswürdig. In anderen Gesellschaften sieht man sie dagegen unter Umständen für geradezu gefordert an. Eskimos halten Kindsmord für zulässig, wenn die Ressourcen knapp sind; wir lehnen das ab. Wer in Notwehr tötet, bleibt je nach Hergang in der Regel straffrei. Und in den USA existiert bekanntlich noch die Todesstrafe. SZ: Töten ist aber nicht die Ausnahme, sondern die Regel, wenn es zum Krieg kommt. Hauser: Klar, denn ein Faktor schränkt diese Universalien stark ein: die Gruppenidentität. "Verhalte Dich moralisch - den eigenen Leuten gegenüber", das ist ein sehr gewichtiges Gebot. SZ: Wenn das streng gälte, wären Organisationen wie die Vereinten Nationen doch zum Scheitern verurteilt. Hauser: Wie wir wissen, ist die Völkerverständigung oft nicht ganz einfach. Aber wir sind in unseren Wahlmöglichkeiten keineswegs eingeschränkt. Im Gegenteil: Wir sind lernfähig. Das sehen Sie an den Fortschritten in Sachen Gleichberechtigung, Rassismus oder Tierrechte. Wir können auf der Grundlage des Imperativs "Füge kein unnötiges Leiden zu" durch rationalen Diskurs erkennen, dass wir das Leiden von Tieren so weit wie möglich vermindern sollten. Noch vor 30 Jahren gab es keine nennenswerten Tierschutzgesetze, heute sieht das anders aus. Die kulturelle Evolution schreitet mitunter flott voran. SZ: Die tiefsitzende Angst und Aggression Fremden gegenüber als Grundlage sozialer und kultureller Spannungen und Kriege lässt sich aber kaum wegdiskutieren. Hauser: Das trifft zu. Das Interessante dabei ist, dass die Aggression anderen Gruppen gegenüber meist geschürt wird, indem man Abscheu vor anderen erzeugt. Man nennt sie Parasiten, Gottlose, Untermenschen, Wilde - die Nazis sind dafür das beste Beispiel. So entstehen starke Feindbilder, zementiert durch elementare Aversion. Menschen, die an der Erbkrankheit Chorea Huntington leiden, kennen keine Abscheu. Das geht auf eine Genmutation zurück. Auch im Tierreich kommt diese Empfindung nicht vor. Wenn wir also Kriege verhindern wollen, müssten wir nur am richtigen Genschalter drehen. Ganz ehrlich: Würden Sie Abscheu wirklich vermissen? SZ: Genmanipulation? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass sich so etwas durchsetzen ließe. Hauser: Wenn man überlegt, was man tun müsste, um die Grausamkeit Fremden gegenüber aus der Welt zu schaffen: Dann wäre es genau das. [Interview: Hubertus Breuer Quelle: Süddeutsche Zeitung, den 09. Dezember 2006 , Seite 24] 39 DEFINITIONEN: AFFEKT - WUNSCH Affekt (lat. affectus = Gemütszustand, gr. pathos) heißt eine vorübergehende, zusammenhängende, stärkere Gemütsbewegung, welche durch äußere Ursachen oder psychische Vorgänge veranlaßt wird und unseren geistigen und leiblichen Zustand stark beeinflußt. Der Affekt hat eine bestimmte Entwicklung, in welcher Anfangsgefühl, Vorstellungsverlauf und Endgefühl unterschieden werden können. Bewußtseinsstärke, Willen, Blutumlauf, Atmung, Absonderung der Drüsen, Muskeltätigkeit und Gliederbewegungen werden durch den Affekt entweder gefördert oder gehemmt. Im Affekt gerät der Mensch, wie man sagt, »außer sich«. Die Wucht, mit der die Affekte auftreten, und die Art, wie sie verlaufen, richtet sich einerseits nach der Konstitution und dem Temperament, nach der Erziehung und dem Bildungsstandpunkt des Menschen, andrerseits nach dem äußeren Anlaß. [Kirchner/Michaelis: Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe. Geschichte der Philosophie. S. 8746 Bedürfnis ist alles, was ein Wesen bedarf, zur Erhaltung und Steigerung seiner Existenz braucht, benötigt (B. im objectiven Sinne), zugleich das Bewußtsein (Gefühl) einer Unzuträglichkeit, verbunden mit dem Streben nach deren Beseitigung (B. im subjectiven Sinne). Es gibt körperliche und geistige, materiale und functionelle Bedürfnisse. JERUSALEM unterscheidet körperliche und seelische Bedürfnisse; die körperlichen zerfallen in stoffliche und functionelle Bedürfnisse, unter welchen ein Verlangen der Organe nach Betätigung zu verstehen ist. Die seelischen Bedürfnisse sind durchaus functioneller Natur, sie gliedern sich in intellectuelle und emotionelle Functionsbedürfnisse. Mit anderen betont IHERING die sociale Bedeutung der Bedürfnisse. Das Bedürfnis ist »das Band, mit dem die Natur den Menschen in die Gesellschaft zieht« [Eisler: Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Geschichte der Philosophie, S. 11775 Empfindung (von ahd. intfindan) heißt das durch einen Nervenreiz veranlaßte objektive Element der Bewußtseinsinhalte. Die Empfindung, die erfahrungsmäßig durch die Einwirkung eines Äußeren auf das Innere, oder durch die Aufnahme eines Sinneseindruckes in die Seele entsteht, ist ein durch ein körperliches Organ vermittelter objektiver Grundbestandteil der Bewußtseinsinhalte, im Gegensatz zu dem auf dieselbe Weise veranlaßten subjektiven Gefühlszustand der Lust und Unlust. Zustande kommt die Empfindung dadurch, daß ein äußerer Reiz eine Nervenfaser erregt und diese Erregung ins Gehirn fortgepflanzt wird, wo sie sich in einen psychischen Inhalt umsetzt. Man hat physikalische und physiologische Empfindungsreize zu unterscheiden, je nachdem sie in der Außenwelt oder in unseren Organen entspringen. Die physiologischen zerfallen wieder in zentrale und peripherische; jene bestehen aus Vorgängen im Gehirn, diese aus solchen in den Körperorganen. [Kirchner/Michaelis: Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe. Geschichte der Philosophie, S. 9350 Gefühle heißen die subjektiven Elemente unseres Bewußtseinsinhalts, welche wie die objektiven Elemente, die Empfindungen, sich im einzelnen durch ihre Qualität und Intensität voneinander unterscheiden, aber im Gegensatz zu jenen nicht durch größte Unterschiede, sondern durch größte Gegensätze begrenzt werden. Die Empfindungen bieten innerhalb ein und derselben Qualität regelmäßig Intensitätsunterschiede dar, die von einem Minimum aus in einer Richtung zu einem Maximum aufsteigen; die Gefühle dagegen entwickeln sich von einem Null- oder Indifferenzpunkte aus regelmäßig nach zwei einander entgegengesetzten Richtungen, wobei sie zu immer stärker kontrastierenden Gefühlen werden. Irrtümlich werden die Gefühle oft mit den Empfindungen überhaupt oder im Besonderen mit den Empfindungen des Tastsinnes verwechselt, und der ältere Sprachgebrauch wirft beide Ausdrücke unterschiedlos durcheinander; aber die neuere Psychologie scheidet sie mit größter Schärfe. [Kirchner/Michaelis: Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe. Geschichte der Philosophie, S. 9513 40 Leidenschaft (lat. passio, gr. pathos) heißt eine dauernde Begierde, die so stark ist, daß sie des Menschen Willen beherrscht, ihn also in praktische Unfreiheit versetzt.[...] Sie ruft einen Gegensatz zwischen Willen und Vernunft, zwischen Wollen und Wissen hervor. Sie ist mit dem Eigensinn verwandt und doch von ihm verschieden. Sie ist rücksichtslos und einseitig wie der Eigensinn, aber der Eigensinn ist ein intellektueller Mangel; er hört nicht das Urteil der Vernunft und entschließt sich, ohne erwogen zu haben; die Leidenschaft ist ein sittlicher Mangel; sie hört die Vernunft und entschließt sich doch gegen dieselbe. Sie hindert an der Ausübung vernünftiger Willenstätigkeit, raubt die ruhige Besinnung und den unbefangenen Blick in die Welt, obgleich sie in bezug auf ihr eigenes Ziel den Verstand schärft. Sie entsteht, wenn sich irgend ein Vorstellungskreis isoliert, sich zur bestimmten Neigung umgestaltet und diese sich fest behauptet. Innere Zerrissenheit befördert die Leidenschaften, Vielseitigkeit des Interesses hemmt sie. Die Leidenschaft grenzt an die Seelenkrankheit an. [Kirchner/Michaelis: Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe. Geschichte der Philosophie, S. 9886 Stimmung ist (psychologisch) die besondere, von äußeren und inneren Umständen abhängige Gemütslage, Gemütsverfassung, gemütliche Resonanz eines Individuums, die Gefühlsdisposition zu einer bestimmten Zeit im Gefolge von Organempfindungen, Vorstellungen, Reflexionen, Erlebnissen heiterer oder trauriger Art. Nach BIUNDE ist Stimmung »diejenige Verfassung des Subjects, welche die Entstehung eines Gefühls oder einer Begierde fördert, dazu Disposition ist« Vorübergehende und bleibende Stimmungen des Begehrens sind die Neigungen, des Willens die Gesinnungen BENEKE versteht unter affectiven oder Stimmungs-Gebilden die nicht-intellectuellen seelischen Zustände »Durch die auch von den Gefühlen zurückbleibenden Spuren oder Angelegtheiten werden mehr oder weniger bleibende Gemütsstimmungen begründet, vermöge deren Glücklichsein und Unglücklichsein, in den mannigfachsten Modificationen, gewissermaßen zu Eigenschaften werden können« [Eisler: Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Geschichte der Philosophie, S. 16368] Wert ist die Entsprechung, der Niederschlag, die Setzung des Wertens (Schätzens). Dieses besteht in der gefühlsmäßig-unmittelbaren oder urteilenden (beurteilenden) Beziehung eines Objects auf ein (wirkliches oder mögliches, einzelnes oder allgemeines) Wollen, Bedürfen, Zwecksetzen. Wert ist (hat) etwas, insofern es in irgend einem Grade als begehrbar erscheint seiner Brauchbarkeit für einen zwecksetzenden Willen wegen. Ohne zwecksetzenden Willen, ohne Bedürfnis kein Wert. An sich (im erkenntnistheoretischen Sinne) gibt es keine Werte, aller Wert ist subjectiv und relativ, insofern er ein Subject überhaupt voraussetzt. Aber es gibt außer den individuell-subjectiven auch allgemeinobjective (allgemeingültige, anerkannte) Werte, d.h. Werte, die es für jedes gleichorganisierte Wesen sind oder sein sollen. [Eisler: Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Geschichte der Philosophie, S. 17555 Wunsch ist ein Begehren, dessen Befriedigung als (zur Zeit) unerreichbar erscheint und das daher nicht zur vollen Entfaltung gelangt. DUNS SCOTUS unterscheidet Wille und Wunsch. BENEKE bestimmt: »Ein Wollen ist... nichts anderes als ein Begehren, welchem sich eine Vorstellungsreihe anschließt, in der wir (mit Überzeugung) das Begehrte von diesem Begehren aus verwirklicht vorstellen. Wo dagegen dieses Vorstellen entweder überhaupt nicht möglich ist, oder doch aus irgend einem Grunde nicht eintritt, bleibt das Begehren ein bloßer Wunsch«. CZOLBE bemerkt: »Der feste Glaube an das Können ist zum Wollen unerläßlich, denn der Wille schließt den Beschluß einer Handlung in sich. Im entgegengesetzten Falle ist nur ein Wunsch da« [Eisler: Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Geschichte der Philosophie, S. 17842] 41 Ein Alphabet der Gefühle Abneigung Angst Begeisterung Betroffenheit Dankbarkeit Empörung Entzücken Freude Gefühl der Ungleichheit Gewissensnot Grauen Hass Hochstimmung Missbilligung Neid Peinlichkeit Rachbegierde Schadenfreude Scheu Schuldgefühl Sorge Trauer Unzufriedenheit Verehrung Wertschätzung Zorn Achtung Anteilnahme Begierde Bewunderung Eifersucht Entrüstung Erbitterung Furcht Genugtuung Gleichmut Groll Heimweh Lampenfieber Mitgefühl Niedergeschlagenheit Pflichtgefühl Reue Scham Schmerz Sehnsucht Stolz Trübsinn Verachtung Verwirrung Wut Zufriedenheit Anerkennung Bedauern Bestürzung Billigung Ekel Entsetzen Ergriffenheit Gefühl der Kränkung Gewissensbisse Gram gutes Gewissen Hilflosigkeit Liebe Mitleid Panik Prüfungsangst Rührung Schauder Schreck sexuelle Erregung Taubheitsgefühl Unmut Verantwortungsgefühl Verzweiflung Zerknirschung Zuversicht Arten von Gefühlen objektbezogene Gefühle Empfindungen Stimmungen Basale Gefühle 42 Erlernte Gefühle Moralische Gefühle In Bezug auf mich Positive moralische Gefühle In Bezug auf andere Negative moralische Gefühle in Bezug auf andere Ein Alphabet moralischer Gefühle Achtung Anerkennung Anteilnahme Bedauern Begeisterung Betroffenheit Bewunderung Billigung Dankbarkeit Empörung Entrüstung Erbitterung Ergriffenheit Gefühl der Ungleichheit Gefühl der Kränkung Genugtuung Gewissensbisse Gewissensnot Gram gutes Gewissen Missbilligung Mitgefühl Mitleid Pflichtgefühl Reue Rührung Scham Schuldgefühl Selbstwertgefühl Sorge Stolz Trauer Unmut Verachtung Verantwortungsgefühl Verehrung Verzweiflung Wertschätzung Zerknirschung Zufriedenheit Aufgabe: Ordnen Sie die moralischen Gefühle in das Modell der 'Arten moralischer Gefühle' ein. Soweit möglich, gliedern Sie dabei die einzelnen Gefühle nach ihrer Intensität. 43 ARTEN MORALISCHER GEFÜHLE Gefühle gegenüber Gefühle gegeneigenem Handeln über d. Handeln anderer positive Gefühle negative Gefühle 44 Gefühle gegenüber der Lage anderer Im Dschungel der Gefühle (1) Der kleine Alwin findet im Briefkasten eine handgemalte Einladung zu Olafs Geburtstag. (2) Bei der Geburtstagsfeier spielt Olaf meist mit Alwin, obwohl Felix eigentlich sein bester Freund ist. (3) Beim Wettrennen stellt Felix Alwin ein Bein, worauf dieser hinfällt und sich das Knie aufschürft. (4) Daraufhin tritt Alwin Felix mit Wucht ans Schienbein. (5) Felix humpelt schreiend zu Olaf, der ihn tröstet. (6) Alwin lässt sich von Olafs Vater das blutende Knie verbinden. (7) Felix und Olaf schauen dabei zu. WER EMPFINDET WELCHE GEFÜHLE? Alwin Olaf Felix (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Hier könnt Ihr auswählen: Dankbarkeit, Eifersucht, Empörung, Enttäuschung, Freude, Gewissensbisse, Mitgefühl, Rachegefühl, Reue, Schadenfreude, Schmerz, Schrecken, Stolz, Vorfreude, Wut, Zuneigung 45 Philip Roth: Empörung (Aus: P. Roth: Empörung. München 2009. S. 77 ff) [Der Held des Romans, Marcus Messner, studiert im 1. Semester. Seine Zimmerkameraden drangsalieren ihn, er zieht in andere Zimmer des Studentenwohnheims um. Nun wird er zum Direktor zum Gespräch bestellt.] Er bedeutete mir, auf dem Stuhl gegenüber dem seinen Platz zu nehmen, und sagte, während er auf seine Seite des Schreibtischs zurückkehrte, in freundlichem Ton: " Ich habe Sie herbestellt, damit wir uns kennenlernen und herausfinden können, ob ich Ihnen irgendwie dabei behilflich sein kann, sich in Winesburg einzuleben. Ich sehe hier in Ihren Unterlagen« -er hob einen braunen Aktenordner, in dem er bei meinem Eintreten geblättert hatte -, "dass Sie im ersten Jahr lauter Einsen bekommen haben. Ich möchte nicht, dass eine so brillante schulische Leistung durch irgend etwas hier in Winesburg auch nur im geringsten beeinträchtigt wird.« Mein Unterhemd war schon durchgeschwitzt, bevor ich Platz nahm und die ersten gestelzten Worte sprach. Und natürlich war ich noch überreizt und aufgewühlt von der gerade erlebten Stunde im Gottesdienst [...] »Ich auch nicht, Sir«, antwortete ich. Ich hatte nicht erwartet, mich den Dean mit »Sir« anreden zu hören, auch wenn es nicht so ungewöhnlich war, dass ich von Schüchternheit - die sich in Form von großer Förmlichkeit zeigte - schier überwältigt wurde, wenn ich zum erstenmal mit einer Autoritätsperson zu tun bekam. Nicht dass ich vor solchen Leuten instinktiv zu Kreuze kroch, eher hatte ich gegen ein starkes Gefühl von Einschüchterung anzukämpfen, und dies gelang mir jedesmal nur, indem ich schroffer reagierte, als es der Anlass erforderte. Schon oft hatte ich mich nach solchen Begegnungen erst für meine anfängliche Zaghaftigkeit und dann für die unangebrachte Aufrichtigkeit getadelt, mit der ich jene überwunden hatte, und mir fest vorgenommen, künftig auf jegliche Fragen, die mir gestellt würden, mit äußerster Knappheit zu antworten und im übrigen den Mund zu halten. » Haben Sie das Gefühl, Sie könnten hier Probleme bekommen?« fragte der Dean. »Nein, Sir. Habe ich nicht, Sir.« » Wie läuft es für Sie im Unterricht?« »Gut, glaube ich, Sir.« »Die Kurse bringen Ihnen alles, was Sie sich erhofft haben?« »Ja, Sir.« [...] "Haben Sie ausreichend Kontakte?" fragte Caudwell. "Kommen Sie dazu, andere Studenten kennenzulernen?" "Ja, Sir." Ich wartete, dass er mich aufforderte, ihm alle aufzuzählen, die ich bisher kennengelernt hatte, und nahm an, er werde sich die Namen auf dem Notizblock vor ihm notieren - auf dem oben bereits in seiner Handschrift mein Name stand -, um sie dann in sein Büro zu bestellen und herauszufinden, ob ich die Wahrheit gesagt hatte. Er nahm aber nur eine Karaffe von dem kleinen Tisch neben seinem Schreibtisch, schenkte ein Glas Wasser ein und reichte es mir. »Danke, Sir.« Ich nippte nur daran, um mich bloß nicht zu verschlucken und einen Hustenanfall zu bekommen. Und dann errötete ich heftig, als mir klar wurde, dass er schon aus meinen ersten Antworten geschlossen haben musste, was für einen trockenen Mund ich hatte. »Dann scheint das Problem nur darin zu bestehen, dass Sie ein wenig Schwierigkeiten haben, sich in die Situation im Wohnheim einzuleben«, sagte er. »Stimmt das? Wie ich in meinem Brief geschrieben habe, macht es mir Sorgen, dass Sie in den ersten Wochen Ihres Aufenthalts hier bereits drei verschiedene Zimmer bewohnt haben. Können Sie mir mit eigenen Worten schildern, wo die Schwierigkeiten zu liegen scheinen?« In der Nacht zuvor hatte ich mir eine Antwort zurechtgelegt, denn ich wusste ja, dass es bei dem Gespräch vor allem um meinen neuerlichen Umzug gehen sollte. Nur konnte ich mich jetzt nicht mehr erinnern, was ich hatte sagen wollen. »Könnten Sie Ihre Frage wiederholen, Sir?« »Beruhigen Sie sich, junger Mann«, sagte Caudwell. »Nehmen Sie noch einen Schluck Wasser.« Ich gehorchte. Man wird mich aus dem College werfen, dachte ich. Weil ich zu oft umgezogen bin, wird man mich auffordern, Winesburg zu verlassen. Darauf läuft das hier hinaus. Rausgeworfen, eingezogen, nach Korea geschickt und dort getötet. 46 Franz Kafka: Der Schlag ans Hoftor (1917) Es war im Sommer, ein heißer Tag. Ich kam auf dem Nachhauseweg mit meiner Schwester an einem Hoftor vorüber. Ich weiß nicht, schlug sie aus Mutwillen ans Tor oder aus Zerstreutheit oder drohte sie nur mit der Faust und schlug gar nicht. Hundert Schritte weiter an der nach links sich wendenden Landstraße begann das Dorf. Wir kannten es nicht, aber gleich nach dem ersten Haus kamen Leute hervor und winkten uns, freundschaftlich oder warnend, selbst erschrocken, gebückt vor Schrecken. Sie zeigten nach dem Hof, an dem wir vorübergekommen waren, und erinnerten uns an den Schlag ans Tor. Die Hofbesitzer werden uns verklagen, gleich werde die Untersuchung beginnen. Ich war sehr ruhig und beruhigte auch meine Schwester. Sie hatte den Schlag wahrscheinlich gar nicht getan, und hätte sie ihn getan, so wird deswegen nirgends auf der Welt ein Beweis geführt. Ich suchte das auch den Leuten um uns begreiflich zu machen, sie hörten mich an, enthielten sich aber eines Urteils. Später sagten sie, nicht nur meine Schwester, auch ich als Bruder werde angeklagt werden. Ich nickte lächelnd. Alle blickten wir zum Hofe zurück, wie man eine ferne Rauchwolke beobachtet und auf die Flamme wartet. Und wirklich, bald sahen wir Reiter ins weit offene Hoftor einreiten. Staub erhob sich, verhüllte alles, nur die Spitzen der hohen Lanzen blinkten. Und kaum war die Truppe im Hof verschwunden, schien sie gleich die Pferde gewendet zu haben und war auf dem Wege zu uns. Ich drängte meine Schwester fort, ich werde alles allein ins Reine bringen. Sie weigerte sich, mich allein zu lassen. Ich sagte, sie solle sich aber wenigstens umkleiden, um in einem besseren Kleid vor die Herren zu treten. Endlich folgte sie und machte sich auf den langen Weg nach Hause. Schon waren die Reiter bei uns, noch von den Pferden herab fragten sie nach meiner Schwester. Sie ist augenblicklich nicht hier, wurde ängstlich geantwortet, werde aber später kommen. Die Antwort wurde fast gleichgültig aufgenommen; wichtig schien vor allem, dass sie mich gefunden hatten. Es waren hauptsächlich zwei Herren, der Richter, ein junger, lebhafter Mann, und sein stiller Gehilfe, der Aßmann genannt wurde. Ich wurde aufgefordert in die Bauernstube einzutreten. Langsam, den Kopf wiegend, an den Hosenträgern rückend, setzte ich mich unter den scharfen Blicken der Herren in Gang. Noch glaubte ich fast, ein Wort werde genügen, um mich, den Städter, sogar noch unter Ehren, aus diesem Bauernvolk zu befreien. Aber als ich die Schwelle der Stube überschritten hatte, sagte der Richter, der vorgesprungen war und mich schon erwartete: „Dieser Mann tut mir leid.“ Es war aber über allem Zweifel, dass er damit nicht meinen gegenwärtigen Zustand meinte, sondern das, was mit mir geschehen würde. Die Stube sah einer Gefängniszelle ähnlicher als einer Bauernstube. Große Steinfliesen, dunkel, ganz kahle Wand, irgendwo eingemauert ein eiserner Ring, in der Mitte etwas, das halb Pritsche, halb Operationstisch war. Könnte ich noch andere Luft schmecken als die des Gefängnisses? Das ist die große Frage oder vielmehr, sie wäre es, wenn ich noch Aussicht auf Entlassung hätte. 47 Th. Fontane, Effi Briest, 27. Kapitel (Auszug) [Die junge Effi Briest hat ihren ältlichen Ehemann Baron v. Innstetten mit dem Major Crampas betrogen. Sieben Jahre später erfährt er durch den Fund alter Liebesbriefe von der kurzen Affäre. Er überlegt, sich mit Crampas zu duellieren. Dazu wendet er sich an seinen Kollegen Wüllersdorf.) »Innstetten, Ihre Lage ist furchtbar, und Ihr Lebensglück ist hin. Aber wenn Sie den Liebhaber totschießen, ist Ihr Lebensglück sozusagen doppelt hin, und zu dem Schmerz über empfangenes Leid kommt noch der Schmerz über getanes Leid. Alles dreht sich um die Frage, müssen Sie's durchaus tun? Fühlen Sie sich so verletzt, beleidigt, empört, daß einer weg muß, er oder Sie? Steht es so?« »Ich weiß es nicht.« »Sie müssen es wissen.« Innstetten war aufgesprungen, trat ans Fenster und tippte voll nervöser Erregung an die Scheiben. Dann wandte er sich rasch wieder, ging auf Wüllersdorf zu und sagte: »Nein, so steht es nicht.« »Wie steht es denn?« »Es steht so, daß ich unendlich unglücklich bin; ich bin gekränkt, schändlich hintergangen, aber trotzdem, ich bin ohne jedes Gefühl von Haß oder gar von Durst nach Rache. Und wenn ich mich frage, warum nicht, so kann ich zunächst nichts anderes finden als die Jahre. Man spricht immer von unsühnbarer Schuld; vor Gott ist es gewiß falsch, aber vor den Menschen auch. Ich hätte nie geglaubt, daß die Zeit, rein als Zeit, so wirken könne. Und dann als zweites: Ich liebe meine Frau, ja, seltsam zu sagen, ich liebe sie noch, und so furchtbar ich alles finde, was geschehen, ich bin so sehr im Bann ihrer Liebenswürdigkeit, eines ihr eigenen heiteren Scharmes, daß ich mich, mir selbst zum Trotz, in meinem letzten Herzenswinkel zum Verzeihen geneigt fühle.« Wüllersdorf nickte. »Kann ganz folgen, Innstetten, würde mir vielleicht ebenso gehen. Aber wenn Sie so zu der Sache stehen und mir sagen: 'Ich liebe diese Frau so sehr, daß ich ihr alles verzeihen kann', und wenn wir dann das andere hinzunehmen, daß alles weit, weit zurückliegt, wie ein Geschehnis auf einem andern Stern, ja, wenn es so liegt, Innstetten, so frage ich, wozu die ganze Geschichte?« »Weil es trotzdem sein muß. Ich habe mir's hin und her überlegt. Man ist nicht bloß ein einzelner Mensch, man gehört einem Ganzen an, und auf das Ganze haben wir beständig Rücksicht zu nehmen, wir sind durchaus abhängig von ihm. Ginge es, in Einsamkeit zu leben, so könnt ich es gehen lassen; ich trüge dann die mir aufgepackte Last, das rechte Glück wäre hin, aber es müssen so viele leben ohne dies 'rechte Glück', und ich würde es auch müssen und - auch können. Man braucht nicht glücklich zu sein, am allerwenigsten hat man einen Anspruch darauf, und den, der einem das Glück genommen hat, den braucht man nicht notwendig aus der Welt zu schaffen. Man kann ihn, wenn man weltabgewandt weiterexistieren will, auch laufen lassen. Aber im Zusammenleben mit den Menschen hat sich ein Etwas gebildet, das nun mal da ist und nach dessen Paragraphen wir uns gewöhnt haben, alles zu beurteilen, die andern und uns selbst. Und dagegen zu verstoßen geht nicht; die Gesellschaft verachtet uns, und zuletzt tun wir es selbst und können es nicht aushalten und jagen uns die Kugel durch den Kopf. Verzeihen Sie, daß ich Ihnen solche Vorlesung halte, die schließlich doch nur sagt, was sich jeder selber hundertmal gesagt hat. Aber freilich, wer kann was Neues sagen! Also noch einmal, nichts von Haß oder dergleichen, und um eines Glückes willen, das mir genommen wurde, mag ich nicht Blut an den Händen haben; aber jenes, wenn Sie wollen, uns tyrannisierende Gesellschafts-Etwas, das fragt nicht nach Charme und nicht nach Liebe und nicht nach Verjährung. Ich habe keine Wahl. Ich muß.« 48 Max von der Grün: Masken (1971) Sie fielen sich unsanft auf dem Bahnsteig 3 a des Kölner Hauptbahnhofs in die Arme und riefen gleichzeitig: "Du?!" Es war ein heißer Julivormittag, und Renate wollte in den D-Zug nach Amsterdam über Aachen. Erich verließ diesen Zug, der von Hamburg kam. Menschen drängten aus den Wagen auf den Bahnsteig, Menschen vom Bahnsteig in die Wagen, die beiden aber standen in dem Gewühl, spürten weder Püffe noch Rempeleien und hörten auch nicht, dass Vorübergehende sich beschwerten, weil sie ausgegerechnet vor den Treppen standen und viele dadurch gezwungen wurden, um sie herumzugehen. Sie hörten auch nicht, dass der Zug nach Aachen abfahrbereit war, und es störte Renate nicht, dass er wenige Sekunden später aus der Halle fuhr. Die beiden standen stumm, jeder forschte im Gesicht des anderen. Endlich nahm der Mann die Frau am Arm und führte sie die Treppen hinunter, durch die Sperre, und in einem Café in der Nähe des Doms tranken sie Tee. „Nun erzähle, Renate. Wie geht es dir? Mein Gott, als ich dich so plötzlich sah ... du ... ich war richtig erschrocken. Es ist so lange her, aber als du auf dem Bahnsteig fast auf mich gefallen bist ..." „Nein", lachte sie, du auf mich". „Da war es mir, als hätte ich dich gestern zum letzten Mal gesehen, so nah warst du mir. Und dabei ist es so lange her..." „Ja", sagte sie. „Fünfzehn Jahre." „Fünfzehn Jahre? Wie du das so genau weißt. Fünfzehn Jahre, das ist ja eine Ewigkeit. Erzähle, was machst du jetzt? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Wo fährst du hin?" „Langsam Erich, langsam, du bist noch genau so ungeduldig wie vor fünfzehn Jahren. Nein, verheiratet bin ich nicht, die Arbeit, weißt du. Wenn man es zu etwas bringen will, weißt du, da hat man eben keine Zeit für Männer." „Und was ist das für Arbeit, die dich von den Männern fernhält?" Er lachte sie an, sie aber sah aus dem Fenster auf die Tauben. „Ich bin jetzt Leiterin eines Textilversandhauses hier in Köln, du kannst dir denken, dass man da von morgens bis abends zu tun hat und ...“ „Donnerwetter!" rief er und klopfte mehrmals mit der flachen Hand auf den Tisch. „Donnerwetter! Ich gratuliere." „Ach", sagte sie und sah ihn an. Sie war rot geworden. „Du hast es ja weit gebracht, Donnerwetter, alle Achtung. Und jetzt? Fährst du in Urlaub?" „Ja, vier Wochen nach Holland. Ich habe es nötig, bin ganz durchgedreht ... Und du, Erich, was machst du? Erzähle. Du siehst gesund aus. "Schade, dachte er, wenn sie nicht so eine Bombenstellung hätte, ich würde sie jetzt fragen, ob sie mich noch haben will. Aber so? Nein, das geht nicht, sie würde mich auslachen, wie damals. „Ich?" sagte er gedehnt, und brannte sich eine neue Zigarette an. „Ich ... ich ... Ach weißt du, ich habe ein bisschen Glück gehabt. Habe hier in Köln zu tun. Habe umgesattelt, bin seit vier Jahren Einkaufsleiter einer Hamburger Werft, na ja, so was Besonderes ist das nun wieder auch nicht." „Oh", sagte sie und sah ihn starr an, und ihr Blick streifte seine großen Hände, aber sie fand keinen Ring. Sie erinnerte sich, dass sie vor fünfzehn Jahren nach einem kleinen Streit auseinandergelaufen waren, ohne sich bis heute wiederzusehen. Er hatte ihr damals nicht genügt, der schmalverdienende und immer ölverschmierte Schlosser. Er sollte es erst zu etwas bringen, hatte sie ihm damals nachgerufen, vielleicht könne man später wieder darüber sprechen. So gedankenlos jung waren sie damals. Ach ja, die Worte waren im Streit gefallen und trotzdem nicht böse gemeint. Beide aber fanden danach keine Brücke mehr zueinander. Sie wollten und wollten doch nicht. Und nun? Nun hatte er es zu etwas gebracht. „Dann haben wir ja beide Glück gehabt", sagte sie und dachte, dass er immer noch gut aussieht. Gewiss, er war älter geworden, aber das steht ihm gut. Schade, wenn er nicht so eine Bombenstellung hätte, ich würde ihn fragen, ja, ich ihn, ob er noch an den dummen Streit von damals denkt und ob er mich noch haben will. Ja, ich würde ihn fragen. Aber jetzt? „Jetzt habe ich dir einen halben Tag deines Urlaubs gestohlen", sagte er und wagte nicht, sie anzusehen. ,,Aber Erich, das ist doch nicht so wichtig, ich fahre mit dem Zug um fünfzehn Uhr. Aber ich, ich halte dich bestimmt auf, du hast gewiss einen Termin hier." „Mach dir keine Sorgen, ich 49 werde vom Hotel abgeholt. Weißt du, meinen Wagen lasse ich immer zu Hause, wenn ich längere Strecken fahren muss. Bei dem Verkehr heute, da kommt man nur durchgedreht an." „Ja", sagte sie." „Ganz recht, das mache ich auch immer so." Sie sah ihm nun direkt ins Gesicht und fragte: „Du bist nicht verheiratet? Oder lässt du Frau und Ring zu Hause?" Sie lachte etwas zu laut für dieses vornehme Lokal. „Weißt du", antwortete er, „das hat seine Schwierigkeiten. Die ich haben will, sind nicht zu haben oder nicht mehr, und die mich haben wollen, sind nicht der Rede wert. Zeit müsste man eben haben. Zum Suchen meine ich. Zeit müsste man haben." Jetzt müsste ich ihr sagen, dass ich sie noch immer liebe, dass es nie eine andere Frau für mich gegeben hat, dass ich sie all die Jahre nicht vergessen konnte. Wieviel? Fünfzehn Jahre? Eine lange Zeit. Mein Gott, welch eine lange Zeit. Und jetzt? Ich kann sie doch nicht mehr fragen, vorbei, jetzt wo sie so eine Stellung hat. Nun ist es zu spät, sie würde mich auslachen, ich kenne ihr Lachen, ich habe es im Ohr gehabt, all die Jahre. „Fünfzehn? Kaum zu glauben.“ „Wem sagst du das?" Sie lächelte. „Entweder die Arbeit oder das andere", echote er. Jetzt müsste ich ihm eigentlich sagen, dass er der einzige Mann ist, dem ich blind folgen würde, wenn er mich darum bäte, dass ich jeden Mann, der mir begegnete, sofort mit ihm verglich. Ich sollte ihm das sagen. Aber jetzt? Jetzt hat er eine Bombenstellung, und er würde mich nur auslachen, nicht laut, er würde sagen, dass ... ach ... es ist alles so sinnlos geworden. Sie aßen in demselben Lokal zu Mittag und tranken anschließend jeder zwei Cognac. Sie erzählten sich Geschichten aus ihren Kindertagen und später aus ihren Schultagen. Dann sprachen sie über ihr Berufsleben, und sie bekamen Respekt voneinander, als sie erfuhren, wie schwer es der andere gehabt hatte bei seinem Aufstieg. „Ja, ja" sagte sie; "genau wie bei mir", sagte er. „Aber jetzt haben wir es geschafft", sagte er laut und rauchte hastig. „Ja", nickte sie. „Jetzt haben wir es geschafft.'' Hastig trank sie ihr Glas leer. Sie hat schon ein paar Krähenfüßchen, dachte er. Aber die stehen ihr nicht einmal schlecht. Noch einmal bestellte er zwei Schalen Kognak, und sie lachten viel und laut. Er kann immer noch so herrlich lachen, genau wie früher, als er alle Menschen einfing mit seiner ansteckenden Heiterkeit. Um seinen Mund sind zwei steile Falten, trotzdem sieht er wie ein Junge aus, er wird immer wie ein Junge aussehen, und die zwei steilen Falten stehen ihm nicht einmal schlecht. Vielleicht ist er jetzt ein richtiger Mann, aber nein, er wird immer ein Junge bleiben. Kurz vor drei brachte er sie zum Bahnhof. „Ich brauche den Amsterdamer Zug nicht zu nehmen", sagte sie. „Ich fahre bis Aachen und steige dort um. Ich wollte sowieso schon lange einmal das Rathaus besichtigen.“ Wieder standen sie auf dem Bahnsteig und sahen aneinander vorbei. Mit leeren Worten versuchten sie die Augen des anderen einzufangen, und wenn sich dann doch ihre Blicke trafen, erschraken sie und musterten die Bögen der Halle. Wenn ich jetzt ein Wort sagen würde, dachte er, dann ... „Ich muss jetzt einsteigen", sagte sie. „Es war schön, dich wieder einmal zu sehen. Und dann so unverhofft ..." „Ja, das war es.“ Er half ihr beim Einsteigen und fragte nach ihrem Gepäck. „Als Reisegepäck aufgegeben." „Natürlich, das ist bequemer", sagte er. Wenn er jetzt ein Wort sagen würde, dachte sie, ich stiege sofort wieder aus, sofort. Sie reichte ihm aus einem Abteil erster Klasse die Hand. „Auf Wiedersehen, Erich ... und weiterhin ... viel Glück." Wie schön sie immer noch ist. Warum nur sagt sie kein Wort. „Danke, Renate. Hoffentlich hast du schönes Wetter.“ „Ach, das ist nicht so wichtig. Hauptsache ist das Faulenzen, das kann man auch bei Regen ...“ Der Zug ruckte an. Sie winkten nicht, sie sahen sich nur in die Augen, solange dies möglich war. Als der Zug aus der Halle gefahren war, ging Renate in einen Wagen zweiter Klasse und setzte sich dort an ein Fenster. Sie weinte hinter einer ausgebreiteten Ilustrierten. Wie dumm von mir. Ich hätte ihm sagen sollen, dass ich immer noch die kleine Verkäuferin bin. Ja, in einem anderen Laden, mit zweihundert Mark mehr als früher, aber - ich verkaufe immer noch Herrenoberhemden, - wie früher, und Socken und Unterwäsche. Alles für den Herrn. Ich hätte ihm das sagen sollen. Aber dann hätte er mich ausgelacht, jetzt, wo er ein Herr geworden ist. Nein, das ging doch nicht. Aber ich hätte 50 wenigstens nach seiner Adresse fragen sollen. Wie dumm von mir, ich war aufgeregt wie ein kleines Mädchen, und ich habe gelogen, wie ein kleines Mädchen, das imponieren will. Wie dumm von mir. Erich verließ den Bahnhof und fuhr mit der Straßenbahn nach Ostheim auf eine Großbaustelle. Dort meldete er sich beim Bauführer. „Ich bin der neue Kranführer."„Na, sind Sie endlich da? Mensch, wir haben schon gestern auf sie gewartet. Also dann, der Polier zeigt Ihnen Ihre Bude, dort drüben in den Baracken. Komfortabel ist es nicht, aber warmes Wasser haben wir trotzdem. Also dann, morgen früh, pünktlich sieben Uhr.“ Ein Schnellzug fuhr Richtung Deutz. Ob der auch nach Aachen fährt? Ich hätte ihr sagen sollen, dass ich jetzt Kranführer bin. Ach, Blödsinn, sie hätte mich nur ausgelacht, sie kann so verletzend lachen. Nein, das ging nicht, jetzt, wo sie eine Dame geworden ist und eine Bombenstellung hat. 51 Günther Grass: ALS VATER WIEDER HEIRATEN WOLLTE (1966) Als Vater wieder heiraten wollte, sagten wir nein. Nicht wegen Mama, nur so. Schließlich hat Gitta zwei Jahre lang für ihn und natürlich auch für mich, ihren Bruder Peter, gekocht. Eine für ein damals vierzehnjähriges Mädchen ziemliche Leistung. Dabei haben wir Vater gleich nach dem Trauerjahr alle Freiheit gelassen, nicht nur außerhalb, auch zu Hause. Er konnte mitbringen, wen er wollte. Was ich anfangs nicht verstehen wollte: Gitta hat ihm und seinen Liebschaften am Morgen drauf sogar das Frühstück ans Bett serviert, ziemlich früh allerdings, so um sieben, denn sie mußte ja in die Schule. Wenn ich zu Gitta sagte: "Du übertreibst", gab sie zurück: "Die sollen ruhig sehen, wer hier den Haushalt schmeißt." Aber sonst habe ich mich die ganze Zeit über möglichst rausgehalten, zumal die Damen allesamt, das Fräulein Peltzer, Fräulein Wischnewski oder gar Frau von Wollzogen, nicht mein Fall gewesen sind. Er hatte einen unmöglichen Geschmack. Und Gitta, die mehr mitbekommen hat, lachte sich in der Küche schief, sobald sie oben das Frühstück serviert hatte. Als Vater zum ersten Mal Inge ins Haus brachte, dachte ich: Na also, mal was anderes. Erstens war sie jünger - um genau zu sein, drei Jahre und zwei Monate jünger als ich - zweitens hat sie mich und selbst Gitta nicht geduzt, und drittens hat sie mir gleich gefallen, nicht nur äußerlich. Eigentlich war die erste Zeit die schönste. Manchmal half sie mir in Latein, aber niemals von oben herab, mehr gleichberechtigt. Inge blieb nie bis zum Morgen. Und Gitta mußte kein Frühstück servieren. Vater war so verknallt, daß er wahrscheinlich nichts bemerkt hat, wenn ich mir eine lange Nacht leistete. Gitta war anderer Meinung. Sie roch den Braten früher und sagte: "Hör auf mit dem Gammeln. Wenn du in Schwierigkeiten kommst, nutzt Vater das aus und stellt uns vor Tatsachen." Ich spitzte also: und richtig. Inge begann, die Küche zu besetzen, erstens, weil Gitta angeblich mit dem Schulkram genug zu tun hatte, zweitens, weil sie wirklich vom Kochen eine Menge verstand, und drittens, weil das ihr Plan war. Zwar blieb sie immer noch nicht über Nacht, aber das machte uns eher mißtrauisch: Sie wollte bei uns Eindruck schinden. Hat sie auch zugegeben, als ich ihr kurz entschlossen in Bockenheim auf die Bude rückte. Zuerst wollte sie die Erwachsene spielen: "Das möchte ich nicht gehört haben, Peter." Dann, nach der üblichen Knutscherei, fing sie mit ihrer Wirtin an: "Und wenn ich gekündigt werde?" Ich blieb fest: "Dann ziehst du einfach zu uns." Inge wurde nicht gekündigt. Ich besorgte es ihr zwei, dreimal pro Woche in Bockenheim. – ziemlich glaubwürdig, wenn die Wirtin fragte, als ihr Nachhilfeschüler - und Vater blieb ahnungslos. Als er vor zirka vier Wochen nicht ohne kindliche Verlegenheit etwas von "Ingeheiraten" stotterte, sagten wir: Nein. Gitta kocht jetzt besser. Inge studiert ab nächstes Semester in Gießen. Ich habe ihr versprechen müssen, sie zu besuchen, übers Wochenende und so. (Aus: Günter Grass: Kleine Prosa, Erzählungen. München 1972. S. 34f.) 52 Kurt Marti: Happyend (1960) Sie umarmen sich, und alles ist wieder gut. Das Wort ENDE flimmert über ihrem Kuß. Das Kino ist aus. Zornig schiebt er sich zum Ausgang, sein Weib bleibt im Gedrängel hilflos stecken, weit hinter ihm. Er tritt auf die Straße und bleibt nicht stehen, er geht, ohne zu warten, er geht voll Zorn, und die Nacht ist dunkel. Atemlos, mit kleinen, verzweifelten Schritten holt sie ihn ein, holt ihn schließlich ein und keucht zum Erbarmen. Eine Schande, sagt er im Gehen, eine Affen- schande, wie du geheult hast. Sie keucht. Mich nimmt nur wunder warum, sagt er. Sie keucht. Ich hasse diese Heulerei, sagt er, ich hasse das. Sie keucht noch immer. Schweigend geht er und voll Wut, so eine Gans, denkt er, so eine blöde, blöde Gans, und wie sie keucht in ihrem Fett. Ich kann doch nichts dafür, sagt sie endlich, ich kann doch wirklich nichts dafür, es war so schön, und wenn es schön ist, muß ich einfach heulen. Schön, sagt er, dieser Mist, dieses Liebesgewinsel, das nennst du also schön, dir ist ja wirklich nicht zu helfen. Sie schweigt und geht und keucht und denkt, was für ein Klotz von Mann, was für ein Klotz. (Aus: Kurt Marti, Dorfgeschichten. Harnburg: Luchterhand Literaturverlag 1983) 53 Josef Reding: "Apotheke Vita nova" (1972) Es war ein abgegriffener Zettel, den Munnicher dem einarmigen Apotheker hinhielt. Munnicher trug das aus einem Notizbuch gerissene Blatt schon seit Wochen in der Jackentasche und hatte oft danach gegriffen. Ein paar Gifte standen darauf. Pflanzenschutzgifte, die Erwachsenen ohne Umstände verkauft werden. Munnicher wollte das Gift nicht für Pflanzen. Munnicher wollte es für sich, für die zertretene, weggeworfene Menschenpflanze Munnicher. Er war in diese abgelegene Apotheke gegangen, weil er in den kaltprächtigen Medikamentenpalästen aus Plastikmasse, Nickel und Neon seinen Wunsch nicht vorbringen mochte. „Eins davon“, sagte er. Der Apotheker schaute Munnicher vom zurückweichenden Haaransatz bis zum nachlässig gebundenen Schlips an. Er merkt, dass ich aus dem Gefängnis komme, dachte Munnicher. Er sieht es an dieser ausgebleichten Haut, in der jede Pore drei Jahre lang nach Sonne geschrien hat. Aber heute Nacht kommt die Sonne ja, dachte er. Dann kommt die große Helle von innen. „Sind aber verschieden stark“, sagte der Apotheker. "Das stärkste", verlangte Munnicher. Der Apotheker nickte und stieg auf eine Leiter. Bei jeder Stufe ruderte er mit dem rechten Arm durch die Luft. Sieht komisch aus, wenn ein Einarmiger `ne Leiter raufsteigt, dachte Munnicher. Der Alte kramte in einigen Paketen. Munnicher fühlte sich beobachtet. Aber der Alte schaute nur auf seine Fläschchen und Schachteln. Da sah Munnicher das Mädchen hinter der Waage im angrenzenden Raum. Er sah es durch die geöffnete Tür. Er sah, wie es blaue Tütchen mit hellrotem Pulver füllte und abwog. Das Mädchen – achtzehn ist es, dachte Munnicher – ließ die Waage auszittern und tat nichts. Es schaute Munnicher an. Man erkennt von hier aus, dass es braune Augen hat: Wieso erkennt man das von hier aus, fragte sich Munnicher betroffen. Er hob ein wenig die Hand und winkte. Seh sicher aus wie ein Pinguin, dachte er. Aber da hob das Mädchen das blaue Tütchen und winkte auch. Der Alte ruderte die Leiter wieder herunter. „Hier“, sagte er. „Mit vier Liter Wasser verdünnen.“ „Werd`s schon richtig machen“, sagte Munnicher. „Klar“, sagte der Alte. „Fünf sechzig.“ Munnicher zahlte. Er wollte noch einmal zu dem Mädchen hinüberschauen, aber der Einarmige verdeckte die Tür. Munnicher war versucht, noch eine Schachtel Hustenbonbons oder so etwas zu verlangen, nur damit der Alte ihm aus der Sicht ging. Dann dachte er: Mätzchen! Früher hätte ich so etwas gemacht. Ganz früher. Vor drei Jahren. Er ging. „Wiederschauen“, sagte der Einarmige. Munnicher hatte sich auf das Bett gelegt. Er trank die braune Flüssigkeit. Schmeckt pappig, dachte er. Ich habe immer geglaubt, das Zeug ätzt und würgt. Aber es schmeckt pappig. Schmeckt pappig im Hals, doch nicht im Magen. Merkst du`s, Munnicher, dachte er und legte sich auf die Seite. Merkst du, wie dein Magen zerfressen wird? Ich hätte mich vorher noch rasieren sollen. Wenn morgen einer vom Bestattungsinstitut in meinem kalten Gesicht umherwirkt? Pfui Teufel! Rasieren hätte ich mich sollen, dachte er. Stundenlang dachte er es. Der Morgen hatte die alte Apotheke nicht viel heller gemacht. Munnicher war noch immer nicht rasiert, als er den Apotheker fragte: „Was haben Sie mir da für ein verdammtes Zeug angedreht?“ „Wasser“, sagte der Alte. „Wasser mit einem Schuss Gurgellösung, gegen Mandelentzündung.“ „Was sollte das?“, fragte Munnicher. „Ja, was sollte das?“, fragte der Einarmige und ließ ihn nicht mit dem Blick los. Munnicher senkte den Kopf. „Ich verkaufe keine Gifte in meiner Apotheke“, sagte der Alte. „Von hundert Verkäufen kriege ich nur vierzehn Reklamationen. Das ist noch ein gutes Verhältnis, nicht wahr? Hundert Leute tragen Wasser statt Gift nach Hause und nur vierzehn beschweren sich. Und diese vierzehn schicke ich woanders hin, wenn sie wollen. Manche wollen nicht mehr. Das Geld bekommen sie natürlich wieder zurück. Auch Sie.“ Der Alte schlurfte zur Leiter. Munnicher schaute wieder durch die Verbindungstür. Das Mädchen war nicht da. Im Spiegel fing sich umgekehrt der Name der Apotheke: „Vita Nova“ hieß sie. „Wollen Sie noch etwas?“, fragte der Alte. „Ja“, sagte Munnicher. „Hustenbonbons. 54 Ernst Bloch Armer Teufel und reicher Teufel Reiche Leute wollen gern spielen, setzen dabei arme ein. So hielt es auch jener Amerikaner, als er den sonderbarsten Wettbewerb erfand. Ein junger Mann war gesucht, am liebsten ein Bergarbeiter, gesund und anstellig. Aus den hunderttausend Bewerbern wurde einer angenommen; der junge Mann meldete sich. Ein hübscher Bursche, hatte nun nichts zu tun, als die weiteren Bedingungen zu erfüllen: nämlich auf gute Manier zu essen und zu trinken, feine Kleider mit Schick zutragen,Figur zu machen. Ein Hofmeister brachte ihm die Künste der Welt bei: Reiten, Golf, gebildete Sprache vor Damen und was sonst ein amerikanischer Gentleman braucht. Alles mit dem Geld seines Schutzherren; nach beendetem Schliff trat der Glückliche eine dreijährige Reise um die Welt an, mit Kredit-briefen in der Tasche, die jeden noch so exotischen Wunsch erfüllen ließen. Nur eine kleine letzte Bedingung stand noch aus: Der junge Mann musste nach der Reise wieder ins Bergwerk zurück, als wäre nichts gewesen. Musste dort mindestens zehn Jahre bleiben, als Grubenarbeiter wie bisher. Auch dies unterschrieb der Glückspilz, hielt sich ans Leben, das näher lag; die Zeit der goldenen Jugend begann. Reiste in den Opernglanz von Europa, hatte Glück bei Frauen und zeigte Begabung dafür, jagte indische Tiger und speiste bei Vizekönigen, kurz, führte das Leben von Prinzen. Bis zu dem Tag, wo er heimkehrte und seinem Gönner fast wohlgesättigt dankte, wie einem Gastgeber beim Abschied. Zog die alten Kleider wieder an und stieg in die Grube zurück, zu den Kohlen, blinden Pferden, Kameraden, die ihm so fremd geworden waren und die ihn verachteten. Stieg ins Bergwerk zurück – unvorstellbar jetzt die ersten Tage, Monate, der Gegenschein und jetzige Kontrast, die Einfahrt ums Morgengrauen, die Arbeit auf dem Rücken, das Schwitzen, Husten, der Kohlenstaub in den Augen, der schlechte Fraß, das Bett mit dreien. Nun hätte der Bursche den Vertrag freilich brechen können; auf gute Manier, indem er eine andere Stelle suchte, oder revolutionär, als Arbeiterführer. Stattdessen streikte er verblüffend, fuhr nach New York, sah seinen Wohltäter, erschoss ihn. Für den Arbeiter hatte man danach Verständnis; das Gericht sprach ihn frei. 55 Aufgaben zu den literarischen Texten: Eigene Gefühle zu den Texten und Gefühle in den Texten Eigene Gefühle Welche Gefühle empfinden Sie angesichts des Texts? Bestimmen Sie auch die Stärke der Gefühle. Welche Gefühle empfinden Sie gegenüber den Personen im Text? Bestimmen Sie auch die Stärke der Gefühle Gefühle im Text Welche Gefühle empfinden die Personen im Text? Ordnen Sie zu und bestimmen Sie auch die Stärke der Gefühle. Welche Gefühle der Personen im Text sind positiv, welche negativ? Welche Gefühle sind berechtigt, welche sind nicht-berechtigt? Welche Gefühle können Sie nachvollziehen, welche nicht? 56 Literatur zur Philosophie der Gefühle und zur Gefühlsethik Bauer, Joachim: Warum ich fühle, was Du fühlst. München 2005. Bauer, Joachim: Prinzip Menschlichkeit. München 2007. Breithaupt, Fritz: Kulturen der Empathie. Frankfurt/M. 2009. Damasio, Antonio: Descartes Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. München 1997. Damasio, Antonio: Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins. München 2000. Demmerling, Christoph, Landweer, Hilke: Philosophie der Gefühle. Von Achtung bis Zorn. Stuttgart, Weimar 2007. Döring, Sabine, Verena Mayer (Hg.): Die Moralität der Gefühle. Frankfurt/M. 2002. Döring, Sabine (Hg.): Philosophie der Gefühle. Frankfurt/M. 2009. Döring, Sabine: Gründe und Gefühle. Zur Lösung des Problems der Moralphilosophie. Frankfurt/M. 2010. i. E. Engelen, Eva-Maria: Erkenntnis und Liebe. Zur fundierenden Rolle des Gefühls bei den Leistungen der Vernunft. Göttingen 2003. Engelen, Eva-Maria: Gefühle. Grundwissen Philosophie. Stuttgart 2007. Frankfurt, Harry: Gründe der Liebe. Frankfurt/M. 2005. Harbsmeier, Martin, Möckel, Sebastian (Hg.): Pathos - Affekt - Emotion. Transformationen der Antike. Frankfurt/M. 2009. Hastedt, Heiner: Gefühle. Philosophische Bemerkungen. Stuttgart 2005. Hume, David: Über Moral, (Suhrkamp Studienbibliothek) Kommentar von Herlinde Pauer-Studer, Frankfurt/M. 2007. Hume, David: Ein Traktat über die menschliche Natur. Bde. I und II. Hamburg. 1978. Hume, David: Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. Kommentar von Lambert Wiesing. Frankfurt/M. 2007. Köhl, Harald: Abschied vom Unbedingten. Freiburg/München 2006. Landweer, Hilke (Hg.): Gefühle- Struktur und Funktion. DZPhil Sonderband 14. Berlin 2007. Newmark, Catherine: Passion- Affekt - Gefühl. Philosophische Theorien der Emotionen zwischen Aristoteles und Kant. Hamburg 2008. Ochmann, Frank: Die gefühlte Moral. Berlin 2008. Rifkin, Jeremy: Die empathische Zivilisation. Frankfurt/M. 2010. 57 Rizzolatti, Giacomo, Sinigaglia, Corrado: Empathie und Spiegelneurone. Die biologische Basis des Mitgefühls. Frankfurt/M. 2008. Schopenhauer, Arthur: Metaphysik der Sitten, hrsgg. von V. Spierling, München, Zürich 1985. Schopenhauer, Arthur: Über das Mitleid, hrsgg. und mit Nachwort von Franco Volpi, München 2005. Smith, Adam: Theorie der ethischen Gefühle. Hamburg 2004. de Sousa, Ronald: Die Rationalität des Gefühls. Frankfurt/M. 2009. Stefan, Alfred, Walter, Helmut (Hg.): Natur und Theorie der Emotion. Paderborn 2004. Weber-Guskar, Eva: Die Klarheit der Gefühle. Berlin/New York 2008. Wollheim, Richard: Emotionen. Eine Philosophie der Gefühle. München 2001. 58 59