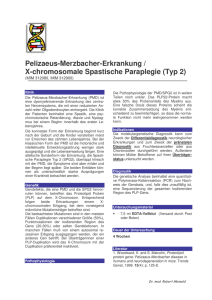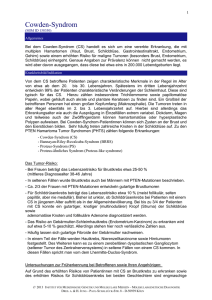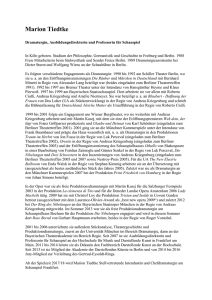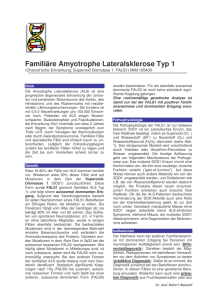Kritiken zu "Die Wände/Les Paravents" von Jean Genet, inszeniert
Werbung

Kritiken zu "Die Wände/Les Paravents" von Jean Genet, inszeniert am Theater an der Ruhr in Mülheim durch Roberto Ciulli (WiSe 2003/2004) Einem Stück über Gewalt wird Gewalt angetan Ciulli und Schäfer inszenieren am Mülheimer Theater an der Ruhr „Die Wände/Les Paravents“ von Jean Genet. (Amrei Beck) Spannungsvolle Erwartung kurz vor Beginn der Inszenierung Roberto Ciullis im Theater an der Ruhr: Wie bringt man ein Stück auf die Bühne, welches siebzehn Bilder und mehr als 35 Rollen umfasst, dessen Aufbau nicht chronologisch verläuft, dessen Autor akribische Regieanweisungen vorgegeben hat? „Die Wände“, im Mai 1961 in Berlin uraufgeführt, thematisieren den Kolonialismus in Algerien und die damit verbundene Unterdrückung der Algerier durch die Franzosen. Viele verschiedene Handlungsstränge werden hier miteinander verflochten, wobei im Mittelpunkt des Geschehens ein junger und armer Araber, Said, seine Mutter und seine Frau Leila stehen. Die Realisierung dieses verworrenen und komplizierten Dramas machten sich Regisseur Roberto Ciulli und Dramaturg Helmut Schäfer relativ einfach, indem sie das Stück stark kürzten und Genets liebevolle Regieanweisungen überwiegend ignorierten; die Authentizität ist verloren gegangen, gezeigt wurde eine sehr freie Variation des Stückes. Die (Stell)Wände, durch die Genet seine Handlungsstränge verbindet und die für ihn eine wichtige Bedeutung haben, werden auf einen einzelnen Paravent reduziert. Aber während diese Streichung nicht die Qualität der Inszenierung beeinflusst, wird der Aufführung durch den verwendeten Ton vom Band - eine schlechte und viel zu leise Kassettenaufnahme - ihre Stärke genommen. An anderen Stellen gelingen Abwandlungen vorgeschriebener Regieanweisungen, welche z.B. die Aktualität der Geschichte verdeutlichen können: Als die Araber die Plantagen ihrer arroganten Kolonialherren anzünden,wollte Genet, dass seine Schauspieler Flammen auf einen Baumstamm malten. Bei Ciulli stellen verschleierte Gestalten lautlos Fässer mit Brandsätzen auf die Bühne. Besonders herausragend unter den Schauspielern ist die Darstellerin der Leila, Simone Thoma. Ihr maskulines Aussehen, ihre unterwürfige Haltung, zusammen mit dem Schicksal ihrer Figur, (sie ist die Hässlichste, von dem ärmsten Mann genommen und von ihrer Schwiegermutter verachtet) wirken beklemmend und fast unerträglich auf den Zuschauer. Die Konflikte der verschiedenen Religionen und die damit verbundenen Machtbestrebungen und gewaltsamen Unterdrückungen in Genets Stück könnten nicht aktueller sein. Nachdem die Mutter einen französischen Soldaten erwürgt hat und zum Ende hin immer öfter Leichen von der Bühne gezogen werden, fühlt man sich gequält von so viel Gewalt, von der man sonst nur abstrakt in den Nachrichten erfährt. An den Grenzen des Darstellbaren Roberto Ciulli und Helmut Schäfer zeigen Jean Genets „Die Wände“ in stark gekürzter Fassung am Mülheimer Theater an der Ruhr (Vera Lotte Böcker) „Die erste Leiche, die er sah, war die eines Mannes. Ein Teil des schwarz gewordenen Gehirns klebte am Boden neben dem Kopf.“ - Hinter einem durchscheinenden Paravent sitzt der Regisseur selbst, Roberto Ciulli. Als „Mund“ der Toten spricht er Fragmente aus Genets Text „Vier Stunden in Chatila“; Genet beschreibt darin die Toten des Massakers im Libanon, bei dem die israelische Armee unter Leitung des Generals Scharon 1982 nichts tuend zugegen war. Die Verbindung des Dramas mit dem IsraelKonflikt enthüllt die Aktualität der über 40 Jahre alten „Wände“ sofort. Die Inszenierung ist Teil des „Seidenstraßen-Projektes“ des Mülheimer Theater an der Ruhr. Monatelang spielte das Ensemble um Ciulli in Ländern entlang der alten Handelsstraßen Theater und auch in Mühlheim sind alljährlich eigene Produktionen der Länder zu sehen. „Die Wände“ handeln vom algerischen Aufstand gegen die französischen Besatzer, der 1962 zur Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonie führte. Die Betrachtung der Globalisierung als Re-Kolonialisierung (Dramaturg Helmut Schäfer), führt zu einem Verständnis von weiter historischer Dimension für den Terrorismus unserer Zeit. Das Stück ist in 18 einzelnen Bildern angeordnet, eine durchlaufende Handlung gibt es nicht. Das Bühnenbild ist schlicht und eindrucksvoll: Zwei Kreuze, gefüllt mit schwarzer Asche sind in den Bühnenboden eingelassen, die Schädel und Knochen der Toten scheinen wie nebensächlich daraus hervor. Zwei Gruppen lassen sich unterscheiden: Die Unterdrücker und die Unterdrückten: die Kolonialherren auf einer Seite, die den algerischen Kämpfern andererseits auf einer erotischen Ebene bereits verfallen sind. Ebenso gelungen ist das Bordell um die stolze, schöne Hure Warda (Christine Sohn) gezeichnet. Zwei Menschen jedoch gehören keiner Gesellschaft an: Said, „der ärmste Sohn des Landes“, bleibt nur der Verrat: er hilft den Kolonialisten ebenso wie den algerischen Kämpfern, er ist die Negation der politischen Allianz selbst, da, wo er ist, greifen unsere Begriffe von Moral nicht mehr. Er wählt stets das abgrundtief Böse und gerade durch diese Entmenschlichung wird er in der Genet´schen Dialektik zum Heiligen. Hinter der Maske des ursprünglich aus der Hölle kommenden Harlekin der Commedia dell´ arte versteckt, füllt Ferhade Feqi die Rolle des Said voll aus. Seine Braut, die hässlichste und billigste Tochter des Landes, Leila, wird von Simone Thoma erschütternd dargestellt. Äußerlich sich wie wahnsinnig gebärdend, scheint sie tiefer zu blicken, als die anderen. Sie stirbt einzig durch ihren Willen. Said und Leila sind still miteinander verbunden, nicht aus Liebe, sondern aus Einsamkeit. Das gesamte Ensemble spielt ungeheuerlich mutig, bewegt sich an den Grenzen des überhaupt Darstellbaren. Die Inszenierung ist derartig vielschichtig, dass sie sich einer eindimensionalen Deutung entzieht. Die überbordende Fülle der Bezugspunkte ist das Großartige dieser Arbeit. Die schwer entschlüsselbaren Elemente erheben den Zuschauer zu einem im existentialistischen Sinne verantwortlichen „vierten Autor“. „Dunkel war’s, der Mond schien helle …“ ‚Kriegswirren‘ im Mülheimer „Theater an der Ruhr“: Regisseur Roberto Ciulli & Dramaturg Helmut Schäfer liefern sich schwerverdauliche ‚Materialschlacht‘ mit Jean Genets „Les Paravents“. (Christian Consten) Unordnung. Vielleicht wäre Unordnung das richtige Wort, eine Art WeltUnordnung. Da sitzt mindestens ein Zuschauer, wahrscheinlich aber ein Vielfaches, im Mülheimer Theater an der Ruhr und sucht. Sucht das Durchgehende. Sucht die Struktur. Ahnt Bruchstücke davon. Aber steht vor einem Rätsel, beinah zermürbende zweieinhalb Stunden lang. Ja, lieber Herr Ciulli, gewiss ist dem Jean Genet sein „Les paravents“ („Die Wände“) mit dieser zusammengestrichenen Fassung endgültig ‚entrissen‘: ganz wie Sie meinen – die Frage, ob ein niemals umgearbeiteter Autor „mundtot“ wird, ist aber wohl eine abendfüllende. Ebenso gewiss spielt das Ensemble unter Ihrer Regie ganz fabelhaft, ja, fast läßt sich sagen, es spielt – verrückt. Denn dies ist ja gleichsam Gespenstertheater, ein Toten, wenigstens Todgeweihtentanz unter jener Sonne, die über den im Staub liegenden Opfern des Algerienkriegs seinerzeit glühte wie noch heute über denen des Nahostkonflikts. Was Genet damals wollte – die Uraufführung war ein Ereignis der Sechziger –, scheint schwierig, aber vielleicht angesichts der Nähe des Stoffs zur politischen Wirklichkeit, einer gewissen Möglichkeit der Zuordnung von auftretenden Typen zu bestimmten französischen oder algerischen Gruppierungen noch lokalisierbar. Die aktuelle Mülheimer Reduktion des Materials aber, das für mehr als zehn Stunden Theaterspiel ausreichte, beweist Mut zur Neuerung und Umformung wohl in dem gleichen Maß wie es leider der Zusammenhanglosigkeit anheimfällt. Zeitweise umgeben von dem Ekstatischen nordafrikanischer Musik, erleben wir Lust- und Unlustwandeln verfremdeter Gestalten, auf von vielen Richtungen her zugänglicher Bühne ein ständiges „Auf“ und „Ab“. Es soll nicht verschwiegen werden, dass wir, trotz allem, durchaus hervorragende schauspielerische Leistungen zu beobachten Gelegenheit haben. Wir sehen als französische Soldaten Gemeinte brüllen, befehlen, strammstehen (skurril: Rupert J. Seidl); algerische Huren breitbeinig obszön fluchen (unwiderstehlich kaputt: Christine Sohn); ein fragwürdiges Liebespaar zärtlich sich verachten, bis dass sie, Leila (Simone Thoma), fortwährend eine eigenschaftslose mannsgroße Puppe als Surrogat für ihren Said (Ferhade Feqi) im Arm, vor Zorn freiwillig stirbt, weil er nicht bei ihr bleibt. Und immer wieder „Der Mund“ (Roberto Ciulli selbst), leichenbergskommentierender pudergesichtiger Alter mit langer Perücke in 18.Jh.-Aufklärermontur – im Schlussbild vielleicht als Nietzschescher „unbedenklicher Künstler-Gott“, die Gesten aller Figuren eigenhändig lenkend. Aber wie in solchen Kriegswirren versprengt, müssen sich die Zuschauergedanken in den undeutlichen Beziehungen und kryptischen Dialogen verirren. Die Menge der Figuren zerfällt in Einzelbezirke, und dennoch scheint hier und da irgendwie alles miteinander verzahnt: es stirbt die Hure, und es legt die stahlhelmtragende Kolonialistenfrau ihr Rosen auf die Brust, dem Dirnenduft nachhängend, den ihr ihr Mann so oft nach Hause trug. – Aber unübersichtlich. Überfrachtet. „Nehmen Sie nicht Verstehen immer als etwas Positives“, sagt Ciulli hinterher mit vielsagendem Lächeln, abgeschminkt, aber immer noch ein ‚Rätsel-Mund‘. „Sehen Sie, ich schaue Theater am liebsten in Sprachen, die ich nicht verstehe.“ Ein Hauch von Sokrates liegt da in der Luft: ‚Ich verstehe, dass ich nichts verstehe.‘ Und auf heimwärtsgewandten Publikumszungen ein Beigeschmack wie Schierling. „Aber nur einen wönzigen Schlock!“ heißt es anderswo. Und: „Ich stehe vor einem Rätsel!“ „Theater ist der Ort, an dem Rätsel entstehen“ Roberto Ciulli inszeniert Genets „Die Wände“ im Theater an der Ruhr. (Julia Falck) „Theater ist der Ort, an dem Rätsel entstehen.“ Recht hat er, der große Roberto Ciulli – Regisseur und Intendant des Mülheimer Theater an der Ruhr - mit dieser Aussage. Rätsel hat seine eindrucksvolle Interpretation von Jean Genets Meisterwerk „Die Wände“ aufgegeben, und derer nicht gerade wenige. Zunächst einmal stellt sich dem interessierten Theaterbesucher natürlich die Frage, wie man die Komplexität und Tiefe der „Wände“ überzeugend und möglichst mit Aktualitätsbezug auf die Bühne bringen mag - hält man sich an Genets zahlreich vorhandene, detaillierte Regieanweisungen und hat kaum Einfluss auf die Inszenierung oder löst man sich stark davon und kann so dem Stück seine persönliche Note verleihen? Ciulli entschied sich für Letzteres und zeigte während des gesamten Stückes, mal offensichtlich durch das Auftreten arabischer Terroristen, von denen Polizeifotos gemacht wurden, mal hintergründig durch den Verfall der „Familie der Brennesseln“ um Said und Leila, die permanente Bedrohung des Friedens durch die Macht des Terrors. Genet und auch Ciulli stellen das Verhältnis von Herrschern und Beherrschten thematisch in den Vordergrund. Die Kolonialherren und das arabische Volk bilden zunächst zwei klar voneinander getrennte Ebenen, die sich später vermischen. Die Macht der Beherrschten wird stärker; mit Gewalt finden sie Wege und Möglichkeiten, sich für die Morde und Folterungen zu rächen. Die Darstellungen der Morde in Ciullis Inszenierung stehen bezeichnend für die Atmosphäre des gesamten Stückes: schrecklich und doch irgendwie spannend, beängstigend und doch lustvoll; gemordet wird aus tiefster Überzeugung und doch wie nebenbei. Jede Szene wirkt unglaublich intensiv, manchmal zu sehr; man fühlt sich überfordert. Das Bühnenbild variiert; ein einziges Paravent (bei Genet sind es bis zu acht Wänden in einer Szene) wird vielseitig verwendet: mal dient es als Fotoschirm, vor dem Fotos ge- und Menschen erschossen werden, mal als Zimmertür, mal als Trennwand im Polizeipräsidium. Ciulli selbst tritt zwischen oder auch während der Szenen auf die Bühne, beobachtet, gekleidet im Stil des 18. Jahrhunderts, das Geschehen und stellt Bezüge zu heutigen Terrorakten her. Gerade die Gefahr des Terrorismus, der durch das heutige neokolonialistische Verhalten der westlichen Welt zum Äußersten getrieben wird, ist ein sehr aktuelles sowie brisantes Thema. Das Stück erscheint nicht als zusammenhängender Handlungsstrang, sondern wie viele bunte, intensive Fragmente; in der Mimik und Gestik der Schauspieler zeigen sich extreme Gefühle wie Hass, Wut, Trauer und Resignation; Said als Verkörperung des Bösen ??, als einziges Mittel gegen den völligen Verfall trägt bezeichnenderweise eine Maske - am Ende sterben sowohl Herrscher als auch Beherrschte. Der Zuschauer ist wie betäubt, applaudiert, muss erst einmal die vielen Gedanken und Eindrücke sortieren - und kann hinterher vielleicht einige Rätsel des Theaters lösen, bestimmt aber nicht alle. Am Ende sind alle tot Roberto Ciulli inszeniert Jean Genets Drama „Die Wände“ im Theater an der Ruhr. (Gregor Kühn) Der Franzose Jean Genet (1910-1986) schrieb mit „Die Wände“ Ende der 50er-Jahre gegen Frankreichs Krieg in Algerien an, der die Kolonialherrschaft bewahren sollte. Der Schriftsteller musste aufgrund seiner aufrührerischen Texte wiederholt ins Gefängnis. Jetzt nimmt sich der italienische Regisseur Roberto Ciulli, Intendant des Mülheimer Theater an der Ruhr, des Dramas an, das auf subtile Weise Parallelen etwa zu USSoldaten im Irak erkennen lässt. In der parabelhaften Geschichte, die 1961 in Berlin uraufgeführt wurde, geht es um die bewusste Auseinandersetzung mit der Legitimation und den Folgen der Kolonialisierung. Eingebettet ist die Inszenierung von „Die Wände“ in das 1997 vom Theater an der Ruhr initiierte Seidenstraßenprojekt, das den Austausch mit Ländern des Maghreb und Iran fördert. Zusammen mit Dramaturg Helmut Schäfer kürzte Ciulli Genets Vorlage radikal und zeigte Mitte Dezember 2003 eine Aufführung, die sich selbst von der eigenen Premiere am 16. Oktober schon wieder erheblich unterschied. Erstmals verkörpert Ciulli selbst den „Mund“, einen französischen Geist des 18. Jahrhunderts in einem weißen Rokokogewand. Trotz Zensur durch die Erben Genets, rezitiert er nun Stellen aus dem 1982 erschienenen Werk „Vier Stunden in Chatila“, das über die Massaker in Beirut berichtet. Gerade durch das zynische, fast genussvolle Erzählen über verstümmelte Leichen wird der Zuschauer schockiert. Das Bühnenbild von Gralf-Edzard Habben zeigt, dass sich Ciulli bewusst von den Regievorgaben Genets emanzipieren wollte: Es gibt keine Podeste mehr, und die Wände sind durch lichtdurchlässige Paravents ersetzt, die immer noch Grenzen markieren zwischen Klassen und Rassen, Christen und Moslems, Arabern und Europäern, Lebenden und Toten. Die drei Hauptfiguren Leila, ihr Freund Said und dessen Mutter gehören zum Sub-Proletariat der algerischen Bevölkerung. Alle versuchen sie, sich vom Joch der Unterdrückung zu befreien. Mit entrückter Gestik und vollem Körpereinsatz brilliert Simone Thoma in der Rolle der hässlichen Leila. Die traumatisierte Frau trägt stets eine lebensgroße, gesichtslose Sackpuppe mit sich herum, an der sie ihre unterdrückten Gefühle ausagiert. Sie entscheidet sich selbst für den Tod in der heißen Wüstensonne. Der maskierte Said, verkörpert durch Ferhade Feqi, ist ein Dieb, der „die Welt in Brand sehen“ will. Leila, die er heiraten soll, hält zu ihm, bis er seine Landsleute an die Franzosen verrät und dafür erschossen wird. Einzig für die stets gekrümmt laufende Mutter von Said (Maria Neumann) scheint keine Rache an den Unterdrückern möglich – weder durch Aufstand noch durch Selbstvernichtung. Die Visionen etwa der Dirnen Warda (Christine Sohn) und Malika (Nicola Thomas) sind ebenfalls pessimistisch; die Welt scheint sinnlos, und selbst das Bordell fungiert nur noch als Metapher für den Verfall. Die Machthaber verteidigen die Glorie und Disziplin der Armee mit Brutalität. Der Kinder mordende Unteroffizier (Fabio Menéndez), der von Kostümbildner Leo Kulas als Engel mit Flügeln, Brustpanzer und riesigem Schwert ausgestattet wurde, wird der Lächerlichkeit preisgegeben. Dabei werden Verbrechen und Sünde gleichsam als göttliches Prinzip ironisiert. Im Hintergrund knattern immer wieder Maschinengewehrsalven, was das Stück in die Nähe einer Militärfarce rückt. Am Ende sind alle tot: Die Kolonialherren, die den Status Quo absichern wollten und die Araber in ihrem Aufstand. Im doppelten Sinne beleuchten auch Scheinwerfer diese melancholische Groteske, die ohne erhobenen Zeigefinger politische Manipulation anzuprangern sucht. Der Betrachter bleibt nach 150 Minuten Aufführung ohne Pause gleichermaßen verstört und erschlafft zurück – hat das Publikum den 15 Schauspielern deshalb nur einen mäßigen Applaus gezollt? Ein Tod, leicht und durchdringlich wie ein weißer Paravent Roberto Ciulli inszeniert in Mühlheim Jean Genets „Die Wände“. (Verena Meis) Ein einziger, hell beleuchteter „Paravent“. Ein einziger Schatten des „Mundes“ Ein einziges Foto der Wandertruppe: „Das Foto erfasst nicht die Fliegen, nicht den fahlen Geruch, und es macht den Tod undurchdringlich. Roberto Ciullis Inszenierung zweier Texte von Jean Genet – „Die Wände“ und „Vier Stunden in Chatila“ - am Mühlheimer Theater an der Ruhr erfasst die Fliegen und auch den fahlen Geruch, und der Tod ist durchdringlich wie ein Paravent aus weißem durchsichtigem Papier. Uraufgeführt im Jahre 1961 in Berlin, feierte Genets „Die Wände“ am 16. Oktober 2003 seine Premiere im Mühlheimer Theater an der Ruhr. Ciulli und sein Dramaturg Helmut Schäfer schafften es, das AntikolonialismusStück der 50er Jahre in drei Stunden mit heutigem Leben zu füllen. In seinem geisterhaften weißen Rokoko-Kostüm berichtet Intendant und Regisseur Roberto Ciulli als „Der Mund“ von Leichen, schwarz gewordenem Hirn und Blutlachen: Immer wieder rezitiert er Passagen aus Genets Text „Vier Stunden in Chatila“, einem Bericht der Massaker in den Palästinenserlagern Sabra und Chatila angefertigt von Jean Genet 1982 in Beirut. „Der Mund“ ist es, der seine Figuren am Faden führt, sie ins richtige Licht setzt und als Spielmacher eine nicht auszuhaltende Ruhe ausstrahlt, die den Figuren gänzlich fehlt und nie gehören wird: Da ist Said (Ferhade Feqi), „der ärmste Sohn des Landes“, der Leila (Simone Thoma), „die hässlichste Tochter des Landes“, heiraten muss. Beide beschreiten den Weg der Selbstauslöschung und spielen uns das Lied, die Geschichte vom Tod, die im Algerienkrieg spielt. „Das Land hat so was wie eine Gänsehaut.“ Macht- und Ohnmachtsgefühle sind heute wie früher die gleichen geblieben, sie haben Kostüm- und Zeitwechsel überdauert. Fast autistisch, quälend wahnsinnig vor Hässlichkeit und Einsamkeit räkelt sich Simone Thoma als Leila mit ihrem einzigen Besitz, einer anonymen Stoffpuppe, auf der von Dreck und Menschenknochen übersäten Bühne (Gralf-Edzard Habben). „Die Einsamkeit der Toten im Lager war noch deutlicher, weil sie Posen und Haltungen einnahmen, die nicht die ihren waren.“ Sind Leilas Bewegungen ihre eigenen? Der Araber Said (Ferhade Feqi), Antiheld mit Gummimaske und französischem Akzent, bewohnt eine Mülltonne und hat sich mit der Rolle des Geächteten abgefunden. Mit Stolz in der Stimme verkündet er: „Ich habe gestohlen. Ich bin ein Dieb.“ Die Mutter (Maria Neumann), eine Figur ebenfalls gestraft durch Abartigkeit, erwürgt mit gekrümmtem Rücken und gekrümmter Würde den besoffenen französischen Soldaten Pierre (Steffen Reuber). Auf der anderen Seite Herr Blankensee (Klaus Herzog), einer der Kolonialisten, der von seiner Rosenzucht schwärmt und nicht ohne sein Polster an Bauch und Hintern vor die Tür geht: „Wegen der Symmetrie“. Außerdem der Unteroffizier (Fabio Menéndez) mit Engelsflügeln, der vor allem wohl gefallener Engel ist: „Aus dem Bauch, den ich aufschlitze, soll das Blut sprudeln. Blut, Herr Leutnant!“. Führen wir etwa einen heiligen Krieg? Mittendrin und zwischen den Fronten die beiden Huren Malika (Nicola Thomas) und Warda (Christine Sohn), deren Betten auch dazu benutzt werden, die Toten zu waschen. Das Bordell als „Verschiebebahnhof der Gesellschaft“ zeigt somit das Bild des Weltverfalls. Sind all diese Figuren auf der Suche nach einer Identität? Nein, sie besitzen bereits eine. Diese wurzelt im Bösen, im Gegenteil des Guten, diese führt jedoch zum Heiligen. Trösten können sie sich nur mit dem Tod, und der ist leicht und durchdringlich wie der weiße Paravent. Ästhetik des Amoralen Roberto Ciulli inszeniert am Mülheimer Theater an der Ruhr „Die Wände/Les paravents“ von Jean Genet. (Daniel Myslinski) „Rimbaud wollte das Leben und Marx die Gesellschaft ändern. Genet will gar nichts ändern. Er tut alles, um die soziale Ordnung, aus der er ausgeschlossen ist, lebensfähig zu erhalten.“ So beschrieb Jean-Paul Sartre das Werk des „schwarzen Magiers“ Jean Genet. Sein letztes und wahrscheinlich komplexestes Bühnenstück, „Les Paravents – Die Wände“, wurde nun von Roberto Ciulli – im Rahmen seines Projektes der `Seidenstraße´ - inszeniert. Die Hauptarbeit der Inszenierung bestand darin, das Stück dem Autor zu entreißen und es spielbar zu machen, so Dramaturg Helmut Schäfer. In der Tat erscheint Genets Stück im Original mit etwa einhundert Darstellern, zahlreichen Spielebenen (auf denen teilweise parallel gespielt werden solle), dem fast unüberschaubaren Handlungsstrang und der zu benötigenden Aufführungszeit, die an zehn Stunden heranreichte auch auf den zweiten Blick unspielbar. Auch scheint es noch immer so, als halte der Autor sein Stück fest umklammert in seinen Händen. Ausführlichst umschreibt er Szene um Szene, jede Kleinigkeit wird penibelst detailliert erläutert. Mimiken, Bewegungen, die Anordnung der Requisiten. Der Regie werden kaum Entfaltungsmöglichkeiten gegeben. Zu Lebzeiten überwachte Genet jede Inszenierung, war kaum zu Kompromissen bereit. Im Stück stehen sich Welten gegenüber, nur durch Wände getrennt. Besetzer, Rebellen, Besetzte gleich sind sie sich nur im Bordell, vereinigt nur im Reich der Toten. In der rigorosen Mülheimer Strichfassung der „Wände“ bleiben noch zwei dieser Ebenen übrig. Ciulli und Schäfer stellen Kolonialisten den Kolonialisierten gegenüber. Nicht zufällig. Anlässlich einer Matinee stellt Ciulli seinem Publikum die Frage: „Was soll ein Iraker denken, wenn die Engländer wieder da sind?“. Konkrete Anspielungen im Stück sind unübersehbar. „Wir sind mit der Kultur zu euch gekommen.“ Sie sollen auch nicht übersehen werden, aktuelle Bezüge sind gewollt. Man betreibe politisches Theater, so Ciulli. Schäfer wird noch konkreter, das Zeitalter der Globalisierung ähnele verdächtig einem Rekolonialismus. Imperialismus mit anderen Strukturen. In der Tat: militärische Gewalt weicht zunehmend einer wirtschaftlichen, ist sie doch `notwendig´, so heißt die derzeit immer passende Rechtfertigung: Terrorismus. Ciullis Inszenierung besticht durch die erschaffenen, vollkommen ästhetischen Bilder. Am Ende bleiben dann doch Rätsel und Fragen offen, wie beispielsweise wen oder was denn nun der „Mund“, einer Erzählerfigur, die Textauszüge eines Genetschen Massakerberichts („4 Stunden in Chatila“, Beirut 1982) rezitiert und immer wieder inszenatorisch ins Spielgeschehen eingreift, darstelle. Interpretationsansätze reichen von de Sade über Voltaire bis Goldoni. Keine dieser Figuren sei gemeint, so Schäfer, aber man dürfe es annehmen. Die Versendung einer Botschaft, die man lediglich richtig zu deuten habe, sei nicht die Aufgabe des Theaters. Die Anregung zum Denken stehe im Vordergrund. Eine gewisse Ohnmacht bleibt jedoch bestehen, die auch Genet erkannte. „Die Künstler haben nicht die Aufgabe, die praktische Lösung zu finden. Sie sollten akzeptieren Verdammte zu sein. Sie werden bei ihrer Arbeit die Seele verlieren.“ Phantastische Verwirrung oder „Europa ist am Arsch“ „Die Wände“ von Jean Genet inszeniert am Mülheimer Theater an der Ruhr (Melanie Schya) Roberto Ciulli bringt im Oktober 2003 „Die Wände“, ein 1959 von Jean Genet geschriebenes Stück, welches den algerischen Befreiungskrieg thematisiert, auf die Bühne des Theater an der Ruhr in Mülheim. Ist der mit dem Werk bereits vertraute Zuschauer vor der Aufführung misstrauisch, ob es Ciulli schaffen wird, die komplizierte Geschichte um Krieg und Verrat verständlich aufzuführen, so wird der unbelesene Zuschauer vielleicht auch nach Ende des Schauspiels nicht genau sagen können, was er da gesehen hat. Dramaturg Helmut Schäfer erklärt, das Stück sei „aus der Perspektive des Endes heraus geschrieben“. „Vom Ende her“ sei es „logisch“, aber dahin zu gelangen sei „schwierig“. Damit hat er offensichtlich Recht behalten, denn nicht wenige Zuschauer verließen während der mehr als zweistündigen Aufführung den Saal. Ciulli war wohl klar, dass er die Zuschauer mit Schockeffekten fesseln musste: Gleich zu Beginn zeigt er einen splitternackten Mann, später wird der Zuschauer mit lauten Schüssen „aufgeweckt“. Mit Ende des Stückes wird demjenigen, der durchgehalten hat, klar sein, dass Genet den algerisch-französischen Konflikt darzustellen versuchte. Aufgezeigt wird, wie Bordelle aus dem Krieg ihren Profit schlagen und nicht unterscheiden, ob Feind oder Freund, solange das Geld stimmt, - wir sehen, dass der junge Said ein Verräter ist, dass Leila dumm und hässlich, aber trotzdem so schlau ist, zu erkennen, dass „Europa am Arsch“ ist. Herr Blankensee versucht durch Bauch- und Popolster imposanter zu wirken und wird letztlich ohne Verkleidung von seiner Frau erschossen. Schließlich ist alles ein großes Durcheinander, niemand kann dem anderen mehr trauen. Vieles wird mit Humor genommen, so ähnelt der Krieger, der wie Gott wirken soll, eher einem schwulen Engel an Karneval. Das Bühnenbild ist ebenso einfach wie beeindruckend. Links und rechts jeweils drei gleichgroße, schwarze Wandelemente, so dass man den Eindruck gewinnen kann, bei den noch bestehenden Wandelementen handele es sich um Säulen. Doch beim Mord an Herrn Blankensee fällt nur auf der linken Seite Licht durch die drei Freiräume, so dass die Räumlichkeit betont wird, indem man den Eindruck von Fenstern mit einfallendem Mondlicht gewinnt. Eine abschließende Bewertung dieses Inszenierung fällt schwer, fest steht jedoch, dass Bühnenbild, Inszenierung und schauspielerische Leistung den Applaus zum (lang herbeigesehnten) Schluss verdient hatten. Opulenter Todesreigen „Die Wände“ von Jean Genet am Theater an der Ruhr (Diane Sellenmerten) Düster ist es. Schwarze Wände, schwarzer Boden. Zwei flache Kiesgruben. In diesen wird gestorben und geliebt - genauer gesagt verreckt und kopuliert und die brutale Nähe von beidem besticht. Roberto Ciulli inszeniert das gewaltverherrlichende Alterswerk Jean Genets als eigentümlich traumwandlerische Mischung aus Pantomime, Satire und absurdem Theater. Der Tod ist dabei immer allgegenwärtig: Schon in der ersten Szene werden alle Figuren, gerade auf der Bühne installiert, von dem Schuss eines photographischen Apparats hinweggefegt. Später findet im Bordell eine Leichenwaschung statt, es wird gemordet, Suizid begangen, symbolisch eine archäologische Ausgrabungsstätte beackert, Puppen beerdigt. Das eigentliche Thema, der Algerienkonflikt, der 1958, zur Entstehung des Stückes hochaktuell war, tritt angesichts dieser existentiellen Ebene etwas in den Hintergrund. Eine Parteinahme des Zuschauers für die Araber, allen voran für Said (Ferhade Feqi), fällt jedoch nicht schwer. Werden doch die Kolonialherren als oberflächliche, verweichlichte, anzüglich-schwülstige Homosexuelle karikiert. „Wir haben ihnen die Kultur gebracht“ bekennen sie stolz und beweisen dabei ständig Un-Kultur, deren Lächerlichkeit in einer Männerballetteinlage auf die Spitze getrieben wird. Said, einer der Ärmsten, mit der hässlichen Leila (Simone Thoma) verheiratet, wird zum Dieb und Totalverweigerer. Er verrät sie alle: die Rebellen der eigenen Seite und die Feinde, und lässt sich paradoxerweise gerade dadurch von niemandem korrumpieren. Stattdessen will er den Weg eines Märtyrers gehen, der nicht aus Liebe zu Gott, sondern aus tiefstem Hass, den Tod sucht. In seiner Absolutheit weckt er Assoziationen zu aktuellen Selbstmordattentätern. Er wählt freiwillig „das Böse (..) und immer nur das Böse“ wie es seine Frau Leila formuliert. - eine der rührendsten und gleichzeitig absurdesten Figuren des Stückes. Sie gehört nicht nur zu der Gruppe der Opfer, sondern ist auch innerhalb dieser ein Außenseiter. In ihrer Verzweiflung liegen hospitalistische Züge und ihr Gesicht, mit den dunklen Augenhöhlen bleibt dem Zuschauer unweigerlich im Gedächtnis. Said hingegen trägt eine Gesichtsmaske und ist mehr Typus als Individuum. Doch auch er bleibt ein Rätsel, wie letztlich auch die gesamte Inszenierung. Die teilweise unerträgliche Langsamkeit der Szenen, entfernt an Robert Wilson erinnernd, bildet einen fremdartigen, aber höchst faszinierenden Kontrast zu der oft harten Fäkalsprache der Figuren. Symbole treten jedoch so gehäuft auf und machen die Inszenierung so unglaublich dicht, dass sie den Zuschauer auch erschlagen und überfordern können. Ciulli aber - so offenbart er im Gespräch - will den Zuschauer von dem eigenen Leistungsdruck befreien und propagiert die Offenheit des Kunstwerkes. Wie etwas wahrgenommen und entschlüsselt wird, soll unbedingt subjektiv bleiben. Was in mir – ganz subjektiv - zurückbleibt sind scheinbar widersprüchliche Gefühlseindrücke wie Verzauberung und Ekel und berückende Bilder, die sich zu einem Gesamteindruck verweben: Poesie. Provokative Rätselhaftigkeit Roberto Ciulli inszeniert im Müllheim an der Ruhr Jean Genets Stück „Die Wände“ (Reka Török) „Normalerweise, sagt man, hätten die Stücke einen Sinn: dieses nicht. Dies ist ein Fest, dessen Teile nicht zusammenpassen, es ist eine Feier von nichts.“ (Genet 1966) Nach einer Oktober-Premiere im Rahmen des Festivals „Theaterlandschaften Seidenstraße“ wurden Jean Genets „Les paravents“ unter der Regie von Roberto Ciulli am 15. Dezember erneut und in wieder vollständiger Fassung im Mülheimer Theater an der Ruhr präsentiert. Genets umfangreiches Bühnenwerk bezieht sich thematisch auf den Algerienkrieg und Kolonialismus. Ende der 50-er Jahre geschrieben, teilt das Drama die Personen in zwei Gruppen: Die Unterdrücker und die Unterdrückten, französische Kolonialherren und Algerier. Die Hauptfigur ist Said (Ferhade Feqi) „der ärmste Sohn des Landes“, dem keine andere Frau zum Heiraten bleibt, als die „hässlichste und billigste Tochter des Landes“, Leila (Simone Thoma). Saids Schicksal ist von Anfang an festgelegt. Sein Lebensweg ist ein kontinuierlicher Abstieg vom Dieb zum Verräter. Am Ende wird er erschossen. Genets Theater und dessen ästhetischen Spiel sind auch heute noch eine Provokation. Genet inszeniert beim Schreiben sein eigenes Stück, hält sich so stark an seinem Text fest, dass Regisseur Roberto Ciulli und Dramaturg Helmut Schäfer sich zunächst von allen Regieanweisungen des Autors befreien müssen, um ein individuelles Kunstwerk zu schaffen, um ihre eigenen politischen und künstlerischen Statements abzugeben. Sie sehen „Die Wände“ nicht als Stück im klassischen Sinne. Eher als Materialsammlung, als Parabel. Es zeigt die Absurdität des Lebens und des Todes. Die Realität ist damit in ein Phantasiefeld oder Spiegelkabinett verwandelt, in dem der Mensch in seiner gebrochener Erscheinung in die Irre geht. Die Friedhof-Szene mit Totenköpfe und die Bordell-Szene mit den Huren Warda und Malika schaffen ein tristes Bild der Verfallenheit. Die Moralität der Welt hat ihre Stabilität verloren. Was bleibt ist die Schönheit des Amoralischen. Roberto Ciuli tritt mehrmals während des Stückes auf, mal als Kommentator („Mund“), mal als Beobachter in seinem weißen Kostüm aus dem 18. Jahrhundert, vielleicht sogar darauf wartend, am Ende die Seele der Theaterfiguren in die Unterwelt zu bringen. Der „Mund“ spricht Textfragmente aus einem späteren Werk von Genet, „4 Tage in Chatila“, einem Bericht der Massaker in Beirut von 1982. Die Aktualität des Stückes liegt in seiner politischen Thematik: ReKolonialismus als eine Spielart der Globalisierung. In Saids Figur konkretisiert sich die Theorie der Verweigerung, der Widerstand gegen jedes politische System, die totale Absage. Trotz aller aktuellen weltpolitischen Brisanz, ist Genets Stück nicht leicht interpretierbar. Das Stück stellt Fragen, deren Antworten nicht unbedingt das Rätsel lösen. Politisch-philosophische Gewandtheit und Assoziationsvermögen verlangt Ciuli von jedem Zuschauer, um eine eigene Interpretation zu finden. Ein monumentales Stück mit provokativen Bildern (Gralf-Edzard Habben) und erschütternden Sprachgebilden. Theatergenuss für Fortgeschrittene Roberto Ciulli bringt in Mülheim Jean Genets Epos „Die Wände“ auf die Bühne. (Henry Wahlig) „Normalerweise, sagt man, hätten die Stücke einen Sinn: Dieses nicht. Dies ist ein Fest, dessen Teile nicht zusammenpassen, es ist ein Feier von nichts.“ Es klingt schon fast wie eine Warnung, die uns der französische Schriftsteller Jean Genet zu seinem letzten Drama „Die Wände“ hinterlassen hat. Und tatsächlich stellt das 1962 in Berlin uraufgeführte und nun vom Theater an der Ruhr in Mülheim neu inszenierte Werk in jeder Beziehung eine Herausforderung für die Zuschauer dar. Schon der äußere Rahmen macht dem Betrachter schnell klar, dass er an diesem Abend alles vergessen kann, was er im Theater über das Theater zu wissen glaubte. Einen linearen Handlungsverlauf lassen die Wände genauso vermissen wie Leitfiguren und Charaktere, die eine Entwicklung durchmachen. Wir bewegen uns mit den Schauspielern in einem zeit- wie ereignislosen Raum. Diesen siedelt Genet in Algerien zur Zeit des Befreiungskrieges gegen die französischen Besatzer an. Auf der Bühne gruppieren sich zwei Klassen von Figuren, die Unterdrücker und die Unterdrückten: Auf der einen Seite der Kolonialist Blankensee, dem die Aufzucht seiner Rosenzucht wichtiger als das Schicksal der Einheimischen geworden ist – auf der anderen die Araberin Kadidja, die sich mit Benzin übergießt und fest davon überzeugt ist, „das Böse“ tun zu müssen. Zwischen ihnen steht Said, der als „Ärmster von allen“ in seinem eigenen Dorf ausgegrenzt ist und von den Kolonialherren benutzt und verlacht wird. Er steht zwischen allen Stühlen und so bleibt ihm als letzter Stolz sein offener Widerstand, seine Absage gegen die ganze Welt – für die er am Ende mit dem Leben bezahlen muss. Genet lässt seine Personen in Traumwelten agieren, die aus ihren Symboliken heraus lebt. Der Zuschauer muss sich deshalb in ein wahres Dickicht von szenischen Fragmenten, Anspielungen und Bildern begeben, in denen viel geschürzt, aber wenig gelöst wird - der unerfahrene Theaterbesucher kann da schnell die Übersicht verlieren. Dramaturg Helmut Schäfer hat diese Gefahr erkannt und das Stück für das Theater an der Ruhr entwirrt, „überhaupt erst spielbar gemacht“, wie er selbst sagt. Komplette Passagen des Stückes hat er gestrichen, dadurch die Spieldauer von sechs auf erträgliche zweieinhalb Stunden gesenkt. Damit strafft er Genets Traumwelt, auflösen kann und will er sie aber nicht. Das Stück bleibt eine Herausforderung für die Imaginationskraft der Zuschauer. Und dennoch wagt Schäfer mit Regisseur und Darsteller Roberto Ciulli das „Nichts“ der Handlung mit der Gegenwart zu verknüpfen - der blutigen Gegenwart des israelisch-palästinensischen Konfliktes. So liest Ciulli zu Beginn einiger Szenen Passagen aus Genets letztem Buch „Vier Stunden in Chatila“, in dem er die israelische Mitschuld am Massaker christlicher Milizen an Palästinensern im Libanon 1982 thematisiert. Damit lenkt Ciulli den Blick auf die Herkunft der heutigen Terroristengeneration, die in den palästinensischen Flüchtlingslagern herangewachsen ist. Sie, so macht uns Ciulli deutlich, hatte in ihrer Ausweglosigkeit kaum eine andere Wahl, als sich wie Kadidja für „das Böse“ zu entscheiden. In einer Phase wachsender Re-Kolonialisierung der dritten Welt, verpackt unter dem Deckmantel des Schlagworts der ökonomischen Globalisierung, setzt diese Inszenierung damit einen wohltuenden Kontrapunkt. Und wird, wenn man es schafft in die Traumwelten Genets und Schäfers einzutauchen, doch zu einem echten Theatergenuss – für Fortgeschrittene. „Europa macht sich dünne.“ Jean Genet – Die Wände am Theater an der Ruhr in Mülheim (Katrin Wiesemann) Ein Photoapparat klickt und die 14 Personen auf der Bühne kippen wie tot um, das Klirren eines Schlüsselbunds und alle erwachen wieder zum Leben: Eines von vielen Rätseln in dem Stück „Die Wände“, welches zur Zeit in Mühlheim gezeigt wird. Genau diese Rätsel will Regisseur Roberto Ciulli aber hervorrufen: „Je mehr Chancen wir haben vor einem Rätsel zu stehen, desto mehr Chancen haben wir.“ Und die sind in dieser Inszenierung des Stückes von Jean Genet zur Genüge zu finden. Dramaturg Helmut Schäfer und Ciulli ließen sich nicht durch die strengen Regieanweisungen des Autors einschränken. Schäfer: „Den Text eines Autors aus Verehrung unverändert zu lassen, hieße den Autor mundtot zu machen.“ Denn jeder Text müsse in „unserer“ jeweiligen Zeit gedacht werden. So entsprechen weder das karge Bühnenbild noch die Kostüme den Originalanweisungen. Auch der Text wurde erheblich gekürzt. Hinzugefügt aber wurden Textstücke aus Genets Buch „Vier Stunden in Chatila“, einem Bericht der Massaker in Beirut aus dem Jahr 1982, in dem Genet auf ästhetische Weise tote Körper beschreibt. Das Stück dreht sich um Said, seine hässliche Frau und seine Mutter: die „Brennnesselfamilie“. Algerien ist in kolonialer Hand, “der ärmste Sohn des Landes“ schlägt sich mit Diebstahl durch, verrät seine Landsleute wie auch die Engländer und wird durch Genets Umkehrung der Werte zum Helden. Wichtige Rollen spielen u.a. die Araber, die Kolonialherren, die Legionäre und die Huren. Ein Soldat mit Flügeln, ein Messdiener, der einen Leutnant ankleidet und der pantomimische Empfang der Hostie sind nur drei der Zeichen, welche Ciulli und Schäfer bewusst in die Inszenierung einbauten. Sie sind Symbole für das, was „wir“, Europa, exportiert haben: die christliche Politisierung. Doch bei den im Moment anstehenden Problemen im Nahen Osten entziehe sich Europa der Verantwortung. Alle Rätsel der Inszenierung zu verstehen, wäre für Ciulli ein „Stehenbleiben“. Deshalb gibt es für ihn auch keinen ultimativen Sinn, jeder Zuschauer nimmt sich seinen eigenen Sinn mit nach Hause. Brüchige Fassaden zwischen Kindlichkeit und Wahnsinn Das Mülheimer Theater an der Ruhr inszeniert „Die Wände/Les Paravents“ von Jean Genet. (Frank Zimmermann) In einem Kostüm des späten 18. Jahrhunderts, aus der Zeit also, aus der auch das Wort `Terror´ stammt, wandelt Regisseur Roberto Ciulli über die Bühne und spielt einen Regisseur des Terrors. In der Fassung von Helmut Schäfer zeigt das Theater an der Ruhr Jean Genets „Wände“ als einen bunten Bilderbogen der Gewalt, gespickt mit Anspielungen und Symbolen, die von der Zeit der Kreuzzüge bis in die Gegenwart reichen. Das Leben als Kampf zwischen Gesellschaften, Religionen, Geschlechtern und Hierarchien, wird ausgetragen auf dem maroden Parkett des Kolonialismus. Den Holzboden hat Bühnenbildner Garf-Edzard Habben durch zwei mit Rollsplitt gefüllte Kuhlen unterbrochen, die im Laufe der Inszenierung mal als Schützengraben fungieren, mal als Sandkasten, mal als Wüstensand, der sich gegen die Bebauung der Besatzer durchsetzt. Unter dem Personal des Stücks finden sich alle möglichen Menschentypen; nur eines gibt es nicht: Sieger! Die ausgemergelten Huren geben sich ihren Freiern wahllos hin und waschen bei Bedarf auch deren Leichen. Der arme Said (Ferhade Feqi) kann sich nur jeglicher Verstrickung entziehen, indem er alle verrät, auch seine Frau Leila, „die hässlichste Tochter des Landes“. Diese oszilliert, beeindruckend eindringlich gespielt von Simone Thoma, zwischen Kindlichkeit und Wahnsinn und findet schließlich in einem suizidalen Tanz ihr Ende. Die Besatzer glänzen mit Siegelring, Reitstiefeln und goldenem Harnisch. Eine brüchige Fassade, hinter der sie sich alkoholisiert in schwülstigen, homoerotischen Soldatenspielen verlieren, während die Gattinnen zum Negligé Stahlhelm tragen müssen. Um Genets Dramenungetüm spielbar zu machen, wurde das Stück von Dramaturg Helmut Schäfer stark gekürzt. Durch die Ergänzung von Textpassagen aus Genets „Vier Stunden in Chatila“ wird der Blick von den historischen Zuständen in Algerien hin zu der aktuellen Situation des Nahen Ostens gelenkt. Genets Prosatext beschreibt seine Eindrücke, die er beim Besuch im Palästinenserlager Chatila im September 1982 sammelte, kurz nachdem dort christliche Milizen unter den Augen der israelischen Besatzer ein Massaker angerichtet hatten. Dass diese Textpassagen nach der Premiere zunächst – auf Anweisung des Verlages - gestrichen werden mussten, rief bei einigen Zuschauern den Verdacht politischer Zensur hervor, doch tatsächlich waren lizenzrechtliche Auseinandersetzungen Hintergrund dieser Maßnahme. Als „ästhetische Dummheit“ bezeichnete Schäfer verärgert im Gespräch die Haltung der Lizenzeigentümer, die seiner Fassung des Textes kein grünes Licht gaben. In Anbetracht der Menge von Hintergrundwissen, das nötig ist, um die Inszenierung in all ihren Facetten zu verstehen, ist die Bezeichnung „Theater für Fortgeschrittene“ sicher berechtigt. „Theater ist ein Ort an dem Rätsel entstehen!“, erklärt Ciulli dagegen seine Auffassung des Dramas und macht dem Publikum damit das Angebot sich von den eigenen Impressionen und Interpretationen leiten zu lassen und auch das Unerklärliche als anregendes Bestandteil des Rätsels zu genießen.