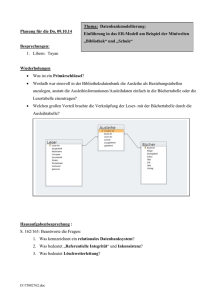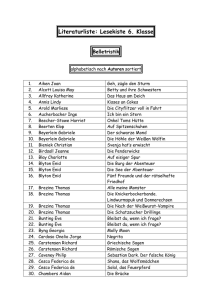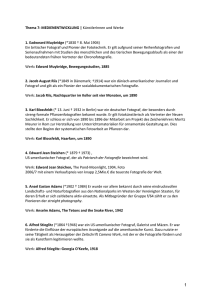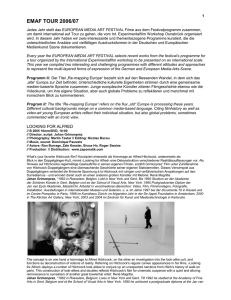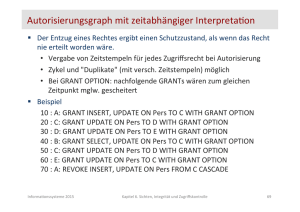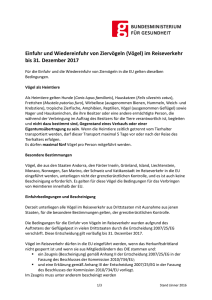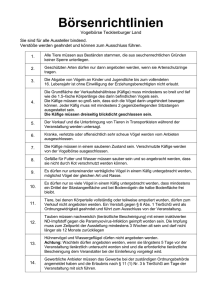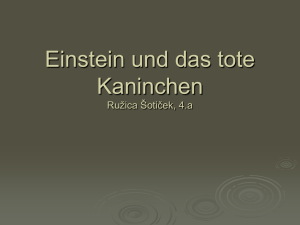Essay-Ott
Werbung

„Protect your eyes!” oder Wie Hitchcock uns das Sehen zeigt Karl-Heinz Ott Die Spionage- und „Psycho“-Thriller von Hitchcock leben von Geschichten, die das Gruseln lehren, wobei es ein Gruseln ist, das oft eher im Innenleben als in der sichtbaren Welt seine Wirklichkeit besitzt. Dabei kommen uns, wenn wir an die „Vögel“ oder „Vertigo“, an „Psycho“ oder „Das Fenster zum Hof“ denken, nicht in erster Linie die dramatischen Zuspitzungen und Geschehnisse, sondern vielmehr bestimmte Bilder in den Sinn, die sich – wie nur wenige andere aus der Filmgeschichte – in unser Gedächtnis eingefräst haben. Selbst wenn wir die jeweilige Story nur vage in Erinnerung haben, sind einzelne Szenen sofort wieder präsent. Zwar ist es nicht verwunderlich, wenn uns bei Filmen vor allem das Visuelle in Erinnerung bleibt. Dennoch kann man zwischen solchen Regisseuren unterscheiden, die – wie etwa Wim Wenders – von Bildern leben, an die sie dann ihre wie nachträglich erfundenen Geschichten ankleben, und solchen, die auf den Plot setzen. Hitchcock, so scheint mir dagegen, ist in jedem Augenblick Bühnenbildner, Maler, Lichtarchitekt und subtiler Zuchtmeister der Schauspieler in einem. Zahllose Einstellungen besitzen bei ihm den Charakter von Gemälden, wie sie auch in einem Museum hängen könnten, ohne dass bei ihm deshalb die Handlung an zweiter Stelle stünde. Gelegentlich wurde Hitchcock bereits in eine Ahnengalerie mit Shakespeare, Edgar Allan Poe und Kafka eingereiht, doch mit ähnlichem Recht könnte man ihn auch der bildenden Kunst zuordnen, zumal er in seinen Filmen den Bezug zur Malerei immer wieder ostentativ herausgestellt hat. Sehen wir einmal davon ab, dass Buñuel schon früh Experimente mit Dalí gemacht hat, und blenden wir einmal für einen Augenblick aus, dass es seit Godard nichts Ungewöhnliches mehr ist, wenn ein Filmemacher sein eigenes Medium thematisiert und sein Werk als disparates Text-, Musik- und Bildgefüge konzipiert, so könnte man behaupten, dass es vor allem Hitchcock war, der seine ästhetischen Mittel als solche stets auch bewusst ausgestellt hat. Er hat das auf weit weniger explizite Weise als Buñuel oder Godard und ohne jeden forcierten Kunst- und Reflexionsanspruch getan, vielmehr geschieht es bei ihm spielerisch und gleichsam nebenbei, stets eingebettet ins Gesamtgeschehen und motivisch mit den Geschichten vernetzt. Das Thema bildnerischer Darstellungs- und Kompositionsprinzipien, des Sehens selbst, der Perspektive, des Bildausschnitts, der Farbgebung und Stimmungserzeugung rückt in seinen Filmen auffällig oft in den Blick. „Protect your eyes!“ heißt es in den „Vögeln“ einmal, wobei sich diese Warnung für uns Zuschauer in die paradoxe Bedeutung verkehrt: „Schaut genau hin!“ 1 Immer wieder weist Hitchcock uns auf seine ikonographische Erzählweise hin, und sei es nur, dass er – wie etwa in „Vertigo“ – ein Porträt ins Bild rückt, das nicht nur die Figuren im Film, sondern vor allem uns selbst in ein Verhältnis zum eigenen Schauen setzt. Wir beobachten, wie in einem Museum James Stewart und Kim Novak Gemälde betrachten, und auf einmal drängt sich der Gedanke auf, dass Hitchcock seine Filme ebenfalls wie Bilderbögen konzipiert hat und dass er uns das auch zu Bewusstsein bringen will. Als er für die Traumszenen in „Spellbound“ Salvador Dalí engagiert hatte und dieser tatsächlich fast zwei Monate lang in Hollywood Dutzende von Skizzen und Ölbildern entwarf, griff sich Hitchcock am Ende nur wenige seiner Vorschläge heraus. Er hatte Dalí geholt, um nicht mit den üblichen verschwommenen, vernebelten oder zitterigen Bildern, sondern vielmehr mit glasklaren Aufnahmen mentale Konfusionszustände darzustellen. Dalí schätzte er, wie er Truffaut gestand, wegen „der schneidenden Konturen seiner Werke, wegen der langen Schatten, der unendlichen Entfernungen und der Fluchtlinien, die sich im Unendlichen treffen.“ Tatsächlich taucht in „Spellbound“, gleichsam als Reminiszenz an den „Andalusischen Hund“, das Motiv des zerschnittenen Auges auf, und für wenige Augenblicke sehen wir uns tatsächlich mit Dalís surrealer Ästhetik konfrontiert. Doch obwohl Hitchcock in anderen Fällen gelegentlich auch weniger wichtigen Szenen weit mehr Platz eingeräumt hat, erschienen ihm Dalís Ideen schließlich zu kompliziert und artifiziell, weshalb er nur wenige von ihnen in den Film implantiert hat. Dabei war eine 20-minütige Traumszene bereits gedreht, der aber offensichtlich nur Ingrid Bergman nachgetrauert hat. Vergeblich schlug sie vor, das ungewöhnliche Opus einem Museum zu vermachen, um es als gleichsam autonomes Kunstwerk vor dem Verschwinden zu retten. Hitchcocks Ästhetik bewegt sich meist in den Grenzen des Gewohnten, doch das hat mit Konvention schon deshalb wenig zu tun, weil seine Licht- und Schattenspiele, seine Farbkompositionen, seine geradezu ruhige Art, eine quälende Unruhe auszudrücken, ihresgleichen suchen und unverwechselbar geworden sind. Die unaufgeregte Intensität, mit der er gleich in den Eröffnungsszenen unsere Aufmerksamkeit zu bannen versteht und auf jenen Suspense vorausweist, der von Anfang an bereits unmerklich anwesend ist, lässt seine Handschrift unter Hunderten ähnlich gemachter Filme sofort erkennen. Jeder von uns könnte auf Anhieb ein Dutzend Hitchcock-Bilder nennen, und mit Gewissheit gehören zu ihnen die Duschszene aus „Psycho“, das Bild der endlosen Ebene mit dem vertrockneten Maisfeld aus „North by Northwest“, und jene Myriaden von Vögeln, die sich auf Bäumen, Gartenzäunen, Stromleitungen und Dächern versammeln. Es kann aber auch nur das rote Kleid von Tippi Hedren oder das grüne von Kim Novak sein, oder auch nur eine Krawatte, ein schwarzes Telefon auf einer Kommode oder ein Glas Milch, das von innen heraus leuchtet. Diese an sich harmlosen Dinge entwickeln bei Hitchcock gerade durch ihre Unschuld eine Mächtigkeit, die monströser nicht sein könnte. Jenseits ihres praktischen Nutzens, den sie im Verlauf des Geschehens gewinnen, lädt Hitchcock sie mit einer 2 auratischen Bedeutung auf, wenn er sie gelegentlich wie Stillleben präsentiert, auf denen er eigens unser Auge ruhen lässt, als handle es sich um Morandis Vasen und Krüge. Überhaupt setzt Hitchcock trotz aller Verwicklungen und Intrigen selten auf einen äußerlichen Erregungsfuror. Manchmal lässt er sich erstaunlich viel Zeit, wie um die Bilder auf uns wirken zu lassen, auf dass wir gleichsam in ihnen umhergehen und sie studieren können. Und wenn er – selten einmal – dennoch eine Verfolgungsjagd inszeniert und den ebenso abgefüllten wie immer noch noblen Cary Grant in einer nächtlichen Harakirifahrt selbstmörderische Serpentinen hinabrasen lässt, dann ist das eher eine Parodie auf das Actionkino denn dessen Apologie. Meist bedient sich Hitchcock einer Bildersprache, die den Schrecken, das Grauen, den Abgrund bloß andeutet, sich aber im Wesentlichen hinter dem Sichtbaren versteckt. Beispielhaft mag dafür jene berühmte Szene aus „North by Northwest“ sein, in der so gut wie nichts geschieht. Cary Grant steht in einer wüstenhaften amerikanischen Landschaft, nachdem er der Anweisung gefolgt ist, mit dem Bus an einen bestimmten Ort zu fahren, um gleichsam auf freiem Feld einen gewissen Mister Kaplan zu treffen. Der Kamerablick verschafft uns aus der Vogelperspektive einen Eindruck von der unendlich einsamen, einförmigen Weite, die schattenlos unter der sengenden Mittagssonne liegt. Als der Bus nicht mehr zu sehen ist, versetzt uns ein Schnitt in die Bodenperspektive, als stünden wir wie Cary Grant da unten und wüssten nicht, was diese menschenleere Landschaft zu bedeuten hat. Abwechselnd schauen wir dann wie aus seinen Augen und gelegentlich wie von oben herab auf die öden Steinäcker, unter denen sich abseits der Straße auch ein Maisfeld befindet. Cary Grant steht neben einem verlorenen Bushaltestellenschild, wie stets mit Anzug und Krawatte, und schaut drein wie nicht abgeholt. Zwei, drei Mal sieht man von weitem ein Auto kommen, bei dem man nicht nur darauf wartet, dass es langsamer wird und anhält, sondern weit Schlimmeres vermutet, doch jedes Mal düst es wie jener Lastwagen vorbei, der die ganze Szenerie in eine Staubwolke hüllt. Dazwischen geschieht jeweils eine lange Weile wieder nichts, bis dann aus einem Feldweg ein Auto heranrollt, aus dem ein Mann in braunem Anzug und mit grauem Hut steigt, der sich schräg gegenüber, auf der anderen Seite, an den Straßenrand stellt. Die Hände in die Hosentaschen gedrückt, steht auch er fortan stumm und ein bisschen krumm herum, und wieder bewegt sich nur etwas in unserer Phantasie, ohne dass tatsächlich etwas geschieht. Scheinbar wartet der andere auf den Bus, der in die entgegengesetzte Richtung fährt, doch das wissen wir nicht. Alles ist möglich – dass er eine Pistole zückt, dass ein Kampf einsetzt, dass weiß Gott was zu erwarten ist. Aus den Augen des einen blicken wir immer wieder eine Weile zum andern, und aus denen des andern schließlich wieder zu dem einen hinüber. So geht das eine geraume Zeit hin und her. Es ist aber keineswegs wie in einem Western, wo alle Signale auf Rot stehen, wenn zwei Kerle aufeinander treffen. Mit fragendem Blick, aber durchaus unverkrampft – als besitze er kein Sensorium für das, was Angst ist – geht Cary Grant irgendwann die paar Schritte zu dieser Gestalt hinüber, grüßt sie und sagt: „Heiß heute“, worauf der andere wortkarg erwidert: „War 3 aber schon heißer.“ Der von weitem sichtbare Bus und ein am Horizont auftauchendes Flugzeug erlösen die beiden von ihrer Not, kein rechtes Stichwort für ein Gespräch zu finden. Vor dem Einsteigen bemerkt der Fremde noch: „Das ist ja komisch, dass der Pilot da drüben sein Pulver verspritzt, wo schon abgeerntet ist.“ Und dann setzt jene berühmte Verfolgungsjagd ein, die von der Luft aus stattfindet. Hitchcock hat bis hierhin den schieren Stillstand als ein Riesengemälde aus gelblich-brauner, asphaltgrauer, von einem endlosen blauen Himmel überwölbter Landschaft und damit das Gegenstück zu den üblichen Schauderszenarien inszeniert. Wäre Cary Grant für die Nacht in eine finstere, von matten Laternen schummerig erhellte Gasse bestellt worden, hätten wir sofort die stummen Ausrufezeichen wahrgenommen und gewusst, dass das Böse nicht weit ist. Doch Hitchcock schenkt uns ein Bild, das noch in keinem wie auch immer gearteten Museum hängt und seinesgleichen sucht. Er reichert es mit einer äußerst sparsamen Bewegungschoreographie an, die inmitten der imaginierten Gefahren beinahe Heiterkeit auslöst, ohne die Spannung auch nur einen einzigen Augenblick zu mindern. Allein, dass er für diese Rolle Cary Grant ausgesucht hat, der noch in der größten Konfusion seine Contenance wahrt, spricht Bände. Er spielt einen Geschäftsmann, der entführt und nach seiner Flucht mit allen nur erdenklichen Mitteln verfolgt wird, wobei er bald nicht mehr weiß, auf wen er sich noch verlassen kann und auf wen nicht. Von jetzt auf gleich beginnt ein lebensgefährlicher Wirrwarr und Irrsinn, der ihn an sich selbst und allen anderen verzweifeln lassen müsste, weil ihm so gut wie niemand mehr bestätigen kann, dass er derjenige ist, für den er sich vor wenigen Stunden noch gehalten hat. Um eine mit einer derartigen Identitätszerrüttung bedrohte Figur darzustellen, greift Hitchcock nicht, wie es nahe liegend wäre, auf einen tragisch imprägnierten Schauspieler zurück, der einem solchen Horror mit derangierten Gesichtszügen, Furchen in der Stirn und einem Wahnsinnsblick zum unmissverständlichen Ausdruck verhelfen könnte. Ganz im Gegenteil wählt er den eleganten, jovialen Cary Grant, der sich noch in größter Gefahr wie ein Seiltänzer über dem Bodenlosen bewegt. Zwar zählt „North by Northwest“ nicht zu den abgrundtief düsteren Hitchcock-Filmen, doch mit solchen scheinbaren Inkongruenzen und Gegenbesetzungen arbeitet Hitchcock auch sonst. Seine Bilder machen das Dunkle, Düstere und Mysteriöse selten auf den ersten Blick sichtbar, lassen es aber gerade dadurch und in den unsichtbaren Bildern dahinter aufscheinen. Schließlich nehmen wir den wirklichen Horror weniger auf der Leinwand als in unserer Phantasie wahr. Nicht zufällig begegnen wir in diesen Filmen immer wieder Gemälden, die Stillleben darstellen und damit vor allem Frieden ausstrahlen. In „Fenster zum Hof“ hängt in der Wohnung des von James Stewart gespielten, voyeuristisch-detektivischen Fotografen über dem offenen Kamin ein solches Bild, das wie ein Kontrast zu den aufgewühlten Gedanken wirkt, die in seinem Kopf kreisen. Und in der makabren Komödie „Immer Ärger mit Harry“ treffen sich die Dorfbewohner regelmäßig an einem Apfelweinstand, an dem außer Getränken Dutzende halbwegs abstrakter Obst- und Früchtebilder zum Verkauf angeboten werden. 4 Dabei vermitteln Stillleben immer auch etwas anderes, als vordergründig zu erkennen ist. Es müssen nicht gleich tote Fasane auf ihnen zu sehen sein, es genügen auch Birnen und Ähren, um in deren herbstlicher Schönheit etwas Totes zu erblicken. Man muss nicht gleich die biblische Geschichte vom verbotenen Apfel bemühen, um sich die Mehrdeutigkeit dieser Frucht in Erinnerung zu rufen. Es genügt, sich zu vergegenwärtigen, dass ein gedeckter Tisch ohne das Naturgesetz von Fressen und Gefressenwerden kaum denkbar ist. Der Vorgang des Verspeisens und Vertilgens kehrt in Hitchcocks Filmen regelmäßig wieder, und sei es nur nebenbei, wie etwa zum Auftakt von „Frenzy“, wenn der – später als Krawattenmörder identifizierte – Marktvorsteher an einem Sommermorgen einen Apfel verspeist. In „Rope“ – auf Deutsch: „Cocktail für eine Leiche“ – lassen zwei Studenten von ihrer Haushälterin ein kaltes Büffet auf einer Truhe herrichten, in die sie ihren ermordeten Kommilitonen gesteckt haben. Es ist ein mit Kandelabern geschmückter Altar, auf dem Brot und Wein und Häppchen gereicht werden, wobei auch die Eltern des Toten zu dem Empfang eingeladen wurden, ohne dass sie von ihrer noch warmen Sohnesleiche, der sie während des Essens, Trinkens und Plauderns seltsam nah sind, etwas ahnen können. Und in „Topaz“ trifft sich im Nebenzimmer eines Pariser Restaurants eine Gruppe französischer Geheimdienstler zu einem wortkargen Mahl, an dem – gleich Judas beim Letzten Abendmahl – auch ein Doppelagent teilnimmt, der sich danach eine Kugel in den Kopf schießt und selbst richtet. All das verknüpft sich mit dem Bild von Gottes Gaben, die in Gestalt von Tafelrunden und Stillleben an den tödlichen Spielen teilhaben. Nur in dem Film „Sabotage“ rücken Messer und Gabel als Mordwerkzeuge in den Blick, nachdem der Lebensgefährtin eines Bombenattentäters, der durch ein Versehen ihren Sohn auf dem Gewissen hat, offensichtlich für immer der Appetit vergangen ist. Selten tendiert Hitchcock zu expressiven Überzeichnungen, eher zielen seine Arrangements darauf, unser inneres Auge, das heißt: unsere seelische Welt, in Erregung zu versetzen. Das Gegenteil erleben wir bei solchen Regisseuren, die jede Art von Schrecken hochenergetisch und offensichtlich vorführen wollen, damit jedoch unsere Phantasie keineswegs entzünden, sondern torpedieren. Ihnen liegt mehr daran, uns ihre eigene, scheinbar üppig sprießende Imaginationskraft vorzuführen, anstatt es dem Zuschauer zu überlassen, hinter dem friedlichen Schein die Bedrohung, hinter der Schönheit die Zerrüttung, hinter der Normalität die Katastrophe zu erahnen. Hitchcock dagegen führt vor, was Freud in seiner Studie über „Das Unheimliche“ hervorhebt, von dem dort behauptet wird, es sei das uns Allervertrauteste, in dem wir uns wie in nichts anderem auskennen, obwohl oder gerade weil wir es in seiner Anziehungskraft so sehr abwehren. Freud veranschaulicht seine These unter anderem mit einer Erfahrung, die unsere frühe Kindheit prägt und in der Kunst fortbesteht. Als wir nämlich Puppen wie Menschen behandelt, sie liebkost, ausgeschimpft, an- und ausgezogen und im Bett neben uns schlafen gelassen haben, trieben wir die Ähnlichkeit des Leblosen mit dem Lebenden so weit, dass wir den Verlust eines solchen Stoffstücks als schlimmste Sache der Welt empfinden konnten. In gewisser Weise setzt sich diese Belebung des Unbelebten in der bildenden Kunst fort, wenn wir etwa einem Gemälde einen unermesslichen, jedes menschliche Maß übersteigenden 5 Wert zumessen. Auch wenn wir mit ihm nicht wie mit einer Puppe spielen, an ihm zerren und es wieder besänftigen können, strahlt es für uns zuweilen ein Leben aus, wie es Wesen aus Leib und Blut oft kaum vermögen. Aus der Antike ist uns die Geschichte von Pygmalion überliefert, der sich aus Elfenbein eine Frauengestalt geschnitzt hat, in die er sich heillos verliebte. Aus Erbarmen mit dem beinahe in den Wahnsinn Getriebenen erweckte Aphrodite die Skulptur zum Leben, und sie gebar ihrem Schöpfer, wie der Mythos berichtet, sogar eine Tochter. In „Psycho“ pervertiert Hitchcock diese Erweckungslegende, wenn er uns am Ende das Bild eines Skeletts präsentiert, das angezogen im Schaukelstuhl sitzt. Es ist die Mutter von Norman Bates, der mit ihr, wie sich am Ende herausstellt, immer noch zusammenlebt, während alle anderen sie im Grab wähnen. Jener jungen Frau, die vor einem wolkenbruchartigen Regen in seinem gottverlassenen Motel Zuflucht gesucht hat und die er später unter der Dusche niedermetzeln sollte, bekennt er: „Der beste Freund für einen Mann ist seine Mutter.“ Auch Norman Bates hat seinem Opfer ein Abendbrot hergerichtet, und während die Frau es zu sich nimmt, reden die beiden über die ausgestopften Käuzchen und Krähen, die mit gespreizten Flügeln über ihren Köpfen an der Wand hängen. „Sie essen wie ein kleiner Vogel“, bemerkt er, worauf sie meint: „Das müssen Sie ja wissen!“ – „Sie kennen den Ausdruck: Isst wie ein kleiner Vogel?“, hakt er nach und erklärt: „Aber das ist falsch. In Wirklichkeit fressen Vögel, auch die kleinsten, eine Unmenge. Wissen Sie, eigentlich weiß ich gar nicht viel über Vögel, denn mein Hobby ist, alles Mögliche auszustopfen. Das heißt allerdings – stopfe ich am allerliebsten Vögel aus. Ich hasse den Blick von großen und wilden Tieren, wenn sie tot sind. Manchmal stopfen Menschen sogar Hunde und Katzen aus. Das könnte ich nicht. Die großen, leeren, aufgerissenen Augenhöhlen. Vögel sind viel netter und nicht so menschenähnlich.“ Als sie ihm, ein wenig verlegen, mit der Bemerkung zustimmt, jeder Mensch brauche ein Hobby, versucht er seine aufkommende Erregung niederzuhalten und sagt ein wenig stammelnd: „Nur – für mich ist es viel mehr als ein Hobby. Ein Hobby vertreibt einem die Zeit, aber es füllt sie nicht aus.“ Wie eine Puppe, neben der keine andere Frau Platz hat, füllt auch seine im Schaukelstuhl hin- und herwippende, längst verwesende Mutter sein Leben aus. Aber nicht nur Stillleben, ausgestopfte Vögel und bekleidete Mutterskelette, auch Ahnengalerien, Ahnenporträts und Ahnenhinterlassenschaften können die Lebenden weit mehr terrorisieren als ihre Zeitgenossen dies zu tun vermögen. Wenn jedoch die toten Geschlechter wie ein Alp auf dem Gehirn der Lebenden lasten, wie es bei Marx heißt, und ihre Bilder zu unnachahmlichen Vorbildern stilisiert werden, bleibt nur noch wenig Luft zum Atmen. Die Haushälterin des Schlossherren Mister de Winter vergöttert ihre einstige Herrin Rebecca, die dem Film den Titel verleiht, zu einer solch allgegenwärtigen, noch im Tod dominierenden Gestalt. An ihrem Bild muss sich ihre namenlos bleibende Nachfolgerin, die zweite Frau von Mister de Winter, unentwegt messen, was sie schließlich an den Rand eines Zusammenbruchs bringt. 6 Dabei beginnt dieser Film mit einem Gespräch über die unerfüllbaren Ideale der bildlichen Darstellung. Ihr Vater, so erzählt die junge Frau ihrem künftigen Mann, sei ein Künstler gewesen, der ausschließlich Wiesen gemalt habe – am Ende nur noch eine einzige, da für ihn das größte Glück darin bestehen sollte, von einem Gegenstand oder einem Menschen die Höchstform zu finden und daran festzuhalten. Man mag dabei an Monets viele Seerosenteiche, an Cézannes dutzendfach gemalten „Mont Ventoux“ oder wiederum an Morandis Krüge und Vasen denken, nur dass wir bei Hitchcock Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung kaum auseinander dividieren können. „Und was haben Sie gemacht, während Ihr Vater seine Wiesen gemalt hat?“, fragt Mister de Winter süffisant, worauf sie, ein wenig beschämt, auf ihre Hobbyzeichnerei verweist. Kurz darauf beklagt er sich, weil ihm auf einer ihrer Porträtskizzen seine Nase nicht passt, doch sie kontert, nichts dafür zu können, wenn er ständig seinen Ausdruck wechsle. Ohne tiefgründige Reflexionsanstrengung handelt Hitchcock mit solchen Sätzen die weit reichenden Fragen der Nichtdarstellbarkeit, des Festhaltens und des Todes, aber auch der Differenz zwischen den bewegten Bildern des Kinos und den stillgestellten der Malerei ab. Dabei bildet das Zentrum einiger seiner wichtigsten Filme ausgerechnet jene Leere, der Hitchcock den Namen „MacGuffin“ verliehen hat. Zwar dreht sich alles Geschehen um diesen ungreifbaren Ort, aber wie beim alttestamentarischen Bilderverbot hat er gestaltlos zu bleiben. Wobei das Erstaunlichste ist, dass dem Zuschauer nicht das Geringste fehlt, wenn er gar nicht erfährt, worin der Grund der ganzen Aufregungen, Intrigen und Mordabsichten besteht. Letztlich ist es wie mit der Frage nach Gott und dem Nichts, die beide identisch seien, sich aber auch ausschließen können. Hitchcocks Filme belassen diese Geheimnisse als solche, weil sie letztlich nur als „unbewegte Beweger“, die dann selbst keine aktive Rolle mehr spielen, alle Geschehnisse in Gang setzen. So wird – wie schon gesagt - in „North by Northwest“ ein Mann entführt, der offensichtlich für einen anderen gehalten wird, der jedoch, anstatt zur Polizei zu flüchten, das Spiel mit seinen Verfolgern aufnimmt, was die Dinge nicht gerade durchschaubarer macht. Kein Mensch weiß, wer warum auf welcher Seite steht und worum es eigentlich geht. Doch das spielt auch keine Rolle, schließlich genügt es vollauf, dass die Geschichte ihren verworrenen Lauf nimmt und stets für Spannung gesorgt ist. Das geheimnislose Geheimnis beginnt bereits beim Titel, der einem sinnlosen Satz von Hamlet entstammt, ohne dass das kryptische Zitat im Verlauf des Films je noch einmal eine Rolle spielt. Den beiden Spitzeln Güldenstern und Rosenkranz, die bei Shakespeare herausfinden sollen, ob Hamlet tatsächlich irr ist oder nur heimtückisch den Irren mimt, antwortet dieser: „Ich bin nur irr bei Nord-Nord-West. Kommt der Wind vom Süden her, kann ich einen Habicht von einer Säge durchaus unterscheiden.“ Fortan dürfen Rosenkranz und Güldenstern rätseln, welche Botschaft hinter diesem Satz verborgen sein könnte. Bei seiner Arbeit, so gestand Hitchcock Truffaut, habe er sich immer vorgestellt, dass die Geheimpapiere, Geheimdokumente, geheimen Gifte und Schätze und alle sonstigen Geheimnisse ungeheuer wichtig für seine Figuren sein müssten, doch ganz ohne jede Bedeutung für ihn, den Erzähler. Man muss hinzufügen, dass die nichtige Wichtigkeit des MacGuffin auch für den Zuschauer ohne Belang bleiben kann. „Mein bester MacGuffin – und 7 darunter verstehe ich den leersten, wertlosesten, lächerlichsten – ist der von ‚North by Northwest’“, hat Hitchcock bekannt. Und er vergaß nicht zu erzählen, dass Cary Grant mitten während der Arbeit eines Tages zu ihm gekommen ist und gestöhnt hat: „Ich glaube, das ist ein fürchterliches Drehbuch. Wir haben jetzt schon ein Drittel des Films abgedreht, es passiert alles Mögliche, und ich weiß noch immer nicht, worum es geht.“ Cary Grant hat damit in den Augen seines Regisseurs seine Rolle auf paradoxe Weise restlos erfasst, ohne zu wissen, dass er längst das Entscheidende begriffen hat. Um keine weiteren Fragen offen zu lassen, erzählt Hitchcock in diesem Zusammenhang noch einmal die Essenz des Films, wenn er erläutert: „‚North by Northwest’ ist ein Spionagefilm, und in der Geschichte geht es nur um eine einzige Frage: Was suchen die Spione? In der Szene auf dem Flugfeld von Chicago wird Cary Grant von dem CIA-Mann alles erklärt. Und als Cary Grant dann mit Blick auf James Mason fragt: ‚Und was macht der da?’, da antwortet der andere: ‚Sagen wir Import-Export.’ – ‚Ja, aber was verkauft er denn?’ – ‚Na, eben Regierungsgeheimnisse.’ Sehen Sie“, fasst Hitchcock zusammen, „da haben wir den MacGuffin, reduziert auf seinen reinsten Ausdruck: nichts.“ Den Motor aller Bilder bildet also ein bilderloser Mittelpunkt und Untergrund, aus dem alles kommt und auf den alles zurückweist und der dafür sorgt, dass all die Erregungen und Phantasmen, die das Ungreifbare so inständig umkreisen, aufs Ganze gesehen nie ein Ende finden können. 8