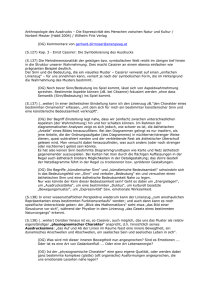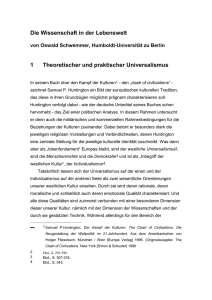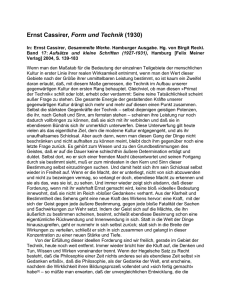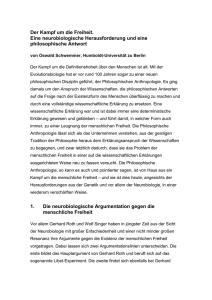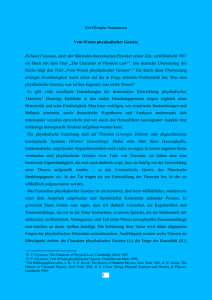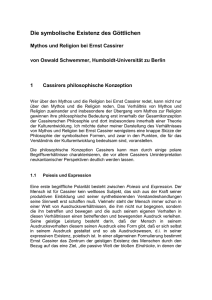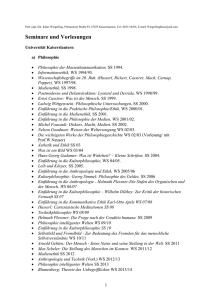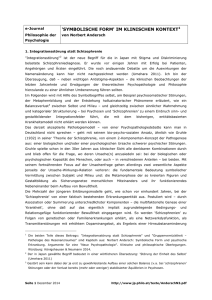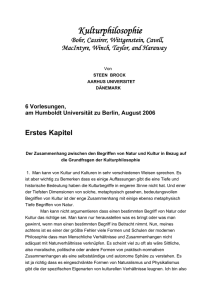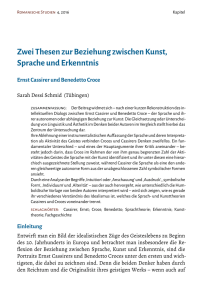Infos
Werbung

Ernst Cassirer und die zwei Kulturen von Oswald Schwemmer, Humboldt-Universität zu Berlin 1 Die zwei Kulturen und der Formbegriff Obwohl in den letzten zehn Jahren eine bemerkenswerte Intensivierung der Cassirer-Forschung stattgefunden hat, sind einige der zentralen Konzepte in der Philosophie Cassirers noch weitgehend unthematisiert geblieben. Eines dieser Themen ist Cassirers Sicht auf die seit Charles Percy Snow1 so genannten zwei Kulturen, das Verhältnis zwischen Naturwissenschaften und Literatur bzw. zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Dabei ist es für Cassirer selbst ein zentrales Projekt, Natur- und Geisteswissenschaften – diese zumeist paradigmatisch vertreten durch die Biologie und durch die Geschichtswissenschaft – in ihrem gemeinsamen Charakter als Wissenschaften zu verstehen. Das Überraschende bei diesem Projekt ist allerdings [– und dies mag auch die bisher eher zögerliche Beschäftigung mit diesem „einheitswissenschaftlichen“ Projekt Cassirers erklären2 –], dass es ein eher neutraler Begriff ist, mit dem Cassirer die Brücke schlagen will, auf der ein Weg die beiden Kulturen miteinander verbindet. Es ist dies der Begriff der Form. 1 Charles Percy Snow stellte die These von den zwei Kulturen 1959 in der Rede-Lecture auf. S. dazu: Charles P. Snow, Die zwei Kulturen : Literarische und naturwissenschaftliche Intelligenz. (Aus d. Engl. übers. von Grete u. Karl-Eberhardt Felten), Stuttgart [Klett Verlag] 1967; Charles P. Snow (Ed. and ann. by Kurt Schrey), The two cultures and a second look . Frankfurt a.M./ Berlin/Bonn/München [Diesterweg] 1968. 2 Verdienstvoll sind hier die Studien über Cassirers Verständnis der Naturwissenschaften: Karl-Norbert Ihmig, Cassirers Invariantentheorie der Erfahrung und seine Rezeption des ,Erlanger Programms‘. Cassirer-Forschungen Band 2. Hamburg [Felix Meiner Verlag] 1997; Enno Rudolph / Ion O. Stamatescu (Hg.), Von der Philosophie zur Wissenschaft. Cassirers Dialog mit der Naturwissenschaft. Cassirer-Forschungen Band 3. Hamburg [Felix Meiner Verlag] 1997; Christiane Schmitz-Rigal, Die Kunst des offenen Wissens. Ernst Cassirers Epistemologie und Deutung der modernen Physik. Cassirer-Forschungen Band 7. Hamburg [Felix Meiner Verlag] 2002. Von großer Bedeutung für Cassirers Verständnis der zwei Kulturen ist der Lebensbegriff, der neben und zusammen mit dem Formbegriff dieses Verständnis begründet. Vgl. dazu Christian Möckel, Urphänomen des Lebens. Ernst Cassirers Lebensbegriff. Cassirer-Forschungen Band 12, Hamburg [Felix Meiner Verlag] 2005. Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 2 Dabei ist allerdings einzuräumen, dass Cassirer in seinen verschiedenen Formulierungen durchaus nicht eindeutig ist und vielfach eine genauere Klärung erst gar nicht unternimmt. Dies hängt mit einer stilistischen Eigenart zusammen, die sich durchgängig in seinem Werk zeigt. Sie besteht darin, dass Cassirer eher auf bestimmte endgültige Formulierungen, auf Formeln, aus ist als auf deren schrittweise Erläuterung und Begründung. Diese Formeln – wir werden ihnen noch begegnen – tauchen immer wieder auf und werden von Cassirer als Beglaubigungsinstanzen herangezogen, die den Wahrheitsgehalt der diskutierten These garantieren sollen. Vor allem im Wortfeld des Dynamischen sammeln sich diese Formeln, wenn es um das Verhältnis zwischen biologischem und historischem Wissen geht. Da ist die Rede von den Energien des Geistes und den Potenzen des Lebens, vom Werden – sei es zur Form oder sei es zum Sein –, vom Wandel und vom Bewegenden, vom Gestalten und Erzeugen, von den dynamischen Prozessen des Lebens und der Dynamik des geistigen Werdens, von der Metamorphose im organischen Sein und zugleich im Sein der Kultur. Seine besondere Pointe gewinnt dieses Wortfeld durch seine Kontrastierung mit den statischen Momenten des Festen und Konstanten, der Permanenz und der Einheit der Gestalt. Indem dann beide, das Dynamische und das Statische – dies allerdings im Sinne eines Statischen im Dynamischen – aufeinander bezogen werden, ergibt sich als Drittes eine übergreifende Dynamik, die über eine Semantik der gespannten Bezüge charakterisiert wird: zunächst als Verhältnis der Polaritäten, der Spannungen, des Gegensatzes oder auch des Kampfes – und dann auch hier wieder in einer pointierenden Steigerung als ein Moment des Ausgleichs und des Gleichgewichts in diesen gespannten Bezügen. Cassirer selbst bringt dieses in sich gespannte Verhältnis dynamischer Entwicklungen mit dem Formbegriff zusammen: „Nur in [...] dynamischen Gleichnissen, nicht in irgendwelchen statischen Bildern läßt sich die Form als werdende Form, als beschreiben. Wie die scholastische Metaphysik den Gegensatz zwischen dem Begriff der ,natura naturata‘ und der ,natura naturans‘ geprägt hat, so muß die Philosophie der symbolischen Formen zwischen der ,forma formans‘ und der ,forma formata‘ unterscheiden. Das Wechselspiel Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 3 zwischen beiden macht erst den Pendelschlag des geistigen Lebens selbst aus. Die ,forma formans‘, die zur ,forma formata‘ wird, die um ihrer eigenen Selbstbehauptung willen zu ihr werden muß, die aber nichtsdestoweniger in ihr niemals gänzlich aufgeht, sondern die Kraft behält, sich aus ihr zurückzugewinnen, sich zur ,forma formans‘ wiederzugebären – dies ist es, was das Werden des Geistes und das Werden der Kultur bezeichnet.“3 Es ist diese Rede von dem ständig sich erneuernden Wechselverhältnis zwischen der forma formans und der forma formata, von einem dynamischen Spannungsverhältnis von aufeinander bezogenen Polaritäten, die uns den Schlüssel zu Cassirers Formbegriff liefert. Dieser Formbegriff steht für ein Formgeschehen, für den ständigen Prozess einer immer neuen Formbildung, den ständigen Wechsel von Formbefestigung und Formerneuerung. Wie bereits gesagt, sieht Cassirer dieses dynamische Verhältnis von gewordener Form und werdender Form nicht nur als kulturelle Prozessform, sondern auch als die Charakteristik aller Lebensprozesse. Dem entspricht dann auch, dass Cassirer durchgängig in seinem Werk Geist und Leben in einen strukturellen Zusammenhang bringt. So bemerkt Cassirer in einer kritischen Bemerkung zu Linné, dass „das eigentliche Leben der Natur“ im „Übergang [der Arten], in ihrer Entwicklung und Umbildung“ bestehe.4 Dieser Gedanke der Formung und Umformung charakterisiert – wie Christian Möckel in seiner umfassenden Studie über das Urphänomen des Lebens eingehend darstellt5 – das Leben überhaupt und nicht nur das Leben des Geistes. Und auch, was die innere Gliederung, die „innere Form“ des Lebens angeht, finden sich zu biologischen Lebensphänomenen und historischen Sinnverhältnissen gleichartige Charakterisierungen. So stellt Cassirer im Anschluss an Cuvier für die Erforschung biologischer „Strukturverhältnisse“ fest: 3 Ernst Cassirer, Nachgelassene Manuskripte und Texte. Hg. von John Michael Krois und Oswald Schwemmer (ab Band 2: Hg. von Klaus Christian Köhnke, John Michael Krois und Oswald Schwemmer. Im folgenden zitiert als ECN) Band 1: Zur Metaphysik der symbolischen Formen. Hg. von John Michael Krois unter Mitwirkung von Anne Appelbaum, Rainer A. Bast, Klaus Christian Köhnke, Oswald Schwemmer. Hamburg [Felix Meiner Verlag] 1995, ECN Band 1, S. 17f. 4 Ernst Cassirer, Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe. Hg. von Birgit Recki. (Im folgenden zitiert als ECW) Band 15: Die Philosophie der Aufklärung, Hamburg [Felix Meiner Verlag] 2003, S. 80. 5 Christian Möckel, Urphänomen des Lebens. Ernst Cassirers Lebensbegriff. A.a.O. Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 4 „Alles Sein ist durchgängig gegliedert; es ist demgemäß nicht nur eine zufällige Verbindung von Teilen, sondern ein geschlossener Zusammenhang, dem eine eigentümliche Art von Notwendigkeit anhaftet. Ist es uns einmal gelungen, die Haupt- und Grundtypen der Lebewesen zu erkennen […], so wissen wir damit nicht nur, was tatsächlich existiert, sondern auch was miteinander bestehen kann und nicht bestehen kann. […] Denn alles Einzelne ist hier aufeinander bezogen und greift ständig ineinander ein.“6 2 Form in der Welt des Lebens Formbildung und Gerichtetheit auf Formbildung, so können wir sagen, ist ein Charakteristikum von Leben überhaupt: „,Leben‘ ist nicht blinder Drang; es ist [...] ,Wille zur Form‘, Sehnsucht nach Form“.7 Wie sollen wir diesen Anthropomorphismus verstehen? Wie sind die Formelwendungen „Wille zur Form“ und „Sehnsucht nach Form“ aufzulösen, ohne sie in das semantische Abseits verunglückter Metaphern abzuschieben? Hilfreich für eine Antwort scheint hier eine Unterscheidung, die Cassirer für verschiedene Wissenstypen anführt, und ein besonderes Charakteristikum der Formbildung, die den Begriff der Form oder noch deutlicher den der „inneren Form“ in seiner Bedeutung für unsere Darstellung der Weltwirklichkeit erst verständlich macht. 6 ECW Band 5: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Vierter Band: Von Hegels Tod bis zur Gegenwart (1832-1932). Hamburg [Felix Meiner Verlag] 2000, S. 150. 7 ECN Band 3: Geschichte. Mythos, mit Beilagen: Biologie, Ethik, Form, Kategorienlehre, Kunst, Organologie. Sinn, Sprache, Zeit. Hg. von Klaus Christian Köhnke, Herbert KoppOberstebrink und Rüdiger Kramme. Hamburg [Felix Meiner Verlag] 2002, S. 214. Vgl. auch die vorangehende Formulierung: „Das blosse Leben, das nichts anderes wäre als das Leben, gehört jedenfalls nicht zu den psychischen ,Phaenomenen‘ – es ist eine metaphysische Konstruktion. Nimmt man das Leben als reines Phaenomen, so hat man an ihm immer schon die intentionale Gerichtetheit – so hat man also an ihm die ,Idee‘, auf die es ,hinzielt‘[.] Dies ist der Sinn der Platonischen Eros-Lehre – Das Leben ist nicht blinder Wille, Trieb[,] es ist , u[nd] dieser greift über sich selbst hinaus – er begehrt nicht blind, sondern er ,sehnt sich‘ nach der Form […]“ (Ebd., S. 215) Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 5 Zunächst zur Unterscheidung zwischen Ursachen- und Formwissenschaft oder auch Gesetzes- und Strukturwissenschaft. Mit großer Selbstverständlichkeit spricht Cassirer häufig davon, dass es den Naturwissenschaften um die Erforschung von Ursachen und die Erkenntnis von Gesetzen geht. Dabei sind diese Formulierungen durchaus nicht eindeutig. Denn auch eine Struktur kann als Ursache aufgefasst werden, und Gesetze können zwar Verlaufsgesetze, aber auch Strukturgesetze sein. Was Cassirer aber, wie der jeweilige Kontext zeigt und er selbst oft auch deutlich macht, meint, ist die Gegenüberstellung von Ereignissen und Strukturen. Eine Ursache ist für ihn ein Ereignis, das einen bestimmten Ablauf auslöst, an dessen Ende dann die Wirkung steht. Ein Gesetz wäre dann erkennbar, wenn dieser Ablauf sich immer wieder ereignete und damit jeweils als Fall dieses allgemeingültigen Gesetzes verstehen ließe. Tatsächlich lässt sich ein solcher Ablauf aber nur unter genau definierbaren Bedingungen reproduzieren. Wir müssen ihn gleichsam aus der Welt heraus isolieren, damit keine unerwarteten oder unkontrollierbaren Einflüsse auf ihn einwirken können. Wir tun dies gewöhnlich durch den Bau von Laboren, von im wörtlichen Sinne abgedichteten Räumen, in denen die immer gleichen Bedingungen oder aber auch kontrollierte Abweichungen von ihnen für bestimmte Abläufe hergestellt werden können. Eben dies geschieht, wie auch Cassirer sagt, im „physikalische[n] Experiment, das die eigentliche und einzig legitime Grundlage aller Gesetzesaussagen ist.“8 Die Erfolgsgeschichte der 8 ECW Band 19: Determinismus und Indeterminsmus in der modernen Physik. Historische und systematische Studien zum Kausalproblem. Hamburg [Felix Meiner Verlag] 2004, S. 52: „Der Anspruch, den das Experiment in sich schließt, besteht ja eben darin, an eine Feststellung, die an und für sich auf ein individuelles Hier und Jetzt bezogen und an dasselbe gebunden ist, eine Folgerung anknüpfen zu dürfen, die von dieser Schranke frei ist – die übertragbar ist auf andere Raum- und Zeitstellen. Ein Versuch, der nur die Vorgänge in einem bestimmten Laboratorium und im Augenblick der Ablesung bestimmter Instrumente beschreiben wollte, hätte methodologisch offenbar keinerlei Wert: Er würde lediglich einen singulären Fall bezeichnen, der sich der Kette der stetigen physikalischen Beobachtung und Schlußfolgerung nicht einreihen ließe. Für diese Einreihung bedarf es der Voraussetzung, daß wir das, was im Einzelexperiment festgestellt wurde, von Ort zu Ort, von Augenblick zu Augenblick übertragen, daß wir es gewissermaßen frei verschieben können, ohne dadurch etwas an der ,Natur‘, an der Wahrheit der Feststellung zu ändern. Der fragwürdige und prekäre Schluß von ,einigen‘ Fällen auf ,viele‘, von ,vielen‘ auf ,alle‘ tritt hierbei nirgends auf: Denn in dem, was das Experiment aussagt, wird nicht sowohl von einem Hier auf ein Nicht-Hier, von einem Jetzt auf ein Nicht-Jetzt geschlossen, sondern es wird bewußt über den Gesichtspunkt des bloßen Hier und Jetzt hinausgegangen. Es findet nicht eine Erweiterung innerhalb der räumlich-zeitlichen Sphäre, sondern gewissermaßen eine Aufhebung dieser gesamten Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 6 klassischen Mechanik verdankt sich eben dieser Konstruktion und ihrer auch alltagstechnischen Realisierung. Die auf dieser Isolationsmethode beruhenden Geräte – von den Verbrennungsmotoren bis zu unseren Kühlaggregaten – sind eine Art von alltäglichen Gebrauchslaboren, die nicht mehr funktionieren, wenn ihre Abdichtung gegen die Umwelt schadhaft geworden ist. Und damit sind wir bei der Betrachtung von Strukturen. Alle Verlaufsgesetze, die wir kennen, gelten nur unter bestimmten Randbedingungen. Wenn die Temperatur, der Luftdruck usw. zu hoch oder zu niedrig sind, lassen sich bestimmte Abläufe nicht mehr herstellen. Diese Randbedingungen ergeben sich aus den Strukturen der jeweiligen Umgebungen, in denen sie stattfinden. In organischen Systemen dagegen finden wir interne Veränderungen, die aus sich heraus bzw. in sich selbst, also in ihrer inneren Gliederung Neues und vielfach Unerwartetes oder Unkontrollierbares hervorbringen. Und im strengen Sinne isolieren lassen sich Lebensprozesse auch nicht. Leben ist nur möglich im ständigen und vielfältigen Austausch mit seiner Umwelt. Leben ist nur möglich, so kann man es auch sagen, als ein System von Systemen. Und zwar von Systemen, die sich in sich selbst organisieren und wechselseitig aufeinander einwirken. Und all dies wiederum in Wechselwirkung mit ihren Umwelten. In diesen komplexen Systemzusammenhängen sind auch anorganische Strukturen integriert. Aber als Teile von Lebensprozessen sind sie ständig sich verändernden Randbedingungen ausgesetzt und so auch nicht nur in der ihnen eigenen Kausalität unter isolierten „Normalbedingungen“ darstellbar, sondern – in der Sprache Cassirers – als Elemente eines umfassenden komplexen Formverhältnisses. Denn eben dies ist für Cassirer eine Form: eine sich selbst gliedernde Struktur bzw. ein solches System. Beide Termini verwendet Cassirer übrigens auch selbst. Kehren wir damit zurück zu der Rätselformel vom Leben als Willen zur oder Sehnsucht nach Form. Sphäre, es findet der Fortgang in eine neue Dimension statt: Und diese Änderung der Dimension ist es, die die Gesetzesaussagen von den bloßen Maßaussagen unterscheidet.“ Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 7 Zunächst dieses: Einen Willen zu etwas oder eine Sehnsucht nach eben diesem kann man nur haben, wenn dieses Gewollte oder Ersehnte in einer Differenz zum Wollenden oder Sehnendem steht. Es muss anders sein als er. Und tatsächlich redet Cassirer auch allgemein von der „,Andersheit‘ der Form“: „Eine Selbsterfassung des Lebens ist nur möglich, wenn es nicht schlechthin in sich selbst verbleibt. Es muß sich selber Form geben; denn eben in dieser ,Andersheit‘ der Form gewinnt es, wenn nicht seine Wirklichkeit, so doch erst seine ,Sichtigkeit‘.“9 Leben in seiner „Sichtigkeit“, das ist Leben, das sich selbst erfasst, das sich auf sich selbst bezieht und darin gestaltet: das darin seine Form gewinnt. Diese Form geht nicht aus der „Energie der reinen Lebensbewegung […], wo diese sich noch ganz selbst überlassen ist“, hervor, sondern entwickelt sich erst im Widerstand zu ihr: „Die Formen, in denen sich das Leben äußert und vermöge deren es seine ,objektive‘ Gestalt gewinnt, bedeuten für dasselbe ebensowohl Widerstand, wie sie seinen unentbehrlichen Widerhalt bezeichnen. […] Die scheinbare Gegenkraft wird damit selber zum Impuls der Gesamtbewegung“.10 Was Cassirer hier als ein allgemeines Verhältnis des Lebens beschreibt, kann man als die reflexive Dynamik der Selbstorganisation charakterisieren: Durch die Etablierung von – wie Arnold Gehlen formuliert – „Kreisprozessen im Umgang“,11 nämlich in Austausch- und Wechselwirkungsbeziehungen mit den jeweiligen Umgebungen, werden neue Prozessstrukturen etabliert. Neu sind sie in dem Sinne, dass sie Eigenschaften besitzen, die keinem ihrer Elemente zukommen: neu also im Sinne der Emergenz. Aber es geht Cassirer nicht bloß um das Neue als solches. Es geht ihm vor allem darum, deutlich zu machen, dass sich die neuen Eigenschaften einer internen Eigenentwicklung verdanken: einer Entwicklung, die nicht durch eine voraussteuernde Instanz hervorgebracht und gelenkt wird, sondern die sich in der wechselseitigen Anpassung der Elemente aneinander ergibt. Cassirer 9 ECW Band 13: Philosophie der symbolischen Formen. Dritter Teil: Phänomenologie der Erkenntnis. Hamburg [Felix Meiner Verlag] 2002, S. 45. 10 Ebd., S. 46. Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 8 spricht daher auch – und dies im ausdrücklichen Bezug auf Jakob von Uexküll12 – von der „Autonomie des Lebens“. Leben besteht darin, sich selbst eine Form, eine innere Form, zu geben. Und diese Form besitzt wiederum ein Eigensein, das sich – sozusagen im freien Spiel der wirkenden Kräfte – aus seinem Formbildungspotential unter den gegebenen Umgebungsverhältnissen ergibt. In diesem Sinne ist Leben ein ständiger Formbildungsprozess, ein sich selbst Beziehen auf mögliche Formen und dadurch sich selbst Formen. Eben dies wäre der Übersetzungsversuch der Cassirerschen Formel vom Leben als dem Willen zur Form und der Sehnsucht nach Form. Durch ihre innere Gliederung bewahren die Formen des Lebens ihr Eigensein und damit auch ihre unaufhebbare „Andersheit“ gegenüber dem reinen Ablauf der Lebensprozesse. Leben geht daher niemals in einer einmal erreichten Form auf, sondern bleibt diese Bezugswirklichkeit, diese – wie man auch sagen könnte – relationale Realität, die sich im Vollzug ihrer Bezüge zugleich aufbaut und verändert. Eben dieses dynamische Verhältnis war es, das Cassirer als „Wechselspiel“ zwischen forma formans und forma formata darstellte und dann „als Pendelschlag des geistigen Lebens selbst“, als das, „was das Werden des Geistes und das Werden der Kultur“ ausmacht. Lassen sich also Sinnverhältnisse, um die es in den Geisteswissenschaften geht, in ihrer Struktur wie oder sogar als Lebensprozesse darstellen? 3 Form und Sinn Tatsächlich weisen viele Formulierungen Cassirers in diese Richtung. Immer wieder stellt er die Prozessform – die Ausbildung und Befestigung einer Form, die Umformung dieser Form zu einer neuen Form, deren Befestigung und erneute Umformung, die „Festigkeit und innere Wandlungsfähigkeit“ einer 11 So in Arnold Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Wiesbaden [Aula-Verlag] 131986, 131ff. 12 ECW Band 23: An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of Human Culture. Hamburg [Felix Meiner Verlag] 2006, S. 28. Sowohl in der englischen Originalausgabe als auch in der deutschen Übersetzung (Ernst Cassirer, Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur. Hamburg [Felix Meiner Verlag] 1996, S. 47) wird Uexküll falsch als Johannes von Uexküll zitiert. Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 9 Gestalt13 usw. – als solche in den Mittelpunkt seiner Darstellung. Und immer wieder finden sich dann die Wendungen, die die Lebendigkeit einer Gestalt14 als Charakteristikum der geistigen Welt herausstellen, die von einem „lebendige[n] Gewebe des Geistes“15, von einer „lebendigen Wissenschaft“16 oder auch einer „lebendige[n] Heuristik“17 und ähnlichem reden. Auf der anderen Seite hebt Cassirer allerdings auch immer wieder die Besonderheit der geistigen Lebendigkeit im Unterschied zur organischen Lebendigkeit hervor. Wo es im organischen Leben um Wirkverhältnisse geht, geht es im geistigen Leben um Sinnverhältnisse. Was sind Sinnverhältnisse? Oder einfacher: Was ist Sinn? Über Cassirers eigene Formulierungen hinaus gedacht lässt sich Sinn über den Zusammenhang von Form und Sinn verstehen: Wir sehen eine Form, ein Liniengefüge oder ein Farbengeflecht, eine Wölbung oder eine Kante. Aber wir sehen nicht nur diese Form. Wir sehen sie als Verweisungsmomente auf ihr Auftreten auch in anderen Konstellationen. Die Form in einer Rockfalte und in der Kante eines Felsens, in einem Nasenrücken – den das Englische übrigens als „bridge of the nose“ sieht – und im Sturzflug einer Seeschwalbe: die Form in der Vielfalt ihres Auftretens schafft ein Netz von Verweisungen, sozusagen Verwandtschaftsbeziehungen der Formen, die unsere Sehwelt zusammenhalten. Aber nicht nur das. Über diese Verweisungsverhältnisse bildet sich für uns Sinn aus: sichtbarer Sinn. Denn Sinn ist in seiner Grundform Verweisung, Zusammenhang, Ordnung. Sinn wird durch Form in die Welt gebracht, weil 13 ECN Band 10: Kleinere Schriften zu Goethe und zur Geistesgeschichte 1925-1944. Hg. von Barbara Naumann in Zusammenarbeit mit Simon Zumsteg. Hamburg [Felix Meiner Verlag] 2006, S. 26. 14 Z. B. ECW Band 7: Freiheit und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschichte. Hamburg [Felix Meiner Verlag] 2001, S. 316, 317, ECW Band 8: Kants Leben und Lehre. Hamburg [Felix Meiner Verlag] 2001, S. 301, ECW Band 9: Aufsätze und kleinere Schriften (1902-1921), Hamburg [Felix Meiner Verlag] 2001, S. 317, 336 ECN Band 3: Geschichte. Mythos, mit Beilagen: Biologie, Ethik, Form, Kategorienlehre, Kunst, Organologie. Sinn, Sprache, Zeit. Hg. von Klaus Christian Köhnke, Herbert KoppOberstebrink und Rüdiger Kramme. Hamburg [Felix Meiner Verlag] 2002, S. 224, 226. 15 ECN Band 1, S. 6. 16 ECN Band 5, S. 91. 17 ECW Band 5, S. 272. Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 10 Form Verweisung, Zusammenhang und Ordnung ermöglicht. Sinn entsteht in der Formwahrnehmung. Dieses Verhältnis von Form und Sinn überträgt Cassirer auf das Verhältnis von Form und Leben. Wie Sinn in Verweisungsverhältnissen entsteht, so entsteht Leben in Korrelationsprozessen. Beide – Verweisungsverhältnisse und Korrelationsprozesse – sind Formen reflexiver Selbstbezüge: einmal als symbolische Verweisungen in einem Formkreis und zum anderen als reale, d. h. energetische, Prozesskoppelungen in einem Funktionskreis. Man kann dabei das „Herauswachsen“ eines Sinnverhältnisses aus einem Wirkverhältnis durch besondere formfähige und formbildende Wirkverhältnisse oder auch – mit der Gehlenschen Formulierung – durch „Kreisprozesse im Umgang“ verdeutlichen. Das Ereignis des Wahrnehmens wird zu einer Form, wenn sich im Wahrnehmen korrespondierende Momente entwickeln, die aufeinander verweisen. Die Linie, die sich krümmt, der Farbtupfer, der sich ausbreitet, der Ton, der sich abschwächt – sie alle sind dynamische Spannungen, die sich für unsere Wahrnehmung als ein Gefüge von inneren Verweisungen anbieten. Diese Verweisungen, die sich im Wahrnehmen ausbilden, sind zugleich eine Art von Führungslinien für unser Wahrnehmen. In diesem Geführtwerden baut sich unser Wahrnehmen zugleich auf und erscheint ihm so die Form eines Wahrgenommenen. Ernst Cassirer bringt diesen Zusammenhang auf die Formel: „Die ,Gestalt‘ der Welt ,ist‘ nicht praeexistent, um nachher sichtbar gemacht zu werden – sondern im Sehen und für das Sehen bildet sich die Gestalt“.18 Will man solche korrespondierenden Verweisungen in sich, in ihrer inneren Form also, darstellen, so kann man auf verschiedene Arten von Wechselverhältnissen hinweisen, auf das Verhältnis der Spiegelung oder der Resonanz, der Variation oder überhaupt des Rückbezugs. Sie – diese korrespondierenden Verweisungen – sind es, die etwas in eine Form bringen. Mit dieser Form wird ein neues Sein in die Welt gebracht, ein Sein aus eigenem 18 ECN Band 3, S. 249. Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 11 Recht, das von nun an eine Identität besitzt. Man kann sich auf dieses identifizierbare Sein als dieses oder jenes beziehen. Nehmen wir als Beispiel einen Ton und einen Klang. Erst wenn die Schwingungsereignisse sich in einer periodischen Ordnung aufeinander beziehen, haben wir es nicht nur mit Geräuschen oder einem ungeordneten und nur noch in seiner Intensität identifizierbaren Rauschen zu tun. Wir hören vielmehr einen Ton, den wir in seiner Höhe und Lautstärke identifizieren können. Und wenn verschiedene periodische Schwingungsfolgen sich ihrerseits in die Wechselbeziehung von Teilschwingungen und umfassenden Grundschwingungen ordnen, hören wir einen Klang. Töne und Klänge sind identifizierbar, weil sie unser Hören in eine innere Ordnung von zueinander führenden und damit aufeinander verweisenden Hörereignissen hineinziehen. Dieses Wechselverhältnis bildet einen Formkreis, der von unserer Wahrnehmung immer wieder durchlaufen werden und in dem unsere Wahrnehmung, ihn immer wieder durchlaufend, verbleiben kann. Sowohl unser Hören als auch das Gehörte ist damit in eine Form gebracht. Wir hören etwas – nämlich Schallereignisse – als etwas – nämlich als bestimmte, d. h. in ihren Tonhöhen oder Intervallen, in ihrer Lautstärke und Klangfarbe identifizierbare, Töne oder Klänge. Wir hören in sich gegliederte Ton- und Klangformen und Klangformverhältnisse. Wir hören akustische Sinnverhältnisse. Und diese wiederum sind sich aus sich selbst in der Wahrnehmung herausbildende Formen. Noch einmal pars pro toto mit Cassirers eigener Formulierunng gesagt: „im Sehen und für das Sehen bildet sich die Gestalt“.19 4 Formen des Wollens und Wirkens Dieses Sich-Bilden der Gestalt, der Form, macht die Form zu einem Eigenen, das nicht – obzwar es aus der Welt- und Selbsterfassung hervorgeht – unter der Herrschaft des subjektiven Erfassens steht. Wenn es auch durch die Beteiligung dieses Erfassens entstehen kann, gewinnt es doch, einmal entstanden, seine eigene Dynamik, die sich in einer kollektiven Formgleichheit 19 ECN Band 3, S. 249. Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 12 der einmal entstandenen Formverhältnisse auswirkt. Auf diese Weise entstehen nicht nur die Arten und ihre Merkmale im Bereich des Lebendigen, sondern stabilisieren sich auch in den historischen Sinnverhältnissen kollektive Formen des Wollens und Wirkens. Auch in dieser historischen Welt finden wir daher kollektive Formen, die zwar in den konkreten Beziehungen der Menschen zueinander gründen, dann aber zu bestimmten sich selbst etablierenden und tradierenden Formen der Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung führen. Dabei muss aber ein entscheidender Unterschied zu der Formbildung im Bereich des organischen Lebens festgehalten werden: ein Unterschied, auf den der Sache nach schon bei der Darstellung des Zusammenhang zwischen Form und Sinn hinzuweisen war. Denn Sinn im Unterschied zu Leben konnte nur durch ein Erfassen von Verweisungen und damit von Formen entstehen, das diese Verweisungen und Formen auch unabhängig vom Wechsel der Kontexte und Situationen, in denen sie auftauchen, identifiziert. Eben diese situationsund kontextübergreifende Wahrnehmung bietet ja erst die Möglichkeit zum Aufbau eines Beziehungsnetzes zwischen den Formen. Die Formen, so können wir auch sagen, müssen in sich und als sie selbst erfasst werden, um Sinn entstehen zu lassen. Diese die Formen verselbständige Erfassung ist ein Charakteristikum der menschlichen Wahrnehmung und wird von Cassirer in seinem Essay on Man bei seiner Nachzeichnung des Weges „From Animal Reactions to Human Responses“ auch entsprechend hervorgehoben.20 Mit dieser Verselbständigung der Form wird diese zum immer wieder identifizierbaren Ausgangs- und Endpunkt von Verweisungen von Formen auf Formen. Kurz: Formen repräsentieren und schaffen damit ein Netz von Repräsentationsbeziehungen, ein, wie Cassirer sagt, „lebendige[s] Gewebe des Geistes“.21 Mit Cassirer können wir dann schließlich auch sagen: Sie schaffen eine Gewebe von Symbolen, von gesellschaftlich sedimentierten Repräsentationsformen. In diesem Gewebe können sich Anziehungs- und Sammlungspunkte, Gravitations- und Assoziationsfelder ausbilden, die sich zu „Ideen“, zu 20 ECW Band 23, S. 32-47. 21 ECN Band1, S. 6. Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 13 kollektiven Gedankenverknüpfungen, verfestigen und dadurch zu Faktoren der kollektiven Weltorientierung entwickeln. So stellt Cassirer denn auch fest: „Die verschiedenen Staaten, die grossen Mächte, die sich jeweilig in einer bestimmten historischen Epoche gegenüberstehen – die sich die Herrschaft streitig machen – die mit einander um den ,historischen Lebensraum‘ ringen – sie repraesentieren je eine bestimmte ,Idee‘, d. h. sie verkörpern eine bestimme Richtung des Herrschaftswillens – Diese Richtung liegt all ihren Einzelaktionen zu Grunde – und es ist die Kunst des Historikers[,] sie sichtbar zu machen – sie in den einzelnen, empirisch noch so zufälligen, Entschlüssen und Aktionen der ,großen Mächte‘ wiederzuerkennen als das eigentlich beseelende Grundmotiv, was die einzelnen Akte davor bewahrt, zu zerflattern, was sie zu einer (teleologischen) Einheit zusammenschließt“22 Er spricht in diesen Zusammenhang auch von einem „Gesamtwollen“, für das der Einzelakt „symbolisch“ sei.23 Dieses „Gesamtwollen“ kommt durch „Kräfte“ zustande, „die in den einzelnen Taten ihren Ausdruck und Ausbruch gefunden heben“, durch „ganz bestimmte gerichtete Kraftquellen“, die er „gewissermassen als gewaltig aufgespeicherte Energien, als ,vektorielle‘ Größen“ ansieht.24 Fragt man, wie dieses Verhältnis zwischen den allgemein wirkenden „Kräften“ und dem Wollen der Einzelnen näherhin zu denken ist, so verweist Cassirer auf die „Einheit der Motivation“: „Das waere sodann eine neue, erst wahrhaft ,philosophische‘ Auffassung der Geschichte: philosophisch, weil sie nicht auf die Mannigfaltigkeit der Dinge, Ereignisse, Vorgänge, Taten gerichtet ist, – sondern für die Mannigfaltigkeit eine ,Einheit‘, als den ,Grund‘ des Mannigfaltigen ansetzt und voraussetzt – eine Einheit, die in nichts anderem gefunden werden kann, als in der Einheit der Motivation“.25 22 ECN Band 3, S. 55. 23 ECN Band 3, S. 56. 24 ECN Band 3, S. 57. 25 ECN Band 3, S. 59f. Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 14 Zwei Seiten dieser „Einheit der Motivation“ scheinen hier wesentlich und in ihrer Verschränkung wirksam zu sein. Einmal der Charakter der Motivation als solcher, dass mit ihr nämlich die „inneren Kräfte“ der Motivation, die Cassirer auch als „Triebe“ sieht, Vorstellungen erregen und erst über diese Vorstellungen „auf unser Handeln einwirken und den Lauf dieses Handelns wesentlich lenken“. Zum anderen ist dabei ein entscheidender Zug dieses Wirkzusammenhangs, dass sich die „Vorstellungsmassen verdichten“,26 dass sie sich zu einer Einheit zusammenschließen. 5 Form- und Stilbegriffe Es ist diese Formeinheit, diese einheitliche Form verschiedener Formverhältnisse, die für Cassirer die kollektive Wirkungsweise bestimmter Motive und Vorstellungen ermöglicht. Wie aber ist die Entstehung einer solchen Formeinheit zu verstehen, und wie ist diese Einheit der Formen zu charakterisieren? Cassirer selbst erläutert sein Verständnis dieser Formeinheit noch dadurch, dass er in ihr – und dies vor allem in seinen nachgelassenen Manuskripten – im Anschluss an Max Weber einen „Idealtypus“27 oder einen „Stil-Charakter“28 sieht, der durch „Stilbegriffe“29 darzustellen ist. Vor allem in seinen Manuskripten zur Kulturphilosophie finden sich Cassirers Überlegungen zu den Stilbegriffen. So erklärt er: 26 ECN Band 3, S. 62. 27 ECN Band 3, S. 71f., 93, 169. ECW Band 15, S. 220: „Man kann von Montesquieu sagen, daß er der erste Denker ist, der den Gedanken des historischen ,Idealtypus‘ gefaßt und der ihn klar und sicher ausgeprägt hat. Der »Geist der Gesetze« ist eine politische und soziologische Typenlehre. Was hier gezeigt und was streng bewiesen werden soll, ist dies, daß die politischen Gebilde, die wir mit dem Namen der Republik, der Aristokratie, der Monarchie, des Despotismus bezeichnen, keine bloßen Aggregate sind, die aus bunt zusammengewürfelten Einzelheiten bestehen, sondern daß jedes von ihnen gewissermaßen präformiert, daß es Ausdruck einer bestimmten Struktur ist.“ 28 ECN Band 3, S. 197. 29 ECN Band 3, S. 232 („Stilbegriffe“, die sich auf „dauernde Tendenzen der Gestaltung“ beziehen), 236 („Die Begriffe, die wir brauchen, sind immer Stilbegriffe“); ECN Band 2: Ziele und Wege der Wirklichkeitserkenntnis. Hg. von Klaus Christian Köhnke und John Michael Krois. Hamburg [Felix Meiner Verlag] 1999, S. 165; ECN Band 5: Kulturphilosophie. Vorlesungen und Vorträge 1929–1941. Hg. von Rüdiger Kramme † unter Mitarbeit von Jörg Fingerhut. Hamburg [Felix Meiner Verlag] 2004, S. 103 („Alle Kulturbegriffe sind Stilbegriffe“), 122, 133, 166, 168f., 171, 222, 230, 245. Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 15 „Und die gesamte Kulturwissensch[aft] besteht zuletzt in der Gewinnung solcher Stilbegriffe, durch deren fortschreitende Anwendung wir ein individuelles Gebilde bestimmen – als dieser oder jener Epoche dieser oder jener Kultur[,] diesem oder jenem Künstler ,zugehörig‘ erkennen können – Diese Zugehörigkeit gibt dann die synthet[ische] Einheit des Mannigfaltigen, die wir suchen: wir ordnen die Phaenomene in Reihen – und durch diese Form der ,Reihung‘ treten sie für uns zusammen und auseinander – wir unterscheiden und verbinden und dieses Unterscheid[en] und Verbinden kann, wie die Entwickl[ung] der Wissensch[aften] zeigt, zu immer grösserer Schärfe und Deutlichkeit gebracht werden“.30 Ein „individuelles Gebilde“ soll durch Stilbegriffe charakterisiert werden, wobei diese Individualität die einer Epoche, einer Kultur oder eines Künstlers sein kann. Das „Bestimmen“ von Individualität wird damit zur Hauptaufgabe der Kulturwissenschaft erklärt. Es ist aber, um dies noch einmal zu wiederholen, nicht die Individualität von Ereignissen, um die es hier geht, sondern die Individualität von Formen und damit von Sinnverhältnissen, also kulturellen bzw. geistigen Sachverhalten. Zu begreifen oder – wie Cassirer formuliert – zu „bestimmen“ ist also die individuelle Form von Sinnverhältnissen. Und dies solle am Ende „zu immer grösserer Schärfe und Deutlichkeit“ des Begreifens führen. Der Weg allerdings, den Cassirer zu diesem Ziel angibt, erscheint einem eher mathematischen Denken zu entsprechen als einer Phänomenologie der Kultur. Denn in welchem Sinn eine Reihenbildung hier hilfreich sein kann, bleibt schwer bis unverständlich. Ich sehe darin ein Relikt aus der Zeit der Arbeit an „Substanzbegriff und Funktionsbegriff“31, das Cassirer bis in seine Philosophie der symbolischen Formen und noch spätere Schriften hinein immer wieder aufgreift. Tatsächlich führt aber auch Cassirer selbst viel häufiger als die Reihenbildung den Idealtypus Max Webers an, um die Bildung von Stilbegriffen zu erläutern. Und der Idealtypus lässt sich als eine Konfiguration verschiedener Denk- und Handlungsformen verstehen, die als ein charakteristisches Ganzes 30 ECN Band 5, S. 168f.. 31 ECW Band 6: Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundlagen der Erkenntniskritik. Hamburg [Felix Meiner Verlag] 2000. Erstveröffentlichung 1910. Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 16 einzelne Handlungen und Gedanken und auch einzelne Entwicklungen – und in diesem Sinne dann auch „Reihen“ – von Handlungen und Gedanken zu erklären erlaubt. Dass jede solche Erklärung und damit auch die Konstruktion von idealtypischen Form- und Sinnverhältnissen provisorisch bleibt und sich in ihrem Gebrauch ständig ändert, ist für Cassirer dabei kein Argument gegen die Wissenschaftlichkeit der Stilbegriffe: „Alle Gestaltbegriffe, Stilbegriffe sind provisorisch, und ständig vervollkommnungsfähig – aber das ist kein Einwand gegen ihre ,Wissenschaftlichkeit‘[; im Gegenteil: dieser provisorische Charakter ist auch in der Physik nie zu überwinden. Auch die Gesetzesbegriffe sind ,offene‘ Systeme[,] keine ,geschlossenen‘ Systeme von Phaenomenen – hierin vermögen wir also keinen Mangel an Exaktheit in den kulturwiss[enschaftlichen] Gestaltbegriffe[n] zu erkennen und anzuerkennen – Und auch der ,Objektivierungsprozess‘ vollzieht sich in beiden Fällen ganz analog“.32 Interessant erscheint hier der Vergleich ausgerechnet mit der Physik und nicht, wie meist sonst, mit der Biologie. Die Gesetze allerdings, um die es hier geht, sind keine Gesetze von reibungsfreien Verläufen womöglich noch im Vakuum eines abgedichteten Laborraumes. Die Gesetze, um die es hier geht, schließen auch die Umgebungen der Verläufe ein, also deren Randbedingungen, mit deren Veränderung sich auch die Verlaufsformen ändern können. Sie formulieren damit Strukturverhältnisse und sind so in der Tat „offene Systeme“ und damit Formbegriffe. Cassirer kann hier auf seine Studien zu „Determinismus und Indeterminismus in der modernen Physik“33 zurückgreifen und sich auf einen weiteren – auch die Betrachtung der Randbedingungen umfassenden – Physikbegriff beziehen als in seinen frühen Schriften. In dieser erweiterten Perspektive kommt den Form- und Stilbegriffen sogar die fundierende Rolle zu, die Wissenschaft wie die Wissenschaftlichkeit 32 ECN Band 5, S. 169. 33 ECW Band 19. Erstveröffentlichung als Band 42, Nr. 3 (1936) in der Reihe Göteborgs högskolas årsskrift, Stockholm 1937, erschienen. (S. dazu den Editorischen Bericht in ECW Band 19, S. 257. Das Manuskript, aus dem hier zitiert ist, ist wahrscheinlich 1937/38 entstanden. (S dazu den Editorischen Bericht in ECN Band 5, S. 260.) Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 17 überhaupt und darüber hinaus, wie es scheint, auch das nichtwissenschaftliche Wissen auf den Begriff zu bringen. Zwar formuliert Cassirer vorsichtiger: „Was wir bedürfen ist, wie mir scheint, eine eigene Theorie der Form- und Stilbegriffe, die sowohl der Theorie der mathematisch-physikalischen Begriffe, als auch der Theorie der historischen Begriffe auf der andern Seite, gleichberechtigt zur Seite treten kann.“34 Aber wenn sowohl die Kulturwissenschaft und damit auch die historische Forschung auf der einen Seite und die Naturwissenschaften einschließlich der Physik auf der anderen Seite Form- und Stilbegriffe benötigen, weil sie „offene Systeme“ sind, wird die eingeforderte Theorie der Form- und Stilbegriffe zur Grundlagendisziplin für beide Wissenschaftszweige bzw. -kulturen. Wie sollen wir nun aber die Entstehung einer solchen Formeinheit zu verstehen? 6 Form als dynamisches Korrespondenzverhältnis Um diese Frage zu beantworten, empfiehlt es sich, auf die Form- und damit Erkenntnisbildung in der historischen Forschung, so wie Cassirer sie sieht, einzugehen. Diesen Erkenntnisprozess stellt Cassirer als einen Prozess „wechseitiger Formung“ von forschendem Subjekt und erforschter Geschichte dar: „,Geschichte‘ ist ein Ergebnis aus wechselseitiger Formung, vom Subjekt und vom Objekt her – beide als noch nicht erstarrt, fest, gegeben gedacht – sondern beide an einander sich suchend und findend – in steter Beweglichkeit und Plastizität[.] Dem ,Fertigen‘ erschliesst sich keine ,Geschichte‘ – nur wer selbst noch Geschichte ,ist‘ und Geschichte ,hat‘, dem kann Geschichte sichtbar werden und etwas bedeuten“.35 Cassirer sieht in diesem Verhältnis lediglich einen besonderen, auch in der historischen Forschung auftretenden Fall einer allgemeinen Beziehung, die das Verhältnis zwischen Ich und Welt charakterisiert: 34 ECN Band 5, S. 245. 35 ECN Band 3, S. 119f. Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 18 „Indem das ,reine Ich‘ in einem bestimmten, Schwingungszustand‘ sich befindet, teilt sich dieser Schwingungszustand allem mit, was es, in Wahrnehmung und Anschauung, an objektivem ,Inhalt‘ vor sich hat – die Welt um es umher, wie ,sie‘ durch die Anschauung geformt wird, gerät in denselben Schwingungszustand – und bleibt doch ein durchaus Eigenes, Selbständiges, Objektives – vom Ich Getrenntes u[nd] dem Ich ,Gegenüber‘-Stehendes aber die Form der ,Oszillation‘ – das Auf und Ab der Bewegung – dies ist auf beiden Seiten ,dasselbe‘ oder vielmehr es ,entspricht sich harmonisch‘ – wie es ,harmonische Wellenzüge‘ gibt[.] […] , […] Natur‘ u[nd] ,Ich‘ in ,harmonischem’ Schwingungszustand […]“.36 Mit dieser Metapher verlegt Cassirer die menschliche Erkenntnis in einen Bereich der Selbstorganisation, des Sich-Einschwingens, der heute insbesondere in der neuropsychologischen Hirnforschung eine prominente Rolle spielt. So stellt etwa Wolf Singer die Vernetzung neuronaler Prozesse als eine Synchronisation von Oszillationsphasen dar.37 Und auch in der Philosophie gibt es die ähnliche Metapher der Resonanz. So schreibt Helmuth Plessner 1928 in seiner Philosophischen Anthropologie: „Geistiges Leben braucht […] Resonanz und wird nur in Resonanzphänomenen faßbar.“38 36 ECN Band 3, S. 262. 37 Im Zusammenhang mit dem sogenannten Bindungsproblem - philosophisch könnte man auch vom Synthese-Problem reden - sagt Wolf Singer: „Das Bindungsproblem resultiert aus der distributiven Organisation des Gehirns und dem Fehlen eines singulären Koordinationszentrums. […] Wie dennoch ganzheitliche Wahrnehmung und wohlkoordinierte Bewegungen zustande kommen, ist unklar. Es muß Metarepräsentationen für die Ergebnisse dieser Teilprozesse geben […] Wir vermuten, daß die Einbindung verteilten Neuronengruppen in diese Metarepräsentationen durch die zeitliche Synchronisation neuronaler Antworten erfolgt. Die Signatur, welche die Aktivität verteilter Neuronengruppen zusammenbindet, wäre die präzise zeitliche Synchronisation der entsprechenden Aktivitätsmuster.“ Vgl. dazu auch Singers Beschreibung eines Wahrnehmungsprozesses, in dem „räumlich verteilte Merkmalsdetektoren ihre rhythmischen Aktivitäten synchronisieren können und dann in Phase schwingen.” (Wolf Singer: Hirnentwicklung und Umwelt. In: Wolf Singer (Hg.), Gehirn und Kognition. Heidelberg [Spektrum der Wissenschaft] 1990, S. 63. 38 Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie. Berlin / New York [Walter der Gruyter, Sammlung Göschen 2200] 1975, S. 16. Das Manuskript des 1928 in erster Auflage publizierten Werkes war 1926 abgeschlossen. Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 19 Cassirer bedient sich also keiner ungewöhnlichen Metapher, wenn er von Schwingungszuständen, harmonischen Wellenzügen und Oszillation spricht. Gleichwohl wird man hier ein gewisses Ausweichen vor einer genaueren Klärung der epistemischen Verhältnisse nicht übersehen können. Es bleibt bei Hinweisen, die auch als subjektivistisch missverstanden werden könnten. Gelingt doch das historische Verstehen nur dann, wenn die historischen Entwicklungsfaktoren als mögliche Momente des eigenen Sinnverstehens und damit der eigenen Entwicklung erfasst werden. Dass Cassirer diese Verschränkung objektiver und subjektiver Form- und Sinnentwicklung nicht subjektivistisch meint, lässt sich verstehen, wenn man seine übrigen Formulierungen über diese Verschränkung hinzu nimmt. So schreibt er über das „große Kunstwerk“, dass in ihm eine „neue Form der Wirklichkeit heraufsteigt“, die wir in diesem erleben. Und er fügt hinzu: „In ihm (sc. dem großen Kunstwerk] werden wir ,unserer selbst‘ gewahr – nicht desjenigen ,realen‘ Selbst, das einer einzelnen realen Seins-Stelle verhaftet ist, das ,verhaftet an dem Körper klebt‘ sondern der ganzen Schwingungsebene unseres Ich – nicht seiner ,wirklichen‘ Inhalte, Stoffe, sondern seiner (funktionellen) Möglichkeiten[.]“39 Was wir in dem Kunstwerk erfassen können, sind eigene Möglichkeiten: Möglichkeiten der Welt- und Selbstwahrnehmung. Und diese erschließen sich uns nicht in einem diskursiven Prozess, sondern im Wahrnehmen, in dem wir uns auf das Kunstwerk oder was sonst auch immer einlassen. Dieses SichEinlassen auf etwas ist es wohl, was Cassirer als ein Resonanz- oder auch Korrespondenzverhältnis zu beschreiben versucht. Und dieses Verhältnis sieht Cassirer in einer ähnlichen Weise auch für verschiedene bereits etablierte, nämlich wirtschaftliche, rechtliche, religiöse und künstlerische Ordnungsformen: „Die Formen reflektieren sich in einander u[nd] werden durch einander erkannt“.40 39 ECN Band 3, S. 44. 40 ECN Band 3, S. 67. Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 20 Insgesamt nennt er diese Formbeziehungen „Korrelationen“41 und die Formenlehre eine „Korrelations-Lehre“, „eine Lehre von der wechselseitigen Entsprechung“.42 Dabei ist es so, dass diese Korrelationen in sich selbst die Formen, eine jeweils „innere Form“,43 bilden und als sie selbst in verschiedenen Bereichen sich entwickeln und wirken können. Sie sind Relationen, die nicht durch die Relata definiert sind, die sie in eine Verbindung bringen, sondern alleine durch ihre „immanente Gliederung“.44 „Formen können ,sich entsprechen‘, können einander analog, zugeordnet[,] eben ,kon-form‘ sein, auch wenn die Inhalte gar nichts mit einander gemein haben, ganz verschiedenen Dimensionen angehören“.45 Diese „wechselseitigen Entsprechungen“ sind für Cassirer gleichsam das Gewebe, das „die Welt im Innersten zusammenhält.“46 Dadurch, dass sie verschiedene Dimensionen von „Sinn-Ordnungen“47 durchziehen, beziehen sie diese auch aufeinander und schaffen sie die in sich vielfältige Einheit, die wir als unsere Welt erfahren. 41 ECN Band 3, S. 70. 42 ECN Band 3, S. 67. 43 Für Cassirer ist der Begriff der „inneren Form“ grundlegend und – auch in Abwandlungen wie der Rede etwa von „inneren Gesetzen und Regeln“ usw. Vgl. dazu auch ECN Band 3, S. 250f. 44 Es sei hier daran erinnert, dass diese Eigenexistenz der immanenten Gliederung auch zur Definition der symbolischen Prägnanz gehört: „Vielmehr ist es die Wahrnehmung selbst, die kraft ihrer eigenen immanenten Gliederung eine Art von geistiger ,Artikulation‘ gewinnt - die, als in sich gefügte, auch einer bestimmten Sinnfügung angehört. In ihrer vollen Aktualität, in ihrer Ganzheit und Lebendigkeit, ist sie zugleich ein Leben ,im‘ Sinn. Sie wird nicht erst nachträglich in diese Sphäre aufgenommen, sondern sie erscheint gewissermaßen als in sie hineingeboren. Diese ideelle Verwobenheit, diese Bezogenheit des einzelnen, hier und jetzt gegebenen Wahrnehmungsphänomens auf ein charakteristisches Sinn-Ganzes, soll der Ausdruck der ,Prägnanz‘ bezeichnen.“ (ECW Band 13, S. 231.) 45 ECN Band 3. S. 72. 46 Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Eine Tragödie. Erster Teil, Nacht. 47 ECN Band 3, S. 173. Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen 7 Seite 21 Die zwei Kulturen und die Einheit von Natur- und Geschichtswissenschaften Kehren wir damit zurück zu unserem Ausgangspunkt: zu den zwei Kulturen und der einheitswissenschaftlichen Perspektive. Für Cassirer ist es der Grundfehler im gängigen „kausalistischen“ Wissenschaftsverständnis, dass die Wissenschaften als Ursachenforschung verstanden werden. Dabei ist zu sehen, dass Cassirer die Erforschung der Ursachen und die Aufstellung von entsprechenden Gesetzen – wohl unter dem Leitbild der klassischen Mechanik – auch in seinen Manuskripten aus der schwedischen und amerikanischen Zeit immer wieder noch als Aufgabe der Naturwissenschaften sieht. Zugleich erkennt er aber auch – wohl unter dem Eindruck der Entwicklungen in der modernen Physik, wenn auch nicht schon in der Relativitätstheorie,48 sondern erst in der Quantenphysik und dem Determinismusproblem –, dass alle Naturwissenschaften Strukturforschung zu sein haben, die sich auch auf die Konfiguration der Randbedingungen bezieht. Erst in diesem zweiten Verständnis, auf das er allerdings nur programmatisch und pauschal hinweist und das er nicht wirklich ausführt, hat er die Perspektive gewonnen, in der sich 48 Die Besonderheit der Relativitätstheorie gegenüber der klassischen Mechanik besteht für Cassirer in der Relativität der Bezugssysteme, in denen Bewegungen dargestellt und gemessen werden, nicht aber in der Abhängigkeit von physischen Randbedingungen. Die Pointe sieht er darin, dass Die Bewegungsgesetze unabhängig von den verschiedenen Bezugssystemen formuliert werden können. Vgl. dazu ECW Band 10: Zur Einsteinschen Relativitätstheorie. Erkenntnistheoretische Betrachtungen. Hamburg [Felix Meiner Verlag] 2001, S. 34: „Die Gesetze, nach denen sich die Zustände der physikalischen Systeme ändern, sind unabhängig davon, auf welches von zwei relativ zueinander in gleichförmiger Translationsbewegung befindlichen Koordinatensysteme diese Zustandsänderungen bezogen werden.“ Und auch, wenn er von der „Systemform der Natur und ihrer Gesetze“ spricht, versteht Cassirer darunter lediglich die mathematisch formulierbare Invarianz „universeller Konstanten“ und „universeller Gesetze“. Vgl. dazu ECW Band 10, S. 66f.: „Auch hierin äußert sich wieder das charakteristische Verhalten der allgemeinen Relativitätstheorie: Indem sie die Dingform der endlichen und starren Bezugskörper zerschlägt, will sie eben damit nur zu einer höheren Objektform, zur echten Systemform der Natur und ihrer Gesetze vordringen. Nur dadurch, daß sie die Schwierigkeiten, die sich schon der klassischen Mechanik aus der Tatsache der Relativität aller Bewegungen ergeben hatten, steigert und überbietet, hofft sie einen prinzipiellen Ausweg aus diesen Schwierigkeiten zu finden.“ Ebd., S. 77.: „Der Physiker rechnet jetzt weder auf die Konstanz jener Objekte, | bei denen sich die naive sinnliche Weltansicht beruhigt, noch auf die Konstanz der besonderen, von einem einzelnen System aus gewonnenen räumlichen und zeitlichen Maßbestimmungen – aber dessenungeachtet behauptet er, als Bedingung seiner Wissenschaft, den Bestand ,universeller Konstanten‘ und universeller Gesetze, die für alle Systeme der Messung den gleichen Wert behalten. Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 22 die Wissenschaften insgesamt – und damit auch alle Naturwissenschaften und nicht nur die Biologie – als Strukturforschung verstehen lassen. Gerade in seinen programmatischen Hinweisen steckt aber ein wissenschaftsphilosophisches Projekt, das über die weitere Ausarbeitung des Formbegriffs ein nicht reduktionistisches Verständnis der Einheit der Wissenschaften zu entwickeln hätte. Cassirer selbst jedenfalls hat dies als Aufgabe gesehen und ausdrücklich formuliert. Dabei steht die Kulturwissenschaft und die historische Forschung im Vordergrund. So konstatiert Cassirer: „Das „Kausalproblem“ – das Problem, worin das „Wirken“ in der Kultur besteht – lässt sich hier niemals losgelöst vom Formproblem stellen – und es lässt sich, innerhalb der Kulturwiss[enschaft], immer nur durch Rückgang auf das Formproblem lösen“49 Und zur Begründung fügt Cassirer hinzu: „Alles individuelle ,Wirken‘ im theoretischen wie im praktischen Sinne erfolgt ja hier schon immer innerhalb einer „vorgegebenen“ Form („in“ der Sprache, „im“ Staat) andererseits ist diese Form nicht in dem Sinne vorgegeben, daß sie als ein Ens per se im begriffsrealistischen Sinn vorausginge („die“ Sprache ist nur „im“ Sprechen, „der“ Staat nur „in“ den Bürgern) es ist also hier stets eine individuelle Aktivität die eingebettet ist in eine universale Form – und es ist eine universale Form, die sich nicht anders manifestieren kann und die gar nicht anders „da ist“ als in einer sich fortzeugenden Gesamtheit von Taten, von individ[uellen] theoretischen und praktischen Akten“50. Zugleich betont Cassirer auch die disziplinübergreifende Bedeutung des Formproblems: „Denn jedes echte Formproblem kann nicht nur, sondern es muss sowohl natur-theoretisch als geschichts-theoretisch behandelt werden“.51 49 ECN Band 5, S. 190f. 50 ECN Band 5, S. 191. 51 ECN Band 3, S. 235. Oswald Schwemmer, Ernst Cassirer und die zwei Kulturen Seite 23 Dabei sieht Cassirer zwar Möglichkeiten zur Überwindung eines reduktionistischen Kausalismus, allerdings auch die Gefahr, Form wieder im kausalistischen Sinne zu interpretieren. „Die Unsicherheit über das Verhältnis Ursache – Form – Zweck ist für die Erkenntnislehre der Biologie wir für die Geschichte das eigentliche und schwierigste Hindernis“.52 Und auch, wenn „die Eigentümlichkeit ihres Formbegriffs“ erkannt wird, hat sich doch immer wieder die Tendenz eingestellt, den Formbegriff seinerseits durch den Kausalbegriff zu interpretieren und damit die Form als „eine neue Art von Ursache‘ (neben der mechanischen)“ einzuführen: „Dieser Weg lässt sich von Platon an bis zur Erkenntnistheorie der modernen Biologie und der modernen Historik verfolgen“53 Indem an man die Form „zu einer ;Art von Ursache‘ macht und „das Wirken der Form-Ursachen zu beschreiben und im Einzelnen zu erklären sucht“, hat man „sich schon dem ,Kausalismus‘ in die Arme geworfen“. Statt dessen hätte man „in der ,Form‘ einen ,Gesichtspunkt‘, eine regulative Maxime, eine Funktion der ,Synthesis‘ zu sehen)“.54 Was man bisher noch nicht durchzuführen vermocht hat, wartet nun auf uns. 52 ECN Band 3, S. 126. 53 Ebd. 54 ECN Band 3, S. 132.