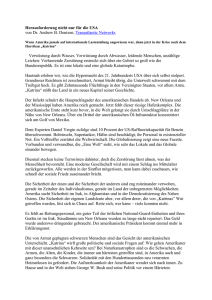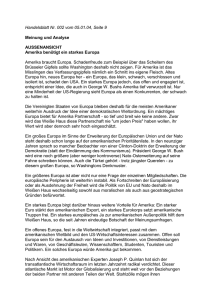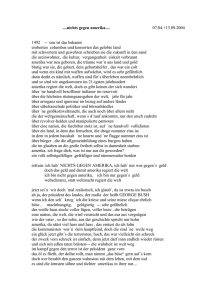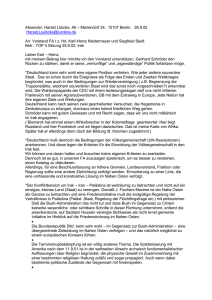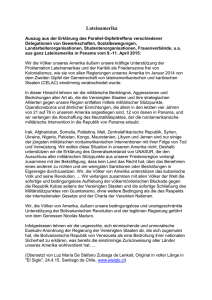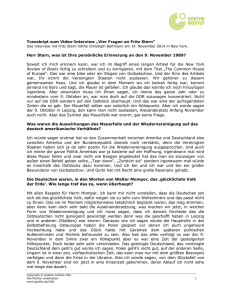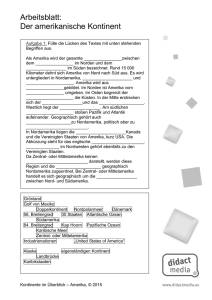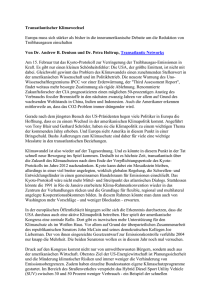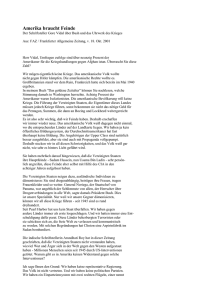Die politische Kultur Westdeutschlands nach 19
Werbung
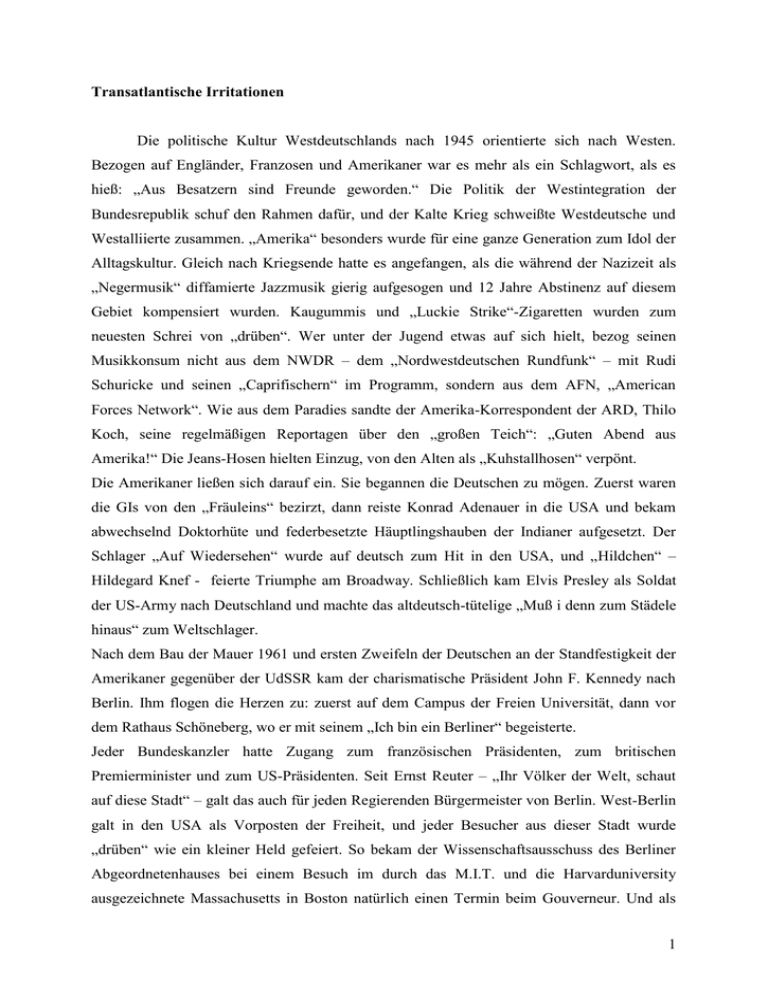
Transatlantische Irritationen Die politische Kultur Westdeutschlands nach 1945 orientierte sich nach Westen. Bezogen auf Engländer, Franzosen und Amerikaner war es mehr als ein Schlagwort, als es hieß: „Aus Besatzern sind Freunde geworden.“ Die Politik der Westintegration der Bundesrepublik schuf den Rahmen dafür, und der Kalte Krieg schweißte Westdeutsche und Westalliierte zusammen. „Amerika“ besonders wurde für eine ganze Generation zum Idol der Alltagskultur. Gleich nach Kriegsende hatte es angefangen, als die während der Nazizeit als „Negermusik“ diffamierte Jazzmusik gierig aufgesogen und 12 Jahre Abstinenz auf diesem Gebiet kompensiert wurden. Kaugummis und „Luckie Strike“-Zigaretten wurden zum neuesten Schrei von „drüben“. Wer unter der Jugend etwas auf sich hielt, bezog seinen Musikkonsum nicht aus dem NWDR – dem „Nordwestdeutschen Rundfunk“ – mit Rudi Schuricke und seinen „Caprifischern“ im Programm, sondern aus dem AFN, „American Forces Network“. Wie aus dem Paradies sandte der Amerika-Korrespondent der ARD, Thilo Koch, seine regelmäßigen Reportagen über den „großen Teich“: „Guten Abend aus Amerika!“ Die Jeans-Hosen hielten Einzug, von den Alten als „Kuhstallhosen“ verpönt. Die Amerikaner ließen sich darauf ein. Sie begannen die Deutschen zu mögen. Zuerst waren die GIs von den „Fräuleins“ bezirzt, dann reiste Konrad Adenauer in die USA und bekam abwechselnd Doktorhüte und federbesetzte Häuptlingshauben der Indianer aufgesetzt. Der Schlager „Auf Wiedersehen“ wurde auf deutsch zum Hit in den USA, und „Hildchen“ – Hildegard Knef - feierte Triumphe am Broadway. Schließlich kam Elvis Presley als Soldat der US-Army nach Deutschland und machte das altdeutsch-tütelige „Muß i denn zum Städele hinaus“ zum Weltschlager. Nach dem Bau der Mauer 1961 und ersten Zweifeln der Deutschen an der Standfestigkeit der Amerikaner gegenüber der UdSSR kam der charismatische Präsident John F. Kennedy nach Berlin. Ihm flogen die Herzen zu: zuerst auf dem Campus der Freien Universität, dann vor dem Rathaus Schöneberg, wo er mit seinem „Ich bin ein Berliner“ begeisterte. Jeder Bundeskanzler hatte Zugang zum französischen Präsidenten, zum britischen Premierminister und zum US-Präsidenten. Seit Ernst Reuter – „Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt“ – galt das auch für jeden Regierenden Bürgermeister von Berlin. West-Berlin galt in den USA als Vorposten der Freiheit, und jeder Besucher aus dieser Stadt wurde „drüben“ wie ein kleiner Held gefeiert. So bekam der Wissenschaftsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses bei einem Besuch im durch das M.I.T. und die Harvarduniversity ausgezeichnete Massachusetts in Boston natürlich einen Termin beim Gouverneur. Und als 1 dem zum Gastgeschenk eine von der KPM – „Königliche Prozellanmanifaktur“ - in Berlin gefertigte Nachbildung der Freiheitsglocke gereicht wurde, kamen dem Mann die Tränen, und er lobte: „O, Hutschenreuter!“ Die ganz besonderen Beziehungen zwischen Westdeutschland und besonders West-Berlin und den USA blieben erhalten, auch als die APO gegen den Vietnam-Krieg protestierte. So war es der US-Präsident Bush, Bush-Vater, der nach 1989 der deutschen Vereinigung den Weg ebnete. Als dann am 11. September 2001 die Terroristen in die Twin Towers von New York rasten, bekundete der Bundeskanzler Gerhard Schröder – der angebliche „68er“ – noch die unzerbrüchliche Solidarität mit den USA, doch da hatte die Entfremdung schon eingesetzt. Der 11.September 2001 war einer jener Tage, die das politische Bewusstsein der Menschen prägen und damit die Welt ändern. Letztlich bekam auch das amerikanischdeutsche Verhältnis, bekamen die transatlantischen Beziehungen einen Bruch. Das Datum 11. September 2001 war einschneidend wie der 13. August 1961, der Tag des Mauerbaus. Auch 2001 hatte man wie 1961 das Gefühl, die Menschheit halte den Atem an. So war das am 22. November 1963, dem Tag als John F. Kennedy ermordet wurde. Solche Tage haben weltgeschichtliche Aura, und alle spüren es sofort. Meist lösen diese Tage Furcht und Entsetzen aus, seltener Freude und Euphorie. Der letzte Freudentag dieser Dimension war der 9. November 1989, als die Mauer fiel. Wie ändert sich die Welt an Tagen mit weltgeschichtlicher Aura? Der 11. September 2001 jedenfalls wirkte wie die Kriegserklärung der ärmeren, fundamentalistischen gegen die reichere, liberal-demokratische Welt. Im so euphorisch begrüßten neuen Jahrhundert also war die Zivilisation aufs höchste gefährdet. Waren es im vorigen Jahrhundert politische Religionen - vor allem der Kommunismus und der Nationalsozialismus - , die Abermillionen Menschen in die Gaskammern, in die Gulags, auf die Schlachtfelder und dort in den Tod trieben, so scheinen es im neuen Jahrhundert religiös verbrämte politische Ideologien zu sein, aus denen der Terror entstand, der wiederum tausende Menschenleben kostete. Es war Terror gegen Toleranz, gegen eine offene Welt - gegen jede Form aufgeklärter politischer Kultur. So jedenfalls empfand man 2001 noch gleichermaßen in Amerika wie in Europa. Übersehen hatte man damit jedoch, dass Terror auch anderswo und selbst vor unserer Haustür stattfand, und der hatte nicht immer etwas mit moslemischem Extremismus zu tun: - In Nordirland jagten erbarmungslos angebliche Christen heulende Schulkinder aus purer Rechthaberei durch eine Gasse der Gewalt und Bösartigkeit. Das geschah im Namen 2 christlicher Konfessionen, und der Papst begab sich ebenso wenig wie höchste protestantische Kreise dorthin, um Einhalt zu gebieten. - Auf dem Balkan verjagten sie sich gegenseitig, mordeten und vergewaltigten im Namen ihrer unterschiedlichen Nationen und Religionen. In ihrem Bemühen, das einzustellen, verstrickte sich die westliche Welt derweil in einem Dickicht von Hass, Egozentrik und Unerbittlichkeit. Um den auf diesem Boden heranwachsenden Terroristen etwas entgegen zu stellen, züchtete der Westen beispielsweise mit der „Befreiungsarmee“ der Albaner Strukturen heran, aus denen heraus sich der Terror schließlich gegen ihn selber richten konnte. - Im Nahen Osten kämpften Juden und Araber alttestamentarisch um ihr Land: „Auge um Auge, Zahn um Zahn”. Das Tempo dabei bestimmten religiös aufgeputschte Fundamentalisten. Sogenannte Gottesmänner säten Hass in die Seelen „heiliger Krieger”, und auf der anderen Seite pochten Orthodoxe unerbittlich auf den alleinigen Besitz von Wahrheit, Recht und Moral. In den Lagern der Palästinenser wuchsen seit Generationen das eigene Leben und das anderer verachtende Selbstmordkrieger heran. Bei den Juden errichteten unerbittliche Orthodoxe Barrieren gegen die Vernunft und den Friedenswillen des eigenen Volkes. Sie und ihre kongenialen Gegner bei den Moslems hatten der gesamten Region ein Klima der Gewalt, der Rechthaberei und des Todes gebracht. - Weiter weg in Afghanistan war eine Gruppierung an die Macht gekommen, die sich auf den Islam berief und Menschen, welche nicht ihren Vorstellungen entsprachen, drangsalierte, verfolgte und vernichtete: die Taliban. Frauen waren unmündig. Diese Taliban waren einst von den USA gegen die eingedrungenen Sowjets unterstützt worden. In diesem Land - geschunden, zerstört, materiell und geistig ruiniert – sollten nun von einem reichen Araber die Fäden gesponnen worden sein für den Angriff auf Amerika am 11. September. Bis heute hat die letzte verbliebene Weltmacht diesen einen Mann nicht stellen können. Seit die Flugzeuge mitsamt ihren zu Gefangenen gewordenen Passagieren und ihren selbstmörderischen Entführern in die Twin Towers gerast sind, ist in den USA das Urvertrauen in die Sicherheit ihrer Zivilisation dahin. Was sich diese Zivilisation in ihrer hemmungslosen Unterhaltungswut als virtuellen Nervenkitzel schon ausgedacht hatte, war wie nach dem Prinzip der Self Fulfilling Prophecy Wirklichkeit geworden. Es war wie in den von Hollywood ausgedachten Horror-Filmen - und doch schlimmer: Die Wolke von Staub und Rauch blieb wie ein infernalischer Stempel lange über der Superstadt kleben. Es schien, als käme das Dunkle aus dem Hellen, der Terrorismus aus der Zivilisation. Einige der Attentäter hatten sich in Florida - des neuen Präsidenten politische Heimat - ausbilden lassen. Einer hatte in Hamburg auf den Einsatz gewartet. Unter anderem in Boston - der 3 Wiege der amerikanischen Demokratie - haben sie sich eingecheckt. Sie nutzten die Hightech der modernen Welt in den USA, um ihr einen tiefen Stoß zu versetzen. Diese Terroristen spielten virtuos auf der Klaviatur der modernen Medienwelt, in der Bilder und Symbole zählen. New York und Washington, die Metropolen der wirtschaftlichen, politischen und militärischen Macht des Westens wurden angegriffen. Der Landsitz des Präsidenten war offensichtlich ein weiteres Ziel. Mit dem Doppelschlag gegen die Handelstürme wurde die Traumkulisse Manhattans in einen Alptraum verwandelt. Und als hätten die Attentäter noch dabei Regie geführt: Die Fernsehstationen dieser Erde wiederholten die apokalyptischen Bilder wieder und wieder. Da sprach der Präsident der USA von einem Krieg des „Guten” gegen das „Böse”. Das „Gute” werde gewinnen: „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns.“ Das erinnerte an das WesternSchema. Dabei definierte sich das „Böse” durch das “Gute” und umgekehrt. Für das „Böse” selber war Amerika der Feind schlechthin, der Weltenverderber. Auf der anderen Seite brauchte das sich als „gut” Definierende offenbar das „Böse”, sonst hätte es die Orientierung verloren. Für die USA vor allem schien ein Jahrzehnt nach dem Untergang des Ostblocks und dem Verlust des alten „Bösen“ diese Orientierung wieder da zu sein. Das neue Feindbild Amerikas fokussierte sich auf den moslemischen Fundamentalismus. Noch folgte Europa dieser Sichtweise, wenn auch angesichts des amerikanischen Schwarz-Weiß-Denkens etwas verwirrt. Amerika wollte auf den 11. September reagieren. „Die sind da so.“, sagte ein damals führender deutscher Politiker halb fatalistisch, halb respektvoll. Anfangs schwankte Amerika ein wenig zwischen seinem strikten Freund-Feind-Schema und einem stärkeren Interdependenz-Denken. Das Freund-Feind-Schema jedoch hatte sich bald in den USA durchgesetzt. Die Kriege in Afghanistan und schließlich im Irak waren die Folgen. In Europa und besonders Deutschland und Frankreich dagegen gewann das InterdependenzDenken an Relevanz. Das suchte die Ursachen des internationalen Terrorismus in den Ungerechtigkeiten dieser einen Welt: - Die ganz Elenden in Afrika bäumten sich global nicht auf. Viel zu schwach waren sie. Regional allerdings kam es dort immer wieder zu Ausbrüchen. Diese waren infernalisch, doch sie trafen die westliche Welt nicht. - Trotz vorhandener terroristischer Strukturen auch in den USA selber – wie immer wieder auftretende Gewaltexzesse - oder wie geschildert in Europa: Der Hauptangriff kam in der Tat aus dem Gürtel der moslemischen Staaten im Süden der „weißen” Länder - von Westafrika bis Fernost. Dort gab und gibt es eine gewachsene Kultur, eine nicht wie in Afrika 4 einst zerstörte Infrastruktur und eine aggressiv aufladbare Religion. Setzte man hier – so das Interdependenz-Denken - mit tätiger Hilfe an, könnte dem internationalen Terrorismus langsam der Boden entzogen werden. Dazu aber hätte der Westen einen Teil seines Reichtums wirklich opfern müssen. Das Freund-Feind-Denken begann die USA zu beherrschen, auch dank des propagandistischen Einsatzes von George W. Bush. Das Interdependenz-Denken fasste in Europa Fuß, jedenfalls in jenen Teilen Europas, dass der amerikanische Verteidigungsminister später das „alte Europa“ nennen sollte. Dieses „alte Europa“ trug den Krieg in Afghanistan – der angeblichen Basis des US-Feindes Nr. 1, Bin Ladin – noch mit. Doch beim Militäreinsatz gegen den Irak verweigerte es sich vehement. Dadurch wurde das kulturelle Band über den Atlantik gekappt, und viele in Europa glaubten, ein neues europäisches Bewusstsein sei im Entstehen. Die großen historischen Ereignisse lehren: Die Menschen meinen zwar, dass sich durch diese etwas ändern wird, aber ihre konkreten Erwartungen gehen oft in die falsche Richtung. Beim Mauerbau dachten viele, Berlin, Deutschland und Europa würden nun auf ewig geteilt bleiben. Dabei war der Bau der Mauer der Anfang vom Ende der Teilung. Als John F. Kennedy ermordet wurde, sah das Publikum die amerikanische Demokratie gefährdet und den Rassismus auf dem Vormarsch. Der Rassismus ist mittlerweile in den USA allgemein geächtet, und der Kampf gegen ihn ist substanzieller Bestandteil der „Political Correctnes“: Amerika ist noch stärker geworden. Die älteste Demokratie funktioniert nach wie vor - wenn auch manchmal wie bei der Präsidentschaft Nixons oder bei der ersten Wahl von Bush-Sohn mehr schlecht als recht. Zu gut schließlich ist in Erinnerung – um ein weiteres Beispiel für die spontane Fehleinschätzung der Folgen großer Ereignisse zu geben, dass die deutsche Vereinigung die erwarteten „blühenden Landschaften” beileibe nicht gebracht hat. Aber im großen und ganzen ist doch ein friedliches und demokratisches Deutschland mit einer neuen Hauptstadt daraus geworden. Der 11. September 2001 ist nicht vergessen worden wie viele andere Ereignisse dieses Ranges. Die an diesem Tage deutlich gewordene Fragilität der westlichen Zivilisation blieb bewusst. Aber die eilig beschworene unverbrüchliche Solidarität Europas und Deutschlands mit den USA trat nicht ein. Amerika entpuppte sich als militärisch allen anderen weit überlegene, auch religiös orientierte und tief verankerte Demokratie, die ihre Interessen unbeeindruckt von Bedenken bisheriger Partner vertrat. Europa erwies sich als militärisch schwach, uneinig und dort, wo es sich in der militärischen Gewaltfrage den USA moralisch überlegen wähnte, säkular und außenpolitisch wenig effektiv. 5 Insbesondere die nach1945 erworbene Unbefangenheit im Verhältnis zwischen den USA und Deutschland ist dahin. Sollte es in der deutschen Politik einen transatlantischen Richtungswechsel geben, wird diese Unbefangenheit nicht einfach wieder aufleben – nein, sie wird neu erarbeitet werden müssen. Denn zwischen beiden Ländern steht das Zerwürfnis beim Streit um den Krieg im Irak. Hier wurden große kulturelle Unterschiede deutlich. Anfang 2003 begannen die Amerikaner ihren Krieg im Irak. Anfang 2003 kamen in Deutschland nicht nur bei der Regierung, sondern auch im Volk Zweifel auf, ob die Menschheit hinzulernen könne. Das Wissen über die brutalen Folgen des Krieges gehörte – das zeigte sich jetzt - zu den Kollektiverfahrungen des deutschen Volkes. Bilder des Infernos von 1945 haben sich bei vielen eingeprägt und sind weitergegeben worden. Da ist die Szene auf einer Straße in Berlin: brennende und schwelende Ruinen, herunterhängende Straßenbahnoberleitungen, auf dem Pflaster liegende tote Pferde mit aufgerissenen Augen und daneben getötete Landser in ihren grauen Uniformen. Entsprechendes haben alle erlebt, oder sie haben durch Familienmitglieder davon erfahren. In solchen Situationen sind es nicht die hochmächtigen Staatsmänner, die sich des Elends annehmen, sondern das tun Hilfsorganisationen, Glaubensgemeinschaften, Nachbarn. Nach dem Inferno des II. Weltkrieges haben viele in Deutschland geglaubt, die Menschheit hätte sich fortentwickelt. Die UNO würde dafür sorgen, dass Recht vor Stärke geht. Die nordatlantische Gemeinschaft würde Krieg als Mittel der Konfliktlösung tunlich vermeiden. Europa würde sich zu einer der Freiheit, dem Frieden und dem Wohlstand verpflichteten Wertegemeinschaft entwickeln. 2003 schien den meisten Deutschen das alles infrage gestellt. Lag nun nur eine kurze Periode der Aufklärung hinter dem Land und stand jetzt wieder die Gewalt über dem Recht? Wenn eine der stabilsten und ältesten Demokratien der Welt – die USA - robust auf Gewalt setzte und die Verantwortlichen sich dabei nicht nur auf eigenes Recht, sondern auch auf Gott selber beriefen, dann wurde die Gefahr gesehen, dass die Dämme der liberalen politischen Kultur allüberall brechen. Es war zu befürchten, dass andere Staaten, dass Institutionen und letztlich die Menschen sich untereinander ebenso nach dem Recht des Stärkeren verhalten würden. Vielen in Deutschland schien es, als habe Amerika den amerikanischen Traum zerstört. Die Hoffnung breitete sich aus, dass die inneren Ereignisse der USA dort sehr bald politisch, publizistisch und wissenschaftlich analysiert würden. Man setzte auf die großen 6 intellektuellen und moralischen Kräfte im amerikanischen Volke und die Abwahl von George W. Bush. Die Administration Bush sagte damals, sie wolle nach dem Sieg über den Irak dort eine Demokratie installieren wie in Deutschland nach 1945. Dabei hatte Deutschland eine eigene demokratische Tradition spätestens seit 1848. Darauf ließ sich mit Unterstützung der westlichen Alliierten aufbauen. Entsprechendes gab es im Irak nicht. Wo waren dort die erfahrenen und untadeligen demokratischen Politiker vom Schlage Konrad Adenauers, Kurt Schumachers oder Thomas Dehlers? Der Eindruck entstand, dass im Irak ein Projekt begonnen hatte, das politisch nicht zu einem befriedigenden Abschluss geführt werden konnte. So kam es. Der Irak ist heute ein Pulverfass. Zwar steht jetzt amerikanisches und anderes Militär dort, aber zu Selbstmörderattentaten kommt es fast täglich. Weit mehr als 1000 Amerikaner mussten dort ihr Leben lassen. Für die moslemische Welt ist der Irak ein Trauma. Amerika aber ist stärker denn je. Mit religiösem Rückenwind fand die Irak-Intervention ihrer inneramerikanische Legitimation. Die Hoffnungen vieler Europäer, George Bush jun. werde nicht wiedergewählt, haben sich nicht erfüllt. Auch wirtschaftlich stehen die USA blendend da. Ihre Companies, ihre Methoden bestimmen, welche ökonomische Musik weltweit gespielt wird. Und die deutsche Regierung erhält beim Betteln um einen ständigen Sitz im WeltSicherheitsrat in Washington einen Korb – im Unterschied zu Japan, das ja zur „Koalition der Willigen“ gehört hatte und ein Gegenspieler von China ist. Derweil kommt das neue Europa nicht voran. Schröder und Chirac stehen vor ihrem politischen Ende und sind „lame ducks“. Tony Blair, der beim Irak-Krieg als Schoßhund von George W. Bush Verlästerte, steht wiedergewählt und strahlender denn je dar. Er wird nun die Ratspräsidentschaft in Europa übernehmen. Deutschland und Frankreich - - der einstige „Motor Europas“ - müssen erst einmal umgebaut werden, bevor sie wieder eine wichtige Rolle in Europa spielen. Viele haben gesagt, Gerhard Schröder habe 2002 so massiv gegen die Intervention der USA in den Irak Stellung genommen, weil er die Wahlen gewinnen wollte. Das hat er auch. Aber Schröder handelte zur Überraschung vieler nicht taktisch, sondern grundsätzlich, denn anach setzte er seinen Kurs gegen die Intervention fort. Der transatlantische Krach war da. Heute ist Schröder gescheitert, vor allem wegen seiner Sozialpolitik. Er hat seine Partei, die SPD, in dieser Frage in eine tiefe Krise geführt. Da erscheint der Anti-USA-Kurs – der zweifellos die Befindlichkeiten in Deutschland artikuliert hatte – nach den innenpolitischen Siegen von Bush und Blair im Nachhinein auch als Niederlage der Regierung Schröder. 7 Geschwächt und schwächer als jeder ihrer Vorgänger wird die wahrscheinliche neue deutsche Kanzlerin Angela Merkel nach ihrer Wahl im Herbst zum Antrittsbesuch in die amerikanische Hauptstadt kommen. Sie kann – schon weil das deutsche Volk da gar nicht mitmachen würde – nicht im Nachhinein der „Koalition der Willigen“ beitreten. Aber weil es nun einmal die militärisch, wirtschaftlich und auch kulturell stärkste Macht der Welt ist, wird sie wieder ein Band zwischen den USA und Deutschland knüpfen wollen. So eng und herzlich wie bis 2001 werden die Beziehungen zwischen Amerika und Deutschland wohl nicht wieder werden. Vielleicht ist das ja ein Zeichen dafür, dass Deutschland eigenständig geworden ist: Es kann nicht mehr der naive Bewunderer des großen Bruders sein, sondern ein mittelmächtiger Spieler, der Chancen und Risiken der Weltpolitik selbst und eigenständig tragen muss. Transatlantische Irritationen werden bleiben, wie es sie immer gab. Schon die Engländer täuschten sich in ihrer Kolonie: Die Siedler und Farmer an der Ostküste der Neuen Welt erwiesen sich bei all ihre Religiosität als pragmatische Wirtschafter und Politiker. Als ihnen politische Mitwirkung verwehrt wurde, obwohl man ihr Geld haben wollte, entledigten sie sich der Kolonialmacht: „No taxation without representation.“ Sie machten den Erzrivalen Großbritanniens, Frankreich, zu ihrem Bündnispartner und erkämpften ihre Freiheit. Sie ersannen eine demokratische Verfassung, die bis auf den heutigen Tagintakt blieb. Dann dehnten sie ihr Territorium aus: „From coast to coast“ und von Kanada bis nach Mexiko. Die Europäer unterschätzten dieses Land, bis sie merkten, dass sie von der neuen Welt nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich-technologisch eingeholt und übergeholt waren. Diese Amerikaner redeten nicht nur von ihren Werten wie Freiheit, Wohlstand und Glück; sie meinten das auch ernst. Auch um ihrer Werte willen intervenierten sie im ersten und zweiten Weltkrieg in Europa. Die Amerikaner glauben an Demokratie, Wohlstand, Recht auf Glück. Das sehen sie aber nicht als Staatsziele, sondern als Bürgerrechte: Hilf Dir selbst, dann wirst Du es schaffen. In Europa hingegen betonte man die Schattenseiten dieses Amerikas: die Bekämpfung und Verdrängung der Indianer, den weißen Rassismus, die Kolonialattitüde auf dem amerikanischen Kontinent und im Pazifik. „Halleluja“ laute ihr Schlachtruf, mit dem sie sich die Welt untertan machen. Pfeffersäcke und Beetbrüder in einem seien sie. Da ist manches dran. In seinem berühmten Aufsatz über die protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus hat Max Weber den Zusammenhang zwischen Puritanismus und Ökonomie analysiert. Der Puritaner wollte ausgezeichnet werden vor Gott, und da selbstgeschaffner 8 Wohlstand ein Ausweis der Gottgefälligkeit des Lebens eines Menschen sei, arbeitete der Puritaner hart in seinem Beruf und brachte es zu Reichtum. Wer aber nicht gottesfürchtig, nicht „gut“ ist, dem kann es schlecht gehen bei den Amerikanern. Ihre Gefängnisse gehören bestimmt zu den ungemütlichsten der Welt, und die Todesstrafe wird weithin als gerecht empfunden. Wenn es der Bekämpfung des Bösen dient, kann auch das ansonsten so hoch geschätzte Recht außer Kraft gesetzt werden. Guantanamo ist ein aktuelles Beispiel hierfür. Doch sollte die Europäer dieses alles nicht verwundern. Amerika ist geworden, weil von der Mayflower angefangen religiös Unterdrückte, Sekten und Sektierer aus Europa – wo sie verfolgt wurden – flohen. In der Neuen Welt fanden sie ihre Freiheit. Aus diesen Wurzeln zehrt Amerika heute noch, sehr zum Unverständnis des säkularisierten Europas. Leistung und Erfolg zählt viel in Amerika. Auf diesen Prinzipien haben sie ihre Hochschulen aufgebaut, und die sind heute führend in der Welt. Wer hinaus will in die internationale Welt des Wissens, der studiert und forscht heute nicht wie vor 100 Jahren in Deutschland, sondern in den USA. Heute ist Amerika kein weißes Land mehr. Es ist bunt, farbig. Immer mehr Menschen sprechen Spanisch. Das Spanische hat das Englische schon mancherorts verdrängt. An der Westküste siedeln mehr und mehr Asiaten. Viele der vor den Kommunisten geflohenen HongKong-Chinesen siedelten sich nicht in London, sondern in Vancouver an. Und diese sind keine armen Flüchtlinge, sondern pragmatische, gute Geschäftsleute, die nach Amerika passen. Chinesen-, Italiener- und Judenviertel gibt es schon lange. In New York ist die ganze Welt zu Hause. Amerika ist global ausgerichtet. Europa ist nicht mehr der Dreh- und Angelpunkt des Denkens. Die Elite hat China im Blick: Wird das die Supermacht von morgen sein und Amerika den Rang ablaufen? So gesehen, muss Europa Amerika schon etwas bieten, wenn es dort relevant sein will. Gegenwärtig arbeitet Europa allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Jürgen Dittberner (17.6.05) 9