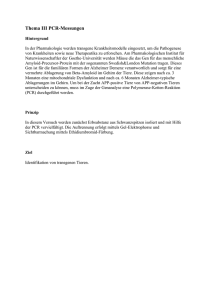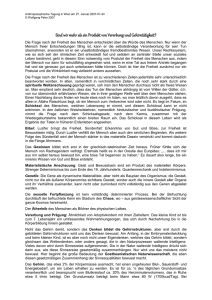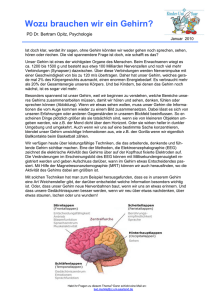Denkenphilosophie
Werbung
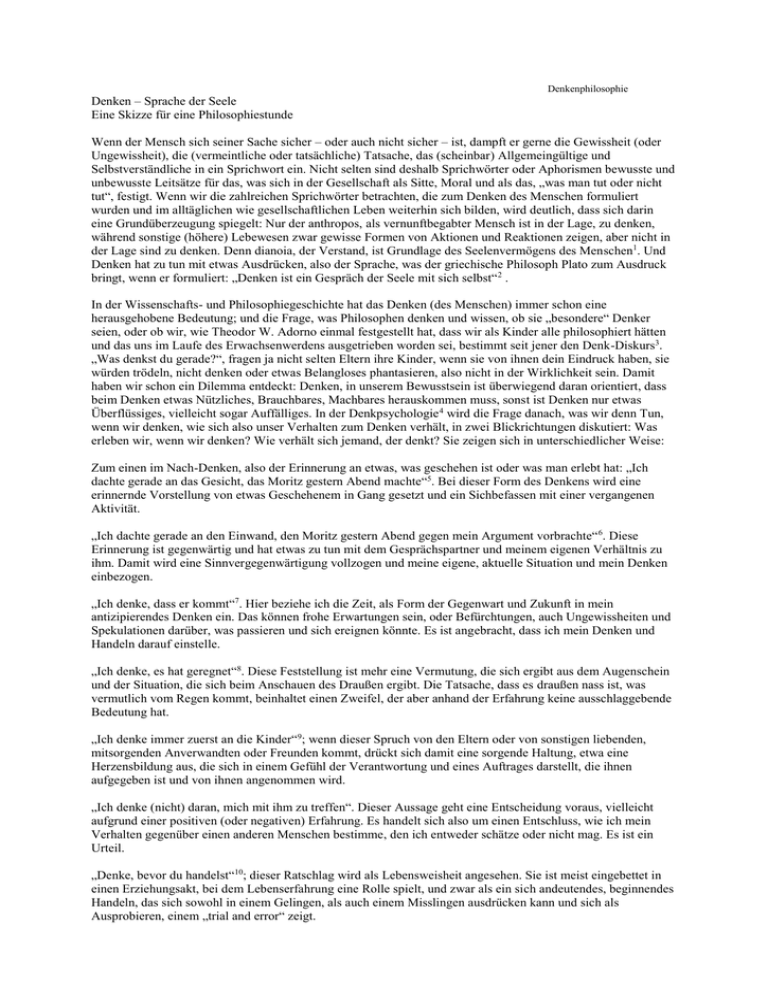
Denkenphilosophie Denken – Sprache der Seele Eine Skizze für eine Philosophiestunde Wenn der Mensch sich seiner Sache sicher – oder auch nicht sicher – ist, dampft er gerne die Gewissheit (oder Ungewissheit), die (vermeintliche oder tatsächliche) Tatsache, das (scheinbar) Allgemeingültige und Selbstverständliche in ein Sprichwort ein. Nicht selten sind deshalb Sprichwörter oder Aphorismen bewusste und unbewusste Leitsätze für das, was sich in der Gesellschaft als Sitte, Moral und als das, „was man tut oder nicht tut“, festigt. Wenn wir die zahlreichen Sprichwörter betrachten, die zum Denken des Menschen formuliert wurden und im alltäglichen wie gesellschaftlichen Leben weiterhin sich bilden, wird deutlich, dass sich darin eine Grundüberzeugung spiegelt: Nur der anthropos, als vernunftbegabter Mensch ist in der Lage, zu denken, während sonstige (höhere) Lebewesen zwar gewisse Formen von Aktionen und Reaktionen zeigen, aber nicht in der Lage sind zu denken. Denn dianoia, der Verstand, ist Grundlage des Seelenvermögens des Menschen1. Und Denken hat zu tun mit etwas Ausdrücken, also der Sprache, was der griechische Philosoph Plato zum Ausdruck bringt, wenn er formuliert: „Denken ist ein Gespräch der Seele mit sich selbst“ 2 . In der Wissenschafts- und Philosophiegeschichte hat das Denken (des Menschen) immer schon eine herausgehobene Bedeutung; und die Frage, was Philosophen denken und wissen, ob sie „besondere“ Denker seien, oder ob wir, wie Theodor W. Adorno einmal festgestellt hat, dass wir als Kinder alle philosophiert hätten und das uns im Laufe des Erwachsenwerdens ausgetrieben worden sei, bestimmt seit jener den Denk-Diskurs3. „Was denkst du gerade?“, fragen ja nicht selten Eltern ihre Kinder, wenn sie von ihnen dein Eindruck haben, sie würden trödeln, nicht denken oder etwas Belangloses phantasieren, also nicht in der Wirklichkeit sein. Damit haben wir schon ein Dilemma entdeckt: Denken, in unserem Bewusstsein ist überwiegend daran orientiert, dass beim Denken etwas Nützliches, Brauchbares, Machbares herauskommen muss, sonst ist Denken nur etwas Überflüssiges, vielleicht sogar Auffälliges. In der Denkpsychologie 4 wird die Frage danach, was wir denn Tun, wenn wir denken, wie sich also unser Verhalten zum Denken verhält, in zwei Blickrichtungen diskutiert: Was erleben wir, wenn wir denken? Wie verhält sich jemand, der denkt? Sie zeigen sich in unterschiedlicher Weise: Zum einen im Nach-Denken, also der Erinnerung an etwas, was geschehen ist oder was man erlebt hat: „Ich dachte gerade an das Gesicht, das Moritz gestern Abend machte“5. Bei dieser Form des Denkens wird eine erinnernde Vorstellung von etwas Geschehenem in Gang gesetzt und ein Sichbefassen mit einer vergangenen Aktivität. „Ich dachte gerade an den Einwand, den Moritz gestern Abend gegen mein Argument vorbrachte“ 6. Diese Erinnerung ist gegenwärtig und hat etwas zu tun mit dem Gesprächspartner und meinem eigenen Verhältnis zu ihm. Damit wird eine Sinnvergegenwärtigung vollzogen und meine eigene, aktuelle Situation und mein Denken einbezogen. „Ich denke, dass er kommt“7. Hier beziehe ich die Zeit, als Form der Gegenwart und Zukunft in mein antizipierendes Denken ein. Das können frohe Erwartungen sein, oder Befürchtungen, auch Ungewissheiten und Spekulationen darüber, was passieren und sich ereignen könnte. Es ist angebracht, dass ich mein Denken und Handeln darauf einstelle. „Ich denke, es hat geregnet“8. Diese Feststellung ist mehr eine Vermutung, die sich ergibt aus dem Augenschein und der Situation, die sich beim Anschauen des Draußen ergibt. Die Tatsache, dass es draußen nass ist, was vermutlich vom Regen kommt, beinhaltet einen Zweifel, der aber anhand der Erfahrung keine ausschlaggebende Bedeutung hat. „Ich denke immer zuerst an die Kinder“9; wenn dieser Spruch von den Eltern oder von sonstigen liebenden, mitsorgenden Anverwandten oder Freunden kommt, drückt sich damit eine sorgende Haltung, etwa eine Herzensbildung aus, die sich in einem Gefühl der Verantwortung und eines Auftrages darstellt, die ihnen aufgegeben ist und von ihnen angenommen wird. „Ich denke (nicht) daran, mich mit ihm zu treffen“. Dieser Aussage geht eine Entscheidung voraus, vielleicht aufgrund einer positiven (oder negativen) Erfahrung. Es handelt sich also um einen Entschluss, wie ich mein Verhalten gegenüber einen anderen Menschen bestimme, den ich entweder schätze oder nicht mag. Es ist ein Urteil. „Denke, bevor du handelst“10; dieser Ratschlag wird als Lebensweisheit angesehen. Sie ist meist eingebettet in einen Erziehungsakt, bei dem Lebenserfahrung eine Rolle spielt, und zwar als ein sich andeutendes, beginnendes Handeln, das sich sowohl in einem Gelingen, als auch einem Misslingen ausdrücken kann und sich als Ausprobieren, einem „trial and error“ zeigt. „Ich denke, dass es Gott (nicht) gibt“11. Die Entscheidung oder Vermutung über meine religiöse Einstellung, als Gläubiger oder Agnostiker, wurzelt in den festgefügten, unhinterfragten Gewissheiten oder in Überzeugungen, die nicht beweisbar sind; den die Aussage: „Ich glaube“, oder „Ich glaube nicht“ gründet auf weltanschaulichen Standpunkten. „Ich denke, wie ich bin“12, erfordert eine autobiographische Erforschung 13 und des Nachdenkens über das eigene Leben, sowohl als Selbstansicht, als auch als Weltansicht. Darin artikulieren sich die Wege, Erfahrungen und Diktate, wie sich Selbsterkenntnis ergibt, wie auch generalisierbares Handeln von Vorbildern und Normgebungen der Gesellschaft. „Ich denke, dass ich du bin“14. Mit dem Aphorismus: „Lass mich Ich sein, damit du Du sein kannst“15, wird deutlich, dass der Mensch als zôon politikon (Aristoteles) ein Lebewesen ist, das nicht ohne seinesgleichen leben kann und nur in der Gemeinschaft nach den Grundwerten eines guten Lebens – Gerechtigkeit, Freiheit, Friedfertigkeit und Solidarität – streben kann. „ego cogito, ergo sum“ Wenn also Denken Vergegenwärtigung ist, und zwar von Vergangenem, Gegenwärtigem und Zukünftigem, liegt in diesem Akt menschlichen Daseins sowohl ein Habhaftwerden von materieller, sichtbarer und lebensnotwendiger Dinghaftigkeit, die sich in der „Habenmentalität“, wie auch im „Seinsmodus“ (Erich Fromm) ausdrückt und im Cartesischen „cogitatio“ als Bewusstsein verdeutlicht, als auch mit den prozesshaften Auffassungen formuliert werden, wie sie in der Denkpsychologie Verwendung finden: 1. 2. 3. 4. 5. Jedes Denken tendiert dazu, Teil eines persönlichen Bewusstseins zu werden. In jedem persönlichen Bewusstsein ist Denken in einem ständigen Wandel begriffen. In jedem persönlichen Bewusstsein weist Denken eine merkliche Kontinuität auf. Es scheint sich immer mit Gegenständen zu befassen, die von ihm unabhängig sind. Es wählt fortwährend unter ihnen aus16. Wenn unser Gehirn sich verändert, verändern wir uns mit ihm Das Gehirn, als Zentralnervensystem unseres Körpers, ist seit Menschengedenken Forschungs- und Spekulationsobjekt. Die Erkenntnis, dass das Gehirn des Menschen aus zwei Hälften besteht, die jeweils unterschiedliche Funktionen ausüben, erkannten bereits die antiken Denker. Aristoteles etwa gliederte das enkephalos, in ein „kaltes“ und ein „warmes“ Gehirn, das die Aufgabe hat, „die kochende Wärme des Herzens auszugleichen und ein ideales Temperaturverhältnis herzustellen“17 .Nach den moderneren Vorstellungen befindet sich im Großhirn das Zentrum unserer Wahrnehmungen, unseres Bewusstseins, Denkens, Fühlens und Handelns18. Es sind insbesondere die neurophysiologischen und -wissenschaftlichen Forschungen, die in der öffentlichen Meinung euphorische, euphemische, empathische wie enragierte und eskapatische Auffassungen der Bedeutung der (Spiegel-)Neuronen für das Denken und Verhalten der Menschen hervorrufen 19 Der Aufbau des menschlichen Gehirns aus mehreren Hundert Milliarden Zellen verursacht beim naiven wie beim wissenschaftlichen Betrachter eher Staunen denn Wissen; und in der neurowissenschaftlichen Forschung wird immer deutlicher, dass ein Mehr-Wissen über das, was Denken, Fühlen, Erfahren und Erleben beim Menschen ausmacht, nur als gemeinsame Anstrengung der Wissensdisziplinen, der Biologie, Medizin, Psychologie, Philosophie, Sprachwissenschaften, Mathematik, Physik…, möglich ist. Die sich daraus ergebenden Forschungsergebnisse füllen mittlerweile ganze Bibliotheken; und die Befürworter wie Kritiker zum Erkenntnisstand über das menschliche Gehirn tappen vielfach weiterhin im Dunkeln, bzw. haben sich mit ihren Konzepten mehr oder weniger eingeigelt20. Es wirkt irritierend oder gar verstörend und bedrohlich, wenn unser Bewusstein vom selbständigen Denken und Tun mit Behauptungen korrigiert wird, wie: „Gehirne haben sich darauf spezialisiert, Informationen zu sammeln und das Verhalten entsprechend zu steuern. Dabei ist es egal, ob das Bewusstsein an der Entscheidungsfindung beteiligt ist oder nicht“. Was passiert da mit uns ohne unser intellektuelles Zutun? Sind wir den evolutionsgeschichtlichen Entwicklungen, die unser Gehirn zu diesem geheimnisvollen Megasystem gemacht hat, machtlos ausgeliefert? Steuert uns unser Gehirn? Solche Fragen bieten Medien reißerische Schlagzeilen. Und, wenn wir nicht das einsetzen, was uns Menschen zu den vernunftbegabten Lebewesen macht, geraten wir unversehens in Fatalismen oder Euphorismen. „Kaum etwas von dem, was sich in unserem Geist abspielt, können wir bewusst kontrollieren“; schon wieder so ein Satz, der einem (ver)zweifeln lassen kann. Denn: Ist der Mensch nicht die Krone der Schöpfung? Ist er nicht der Herr über alles, was sich auf Erden bewegt, gedacht und getan wird? Wie unsere Sinne funktionieren und wie Sinnestäuschungen unsere Erfahrungen bestimmen, das sind oftmals erstaunliche Entdeckungen und Aha-Erlebnisse, gelingt es erst einmal, unseren Blick zu „richten“, wird deutlich, dass wir mit unserem Gehirn sehen – und unsere Augen lediglich die Vollzugsorgane dieser Gerichtetheit sind, das nicht linear, also etwa von A nach B, sondern in verschiedenen Bahnen verläuft, rückgekoppelt. querverweisend und vorwärtsorientiert. Stellen sich die Erkenntnisse der Neurowissenschaften nun als „Sturz aus unserer eigenen Mitte“ dar, weil „wir kaum bewussten Zugang zu dem Apparat unter unserer Haube haben“; oder führen die Ergebnisse über das geheime Innenleben in unserem Gehirn dazu, uns bewusst zu werden, dass die neue „Kartierung unserer Innenwelt“ uns verstehen lassen kann, dass unser Gehirn ein Apparat mit widerstreitenden Teilen ist und “nach Mustern im Chaos (sucht)und sinnlose Daten in eine Ordnung bringen (will)“ 21. Die Kontroverse, wie sie sich beim geistes-22 und neurowissenschaftlichen Diskurs zeigt, wenn es um die Frage der philosophischen Fragen geht: „Wer bin ich?“23, ist ohne Zweifel auch eine Herausforderung für schulisches Lernen. Die Erkenntnis, dass Philosophie, Werte und Normen, Ethik keine Neben-, Orchideenfächer24 oder bestenfalls Lernangebote für Arbeitsgemeinschaften darstellen, sondern konstitutiv für ganzheitliches Lernen und Entwickeln sind, sollte Mut machen für curriculares, kooperatives Denken und Arbeiten. Arbeitsblatt „Der Mensch denkt ...“25 Sprichwörter sind geronnene Wahrheiten; oder: Sprichwörter sind Verführungen, selbst nicht zu denken! Am Beispiel des Sprichworts „Der Mensch denkt und Gott lenkt“, das aus dem Alten Testament, Die Sprüche Salomos, Spruch 16/9, vereinfacht übernommen wurde: „Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein lenkt seinen Schritt“ (Die BIBEL oder die ganze HEILIGE SCHRIFT des Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen Übersetzung Martin Luthers, Württembergische Bibelanstalt, Stuttgart 1966, S.690), soll die Bedeutung der Spruchweisheit in Partner- oder Kleingruppenarbeit analysiert werden: 1. Bertold Brecht bezieht sich in seinem 1938/39 im schwedischen Exil verfassten und 1941 in Zürich uraufgeführten Drama „Mutter Courage und ihre Kinder“ auf den Bibelspruch, indem er ihn durch die Änderung der Satzzeichen umkehrt: „Der Mensch denkt: Gott lenkt. Keine Red‘ davon“. 2. Die Situation, dass Medienfachjournalisten überwiegend nur beim Bertelsmann-Konzern ausgebildet werden, führt zu der Frage, ob es richtig ist, dass ein Medienunternehmen diejenigen schult, die über Medien berichten sollen: „Ein Schelm, der Böses dabei denkt“. 3. „Es kommt meist anders, als man denkt“. Woran kann es liegen, dass sich eine Sache auf andere Weise entwickelt, als man vorher gedacht, geplant oder gehofft hat? Welche Folgen kann das haben? Positive und negative? Findet weitere Sprichwörter, bei denen das Denken als Widerspruch dargestellt wird! Dr. Jos Schnurer Immelmannstr. 40 31137 Hildesheim (8. 4. 2012) 1 Otfried Höffe, Aristoteles-Lexikon, Stuttgart 2005, S. 47ff, sowie 120ff Martin Gessmann, Philosophisches Wörterbuch, Stuttgart 2009, S. 154f 3 Herbert Schnädelbach, Was Philosophen wissen und was man von ihnen lernen kann, München 2012, 237 S. 4 Carl Friedrich Graumann, Hrsg., Denken, 5., Aufl., Köln – Berlin 1971, 513 S. 5 Christian Gudehus / Ariane Eichenberg / Harald Welzer, Hrsg., Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart 2010, 364 S., vgl. auch: Astrid Erll: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung,, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage, Stuttgart - Weimar 2011,.243 S. 6 Siegfried Schumann, Individuelles Verhalten. Möglichkeiten der Erforschung durch Einstellungen, Werte und Persönlichkeiten, Schwalbach/Ts, 2012, 383 S. 7 Nora Nebel, Ideen von der Zeit. Zeitvorstellungen aus kulturphilosophischer Perspektive, Marburg 2011, 287 S. 8 Ludwig Trepl, Die Idee von der Landschaft. Eine Kulturgeschichte von der Aufklärung bis zur Ökologiebewegung, Bielefeld 2012, 255 S. 9 Kerstin Jergus, Liebe ist ... Artikulationen der Unbestimmtheit im Sprechen über Liebe. Eine Diskursanalyse, Bielefeld 2011, 272 S. 2 10 Lukas Neuhaus, Wie der Beruf das Denken formt. Berufliches Handeln und soziales Urteil in professionssoziologischer Perspektive, Marburg 2011, 306 S. 11 Bruno Latour, Jubilieren. Über religiöse Rede, Berlin 2011, 247 S. 12 Georg Stefan Troller, Selbstbeschreibung, Düsseldorf 2009, 360 S. 13 Thorsten Fuchs, Bildung und Biographie. Eine Reformulierung der bildungstheoretisch orientierten Biographieforschung, Bielefeld 2011, 440 S. 14 Tobias Künkler, Lernen in Beziehung. Zum Verhältnis von Subjektivität und Relationalität in Lernprozessen, Bielefeld 2011, 608 S. 15 Jos Schnurer, Für Eine Welt – in Einer Welt. Überlebensfragen bei der Weiterentwicklung von Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Schule, Verlag Dialogische Erziehung / Paulo Freire Verlag, Oldenburg 2003, 267 S. 16 Graumann, a.a.o., S. 22 17 Höffe, a.a.o., S. 185 18 http://de.wikipedia.org/wiki/Gehirn 19 Ulrich Herrmann, Hrsg., Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen; 2. Aufl., Weinheim / Basel 2009, 288 S. 20 Karl Heinz Bohrer, Selbstdenker und Systemdenker. Über agonales Denken, München 2011, 223 S. 21 David Eagleman, Inkognito. Die geheimen Eigenleben unseres Gehirns, Frankfurt/M., 2012, 328 S.; vgl. dazu auch die Kritik am bildgebenden Verfahren bei der Hirnforschung: Ulrich Salachek, Der Mensch als neuronale Maschine? Zum Einfluss bildgebender Verfahren der Hirnforschung auf erziehungswissenschaftliche Diskurse, Bielefeld 2012, 224 S. 22 Ulrich Salachek, Der Mensch als neuronale Maschine? Zum Einfluss bildgebender Verfahren der Hirnforschung auf erziehungswissenschaftliche Diskurse, Bielefeld 2012, 224 S. 23 Richard David Precht: Wer bin ich - und wenn ja wie viele? Eine philosophische Reise, München 2007, 398 S. 24 Stefan Conermann, Hg., Was ist Kulturwissenschaft? Zehn Antworten aus den „Kleinen Fächern“, Bielefeld 2012, 313 S. 25 u. a.: http://www.redensarten-index.de/suche.php?/suchbegriff...