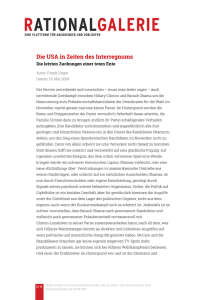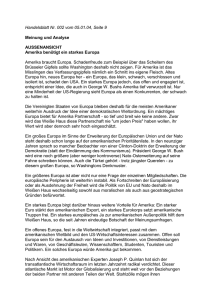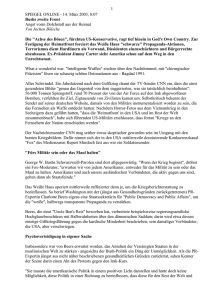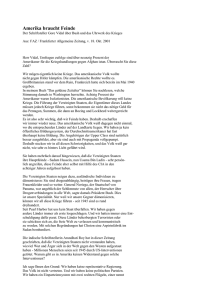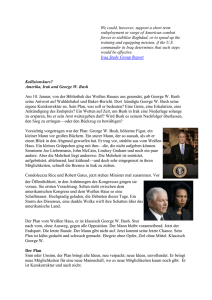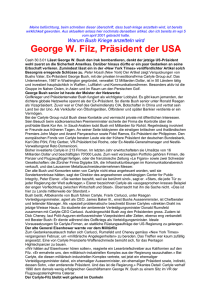als WORD-DOC downloaden
Werbung

Vier andere Jahre Am 20. Januar hat die zweite Amtszeit des amerikanischen Präsidenten George W. Bush begonnen. Seine Wiederwahl im vergangenen November hatte in Europa für viel Enttäuschung gesorgt. Doch der Rechtsruck geht nicht so weit, wie vielfach behauptet. Die Entscheidung der amerikanischen Wähler bietet auch Chancen für ein besseres transatlantisches Verhältnis. Von Dr. Claudius Wenzel Der erste Schock saß tief. Wie konnten sie nur? Wie konnten die amerikanischen Wählerinnen und Wähler George W. Bush wiederwählen nach all dem was er Amerika angetan hat: fast 1300 gefallene amerikanische Soldaten im Irak und in Afghanistan, viele von Ihnen gerade 19, 22, 25 Jahre alt, ein Anti-Terrorkrieg der anfängliche internationale Sympathien in Rekordzeit verspielt hat und ein desaströser Bundeshaushalt mit all den bekannten Folgen für die Handlungsfähigkeit der Regierung – die Liste ließe sich fortsetzen. Amerikanische aber auch europäische Medien haben nach der Wahl mit Kritik nicht gespart. Bei allem Verständnis für die Enttäuschung, dass nun in den nächsten vier Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit keine neue Ära der Harmonie und multilateralen Zusammenarbeit beginnen wird – es muss gerade deshalb darum gehen, die transatlantische Verständigung und eben auch das Verständnis füreinander zu verbessern. Ein vereinfachtes Bild von einem machtbesessenen, missionarischen und rücksichtslosen Amerika hilft nicht weiter. Es wirkt allenfalls kontraproduktiv, behindert es doch eine differenzierte Wahrnehmung als Voraussetzung eines klugen Umgangs miteinander. Zu dieser differenzierten Wahrnehmung gehört, die aktuellen politischen Verhältnisse und das Wahlergebnis in den USA in das richtige Licht zu rücken: Erstens: Ja, das Wahlergebnis erteilt George W. Bush im Gegensatz zu dem umstrittenen Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2000 ein Mandat, stärkt die Republikaner und vermutlich auch den rechten Flügel der Partei. Dennoch: die Wiederwahl von Bush Junior ist keinesfalls ein Beweis für eine neue Dominanz eines religiös-fundamentalistischen Konservatismus in den USA. Die USA durchleben noch immer eine außergewöhnliche Zeit. Europa hat in den Monaten nach den grauenhaften Terroranschlägen vom 11. September 2001 viel Solidarität und Mitgefühl gezeigt. Wie tief die Verletzungen des American way of life jenseits des Atlantiks tatsächlich empfunden werden, ist hier bestenfalls ansatzweise begriffen worden. Die Amerikaner haben einen Präsidenten wiedergewählt, dem sie Entschlossenheit und Tatkraft insbesondere in Fragen der inneren und äußeren Sicherheit zutrauen. Das zu belächeln wäre überheblich. Die Wahl als eine zwischen verschiedenen Wertewelten darzustellen, trifft ebenfalls nicht den Kern. In Zeiten, in denen inhaltliche Alternativen schwierig darzustellen sind und eine Bedrohung hoch eingeschätzt wird, ist die wahrgenommene Integrität der Kandidaten ausschlaggebend. Der Amtsbonus war für George W. Bush ein erheblicher Vorteil. Zweitens: Das politische System der USA und die amerikanischen Wählerinnen und Wähler haben ihre Fähigkeit zu Lernen schon häufiger unter Beweis gestellt – die checks and balances verdienen Vertrauen. Die republikanische Herrschaft im Weißen Haus und in beiden Häusern des Kongresses bedeutet angesichts einer eingeschränkten Parteidisziplin keinesfalls das Ende der Gewaltenteilung, die gerade im amerikanischen System stark ausgeprägt ist. Die zweite Administration Bush hat keinen Freifahrtschein für ihre politischen Vorhaben, zumal die Haushaltslage den Kongress in den kommenden Jahren verstärkt interessieren wird. Drittens: Die amerikanische Verfassung gestattet dem amerikanischen Präsidenten George W. Bush nur noch eine Amtszeit. Sein Vize, Dick Cheney, wird alters- und krankheitsbedingt kaum sein Nachfolger sein können. Die amerikanischen Wählerinnen und Wähler müssen in vier Jahren also etwas Neues wagen. Dies wird die politische Auseinandersetzung nicht erst im Wahlkampfjahr 2008 beeinflussen. Die Demokratische Partei wird sich schon bald darauf vorbereiten. Und auch in der Republikanischen Partei wird spätestens nach den Wahlen zum Kongress in zwei Jahren, die Frage gestellt werden, was nach Bush kommt. Viertens: Amerika ist keinesfalls so tief gespalten, wie dies gerne behauptet wird. Das was amerikanische Experten als cultural divide bezeichnen, lässt sich schwer als Spaltung bezeichnen. Richtig ist, das sich das Wahlverhalten bestimmter Gruppen (Frauen und Männer, Alters- und Einkommensgruppen, Regionen) seit einigen Jahren verstetigt hat und zwischen den Parteien bei wichtigen Fragen eine zunehmende Polarisierung zu erkennen ist. Doch gerade im Vergleich zu Europa sind die Parteienbindungen traditionell wesentlich lockerer und Persönlichkeiten spielen eine herausragende Rolle. Bewegung ist und bleibt deshalb möglich, zumal die beiden Lager nur drei Prozent der Wählerstimmen auseinanderliegen. Fünftens und in dieser Phase besonders wichtig: Bei all den beschworenen Gefahren einer zweiten Amtsperiode von George W. Bush – es lohnt sich die tatsächlichen Entwicklungen abzuwarten. Vieles spricht dafür, dass George W. Bush seinem politischem Stil treu bleibt: selbstbewusst und standfest in den eigenen Überzeugungen. Doch auch er wird die Grenzen des Machbaren mittlerweile stärker realisiert haben, als zu Beginn der ersten Amtsperiode. Dass militärische Einsätze nach dem Modell Irak allenfalls begrenzt erfolgreich sind und die eigenen Kräfte lange Zeit binden, hat die Regierung erfahren müssen. Bereits die letzten Monate haben gezeigt, dass Bush sehr wohl begriffen hat, dass Amerika ohne das „alte Europa“ an der Seite in der internationalen Politik nicht stärker werden kann. Die früh angekündigte Europareise des wiedergewählten Präsidenten deutet in dieselbe Richtung. Das Wandel in acht Jahren Amtszeit möglich ist, haben schon andere amerikanische Präsidenten gezeigt – nicht zuletzt das Vorbild des George W. Bush: Ronald Reagan. Kurzum: Die politische Mitte Amerikas hat sich keinesfalls von der politischen Bühne verabschiedet. Gelassenheit ist auf europäischer Seite deshalb der beste Ratgeber. Die Devise einer möglichst gemeinsamen, durchaus selbstbewussten europäischen Außenpolitik gegenüber der Bush-Administration sollte lauten: So viel Kooperation und diplomatisches Geschick wie möglich, so wenig öffentlich ausgetragene Konflikte wie möglich. Amerika und Europa werden in Zukunft noch stärker aufeinander angewiesen sein. Das sollte nicht nur so mancher Amerikaner, sondern auch der ein oder andere Europäer begreifen. In einer Zeit schwer berechenbarer Chaosmächte wird es nur gemeinsam und arbeitsteilig gelingen, hard power und soft power so einzusetzen, dass der Nährboden für den internationalen Terrorismus ausgetrocknet, gewalttätige Konflikte verhindert, Menschenrechte verwirklicht und nachhaltige Entwicklungen möglich werden. Meinungsverschiedenheiten, deutliche Meinungsverschiedenheiten, werden nicht ausbleiben. Stille Diplomatie kann auch gegenüber Freunden und Partnern der richtige Weg sein, gerade wenn es Gelegenheiten für Neubestimmungen von Positionen gibt. Genau diese Chance besteht jetzt.