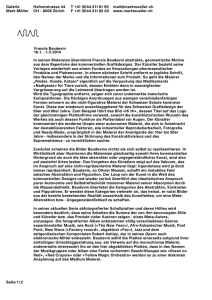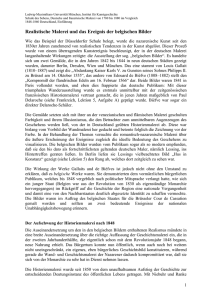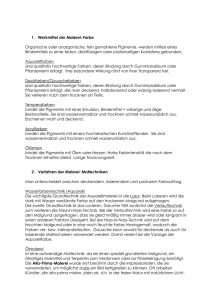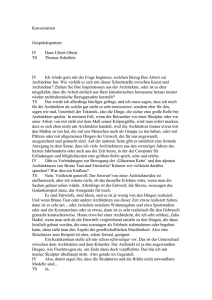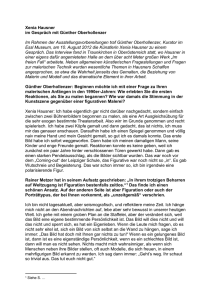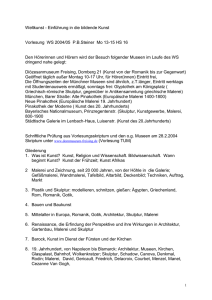bignothing_kuenstlertexte
Werbung
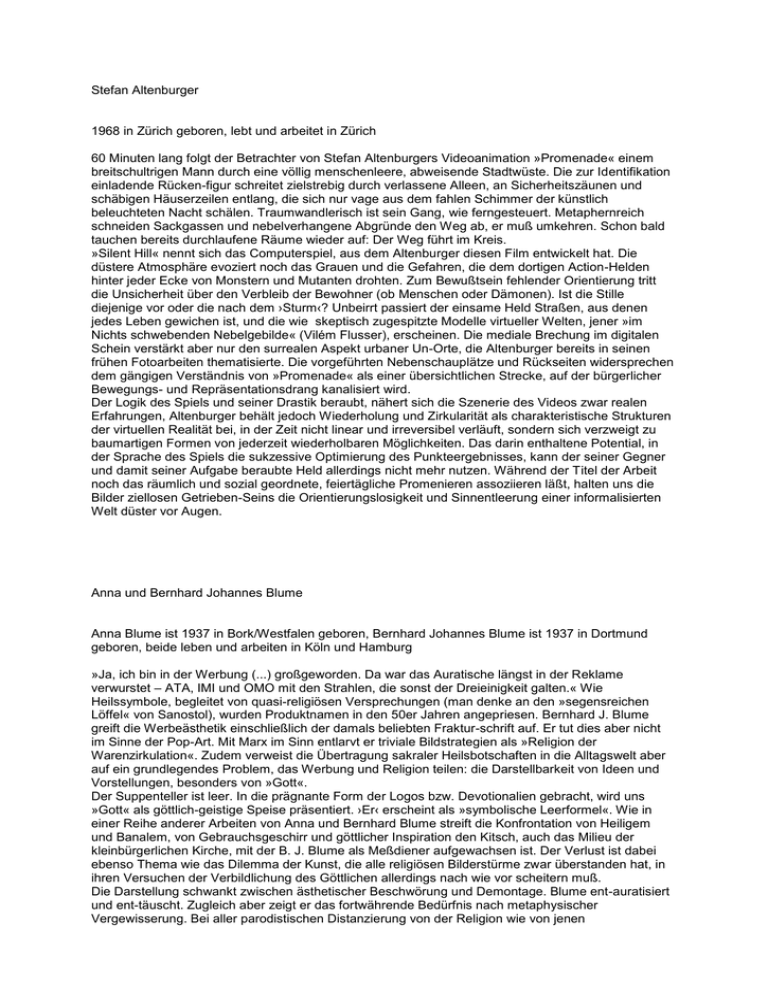
Stefan Altenburger 1968 in Zürich geboren, lebt und arbeitet in Zürich 60 Minuten lang folgt der Betrachter von Stefan Altenburgers Videoanimation »Promenade« einem breitschultrigen Mann durch eine völlig menschenleere, abweisende Stadtwüste. Die zur Identifikation einladende Rücken-figur schreitet zielstrebig durch verlassene Alleen, an Sicherheitszäunen und schäbigen Häuserzeilen entlang, die sich nur vage aus dem fahlen Schimmer der künstlich beleuchteten Nacht schälen. Traumwandlerisch ist sein Gang, wie ferngesteuert. Metaphernreich schneiden Sackgassen und nebelverhangene Abgründe den Weg ab, er muß umkehren. Schon bald tauchen bereits durchlaufene Räume wieder auf: Der Weg führt im Kreis. »Silent Hill« nennt sich das Computerspiel, aus dem Altenburger diesen Film entwickelt hat. Die düstere Atmosphäre evoziert noch das Grauen und die Gefahren, die dem dortigen Action-Helden hinter jeder Ecke von Monstern und Mutanten drohten. Zum Bewußtsein fehlender Orientierung tritt die Unsicherheit über den Verbleib der Bewohner (ob Menschen oder Dämonen). Ist die Stille diejenige vor oder die nach dem ›Sturm‹? Unbeirrt passiert der einsame Held Straßen, aus denen jedes Leben gewichen ist, und die wie skeptisch zugespitzte Modelle virtueller Welten, jener »im Nichts schwebenden Nebelgebilde« (Vilém Flusser), erscheinen. Die mediale Brechung im digitalen Schein verstärkt aber nur den surrealen Aspekt urbaner Un-Orte, die Altenburger bereits in seinen frühen Fotoarbeiten thematisierte. Die vorgeführten Nebenschauplätze und Rückseiten widersprechen dem gängigen Verständnis von »Promenade« als einer übersichtlichen Strecke, auf der bürgerlicher Bewegungs- und Repräsentationsdrang kanalisiert wird. Der Logik des Spiels und seiner Drastik beraubt, nähert sich die Szenerie des Videos zwar realen Erfahrungen, Altenburger behält jedoch Wiederholung und Zirkularität als charakteristische Strukturen der virtuellen Realität bei, in der Zeit nicht linear und irreversibel verläuft, sondern sich verzweigt zu baumartigen Formen von jederzeit wiederholbaren Möglichkeiten. Das darin enthaltene Potential, in der Sprache des Spiels die sukzessive Optimierung des Punkteergebnisses, kann der seiner Gegner und damit seiner Aufgabe beraubte Held allerdings nicht mehr nutzen. Während der Titel der Arbeit noch das räumlich und sozial geordnete, feiertägliche Promenieren assoziieren läßt, halten uns die Bilder ziellosen Getrieben-Seins die Orientierungslosigkeit und Sinnentleerung einer informalisierten Welt düster vor Augen. Anna und Bernhard Johannes Blume Anna Blume ist 1937 in Bork/Westfalen geboren, Bernhard Johannes Blume ist 1937 in Dortmund geboren, beide leben und arbeiten in Köln und Hamburg »Ja, ich bin in der Werbung (...) großgeworden. Da war das Auratische längst in der Reklame verwurstet – ATA, IMI und OMO mit den Strahlen, die sonst der Dreieinigkeit galten.« Wie Heilssymbole, begleitet von quasi-religiösen Versprechungen (man denke an den »segensreichen Löffel« von Sanostol), wurden Produktnamen in den 50er Jahren angepriesen. Bernhard J. Blume greift die Werbeästhetik einschließlich der damals beliebten Fraktur-schrift auf. Er tut dies aber nicht im Sinne der Pop-Art. Mit Marx im Sinn entlarvt er triviale Bildstrategien als »Religion der Warenzirkulation«. Zudem verweist die Übertragung sakraler Heilsbotschaften in die Alltagswelt aber auf ein grundlegendes Problem, das Werbung und Religion teilen: die Darstellbarkeit von Ideen und Vorstellungen, besonders von »Gott«. Der Suppenteller ist leer. In die prägnante Form der Logos bzw. Devotionalien gebracht, wird uns »Gott« als göttlich-geistige Speise präsentiert. ›Er‹ erscheint als »symbolische Leerformel«. Wie in einer Reihe anderer Arbeiten von Anna und Bernhard Blume streift die Konfrontation von Heiligem und Banalem, von Gebrauchsgeschirr und göttlicher Inspiration den Kitsch, auch das Milieu der kleinbürgerlichen Kirche, mit der B. J. Blume als Meßdiener aufgewachsen ist. Der Verlust ist dabei ebenso Thema wie das Dilemma der Kunst, die alle religiösen Bilderstürme zwar überstanden hat, in ihren Versuchen der Verbildlichung des Göttlichen allerdings nach wie vor scheitern muß. Die Darstellung schwankt zwischen ästhetischer Beschwörung und Demontage. Blume ent-auratisiert und ent-täuscht. Zugleich aber zeigt er das fortwährende Bedürfnis nach metaphysischer Vergewisserung. Bei aller parodistischen Distanzierung von der Religion wie von jenen »Künstlerpriestern« der Avantgarde, die in der abstrakten Form den Kosmos zu umschließen meinten, ist das »Faszinosum« immer noch da. In seinem Statement »Gott o Gott« entwirft Blume den Künstler »nochmal« als Zelebranten einer romantisch entgrenzten Liturgie: Es »soll in jedem Satz und jedem Bild / noch einmal Gott in einer Subjekt-Objekt-Kernverschmelzung glühen / dann sollen die Teller, Tassen, Vasen und Tabernakelbretter / nochmal als heilige Geräte dienen / (...) und soll der Küchentisch mein täglicher Altar sein / auf dem der Immerwiederneuauferstandene / erneut gegessen wird //«. In der Fotografie »Magischer Subjektivismus« erfährt Blume als Eingeweihter oder Medium Erleuchtung. Hand und Kopf – traditionelle Fokuspunkte des Künstlerporträts – berühren eine lichte Erscheinung, die den (genialen) Künstler in die Aura des Göttlichen rückt. Genau an der Stelle aber, an der das Licht am hellsten leuchtet, bleibt das Fotopapier faktisch unbelichtet: Der formale Bruch deutet auf das Transzendente als der mutmaßlichen Quelle künstlerischer Inspiration, die sich aber ironischerweise der Darstellung entzieht. Jennifer Bolande geboren 1957 in Cleveland/Ohio, lebt und arbeitet in New York Pornofilme erzählen nichts. Kein narrativer Zusammenhang verknüpft die Folge der abgefilmten Kopulationen zu einer Geschichte. Zwar gehören Übergangsszenen wie das Betreten eines Zimmers oder der neckische Schluck Champagner (oder Eierlikör) konventionellerweise zum Pornofilm, aber angesichts der direkten Zweckbindung solcher Filme sind die Zwischenszenen eigentlich »tote Zeiten« (Umberto Eco). Der italienische Stardenker erhebt die verbindungslosen Füllszenen geradezu zum Kenn-zeichen von Pornofilmen: »Wenn die Protagonisten des Films länger brauchen, um sich von A nach B zu begeben, als man es sehen möchte, dann handelt es sich um einen Pornofilm.« Für ihre Filmstills aus Pornofilmen hat Jennifer Bolande nicht etwa nur Füllsze-nen ausgewählt, sondern – noch banaler – leere Stühle, Sessel, Nachttischlampen, Konsolen, also die nebensächlichsten Requisiten in der immer nebensächlichen Kulisse des Pornofilms. Sie hat den filmischen Fortlauf erregter Bewegungen an den Stellen angehalten, an denen von Erregung nichts zu sehen ist. Ihre stillen Bilder zeigen den äußersten Rand dessen, was einen Pornofilm ausmacht: die blinden Flecken im voyeuristischen Fastfood. Einerseits machen die unbestimmt leeren Anblicke das Phänomen Porno geheimnisvoller und interessanter. Der voyeuristische Blick (der konsumiert) wird zum detektivischen (der phantasierend produziert). Im totalen Sexverzicht reauratisiert sich der Bezirk des Pornografischen paradoxerweise zum Erotischen. Andererseits stellen sich diese Filmstills als fotografische Starre dem filmisch fortlaufenden Blicksog »Porno« entgegen. Das Substrat, das Bolande aus dem stets zuviel versprechendenErregungsphan-tasma »Pornofilm« zieht – Bilder der Leere –, kann es in seiner lakonischen Härte durchaus mit der ästhetischen Gewalt von Hardcore-Szenen aufnehmen, die dem einsamen Onanisten nach geschehener Aufwallung auch nur innere Bilder der Leere hinterlassen. Bolande folgt nicht moralischen Bilderverboten, sondern sie betreibt ihren Bilder-verzicht analytisch. Wie Eco gewinnt Bolande ihren deskriptiven Zugriff auf den Pornofilm über seine Leerstellen. Von da aus eröffnen sich Fragen: Wie pornografisch ist beispielsweise der Voyeurismus, mit dem wir allabendlich Fernsehnachrichten schauen? Ist nicht alle direkte Darstellung des menschlichen Leibes (ob nun im Porno oder in der Welthungerberichterstattung) ohne die Verhüllung durch Mehrdeutigkeit pornografisch? John Cage geboren 1912 in Los Angeles, gestorben 1992 in New York John Cage war Komponist, Musiktheoretiker, Dichter und Schriftsteller, Maler und Zeichner, weltweit einer der einflußreichsten Künstler. Cage hat neue Räume der Musik erobert und ist wegweisend für die gegenwärtige Crossover- und Intermedia- Kultur. Am Black-mountain College, North Carolina, wirkten unter der Leitung von Josef Albers neben John Cage der Dichter Charles Olson, der Maler Robert Rauschenberg, der Tänzer und Choreograf Merce Cunningham. Es ist der Kreis, dem die Musikgeschichte »4´33´´«, das wohl radikalste Musikstück verdankt, am 29. August 1952 in Wood-stock, New York, uraufgeführt. »Bei dieser Aufführung – die Dauer der Einzelsätze war 33´´, 2´40´´ und 1´20´´ – habe Tudor zu Beginn jedes Satzes die Klappe über den Klaviertasten geschlossen und nach Verstreichen der Dauer jeweils wieder aufgehoben« (Herbert Henck). Die Länge der Sätze wurde durch Zufallsoperationen mit dem chinesischen I Ging festgelegt. Gemessen an der traditionellen Vorstellung von Musik als eines durch Töne und Rhythmus sich entwickelnden Klanggebildes, wird »Silence«, die Stille, das sonst nicht Gehörte, gleichwohl akustisch Gegenwärtige und zugleich Abwesende bzw. künstlerisch nicht Kontrol-lierte ins Bewußtsein gerückt, denn: »Ich habe nichts zu sagen und ich sage es und das ist die Poesie, die ich brauche. Dieser Raum der Zeit ist geordnet. Wir müssen diese Stille nicht fürchten – wir mögen sie lieben« (John Cage, 1961). »4´33´´« steht – musikhistorisch gesehen – so den radikalen Setzungen Marcel Duchamps oder Kasimir Malewitschs nahe. Die Eliminierung von Hierarchien, das Zulassen von akustischen Ereignissen des Alltäg-lichen jenseits künstlerischer Kontrolle stellt den abendländischen Werkbegriff der Komposition in Frage, der bei Cage durch Beschäftigung mit dem Zen-Buddhismus vom Nichts als umfassender Ganzheit ausgeht. »Dieses Spiel bedeutet die Bejahung des Lebens wie auch immer – weder den Versuch, Ordnung aus dem Chaos hervorzubringen, noch die Schöpfung zu verbessern, sondern einfach ein Weg, sich dem Leben, das wir leben, zu öffnen, das so vortrefflich ist, wenn man erst einmal sein Bewußtsein und seine Wünsche aus dem Weg geräumt hat und es sich aus sich selbst heraus entfalten läßt.« (John Cage, 1961) Hanne Darboven geboren 1941 in München, lebt und arbeitet in Hamburg Nach der Art eines Tagebuchs füllte Hanne Darboven für jeden Tag des Jahres 1984 ein Blatt Millimeterpapier in ihrem charakteristischen Schriftduktus. Die Höhe der vorgegebenen Zeilen vermindert sich von unten nach oben zweimal schrittweise und die Schreiblinien formieren sich zu Gefügen, die Horizont und Landschaft assoziieren lassen: den täglichen Rhythmus von Sonnenauf- und -untergang. Hinter den Auf- und Abschwüngen dieser ›konkreten‹ Schrift verbirgt sich keine außerbildliche Bedeutungsebene. Die aus Ziffern und Worten bestehenden Legenden wiederum, welche die Schrift-Bilder systematisch nach Monat, Jahr und Tag durchnummerieren, sind Teil der ›Bild‹-Gestaltung. Darboven zerlegt den Zeitablauf eines Jahres zahlenmäßig und fixiert ihn. Sie läßt ihn durch die räumliche Präsentation als ›permanente Gegenwart‹ erscheinen. In der Serialität aber verliert sich das im Titel angedeutete Besondere. Die Erwartung eines subjektiven Zeugnisses, durch die äußere Struktur des biografischen Dokuments geweckt, wird enttäuscht. Nichts verrät das Aufgeschriebene darüber, wie New York während zweier erlebnisreicher Jahre der jungen Künstlerin zur »zweiten Heimat« wurde. Die motorisch-gestisch wiederholten Lineaturen aber entleeren die Aufzeich-nung von jeglichem persönlichen Inhalt. In ihrer weitreichenden Verweigerung, sich konventionell mitzuteilen, demonstriert Darboven die Relativität von Raum- und Zeiterfahrung, die sich eindeutiger Festlegung entziehen. Wenn in die schriftlich ausgebreitete und doch verschlossene Gegenwart auf dem jeweils achten Blatt einer Woche, das mit »heute« bezeichnet ist, bunte Postkarten-Bilder eines vergangenen New York hereinbrechen, unterstreicht das einerseits diese Komplexität der Wahrnehmung. In ihr durchdringen sich verschiedene Räume, Erzählzeit und erzählte Zeit, und können nur unzulänglich dargestellt werden. Andererseits vollziehen die Arbeiten in ihrer inneren Struktur gesellschaftliche Umwälzungen nach, in deren Folge wir die intakte Welt der alten Postkarten als historischen Verlustraum betrachten. Die Bemühungen, in Darbovens hermetisches Darstellungssystem vorzudringen, führen zu der gleichen Erkenntnis wie die Versuche zur Entschlüsselung der DNA: Eine einfache »Lesbarkeit der Welt« (Blumenberg) ist nicht mehr gegeben. Wie Massenproduktion und kultur haben Darbovens ständige Wiederholungen die Konsequenz, daß das Einzelne und Einzigartige entwertet wird und verschwindet. Walter de Maria geboren 1935 in Albany/Kalifornien, lebt in New York Das Werk von Walter de Maria ist nur unzureichend mit »Minimal Art« oder »Land Art« beschrieben. Mit spektakulären Realisationen wie dem »Vertikalen Erdkilometer« (1977) zur Documenta in Kassel, dem »Lightning Field« (1977) in der Wüste in New Mexiko, der »5 Kontinente Skulptur« (1987–89) und der »The 2000 Sculpture« (1992) schreibt de Maria in weiträumigen Land-schaftsprojekten und aufwendigen Museumsinszenierungen der Kunst den Anspruch auf transzendente Universa-lität zu. Elementares als Zahlenverhältnis und geometrische Form, als Sprache und Gegenstand, als bloßes Material faßt de Maria als wichtige Dimensionen der menschlichen Aneignung von Realität auf und stellt diese der Landschaft, der Erde, der Welt, dem Kosmos, dem Unendlichen, dem nicht Faßbaren entgegen. Programmatisch fordert er 1960 »Werke ohne Bedeutung« ein: »Das ästhetische Empfinden durch Werke ohne Bedeutung kann nicht genau beschrieben werden, weil es mit jedem Individuum variiert, das diese Werke ausführt. Bedeutungslose Werke sind ehrlich. (...) Es kann dich veranlassen, dich selbst zu fühlen oder über dich selbst nachzudenken, über die äußere Welt, über Moral, Realität, Unterbewußtsein, Natur, Geschichte, Zeit, Philosophie, über überhaupt nichts, über Politik, etc. ohne die Begrenztheit traditioneller Kunstformen« (de Maria 1960). »Invisible Drawings« (1963) sind Zeichnungen in repräsentativem Format, frühe materielle Manifestationen einer Kunstauffassung, die sich literarischen Bedeutungen verweigert. Durchaus dicht an der Grenze zur Sichtbarkeit und zart angelegt, sind sie Setzungen, die Assoziationen provozieren, ohne auf eindeutige Interpretationen aus zu sein. Die kargen Mittel stehen im Gegensatz zu dem programmatischen Schwergewicht. »Word« verweist auf die elementare, in begrenzter Eindeutigkeit nur menschlich mögliche Verständigung durch Sprache und Schrift. Mit »I hate Paul Klee« erteilt de Maria jenem Maler und Zeichner eine Absage, dessen Kunst-Lehre den Elementen der Zeichenkunst universale Bedeutung in den europäischen literarisch-humanistischen Traditionen zugewiesen hat. De Maria scheint so einen Nullpunkt zu umkreisen, von dem aus eine betont asketische Ästhetik seit 1960 ihren Siegeszug durch die Kunstwelt angetreten hat, um eine grenzenlose und zeitlose Kunstsprache einzufordern, die mittlerweile ihren historischen Ort und damit ihre begrenzte Bedeutung hat. Paul Delvaux geboren 1897 in Antheit, gestorben 1994 in Furnes Seit der Tod nicht mehr als bloße »Verwandlung« in der Erwartung einer kollektiven Auferstehung angesehen, sondern zunehmend individualisiert wurde, verschärfte sich seine Dramatik: »Der Tod als Tod des Subjekts wird doppelt dramatisch: Er mündet ins Nichts, ins Sinnentleerte; vor allem aber vernichtet er das Ich« (LouisVincent Thomas). In unzähligen, mehr oder weniger religiös motivierten Bildern führte das memento mori der Totenschädel und Sensenmänner dem Betrachter die eigene Vergänglichkeit vor Augen. Allein Christus soll sich ihr entzogen und in der Überwindung des Todes den Menschen Rettung gebracht haben. Als Paul Delvaux dieses zentrale Heilsgeschehen allein mit Skeletten als Bildpersonal darstellte, war der Skandal vorprogrammiert. Die auf der Biennale 1954 in Venedig vorgestellte »Kreuzigung« verurteilte Monseigneur Roncali, der spätere Papst Johannes XXIII und damalige Patriarch von Venedig, als Blasphemie. Er verbot dem italienischen Klerus den Besuch der Ausstellung. Zu seiner Rechtfertigung führte Delvaux eine rein ästhetische Motivation für sein Vorgehen an: »Ich wollte dieses gewaltige Menschheitsdrama zum Ausdruck bringen, das für mich eindringlicher mit Skelet-ten dargestellt werden konnte.« Nur indem er die Darstellungs- und Rezeptionsgewohnheiten religiöser Kunst durchbrach, hätte er »mit einem Schlag‹ etwas ›andres‹ erreichen« können, »etwas Dramatisches, etwas Lebendiges!« (Paul Delvaux, 1973) Skelette spielten bereits in Delvaux’ surreal geprägten Bildwelten der 1940er Jahre eine entscheidende Rolle. Ausgangspunkt der langjährigen Faszination war wohl ein Besuch des Brüsseler Jahrmarkts 1932 gewesen, »wo mich die außergewöhnliche Bude des Musée Spitzner in ihren Bann geschlagen hatte, roter Samt in den Fenstern, zwei Skelette und eine eingeschlafene, mechanische Venus in Pappmaché.« Gerippe skizzierte der Belgier dann häufig in den naturkundlichen Museen, sie bevölkern seine gemalten Interieurs, agieren in Bibliotheken und Büros wie auch im öffetlichen Raum. Immer wieder halten sie als lebende Tote den im Leben wohnenden Tod vor Augen. In dieser Hinsicht scheinen die Skelette wie prädestiniert als Staf-fage der Passion Christi, der nach biblischem Verständnis geboren worden ist um zu sterben. In Kreuzigung und Grablegung würde Delvaux einer möglichen Lesart zufolge Jesus als Skelett unter Skeletten zeigen, als sterblichen Menschen im Kreise derer, die in ihrem Mitleid wiederum den eigenen Tod vorwegnehmen. Die Irritation der Sehgewohnheiten könnte im Sinne des obigen Kommentars zu einer tieferen Ein-sicht führen. Eine Ambivalenz aber bleibt bestehen und wird noch durch die anachronistische nächtliche Kulisse verstärkt. Straßenlaternen und Strommasten rahmen ein traumhaftes Mysterienspiel, bei dessen makabermanieristischer Inszenierung unklar bleibt, ob die heftig gestikulierenden Akteure um das reglose Gerippe in ihrer Mitte, das sie zu Grabe gebracht haben, wirklich trauern. Thomas Demand geboren 1964 in München, lebt und arbeitet in Berlin Die Fotografie zeigt einen von einem Geländer umgebenen Treppenschacht, wie er in einer Behörde oder Schule oder einem anderen im Stil der 50er Jahre errichteten Funktionsbau auf das oberste, selten benutzte Stockwerk münden könnte. Die atmosphärische Kühle wird verstärkt durch die menschenleere Bodenfläche um den Treppenschacht herum. Die gegenständliche und fotografische Präzision zieht unseren Blick sofort in das Bild, ohne daß sich dieser in eine entschlüsselbare Szene auflösen ließe. Haben wir es mitten in der Banalität des Alltags mit etwas Abgründigem, mit einem Eingang in eine Unterwelt zu tun? Auf den zweiten Blick allerdings wirkt am abgründigsten, daß der schwarze Schatten unter der Treppe nicht aus dunkler Hohl-heit besteht, sondern schwarzfarbene Oberfläche ist. Thomas Demand fotografiert Skulpturen aus Pappe und Papier. Meist wählt er in seinem Berliner Atelier zuerst für seine Kamera einen festen Punkt, um für die Per-spektive der Kamera Zimmer- oder Architektur-anblicke im Maßstab 1:1 aufzubauen. Fotografie nimmt hier nicht dokumentarisch Tatsäch-liches auf, sondern – umgekehrt – die Kamera entwirft wie ein Projektor den Anschein von tatsächlicher Architektur vor ihrem künstlichen Auge. Indem zwei Kunstformen – Skulptur und Foto-grafie – zu perfekter Abbildhaftigkeit getrieben werden, stören sie sich gegenseitig auf geradezu allergische Weise. Das gestochen scharfe Foto desillusioniert die Kulissenhaftigkeit der Eisengitter und Bodenbeläge aus Papier. Die vollkommene mimetische Anschmiegung der Skulptur an alltäglich Sichtbares wiederum unterläuft den konventionellen Daseinszweck von Fotografie, sichtbare Realität verläßlich zu dokumentieren. Im Zusammenspiel von perfekt dokumentierender Skulptur und phantasierend entwerfender Fotografie erweist sich die Stofflichkeit der Bildgegenstände nicht etwa als letzter Anhaltspunkt für Tatsächlich-keit, sondern als ihr größter Saboteur. Die haarfeine Verfehlung der Rückübersetzung der Übersetzung (vom Foto in die Papierskulptur; vom Alltagsanblick in die Fotografie) führt unseren Blick an einen Nicht-Ort, eine Utopie ohne Idealität. Zirkulär und labyrinthisch bezieht sich die eine Übersetzung auf die andere Übersetzung, womit Demand sehr bewußt die schleichende atmosphärische Entleerung, die suggestive Vertotung inszenatorisch zustande bringt. Das Moment des Filmischen, Tatorthaften, Kriminalistischen macht Demands fotografierte Papierskulpturen jedoch nicht zu Kulissen. Vielmehr sind sie Attrappen, in denen sich unser Blick verfängt wie ein Tier in der Falle. Stefan Demary geb0ren 1958 in Troisdorf, lebt und arbeitet in Düsseldorf Stefan Demarys Veränderungen an Alltagsgegenständen zielen darauf, standardisierte Wahrnehmungsabläu-fe zu unterbrechen. Über eine – in der handwerklichen Ausführung geradezu liebevoll – umgearbeitete Spielzeuggiraffe sagt er: »Das typischste Merkmal einer Giraffe ist der lange Hals. Also habe ich den abgeschnitten.« Die Kürzung des Halses hat Demary nicht als wilde Geste, als symbolträchtige Verletzung vorgenommen, sondern die Schnittstelle säuberlich zugenäht. Erst die neue amputierte Ganzheit vermag gewohnheitsmäßige Assoziations-ketten verläßlich zu unterbrechen. Nicht einer Giraffe, sondern einem denkfaulen Klischee, verdichtet im vorgeblich harmlosen Spielzeug, gilt Demarys Eingriff. Immer geht es ihm um das, was alles nicht ist, was als Weg oder Möglichkeit von unseren Alltagsvereinfachungen systematisch ausgeschlossen wird, weil es die Funktionalität einer Alltagsbewältigung stört. Also stört Stefan Demary – im Interesse einer genaueren Wahrnehmung – konsequent zurück. Nachdem Stefan Demary 1990 eine perfekte Replik einer antiken Jünglingsstatue hatte anfertigen lassen, goß er sie bis auf Kopf und Fuß vollständig in einen Gips-block ein. Paradoxerweise verlebendigt die Blickbehinderung die im Gipsmaterial versteckte Figur für die ergänzende Vorstellungskraft. Die entfernte Antike, das bildungsbürgerliche Zentralklischee von touristischer Verfügbarkeit und Anschaulich-keit, öffnet sich erst durch die optische Verweigerung wieder für die Betrachtung. Sehen und Betrachten treten auseinander. Nur der verletzte Blick ist ein reflektierender, intelligent gewordener Blick. Fast mutwillig unintelligent wirken dagegen Demarys Übermalungen der schwarzen Linien eines Malbuches, wie es Kindern zum farbigen Ausfüllen der Binnenflä-chen gegeben wird. Daß die weiße Tippex-Masse nicht die Felder ausfüllt, sondern das Linienraster auslöscht, kann als praktizierter Sekretärinnenwitz oder als Sabotage einer erzieherischen Zumutung verstanden werden. Die scheinblöde Beharrlich-keit, mit der Demary die Aufforderung zum Ausmalen befolgt, gibt beidem nicht recht: weder der Kinderwelt der Malbücher (durch die Erwachsene Kindern Beharrlichkeit und manuelles Geschick beizubringen glauben), noch der Tippex-Welt »Büro« (in dem mitunter real beharrliche Blödheit herrscht). Nebenbei verlängert Demarys offensiv infantiler Kunstverzicht die avantgardistische Tradition weißer Bilder. Daß damit wiederum den Heroen der Avantgarde recht gegeben würde, darf bezweifelt werden. Marcel Duchamp geboren 1887 in Blainville, gestorben 1968 in Paris »Ich liebe die Risse, die Art, wie sie verlaufen, die Sprünge (...) In den Sprüngen steckt eine Symmetrie, beide Sprünge sind symmetrisch angeordnet und darin liegt mehr (...) fast eine Absicht, für die ich nicht verantwortlich bin, mit anderen Worten eine ready-made-Absicht, die ich respektiere und liebe.« Marcel Duchamps Hauptwerk, das »Große Glas«, wird zuletzt vervollkommnet durch den Zufall, bei einem Transport wird es beschädigt. Mit der Forderung nach der Abkehr vom rein Retinalen und der Aufgabe aller Gegenständlichkeit betreibt sein Werk das radikale Ende aller Malerei. An diesen Punkt gebracht, wandelt sich die Substanz des Kunstwerkes zum Konzept. Duchamp hatte 1915 in New York mit der Realisierung seines »Großen Glases« begonnen und 1923 definitiv beschlossen, es unvollendet zu belassen. Eine Fotografie Man Rays dokumentiert den noch unzerstörten Zustand während seiner ersten öffentlichen Ausstellung in der »International Exhibition of Modern Art« 1926/27 in New York. Nach der Beschädigung ergänzt Duchamp 1934 das Werk durch die »Grüne Schachtel«, die in Faksimiles der Skizzen und Konzepte dessen intellektuellen Zusammenhang konserviert. Den klassischen Topos des Bildes als Fenster zur Welt ironisiert Duchamp durch das populäre Motiv des Schaufensters. In dessen transparenter Fläche wird die Ebene zur räumlichen Perspektive und gleichzeitig das abgebildete Objekt zur Fiktion – jegliche Illusion betreibt immer bereits ihre eigene Desillusion. Entsprechend bleibt auch der Titel ein unlösbares Puzzle. Die sexuellen Anspielungen auf existentielle menschliche Erfahrungen wandelt Duchamp zum intellektuellen Spiel. Seine »Liebesmaschine« bleibt unauflösliches Begehren, denn das Begehren ist Motor und Ziel des Begehrens selbst und gefriert damit im Stillstand. Der Beschreibung des Unbeschreibbaren widmet sich Duchamps Wortschöpfung »inframince«. »Inframince« ist das Geräusch, das eine Samthose beim Gehen macht, wenn ihre beiden Beine aneinanderreiben, »wenn der Tabakrauch auch nach dem Mund riecht, von dem er kommt, heiraten die zwei Gerüche durch den inframince«, aber auch das »Malen auf Glas gesehen von der unbemalten Seite ist inframince«. Inframince ist das »Mögliche, das das Werdende einschließt – der Übergang vom einen in das andere findet im inframince statt«. Lucio Fontana geboren 1899 in Rosario di Santa Fé, gestorben 1968 in Varese Lucio Fontana widmet sein Werk der Erweiterung des Kunstbegriffs – auch auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Dimensionen. Im »Spacialismo«, einer neuen Raum-Zeit-bezogenen Kunst, antwortet er auf Kubismus und Futurismus. »Ambiente spaziale« (1949) repräsentiert eine künstlerische Konzeption einer Zu-kunft, »die auf der Entwicklung der künstlerischen Mittel, auf Licht, Neon, Television und Radar beruht« (Fontana, nach 1949). Um 1958 vollzieht er in den »Concetti spaciali« die eigentliche revolutionäre Geste seiner Malerei. Durch Schnitt bzw. Stoß wird die über Jahrhunderte sakrosankte Fläche des Bildes unkorrigierbar und unwiederruflich geöffnet, ausgeführt in einer durch Meditation vorbereiteten Bewegung. Sinnlich faßbar wird so das Dahinter. Das tatsächlich Vorhandene, greifbare wie ungreifbare Reale wird mit in das Bild einbezogen. Der sinnlich-haptischen Qualität der Farbe wird unendliche, wenn auch illusionistische Tiefe – die Schnitte sind zumeist mit dunkler Gaze hinterlegt – einbeschrieben. Malerei und Skulptur werden in einen Ort überführt, der einem durch Dynamik und Geschwindigkeit geprägten Lebensgefühl entsprach. »Die unbeweglichen Bilder von früher befriedigen nicht mehr die Wünsche des neuen Menschen, der geformt wird vom Aktionsdrang und vom Zusammenleben mit der Mechanik, was eine beständige Dynamik erfordert. (...) Indem wir uns berufen auf diesen Wandel, der sich in der Natur des Menschen vollzogen hat, und auf die geistigen und moralischen Veränderungen in allen menschlichen Beziehungen und Tätigkeiten, verzichten wir auf den Gebrauch bekannter Kunstformen und beginnen die Entwicklung einer Kunst, die aus der Einheit von Zeit und Raum beruht« (Fontana, 1946). Damit wird der Unbestimmtheit des Bildes als Konkretum an der Wand eine neue realräumliche Dimension zugewiesen. »Ich habe Löcher gemacht, um etwas anderes zu finden (...) ich entfliehe im symbolischen, aber auch im materiellen Sinne der glatten Oberfläche (...) Das Loch ist freier Raum« (Fontana, 1968). In der Aura des Momentanen wird ein Geheimnis sichtbar, das einer »Theologie nach dem Tod Gottes«, nach dem Ende des Kosmos nahe kommt, das »Unendlichkeit bedeutet, das Unfaßbare, das Ende der Darstellung, den Beginn des Nichts« (Fontana, nach 1960). Katharina Fritsch geboren 1956 in Essen, lebt und arbeitet in Düsseldorf Der eigentliche Augenblick, in dem Kunst stattfindet, liegt in einer vorbegrifflichen Erfahrung, in einer Art des Sprachlos-Seins. Es ist der »Moment, in dem ich den Dingen unverstellt begegne, erschrecke, staune, den Sog eines Raumes empfinde, einer Leere begegne …« 1984 entsteht Katharina Fritschs erste Arbeit, in der es kein physisches Objekt im eigentlichen Sinne mehr gibt. Das Kunstwerk »Parfüm im Hausflur« besteht darin, daß die Künstlerin Parfüm in einem Treppenhaus versprüht. Auch wenn die Arbeit immer noch physisch ist, ihr Material ist optisch nicht mehr wahrnehmbar – so entspricht das Werk eher einer flüchtigen Erscheinung, als einem traditionellen Werk-begriff. Der Auslöser der Arbeit »Parfüm im Hausflur« ist die Erinnerung an eine biografische Erfahrung aus der Kindheit der Künstlerin. Immer wenn eine bestimmte Nachbarin im Haus ihrer Großeltern anwesend war, dann war dies bereits an ihrem Duft, den sie als Spur zurückließ, zu ahnen. Von ihrer Mutter erfuhr Fritsch, daß das Parfüm jener Dame »Je reviens« hieß. Umso erstaunlicher, denn bereits der Name spiegelte den Effekt jener geheimnisvollen Verschmelzung aus Erfahrung und Erinnerung, die seine eigene Wirkung kennzeichnet. Der Duft verweist mit seinem Versprechen stets auf ein Objekt, dessen Ankunft oder Rückkehr er verspricht. Fritsch sucht »Momente, die man nicht erklären kann, die man aber erleben kann, wenn man sich ganz unverstellt und möglichst ohne viele Vorgedanken« darauf einläßt. Die irritierende Atmosphäre, die durch ihre Objekte und Installationen entsteht, produziert eine Intimität, die den Betrachter zwangsläufig vereinnahmt. Außerhalb begrifflichen Vorwissens auf einen Zustand nicht vorgefertigter Bilder zu stoßen und mit großer Präzision Unmittelbarkeit herzustellen, ist Ziel des Werkes, das ebenso rational wie psychologisch ist. »Parfüm im Hausflur« ist aber auch eine Metapher des eigenen Begehrens an die Kunst. Was immer man aufgrund der Spur des Duftes erwarten mag oder zu begehren beginnt, man wird es nicht finden, denn die Kunst hat ihre institutionalisierte Hülle entweder verlassen und den Ort gewechselt, oder sie existiert nicht mehr. Wie die Arbeit »Museum, Modell 1:10« (1995 im Deutschen Pavillon in Venedig) thematisiert »Parfüm im Hausflur« die Beziehung zwischen Künstler und Publikum, zwischen Kunst und der Institution des Museums – allerdings auf eigene, kaum merkliche Weise. Isa Genzken geboren 1948 in Bad Oldesloe, lebt und arbeitet in Köln Leone Battista Alberti erklärte das Bild in seinem Malereitraktat von 1435 als »fenestra aperta«, als Fenster, das die Kunst mittels der perspektivischen Konstruk-tion auf die sichtbare Welt öffnet. Den damit implizierten, strengen Abbildungs-charakter hat die Kunst allerdings nach dem Ikonoklasmus der Fotografie und der folgenden, kompletten Desillusion durch die zwei Avantgarden des 20. Jahrhunderts eingebüßt. Mit ihren Fenster-Plastiken verweist Isa Genzken auf diese Vertreibung mimetisch dargestellter Inhalte aus der Kunst. Anstatt des geschlossenen Volumens traditioneller Bildhauerarbeiten verwendet Genzken die offene Form, deren Zentrum leer ist. Was bleibt, ist zunächst der bloße Rahmen, also eine äußere Voraussetzung dafür, etwas zu sehen. Das Kunst-Fenster hört auf, eindeutig definierte Grenze zwischen einem Hier und einem tiefenillusorisch gezeigten Dort zu sein, in das sich der Betrachter hineinträumen kann. Wenn auch Allusionen an alltägliche Erfahrungen von Architektur – das Fenster als optische Membran – die Arbeit begleiten, ist doch die Trennung zwischen Betrachterstandpunkt und Illusionsraum aufgehoben. An dessen Stelle tritt in Genzkens transparenter Konstruktion das reale Umfeld des Museumsraums. Die inszenierte Leerstelle regt zweierlei an: Reflexionen über den Ausstellungsraum als Ort, an dem der Künstler mit seinem Werk und sein Publikum aufeinandertreffen, darüber hinaus aber auch die Frage nach und das Spiel mit dem eigenen Standpunkt. Als Leitspruch für eine Ausstellung 1993 formulierte die Künstlerin: »Jeder braucht mindestens ein Fenster«. Transparenz und Grenzüberschreitung sind auch Themen der Röntgenbild-Fotografien, die Isa Genzken selbst zeigen. Die nach dem englischen Begriff für die aggressive Bildtechnik genannten »X-Rays« gewähren Einblicke in das Innere des Körpers. Auch unter die Oberfläche schauen zu können, zeichnete immer schon den Porträtisten aus. Angesichts der nackten Knochen aber fühlen wir uns schmerzlich an unseren sterblichen Leib erinnert, der sich sonst nur als kranker der Durchdringung des Röntgengeräts aussetzt. In der makabren Tradition des memento mori stößt die Künstlerin auf den Tod an, der mitten im Leben steht, und nimmt ihr eigenes Ende vorweg. Sabine Groß geboren 1961 in Ulm, lebt und arbeitet in Berlin »Wenn sie zu bestimmen hätten, würden alle Polizisten gerasterte Uniformen tragen, würden sie den Bundesadler durch Raster ersetzen. Jeder hätte gepunktete Taschentücher.« So Sigmar Polke und Gerhard Richter in einer Textcollage von 1966. Anders als deren Idee der »Überblendung der ›Wirklichkeit‹ durch ein flächendeckendes, die Leere umschreibendes Ornament, das sich – je nach Couleur – unterschiedlich deuten läßt ...« (Karin Stempel) drängt Sabine Groß ihren menschlichen Untersuchungsobjekten nicht eine neue Ordnung auf, sondern entdeckt Ordnung im bereits Bestehenden. In ihrem Projekt »Grammatik, Vol. 1« von 1997 wird die Künstlerin zur Außerirdischen, die in Unkenntnis des Systems an zufälligen Struk-turen eine logische Ordnung entwickelt. Bereits in den 70er Jahren hatten sich Künstler, vor dem Hintergrund der Sprachspiel-Theorie Wittgensteins, mit dem Phänomen beschäftigt, daß auch außersprachliche Mittel nach Sprachstrukturen organisiert sind. Groß verfährt ironischer und subversiver, indem sie in »Grammatik, Vol. 1« die willkürliche Modeerscheinung von Kleidungsstücken aus kariertem Stoff durch ein von ihr entwickeltes Dekodierungssystem in Sprache »übersetzt«. In mehreren Forschungsschritten demonstriert sie die vollständige Entwicklung eines Systems, das einer immanenten Logik folgt. Bisher geheime Sprachstrukturen deckt sie in ihrer Analyse als vermeintliche Information in Karo-mustern auf. Aus dem Gefüge unterschiedlicher Farb- und Musterqualitäten entstehen per Computer Sätze, die mal mehr, mal weniger Sinn ergeben und als verschlüsselte Parolen ihren Trägern anhaften. Das ironische Spiel produziert mit ausgefeilter Methode zufällig Sinn und relativiert damit die gewohnte Bedeutung von Ordnungs-strukturen. Die scheinbar unsinnigen Forschungen von Groß irritieren auch in anderen ihrer Arbeiten die gewohnten Wahrnehmungsmuster. Ihr Projekt »Fünf Handbücher«, das 1994/95 in den Hauptbahnhöfen von München und Frankfurt realisiert wurde, betreibt die Subversion technoider Visionen des Menschen. Die fünf Leuchtkästen aus Aluminium gleichen den Monitoren mit Fahrplananzeigen auf Bahnhöfen. Auf ihren Informationstafeln strahlen dem Betrachter die schematischen Gliederungen komplexer Abläufe entgegen: »Raumkonstruktor«, »Emotionsmanager«, »Wirklich-keitsprozessor« sind deren Titel. Individuelle Wahrnehmung, Empfinden, Denken und Handeln scheinen verknappt auf modellhaft gegliederte Ablaufschemata. Bevor man noch die Autorität dieser Schemata in Frage stellt, versucht man sich verwirrt in das befremdliche Modell einzudenken. Die humorvolle Kategorisierung von Wahrneh-mung und Welt und ihre Frage danach, ob es eine den Dingen immanente Ordnung gibt, stößt letztlich immer an die Frage nach der sinnstiftenden Instanz – sollte sich keine finden, bleibt nur die Illusion der Verabredung im leeren Raum. Georg Herold geboren 1947 in Jena, lebt und arbeitet in Köln Eine kosmologisch dunkle Fläche – »ohne Titel« – schaut uns an. Erhaben scheint sie Respekt einzufordern: eine Leinwand so groß, als wäre sie von Barnett Newman, so schwarz wie von Ad Reinhardt. Aber was machen die gehäkelten Topflappen am oberen Bildrand und der rechten Seite? Knüpft das Werk etwa an die altehrwürdige Tafelbildtradition der »Fenestra aperta« an und die Lappen sind eine Gardinenbordüre am Küchenfenster von Georg Herolds Mutter? Ist die Küche ein Kosmos? »Wenn es eine Pfannkuchentheorie gibt, muß es auch eine Topflappentheorie geben«, sagt Georg Herold . Ist nicht jede einigermaßen umfängliche Theorie (gar die über den Zusammenhalt von Materie im Weltall) irgendwie zusammengestrickt? Auf jeden Fall hängt in einem Topflappen alles mit allem zusammen. Ähnlich kosmologische Grundweisheiten lassen sich auch auf die schwarze Masse auf der Leinwand anwenden: unraffiniertes Erdöl. »Zum Malen ist es fast brauchbar – bis auf den Umstand, daß es nicht trocken zu kriegen ist« (Herold). Insofern gilt: panta rhei – alles fließt (und tropft auf den Boden). »Das dicke Licht« verstößt gegen die Malerübereinkunft, daß Licht nur mittelbar im Widerstrahl, als Auswirkung auf farbige Flächen darstellbar sei. Laut Titel zeigt uns der Balkenblock an der Wand einigermaßen kurz und bündig (0,40 x 1,60 x 0,20 m), was der gesamte Impressionismus stets indirekt thematisierte: das Licht selber. Die Vorstellung, daß Licht nicht nur eine bestimmte Wellenlänge habe, sondern eine bestimmte Länge (1,60 m), sei ihm hilfreich erschienen, so Herold, schon um ästhetische Sprechgewohnhei-ten und Interpretationsstandards auszuhebeln (wozu Balken immer taugen). Auf vertrackte Weise verteidigt Herold letztlich das Bildtabu direkter Darstellbarkeit gegen diskursive Ausdeutungsinflationen. Nach wie vor geht das, worum es in der Kunst geht, nicht in Text auf. Das ist der Nicht-Bereich, in dem Herold arbeitet. Unraffiniertes Erdöl ist ihm lieber als raffinierte Erkärungen, jeder Kalauer ein willkommenes und ernsthaftes Hilfsmittel, um Künstler/Interpreten-Übereinkünfte zu kündigen. »Mit der Erklärung verschwindet die Poesie«, zitiert eine Kunstkritikerin Georg Herold in der Einleitung einer längeren Erklärung seines Werkes. Für allzu kongeniale, einverstandene Interpretationen seiner Kunst hält Herolds umfängliches Werk u.a. eine beschriftete Dachlatte bereit, die immerhin in der Formel noch erhaben klingt: »Gemeinsam sind wir Arschlöcher (Nebenlatte)« (1984). Dieter Kiessling geboren 1957 in Münster, lebt und arbeitet in Düsseldorf und Karlsruhe Zwei Videokameras stehen sich in einer closed circuit Situation gegenüber und beobachten sich gegenseitig beim Beobachten: Die Kamera filmt die Kamera filmt die Kamera … Ihre Bilder werden unmittelbar auf zwei Monitore übertragen, die das face-to-face der Objektive flankieren. Das Handicap: In dieser Versuchsanord-nung von Dieter Kiessling stehen sich beide Kameras zu nahe. Ihr Autofocus kann kein scharfes Bild vom Gegenüber herstellen. Begleitet vom Geräusch der sich permanent einstellenden Objektive, versucht die Elektronik vergeblich ihr Bild zu gewinnen. In unregelmäßiger Choreografie zeigen sich ihre veränderlichen, aber immer unscharfen Bilder mal größer mal kleiner gezoomt auf den beiden Monitoren. Der surrende Ton der Autofocussysteme, der über die Lautsprecher der Monitore verstärkt wird, erhöht die unangenehme Wirkung der Installation, in die der Betrachter als Zeuge des permanenten Scheiterns des Bildmediums bei der Produk-tion seines Bildes sieht. In Dieter Kiesslings Arbeiten »gerät etwas in den Blick, das oft als unsichtbar beschrieben wird«, so Carina Plath. Sie überwinden die übliche Unsichtbarkeit technologischer Medien. Seine künstlerischen Untersuchungen entwickeln spezifische Situationen, die sich auf deren jeweilige hoch-technologische Bedingungen konzentrieren. Das aktuelle Bild einer absoluten Identität zwischen Abbildungsmedium und Abgebildetem vereitelt Kiessling in »Two Cameras«, indem er eine Situation doppelter Exklusivität schafft. Der Betrachter blickt auf eine in sich geschlossene Situation, die ihn ausschließt und ihn darüberhinaus kein Bild mehr von der Situation innerhalb gewinnen läßt. Ungewöhnlich für Kiesslings Œuvre ist die akustische Ebene in »Two Cameras«. Das geschäftige Surren des Autofocus verleiht beiden Kameras den Charakter von insektenhaften Wesen, deren Verhalten fremd bleibt, denn es gibt kein erkennbares System, nach dem beide Objekte miteinander verhandeln. Das technoide Anschauungsmodell läßt sich aber auch als Metapher für die Grundprinzipien der Wahrnehmung lesen: Wahrnehmung des Anderen ist nur möglich, wenn die Bedingungen seines Wahrnehmungsapparates grundsätzlich erfüllt werden. Der Imperativ: ›Du sollst dir kein Bild machen‹ wird zum Fakt: ›Du kannst Dir gar kein Bild machen‹. Martin Kippenberger geboren 1953 in Dortmund, gestorben 1997 in Wien Die Bilderberge der Kunstgeschichte scheint Martin Kippenberger manchmal als Schrotthaufen (oder Steinbruch) aufgefaßt zu haben. Einerseits konnte man sich ihrer ohne unnötigen Respekt bedienen (insbesondere, wenn man die instrumentellen Vermarktungsvorteile von avantgardistischem Pathos und künstlerischem Welt-schmerz eher komisch nahm), andererseits fand man auch immer etwas Interessan-tes. Kippenberger begab sich in die ebenso lebensgierige wie theatralisch todgeweihte Pose von Otto Dix (»ohne Titel«, 1988), zog in einer Serie wenig schmeichelhafter Selbstportraits Picassos Unterhosen an (nach dem berühmten Foto des Malerheroen) oder verarbeitete ein graues abstraktes Bild von Gerhard Richter (das einer Schieferplatte ähnelt) zum Beistelltisch »Modell Interconti«. Auch wenn Kippenberger selbst diese Anknüpfungen eher abfällig kommentierte (»Abklatsch verhilft einem zur Größe, wenn man die Regeln des Vergessens kennt«, 1987), begann sein Verfahren der Aneignung neuen Sinn zu provozieren. War die Künstlerheldenpose erst einmal als Hohlform desillusioniert, so wurde sie gewissermaßen zu einer reinen Form ohne Inhalt – und ließ sich neu füllen. Kippenbergers Bilder nach dem »Floß der Medusa« von Théodore Géricault Mitte der 1990er Jahre gerieten jedenfalls selber mehr zu dramatischen Anblicken als daß sie den französischen Meister verhöhnten. Aus dem (eher marktgesetzlichen als kunstgeschichtlichen) Paradigma von Steigerung und Überbietungsästhetik fand Kippenberger den Ausweg der Unterbietung. Als Strategie bedeutete Kippenbergers Infantilisierung seiner Bezugnahmen auf berühmte Malerkollegen den Verzicht auf weniger anstrengende, ebenso marktgängige Verfahren der Bilderfindung. Paradox wurde ihm die konsequente Verneinung zur verlässlichen Orientierung, zur einzig berechtigten, wenn auch von Galgenhumor durchkreuzten Hoff-nung: »If You Don’t Know Where to Go, Go to the No«, Bild-titel, 1985. Die »Weißen Bilder« – weißer Text von Witzen auf weißer Leinwand – greifen die lange Tradition weißer Bildflächen und weißer Bilder von der historischen Avant-garde über Robert Ryman bis heute auf und an. Die Arbeit scheint dem Betrachter die Frage zu stellen, ob der schlechte Witz oder das harmlos gewordene Pathos einer absoluten, Kunst und Leben revolutionierenden Malerei lächerlicher ist – oder aber, ob in der rüden Attacke nicht doch ein heftiger Glaube an die Möglichkeiten der Malerei versteckt ist und es Kippenberger darum ging, »Bilder zu malen, die das ganz Banale und Alltägliche mit den hohen Ansprüchen der abstrakten Malerei verbinden und den Bogen vom völlig Ordinären zum Kompromißlosen spannen« (Daniel Baumann). Als weiße Entleerung vollzieht Kippenberger den kunsthistorischen Kompetenzverlust in Sachen Sinnstiftung mutwillig nach – wodurch Sinnfra-gen erst wieder ins Spiel kommen. Es ist eigenartig, wie Martin Kippenbergers ironische, gegen Pathos und wohlfeile Betroffenheit gerichtete Desillusionsarbeit, die sich in den späten 1980er Jahren unter anderem an der weihevollen Beuys-Verehrung kurz vor und nach dessen Tod entzündet hatte, in allgemeinste Zustimmung der Kunstöffentlichkeit in Europa und den USA mündete, als Kippenberger 1997 alkoholkrank verstarb. Roy Lichtenstein geboren 1923 in New York, ebenda gestorben 1997 Ein T-Shirt, im rudimentären Malstil seiner frühen Comic-Bilder gehalten, und einen rechteckigen Spiegel kombiniert Roy Lichtenstein 1978 zu einem Selbstpor-trait. An die Stelle des Körpers ist die leere Hülle eines Kleidungsstücks getreten, an die des Kopfes ein blinder Spiegel. Mit dem Spiegel als Bildmotiv, Form und Reflexion begann sich Lichtenstein bereits in den frühen 60er Jahren auseinanderzusetzen. Ausgangspunkt dafür waren weniger die berühmten Vorbilder der Kunstgeschichte als die aktuellen und massenhaft reproduzierten alltäglichen Werbebilder. In Airbrush-Technik waren dort Spie-gel wiedergegeben, »die nichts spiegelten«. Die Banalität und Bedeutungslosigkeit dieser Grafiken steigerte Lichtenstein, indem er die repräsentativ-ornamentale Rahmung der Spiegel wegließ und sie formal zur bildlichen Chiffre vereinfachte. Entsprechend sind auch in dem Selbstporträt nur einige gepunktete, gewellte ›Reflexe‹, nicht aber ein gespiegelter Gegenstand – das Antlitz des Künstlers etwa – auf der Oberfläche des Spiegels zu sehen. Der leere Spiegel enttäuscht die Erwartungen an ein herkömmliches Portrait und setzt zwei ineinander verschränkte kunstphilosophische Traditionen außer Kraft, diejenige des Spiegels als Mittel der Selbsterkenntnis und die der Malerei als mimetischer Widerspiegelung der Welt. Die von Spiegel und Malerei erzeugten Bilder werden als Oberflächlichkeiten entlarvt. Was für ein Mensch hinter Konfektionsware und sozialen Rollen steckt, entzieht sich ihrer Darstellung. »Wir wollen dauernd wissen, was sich hinter dem verbirgt, was wir sehen.« So kommentierte Magritte sein Bild des »Menschensohns« (1964), auf dem ein Apfel das Gesicht verdeckt. Lichtenstein greift in seiner Beschäftigung mit dem Surrealismus dieses Motiv auf, um Magrittes Bildwitz zu übertreffen. In einem 1977 entstandenen Portrait ersetzt eine durchlöcherte Scheibe Käse den Kopf, ein Jahr später ein Spiegel. Das hintersinnige Spiel mit der (kunst-)historisch gestörten Beziehung von Wirklichkeit und Illusion zeigt einzig einen Platzhalter, auf den sich der Betrachter auch selbst projizieren kann. Das Selbstportrait wird zum Rätsel, das uns nichts mehr über den Künstler als Person, viel aber über seine Funktion als Spiegel der Gesellschaft verrät. Axel Lieber geboren 1960 in Düsseldorf, lebt in Malmö/Schweden Als Bildhauer hat Axel Lieber ein direktes Interesse an Dingen. Ihn beschäftigt am anfaßbaren Gegenstand nicht das symbolisch Verweis-hafte, politisch Relevante oder diskursiv ausführlich Verwertbare, sondern das konkrete Einzelne. Was passiert, wenn ich aus einem Holzschrank alle Zwischen- und Füllflächen heraussäge? Was verhüllen Wolldecken, die stabilisatorgetränkt über einem (unbekannten) später entfernten Gegenstand getrocknet worden sind? Luft? Nichts? Oder das, was wir als Betrachter unausweichlich hineinphantasieren? Daß Liebers Ausgangsmaterialien Fundstücke des Alltags sind, gibt seinen Skulpturen und Installationen eine lakonische Gelassenheit, die nicht einmal das Provokationspotential des Ready-mades gegen das Artefakt in Anspruch nimmt. Denn Liebers Arbeiten sind sorgsam ausgedachte und ausgeführte Artefakte. Dabei führt die formale Konsequenz des Reduzierens und Weglassens dazu, daß zwar nicht alle All-tagsfunktionen, wohl aber alles Anekdotische verschwindet. Aus dem zweckbefreiten Schrank ohne Zwischenböden kann man immer noch die Schubladen herausziehen, die Schranktüre, die nichts mehr verdeckt, kann man immer noch aufschließen. Warum macht uns das durchsichtige Gerippe eines Schrankes neugieriger als ein konventioneller Schrank, der tatsächlich etwas vor unserem Blick verbergen könnte? Eher beiläufig scheinen in Axel Liebers Dinguntersuchungen formale Thematiken der existentialistisch gestimmten Bildhauerei nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Wie bei Henry Moore ist es das Loch im Material, das bewußt Weggelassene, das die skulpturale Gesamterscheinung dialektisch und paradox mit massiver Fülle ausstattet. Schien es bei Giacometti der drohend drängende Raum zu sein, der nur noch manisch abgeschabte, strichdünne Figuren übrigließ, so reduziert Liebers bildhauerischer Röntgenblick Alltagsgegenstände auf das Knochengerüst der Dinge, etwa beim »Sessel« (1999/2000). Aber Liebers Ausgangsmaterialien stammen aus dem Keller oder vom Speicher, nicht aus existentiell beunruhigter Philosophie oder aus Weltkrieg II-Erlebnissen. Deshalb gerät ihm die Dialektik von strichhafter Raumumzeichnung und negativem Volumen weniger pathetisch. Deutlich wird so, was – bei aller existentieller Infragestellung – schon bei Giacometti und Moore ein gekonnter Bildhauertrick war. Einen Bluff inszeniert Lieber als Bluff, z.B. mit seinen »Memorials«. Die konkreten Dinge sind, was sie sind, und zugleich eben nicht. Kasimir Malewitsch geboren 1878 in Kiew, gestorben 1935 in St. Petersburg Kasimir Malewitsch hat die Malerei als abbildende Kunst nach eigenen Worten ihrem »absoluten Nullpunkt« zugeführt. Zugunsten einer »Suprematie (Herrschaft) der reinen Empfindung« sollte »die Kunst vom Ballast der gegenständlichen Welt« sowie von jedem Zweck befreit werden. Das 1918/19 entstandene Werk teilt die radikale Gegenstandslosigkeit jenes 1915 in einer Petrograder Galerie präsentierten »Schwarzen Quadrats«. Das viel zitierte Programmbild der Avantgarde steht am Anfang des Schule machenden Suprematismus. Die »Null-Form« (Malewitsch: Die gegenstandslose Welt, 1927) des »Schwarzen Quadrats« sollte aber nicht den Endpunkt der Malerei in der Abstraktion markieren. Malewitschs formale Reduzierung auf das elementare Quadrat ist kein nihilistischer Akt. Vielmehr ist sie als Versuch einer Rückkehr zu den Anfängen zu deuten. Von hier aus sollte ein Neubeginn möglich werden. In diesem Umfeld flammt das rote Quadrat vor schwarzem Grund wie das Fanal einer neuen Kunst auf, die das alte Wertesystem zerstört, um die Herrschaft der reinen Formen und Farben über die Natur zu proklamieren. Wenn Malewitsch seinen Farben auch nur selten metaphorische Bedeutung beimaß (»das Rote« als »das Signal der Revolution«), gibt es in den theoretischen Schriften doch deutliche Parallelen zur revolutionären Rhetorik des jungen Sowjetstaats, an dessen ästhetischer Neugestaltung er maßgeblich mitwirkte. Malewitschs künstlerische Utopie reichte aber über den gesellschaftspolitischen Aspekt hinaus. Ersichtlich wird das wiederum am »Schwarzen Quadrat«, genauer: an dessen Plazierung in der Ausstellung von 1915. In der oberen Raumecke – dem traditionellen Ort der Ikone – provozierte es nicht zufällig den Vorwurf der Gotteslästerung. In den heiligen Winkel setzte der technikbegeisterte Malewitsch eine neue »Ikone meiner Zeit«, deren reine Formen dem Chaos eine kosmologische Ordnung entgegenstellen. Letztlich scheinen die formale Abstraktion wie der quasi-religiöse Anspruch von wissenschaftlichen Theorien der Zeit inspiriert, die nicht Materie, sondern Energie als Träger und Ursprung hinter der gegenständlichen Welt behaupten. Auf diesen Urzustand zielt Malewitsch zurück. Anstelle der Aura des Religiösen gelte es nun, die erhabene »Feierlichkeit des Weltalls« in der Kunst sichtbar zu machen. Piero Manzoni geboren 1933 in Soncino, gestorben 1963 in Mailand Piero Manzoni , Maler und Konzeptkünstler, kritisiert die subjektiven Dimensionen traditioneller Kunstgattungen. Malerei, Objektkunst, Skulptur, Aktionen und konzeptuelle Setzungen reflektieren die Existenz der Materie bis zum gestalterischen Nichts. Manzoni engagiert sich ab 1959 in der Galerie Azimuth und bei der gleichnamigen Zeitschrift. Mailand wird zu einem Zentrum der europäischen Avantgarde, im Dialog mit den Nouveaux Realistes, Paris, und der Gruppe Zero, Düsseldorf, mit Robert Rauschenberg und Jasper Johns in New York. Manzonis in Kaolin getränkte »Achrome« entstehen seit 1957. Sie vollenden sich im Verlauf der Trocknung selbst, emanzipieren sich als konkrete Existenz vom individuellenGestaltungsprozeß. »Für mich ist das Problem, eine gänzlich weiße (…) Fläche außerhalb jedes malerischen Phänomens, jedes dem Flächenwert fremden Eingriffs zu bieten; ein Weiß, das nicht Polarlandschaft, evozierende oder schöne Materie, Empfindung oder Symbol oder sonst etwas ist: eine weiße Fläche, die weiße Fläche ist und nichts anderes (eine farblose Fläche, die eine farblose Fläche ist), oder besser, die ist und nichts anderes: Sein (und totales Sein ist reines Werden). Kann diese unbestimmte (nur lebendige) Fläche aufgrund der materiellen Gegebenheit des Werkes auch nicht unendlich sein, so ist sie doch zweifellos undefinierbar, bis ins Unendliche wiederholbar, ohne Unterbre-chung der Kontinuität« (Piero Manzoni, 1960). Aus der Haltung der Reduktion erwachsen Setzungen wie die »Unendliche Linie« (1959), der »Magische Sockel« (1961), die »Signatur lebender Menschen« (1961), der »Sockel der Welt« (1961), »Merde d’artista« (1961). Die »Corpi d’aria« (1960) sind Ballons, die Luft, auch den Atem des Künstlers, festhalten, für einen Moment greifbar Existenz und Leben beweisend, das sich im Ungreifbaren diffundiert. Manzoni erläutert dies: »Das (…) gilt für die ›Corpi d’aria‹, reduzier- und ausdehnbar von einem Minimum zu einem Maximum (vom Nichts zum Unendlichen), als Sphäroiden absolut unbestimmt, weil jeder Eingriff, der darauf ausgerichtet ist, ihnen eine (auch unförmige) Form zu geben, illegitim ist. Es geht nicht da-rum, zu formen, es geht nicht darum, Botschaften zu artikulieren. (…) Es gibt nichts zu sagen, es gibt nur zu sein, es gibt nur zu leben« (Piero Manzoni, 1960). Gerhard Martini geboren 1953 in Bochum, lebt und arbeitet in Düsseldorf Im ältesten Naturkino Griechenlands herrschte Ordnung. Fest an ihre Sitze geschnallt, konnten die Besucher nur nach vorne schauen, dorthin, wo die Lichtspiele projiziert wurden. Als Projektorlampe fungierte ein Feuer. Projiziert wurde, was Passanten an Gegenständen hinter dem Rücken der Besucher vor dem Feuer vorbeitrugen: »Bildersäulen und andere steinerne und hölzerne Bilder«. Zu sehen waren also Bilder von Bildern, was den Erkenntnisstand der Besucher recht niedrig hielt: »Auf keine Weise also können diese irgend etwas anderes für das Wahre halten als die Schatten jener Kunstwerke.« Seit Platons Höhlengleichnis ist im Abendland einiges passiert, unter anderem kam Ende des 18. Jahrhunderts der Schattenriß, die handgefertigte Vorform der Portraitfotografie, in Mode – um alsbald von der Portraitfotografie verdrängt zu werden. Heute beschert uns die Fotografie (und erst recht das laufende Filmbild) eine solche Fülle von Gesichtern, die uns schattenlos (dabei durchaus künstlich) in unseren häuslichen Höhlen angucken und ansprechen, daß die von Platon einst bemängelte Informationsarmut silhouettenhafter Abbildungen einen neuen Reiz bekommen hat. Gerhard Martinis Bilder von Köpfen oder Figuren zeigen in ihrem Zentrum monochrome, pastos durchstrukturierte Flächen. Einerseits geben diese Bilder ohne falschen Schein zu erkennen, was sie sind: Ein gemaltes Gesicht ist nie anwesend, nur die Farbe ist anwesend. Andererseits wirkt der mimetische Verzicht im Innern der Silhouette wie ein Loch, eine Ausblendung (bei Platon beginnt die Befreiung von Unwissen mit Blendung: dem Blick ins Licht). Die Bilder bieten dem Betrachtergesicht kein Bildgesicht als antwortenden Spiegel mehr an. Jedoch zeigt diese Malerei ihren Verzicht nicht als düsteres Verdämmern, sondern in signalhafter Deut-lichkeit. Hier wird nicht mangelnde Erkenntnishelle gleichnishaft kritisiert, sondern Erkenntniskonventionen hell und klar in Zweifel gezogen. Hat Platons bis heute folgenreiche Gleichsetzung von Licht mit Wahrheit und Vernunft im Zeitalter elektronisch simulierter, heller Anwesenheit eines Fernsehgesichtes im Wohnzimmer noch Sinn? Martinis Gemälde sind Bilder von Bildern, wobei die Vorlagen »Kunstwerke« sowohl in Platons eher abfälligem Wortgebrauch von »Tand« sind (Postkarten, Zeitungsfotos), wie im heutigen Sinn, also Bilder anderer Maler. In einer durchkommerzialisierten, auch im Kunstmarkt extrem beschleunigten Bilderwelt, die Information mit Erkennen verwechselt, nimmt sich eine Malerei philosophisch aus, die mit Platons Lehrer zu sagen scheint: »Ich weiß, daß ich nichts weiß.« Allan McCollum geboren 1944 in Los Angeles, lebt und arbeitet in New York Allan McCollums erster Stellvertreter für ein Gemälde entstand 1978. Er sollte Malerei auf ein universelles Zeichen reduzieren und bestand wie eine Vielzahl folgender »Surrogate Paintings« aus monochrom bemalter Pappe auf Holz. Auch bei den »Plaster Surrogates« (seit 1982), gerahmten dreidimensionalen Gipsobjekten, bleibt der Bildcharakter erkennbar, alle Individua-lität aber ist ausgelöscht. Sie unterscheiden sich voneinander nur noch durch variierende Formate, wechselnde Farbtöne der Rahmen sowie die abschließende Bearbeitung von Hand des Künstlers, der alles Anderes an seine Assistenten delegiert. Die Präsentation läßt an eine Galeriehängung des 17. Jahrhunderts denken, eher noch an den mit Serienware gefüllten Rahmenladen. Mit ihrem schwarzen Zentrum erinnern die nach 1979 entstandenen Surrogate an das »Schwarze Quadrat« von Malewitsch. Nochmals profitiert der Amerikaner von dem Effekt, daß die schwarze Leerstelle, sobald sie gerahmt ist, die Augen bannt, daß die Durchstreichung zur Attraktion wird. Gleichzeitig aber banalisiert er die zitierte künstlerische Strategie, indem er Hunderte und Tausende der Surrogate in einer Installation anhäuft. Er parodiert den emblematisch gewordenen Reduktio-nismus der modernen Malerei. Das massenhafte Auftreten der Surrogate befreit vom Absolutheits-anspruch der Suprematisten. Allgemeiner noch untergräbt McCollum damit den Artefakt- und Fetischcharakter museal ausgestellter Kunstwerke, die seiner Überzeugung nach allein dem ästhetischen Ideal der herrschenden Schicht folgen. Von der Ästhetik des Einzigartigen verabschiedet er sich ebenso wie vom Mythos des Künstlers, als er sein Atlelier in eine straff durchorganisierte Fabrika-tionsstätte verwandelt. Statt einzigartiger und exklusiver Gemälde und Skulpturen stellt McCollum im Grenzbereich von Massenproduktion, Handarbeit und Unikat im Überfluß verfügbare Ersatz-Werke her, welche aber die gleichen sozialen Funktionen erfüllen können. In »Surrogates on Location« (1981/83), einer Serie von Fotografien nach Medienbildern, sind Gemälde Objekte der Begierde, Statussymbole, Wandschmuck, immer aber im Hintergrund und bis zur Unkenntlichkeit verunklärt. Die Gips-Surrogate sind Konkretionen der flüchtigen Wahrnehmung von Gemälden im Alltag: »their real place in the world is to be in the background functioning as a prop, or a token« (1985). Gerhard Merz geboren 1947, lebt und arbeitet in Pescia und Berlin »Strenge Arbeit vollzieht sich durch Verweigerung.« So wird das Werk zum Ergebnis all seiner Verwerfungen. Mit dem Wissen um das Unmögliche eines reinen Sehens führt die Kunst von Gerhard Merz an dessen Grenzen und fragt nach dem Wesen der Täuschung. Es gilt: »nur so viel visuelle Illusion, als nötig ist, diese wieder aufzulösen« (Beat Wyss). In der Tradition der Vermittlung eines Begriffs vom Erhabenen versteht sich auch die Kunst von Merz als Schwelle. Sie wird – pathetisch formuliert – zum Vorhang, der sich öffnet und den Betrachter in einen Zustand außerhalb seiner selbst katapultiert. Die Rauminstallation »Pavillon« entsteht im Sommer 2000 für seine Werkschau im Kunstverein Hannover. Sie wird das zentrale Werkstück eines Ausstellungspro-jektes, in dem sich sein bisheriges Schaffen bündelt. Im Rahmen der in Hannover stattfindenden Expo bezieht sich Merz auf Mies van der Rohes Barcelona-Pavillon, den dieser 1929 für die Weltausstellung in Spanien entworfen hatte und der zu einem Schlüsselwerk der Moderne geworden ist. Auch der »Pavillon« von Merz arbeitet in kühler Reduktion mit Materialien der Moderne: Stahl, Glas und Neonlicht. In die tragende Konstruktion aus Stahl sind die Wände aus klarem und weißem Glas eingehängt. Erleuchtet wird die Installation von 10.000 Neonröhren, die den Raum in gleißende Helligkeit tauchen. Über zwei korridorähnliche Gänge betritt der Betrachter den Pavillon, der ihn an die Grenze zwischen logischer Konstruktion und überwältigender Erfahrung des Nichts versetzt. »Mythos«, so Beat Wyss, »ist ein hohes Konzentrat logischer Diskurse«. In der ästhetischen Schockerfahrung des »Geblendet-Seins« aber liegt die produktive Schwelle zu erweiterter Wahrnehmung. Das Motiv findet sich bereits in Platons »Höhlengleichnis«, als philosophischer Urerzählung über die kausale Beziehung zwischen Licht, Blendung und Erkenntnis. Im »Pavillon« von Gerhard Merz gerät die überwältigende Erfahrung zum rein technischen Produkt. Das gleißende Licht der 10.000 Neonröhren kann letztlich nur eine elektronische Erleuchtung bringen: Urphänomene gibt es nicht, der Sinn ist nicht etwas, das sich vorfinden läßt – weder in der Natur noch in der Technik. Merz verabschiedet sich von der Idee des Erhabenen, indem er zeigt, wie es gemacht wird, und darin das Werk grundsätzlich an das Ende der Kunst führt – ein Abschied auch von den Versprechungen der Moderne. Gustav Metzger geboren 1926 in Nürnberg, seit 1939 in England, lebt und arbeitet in London Mit dem Pinsel trägt Gustav Metzger Säure auf gespannte Nylontücher auf. Vor den Augen der Londoner Zuschauer dieser frühen Aktionen frißt sich das aggressive Fluid in den Malgrund. Die Kunst entzieht sich durch Selbstauflösung. 1961 und 1963 waren dies die ersten Umsetzungen von Metzgers Konzept der autodestruktiven Kunst. »Wenn sich der Zerfallsprozeß vollendet hat, wird das Werk entfernt und vernichtet«, steht im ersten Manifest der ›Selbstzerstörungskunst‹ von 1959. Im zweiten programmatischen Papier deutet Metzger 1960 den gesellschaftspolitischen Hintergrund an: »Autodestruktive Kunst läßt die Lust an der Zerstörung wiederaufleben, den Trieb, dem der einzelne und die Massen ausgeliefert sind. (...) Autode-struktive Kunst spiegelt den zwanghaften Perfektionismus der Waffenherstellung – Polieren bis zur Zerstörung. Autodestruktive Kunst ist die Umwandlung von Tech-nik in Kunst für den öffentlichen Raum.« Als Reaktion auf die nukleare Bedrohung einerseits und auf die Entwicklung der Kunst hin zur bloßen Ware andererseits greift die autodestruktive Kunst das vorgefundene destruktive Potential auf, um es in Kreativität umzuwandeln. Die Selbstauslöschung der Werke proklamiert Metzger »als die letzte verzweifelte subversive und politische Waffe in der Hand von Künstlern. (...) Sie ist ein Angriff auf das kapitalistische System und die Waffenproduktion. (...) Sie ist außerdem ein Angriff gegen Kunsthändler und Sammler, die sich der modernen Kunst um des Profits willen bedienen.« In der Widersprüchlichkeit der autodestruktiven Kunst zwischen »Protest«, »Lobgesang auf die Zerstörung« (1962) und Adaption industrieller Techniken zeigen sich gesellschaftskritisches und ästhetisches Interesse eng verschränkt. Metzgers Aufruf zur »chemischen Revolution in der Kunst« (1965) und künstlerische Verfahren wie die der Verrottung oder Explosion zielten auf eine Ästhetik des Ephemeren. Wie die selbstzerstörerischen Maschinen Tinguelys und andere Arbei-ten der fast 100 Künstler, die Metzger zu einem großen »Destruction in Art Symposium« (DIAS) 1966 nach London lud, läuft Metzgers Kunst den bürgerlichen Prinzipien eines auf Beständigkeit und Wertsteigerung beruhenden Kunstsystems zuwider. In ihrem performativen und temporären Charakter bezieht die Auto-Destructive Art eine radikale Position innerhalb der Tendenz der Kunst des 20. Jahrhunderts zu fortschreitender Entgrenzung und Entmaterialisierung. Im Gegen-satz aber zu der werkimmanenten Problematisierung von Zerstörung bei Lucio Fontana oder in den Feuerbildern Yves Kleins überschreitet Metzger die ästhetische Grenze und vernichtet das Werk als Einheit selbst. Piet Mondrian geboren 1872 in Amersfoort, gestorben 1944 in New York Piet Mondrian gehört wie Kasimir Malewitsch und Wassily Kandinsky zu den bahnbrechenden Avantgardisten der abstrakten Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Malerei des Neoplastizis-mus, die programmatisch auf alles Figurative und zufällig Erscheinungshafte verzichtete, sollte nicht nur für die Kunst, sondern auch für das gesellschaftliche Leben eine neue Grundordnung entwerfen. Mondrian, der philosophisch und theosophisch interessiert war, hat seine Ansichten in zahlreichen Texten dargelegt. »Das Leben des heutigen Kulturmenschen wendet sich mehr und mehr vom Natürlichen ab; es wird immer mehr abstraktes Leben.« (1917) »Die Maschine ersetzt immer mehr die natürliche Kraft. In der Mode sehen wir die typisierende Straffung der Form und Verinnerlichung der Farbe, Zeichen einer Entfremdung von der Natur. Im modernen Tanz (Step, Boston, Tango usw. ) finden wir dieselbe Straffung: Die runde Linie des alten Tanzes (Walzer usw.) weicht der geraden Linie, während jede Bewegung sofort durch eine Gegenbewegung aufgehoben wird – ein Zeichen für das Verlangen nach Gleichgewicht.« (1918) »Es gibt ein altes und ein neues Zeitbewußtsein. Das alte richtet sich auf das Individuelle. Das neue richtet sich auf das Universelle. Der Streit des Individuellen gegen das Universelle zeigt sich sowohl in dem Weltkrieg wie in der heutigen Kunst.« (1918) »Das Tragische kann nur durch die Herstellung einer (endlichen) Einheit aufgehoben werden; das ist im äußeren Leben viel schwieriger als im abstrakten. In der Kunst ist die Einheit des Einen und des Anderen abstrakt zu realisieren: Daher läuft die Kunst dem Leben voraus.« (1917/18) »Die reine plastische (bewußte) Sicht muß eine neue Gesellschaft aufbauen, wie sie in der Kunst eine neue Gestaltung aufgebaut hat – eine Gesellschaft, in der der Dualismus von Materie und Geist beseitigt ist, eine Gesellschaft von Gleichgewichtsbeziehungen.« (1918/19) »Mit etwas gutem Willen wird es nicht unmöglich sein, ein irdisches Paradies zu schaffen.« (1918) Henry Moore geboren 1898 in Castlefort, gestorben 1986 in Much Hadham »Das erste Loch, das man in ein Stück Stein bohrt, ist eine Offenbarung. Das Loch verbindet eine Seite mit der anderen und macht das Ganze sofort deutlich dreidimensional. Ein Loch kann an sich ebensoviel Formbedeutungen haben wie eine feste Masse. Skulptur in Luft ist dort möglich, wo der Stein nur das Loch enthält, das die ins Auge gefaßte Form ist.« Henry Moore beginnt in den 30er Jahren damit, Löcher in seinen Skulpturen zu verwenden. Das negative Volumen wird zum dynamischen Gestaltungsprinzip und verbindet den immateriellen und den materiellen Raum zur spannungsvollen Einheit. »Head: Cyclops«, der Zyklopenkopf von 1963, zählt zur Werkgruppe der Helme. In wenigen zentralen Motiven variiert Moore seine Themen und bildet Archetypen aus, die jenseits einer individuellen Darstellung auf die Idee ihrer Motive zielen. Trotz seiner Nähe zum Surrealismus und einigen abstrakten bildhauerischen Experimenten bleibt Moore dem Gegenständlichen verpflichtet. Als Ende der 30er Jahre seine »Stringed Figures« als rein abstrakte Skulpturen entstanden waren, äußert er sich kritisch zu dem, was er als die eigentliche Aufgabe der Kunst versteht: »Sie [die Stringed Figures] machten mir Spaß, aber es hätte mehr als ein Experiment sein müssen, um mich wirklich zu befriedigen. Das Experiment ist etwas ganz anderes, als die Gestaltung eines starken menschlichen Erlebnisses, das man vielleicht hatte. Als der Krieg begann, gab ich solche Dinge auf.« Statt dessen entsteht 1939, unmittelbar nachdem in Europa der Krieg ausgebrochen ist und sich zu einem gesamteuropäischen Drama zu entwickeln beginnt, sein erster Helm. Die Erfahrung von Krieg und Tod wird darin zum existentiellen Ausdruck reduziert: Die Idee, daß eine Form eine andere beschützt und darin auch über das Prinzip von Gewalt und Tod spricht, abstrahiert sich formal im »Innen« und »Außen«. In vielen der späteren Helme verschwindet der Kopf zum Teil völlig. Der Helm wird zur leeren Hülle, die nur noch den Verlust bezeichnen kann. Im Zyklopenkopf, als dessen Variation, zieht sich die Form nach innen, als würde sich der Raum im oberen Bereich der Figur in der Zurückweichung verdichten und wie ein schwarzes Loch in ihr verschwinden. Das Auge des Zyklopen wird zur spiralförmigen Mulde, in deren nach innen gerichtetem Sehen sich die Blickrichtung verkehrt. Juan Muñoz geboren 1953 in Madrid, lebt und arbeitet in Torrelodones Nähert sich der Betrachter von der Seite, so sieht er sechs Figuren auf einer horizontalen Fläche in nahezu symmetrischer Ordnung stehen. Genauer besehen, handelt es sich um zwei Flächen, die dort, wo sie fast aneinander grenzen, von einer senkrecht stehenden Scheibe getrennt werden. Ist mit Hilfe der Glasscheibe eine Spiegelung dargestellt? Aber auf welcher Seite beginnt dann das Geschehen? Spiegelt sich die linke Figurengruppe in der rechten? Oder ist die rechte Gruppe die »realere« und die linke nur eine dreidimensionale Ausformulierung des vergleichsweise fiktiveren Spiegelbildes? Steht eine Gruppe vor dem Spiegel, die andere in der illusionistischen Tiefe optischer Reflexion? Genauso unentscheidbar ist, worauf die Figuren stehen: ein Tisch, eine Bühne? Im Maßstab der Figuren könnte die Unterkonstruktion mit ihren sechs Querstreben an den Stirnseiten ebenso ein Gerüst sein. Auch die Figuren sind Mischwesen. Einerseits wirken sie steif wie Puppen, andererseits sind sie mit ihren Gesten und ihrer Beziehung zueinander realistische Miniaturen von Menschen, also Identifika-tionsträger des Betrachters innerhalb des skulpturalen Bildes. Puppen sind tote Dinge, sie wenden sich nicht einander zu und betrachten sich nicht im Spiegel. Aber sind die Figuren deshalb menschlicher? Könnten die Figuren Miniaturen von Schauspielern sein, die eine Spiegelung an der transparenten Scheibe nur darstellen? Dafür würde sprechen, daß ihre Anordnung nicht perfekt symmetrisch ist. Aber warum stehen sie dann auf zwei, durch die Scheibe getrennten Flächen? Befinden sie sich vielleicht nicht in einem Raum, in einem einheitlichen Raum-ZeitKontinuum? Ist links ein späterer Moment zu sehen als rechts? Zeigt uns die Tisch-bühne eine zeitversetzte Spiegelung? Dann wäre die Scheibe nicht nur eine Trennung des Raumes (und der Realitätsebenen »real« und »gespiegelt«), sondern auch ein Riß durch die Gegenwart, eine Entzweiung unserer einheitlichen Orientierung in Zeit und Raum. Wer kann sich im Spiegel erkennen? Ist dort immer nur eine Maske zu sehen? Um sich selbst zu begreifen, ist ein Bruch mit dem Selbstsein nötig, ein Aus-sich-Heraustreten, eine befremdende Objektivierung der eigenen Subjektivität. Aber wenn man außer sich sein muß, um sich zu begreifen, wen begreift man dann? Es gibt keine Selbsterkenntnis ohne Selbstentzweiung. Barnett Newman geboren 1905 in New York, ebenda gestorben 1970 Barnett Newman ist einer der wichtigsten Maler des amerikanischen Abstrakten Expressionismus. Für ihn bringt reine Farbe das Nichtfaßbare eher zur Erscheinung als der gestisch geführte Pinselstrich. Newman hat damit der Malerei wesentliche Dimensionen der ihr innewohnenden Spiritualität erschlossen, die auf eine umfassende anthropologisch gegründete Vergewisserung des Menschen im Körpermaß baut. Befreundet mit Clyfford Still und Jackson Pollock, gründet er zusammen mit Robert Motherwell und Mark Rothko 1948 die für das Selbstverständnis der amerikanischen Malerei wegweisende Schule »The Subject of the Artist«, die der Malerei spirituelle Aufgaben zuweist. »Die Imagination (des zeitgenössischen Malers) versucht, in die metaphysischen Geheimnisse zu dringen. In diesem Sinne verkörpert seine Kunst das Erhabene. Es ist eine religiöse Kunst, die durch Symbole die grundlegenden Wahrheiten des Lebens erfassen will, das im Wesentlichen eine Tragödie ist« (Barnett Newman, 1945). Aus biomorphen, surrealen Kompositionsstrukturen entwickelt er in seinen Gemälden abstrakte, zumeist homogene, teilweise riesige monochrome Farbflä-chen, durch vertikale Streifen, sogenannte »Zips«, strukturiert. Das Multiple »The Moment« (1966) rekurriert u.a. auf »Moment« (1946), das erste Gemälde mit einem Zip überhaupt. Hochschmal ist ein ultramarinblaues Farbfeld von zwei kobaltblauen »Zips« bündig zum Rand gefaßt, auf Plexiglas gedruckt und einem Holzkeilrahmen befestigt. Die dem Werk innewohnende Dynamik gründet in der subtilen Komposition. Der linke Zip beginnt unten schmaler, als er oben endet, beim rechten ist dies umgekehrt. Es entsteht eine vibrierende Spannung, welche die Wahrnehmung irritiert. »Letztendlich zählt Größe nicht. Ob ein Staffeleibild schmal ist oder groß, das ist nicht der Punkt. Nicht die Größe zählt. Es ist das Maß, das zählt. Es ist das menschliche Maß, das zählt, und der einzige Weg, das menschliche Maß zu erreichen, ist durch Gehalt« (Barnett Newman, 1970). Programmatisch hat er das Thema des Künstlers 1947 so formuliert: »… aus dem Nichtrealen etwas hervorbringen, aus dem Chaos der Ekstase etwas, das die Erinnerung beschwört an die Empfindung eines bereits erfahrenen Augenblicks (der totalen Realität) einer umfassenden Wirklich-keit.« Für ihn ist Malerei Bestimmung und Definition der menschlichen Existenz im Ungreifbaren: »The Sublime is now« (Barnett Newman, 1948). Albert Oehlen geboren 1954 in Krefeld, lebt und arbeitet in Köln »Seit 15 Jahren geht es mir eigentlich darum, Sachen wegzuschmeißen, auszuschließen. Im Grunde hat sich alles bei mir entwickelt aus Negation, aus Ablehnung: der Illusion, der Emotion, der Trickkiste, des Wir-Gefühls, bis ich zu dieser vielleicht illusorischen Vorstellung einer Autonomie kam.« Aber da für Albert Oehlen die Auseinandersetzung mit der Malerei »so schön und richtig« bleibt, läßt er sich auf das Risiko ein, daß jede Negation irgendwann selbst ins Positiv kippen kann. Die bewußte Entmystifizierung wird schließlich wiederum mystifiziert und vom Kunstbetrieb vereinnahmt. In den 80er Jahren betreibt der Polkeschüler Oehlen wie Werner Büttner, Georg Herold und Martin Kippenberger eine Gegen-Kunst, die sich ebenso politisch wie kritisch gegenüber der eigenen Profession und deren Strukturen verhält. Als »Junge Wilde« zum Kunstphänomen gebündelt, provozieren sie mit einer exzessiven Malerei, die die Malerei selbst in Frage stellt. Oehlens Malerei ist Institutionskritik der betriebsinternen Strukturen, eine Abrechnung mit den Avantgarden und die »Entlarvung der im Künstlerbild getarnten ›kleinbürgerlichen Bedürfnisse‹«, wie Roberto Ohrt es bezeichnet. In der sechsteiligen Serie »o.T. (nur nicht überanstrengen)« exerziert der professionelle Künstler einen mehr als dilettantisch erscheinenden Durchlauf der Techniken der Malerei. Die Aufgabenstellungen kennt man aus dem Kunstunterricht: Portrait, perspektivische Konstruktion, Licht- und Schattenstudie, gefolgt von abstrakter Komposition. Der Stil von Oehlens Malerei unterscheidet sich nicht wesentlich von dem eines nur matt ambitionierten Schülers, der seine Unterrichtsaufgaben erfüllt. Kunst findet hier im Sichtbaren wohl kaum statt – Kunst muß etwas anderes sein. Und so fragt es sich, ob Kunst selbst erlernbar ist und was Malerei überhaupt sein kann. »Bilder sollen nicht authentisch sein, sondern taktisch richtig«, so liest man seinerzeit in der von Oehlen und Herold mitherausgegebenen Künstlerzeitschrift »dum-dum«. Oehlens Arbeit versucht ein Trotzdem: Eine Malerei, die die Malerei innerhalb der Möglichkeiten, die ihr bleiben, ernst nimmt. Eine Malerei nach der Malerei, da sie keine »Bilder« mehr produzieren will: »Es geht mir um Eliminierung, es geht darum, das ›weiße Bild‹ abzuliefern, nur daß das wieder zu schematisch wäre. Solange die Widerlegung von Malerei sich noch der Malerei bedienen kann, ist sie nicht widerlegt.« Michelangelo Pistoletto geboren 1933 in Biella bei Turin, lebt und arbeitet ebendort »Stück für Stück, wie sich die Spiegel zusammenfügen, vergrößert sich die Zahl der Bilder im Inneren der Konstruktion. In dem Augenblick, wo der letzte Spiegel angelegt wird, wird das verspiegelte Innere zu einem Kubus, in dem alle sichtbaren Bilder verschwinden« (Pistoletto, 1966). Sechs nach innen gewandte Spiegel fügen sich zum »Metrocubo d’Infinito«. Während das Äußere, die grauen Spiegelrücken, an Banalität kaum zu übertreffen sind, fasziniert die Vorstellung unzähliger Reflexionen im Inneren. Durch die unendliche Wiederholung des Spiegelvorgangs dehnt sich – paradoxerweise in den Grenzen eines Kubikmeters – eine imaginäre räumliche Unendlichkeit aus. Im Gegensatz zu den über die Würfelkanten hinausragenden Randstreifen reflektieren die verdeckten Flächen der Spiegel nur die jeweils gegenüberliegenden Spiegel und damit nichts anderes als: nichts. Diese Totalität des Verschwindens ist für den Betrachter aber nicht sinnlich zu erleben. Wie ein schwarzes Loch hat der Kubus »alle sichtbaren Bilder« in sich aufgesaugt und vernichtet. Er ist eine Metapher für die Immaterialität und Unbegreiflichkeit des Unendlichen und verweist zugleich auf eine hinter dem Werk liegende, höhere Wahrheit. Michelangelo Pistolettos »Kubikmeter Unendlichkeit« gehört einer Werkgruppe an, deren Bezeichnung als »Oggetti in meno« die Minimal Art reflektiert. Die »Minusobjekte« teilen deren formale Reduktion und den Anti-Illusionismus, nicht aber deren Eindimensionalität und strenge Selbstbezüg-lichkeit. Pistolettos Spiegel beziehen sich auf den Narziß-Mythos und auf Duchamps »Großes Glas«. Metaphy-sisch aufgeladen, hat Pistoletto sie auch einmal als Altarbil-der konzipiert. Die den Gesichtssinn wie das Bewußtsein erweiternde Wirkung erläutert Pistoletto 1978 unter dem Titel »Die Kunst übernimmt die Religion«: »ein Spiegel reflektiert potentiell jeden Ort und setzt die Widerspiegelung fort, auch dann und dort, wo das menschliche Auge nicht anwesend ist. Dadurch wird der Spiegel (...) zum Begeg-nungspunkt zwischen dem spiegelnden und reflexiven menschlichen Phänomen und der universellen Realität. Der Spiegel vermittelt also zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren.« Eine ähnliche Erweiterung der menschlichen Perspektive regt auch »Il muro« von 1964 an, eine Plexiglasscheibe, die es zuläßt, sich zugleich Bilder des Raumes vor der Wand und hinter ihr zu machen. Die Doppelung des Sichtbaren bezieht die Spiegelung des Betrachters mit ein, der sich der eigenen Wahrnehmung – wie sie zwischen durchscheinendem und reflektiertem Bild hin und her schwankt – bewußt wird. Zwischen zwei gegenüberstehende Spiegel schiebt Pistoletto wiederum eine Plexiglasscheibe als »Hemmnis der Unendlichkeit« (Ausstellungsentwurf, 1976). Ungehindert wäre die unendliche Brechung bloßer Effekt. Die Konfrontation mit dem Nichts vollzieht sich wie im Falle des »Metrocubo« im Imaginären. Sigmar Polke geboren 1941 in Oels, Schlesien, lebt und arbeitet in Köln »Und hier darf wohl gesagt werden, daß dank meiner unermüdlichen wissenschaftlichen Bemühungen, von denen meine Bilder ja beredtes Zeugnis ablegen, endlich wieder Licht in die Welt eben dieser metacausalen Beziehungen zwischen/in den Erscheinungen gedrungen ist, in denen erst der wahre Sinn und die wahre Ordnung der Erscheinungen zu finden ist, – frei von irgendwelchen Causalitäten und Consekutionen, in denen sich doch nichts anderes beweist als das tiefe ornamentale Bedürfnis ansonsten haltloser Intellektueller.« Während seiner unermüdlichen aufklärerischen wissenschaftlichen Bemühungen erreichen den Künstler Sigmar Polke jedoch auch gänzlich ungeplant Eingebungen. So geschehen etwa, als ihm »Höhere Wesen befehlen: Winkel malen!« Wie genau die Übermittlungen der Botschaften sich 1968 zugetragen haben, bleibt im Geheimen, das Ergebnis: Der Künstler hat einen Winkel in eine der Bildecken gesetzt und den Auftrag auf dem Blatt notiert. Um 1968/69 wird Polke einige Male zum Medium derartiger Eingebungen, als deren Folge mehrere Versionen seiner ironischen Herrgottswinkel entstehen. Rein künstlerisch gesehen jedoch haftet den Ergebnissen dieser Eingaben nichts »Kreatives« oder »Schöpferisches« an – eine eher dilettantische, unprofessionelle Malerei, die unangenehm auffällt. Der Kunstkritik aber entzieht sich das Bild, denn als Produkt höherer Mächte ist es unanfechtbar: Eine deftige Parodie auf den schöpferischen Impuls in der Kunst und den Künstler als schöpferisches Genie, deren Topoi Polke ironisch aushebelt. Polke, der Hochstapler-Künstler, kokettiert in seinen fröhlichen Wissenschaften mit dem Nichts. In seinen Bildern verkauft er abstruse Beziehungen aus Schein, Sein und Nichts, in denen das Erhabene und das Lächerliche erstaunlich nahe beieinanderliegen. In Polkes Wiederaufbereitung von Kitsch und Kunst entsteht eine humorvolle Mesalliance, deren vermeintlich schlechter Geschmack zum stilistischen Element wird. Das Bild ist paradoxerweise dennoch ein alchemistisches Produkt, denn selbst wenn es seine eigene Lüge offenlegt, bleibt ihm eine mysteriöse Aura. Künstler waren immer schon die, die mit diesem Unfaßbaren gewirtschaftet haben. Arnulf Rainer geboren 1929 in Baden bei Wien, lebt und arbeitet in Wien und im Kloster Vornbach 1951 gab Arnulf Rainer einer Sequenz von Zeichnungen unter dem Titel »Perspektiven der Vernichtung« folgendes Motto: »Eine Wahl: Das Schweigen gegen die Poesie, (...) der Tod gegen das Leben, (...) das Nichts gegen Alles.« 1953–65 entstanden dann die sogenannten »Übermalungen«, »indem ich Reprophotos alter Bilder (...) retuschierte, weiterbearbeitete, verlöschte, (...) zumalte« (1978). Rainers Form der »Aneignung als Vernichtung« (W. Hofmann) wurde anfangs als kunstfeindliche Attitüde eines Anarchisten mißverstanden, als aggressive Demonstration des philosophischen Nihilismus oder – im Falle der Kreuz-Übermalungen – als bildnerische Belege einer negativen Theologie. Rainer selbst war sich unsicher: »Vielleicht ist alles Schimäre. Bloße Einbildung eines Auslöschungswütigen, Gespinst eines Nichts-Suchers, Hirndrang eines der Formen-welt Überdrüssigen« (1978). Mit seinem Pinsel »ertränkte« Rainer den sensualistischen Formenvorrat der Malerei, um eine neue Bildsprache zu finden, die im spirituellen Gestus der Welt-abkehr und mit der Adaption mittelalterlicher Mystik bzw. ostasiatischer Meditations-lehren einen extremen Gegenpol zur Pop-Art ausbildete. Nach der »Abtötung« der sinnlich-oberflächlichen Reizebene sollte die Malerei als geistiger Akt in ihrem Schöpfer wie im Betrachter Aspekte zur Selbstfindung durch Meditation und Reflexion stimulieren. Konsequent war, daß Rainer seinen Bildersturm auch gegen sich selbst wendete. Es ist das gleiche Schwarz, mit dem er immer wieder den eigenen Körper und die eigene Physiognomie malerisch auslöschte und in dem er sich wiederfindet, wenn sich vor ihm das unterirdische Wien auftut: »Bei der Suche nach Plätzen (...) für meine Posenfotos drängte es mich immer mehr zu Fels, (...) dunklen Ecken, Kellerstiegen, Souterrainräumen, Höhlennischen. Um den Bildcharakter dieser Untergrundarchitektur zu überprüfen, ließ ich sie studienhalber aufnehmen. Beim Betrachten der Fotos sah ich mich aber sofort selbst, versteckt, als schwarzer Schemen, dunkler Schatten, drohender Riß oder grauer Schmutz.« Die Architektur erscheint durch Rainers Übermalungen zunächst renaturiert – hier ein Tunnel wie ein organischkörperliches Loch, Teil der Kanalisation, die den Stoffwechsel im »Bauch der Stadt« regelt. Der mit Ölfarbe aufgetragene »schwarze Bach« aber führt in jenen schwer zu ergründenden Bereich, den schon die Romantiker im Bild der Höhle mit dem Unterbewußten gleichsetzten. Er kann als Metapher für Rainers Kunstauffassung fungieren. Den asketischen Weg nach Innen, den er aufzeigen möchte, begleitet ein abgründiger Todessog. Um den Dingen auf den (letzten) Grund zu gehen, muß Rainer wie der Taucher, mit dem er sich früh identifizierte, die Welt und sich selbst verabschieden: »Ich (...) zeichnete sogleich mich hinein, eben als dunklen Fleck, schwarze Schlinge (...) Manchmal sogar doppelt auf dem Bild, finden viele Betrachter mich trotzdem nicht. Ich bitte Sie, mich zu erkennen oder zu erraten, denn nicht allein die Architektur ist der Inhalt dieser Arbeiten, sondern meine eigene Verwandlung und Auflösung.« Germaine Richier geboren 1902 in Grans bei Arles, gestorben 1959 in Montpellier »Ich glaube, alles muß einmal ein Ende haben. Die Dinge verblassen, werden schal, wenn sie zu lange dauern.« Ihre Skulpturen betrachtet Germain Richier als lebendige, vergängliche Wesen. Das Werk der BourdelleSchülerin ist immer auch ein Spiel mit dem Tod, das Thema des existentiellen Grunddramas ist präsent. Ihre erstaunliche Idee, daß Skulptur etwas Lebendiges ist und dadurch ebenso der Vergänglichkeit, dem Tod anheimfällt, meint weniger deren materielle Substanz – denn Richier fertigte ihre Objekte nicht aus organischem Material, sondern goß ihre Plastiken zumeist in Bronze, einem Werk-stoff, der dem klassischen Anspruch von Dauerhaftigkeit entspricht. Vielmehr sterben sie als Bilder, denn in dem Augenblick in dem sie entstanden sind, beginnen sie bereits zu verblassen und verlieren ihre überraschende Präsenz. Als sich die Künstlerin in den 40er Jahren vom Formenkanon der traditionellen Plastik löst, entwickelt sie ihre vegetabilen Figuren. Unweigerlich bildet der in den politischen und sozialen Desastern des 20. Jahrhunderts ausgelöste Verlust des Glaubens an die Menschheit, als im klassischen Sinne humanen Wesen, den Hinter-grund vor dem ihre Skulpturen entstehen. Der existentielle Nihilismus der französischen Philosophie, der ihre Zeit prägt, löscht zudem jeden Begriff einer sinnstiftenden Instanz außerhalb der individuellen menschlichen Existenz. Richiers Werk vergegenwärtigt das existentielle Grunddrama in naturhaften Formen. Ihre skulpturalen Mischwesen sind ebenso ein surrealistisches Motiv wie psychologisierendes menschliches Portrait. In ihrer Fragilität wirken ihre Skulpturen zugleich bedrohlich. Eines ihrer zentralen Werke, »Mante religieuse«, die Gottesanbete-rin, spricht über diesen Konflikt. In dem Werk, das in mehreren Versionen existiert, stößt der Betrachter auf ein seelenloses Gegenüber, auf ein entleibtes Mischwesen. In der surrealistischen Verwandlungsstrategie wird die insektenhafte Figur als seelenloses Objekt zum Gegenbild des Betrachters und so zu seinem naturhaften Alter ego. Richier faszinerte vor allem die lauernde Haltung der Gottesanbeterin, die der Skulptur den Ausdruck einer potentiellen Bewegung verleiht. Ihren Namen verdankt sie ihrer aufrechten, scheinbar betenden Haltung. Dementgegen pflegt sie eine bedrohliche Praxis: Nach dem »Liebesakt« tötet die Gottesanbeterin bei Nahrungs-mangel ihr Männchen und frißt es, ein scheinbar egozentrischer Erhaltungstrieb. Dieter Roth geboren 1930 in Hannover, gestorben 1998 in Basel »Nachdem ich gesehen hatte, daß Fäulnis und Verschimmeln fast Ornamente liefern und überraschende Veränderungen abgeben, benutzte ich nicht haltbares Material mehrere Jahre hauptsächlich.« In diesen, dem Verfall so offensichtlich preisgegebenen konzeptuellen Arbeiten betreibt Dieter Roth ein perfides Doppelspiel. Produziert er einerseits extrem stoffliche und damit materiell präsente Werke, unterläuft er andererseits deren Objekt- und Warencharakter, indem sie sich von vornherein im Zustand permanenter Auflösung befinden. Durch seinen Verfall betreibt das Werk eine kompromißlose Wirklichkeitsannäherung. Einer gefälligen Aneignung entzieht es sie sich durch sein kunstloses Material und die permanent betriebene eigene Auslöschung – diese Subversion gilt nicht zuletzt dem Kunstbetrieb: »So ist schon einmal Abstand gewonnen zu den Museen, dem ganzen Getue, den Meisterwerken.« »›Verkehrung‹ und ›Umkehrung‹«, so Uwe M. Schneede, »sind Prinzipien der Rothschen Arbeit«. In der ironischen Verwendung traditioneller Formeln der Lanschaftsmalerei etwa unterläuft Roth mit destruktiven Strategien die erhabene Landschaftsdarstellung und deren tragende Symbolik und heilt Gleiches mit Gleichem: »Ich glaube, daß ich ironisch oder aggressiv nur Formen aufgelöst habe, die ihrerseits aggressiv waren, die etablierten Formen der Klassik oder Romantik.« So bestehen einige seiner Sonnenuntergänge schlicht aus einer Salamischeibe, die etwa auf einem Blatt vor sich hinfault. Als einen zentralen und kunstlosen Werkstoff verwendet Roth Schokolade. Seine mit Schokolade überzogenen Puppen entstehen unter dem Einfluß von Hans Bell-mers monströs beweglicher Skulptur »Die Puppe« von 1935/37. Deren aggressive Erotik und triebhafte Ästhetik sind für Roth Zeichen der Auflehnung wie schöpferisches Motiv. Die seinen Schokoladenobjekten innewohnende Verdauungsmetapher, ihr kannibalischer Effekt, behauptet die Möglichkeit einer komplexen Aneignung der Wirklichkeit durch Verdauung – sei es nun im Sinne eines In-sich-Aufnehmens oder einer Auslöschung des Anderen. Roths Werk betreibt die Herstellung von Negativ-Bildern, doch anders als bei der reinen Destruktionskunst geht es ihm um den Prozeß. Das Werk nähert sich anthropologischen Bedingungen an, indem es wenigstens ebenso vergänglich sein will wie sein Betrachter, der zum Zeugen beider Verfallsprozesse wird. Thomas Ruff geboren 1958 in Zell/Schwarzwald, lebt und arbeitet in Düsseldorf Das »Zeitungsfoto 013« gehört, wie stets bei Thomas Ruff , zu einer Serie. Ruffs Arbeiten nach Zeitungsfotos sind standardisierte Vergrößerungen auf das doppelte Format, wobei Ruff die Zeitungsunterzeile wegläßt. Nach den fotografischen Interieurs und den neutralisierenden Portraitserien begann er ab 1989 in seiner Sterne-Serie, Aufnahmen anderer in seiner Arbeit zu verwenden. Die Serie der Zeitungsfotos scheint ein weiterer Schritt zur Indifferenz und Auslöschung des künstlerischen Eingriffs zu sein. Andererseits sagt Ruff 1995: »Die Zeitungsfotos habe ich seit zehn Jahren immer ausgeschnitten, weil sie mir tatsächlich aufgefallen sind. Da wird ein Fotograf losgeschickt (…) und versucht, ein möglichst gutes Bild zu machen. Aber dann wird den Fotos ihre eigene Qualität genommen, weil sie ins Raster der Zeitungsspalten und Zeilenzahlen passen müssen. (…) Und manchmal hat dann ein Zeitungsfoto trotzdem noch einen Charme, fotografische Qualitäten, für mich eben, die ich nicht verloren sehen will.« Sind die konventionellen Erwartungen an Fotografie erst einmal intensiv desillusioniert (»Eine Reproduktion ist eine Reproduktion ist eine Reproduktion«, 1996), so kann umso genauer hingeschaut werden, was ein Foto zeigt, denn selbst Zeitungsfotos haben Ausdrucksqualitäten, »wie alles auf der Welt« (1995). Im Punktraster des »Zeitungsfotos 013« läßt sich Kasimir Malewitschs »Schwarzes Kreuz« (um 1920) erkennen, eine Ikone selbstmächtiger Kunstvollkom-menheit, suprematistisches Ende aller Kunst und sinnstiftender Neuanfang zugleich. Indem Thomas Ruff einen Ausschnitt (fehlende Textzeile) aus der Zeitung zeigt, in der ein Ausschnitt aus der Fotografie abgedruckt ist, die wiederum als Ausschnitt aus einer realen Raumsituation nur das Malewitsch-Gemälde abbildet, konfrontiert er die pathetische Vision der klassischen Avantgarde mit dem desillusionierten Sehen des Künstlers am Ende des 20. Jahrhundert, ja er bringt beides zur Kongruenz innerhalb einer Bildfläche. Denn eigenartigerweise beraubt die vielfache Vermit-teltheit das ferne suprematistische Original nicht völlig seiner Aura. Daß wir eine Abbildung einer Abbildung einer Abbildung sehen, bleibt bei Ruff nicht unsichtbar. Dadurch wird in Ruffs Bild von Malewitschs Gemälde der historische und geistige Abstand zu einem Teil dessen, was wir sehen. Aufgrund der technisch bedingten Bildverschlechterung sehen wir klarer. Mathilde ter Heijne geboren 1969 in Straßburg, lebt und arbeitet in Amsterdam Ohne dich hat mein Leben keinen Sinn Ich bin eine leere Hülle ohne Dich Laß mich nur der Schatten deines Schattens sein (Francois Truffaut, La Femme d’à Côté, 1980) Ich gehe, damit du mich niemals vergißt, Mathilde (Patrice Leconte, Le Mari de la Coiffeuse, 1991) Daß die Frau in ihrer Rolle als Liebesopfer nur so lange existiert, wie sie das Objekt männlichen Begehrens bleibt, diese tragische Wahrheit haben die liebenden Heldinnen dreier französischer Filme verinnerlicht (1980 in Truffauts »La Femme d’à Côté«, 1990 in Brisseaus »Noce Blanche«, 1991 in Lecontes »Le Mari de la Coiffeuse«). Unausweichlich enden alle drei Filme mit dem Selbstmord der Geliebten, die alle »Mathilde« heißen. Mathilde ter Heijne filtert in ihrem fünfminütigen Video diese Erzählungen ihrer filmischen Namenscousinen zum Extrakt und verdichtet darin ein spezifisch weibliches Motiv des Nichts: der Verlust einer Existenzberechtigung, die sich alleine im Geliebtwerden durch einen anderen begründet. Das Motiv der sich von der Brücke in den Fluß stürzenden Mathilde nimmt sie aus Lecontes Film auf und läßt ein Doubel ihrer selbst anfertigen. Aus Abgüssen ihres Gesichtes und ihrer Hände, auf einen Puppenkörper montiert, entsteht eine Doppelgängerin, die auch die Kleidung der Künstlerin trägt. Ter Heijne delegiert die Opferrolle an ihre künstliche Stellvertreterin. Die Puppe, das entseelte Spiegelbild, wird zur Darstellerin ter Heijnes und stürzt statt ihrer über das Brückengeländer. Die romantische Idee des Wiedergängers als zweitem, spirituellen Ich verkehrt sich zum Dummy, dem man alle unangenehmen Erfahrungen überantwortet und sich ihrer damit entledigt. Der virtuelle Suizid am identischen Anderen wird in ter Heijnes Arbeit zum ironischen Krisenmanagement. In der Installation »Mathilde, Mathilde … / Ne me quitte pas« sitzt die Puppe der Künstlerin auf einem Podest neben der Videoprojektion. Ein am Boden stehender Recorder spielt den Song »Ne me quitte pas«, zu dessen Melodie die Puppe mit der Stimme der Künstlerin summt: ein abgründiges Vexierspiel zwischen Mensch und Modell. Andy Warhol geboren 1928 in Pittsburgh, gestorben 1987 in New York Nachdem sich Andy Warhol , der seine Karriere als Werbegrafiker begonnen hatte, Anfang der 1960er Jahre in der New Yorker Kunstszene etabliert hatte, liebte er es, Kritikerinterpretationen seiner Werke und seiner Person zu kommentieren und zu konterkarieren. Sein Leben fand in der konsumorientierten, latent hysterisierten Medienöffentlichkeit Amerikas statt, die er in seinen Bildern thematisierte. Der Frage, ob er mit seinen Bildern elektrischer Stühle, Autounfälle und verstorbener Filmschauspielerinnen Leere und Tod unter der Oberfläche materiellen Wohlstands zeigen wollte, hat er in seinen Antworten meistens neue Fragen hinzugefügt. 1985 schuf Warhol in einem New Yorker Nachtclub eine »unsichtbare Skulptur«, die durch eine entsprechende Hinweistafel gekennzeichnet war: Er stellte sich auf ein Podest und ging fort. »Wenn ihr alles über Andy Warhol wissen wollt, braucht ihr bloß auf die Oberfläche meiner Bilder und Filme und meiner Person zu sehen: Das bin ich. Dahinter versteckt sich nichts.« (1967) »Ich male in dieser Art, weil ich eine Maschine sein möchte, und wenn ich wie eine Maschine arbeite, spüre ich, daß ich genau das, was ich gerade mache, auch tun möchte.« (1963) Zu seiner »Todesserie«: »Ich glaube, es war das große Flugzeugabsturzfoto, die Titelseite einer Zeitung: 129 DIE (129 Tote). Zur gleichen Zeit malte ich auch die Marilyns. Ich erkannte, daß alles, was ich machte, mit dem Tod zusammenhing.« (1963) »Bevor ich angeschossen wurde, dachte ich immer, ich wäre mehr halb anwesend als ganz anwesend – ich hatte immer den Verdacht, vor dem Fernseher zu sitzen statt das Leben zu leben. Die Leute sagen manchmal, daß das, was in den Filmen passiert, unwirklich sei, aber tatsächlich ist es so, daß das, was einem im Leben passiert, unwirklich ist. Im Film sehen die Gefühle so stark und wirklich aus, wenn die Dinge einem aber tatsächlich passieren, ist es wie vor dem Fernseher – man fühlt nichts. Seit genau dem Moment, als mich der Schuß traf, war mir klar, daß ich vor dem Fernseher saß. Die Sender wechseln sich ab, aber alles ist Fernsehen.« (1975) »Ich habe nie verstanden, warum man nicht einfach verschwindet, wenn man stirbt, und alles könnte ohne Unterbrechung genauso weitergehen, wie es war, nur daß man selbst nicht mehr da wäre. Meinen eigenen Grabstein habe ich mir immer gerne unbeschriftet vorgestellt. Kein Epitaph, kein Name. Na, eigentlich wäre es schön, wenn auf meinem Grabstein ›Trugbild‹ stünde.« Lawrence Weiner geboren 1942 in New York, lebt und arbeitet in New York und Amsterdam »1. Der Künstler kann die Arbeit machen 2. Die Arbeit kann von einer anderen Person hergestellt werden 3. Die Arbeit muß nicht realisiert werden Jede dieser Lösungen ist gleichwertig und entspricht der Intention des Künstlers; die Entscheidung über den Zustand liegt beim Empfänger nach der Übernahme.« Sein frühes Statement von 1966, mit dem Lawrence Weiner auch in der von Gerd de Vries 1974 herausgegebenen Sammlung von Konzeptkunst-Texten »On Art/ Über Kunst« vertreten ist, gilt programmatisch für sein Werk. In konsequenter Weise löscht das Konzept die Idee des Originals aus. Auch wenn materielle Installationen als Wahrnehmungs- oder Vorstellungsanwei-sungen des Künstlers entstehen, ist deren wesentliches Medium Schrift und Sprache. In der Ablehnung aller konventionellen Versatzstücke aus dem »Jargon praktischer Kunst« betreibt die Konzeptkunst die Auslöschung der klassischen Autorität des Künstlers wie des Werkes. In der präzisen Gestaltung der Situation nimmt Weiner zwar die Rolle des professionellen Künstlers ein, vermeidet aber jeden Ausdruck einer künstlerischen Handschrift. Das Werk wird zur offenen Struktur: »Wenn man sich mit Sprache befaßt, dann gibt es keinen Rand, über den das Bild hinausgeht oder von dem es hinabfällt. Man hat es mit etwas vollkommen Unbegrenztem zu tun.« Im konzeptuellen Werk verkehrt sich der Text als Sekundärinformation zur Primärinformation, die sich darum bemüht, im materiellen Sinne so reizlos wie möglich zu bleiben: eine radikale Umkehrung herkömmlicher künstlerischer Repräsentation. Sprache als Vermittlungsträger ist ein Abstraktum und an sich ungegenständlich: »Sprache, weil sie die ungegenständlichste Sache ist, die wir je in dieser Welt entwickelt haben, endet nie.« Alles Inhaltliche, das nicht im Objekt materiell existent ist, ist von äußeren Umständen abhängige Konstruktion und Interpretation. Frühe Arbeiten Weiners wie »Ein Quart grüne Industrielackfarbe an eine Backsteinwand« (1971) betreiben eine völlige Transparenz der Produktion, indem Konzept und Realisation konkret zur Deckung gebracht werden. In der Folge entwickeln sich Weiners Arbeiten vom Statement zur poetischen Rezeptur. Der Ort des »Werkes« wird zum potentiellen Raum, der durch Vorstellung veränderlich ist. Unter Einfluß des Textes konstruiert die Vorstellung des Rezipienten seine Wahrnehmung dieses »offenen« Ortes, die bis hinein in die Produktion unterschiedlicher emotionaler Zuständlichkeiten reicht. Georg Winter geboren 1962 in Biberach/Riss, lebt und arbeitet in Stuttgart »Immer sehen wir nur von irgendwoher, ohne daß aber das Sehen in seine Perspektive sich einschlösse«, so hält Maurice Merleau-Ponty in seiner Phänomenologie der Wahrnehmung die Paradoxie fest, daß im Zentrum jeder Wahrnehmung Nichtwahrnehmung herrscht. Ohne den blinden Fleck gibt es kein Sehen. Während ich etwas sehe, kann ich nicht gleichzeitig sehen, daß ich sehe. Unausweichlich und gewohnheitsmäßig vergesse ich mein Wahrnehmen in jeder einzelnen Wahrnehmung. Sobald ich mich darauf konzentriere, daß ich gerade wahrnehme, habe ich den Gegenstand meiner Wahrnehmung verloren. Im Alltag wird dieses Paradox durch die allgegenwärtigen technologischen Hilfsmittel für Wahrnehmung wie Monitore, Foto- und Videokameras nicht etwa relativiert, sondern verstärkt. Das Urlaubsfoto ist ein klassischer Fall von selbstvergessenem Wahrnehmen. Georg Winter 1997: »Immer geht es nur um die fertigen Bilder. Aber im Moment des Fotografierens stellen sich doch Fragen: Wer bin ich? Wo halte ich mich auf? Mit was für Gesten? Und welche Bedingungen dem anderen gegenüber stelle ich auf, wenn ich so ein schwarzes Gerät in die Hand nehme und ihm entgegenhalte? Mich interessiert Fotografie als Handlungsform. Die Abzüge sehen wir ja nicht, während wir fotografieren. (...) Was auf den Abzügen später zu sehen ist, hält nur einen verschwindenden Bruchteil von dem fest, was beim Fotografieren als Handlung passiert, also fast gar nichts.« Georg Winter benutzt das Paradox der Wahrnehmung rückwärts. Er setzt den blinden Fleck an die Stelle des Wahrnehmungsgegenstandes. »Das Entwicklungsbüro für Kameratechnik (UCS) entwirft und baut die für Forschungszwecke benötigten Instrumente. Die Instrumente sind in der Regel aus Holz.« Statt mit einer konventionellen Kamera hantiert der Nutzer mit einem Gerät, das ihn auf seine direkte leibliche Wahrnehmungsfähigkeit zurückverweist. UCS entwickelte auch einen Monitor, dessen äußere Maße dem eines Fernsehers ähneln. Wir halten uns vor Monitoren auf in der Erwartung einer Veränderung (Reiz-Erregung). Der Ukiyo High Black Monitor ist ein reizarmer Monitor zur Bildorganisation.« Während der Nutzer vor der schwarzen Kiste sitzt, mag es in ihm zur »optimalen Frustration« (Heinz Kohut) kommen. Die Verneinung jedweder Betrachtererwartung von unterhaltender Zerstreuung in der Kunst und den Alltagsmedien frustriert ihn ausreichend, aber optimalerweise nur soweit, daß er über seinen täglichen Umgang mit Wahrnehmungsapparaten nachzudenken beginnt.