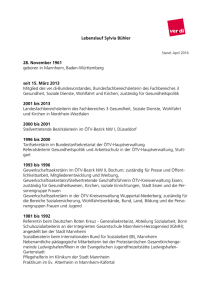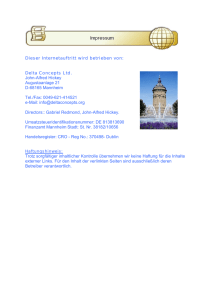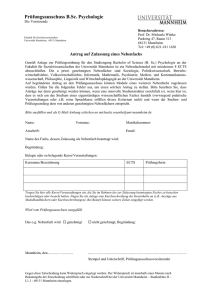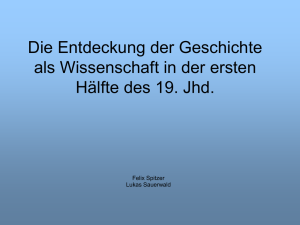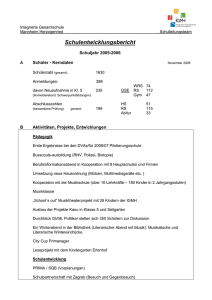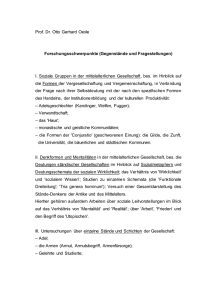Die Wissenschaften in den 20er Jahren
Werbung
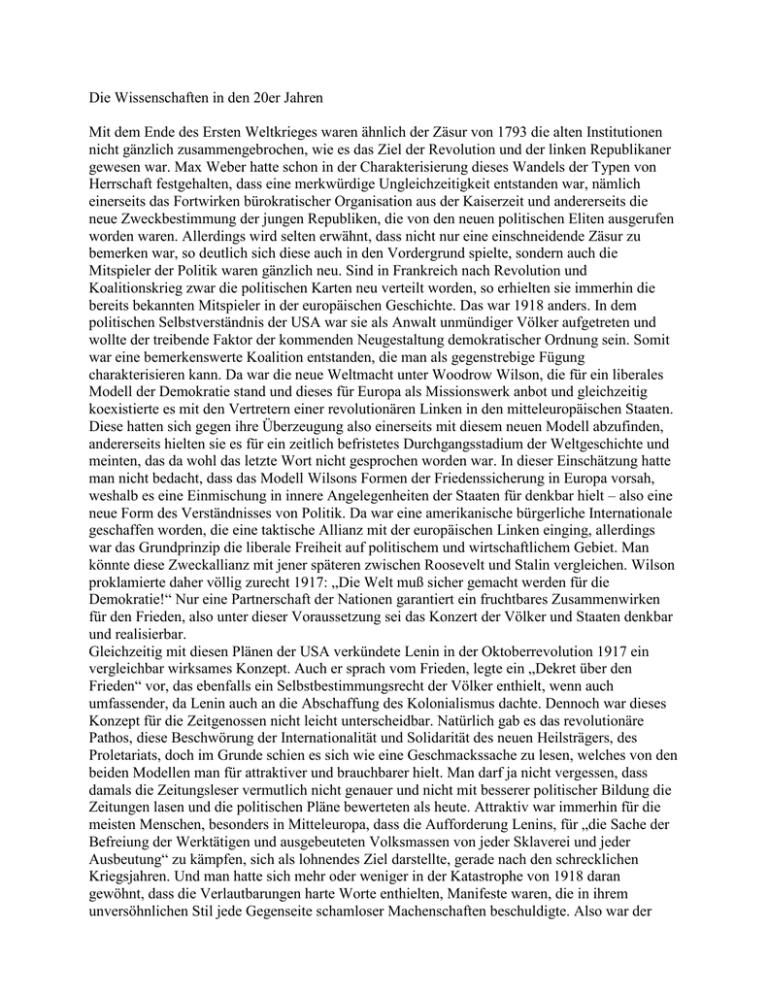
Die Wissenschaften in den 20er Jahren Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges waren ähnlich der Zäsur von 1793 die alten Institutionen nicht gänzlich zusammengebrochen, wie es das Ziel der Revolution und der linken Republikaner gewesen war. Max Weber hatte schon in der Charakterisierung dieses Wandels der Typen von Herrschaft festgehalten, dass eine merkwürdige Ungleichzeitigkeit entstanden war, nämlich einerseits das Fortwirken bürokratischer Organisation aus der Kaiserzeit und andererseits die neue Zweckbestimmung der jungen Republiken, die von den neuen politischen Eliten ausgerufen worden waren. Allerdings wird selten erwähnt, dass nicht nur eine einschneidende Zäsur zu bemerken war, so deutlich sich diese auch in den Vordergrund spielte, sondern auch die Mitspieler der Politik waren gänzlich neu. Sind in Frankreich nach Revolution und Koalitionskrieg zwar die politischen Karten neu verteilt worden, so erhielten sie immerhin die bereits bekannten Mitspieler in der europäischen Geschichte. Das war 1918 anders. In dem politischen Selbstverständnis der USA war sie als Anwalt unmündiger Völker aufgetreten und wollte der treibende Faktor der kommenden Neugestaltung demokratischer Ordnung sein. Somit war eine bemerkenswerte Koalition entstanden, die man als gegenstrebige Fügung charakterisieren kann. Da war die neue Weltmacht unter Woodrow Wilson, die für ein liberales Modell der Demokratie stand und dieses für Europa als Missionswerk anbot und gleichzeitig koexistierte es mit den Vertretern einer revolutionären Linken in den mitteleuropäischen Staaten. Diese hatten sich gegen ihre Überzeugung also einerseits mit diesem neuen Modell abzufinden, andererseits hielten sie es für ein zeitlich befristetes Durchgangsstadium der Weltgeschichte und meinten, das da wohl das letzte Wort nicht gesprochen worden war. In dieser Einschätzung hatte man nicht bedacht, dass das Modell Wilsons Formen der Friedenssicherung in Europa vorsah, weshalb es eine Einmischung in innere Angelegenheiten der Staaten für denkbar hielt – also eine neue Form des Verständnisses von Politik. Da war eine amerikanische bürgerliche Internationale geschaffen worden, die eine taktische Allianz mit der europäischen Linken einging, allerdings war das Grundprinzip die liberale Freiheit auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet. Man könnte diese Zweckallianz mit jener späteren zwischen Roosevelt und Stalin vergleichen. Wilson proklamierte daher völlig zurecht 1917: „Die Welt muß sicher gemacht werden für die Demokratie!“ Nur eine Partnerschaft der Nationen garantiert ein fruchtbares Zusammenwirken für den Frieden, also unter dieser Voraussetzung sei das Konzert der Völker und Staaten denkbar und realisierbar. Gleichzeitig mit diesen Plänen der USA verkündete Lenin in der Oktoberrevolution 1917 ein vergleichbar wirksames Konzept. Auch er sprach vom Frieden, legte ein „Dekret über den Frieden“ vor, das ebenfalls ein Selbstbestimmungsrecht der Völker enthielt, wenn auch umfassender, da Lenin auch an die Abschaffung des Kolonialismus dachte. Dennoch war dieses Konzept für die Zeitgenossen nicht leicht unterscheidbar. Natürlich gab es das revolutionäre Pathos, diese Beschwörung der Internationalität und Solidarität des neuen Heilsträgers, des Proletariats, doch im Grunde schien es sich wie eine Geschmackssache zu lesen, welches von den beiden Modellen man für attraktiver und brauchbarer hielt. Man darf ja nicht vergessen, dass damals die Zeitungsleser vermutlich nicht genauer und nicht mit besserer politischer Bildung die Zeitungen lasen und die politischen Pläne bewerteten als heute. Attraktiv war immerhin für die meisten Menschen, besonders in Mitteleuropa, dass die Aufforderung Lenins, für „die Sache der Befreiung der Werktätigen und ausgebeuteten Volksmassen von jeder Sklaverei und jeder Ausbeutung“ zu kämpfen, sich als lohnendes Ziel darstellte, gerade nach den schrecklichen Kriegsjahren. Und man hatte sich mehr oder weniger in der Katastrophe von 1918 daran gewöhnt, dass die Verlautbarungen harte Worte enthielten, Manifeste waren, die in ihrem unversöhnlichen Stil jede Gegenseite schamloser Machenschaften beschuldigte. Also war der Kampf gegen Kapitalismus und Kriegswirtschaft, gegen Imperialismus und Ausbeutung das zuständige Vokabular zur Charakterisierung der Tagesfragen. Nur wenigen war wirklich aufgefallen, dass da die Karten an neue Mitspieler in Europa verteilt wurden: an die junge Sowjetunion und an die USA. Es war gar nicht aufgefallen, dass zwei Mächte immerhin einen Geltungsbereich beanspruchten, der gleich die ganze Welt betraf – und wahrscheinlich war darin auch die Faszination dieser Pläne begründet. Da diese Pläne aber einander grundsätzlich ausschlossen, konnte man hin und wieder lesen, dass da wohl ein globaler Konflikt die Folge sein würde, eine dauerhafte Instabilität der Weltpolitik und ein latenter Grundkonflikt, der sehr schnell das konstitutive Merkmal der internationalen Beziehungen wurde. Das war nicht wirklich gleich bekannt gewesen, denn zuerst bedauerte man in Europa das je eigene Schicksal, den Zusammenbruch und die Welle einer gemeinsamen Pauperisierung. Diese Darstellung soll als Prolog gelten, denn ohne diese Bedingungen ist weder die geistige Situation dieser Zeit verständlich, noch das Einwirken der politischen Lage auf die Fortsetzung der wissenschaftlichen Forschung. Dass immerhin die Geisteswissenschaften zutiefst betroffen waren, ist nicht verwunderlich, denn schon vor 1914 waren sie in ihrer Weltanschauungsproduktion scheinbar erfolgreich, zumindest – um ein Beispiel mit Max Weber zu nennen, hatten sie sehr häufig den Katheder wie Parlamentarier gebraucht, waren also schon geübt im Wechsel der Tribünen und der politischen Analysen. Und die Tragödie des Weltkriegs ließ diesen Wechsel noch angezeigter erscheinen als vor 1914. So waren die Vorlesungen nicht nur jeweiligen Wissensgebieten gewidmet, sondern enthielten zahlreiche ausgiebige Exkurse zur Tagespolitik. Wenn also diese Staaten Mitteleuropas mit einer besonderen Belastung ihr neues Demokratie-Modell zu übernehmen hatten, vor allem Deutschland und Österreich wie auch Ungarn, dann war die Situation der Zeit geeignet, diese Katheder-Politik an den Universitäten fortzusetzen und sich gründlich einer Zeitdiagnose zu verschreiben. Dass obendrein Demokratien – oder besser gesagt – Republiken ausgerufen worden waren, die ohne Demokraten und großteils ohne Republikaner gegründet wurden, blieb eine dauerhafte Belastung, die bei diesen neuen Allianzen und neuen weltpolitischen Mitspielern in ein noch größeres Dilemma führte. Zeitdiagnose betrieben zum Beispiel Max Scheler, Ernst Troeltsch, Max Weber, Oswald Spengler, Karl Mannheim, Carl Schmitt, Georg Lukacs, Ernst Bloch, Hans Kelsen, Friedrich von Wieser, Joseph Schumpeter und andere mehr. Und da blieb es nicht bei der Debatte über Kriegsschuld und moralischer Niederlage, bei der nötigenden finanziellen Belastung durch Reparationen, bei den Debatten über die Friedensverträge, sondern insgesamt geriet die Politik in ein Klima des ungezügelten Streitens und Agierens wie Agitierens, schlechte Paten des neuen Modells von Staat und Gesellschaft, die erst jetzt jene Unterscheidung sichtbar machten, die Hegel einmal in seiner Rechtsphilosophie recht abstrakt entworfen hatte. Freilich sah die Gesellschaft naach 1918 nicht so aus, dass man sie ohne weiteres als bürgerliche hätte bezeichnen können. Knapp nach 1918 wetterte Max Weber über die „moralische Rechthaberei“ in seinem berühmten Aufsatz zum „Beruf in der Politik“ - und war da nicht der einzige geblieben. Friedrich von Wieser formulierte ähnlich: „Der Unbegreiflichkeit des Weltkriegs folgte die Unbegreiflichkeit des inneren Zerfalls. Nun war die Zeit des Handelns zu Ende und das Gemüt meldete sich zum Wort. Wie hatte das alles geschehen können? Hatte das Leben nicht seinen Sinn verloren? Waren die Mühen einer jahrhundertelangen geschichtlichen Arbeit und die unerhörten Opfer des Krieges ganz vergebens erbracht? ...in einem Artikel „Die Schuld am Frieden“ formulierte ich die Anklage, die ich gegen den Gewaltfrieden zu erheben hatte, außerdem faßte ich den Plan zu einer großen Schrift über den Weltkrieg und die Verfehlungen des Friedensschlusses und war eifrig an den Vorarbeiten hiezu tätig. Aus diesen Ansätzen ist das „Gesetz der Macht“ entstanden.“ Natürlich bemerkte man in Westeuropa, dass da eine ungeheure Gefahr im Entstehen war, denn weiterhin war man überzeugt, dass die ehemaligen Mittelmächte in dem neuen Konzert eine Schlüsselstellung einnehmen werden oder gar behalten haben. Der britische Premier Lloyd George sah in der Räterepublik Bela Kuns im März 1919 nicht nur ganz Europa vom Geist der Revolution verführt, sondern dass wohl zu erwarten sei, dass es zu einer Verständigung zwischen Deutschland und Rußland kommen werde – vermutlich sogar im Geist des Bolschewismus. Diese Diagnose bewog die USA zu einer gewaltigen finanziellen Subvention und Investition in Europa, um über eine liberale Wirtschaftsordnung die Staaten samt Demokratie zu stärken. Der Vetrag von Locarno 1925 war der Höhepunkt dieser Initiative und wirklich konnte man den Eindruck erhalten, dass es nunmehr aufwärts gehen werde. Dass sich diese Hoffnung zerschlug, ist allgemein bekannt. Der Fehler war, dass die USA nicht wirklich eine ökonomische Steuerungsfunktion übernehmen wollten und England dafür zu schwach war. Und 1929 stürzte diese Konstruktion bekanntlich ein. Der Finanzkrach war so gewaltig, dass man eigentlich von vorne hätte beginnen müssen – als wäre man wieder im Jahr 1918. Es erlaubte diese Krise an jene politischen Alternativen zu denken, die bis heute die Fundgrube für Zeithistoriker geblieben sind. Die Zeitdiagnostiker waren also wieder aufgerufen, die Lage zu beurteilen. Vermutlich ist die wichtigste von Karl Mannheim vorgelegt worden, da er in seinem Werk „Ideologie und Utopie“ davon ausgegangen war, dass nunmehr die Geschichte in eine neue und unvergleichbare Phase eingetreten ist. Auch wenn damals in einer ersten Kritik der Historiker Ernst Robert Curtius meinte, dass es sich dabei um „eine zeitbedingte Skepsis“ handle, „die zu den Konstanten der Gesistegeschichte gehört“, hatte er dennoch in der Einschätzung die Bedeutung nicht recht erfaßt. Er meinte, dass sich in „anarchíschen Epochen eine Gleichgewichtsstörung manifestiere und sei so alt wie die Weisheit des Predigers Salomo.“ Er schrieb: „Wenn man dies übersieht und in der Kulturkrisis der Gegenwart eine präzedenzlose Zäsur erblickt, so verrät das Mangel an Abstand vom betrachteten Gegenstand und Mangel an elementaren Geschichtskenntnissen. Die Behauptung, unsre Gegenwart stehe in einem Prozeß, der ohne alle Analogie sei, tritt als Ausdruck naiver, natürlicher, vorwissenschaftlicher Denkhaltung in allen Geschichtskrisen auf....Man kann die ganze Geschichte unseres Abendlandes als eine Kette solcher apokalyptischer Momente darstellen.“ Diese die Zeit beschönigende Kritik an Mannheim konnte nur von einem Historiker stammen, der offenbar das Sensorium für die Überraschungen der Geschichte eingebüßt hat. Mannheim plädierte für einen erkenntnistheoretischen Dynamismus, im Grunde variiert er die Ansicht von Auguste Comte, dass es da eben eine „Statik“ und „Dynamik“ gäbe, jedoch erfuhren sie eine Drehung oder Beschleunigung. „Es mutet ja manchmal geradzu unheimlich an, wenn in der gegenwärtigen Denk- und Seinslage gerade jene sich als höherwertig vorkommende, die irgend etwas „Absolutes“ zu besitzen angeben. Dieses Sich-Anpreisen und Sich-Empfehlen durch Absolutheiten spekuliert allzu bloß auf das Sekuritätsbedürfnis breiter Schichten, die den auf der gegenwärtigen Seinsstufe offenbar werdenden Abgrund des Lebens nicht sehen wollen.“ Daher formulierte Mannheim weiterhin: „Falsch ist es deshalb, die suchende Unruhe durch nicht mehr lebbare Absolutheiten zu verdecken, so etwa „Mythen“ zu wollen, für „Größe an und für sich“ zu schwären, „idealistisch“ zu sein und faktisch sich selbst Schritt für Schritt in bereits leicht durchschaubarer Unbewußtheit zu umgehen.“ Es ist diese Art der Soziologie, die uns den Schwund von Geist und Sittlichkeit vor Augen führt und wie eine Sollensnorm sich aufdrängt. Die Darstellung gesellschaftlicher Kräfte entspricht zwar etwa den Beobachtungen der Wiener Nationalökonomen, die da nur mehr einen Markt als institutionalisierte Vernunft beschwören konnten, aber sie sind nicht mehr durch irgend etwas gehalten, nicht mehr zurückgebunden an Recht und politische Ordnung, sondern zeigen sich im Zerbrechen rationalistischer und verhärteter Strukturen. So sieht dann diese apokalyptische Metaphysik aus, die offensichtlich die Institutionen wie Recht, Staat oder Weltbild überrundete. Wenn diese Apokalyptik zur Realität wurde, so war das Fazit so geartet, dass Hermann Heller schreiben konnte, dass dann eben „entweder nur die Verzweiflung des Historismus übrig bleibt, oder aber die Gespenster leerer, weil geschichts- und damit wirklichkeitsfremder Begriffsformen, die in falscher Analogie zur mathematisch-logischen Methode gebildet, eine höchst trügerische Sekurität und Objektivität vortäuschen.“ Diese Dualität zwischen Historismus und Formalisierung kennzeichnet auch diese Philosophie der Zwischenkriegszeit. Sie ergriff auch die historische Nationalökonomie und historische Rechtsschule. Wenn es einmal geheißen hatte, dass da zwischen der begrifflichen sowie verfahrenstechnischen Invarianz der Methodologie und der historischen Vielfalt der wissenschaftlichen Inhalte eine fruchtbare Spannung bestehe, so ist dieses Spannungsmoment in den 20er Jahren verloren gegangen. Ein Denken, das die Beziehung zwischen Dauer und Wandel nicht mehr nachvollziehen kann und damit das Gleichgewicht verlor, das dazu geeignet erschien, die Geschichte durch Logik zu widerlegen, förderte eher die Erstarrung in den Geistes- und Sozialwissenschaften, nämlich einen Hang zur Formalisierung, aus der die Wirklichkeit verabschiedet erscheint. Das war mit der formalen Soziologie versucht worden, in der Reinen Rechtslehre, im „Modellplatonismus“ der Nationalökonomie oder in einer willkürlichen Konstruktion von Scheinobjektivitäten aller Art. Umgekehrt hat ein Denken, das die Begriffsund Argumentationslogik durch radikale Faktographie und historischen Empirismus zurückdrängen will, die Geisteswissenschaften in der strukturlosen Vielfalt der Phänomene versinken lassen. So kam es zur „gespensterhaften Unwirklichkeit einer Staatslehre ohne Staat und einer Rechtswissenschaft ohne Recht“, wie Hermann Heller bemerkte. Da spinnen sich Mythen oder willkürliche Ermächtigungen aus der Wissenschaft kondensierter Gottheiten, da ist an die Geschichtswissenschaften, an die Ethnologie, Geographie und Kulturgeschichte zu erinnern, aus der Rasse, Volksgeist oder kulturelle Dominanz abgeleitet werden, auf der anderen Seite wird dem ein kruder Daten- und Faktenfetischismus entgegengehalten. Daraus sind die verschiedenen Denkstile abzuleiten. In den Sozialwissenschaften konnte man zwar da und dort historisch bleiben, aber schon ist erkennbar, dass sie es auch in anderer Form gibt, nämlich als soziale Faktographie, die sich als Kriseninterventionsprogramm versteht. Gleichzeitig sieht man auf formalistische Orientierungen, die im Grunde ihren politischen Impetus aus der „mos geometricus“ des 17. Jahrhunderts ableiteten. Diese heterogenen Forschungsorientierungen zeigen gleichzeitig eine methodische Verunsicherung an und fördern erfolgreich entgegenwirkende Orientierungen: nämlich eine Anthropologisierung und Politisierung der Geistes- und Sozialwissenschaften. Diese Anthropologisierung besitzt ihre Ursache in der Auseinandersetzung mit dem Historismus und in der Zuspitzung der Problemfelder durch den Weltkrieg. Bis in die Soziologie reicht dann die Zuwendung zur philosophischen Anthropologie, die – im Unterschied zur Wertphilosophie bei Heinrich Rickert – das Sein im Werden unterhalb der Geschichte, im Wesen der sie konstituierenden Individuen feststellen zu können glaubte. Das war von Max Scheler ausgegangen, wurde aber bei Helmut Plessner und Arnold Gehlen später konsequent fortgesetzt, um eben zu einer ethnisch-kulturethnologischen Selbstvergewisserung in der Soziologie zu gelangen. Diese Wendung motivierte auch in gewisser Weise die geisteswissenschaftlichen Faktographen. Im Soziologismus bestand ja ein ähnliches Konzept für die Konstruktion des „Durchschnittsmenschen“, des „l´homme moyen“ bei Adolphe Quetelet, womit man die Lösung für das Sein-Sollen-Problem zu finden glaubte. Es sollten ja die empirisch ermittelten statistischen Werte zugleich auch die Richtwerte für das Sollen sein. Daraus leitete man die Verbindbarkeit individueller Intention mit der mehrheitlich für moralisch und objektiv gehaltenen Disponierbarkeit ab, worauf man mittels Durkheim auch eine Weltanschauung zu errichten hoffte. Es sollte eine wissenschaftliche Weltauffassung werden, die Max Weber treffend in ihrer Scheinobjektivität entlarvte. Dennoch: Auch dort war Anthropologie angesagt, ein Dogmatismus, der hervorragend für diese Zeit der Sinnkrisen geeignet erschien. Dass dann die Volkswirtschaftslehre sich dieser Anthropologisierung anschloß, verwundert nicht mehr. Sie wollte ebenfalls eine Wissenschaft vom Menschen sein, die vor allem nach der Qualität der Menschen fragte, welche durch die jeweiligen „ökonomischen und sozialen Daseinsbedingungen herangezüchtet werden." – so Max Weber in seiner Kritik an den dogmatischen Wissenschaften. Von daher wird die Beglückung der Menschen und der Welt in greifbare Nähe gerückt, zur Besserung der Lustbilanz des Menschendaseins aufgerufen, so dass nicht mehr die realen Fragen interessieren, die Gegenwart, sondern weit mehr spekuliert wurde, wie einerseits der Mensch aussehen werde und sein solle, andererseits wie die Welt beschaffen sein solle. Das anthropologische Prinzip drückt aufs Visionäre oder Utopische und die Wissenschaften beeilten sich, dieser Gegenwartsfrage nach der Zukunft nachzugehen. Natürlich waren die konkreten Begleiterscheinungen in den 20er Jahren gut geeignet, diese Wende zu vollziehen. Da war eben Kapitalismus und dessen Krise, die Bewußtseinskrise und Sinnkrise, politische Krisen aller Art und jedes Charakters und im Grunde war eben, auch wenn es Curtius nicht glauben wollte, eine Art Zeit eingetreten, die eigentlich ohne Geschichte war oder zumindest sich vor das Problem gestellt empfand, eine Geschichte erst erfinden zu müssen. Und es war wiederum Karl Mannheim, der diese Unübersichtlichkeit dieser Gegenwart in Kategorien einzuteilen versuchte. Am historischen Beispiel der politischen Lage charakterisiert er die unversöhnlichen Strömungen und markiert sie: Zuerst den Konservativismus als wert- und strukturkonservierendes Element, den reformistischen und revolutionären Sozialismus, den politischen und hierauf ökonomische Liberalismus. Alle drei verkörperten Utopien, auch wenn sie ihre utopische Intensität nach und nach vermindern, also die Differenz zwischen Realität und Utopie einebnen. Nirgendwo ist diese Spannung besser veranschaulicht als in den revolutionär anmutenden Prozessen der modernen Malerei. Mit erstaunlicher Präzision gab Mannheim auch einen Fluchtpunkt an: Er prognostiziert einen neuen Realismus durch die Manifestation eines „amerikanischen Bewußtseins“, dessen Einkehr sich wegen des nächsten Weltkrieges allerdings verzögerte. Die Zukunft werde einer organisatorisch-technischen Wirklichkeitsbeherrschung gehören, auch wenn dieser amerikanische Pragmatismus, den etwa John Dewey verkörperte, ebenfalls ein Merkmal des Utopischen besitzt. Es ist eine pädagogische und politische Metaphysik der „One World“. Selbst wenn die Amerikanisierung noch auf sich warten ließ und die ersten Austauschprogramme dank Rockefeller-Stiftung nicht so umfassend an junge europäische Gelehrte anliefen, wie nach 1945, so war im politischen Selbstverständnis in Europa die weit dringlichere Frage, wie man sich zwischen Kommunismus und Sozialismus zu entscheiden habe, so man die Varianten des Faschismus und Nationalsozialismus nicht den Vorzug geben wollte. Diese Konstellation war gerade an den Universitäten geeignet, aus den Gelehrten Intellektuelle zu machen, wie sie Schumpeter charakterisiert hatte. Dieser schäbige Verstandesgebrauch und die Bereitschaft zu Konformitäten aller Art löste im Grunde die alte Struktur der Fakultäten auf. Die intellektuellen Eliten radikalisierten sich, wie sie sich auch dementsprechend in Zirkeln auflösten, in Sekten, Gruppen und Lebensgemeinschaften. Damit haben sie ihre Kompetenz verloren, zuvor schon ihre Verpflichtung zur objektiven Erkenntnis und schwankten somit zwischen politischem Engagement und kognitiver Distanznahme. Es wäre nun verfehlt, für dieses intellektuelle Milieu eine Politisierung anzunehmen, die etwa jener der Öffentlichkeit oder der Gesellschaft adäquat erscheint. Weiterhin gab es den apolitischen Gelehrten. Dieser sah sich innerhalb vier Funktionstypen sozialwissenschaftlicher Erkenntnis. Da gab es weiterhin das Bildungswissen im Rahmen der historischen Sozialwissenschaften, das Ausbildungs- und Dienstleistungswissen der empirischen Sozialforschung, das Aufklärungswissen im Entstehungs- und Verwertungszusammenhang und das Weltanschauungswissen politisierender Wissenschaften. Gerade der letzte Typus erfuhr seine Ausfaltung bei Vertretern kommunistischer, austromarxistischer, völkisch-nationalistischer und katholisch-ständestaatlicher Geistes- und Sozialwissenschaft. In einer bewußt eng gefaßten Analyse, die sich jetzt nicht so sehr an Einzelnen oder an Einzelheiten orientiert, auch bewußt nicht der Frage nach der Dimension dieser die Typologie stellt und daher wie eine Simplifikation erscheint, wird man zur Behauptung veranlaßt, dass für alle diese Richtungen das Dilemma entscheidend war, nämlich die Beziehung zwischen Historismus und Relativismus nicht wirklich geklärt zu haben. Eigentlich war generell eine „Soziologisierung“ eingetreten“, was unter dieser Bedingung heißen soll, dass grundsätzlich in Gebundenheiten gedacht wurde. War der Historiker in seiner Geschichtsgebundenheit gefangen, so der Soziologie in einer holistischen oder kollektivistischen Metaphysik. Es war eine Fehlinterpretation, die man sich nach der Schwächung der Individualität oder des Menschen leistete. Da war Curtius im Recht, wenn er schrieb, dass „ man das Individuum zwar nicht abschaffen könne, aber man kann es entwerten. Es soll nicht Rohstoff für das Kollektiv sein.“ Diesen soziologischen Historismus trennte eine Welt von dem ideographischen, um die Besonderheiten der gesellschaftlich-geschichtlichen Welt bemühten Historismus des 19. Jahrhunderts. Das passierte, da sich die junge Variante des Historismus sich der Veränderung wegen der Entnahme anthropologischer Implikationen nicht wirklich bewußt war. Plötzlich gab es in den Wissenschaften das sogenannte Menschenbild, aber wurde umgehend einem soziologischen Determinismus untergeordnet. In der Zwischenzeit muß man wohl oder übel die Verschärfung der Situation in Erinnerung rufen. Am Ende der 20er Jahre ist die mühsam errichtete liberale Ordnung zusammengebrochen. Neu war daran, dass gegen die Allianz liberaler und sozialistischer Kräfte sich eine andere stellte, die sich abseits von Kapitalismus und Sozialismus definierte. Während also die reformistischen und kommunistischen Flügel überzeugt waren, mit der Weltwirtschaftkrise habe der Kapitalismus ausgedient und die Umwandlung der Demokratie in eine proletarische Herrschaftsform stehe knapp bevor, stand diesen überraschend schnell eine „Bewegung“ gegenüber, die in Perversionen alle Merkmale aller anderen Gruppierungen und Parteien zu vereinen wußte. Es sollte sich der Sinnspruch Goethes als fatal erweisen, denn nun schien er anwendbar geworden zu sein, wenn er gemeint hatte, dass er Ungerechtigkeit eher ertragen könne als Unordnung. Am Horizont erschien der terroristische Maßnahmenstaat, der sich auf die Umfunktionierung der schwachen demokratischen Institutionen hervorragend spezialisierte – doch diese Geschichte ist bestens in der Erinnerung erhalten geblieben. Die Mächte, die Europa nach 1918 zu beherrschen begannen, sollten wieder hinausgedrängt werden. Das war das sozial integrierende Ziel, gegen das die Wissenschaften nicht wirklich ein Mittel mehr wußten.