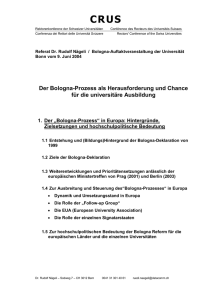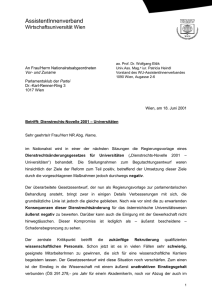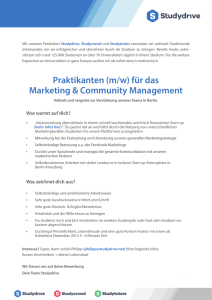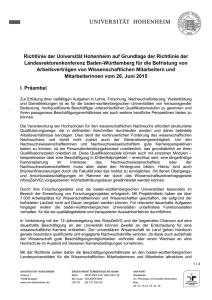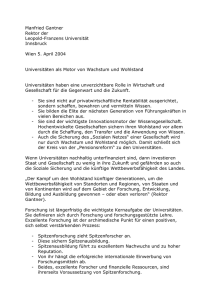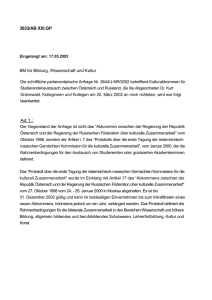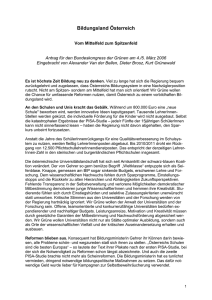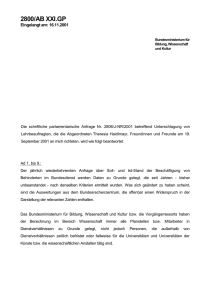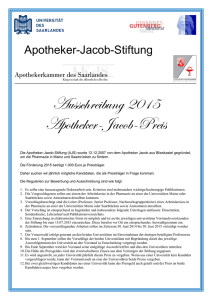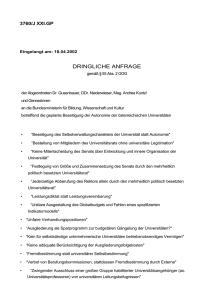"Die Idee der Universität", Universität Hildesheim, 22. Juni 2010
Werbung

Wie männlich ist die Universität? Ringvorlesung Universität Hildesheim „Die Idee der Universität“ 22. Juni 2010 „Ein Student, der nicht saufen kann, niemals! “ soll Professor Heinrich von Treitschke, einer der bedeutendsten deutschen Historiker im Kaiserreichs, bei der Beratung über die Zulassung einer Frau zum Studium an der Berliner Universität gesagt haben. Er konnte es sich schlicht nicht vorstellen, dass es weibliche Studierenden geben könne. Wie kam es zu diesem Unverständnis? Ich werde heute über die moderne Universität als Raum sprechen, in dem wissenschaftliche Erkenntnis produziert und weiter vermittelt wird. In den Geschichten der Universität wird dieser Raum überwiegend als geschlechtsneutral angesehen, denn Wissenschaft und Erkenntnis, so der aufgeklärte französische Philosoph Poulain de la Barre, „haben kein Geschlecht“. Die These meines heutigen Vortrages lautet hingegen: Wissenschaft in der modernen Gesellschaft hatte sehr wohl ein Geschlecht und dieses war in bestimmten Zeiträumen männlich. Ob es das immer noch ist, darüber lässt sich streiten, einige Indizien sprechen dafür, andere dagegen. Die Geschichte der sozialen Praxis von Wissensproduktion und Wissensvermittlung in der Universität soll in ihrer geschlechtlichlichen„Codierung“ betrachtet werden, als Gender-history, wie man heute wohl eher sagt. Mein Vortag gliedert sich in folgende Teile (Folie 2) Zur Vorgeschichte Einheit und Freiheit von Forschung und Lehre Raumverletzungen (1919-1933) Nach 1945: Veränderungen des Raumes? Raumeroberungen: Die Berliner Sommeruniversität, das Historikerinnentreffen in Bielefeld 1980, Provokationen Der Blick über den Zaun: englische Frauencolleges Geschlechterdefinitionen: Never ending oder hat die Zukunft schon begonnen? Zur Vorgeschichte 1 Die Universität des 21. Jahrhunderts hat mit der Einrichtung, die im Mittelalter unter diesem Namen gegründet wurde, vielleicht wirklich nur noch den Namen gemeinsam. Die Formen der Wissensproduktion, die Organisation der Lehre und die Praktiken der Auswahl ihrer Mitglieder haben sich in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder verändert. Nicht verändert hatte sich bis in die letzen Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, dass es sich um eine Institution handelte, die sich als eine von Männer für Männer verstand. Dieses Selbstverständnis hielt sich über enorme Veränderungen der europäischen Gesellschaft hinweg, ich nenne nur auf dem sozio-ökonomischen Sektor die Industrialisierung, die Urbanisierung, den Bevölkerungsanstieg des 19. und 20. Jahrhundert. Einige wichtige Schritte bei der Ausbildung dieses lange gültigen Selbstverständnisses, das anders ausgedrückt, nicht anderes besagt, als dass Wissenschaft eine Angelegenheit ist, die nur von Männern betrieben werden kann, werde ich skizzieren. Ich werde mich heute also nicht damit beschäftigen, wann und wie Frauen in diesen Raum der wissenschaftlichen Wissensproduktion gekommen sind, sondern, wie dieser Raum sein männlich konnotiertes Selbstverständnis entwickelte und erstaunlich lange und zäh bewahrt hat. Im Zentrum meines Vortrags steht die deutsche Universität. Ein Ausflug nach England soll das Verständnis davon vertiefen, wie mithilfe von Geschlechterkonstruktionen Räume gestaltet werden, und ein kleiner Ausblick auf die Zukunft wird uns in die USA führen. Die mittelalterlichen gelehrten Korporationen, die sich in der universitas litterarum zusammenfanden, sind unter dem Aspekt der Geschlechterordnung schnell charakterisiert: Frauen kamen in ihr so gut wie nicht vor. Wenige Ausnahmen, es handelte sich meist um Professorentöchter, die ihre Väter in der Vorlesung vertraten, bestätigen die Regel. Einheit und Freiheit von Forschung und Lehre Die Eigenschaft einer Korporation, d.h. einer Gemeinschaft derjenigen, die Forschen und Lehren und Lernen gemeinsam organisierte, behielt die moderne Universität , von der heute die Rede sein wird, bei. Wenn ich von der modernen Universität spreche, meine ich die Institution, die von Wilhelm von Humboldt und seinen Mitstreitern zu Beginn des 19. Jahrhunderts konzipiert wurde. Diese erweiterte gegenüber der alten Universität das Verständnis davon, was die Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden für Forschen, Lehren und Lernen bedeutete. Die zentrale Idee der neuen Universität von 1810 war die „Freiheit von Forschung und Lehre“. Ein Ideal, auf das bis heute gerne Bezug genommen wird, wenn es um die 2 Ausgestaltung akademischer Praxis in Forschung und Lehre geht. Sie finden es auch gelegentlich bezeichnet als „akademische Freiheit“. Was bedeutete diese „Freiheit“ für die Formen des Forschens, Lehrend und Lernens? Es bedeutet zum einen, dass die Professoren an den deutschen Hochschulen lehren und forschen konnten, was und wann sie wollten. Ein Privileg, das bis vor wenigen Jahren, nach einer kurzen Unterbrechung im Nationalsozialismus, noch gültig war. In der Bundesrepublik haben erst die neuen Besoldungsregeln, die ungefähr seit dem Jahr 2000 in allen Bundesländern eingeführt wurden, diese „Freiheit“ erheblich eingeschränkt. Zusätzlich haben die neuen Studiengänge, also, das was der Bolognaprozess genannt wird, die Einführung von Bachelor- und Masterstudium dieses Recht der Freiheit von Forschung und Lehre faktisch deutlich weiter eingeschränkt. Um 1810 bestand eine Universität aus ungefähr 200 bis 800 Mitgliedern - und damit meine ich Studenten und Professoren zusammen-, manche waren größer, manche kleiner. Auf einen Professor kamen wenige Studenten. Studenten und Professoren begriffen sich als Teil der Universität und waren gemeinsamen verbunden im Prozess der Wissensproduktion. Wissenschaft sei, so Wilhelm von Humboldt „als etwas noch nicht ganz Gefundenes und nie ganz aufzufindendes zu betrachten und unablässig sie als solche zu suchen.“ (zit. nach Jarausch 19) Das war das Neue an der Idee Humboldt, die auch unter der Bezeichnung „Neuhumanismus“ firmiert. Auch dieses Ideal wird bis heute diskutiert, verteidigt oder als für die „Massenuniversität untauglich“ beschrieben und zwar meist unter der Überschrift: “ Einheit von Lehre und Forschung“. Die mittelalterliche und frühneuzeitliche Universität hatte im 18. Jahrhundert an vielen Orten eine beispiellosen Niedergang erlebte. Sie sollte aus diesem Humboldtschen Geist erneuert werden. Das bedeutete gegenüber älteren Strukturen der Universität, dass einer neuer Begriff von Wissenschaft, der Wissensproduktion als Teil des Lehrens und Forschens verstand entstand. Durch diesen dynamischen Wissenschaftsbegriff wandelte sich auch der Sinn des Studiums. In der Idee jedenfalls ging es nun nicht mehr um den Erwerb von Berufswissen sondern um die Suche nach der philosophischen Wahrheit, „Die Universität wird zu einer Stäte, die dem jungen Menschen die Möglichkeit bietet, die reine Wissenschaft aus sich heraus zu entwickeln und sich in seiner reinen Menschlichkeit darzustellen.“ Humboldts Ideal und das seiner Mitstreiter Hegel, Schleiermacher, Fichte verlangte eine idealistische Auffassung des Studienzwecks und eine Bereitschaft zur innerweltlichen Askese, mit dem höchsten Ziel der Entwicklung der intellektuellen Fähigkeiten. Für eine Minderheit der Studierenden war diese Doppelaufgabe der Berufsausbildung und der Selbstbildung durch das 3 Studium eine große Herausforderung und schuf eine neue Ethik der Selbstvervollkommnung, Die Mehrheit der Studenten aber suchte weiterhin eine Berufsausbildung an der Universität und dieser Anspruch wurde zum Problem. Für diese Studenten hatte der Neuhumanismus kein Konzept. Die Gestaltung des Studentenlebens wurde überhaupt nicht thematisiert, und die wichtigste Lebensform der deutschen Studenten um die Wende zum 19. Jahrhundert, die im 18. Jahrhudert entstandenen Korporationen stand in keinerlei Verhältnis zu diesem neuen Wissenschafts- und Bildungskonzept. (Folie 3) Um was handelte es sich bei diesen Korporationen? In der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Universität gab es die studentische Verbindungsform der Landmannschaft. Ursprünglich bedeutete sie, dass junge Männer, die aus der gleichen Region kamen, sich am Studienort in einer geselligen Verbindung zusammenfanden. (Faktisch gibt es das heute auch noch, was in meiner Göttinger Studienzeit die Lipper waren, das waren in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Universität die Landsmanschaften Saxonia oder Lunaburgia. An diese Verbindungen knüpften die modernen Burschenschaften des 19. Jahrhunderts an. Der Universitätshistoriker Konrad Jarausch hat sie als die „erste moderne Jugendbewegung der deutschen Geschichte“ bezeichnet. Der konkrete Anlass der Gründung der Burschenschaften waren die nationale Begeisterung der antinapleonischen Befreiungskriege 1813/14, in denen in Halle und Breslau und in anderen norddeutschen Universitäten ca. 1000 Studenten freiwillig zu den Fahnen strömten. In ihrem hochgespannten Selbstverständnis als Führungsgruppe des Vaterlandes manifestierte sich das Bildungsideal eben jenes Neuhumanismus, der auch die Universitätsreform nach 1800 prägte. Das studentische Engagement wurde aber nach dem Sieg über Napoleon nicht gewürdigt, im Gegenteil, die restaurative Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress von 1815führte zu einer Verfolgung der bürgerlich-nationalen Studenten. (Folie 4) Beim Wartburgfest1817 demonstrierten diese Studenten gegen die Feudalherrschaft, für die nationale Einheit. Diese Intentionen gingen Hand in Hand mit Antisemitismus, antifranzösischer Einstellung und einer deutschtümelnden Subkultur, die sich etwa in der sogenannten Deutschen Tracht der Urburschen Ihren Ausdruck fand (Folie 5). Frankreich und die französische Sprache galten als weibisch. Nach der bürgerlichen Revolution von 1830 kam es zum Verbot der der Burschenschaften. Dennoch bildeten sich 1837 bereits wieder erste neue Burschenschaften. Wie so viele andere Gruppierungen und Organisationen im Laufe des 19. Jahrhunderts (etwa die Turner) entwickelten sich die liberalen Burschenschaften des Vormärz, also der 1840er Jahre nach 1870 im neu gegründeten Deutschen Reich zu einer Organisation, die treu und 4 fest hinter dem neuen Staate stand. Der romantische Burschenschaftler in altdeutscher Tracht (Folie 5)wandelte sich innerhalb eines halbes Jahrhundert in den flotten Korpsstudenten zum farbentragenden Korpsstudent mit Wichs und Säbel und mit Schmissen im Gesicht. (Folie 7) Die Gründe dafür liegen, so hat der bereits einmal zitierte Historiker Jarausch überzeugend herausgearbeitet, in der Organisation der deutschen Universität selbst. Obwohl die Korporationen lange Zeit rechtlich nicht anerkannt, setzt sich der Anspruch „Frei ist der Bursch“ durch. Dieser Anspruch bedeutete, dass sich die Lernfreiheit und Lebensfreiheit als Gewohnheit herausbildete. Das hing zum einen mit der bereits erwähnten sozialen Lücke im Konzept der modernen deutschen Universität, entstanden durch die Kluft zwischen ihren hehren Zielen der Einheit von Forschung und Lehre, in dem sich nur wenige wiederfanden und den Interessen der Mehrheit der Studenten, Söhne der Oberschicht, die eine Berufsausbildung suchten. Vor allen in der Philosophischen Fakultät stand es den Studenten frei, sich ein Studienprogramm selbst auszuwählen, sozusagen als Gegenstück zur akademischen Freiheit der Professoren. Diese studentische Freiheit wurde als „absolute Notwendigkeit“ von den Professoren angesehen, denn „Wissenschaft kann nur gedeihen in der vollen Freiheit, in der absoluten Schrankenlosigkeit des Gedankens.“ Für viele männliche Jugendliche von 18/19 Jahren bedeutete diese Freiheit erst einmal Freiheit vom Lernen, Freiheit zur Verdummung. Nur heroisches Büffeln vor den Examina, die dann den Übergang in die gut bezahlten sozial hoch angesehen Berufen garantierte, konnte den formalen Studienerfolg garantieren. Die akademische Freiheit artete in Trunksucht und geschlechtliche Ausschweifungen aus. Der Trinkzwang in den Korporationen führte zu Schuldenmachen. Die Duellwut, die den Ehrbegriff veräußerlichende Kraftmeierei der Satisfaktionsfähigkeit gehörte zu den weiteren Erscheinungsformen des studentischen Lebens im Kaiserreich. Die hierarchische Unterordnung der jüngeren unter die älteren galten als Mittel zur Charaktererziehung: (Aufnahmeritual: „Aufnahme ins Corps“ Folie 7) Mit welchen Ritualen wurde diese Charaktererziehung erreicht: 1. Durch den Korpskonvent: „Sie dienen freiwillig um in Zukunft herrschen zu können.“ 2. Durch die Bestimmungsmensur, die Mut und Selbstdisziplin erprobte. Eine mit starkem Schutzapparat gefochtene Partie, bis durch einen blutenden Schmiss die Courage der Kontrahenten bewiesen war. Sie wurde von allen neu in die Verbindung eingetretenen Füchsen verlangt. (Folie 8 Mensur) 5 3. Das letzte Erziehungsinstrument war der Trinkzwang, der das Nachtrinken der Füchse bei offiziellen Kneipen verlangte, um der zukünftigen Elite eine gewisse äußere Form und Haltung währen des Alkoholexzesses beizubringen. Während in den großen Stadtuniversitäten wie Berlin und München nur ungefähr ein Viertel aller Studenten Mitglied in einer studentischen Verbindung waren, lag der Organisationgrad in mittleren Universitätsstädten bei zwei Fünfteln und in kleineren wie Marburg sogar bei der Hälfte aller Studenten. Die scheinbar apolitischen Corps (die mensurschlagenden Gruppen) waren die führende Organisation innerhalb der Studentenschaft. Sie bildeten die härteste Variante des studentischen Korporationswesens im Kaiserreich, daneben gab es die Burschenschaften betonten, die stärker den nationalen Charakter betonten, aber auch sie übernahmen im Jahre 1883 die Bestimmungsmensur. Gleiches gilt für die ursprünglich „nichtschlagenden“, also nicht fechtenden Korporationen, Landsmannschaften und Turnerschaften, Sängerschaften. D.h. also die stramme Haltung und „vornehmen“ Umgangsformen der Corps wurden so oft nachgeahmt, dass ein regelrechter Korporationisierungsprozeß stattfand. LoseVereine verwandelten sich in festere farbentragende Verbindungen und diese wiederum in elitäre Waffenkorporationen. Es war offensichtlich so, dass eine Verbindungsmitgliedschaft einen hohen sozialen Mehrwert hatte. Denn eine Analyse der sozialen Zusammensetzung der studentischen Verbindungen ergibt, dass nur ein Teil der schlagenden Verbindungen deutlich elitärer waren als die Nichtverbindungsmitglieder, während die Mehrheit der Verbindungen und studentischen Vereine sich aus sozial bescheideneren Verhältnissen rekrutierte und eher von Aufstiegsambitionen motiviert war. Warum beschrieb ich dies alles so ausführlich. Die Korporationen standen im Kaiserreich für die studentische Kultur. Gekennzeichnet waren alle diese Korporationen durch einen merkwürdigen Ehrbegriff: Beleidigungen wurden aufs schärfste geahndet und führten zu brutalen Zweikämpfen der „Mensur“. Moralisch zweifelhaftes Benehmen wie Schuldenmachen und sexuelle Eskapaden wurden hingegen bagatellisiert. Es handelt es sich soziologisch gesprochen um Männerbünde, in denen Frauen als Mitglieder schlicht nicht vorstellbar waren. Wie lebten diese Studenten: finanziert wurden sie durch ihre Herkunftsfamilien, sie verließen das Elternhaus und mieteten autonom eine „Bude“. Auch dies war Teil der akademischen 6 Freiheit und auch dieser Teil der akademischen Lebensform war für die Schwestern dieser jungen Männer, junge Mädchen aus bürgerlichen Elternhäusern, nicht vorstellbar. Zusammenfassend lässt sich festhalten: die studentische Leitkultur an den zwanzig deutschen Universitäten im Kaiserreich war männlich, antisemitisch, apolitisch und verstand sich als sozial exklusiv. Insgesamt alles schlechte Voraussetzungen dafür, dass es so etwas geben könne wie eine „Studentin“. In diesem Zusammenhang steht der angebliche Ausspruch, der Heinrich von Treitschkes, einer der bedeutendsten deutschen Historiker im Kaiserreichs, zuschrieben wird: „Ein Student, der nicht saufen kann, niemals! “ Überliefert ist der Ausspruch nur weil er anlässlich der Zulassungsgesuch einer prominenten Frau gefallen sein soll. Es handelte sich um Hildegard Wegschneider, die als eine der ersten Abiturienten 1895 an der Berliner Universität ein Studium aufnehmen wollte. Wegschneider war später SPDAbgeordnete und Oberschulrätin in Berlin (1871- 1953). Raumverletzungen (1919-1933) . Bereits zu Beginn der Weimarer Republik machte die Hochschulpolitik eine entscheidende Wandlung durch. Der Freistudentenschaft gelang es, eine Vertretung der Studenten unabhängig von den Korporationen zu etablieren, die Verfasste Studentenschaft. Es bildeten sich die ersten Allgemeinen Studentenausschüsse (AStA) und ihr Dachverband, die Deutsche Studentenschaft. Die Korporationen entwickelten zur gleichen Zeit eine extrem restaurative Tendenz und gehörten mit zu den schärfsten Gegnern der Zulassung von Frauen zum Studium. Die schlagenden Verbindungen schlossen sich zur Durchsetzung ihrer Interessen in den neuen Gremien an den einzelnen Hochschulorten zu so genannten Waffenringen zusammen, die als Dachverband den Allgemeinen Deutschen Waffenring gründeten. In den letzten Jahren der Weimarer Republik erlebten die Korporationen den Höhepunkt ihrer Geschichte: Etwa 80% der männlichen Studierenden an den deutschen Universitäten waren korporiert. Davon gehörten wiederum 50 Prozent zu den schlagenden Verbindungen. Einzig und allein eine Minderheit von katholischen, jüdischen und demokratischen studentischen Verbindungen war NS-feindlich eingestellt. Wie sehr der Raum der Universität, trotz des Anstiegs des Anteil von Studentinnen an der Gesamtstudierendenzahl auf fast 20 % im Verlauf der Weimarer Republik männlich definiert wurde, drückt sich anschaulich und eindrucksvoll in einem Beschluss der in der Deutschen Studentenschaft von 1929 aus. Dieser Zusammenschluss der Allgemeinen 7 Studentenausschüsse beschloss, den Studentinnen das passive Wahlrecht für die Gremien der Universität abzuerkennen. Wie bedrohlich gleichzeitig das Eindringen empfunden wurde, zeigt folgendes Zitat aus einem Vortrag mit dem Thema „Die Erneuerung des studentischen Hauses“, den der Dresdner Philosophieprofessor AlfredBäumler auf der Vertretertagung des Hochschulrings deutscher Art im Oktober 1930 hielt: „Es gibt nicht eine Stelle, wo Männer neben Mann steht, wo Männer zusammenkommen, die jungen mit den jungen, oder die jungen mit den älteren zu keinem andern Zweck, als weil es so sein muss.“ (S. 38) . Hier wird die Geschlechterfrage zur Raumfrage: nicht nur die von Siegermächten des 1. Weltkrieges durchgesetzte Begrenzung des Militärs in der Weimarer Republik reduzierte in der deutschen Nachkriegsgesellschaft männlich definierte Räume sondern auch die Zunahme von Frauen an den Universitäten bedrohte exklusive Räume für Männer. Und wie sah es mit dem männlich geprägten Raum der Universität auf der Seite der Professoren aus? Nachdem seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts Frauen in immer größerer Zahl ein Studium aufgenommen hatten, wäre es nur folgerichtig gewesen, sie hätten sich nun auch als Lehrende an der Universität etabliert. Es gibt aber einige Gründe, warum dies nicht umstandslos der Fall der war. Die organisierten Frauen der Frauenbewegung, die sich für die Öffnung der Universitäten stark gemacht hatten, hatten eine anderes Ziel vor Augen als die Etablierung eines weiblichen Lehrkörpers an den Universitäten und stellten insofern keine große Bedrohung für die Professorenschaft dar: sie verfolgten eine wissenschaftlich qualifizierte Berufsausbildung für Frauen, also ein „Brotstudium“, wie die Professoren es im 19. Jahrhundert genannte hätten. Für diese ersten studierenden Frauen, deren akademisches Berufsziel Ärztin, Rechtsanwältin, Sozialbeamtin oder Studienrätin, also Lehrerinnen an höheren Schulen war und die damit ihren Lebensunterhalt verdienen wollten, war die Hochschullehrerlaufbahn aufgrund der langen Ausbildungszeiten ohne Einkommen insofern ein unattraktive Perspektive. Aber der Wissendrang machte vor dem Geschlecht nicht Halt. Und es gab einige wenige Frauen, die in den zwanziger Jahren diesen Weg in die Wissenschaft aufnahmen. Eine von ihnen war Emmy Noether, Mathematikerin in Göttingen. (Folie 9) 1915 stellte sie an die mathematisch-naturwissenschaftliche Abteilung der Universität Göttingen ein Gesuch, in dem darum bat, in ihrem Fall eine Ausnahme von der Bestimmung, dass Frauen nicht habilitiert werden können, zu machen. Die Fakultät reichte den Antrag an das Ministerium in Hannover weiter. Fräulein Dr. Noether käme für eine solche Ausnahme infrage, „weil ihre schöpferischen Leistungen sehr viel besser seien als die der bisher in 8 Göttingen zugelassenen Privatdozenten im Fach Mathematik“ und sie nähme auch niemandem eine Stelle weg. Die Fakultät weist auch darauf hin, dass angesichts der durch den Krieg entstandenen Neubewertung der Wissenschaft man sich eine so außerordentliche Begabung wie Emmy Noether sichern müsse. Es fehlte in dem Antrag an den Minister auch nicht Hinweis auf die angenehmen Charaktereigenschaften der Kandidatin. Aufgewachsen in einem Gelehrtenhause, sei sie „eine eifrige, stille Arbeiterin“, man könne ausschließen, dass sie in „unliebsamer Weise“ hervortreten werde.- Innerhalb der Fakultät war dieser Antrag in einer Kampfabstimmung zustande gekommen (11:7) Die Gegenargumente interessieren uns hier: Die wissenschaftliche Höhe der deutschen Universität würden durch die fortschreitenden Verweiblichung zweifellos sinken. Die bisher ausschließlich Männern vorbehaltenen Positionen mit zumindest inneruniversitären Macht- und Entscheidungsbefugnissen, wie das Ordinariat, die Mitgliedschaft in der Fakultät und im Senat seien mit der Habilitation von Frauen ebenfalls betroffen. Der Antrag wurde vom Ministerium zunächst abgelehnt aber nach 1919 wurde das Habilitationsverbot für Frauen aufgehoben und 1922 wurde E. Noether habilitiert. Heute trägt ein sehr renommiertes Nachwuchswissenschaftlerstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft ihren Namen. An den grundsätzlichen Bedenken der Professoren änderte sich jedoch nicht viel. Bis zum Jahre 1933 wurden im deutschen Reich 22 Frauen habilitiert. Noch zwanzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in der damaligen Bundesrepublik nur rund zweihundert weibliche Lehrkräfte mit Habilitation gegenüber beinahe neuntausend männlichen. Aber damit greife ich vor. Nach 1945: Veränderungen des Raumes? Zurück zu den Studenten und dem Raum der Universität: Das Korporationswesen der deutschen Studentenschaft war nach dem 2. Weltkrieg nicht vollkommen diskreditiert. Insgesamt kann man jedoch sagen, dass Verbindungsstudenten nicht mehr das Bild der Universitäten prägten. Dennoch: Hans Angers Bericht über eine Umfrage unter Professoren und Dozenten im Jahre 1958 dokumentiert, dass der Raum, in dem Wissenschaft betrieben wurde, gelehrt und geforscht und gelernt wurde, nach wie vor ein Raum von Männern für Männer war. Die Toleranz gegenüber weiblichen Studierenden war gering. Ein Beispiel für die – typische – zunächst tolerant sich gebende, dann aber schnell in 9 Ablehnung umschlagende Beurteilung der Studentinnenzahl. Auf die Frage, ob es zu viele oder zu wenige Studentinnen gebe, antwortet ein Naturwissenschaftler: „Das regelt sich ganz von selbst. Es sind weder zu viel noch zu wenig. – Wieviele gibt es denn überhaupt? Was sagen Sie? 20 Prozent? Doch so viele? Das ist ja schrecklich! Aber die heiraten ja doch wieder weg. Sie sind nur eine unnütze Belastung der Universität.“ Besonders deutlich wird die Geschlechterkonnotation von Wissenschaft jedoch bei den Fragen nach dem Grund der Seltenheit weiblicher Hochschullehrer: „Ich sage es sehr knapp und klar. Der Frau liegt das Auftreten auf dem Katheder nicht. Das ist ein sekundäres Geschlechtsmerkmal. Sie k a n n nicht öffentlich auf dem Katheder auftreten.“ „Weil zu einem Hochschullehrer die ganze Fülle einer männlichen Begabung gehört…“ „Qualitätsfrage. Geistigkeit ist ein Privileg der Männer. Wenn eine Frau Geistigkeit in gleichem Ausmaße besitzt, dann fehlt ihr etwas anderes. S i e i s t d a n n k e i n e F r a u m e h r !” Universität ist Männersache. Die geistig arbeitende Frau verfehlt die schöpferische Absicht…“ „Früher war ein Professor etwas ganz Hohes. Die Distanz hat sich gemindert… So kommen auch Frauen schon auf die verrückte Idee, Hochschullehrer zu werden. – Es gibt aber auch gute Frauen.“ Gefragt wurde nach einer möglichen Begründung für die Seltenheit von Frauen im Lehrkörper. Die Mehrzahl der Antworten e r k l ä r e n nicht etwa die S e l t e n h e i t, sondern sie b e h a u p t e n die U n m ö g l i c h k e i t weiblicher Hochschullehrer. Das dem entgegenstehende Faktum, dass es Hochschullehrerinnen gibt und dass man selbst, wenn man eine kennt – was selten ist – über diese meist günstig urteilt, wird mit der vorher behaupteten Unmöglichkeit vereinbar gemacht durch die ebenso apriorische Erklärung, dergleichen sei „keine Frau mehr“ oder „höchstens biologisch als Frau anzusprechen“. Dasselbe gilt von den Meinungen über die Studentinnen. Da Frauen prinzipiell ungeistig sind, da ihnen von Natur aus wissenschaftliche Arbeit nicht möglich ist, kann es eigentlich keine erfolgreichen, noch nicht einmal normal das Studium durchschreitenden Frauen geben. Das wird im grundsätzlichen Teil der Antworten durchweg behauptet. Gerade in der Frauenfrage war in DDR ja bekanntermaßen vieles anders. 10 Der Universitätsraum in der DDR Frauen öffnete sich für Frauen stärker als der der BRD, vor allem erforderte der Mangels an akademisch qualifizierten Arbeitskräften in den sechziger Jahren eine große Qualifizierungskampagne unter Frauen. In den achtziger Jahren flaute diese Bewegung deutlich ab. Bis 1990 jedenfalls blieb deshalb die männliche Dominanz in den Universitäten und technischen Hochschulen auch in der DDR ungebrochen. Raumeroberungen Wie wurde der männliche Raum, der in der BRD durch die Professorenschaft in den späten fünfziger Jahren noch so deutlich verteidigt wurde, aufgebrochen: Es kamen mehrere Faktoren zusammen: 1. Quantitative Zunahme von Studentinnen in den siebziger und achtziger Jahren, ein Trend, der sich durch den stetig wachsende Bildungsbeteiligung von Mädchen im Allgemeinbildenden Schulwesen der Bundesrepublik seit den fünfziger Jahren bereits angekündigt hatte. Auch die neue Frauenbewegung hatte einen wichtigen Aktionsschwerpunkt in der Universität. Sie stellte in ihren Anfängen nicht mehr „Chancengleichheit“ für Frauen, sondern sie forderte den Frauen eine Stimme in der Wissenschaft: Ein Beispiel aus vielen war die Berliner Sommeruniversität 1976 (Folie 10), in der Frauen sich das recht herausnahmen, ihre Fragen mithilfe wissenschaftlicher Erkenntnismethoden zu beantworten. Das heißt, die Studentinnen und Assistentinnen, die in den siebziger Jahren die Frauenbewegung mit begründeten, hatten erkannt, dass es das Selbstverständnis der Universität selbst war, dass unabhängig von Geschlecht Wissen produziert werde, was sie von dieser Wissensproduktion ausschloss. Und sie forderten nun für sich Räume, in denen sie selbst Wissen produzieren konnten. Das bringt mich dazu, den angekündigten „Blick über den Zaun“ nach England zu werfen. und mich dem Thema Frauencolleges zuzuwenden. Die Frauencolleges von Oxford und Cambridge „ ...als ich an einem wundervollen Sommertag den stolzen Bau von Girton zum erstenmal auf dem satten Grün der weiten Rasenplätze vor mir sah, als ich mir sagte, daß das eine Schöpfung aus freier Initiative der englischen Frauen sei, denen Männer großherzig und mit 11 warmem Interesse ihre Hilfe geboten hatten, da habe ich aufrichtige Bewunderung empfunden. Der gleiche Eindruck wiederholte sich in Newnham College. … Beide Colleges boten je hundert Studentinnen etwa ein behagliches Heim; [...] die vollkommene Selbstsicherheit, mit der alle äußeren und inneren Angelegenheiten von den Frauen selbst nach den ihnen gemäßen Prinzipien geordnet wurden, die freundliche, ohne jede protegierende Überlegenheit gebotene Hilfsbereitschaft der Männer, […] waren so verschieden von dem, was ich zu Hause erlebt hatte, daß ich oft ein bitteres Gefühl nicht unterdrücken konnte“.1 So schwärmte Helene Lange, eine deutsche Pionierin der höheren Mädchenbildung und Kämpferin für die Zulassung von Frauen zum Universitätsstudium, in ihren Lebenserinnerungen von ihrem Besuch in Cambridge 1889. Die englischen Traditionsuniversitäten setzten sich aus Colleges zusammen, in denen Lehrende und Lernende zusammen lebten. Deshalb erlaubten sie die Gründung von reinen Frauencolleges, in denen sich Frauen auf die Universitätsexamina vorbereiten konnten und boten somit Frauen größere Spielräume zur Eigeninitiative. Zwar dauerte es bis zur vollständigen Anerkennung durch die Universität im Falle von Oxford bis 1922, im Fall von Cambridge gar bis 1948, das heißt, dass die Exklusivität dieser Universitäten nicht nur klassengebunden, sondern auch geschlechtsgebunden war. Die Präsenz von Frauen in den exklusiven Rängen des Bildungssystems, selbst wenn es sich nur um eine sehr kleine Gruppe handelte und ihr die vollen akademischen Rechte lange Zeit vorenthalten wurden, besaß jedoch für den Kampf der Frauen um den Zugang zum Studium einen hohen symbolischen Wert. Die Nachteile des englischen Systems, das in hohem Maß auf Stiftungen und Schenkungen angewiesen war, trafen die Frauen ungleich härter als die Männer, was man auch an der chronischen Unterfinanzierung aller Frauencolleges sehen kann. An beiden Universitäten wurde die Idee der Geschlechtertrennung bis in die späten siebziger Jahre für selbstverständlich gehalten. Als die Chemikerin Dorothy Hodgkin 1964 als dritte Frau den Nobelpreis erhalten hatte und der die Welt wichtige Entdeckungen zur Protein- und Insulinstruktur verdankt, stellte einer der Gratulatoren fest, dass es in Oxford nur drei Männercolleges gab, in denen man sie als Gast zum Abendessen empfangen würde. Hodgkins hatte in einem der beiden Frauencolleges von Oxford studiert und war dort auch seit 1936 als research fellow bis 1977 tätig gewesen. Hodgkins standen also Frauenräume zur Verfügung, in denen sie wissenschaftlich arbeiten konnte, Räume. Räume, die es in dieser Form in den deutschen Forschungsuniversitäten nie gegeben hat. Eine etwas andere Geschichte ist die der 1 Lange, Helene: Lebenserinnerungen, Berlin 192, S. 162f. 12 Universitätsneugründungen im 19. Jahrhundert. Soviel sei nur gesagt, in den meisten von ihnen waren Studentinnen von Anfang an zugelassen. Die englischen Universitäten, alte wie neue, boten durch also Frauencolleges bis nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb der Universität Karrierechancen für Frauen, für die es in Deutschland kein Äquivalent gab. Schlaglicht: Never endig Und heute bei uns? Die Deutsche Forschungsgemeinschaft vergibt als wichtigsten Nachwuchspreis den Hans-Maier-Leibniz-Preis. In diesem Jahr ging er an folgend Personen: Bild Was schreibt das DFG Magazin „Forschung“ 2009 dazu. (Folie 12) „Dass unter den sechs Preisträgerinnen und Preisträgern mehr Frauen als Männer waren, stellte übrigens eine Premiere dar in mehr als 30 Jahren Preisgeschichte. Ein Ergebnis gewollter Frauenförderung war dies nicht, wie Luise Schorn-Schütte versicherte. Ein weiterer Grund zur Freude aber war es allemal an diesem Tag der in vielfacher Hinsicht freudig verlief.“ Erstaunlich ist an diesem Text der Satz, den die Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft als Kommentar zur „Premiere“ abgegeben hat: Ein Ergebnis gewollter Frauenförderung war dies nicht, wie Luise Schorn-Schütte versicherte. Die Illusion, dass der Raum der Wissenschaft geschlechtsneutral ist, muss offensichtlich immer noch aufrecht erhalten werden. Mein Thema ist es nicht, Sie mit den Fördermaßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern an deutschen Universitäten bekannt zu machen, die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat dazu in den letzten Jahren zahlreiche Programme und Richtlinien entwickelt, die auf ihrer homepage zu besichtigen sind. Lieber werfe ich noch einen Blick in die Zukunft. (Folie 13) Einer Veröffentlichung aus den USA entnehme ich folgende Daten: Frauen erlangen in den Vereinigten Staaten von Amerika fast 60% aller Bachelor-Abschlüsse, 60% der MasterAbschlüsse, die Hälfte aller juristischen und medizinischen Abschlüsse und 42 Prozent aller wirtschaftswissenschaftlichen Abschlüsse (Master oft Business Administration). Angesichts der Struktur des amerikanischen Universitätswesens insgesamt ist es besonders aufschlussreich, sich bestimmte Gruppen von Universitäten anzusehen, die noch am ehesten 13 mit den deutschen oder englischen in Bezug auf ihre Zielsetzung, die Qualität von Forschung und Lehre und auf die entsprechenden Auswahlkriterien vergleichbar sind: Der sogenannte student gender gap, d.h. , die Tatsache, dass mehr Frauen als Männer zugelassen werden, erreichte die wenig angesehenen Community Colleges bereits in den achtziger und neunziger Jahren, seit ca. 5 Jahren wird er aber auch in den renommierten großen Staatsuniversitäten verzeichnet. Lange Zeit hatte es den Anschein, dass sich nur in den privaten EliteUniversitäten kein gender gap auftat. Der Anschein trog. Die privaten Universitäten können ihre Zulassungsquoten selbst bestimmen und 2003 stellten zwei Ökonomen fest, dass männliche Bewerber bei einer Bewerbung an diesen Colleges eine 5-10% höhere Chance haben, genommen zu werden als weibliche. Nun hat die US Commission of Civil Rights beantragt, zu untersuchen, ob Privatuniversitäten in ihrer Zulassungsverfahren diskriminieren um eine angemessene Geschlechterbalance zu erhalten.“ Wird die Zukunft der Universität weiblich sein? Referenzliteratur: Jarausch, Konrad H.: Deutsche Studenten 1800-1970, Frankfurt a.M. 1984 Mazòn, Patrizia M.: Gender and the Modern Research University. The Admission of Women to German Higher Education 1865-1914, Stanford California 2003 Maurer, Trude: Der Weg an die Universität. Höhere Frauenstudien vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert, Göttingen 2010 http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/07/the-end-of-men/8135/, zuletzt besucht 20. Juli 2010 http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/chancengleichheit/index.html, zuletzt besucht 20. Juli 1010 14