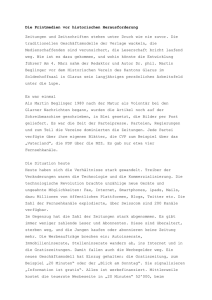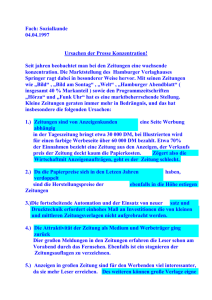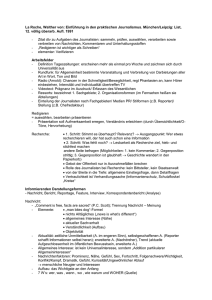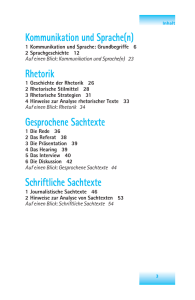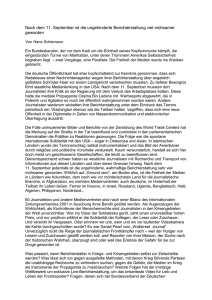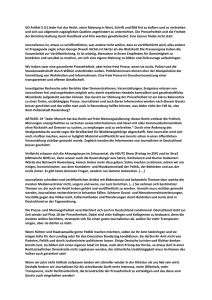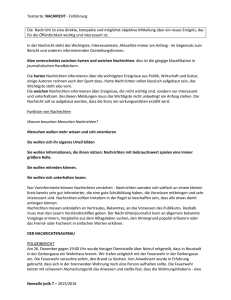1 - Die Medienrevolution – 50 Jahre Theodor-Wolff
Werbung
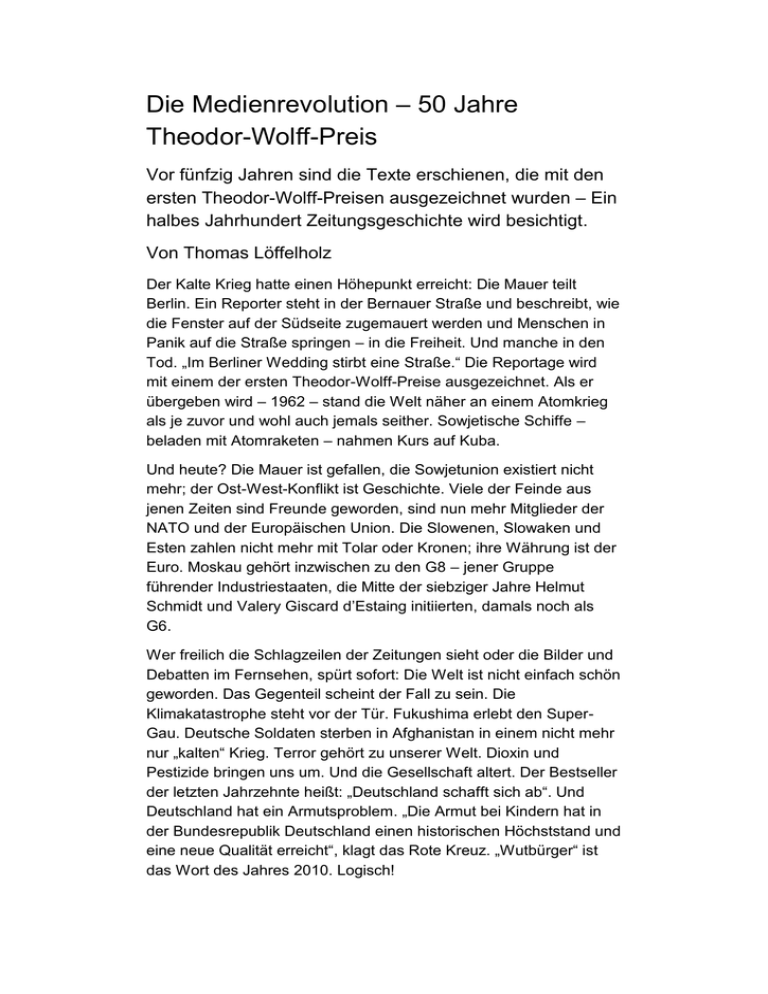
Die Medienrevolution – 50 Jahre Theodor-Wolff-Preis Vor fünfzig Jahren sind die Texte erschienen, die mit den ersten Theodor-Wolff-Preisen ausgezeichnet wurden – Ein halbes Jahrhundert Zeitungsgeschichte wird besichtigt. Von Thomas Löffelholz Der Kalte Krieg hatte einen Höhepunkt erreicht: Die Mauer teilt Berlin. Ein Reporter steht in der Bernauer Straße und beschreibt, wie die Fenster auf der Südseite zugemauert werden und Menschen in Panik auf die Straße springen – in die Freiheit. Und manche in den Tod. „Im Berliner Wedding stirbt eine Straße.“ Die Reportage wird mit einem der ersten Theodor-Wolff-Preise ausgezeichnet. Als er übergeben wird – 1962 – stand die Welt näher an einem Atomkrieg als je zuvor und wohl auch jemals seither. Sowjetische Schiffe – beladen mit Atomraketen – nahmen Kurs auf Kuba. Und heute? Die Mauer ist gefallen, die Sowjetunion existiert nicht mehr; der Ost-West-Konflikt ist Geschichte. Viele der Feinde aus jenen Zeiten sind Freunde geworden, sind nun mehr Mitglieder der NATO und der Europäischen Union. Die Slowenen, Slowaken und Esten zahlen nicht mehr mit Tolar oder Kronen; ihre Währung ist der Euro. Moskau gehört inzwischen zu den G8 – jener Gruppe führender Industriestaaten, die Mitte der siebziger Jahre Helmut Schmidt und Valery Giscard d’Estaing initiierten, damals noch als G6. Wer freilich die Schlagzeilen der Zeitungen sieht oder die Bilder und Debatten im Fernsehen, spürt sofort: Die Welt ist nicht einfach schön geworden. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Die Klimakatastrophe steht vor der Tür. Fukushima erlebt den SuperGau. Deutsche Soldaten sterben in Afghanistan in einem nicht mehr nur „kalten“ Krieg. Terror gehört zu unserer Welt. Dioxin und Pestizide bringen uns um. Und die Gesellschaft altert. Der Bestseller der letzten Jahrzehnte heißt: „Deutschland schafft sich ab“. Und Deutschland hat ein Armutsproblem. „Die Armut bei Kindern hat in der Bundesrepublik Deutschland einen historischen Höchststand und eine neue Qualität erreicht“, klagt das Rote Kreuz. „Wutbürger“ ist das Wort des Jahres 2010. Logisch! -2- Und auch die Welt der Medien und Zeitungen ist eine andere geworden. Gewiss, am Zeitungskiosk hängen die Blätter wie 1961. Millionen von Lesern holen auch heute am Morgen die Zeitung aus dem Briefkasten. Aber die gedruckten Medien stehen inzwischen in einem gnadenlosen Konkurrenzkampf. 1961 gab es in der Bundesrepublik einen einzigen Fernsehkanal und ein Dutzend Radiostationen. Privater Rundfunk? Ein absurder Gedanke! Privatfernsehen? Eine Schnapsidee! Noch nicht einmal das ZDF war auf Sendung. Heute buhlen weit über 30 Fernsehsender um die Gunst der Zuschauer. Dramatische Bilder und Nachrichten erreichen uns aus allen Kontinenten. Die Türme des World Trade Centers stürzen in der Ecke unseres Wohnzimmers zusammen, Sekundenbruchteile nach dem Einschlag in New York. Wir sind dabei, wenn auf dem Tahrir-Platz in Kairo Ägyptens Präsident Muhammad Mubarak hinweggefegt wird. Für einen Augenblick sind wir alle Ägypter. Wir hören Gaddafis wütende Reden, wir sehen live, wie der Tsunami ganze Städte in Japan hinwegschwemmt und wie die Atommeiler in Fukushima explodieren. Wir sind informiert. Wir brauchen – so scheint es – kein bedrucktes Papier. Wir brauchen kaum Worte; wir haben die ganze Welt im Blick. Und dabei muss es nicht einmal Fukushima oder Gaddafi sein. Wenn ein Haus im Westerwald niederbrennt und darin vier Menschen sterben oder Halbstarke in einer Berliner U-Bahnstation einen Menschen fast tot schlagen: Wir sitzen auf unserem Sofa und schauen zu. Manche Fernsehsender – CNN, n-tv, N24 und Phoenix, – senden Nachrichten und das pausenlos. Man muss auch nicht mehr auf die Zuschauertribünen des Bundestags steigen, um unsere Abgeordneten und Regierenden debattieren zu hören. Viele der „Redeschlachten“ werden dem Wähler, wenn er sie denn unbedingt sehen will, frei Haus geliefert. Sogar Heiner Geißlers Stuttgart-21Schlichtung konnte der Bürger daheim über Wochen Wort für Wort verfolgen. Wir informieren uns zu Tode Und dann auch noch das Internet! Was den Profis der Medien entgeht, liefern „YouTube“, „Facebook“ und „Wikileaks“. Amateurvideos zeigen uns Szenen, die die professionellen Medien verpassten oder bei denen ihnen – wie in Damaskus oder Teheran – -3- von der Staatsgewalt der Zugang mit Knüppeln und Gewehren versperrt wurde. Journalisten haben in diesen Jahrzehnten auch ihr Vorrecht verloren, als „vierte Gewalt“ exklusiv ihre Meinung zur Entwicklung der Welt zu äußern. „Blogger“ melden sich rund um die Uhr zu Wort. Vor zwölf Jahren wusste niemand, was ein „Blog“ ist. Das Wort war noch nicht einmal erfunden. Und Blogger sind nicht alles: Der Leser und Hörer kann heute im Netz zu allem und jedem seine Meinung sagen, ob klug oder dämlich, richtig oder falsch, wen schert’s. Und er stimmt dann auch gleich noch über das, was da gesagt und geschrieben wird, ab: „Gefällt mir!“ – „Gefällt mir nicht!“. Ein Sturzbach von Meinungen, Urteilen, von „Gut!“ oder „Schlecht!“ geht auf den Menschen nieder. Neil Postman hat es in einem berühmten Buch vorausgesehen: „Wir amüsieren uns zu Tode!“ Denn wer kann in dem Katarakt des Neuen und der Sensationen noch den Überblick behalten? Dabei hatten die Medien – als die ersten Theodor-Wolff-Preise vergeben wurden – die größte Revolution bei der Verbreitung von Nachrichten schon lange hinter sich: Es gab Telefon und Telegraf. Als Napoleon 1815 die Schlacht von Waterloo verlor, erfuhr man davon in London – zwei Eisenbahnstunden oder den Bruchteil einer Internetsekunde vom Schlachtfeld entfernt – vier Tage lang nichts. Dann erst meldeten die britischen Zeitungen den historischen Sieg. Amerika erreichte die Nachricht über die Schlacht, in der 40.000 Soldaten starben und die Europa veränderte, sechs Wochen nachdem Napoleon sein Waterloo erlebt hatte. Das war 1961 ganz anders. Die Meldung vom Start des Sputniks oder vom Bau der Mauer erreichte die Redaktionen sofort. Zeitungmachen war schneller, hektischer, fordernder geworden. Dies galt doppelt, weil in einer sich globalisierenden Welt die Staaten sehr viel stärker voneinander abhingen und zudem durch Bündnisse – wie NATO oder EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft) – miteinander verflochten waren. Auch was jenseits der Ozeane geschah, ging jetzt alle an. Internationale Konferenzen wurden Alltag. Welche Herausforderung für die Medien! Anfang der 1960er Jahre beklagte dann auch ein Korrespondent in Paris die Unrast der neuen Welt. Traurig erinnerte er sich der guten alten Zeit, als er morgens zum Zeitungsstand ging, die französischen Blätter kaufte, sich zur Lektüre in ein Café setzte, nachdachte, einen -4- Pernod nahm, und mit Kollegen, die sich ebenfalls einfanden und die auch einen Pernod nahmen, prüfte, ob die Ereignisse fortgeschritten genug seien, um dem Leser in Deutschland unterbreitet zu werden. Und oft beschloss man, dass die Dinge doch lieber noch etwas reifen sollten. So wichtig war das meiste, was jenseits des Rheins geschah, zuhause nun auch wieder nicht. Wie haben sich die Zeiten geändert, klagte der Mann. Er ahnte nicht, wieviel schlimmer es kommen würde. Ungezählte Fernsehkameras verfolgen heute rundum die Welt jeden halbwegs wichtigen Politiker. Die Redaktionen werden mit Depeschen und mit Bildern zugedeckt, und wehe dem Korrespondenten, der nicht genau weiß, was sich gerade im Kreml oder im Weißen Haus abspielt. Die Allgegenwart der Kameras zeigt plastisch, wie archaisch die Kommunikation 1961 noch war. Stenographen saßen in den Redaktionen; die Korrespondenten diktierten ihre Texte über das Telefon in den Block. Erst allmählich ersetzten Tonbandgeräte das Stenogramm. Fernschreiber – Telexe – gab es nur in Redaktionsbüros und Agenturen. Und auf Faxgeräte, die heute schon altmodisch erscheinen, musste man noch zwanzig Jahre warten. Dass ein Redakteur auf dem Computer Texte schreiben könne, die ohne Umwege auf die Zeitungsseiten wandern, war unvorstellbar. Denn die Seiten wurden damals noch in Blei gegossen. Als am 22. November 1963 – kurz bevor die Zeitung in Druck ging – die Nachricht vom Attentat auf John F. Kennedy eintraf, wurden zwanzig dramatische Zeilen mit der tonnenschweren Setzmaschine gesetzt: „Attentat auf Kennedy – schwerverletzt“. Minuten später wurde der kleine Bleiblock – noch warm – mit der Sensation zum Umbruchstisch getragen. Da trifft die Nachricht ein: Kennedy ist tot. Keine Chance, die bleiernen Sätze zu ändern. Nur in der Schlagzeile – die aus einzelnen Buchstaben von Hand zusammengesetzt wurde – hätte man dem Leser die aufrüttelnde Nachricht noch liefern können: „Kennedy tot“. Doch der verantwortliche Redakteur entschied: „Was nicht in der (bleigegossenen) Meldung steht, kann auch nicht in der Schlagzeile stehen“. Logisch! Heute hat der Redakteur bis zur letzten Minute Zugriff auf die Nachricht, kann korrigieren, nachschieben, aktualisieren. Und trotzdem scheint es fast ein Wunder, dass sich die Zeitungen in dem rasenden Wettlauf mit den elektronischen Medien behaupteten. -5- „Nichts ist so alt, wie die Zeitung von gestern“, hieß es früher. In unseren Tagen kann die „Zeitung von heute“ – inmitten der Schnelllebigkeit der elektronischen Medien – schon alt aussehen. Weshalb sich alle Zeitungen inzwischen auch „online“ zu Wort melden. Und doch sind sie nach wie vor da: Leitartikel, Glossen, Reportagen und Nachrichten füllen die Seiten, 2011 wie 1961. Bilder spielen allerdings – schaut man auf die alten Zeitungen – heute eine ganz andere Rolle. Damals waren die vorderen Seiten der anspruchsvollen Abonnementszeitungen „Bleiwüsten“, auch aus technischen Gründen. Aktuelle Fotos konnten nicht in sekundenschnelle rund um den Globus abgerufen werden. Auf Farbfotos mussten die Leser der Boulevardblätter sogar noch Jahre warten. 1969 veröffentlichte die „Bild“-Zeitung ihr erstes Foto in Farbe: Neil Armstrong betritt den Mond. Heute kommt keine Zeitung ohne Bilder und Farbe aus. Und dies ist nur ein Teil der Zeitungsrevolution. Denn 1961 verschwendete man – sieht man von den Boulevardblättern ab – an die Grafik, die Optik und das Layout kaum einen Gedanken. Heute sitzen Artdirektoren und Layouter in den Redaktionen. Ihre Namen stehen im Impressum und ihr Wort hat Gewicht. Um den fernsehgewöhnten und verwöhnten Leser zu erreichen, müssen die Blätter „Eindruck“ machen. Und so werden inzwischen für das Layout Medienpreise wie für brillante Texte vergeben. Der Irrweg des Kurz-kurz-kurz Der Weg in die neue Medienwelt war freilich nicht gradlinig. Die Allgegenwart des Fernsehens ließ viele Redaktionen und Verlage zunächst glauben, auch die Zukunft der Zeitung liege vor allem in Bildern und knalligen Schlagzeilen. „USA Today“, die 1982 gegründete Tageszeitung, bildergeprägt, mit knappen Texten galt vielen Medienmachern rund um den Globus als Vorbild. Es schien der logische Weg, um die Information nicht dem Fernsehen und den elektronischen Medien ganz zu überlassen. Der moderne Mensch – so die These – nimmt sich wenig Zeit, um zu lesen und schon gar nicht für anspruchsvolle Texte. Im Fernsehen ist in 1:30 alles gesagt. Und auch die Rundfunkkommentare, die in den 1960er Jahren noch fünf Minuten lang sein durften, müssen in unserer hektischen Welt kürzer werden. -6- Doch die Devise „kurz, kurz, kurz“ erwies sich für die Zeitung als Irrweg. Das zeigen die Theodor-Wolff-Preis-gekrönten Texte der vergangenen Jahre. Kurz zu sein, garantiert keine Aufmerksamkeit. Meinungsforscher sagen inzwischen, das Gegenteil ist der Fall. Mit dem emotionalen Bild, der aufrüttelnden Schlagzeile, der schnellen Nachricht kann die Zeitung den Wettlauf gegen die elektronischen Medien nicht gewinnen. Sie hat den eindringlichen Text, die gründliche Information, die bewegende Reportage den elektronischen Medien voraus. Hier müssen sich die Zeitungen behaupten. Es klingt altmodisch: Aber Theodor Wolff weist mit seinen intensiven Analysen, Essays, Erzählungen auch für die modernen Zeiten den richtigen Weg. Emotionen wecken Aufmerksamkeit Wer die Texte liest, die in den vergangenen 20 Jahren mit dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet wurden, erkennt die Stärke der Zeitung. Es sind faszinierende und bewegende Beiträge. Obwohl sich auch an ihnen der Medien-Umsturz der Jahrzehnte ablesen lässt. Die preisgekrönten Artikel sind emotionaler und persönlicher geworden. Es sind eher Geschichten als Analysen oder grundsätzliche Betrachtungen. Einzelschicksale stehen oft im Mittelpunkt: Der Herzkranke, der – fast ohne Hoffnung – über Wochen hin auf sein neues Herz wartet; der kleine Junge, den die Eltern in die Babyklappe legen und ein paar Stunden später zurückholten, zu ihrem Glück. Der Obdachlose, der als „Waldschrat“ im Wald haust und von einer vorbeijoggenden engagierten Frau ganz langsam in die moderne Welt zurückgeführt wird; das MultikultiHaus in Kreuzberg; die Geschichte eines Frankfurter Trinkhallenbesitzers und dessen – zum Teil dahinvegetierenden – „Saufkundschaft“ oder das Porträt des Fotografen, dessen Leben es war, Lady Di immer im Sucher zu haben. Texte, die – auch wenn es um einzelne Schicksale geht – doch Fragen an die ganze Gesellschaft stellen. In den letzten Jahren wurden zudem immer wieder Artikel ausgezeichnet, in denen Journalisten über persönliche Erfahrungen berichteten, über den Konflikt, der sich an der Rolle des Vaters bei der Erziehung der eigenen Kinder entzündet; über die Gefühle des Journalisten, als er einer Partei beitritt; über das glückliche Leben mit dem eigenen behinderten Kind oder über die „Bewältigung“ der Erinnerung an den RAF-Mord am Patenonkel: Alfred Herrhausen. -7- Brillante Texte, emotionaler und gerade darum oft sogar fesselnder als seine, die in früheren Jahrzehnten ausgezeichnet wurden. Doch dies hat auch eine Kehrseite, die zum Nachdenken über die modernen Medien zwingt. Beiträge, die sich mit großen politischen Themen oder gesellschaftlichen Fragen beschäftigen, sind unter den preisgekrönten Arbeiten rar geworden. Vor 25 Jahren (1987) gingen drei Preise an Essays über die Barschelaffäre, Lothar Späths politischen Aufstieg und die provozierende Behauptung: „Deutschland ist teilbar.“ Vor vierzig Jahren (1971) wurden Texte ausgezeichnet, die untersuchten, wie die Proteste der 68er das Denken der Gesellschaft verändert hatten, welche Rolle das Fernsehen für die Entwicklung eines Politikers spielte, die die politische Bedeutung de Gaulles würdigten und die mit den überzogenen Erwartungen abrechneten, die am Ende der Wunderjahre an die Wirtschaft gestellt wurden. Analytische und nachdenkliche Betrachtungen. In einer Welt aber, in der die Bilder und Berichte über jede mittlere Katastrophe, wo immer sie sich ereignet, uns zuverlässig gemeldet werden – jedes Flugzeugunglück vom anderen Ende der Welt, jeder dramatische Autounfall auch in 500 Kilometer Entfernung –, da ist es schwerer geworden, den Leser zu erreichen und zu fesseln. Das aber können bewegende Geschichten. Sie ragen aus dem unendlichen Strom der Bilder, Nachrichten, Informationen heraus. Es sind zudem journalistische Unikate. Dass Texte – verknüpft mit bewegenden Einzelschicksalen und zum Teil sogar mit persönlichen Erlebnissen – mehr Aufmerksamkeit wecken und ausgezeichnet werden, spiegelt den Umbruch in der Welt der Zeitungen und der Medien wider. Bilder und Worte Vielleicht haben sich aber auch die Erwartungen der Leser geändert. „Die Medienbürger des digitalen Zeitalters“, so schreibt Ernst Elitz, der viele Jahre Intendant des Deutschlandradios war und Medienwissenschaften lehrt, „handeln nicht mehr nach Normen, die lange als unverrückbar galten. Für das Private galt ein Vermummungsgebot. ... In Winnenden veröffentlichten Eltern Fotos ihrer ermordeten Kinder – lachend und lebenszugewandt – um ihnen nach dem Amoklauf ein ‚Gesicht zu geben’. Mit diesen hochemotionalen Bildern konfrontierten sie die Politik.“ Elitz -8- formuliert „zwölf Thesen für einen besseren Journalismus“. Eine von ihnen lautet: „Menschliche Schicksale bieten bessere Argumente als Politikerreden“ und „Die Medien müssen mit Emotionen und mit erschütternden Bildern argumentieren.“ Kommen wir noch einmal auf die Bilder zurück. „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!“ Der Satz ist zu einer Art medialem Glaubensbekenntnis geworden. Der britische Werbefachmann Fred R. Barnard erfand ihn, als man vor neunzig Jahren in London über Werbeplakate auf den Straßenbahnen stritt. Dreist erklärte er ihn zu einer chinesischen Weisheit, „damit die Leute ihn ernst nehmen“. Doch ob chinesisch oder Straßenbahn: Man nimmt ihn ernst. Ja, er scheint die Offenbarung der modernen Medienwelt. „Am Anfang war das Wort!“ Ein absurder Gedanke. „Am Anfang war das Bild!“ Bewegende und anrührende Bilder und Schicksale faszinieren den Leser stärker als die nüchterne Analyse. Die Frage ist freilich: bieten „menschliche Schicksale“ und „erschütternde Bilder“ tatsächlich immer die „besseren Argumente“? Beschwören sie nicht oft die Gefahr herauf, dass Gefühle die Vernunft überwältigen. Die meisten Bilder, sogar die „erschütterndsten“, sagen nichts, wenn der Betrachter sie nicht einordnen kann. Jede Gesellschaft, auch die reichste, auch die gerechteste, produziert Tag für Tag ungezählte „erschütternde Bilder“ und „bewegende, menschliche Schicksale“. Sogar in der Natur, die vielen Menschen in unserer Welt der Technik als das Gute schlechthin erscheint, ist das Erschütternde allgegenwärtig. Beispielsweise wenn der Gepard die Antilope tötet oder ein Tsunami ganze Landstriche verwüstet. Die Natur kennt keine Regeln menschlicher Moral. Sie kennt auch keine Gnade. Und an erschütternden Bildern, mit denen man eine „Kampagne“ fahren kann, ist in der Medienwelt unserer Tage nie Mangel. Notfalls liegen sie im Archiv bereit. Aber sagen Bilder, was sie sagen? Zum Sinnbild des ersten Golfkriegs wurde ein ölverschmierter, totgeweihter Kormoran. Das Bild rüttelte die Menschen auf, als Saddam Hussein Öl in den Golf laufen ließ. Experten warnten, das brennende Öl werde die Welt verdunkeln und das Klima rund um den Erdball zerstören. Was bedeutet es in diesem Zusammenhang, dass der sterbende Kormoran den Golf nie zu Gesicht bekommen hatte. Sein Bild lag im Archiv, wo es kampagnenfähige Journalisten fanden, um die Menschheit aufzurütteln. Es ging schließlich um den -9- Frieden in der Welt! Man könnte auch die Bilder des an Aids sterbenden Kindes nehmen, die die Bundesbürger aufrüttelten, als 1994 über aids-verseuchte Blutkonserven debattiert wurde. Panik verbreitete sich. Todkranke verzichteten auf Transfusionen: Lieber tot als Aids! Nur, die Bilder waren zehn Jahre alt und hatten mit Blutkonserven nichts zu tun. Es gab seit Jahren keine einzige aids-verseuchte Blutkonserve. Was also sagt ein Bild? Bilder, die kommentieren Wenn man genauer hinsieht, ist die Entwicklung noch verblüffender: Bilder, die heute die vorderen Zeitungsseiten dominieren, sind oft eher Symbole als Dokumente. Denn Bilder können Kommentare sein oder sie ersetzen, so paradox es klingt. Der Kormoran oder das sterbende Baby belegen ja nicht das, was sie zu belegen scheinen. Da schlittert eine Regierung in die Krise und das Foto zeigt die entgleisten Gesichtszüge von Kanzlerin und Vizekanzler. Jetzt weiß der Dümmste, was los ist. In Wahrheit stammt das Bild (fast) immer aus dem Archiv und hat mit der sich gerade entwickelnden Krise nichts zu tun. Vielleicht entstand es, als sich die beiden gerade bei einer besonders dummen Rede eines Kollegen langweilten. Was also sagen Bilder? „Der Depressionstod von Robert Enke (dem Torhüter des Fußballvereins Hannover 96) hat uns radikal vor Augen geführt, dass Medien frühzeitig gesellschaftliche Tabus brechen müssen, um Menschen vor Katastrophen zu bewahren“, heißt es in den erwähnten „Zwölf Thesen“ von Elitz. Die Bilder der trauernden Fans, der Mitspieler, gruben sich so tief ein, dass Margot Käßmann als Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in ihrer Neujahrspredigt 2010 Enkes Depressionen und seinen Tod als Beispiel zitierte und hinzufügte: „Nichts ist gut, wir erschrecken, wenn wir erkennen, wie bei uns eine solche Atmosphäre der Gnadenlosigkeit herrscht und alle immer stark sein müssen – wie unmenschlich!“ Schauen wir für einen Augenblick nicht auf Robert Enke, sondern in die Statistik. Sie zeigt: die Selbstmordgefahr ist dramatisch gesunken. 2008 nahmen sich in Deutschland halb so viele Menschen das Leben wie 1980. Dabei werden die Menschen älter. Und alte Menschen neigten laut Studien eher dazu, ihrem Leben ein - 10 - Ende zu setzen. Das macht den Rückgang noch erstaunlicher. In der „Standardisierten Sterberate durch Suizid“ wird die Altersstruktur berücksichtigt: altersbereinigt ist die Zahl der Selbstmorde sogar um sechzig Prozent gesunken. Wo immer sich 1980 fünf Menschen das Leben nahmen, sind es heute noch zwei. Offenbar haben Politik, Gesellschaft und Medizin Unglaubliches erreicht. Aber diese Nachricht hat gegen Enke keine Chance. Wir sehen die trauernden Kicker und schreiben wissend und wütend: Die Politik, die Vereine, der Fußballbund und die Gesellschaft haben versagt! Die Frage ist nur, verstellen Bilder, die solche Emotionen aufrühren, nicht den Weg zu wirklicher Information. Medien, die jede „Katastrophe“ rund um den Globus in Sekundenbruchteilen in unsere Wohnzimmer bringen, zeigen eine Welt, die von Unheil, Gefahr, politischem und gesellschaftlichem Versagen geprägt ist. Dioxin steckt in den Eiern, Millionen Tonnen Erdöl laufen im Golf von Mexico ins Meer, ein Anschlag auf dem Moskauer Flughafen kostet 36 Menschen das Leben, in Duisburg endet die Love Parade mit 21 Toten. Und dann auch noch Stuttgart 21, Guttenberg, Fukushima und Sarrazin! Erstaunlich ist allein, dass wir in dieser Welt des Rinderwahns, des Dioxins und der Pestizide immer älter werden. „Unser Leben währet 70 Jahre, und wenn es hoch kommt, so sind’s 80 Jahre“, lehrt uns die Bibel. Hätte es – als der 90. Psalm niedergeschrieben wurde – kritische Journalisten gegeben, sie hätten melden müssen: „Die Zahlen sind erschreckend falsch!“ Denn die allerwenigsten erlebten damals auch nur den siebzigsten Geburtstag. Die erste überlieferte Sterbetafel – 1693 in Breslau erhoben – zeigt, noch vor 300 Jahren war die Hälfte der Menschen mit zwanzig Jahren tot. Seit 2008 aber ist das biblische Alter von achtzig Jahren in Deutschland der Normalfall. Und genauso alt oder sogar älter werden die Menschen in jedem sechsten Land der Welt. Ein Rekord! Dabei spiegeln diese Zahlen das wahre Maß der Veränderung nicht einmal wider. Vor zwanzig Jahren gab es noch kein einziges Land, in dem der Durchschnittsbürger auf achtzig Jahre hoffen konnte. In einem Wimpernschlag der Geschichte ist die Lebenserwartung des Menschen weltweit um vier Jahre gestiegen, in den beiden größten Staaten – China und Indien, wo mehr als ein Drittel der Menschheit lebt – sogar um sechs! Was nicht verhindert, dass wir unter dem Titel „Unser täglich Gift“ in den Medien anschaulich gezeigt - 11 - bekommen, wie uns die modernen Lebensmittel – „vollgepumpt mit chemischen Stoffen“ – vom Leben zum Tode befördern. Wir rütteln den Leser auf, indem wir die Lebensgefahren der Pestizide, Fungizide, Konservierungsmittel oder des Kunstdüngers beschwören. Die Frage, wo die Menschheit stünde, gäbe es keine Pestizide, Fungizide, Konservierungsstoffe und keinen Kunstdünger, wird nicht gestellt. Dabei hat die Tatsache, dass die Lebenserwartung dramatisch gestiegen ist und dass heute über sieben Milliarden Menschen auf der Erde leben, nichts mit Bio oder Öko zu tun, sondern mit Technik, Medizin und menschengemachter Chemie. Immer weniger Krankheiten „nehmen heute einen tödlichen Ausgang", meldete schon vor Jahren das Statistische Bundesamt. Und auch andere „Lebensgefahren“, wie verdorbene Lebensmittel, Mutterkorn, Schimmel, Fleischvergiftung (Botulismustoxin), an denen früher Millionen starben, spielen gerade in den Industriegesellschaften keine Rolle mehr. Technik und Chemie bewahren uns davor. Dass die heißgeliebte „Natur“ Gifte hervorbringt, an denen gemessen, die meisten von Menschen gemachten Gifte fast harmlos sind, wird kaum vermerkt. Die journalistische Weisheit, dass die schlechte Nachricht die gute Nachricht ist, hat in unseren Zeiten eine neue Dimension bekommen. Einmal, weil wir über eine unendliche Menge an schlechten Nachrichten aus allen Teilen der Welt verfügen; vor allem aber, weil dadurch der Druck wächst, emotionaler, skandalisierender, jubelnder, hysterischer zu berichten, um den Leser und den Hörer zu erreichen. Auch die politische Sprache wird lauter. Kein Wunder, dass die Schlagzeilen in den Medien inzwischen oft Kommentare sind. Statt nüchtern Fakten zu beschreiben, sprechen sie Gefühle an, jubeln, verdammen, verurteilen. Schlagzeilen manifestieren oft (Vor-)Urteile, bevor der Leser die Chance hat, sich sein Bild zu machen. Hier liegt eine Herausforderung für den Qualitätsjournalismus. Dass Journalisten mit erschütternden Bildern „argumentieren“ oder „Kampagnen fahren“, um Missstände aufzudecken, mag hin und wieder nötig sein. Doch Zeitungen – gerade Qualitätszeitungen – müssen sich der Aufgabe stellen, dem Leser jenes Maß an Informationen zu geben, das ihm ein eigenes, sachgerechtes Urteil ermöglicht. Dolf Sternberger – einer der großen deutschen Politikwissenschaftler - 12 - – hat in den Jahren der ersten Theodor-Wolff-Preis-Vergaben die Rolle der „Journalisten im Staatsleben“ wie folgt beschrieben: „Der erste und wahrhaft elementare Beitrag der Journalisten zum Staat – das erste, was sie in Freiheit für den Staat tun, auch tun müssen und tun sollen – ist nicht zu regieren oder die Regierung zu beraten, ist nicht zu opponieren, nicht zu kritisieren, nicht zu kontrollieren und es ist auch nicht die Meinungsbildung und es ist auch nicht die Willensbildung. Sondern das erste ist die Information, die Nachricht. Die Unterrichtung. ... Sie werden mir sagen: Das ist eine Binsenwahrheit. Und das ist es auch. Aber Binsenwahrheiten haben es vielfach an sich, dass man sie übersieht und vergisst." Heute scheint es manchmal, als gehe die Binsenweisheit in der Flut der aufrüttelnden Bilder und der emotionalen Berichte ganz und gar unter. Der Prozess gegen den Wettermoderator Jörg Kachelmann ist ein anschauliches Beispiel dafür. Kachelmann wird verhaftet, abgeführt, angeklagt. Der Leser erwartet Informationen, wie sollte es anders sein. Aber handfeste und unparteiische Informationen über das Verfahren gibt es nicht. Es findet zum größten Teil hinter verschlossenen Türen statt; obendrein liefern Zeugen und Gutachter – wie am Ende das Urteil zeigt – offenbar keine belastbaren Fakten über das, was wirklich geschah. Und so stochert man über ein Jahr lang im Dunkeln herum. Und viele Medien behelfen sich, indem sie als Ersatz das lockere Leben des Jörg Kachelmann erkunden und manche zahlen den Geliebten Geld dafür. Noch bedenklicher aber scheint, dass wichtige, ernsthafte Medien, die fehlenden Informationen dadurch ersetzen, dass sie (Vor-)Urteile aussprechen. Und dies nicht behutsam und leise, sondern donnernd und laut. Sie haben keinen Zweifel: Er ist schuldig, entscheiden die einen; er ist das Opfer, urteilen genauso kategorisch die anderen. Ist dies Information? Journalisten sind keine Richter; sie sprechen nicht Recht. Und sie sollten sich in einem demokratischen Rechtsstaat hüten, Urteilen vorzugreifen und zu versuchen, sie zu beeinflussen. Denn die politische Legitimation des einzelnen Journalisten ist nicht größer als die jedes anderen Bürgers. Er erfüllt eine – für die Demokratie allerdings grundlegende und herausragende – Funktion: zu informieren, nicht zu entscheiden oder zu indoktrinieren, oder gar Kampagnen zu führen. Wobei der Fall Kachelmann nur ein Beispiel für ein Problem ist, dem sich der Journalist mitten in der modernen Nachrichtenflut immer wieder gegenübersieht. Belastbare - 13 - Informationen und Hintergründe fehlen öfter, als dem ernsthaften Berichterstatter lieb sein kann. Wer durchschaut, was in Ägypten, Libyen, Syrien vor sich geht. Nüchterne Information ist aber auch deshalb schwieriger geworden, weil in der arbeitsteiligen, globalen Welt unendlich viele, oft dramatisch widersprüchliche Interessen miteinander konkurrieren. Ihnen muss die Politik gerecht werden, so gut dies geht. Und oft geht es nicht. Wir fordern den Atomausstieg – sofort – und natürlich keine Kohlekraftwerke – des Klimas wegen. Aber trotzdem wollen wir genügend Strom (aus der Steckdose) und jene Energie, die nötig ist, um die Arbeitsplätze zu sichern. Eine solche Gesellschaft im Widerspruch können „erschütternde Bilder“ und Emotionen nicht erklären, im Gegenteil, sie vernebeln und befördern Politikverdrossenheit. Und trotzdem kokettieren wir damit, in einer Gesellschaft der „Wutbürger“ zu leben; wir lieben sie fast unsere Wutbürger. Aber kann sich ein demokratischer Staat wünschen, dass „Wutbürger“ über die Zukunft der Gesellschaft entscheiden. Angst ist kein guter Ratgeber und Wut noch weniger. Wobei erstaunlicher Weise nicht die Armen und Arbeitslosen die „Wutbürgern“ sind, sondern oft Menschen aus einem saturierten Umfeld. Sie gehen für alternative Energien und gegen die Atomkraft auf die Straße, aber genauso gegen Stromtrassen, die den alternativen Strom bringen könnten und natürlich gegen unterirdische Speicher für Kohlendioxid. Sie jetten in den Urlaub, aber wehren sich gegen den Lärm der Flughäfen. Sie fordern Biosprit, der Umwelt zuliebe. Dass die Förderung des Anbaus energiehaltiger Pflanzen auf Kosten der Nahrungsmittelproduktion gehen und die Not gerade in der hungernden dritten Welt steigern könnte, erscheint angesichts der drohenden Klimakatastrophe nicht so wichtig. Wobei freilich der Anreiz, mit Biosprit Geld zu verdienen, leicht dazu führen kann, dass die wichtigste Klimareserve der Welt – der Urwald – zerstört wird. Wie die Wutbürger solche Debatten führen, zeigt das kuriose Ende der deutschen Biosprit-Diskussion. Als klar wird, dass Super E10 vielleicht den Motoren schaden könnte, ist die Antwort eindeutig: Gottseidank gibt es ja „Super-Plus“. „Wo Pressefreiheit herrscht und jedermann lesen kann, da ist Sicherheit“, schrieb Thomas Jefferson, der Vater der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Doch gilt Jeffersons Satz in unserer - 14 - emotionalen und zum Teil hysterischen Gesellschaft noch? Er unterstellt, dass die Medien den Bürger, den Souverän im demokratischen Staat, so klar und unvoreingenommen informieren, dass der sich sein Urteil bilden kann. Dies ist in unseren Tagen schwieriger geworden. Denn der Mensch greift tiefer in die Natur ein, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und die Folgen sind oft schwer abzuschätzen. Unser Blick in die Zukunft ist unsicherer geworden, auch für die Medien. Der Philosoph Hermann Lübbe, nennt es „Zukunftsgewissheitsschwund“. Doch genau das setzt – wenn man an Jeffersons Weisheit und an die aufklärerische Rolle der Medien glaubt – ein neues Maß für den „Qualitätsjournalismus“. Journalisten dürfen sich nicht auf Emotionen, Skandale und aufrüttelnde Bilder beschränken. Sie müssen, so gut sie es können, die Fakten in ihrer ganzen Breite dem Menschen nahe bringen, damit der sich sein Urteil bilden kann. Und da sind – gerade in unserer bild-lastigen Welt – vor allem Zeitungen gefordert.