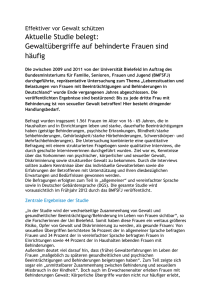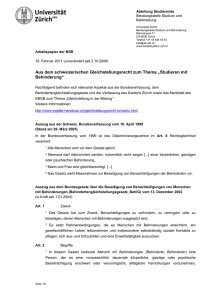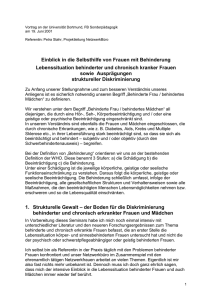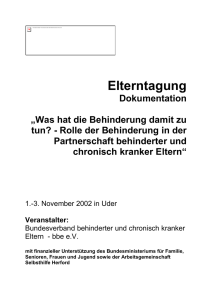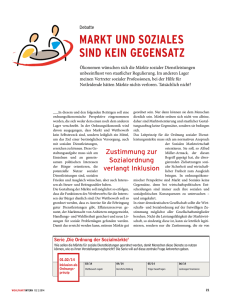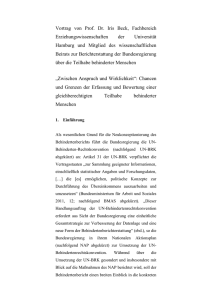Reinhard Markowetz
Werbung

Inklusion – Neuer Begriff, neues Konzept, neue Hoffnungen für die Selbstbestimmung und Partizipation von Menschen mit Behinderung Reinhard Markowetz Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, heute in Klagenfurt zu sein und anlässlich des Fachsymposiums gerade hier an der Universität, an der unser leider viel zu früh verstorbener Kollege Hans Hovorka gelehrt und unermüdlich gearbeitet hat, etwas zu einem Thema beitragen zu dürfen, das er inhaltlich weit voraus dachte. Wie kaum ein anderer hat er unter den deutschsprachigen Integrationswissenschaftern nachdrücklich darauf hingewiesen, dass sich das Recht auf volle gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nicht auf die schulische Lebensphase beschränken darf, sondern alle Lebensphasen und Lebensbereiche umfassen muss. Sein Verständnis von Integration und Integrationspädagogik brachte unmissverständlich zum Ausdruck, dass Menschen mit Behinderungen als gleichgestellte und gleichberechtigte Bürger vorbehaltlos in unsere Gesellschaft einzubeziehen sind und deshalb selbstverständlich am sozialen Leben uneingeschränkt teilhaben dürfen (vgl. z.B. Hovorka 1999). Schon sehr früh hat er statt der Heilung der Defekte die sozialen Folgen einer Behinderung als das zentrale Problem einer Pädagogik der Nichtaussonderung entdeckt und das, was wir heute Partizipation nennen, als unverzichtbare Aufgabe der Integrationspädagogik definiert (vgl. z.B. Hovorka 1998, S. 200). Heute betont in der Tat die aktuelle Fassung der „International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps“ (ICF) der Weltgesundheits-Organisation (vgl. WHO 2001, DIMDI 2002) endlich auch den gesellschaftlichen Kontext, in dem Menschen mit Behinderungen leben, sowie ihre positiven Möglichkeiten (Funktionsfähigkeiten) zu aktiver und selbstbestimmter Teilhabe als Ziel. Zudem wird jetzt die außerordentliche Bedeutung der Einstellungen gegenüber behinderten Menschen gesehen. Der Terminus ´Partizipation´ steht dabei nicht nur für die Überwindung der negativen Begrifflichkeit in der sozialen Dimension (das bisherige ´Handicap´ der ICIDH 1; vgl. WHO 1980), sondern hat nun eine klare sozialintegrative Zielsetzung. Diese deutliche Richtungsänderung hin zu behindertensoziologischem Denken entspricht weitgehend der Position, die die ´Soziologie der Behinderten´ als Wissenschaft vom Zusammenleben der Menschen seit nun mehr als 20 Jahren vertritt und in ihren speziellen Arbeits- und Forschungsschwerpunkten differenziert zum Ausdruck bringt (vgl. Cloerkes 2001, 2003a, b; Cloerkes / Markowetz 1999, 2003; Markowetz 2000a; 2001a, b; 2002a, b, c; 2003b, 2004b). Leider werden solche Beschreibungen und Analysen der sozialen Wirklichkeit von Menschen mit Behinderungen durch die ´Soziologie der Behinderten´ sowohl von der Heil-, Sonder-, Rehabilitations- und Behindertenpädagogik als auch von der Integrationspädagogik nur wenig beachtet und interdisziplinär kaum diskutiert. Um so intensiver war der kritisch-konstruktive Dialog mit Hans Hovorka über die soziologische Sicht der Dinge und den zwischenzeitlich als gefestigt geltenden Erkenntnisstand der Erforschung von Einstellungen und Verhalten gegenüber 1 Menschen mit Behinderungen als dem zentralen Behindertensoziologie (vgl. Cloerkes 1985, 2001, S. 73ff). Arbeitsbereich der Wir waren uns stets darin einig, dass gerade die ´Integrationspädagogik´ (vgl. Eberwein 1990; Eberwein / Knauer 2002, Feuser 2003; Hildeschmidt / Schnell 1998; Hovorka / Sigot 2000) respektive ´inklusive education´ (Daniels / Garner 1999; OECD 1999; Pijl / Meijer / Hegarty 1997) oder inklusive Pädagogik (Schnell / Sander 2004) ein originäres Interesse an Veränderungen der sozialen Reaktion auf behinderte Menschen haben müsste. Schließlich erhofft man sich doch von der Sozialisation (vgl. Hurrelmann 2002; Markowetz 2002a) gerade unter integrativen Bedingungen eine „soziale Kohäsion, d.h. eine gleichberechtigte Interaktion von Mehrheit und Minderheit“ (vgl. Preuss-Lausitz 1998, S. 223). Würde man aus behindertensoziologischer Sicht die Wirksamkeit der Integrationspädagogik in einem „Index for Inclusion“ (vgl. CSIE 2000; Boban / Hinz 2003a, b) zu erfassen versuchen, so müsste dieser differenzierte Items beinhalten, die Auskunft über die sozialen Beziehungen und Verhältnisse in integrativen Handlungs- und Erfahrungsfeldern geben, dem sozialen ´Abstand´ zwischen den Interaktionspartnern umfassend nachspüren (vgl. Wocken 1983a,b; 1993; 1998) und die These „Entstigmatisierung durch Integration“ (vgl. Cloerkes / Markowetz 1999; Markowetz 1998d, 2000a, c;2003b; 2004b) evaluieren. Sie erahnen, dass ich mir in meinem heutigen Vortrag erlaube, die Dinge rund um den Begriff Inklusion (vgl. Hinz 2002; Niehoff 2002; Sander 2002, 2003) bewusst soziologisch anzugehen. Dies nicht nur, weil der geschätzte Kollege Hans Hovorka tiefgreifend soziologisch dachte und mich die Veranstalter des Fachsymposiums darum gebeten haben, sondern weil die ´Soziologie´ eine Grundwissenschaft der Pädagogik ist, die sich mit sozialen Subjekten, sozialen Prozessen und sozialen Katalysatoren beschäftigt, nach Strukturen und Gesetzmäßigkeiten des sozialen Handelns, der sozialen Beziehungen und der sozialen Gebilde fragt und herauszufinden versucht, ob und welchem sozialen Wandel diese unterliegen (vgl. Markowetz 2002b, 270). Lassen Sie mich zunächst die Soziologie, die sich schwerpunktmäßig mit der Situation von Menschen mit Behinderungen beschäftigt und deshalb als „Soziologie der Behinderten“ (vgl. Cloerkes 2001; Markowetz 2003b, 2004b) bezeichnet wird, knapp skizzieren. 1. Soziologie der Behinderten als Partizipationswissenschaft Die „Soziologie der Behinderten“ als ein wissenschaftliches Arbeits- und Forschungsgebiet innerhalb der Heilpädagogik (vgl. Cloerkes 2001, Markowetz 2002b, 2004b) interessiert sich insbesondere für das Zusammenleben und Zusammenhandeln der Menschen und die daraus resultierende soziale Wirklichkeit für Menschen mit Behinderungen. Ausgangspunkt aller Überlegungen der „Soziologie der Behinderten“ sind zwei Fragen: Was verstehen wir unter ´Behinderung´ und wer ist ein ´behinderter Mensch´? Für den Behindertensoziologen ist ein Mensch behindert, wenn er in den Augen der sogenannten Nichtbehinderten in unerwünschter Weise anders ist, von definierten Erwartungen abweicht und deshalb die soziale Reaktion auf ihn negativ ist. Für die ´Soziologie der Behinderten´ ist der behinderte Mensch also keineswegs ein Mängelwesen, sondern in aller erster Linie Mensch wie Du und Ich. Sie interessiert sich nicht für die Vielzahl von Defekten, die einen Menschen als behindert klassifizieren, sondern für die sozialen Folgen einer Schädigung. Aufgrund unserer gesellschaftlichen Normen und Werte sowie unserer Sozialisation wird eine sichtbare und dauerhafte Abweichung im 2 körperlichen, geistigen oder seelischen Bereich negativ bewertet. Behinderung ist das Ergebnis eines sozialen Abwertungsprozesses, das die sozialen Teilhabechancen behinderter Menschen negativ beeinflusst. Negative Bewertungen müssen aber nicht zwangsläufig zu negativen Reaktionen führen. Behinderung wird als nichts Absolutes, sondern als etwas Relationales gesehen. Dennoch fasst die ´Soziologie der Behinderten´ Behinderung als ein Stigma auf und konzeptualisiert damit Behinderung als ein empirisch erfassbares ´soziales Problem´. Für die ´Soziologie der Behinderten´ stellt sich also insbesondere die Frage, wie unsere Gesellschaft mit diesem sozialen Problem umgeht. Hierzu erforscht sie die Einstellung und das Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderungen (vgl. Cloerkes 1985; 2001), beschäftigt sich mit Vorurteilen, Etikettierungen, Stigmatisierungsprozessen und ihren Folgen. Von besonderer Bedeutung sind die Interaktionsspannungen zwischen Behinderten und Nichtbehinderten, der Anpassungsprozess an die ´Behindertenrolle´, die Isolationstendenzen und Auswirkungen auf die Identität Behinderter und deren Identitätsstrategien zur Vermeidung beschädigter Identitäten. Die Auseinandersetzung mit der Identitätsproblematik (vgl. Cloerkes 2001, S. 125ff.; Markowetz 2000c; McCall / Simmons 1974; Neubert / Billich / Cloerkes 1991) wird auf der Grundlage soziologischer Identitätskonzepte und im Wesentlichen auf dem Theoriehintergrund der Symbolischen Interaktion (vgl. Cloerkes 2001, S. 125ff.; Helle 1992; Mead 1973) geführt. Die ´Soziologie der Behinderten´ diskutiert verschiedene Veränderungsmöglichkeiten der sozialen Reaktion auf Behinderte und sucht nach Konzepten der Entstigmatisierung (vgl. Cloerkes / Markowetz 1999; Cloerkes 2001, 160ff.; Markowetz 1998d, 2004b). Langfristig erhofft sie sich von einer konsequenten sozialen Integration behinderter Menschen die nachhaltigsten Veränderungen. Überhaupt wird der Inklusion behinderter Menschen in der Behindertensoziologie ein hoher Stellenwert beigemessen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Rehabilitation Behinderter aus behindertensoziologischer Sicht nur einen Sinn macht, wenn sie umfassend und nahtlos als gesellschaftliche Integration stattfindet. So gesehen versteht sich die ´Soziologie der Behinderten´ als Partizipationswissenschaft und operiert theoretisch wie praktisch sozialintegrativ-emanzipatorisch. Aus meinen Ausführungen wird deutlich, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Soziologie der Behinderten ohne die Begriffe Integration und Inklusion nicht auskommt, ja sich gerade darüber definiert und damit ihr Selbstverständnis zum Ausdruck bringt. Zurecht stellt sich deshalb die Frage, ob der handlungsleitende Begriff Inklusion den Integrationsbegriff substituiert und abermals eine paradigmatische Qualität beansprucht oder hier im Sinne des sonst durchaus üblichen modisch-trendigen Anglizismus lediglich ein terminologisches Spiel betrieben wird, das Moderne suggerieren soll, gesamtgesellschaftlich betrachtet an der Situation und Lage der Menschen mit Behinderungen aber nichts verändert. Nehmen wir uns deshalb für die beiden Begriffe etwas Zeit und lassen Sie mich eine Begriffsklärung aus behindertensoziologischer Sicht versuchen. 2. Integration und Inklusion aus behindertensoziologischer Sicht 2.1 Das Integrationsverständnis in der Behindertensoziologie Aus behindertensoziologischer Sicht ist das Verständnis von Integration als Entstigmatisierung wesentlich (vgl. Markowetz 2001a, 2004b). Integration ist danach ein auf Solidarität und Emanzipation ausgerichteter Interaktionsprozess, der auf 3 soziale Zuschreibungsprozesse verzichtet und damit das Behindertsein als etwas Normales belässt und nicht »besondert«. Auch der Begriff »Normalisierung« spielt in der Integrationsdiskussion eine wichtige Rolle. Aus den Auffassungen über Normalität für Behinderte, wie sie Adam (1977), Thimm (1984 und 1994) und Wolfensberger (1972, 1980 und 1986) auf der Grundlage der skandinavischen Normalisierungsbewegung (Bank-Mikkelsen 1969 und 1980;Nirje 1969, 1980 und 1994) formuliert haben, kann zwar annähernd die gleiche Normalität für Behinderte abgeleitet werden. Gleiche Normalität bedeutet jedoch bei weitem noch nicht, dass Behinderte mit Nichtbehinderten in Kontakt kommen müssen, sondern dass beide isoliert voneinander die gleiche Normalität leben könnten. Wenn wir in der Soziologie der Behinderten von Integration (vgl. Markowetz 2001a, S. 173ff.) sprechen, dann ist damit gemeint, dass behinderte Menschen unabhängig von Art und Schweregrad ihrer Behinderung als vollwertige Mitglieder der Gemeinschaft in allen Lebensbereichen grundsätzlich die gleichen Zutritts- und Teilhabechancen haben sollen wie nichtbehinderte Menschen. Die soziale Wirklichkeit sieht allerdings anders aus und wurde schon früh als Problem erkannt (vgl. z.B. von Ferber 1972). Deshalb erweist sich die Integrationspraxis als Eingemeindung des Besonderen in das Allgemeine und entspricht quasi einer Rückbzw. Zuführung behinderter Menschen in die Gesellschaft. Integration meint die Eingliederung behinderter Menschen in das soziale System Nichtbehinderter, aus dem behinderte Menschen nie vollständig ausgegliedert waren und sind. Der sich dadurch ergebende Kontakt zwischen Behinderten und Nichtbehinderten (vgl. Cloerkes 1982; 2001, S. 114ff.) soll zum Abbau bestehender Vorurteile (vgl. Markowetz 2000c) in einem interaktionistischen, dialektischen Prozess genutzt werden, Nähe und Distanz ermöglichen und im wesentlichen mitleidsfreie und die behinderte Person als solche respektierende und achtende Einstellungen hervorbringen. Integration charakterisiert also insbesondere für den Behinderten einen soziokulturellen Wandel. So gesehen bedeutet Integration nie den Wechsel vom Status »Behinderter« zum Status »Nichtbehinderter«, auch keinen Wechsel von einer Kultur zur anderen und ebensowenig die Assimilation als Übernahme der Verhaltensweisen Nichtbehinderter, ohne sie internalisieren zu können. Integration kann auch nicht bedeuten, dass ein behinderter Mensch einen Teil seines »Soseins« beibehält und einen Teil des »Soseins der Nichtbehinderten« dazugewinnt und ein »Gemischtsein« entfaltet, das seiner Herkunft, seinem »Sosein als Behinderter« nicht mehr entspricht. Integration braucht auch keine neue »Ganzheit« im Sinne einer Vereinheitlichung und Zusammenfassung der Teile zu schaffen. Integration kann nur einen dynamischen Verlauf nehmen. Der prozessuale Charakter bringt auch zum Ausdruck, dass Integration mehrere Stufen der Verwirklichung benötigt. Ein weiteres wichtiges Merkmal von Integration ist die Qualität der Kontakte untereinander. Soziale Interaktionen und Akzeptanz charakterisieren echte Integration. Die bloße physische Anwesenheit Behinderter erhöht zwar die Chance von Begegnungen (im Sinne von Buber: »Der Mensch wird am Du zum Ich«; 1965, erstmals 1919), birgt in sich aber auch die große Gefahr der Bestätigung von Vorurteilen gegenüber Behinderten. Eine solche Integration kann nur als Scheinintegration verstanden werden, die die gleichen Folgen und Auswirkungen hat wie die Verhinderung von Integration und die Aussonderung. In diesem Zusammenhang ist manchmal von »integrationsgeschädigten Menschen mit Behinderungen« die Rede. Integration, verstanden als interaktionistischer Prozess zwischen Integranden (Behinderten) und Integratoren (Nichtbehinderten), kann aber 4 niemals als abgeschlossen gelten, ebensowenig lässt sie sich vollständig antizipieren oder planen. Integration ist ein steuerungsbedürftiger, komplexer Prozess zwischen Nähe und Distanz, Entfremdung und Annäherung. Integration ist des weiteren Ziel und Weg zugleich. Ziel aller integrativen Bemühungen ist die bestmögliche Teilhabe eines Behinderten an allen gesellschaftlichen und sozialen Prozessen der Nichtbehinderten (Familie, Nachbarschaft, Kindergarten, Spielgruppe, Jugendgruppe, Schule, Beruf, Freizeit und Öffentlichkeit), ohne dass sich der Behinderte selbst dabei unwohl fühlt und auf Dauer unzufrieden wird. Integration als Weg meint die Mittel, die man einsetzt, um das Ziel zu erreichen. Heute gehen wir davon aus, dass behinderte und nichtbehinderte Kinder so früh wie möglich in Kontakt miteinander kommen sollten, um qualitative Gemeinsamkeiten entdecken zu können. Die vollständige Integration eines behinderten Menschen in alle Bereiche der Gesellschaft ist praktisch unmöglich, sie kann immer nur in Teilbereichen verwirklicht werden. Integration kann also niemals auf unrealistischen »Alles-oder-nichts«- Forderungen beruhen. Aus behindertensoziologischer Sicht können wir Integration als ein perspektivenreiches Handlungs- und Erfahrungsfeld auffassen. Alle Beteiligten stehen dabei in einem ‘verlässlichen Kontakt’ zueinander. Sie haben reichhaltig Gelegenheit miteinander zu kooperieren, sich selbst, den Interaktionspartner und das Kollektiv kennenzulernen und »Ich-, Du- und Wir-Kompetenzen« zu entfalten. Integration ist ein Prozess auf mehreren Ebenen (vgl. Reiser u.a. 1986, Reiser 1990, Wocken 1998a), der in besonders günstiger Weise kognitive, affektive und konative Komponenten von Einstellungen trianguliert und soziale Vorurteile vermeiden hilft. Damit trägt Integration essentiell zur Entstigmatisierung von Menschen mit Behinderungen bei. Integrativ gemachte Erfahrungen sind identitätsrelevante Erfahrungen (vgl. Markowetz 1998d, S. 65f.), die in die Identitätskonzepte der Interaktionspartner einbezogen werden. Eine positiv erlebte personale Integration ist der Entfaltung eines positiven Privaten Selbst (Selbstbild) förderlich. Eine gelungene soziale Integration fördert die Entfaltung eines positiven Sozialen Selbst (vermutetes Fremdbild). Beide zusammen konstituieren das Selbst einer Person, die Einfluss und Widerstand auf Fremdbilder ausüben und diese verändern kann. Identitätsrelevante situative und transsituative Erfahrungen müssen von den beteiligten Subjekten thematisiert, belichtet und kritisch bewertet werden. Gelingt dieser Prozess der »Dialogischen Validierung identitätsrelevanter Erfahrungen« (vgl. Cloerkes 2001, S. 164ff.; Markowetz 1998d, 2000a, c; 2003b, 2004b), kann die Identitätsentwicklung bei Integration insgesamt günstiger verlaufen. Sogenannte ‘beschädigte Identitäten’ sind unter integrativen Bedingungen reversibel. Integration ist aber per se noch kein Garant für durchgängig vorurteilsfreie Meinungen und dafür, dass Stigmatisierungen gänzlich ausbleiben. Aber: Integration relativiert fiktive Bilder über Behinderte (vgl. Markowetz 1993), weicht globale Etiketten auf und erleichtert den Zugang zu einer differenzierten Betrachtung des Phänomens Behinderung (vgl. Markowetz 2003b). 2.2 Inklusion – behindertensoziologische Annäherung an einen neuen Begriff 2.2.1 Inklusion – ein Leitbegriff der US-amerikanischen Special Education oder Ausdruck visionärer sozialer Gerechtigkeit und neuer gesellschaftlicher Wirklichkeit? 5 Immer häufiger wird in Fachkreisen statt von Integration von “inclusion” gesprochen (vgl. Bürli 1997). Der Terminus “Full Inclusion” stammt aus der radikalen amerikanischen Integrationsdiskussion, der zufolge alle Kinder voll in die Regelschulen integriert werden sollen und die Sonderpädagogik pauschal abzuschaffen ist (vgl. hierzu Hinz 2000; Lipsky / Gartner 1999; Opp 1997 und 1995). Im angelsächsischen Sprachraum hat der Begriff „inclusion“ bereits ab Anfang der 1990er Jahre die Begriffe „integration“ und „mainstreaming“ (vgl. z.B. Benkmann / Pieringer 1991) verdrängt. Schon seit Ende der 1980er Jahre wird der Terminus Inklusion als Leitgedanke der US-amerikanischen Special Education gebraucht, hinsichtlich seiner inhaltlichen Bedeutung und Tragweite allerdings kontrovers diskutiert (vgl. McGregor 1996; Jülich 1996, S. 300ff.). Auch die Sektion Sonderpädagogik (2001) der deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften nennt sich auf internationaler Ebene seit dem Jahr 2000 „special Education and Inclusion“. Kanada als ein „Geburtsland der inklusiven Schule“ (Sander 2002, S. 144) hat wesentlich zur Verbreitung des Begriffs beigetragen. In vielen Übersetzungen (vgl. z.B. Porter / Richler 1991) wurde der Begriff „inclusion“ schlicht mit Integration übersetzt. Ein substantieller Unterschied in den beiden Begriffen wird nicht gesehen. Üblich für diese Epoche ist die Gleichsetzung von Integration und Inklusion. Beide Begriffe werden synonym und nebeneinanderher verwendet. In den richtungweisenden Bestimmungen von Zielen im Bereich Bildung, Erziehung und Unterrichtung behinderter Kinder im „Salamanca Statement and Framework for Actions“ der UNESCO (1994) als Mitveranstalter der Weltkonferenz in Spanien rückt der Begriff Inklusion in den Mittelpunkt und bestimmt maßgeblich den dazugehörigen Aktionsrahmen. Das Dokument bestimmt bis dato nachhaltig die schul- und bildungspolitischen Entwicklungen in Europa (vgl. z.B. Charte de Luxembourg 1996) und übt Einfluss auf die Neu- bzw. Umgestaltung des Bildungswesens in Österreich genauso wie in Deutschland (vgl. z.B. KMK 1994, 2002; VDS 2004) aus. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich Inklusion im internationalen Sprachgebrauch als standardisierter Begriff durchsetzen wird, obwohl der Integrationsbegriff bei uns alltagssprachlich fest verankert ist und auch im wissenschaftlichen Kontext zur Kennzeichnung von sowohl einer pädagogischen Reformbewegung als auch einer Bürgerrechtsbewegung überwiegend verwendet wird. Die viel zitierte SalamancaErklärung mit dem dazugehörigen Aktionsrahmen hingegen stellt den Begriff Inklusion und seine Derivationen wie „inclusive education“, „inclusive schools“ usw. in den Vordergrund. Eine präzise Definition von Inklusion wurde dort allerdings nicht gegeben. So verwundert nicht, dass in der deutschen Übersetzung der österreichischen UNESCO-Kommission (Österreichische UNESCO-Kommission 1996) das Wort Inklusion und seine Ableitungen nicht mehr vorkommen, sondern fast durchwegs mit Integration, integrative, Integrationspädagogik, integrative Schule usw. übersetzt wurden. In der Tat halten viele Fachleute den Begriff für nicht übersetzbar und votieren dafür, das englische Wort in der deutschen Fachsprache zu verwenden. Biewer (2001a, 212; 2001b, S. 277) setzt sich mit den angloamerikanischen Begriffsalternativen differenzierter auseinander und schlägt für unseren Sprachraum die Verwendung des Begriffs „Einbeziehung“ vor. Statt von „Integration behinderter Kinder“ sollte seiner Meinung nach zukünftig besser von der „Einbeziehung von Kindern mit speziellem Erziehungs- und Bildungsbedarf“ gesprochen und die „integrativen Schulen“ sollten als „einbeziehende Schulen“ bezeichnet werden (ebd., S. 219). Der Terminus „Einbeziehung“ scheint sich in Wort und Schrift allerdings bei uns nicht durchzusetzen. Von Kritikern wird er sogar vehement abgelehnt, da er mit 6 der Vision einer inklusiven Gesellschaft nicht in Einklang zu bringen ist und zum Ausdruck bringt, dass es nach wie vor noch Außenstehende gibt, die weiterhin ´in etwas hinein zu ziehen´ sind (vgl. z.B. Hinz 2004, S. 46f.). Vielmehr taucht in deutschsprachigen Publikationen der Begriff "Inclusion" und davon abgeleitet "Inklusion" zunächst vereinzelt in den 1990er Jahren und heute zunehmend häufiger auf. Allerdings wird "inclusion" hierzulande häufig im Sinne eines modisch-trendigen Anglizismus ohne nähere Erläuterungen gebraucht. Substantielle Auseinandersetzungen mit den daraus resultierenden Implikationen sind kaum vorzufinden. Selbst in Fachkreisen wird die Vokabel Integration unreflektiert gegen Inklusion ausgetauscht und alles was bislang integrativ war nun als inklusiv bezeichnet. Kritisch-konstruktive Beiträge, wie sie insbesondere von Andreas Hinz (2002, 2004) und Alfred Sander (2002, 2003, 2004) vorgelegt wurden, sind leider noch Ausnahmen. Noch wird "Inclusion" mit dem einheimischen Begriff "Integration", insbesondere im schulischen Bereich weitgehend gleichgesetzt, während Sander (2002, S. 149) bereits ein Verständnis von ´Inklusion als optimierter und erweiterter Integration´ argumentativ vertritt und das deutsche Fremdwort Inklusion favorisiert. Folgerichtig nennt er eine optimierte und erweiterte Integrationspädagogik nun inklusive Pädagogik (vgl. Schnell / Sander 2004), bezeichnet eine optimierte und erweiterte integrative Bildung als inklusive Bildung und versteht unter einer inklusiven Schule eine integrative, völlig aussonderungsfreie Reformschule, die allen Kindern und Jugendlichen die individuell optimale Bildung und Erziehung vermitteln will (Sander 2002, S. 152). Um eine Vorstellung darüber, was im Einzelnen an der schulischen Integrationspraxis optimiert und erweitert werden muss, damit von Inklusion gesprochen werden kann, verweist Sander auf Andreas Hinz, der in mehreren Aufsätzen die Praxis der Integration und (noch zu entfaltenden) Praxis der Inklusion tabellarisch gegenübergestellt und im Spiegel der Konturen einer Pädagogik der Vielfalt nachvollziehbar erläutert hat (vgl. Hinz 2000, 2002, 2004): Praxis der schulischen Integration Praxis der schulischen Inklusion Eingliederung von Kindern mit bestimmen Bedarfen in die Allgemeine Schule Differenziertes System je nach Schädigung Zwei-Gruppen-Theorie (behindert/nichtbehindert; mit /ohne sonderpädagogischem Förderbedarf) Aufnahme von behinderten Kindern Individuumszentrierter Ansatz Fixierung auf die institutionelle Ebene Ressourcen für Kinder mit Etikettierung Spezielle Förderung für behinderte Kinder Individuelle Curricula für einzelne Förderpläne für behinderte Kinder Anliegen und Auftrag der Sonderpädagogik und Sonderpädagogen Sonderpädagogen als Unterstützung für Kinder mit sonderpädagogischem Leben und Lernen für alle Kinder in der Allgemeinen Schule Umfassendes System für alle Theorie einer heterogenen Gruppe (viele Minderheiten und Mehrheiten) Veränderung des Selbstverständnisses der Schule Systemischer Ansatz Beachtung der emotionalen, sozialen und unterrichtlichen Ebenen Ressourcen für Systeme (Schule) Gemeinsames und individuelles Lernen für alle Ein individualisiertes Curriculum für alle Gemeinsame Reflexion und Planung aller Beteiligter Anliegen und Auftrag der Schulpädagogik und Schulpädagogen Sonderpädagogen als Unterstützung für Klassenlehrer, Klassen und Schulen 7 Förderbedarf Ausweitung von Sonderpädagogik in die Schulpädagogik hinein Kombination von (unveränderter) Schul und Sonderpädagogik Kontrolle durch Expertinnen und Experten Veränderung der Sonderpädagogik und Schulpädagogik Synthese von (veränderter) Schul- und Sonderpädagogik Kollegiales Problemlösen im Team Selbst wenn an dieser Stelle zu kritisieren ist, dass einmal mehr die Einführung des Verständnisses von Inklusion und die Praxis der Inklusion primär mit Schule in Verbindung gebracht wird und Inklusion unzulässig auf die Entwicklung einer Schule für Alle und Pädagogik der Vielfalt reduziert wird, können und dürfen wir aus soziologischer Sicht nicht davon ausgehen, dass der schulischen Inklusion die gesellschaftliche Teilhabe auf dem Fuße folgt, Ausgrenzung verhindert und Lebensqualität garantiert. Es ist deshalb zu begrüßen, dass neben Integrationswissenschaftlern auch traditionelle Selbsthilfe-Zusammenschlüsse und Behindertenverbände (vgl. z.B. Gerben de Jong 1995; Netzwerk People First Deutschland 2002; Niehoff 2000; Österwitz 1996) sich vermehrt am Paradigma der Inklusion orientieren, sich differenziert an der Klärung der Begriffe beteiligen und insbesondere Entwicklungslinien eines sozialen Netzes außerhalb von Schule entwerfen, das alle Bürger einbezieht (vgl. z.B. Niehoff 2002). So ist beispielsweise im Fachdienst der Lebenshilfe (1995, S. 13) zu lesen: „Während sich 'Integration' als Leitbegriff stärker auf die 'Wiederherstellung einer Einheit' und damit vor allem auch auf besondere Maßnahmen bezieht, die es Menschen mit Behinderungen ermöglichen sollen, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, von dem sie vorher ausgeschlossen waren, geht der Begriff 'Inclusion' weit darüber hinaus und fordert radikal, dass Behinderung als normale Spielart menschlichen Seins in allen gesellschaftlichen Bereichen akzeptiert und entsprechend in alle administrativen Planungen regelhaft einbezogen werden muss“ (Hervorhebungen R.M.). Solche und ähnliche Aussagen machen deutlich, dass der Gedanke der "Inklusion" den Integrationsbegriff bei weitem transzendiert. Inklusion als Konzept legt – wie Andreas Hinz (2002, S. 356f.) näher ausführt - seinen Schwerpunkt deutlich anders. Von zentraler Bedeutung ist das Einbezogensein als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft und eben nicht das Einbezogenwerden als ´neues´ Mitglied in die Gesellschaft. Für das Verstehen dieses Unterschiedes sind die symbolisierten Abbildungen zur Unterscheidung von Integration und Inklusion von Hinz (2004, S. 49) hilfreich. Sie visualisieren Inklusion als eine gesellschaftliche Vision menschlichen Lebens in Systemen ohne soziale Ungerechtigkeit. Das Zusammenleben und Zusammenleben der Menschen nach der Theorie einer heterogenen Gruppe (Eine-Gruppe-Theorie versus Zwei-Gruppen-Theorie) wirft aus soziologischer Sicht durchaus auch neue soziale Probleme auf. Insbesondere die gewollte Statusgleichheit aller Menschen könnte zu Spannungen zwischen dem gesellschaftlichen Normensystem und den konkreten Handlungsmöglichkeiten der Individuen und damit zu neuen Anomien (vgl. Durkheim 1893, 1897) führen. Innerhalb inklusiver Systeme könnte der Wunsch nach Differenz so groß werden, dass einzelne Personen sich von der Norm und damit von der heterogenen Gruppe absetzen wollen, mehr Exklusivität für sich beanspruchen und bei der Durchsetzung neue Gruppen mit neuen Mächten entstehen, die - soziologisch gesprochen wiederum einer Form abweichenden Verhaltens entsprechen würden und aus den Reihen der Inklusion mit negativen sozialen Reaktionen zu rechnen hätten. Aus behindertensoziologischer Sicht sollten deshalb vielmehr die Interdependenzen zwischen Inklusion und Exklusion gesehen und ihre wechselseitige Bedingtheit 8 diskutiert werden, um Inklusion pädagogisch und didaktisch zu gestalten (vgl. hierzu Markowetz 2001c, 2003c, 2004a). Trotz der Vorbehalte hinsichtlich Inklusion als gesellschaftlicher Königsweg, ist die Weiterentwicklung des integrativen Handelns hin zum inklusiven Denken zu begrüßen und auch notwendig. Sie erstreckt sich sowohl auf die anthropologischphilosophischen Grundlagen von "Inklusion", deren sozial-politischen Handlungsimplikationen als auch auf die Einbeziehung aller Bereiche menschlicher Existenz sowie aller Formen menschlicher Vielfalt in inklusive Überlegungen. Damit definiert sich Inklusion als elementares Anliegen und fundamentale Aufgabe unserer Gesellschaft, die weder von der Sonderpädagogik noch von der Allgemeinen Pädagogik allein bewältigt werden kann. Wie Walter Dreher (2000, S. 56) zutreffend anmerkt, geht es der Inklusionsbewegung nicht länger um "neue Perspektiven in der Sonderpädagogik", sondern eher um "Perspektiven einer neuen Pädagogik" und letztendlich "um eine Gesellschaft für alle Menschen". Des weiteren wird deutlich, dass Inklusion als gesellschaftliche Vision des Zusammenlebens und Zusammenhandelns von Menschen sich nicht auf Menschen mit Behinderungen beschränkt, sondern alle Dimensionen von Heterogenität wie ability, gender, ethnicity, nationality, first language, races, classes, religions, sexual orientation, physical conditions und andere mehr in den Blick nimmt (vgl. Hinz 2004, S. 46). Inklusion postuliert die Teilhabe aller Menschen als ein Grundrecht für alle Menschen. Inklusion ist also ein Menschenrecht, das selbstverständlich auch und gerade für Menschen mit Behinderungen eigentlich keiner besonderen Begründung bedarf! 2.2.2 Inklusion als Menschenrecht In allen Gesellschaften lassen sich hingegen soziale Ungleichheiten, letztlich als Ausdruck der Missachtung von Menschenrechten ausmachen. Diese soziale Wirklichkeit führt vor Augen, dass keineswegs alle Menschen die gleichen gesellschaftlichen Teilhabechancen und -möglichkeiten haben. Eine behindertensoziologische Grundannahme hierzu lautet: Behinderung ist nichts Absolutes, nichts Objektives, sondern wird sozial konstruiert! (vgl. Cloerkes 2003b, S. 11). Gesellschaftliche Erwartungen an den Menschen schaffen Behinderte. Normabweichungen bestimmen Einstellungen und Verhalten gegenüber behinderten Menschen, repräsentieren und stabilisieren ein vorherrschendes Menschenbild. Verschiebungen in der gesellschaftlichen Wertestruktur können maßgeblich dazu beitragen Behinderung als eine natürliche Variante des sozialen Lebens zu verstehen. Deshalb ist es von fundamentaler Bedeutung, gesellschaftliche Teilhabe nicht nur als Menschenrecht zu verstehen, sondern nachhaltig ins gesellschaftliche Bewusstsein zu befördern und gemeinde- und alltagsnah praktisch umzusetzen. Inklusion muss gesellschaftlich ausdrücklich bejaht und gewollt werden. Wer die Grundrechte unseres Gemeinwesens ernst nimmt, gerät zunächst sicher in einen normativen Konflikt, wird aber sein Menschenbild verändern und seinen Beitrag am sozialen Wandel leisten können. Die gesellschaftliche Realität mit ihren Normen und Werten ist nicht statisch und deshalb prinzipiell veränderbar. Inklusion als Axiom dürfte deshalb langfristig den normativen Kontext innerhalb einer Gesellschaft verändern und den Wertwandel katalytisch beschleunigen. Inklusion basiert also auf einem Menschenbild, das die ausschließliche Normorientierung unserer Gesellschaft am Gesunden und Vollhandlungsfähigen aufhebt und die Unterschiedlichkeit der einzelnen Menschen als zum Menschsein notwendig zugehörig und damit als Variante von "Normalität" begreift. 9 Verschiedenheit wird dabei als eine Bereicherung des menschlichen Lebens und des Zusammenlebens der Menschen gewertet. Auf dieser anthropologischen Basis ist Inklusion "als ein grundlegendes Menschenrecht jedes einzelnen Bürgers einer Gesellschaft" zu sehen, das seine Grundlagen nicht aus der Sonderpädagogik bezieht, sondern "aus der Tradition der nordamerikanischen Diskussion über Menschen- und Bürgerrechte" (Fachdienst der Lebenshilfe 1995, S. 13f). Damit knüpft Inklusion nicht an den traditionellen Konzepten der Behindertenhilfe (Behinderte als hilflose, therapie- und eingliederungsbedürftige Menschen, die heilsbringende Experten benötigen; (vgl. hierzu die Handlungsmodelle nach Kobi 1977)), sondern ruft emanzipatorische, sozial-politische Konzepte wie Selbstbestimmung, Empowerment und Self-Advocacy (vgl. Hähner u.a. 1997; Stark 1996; Theunissen 1999; Theunissen / Plaute 1995) auf den Plan. Im Unterschied zum Leitziel Normalisierung und Integration ist der Begriff Inklusion auf das Engste mit einer „Entinstitutionalisierung von Behinderung“ (vgl. hierzu Cloerkes 2001, S. 33f.) verbunden. Zurecht fordert Niehoff (2002, S. 5) „Community Care als notwendiges Instrument, um eine inklusive Gesellschaft anzustreben: also Inklusion durch Gemeinwesenarbeit“ herzustellen. Community Care meint schlicht, dass Menschen mit Behinderungen vorbehaltlos als vollwertige Bürger mit denselben Rechten und Pflichten wie jeder Bürger in der örtlichen Gesellschaft leben, wohnen, arbeiten und sich erholen und dabei selbstverständlich von der Gesellschaft unterstützt werden. In einer inklusiven Gesellschaft brauchen deshalb Menschen mit Behinderungen weder aus ihrer familiären Umgebung genommen, noch in spezielle Institutionen gebracht werden, sondern verbleiben in ihrem primären sozialen Netzwerk (= „Community Living“, vgl. z.B. Knust-Potter 1995; Thimm 1994). Dabei versteht es sich, dass diese Netzwerke Zuwendung gewähren, um diese Menschen hierbei angemessen zu unterstützen (= „Supported Living“, vgl. z.B. Krüger 2000; Lindmeier / Lindmeier 2001). Inklusion geht es in Anerkennung von Vielfalt darum, alle notwendigen Ressourcen bereitzustellen und einzusetzen, um strukturelle Barrieren genauso wie die Schranken in den Köpfen abzubauen und die gesellschaftliche Teilhabe umfassend sicherzustellen. Eine eindrucksvolle Vorstellung wie solche Strukturen theoretisch reflektiert, entwickelt und als praktische Gemeinwesenarbeit im Alltag gelebt werden, gibt Klaus von Lübke (1994). Doch auch unspektakulärere Beispiele aus dem Freizeitbereich, die eine Ausgrenzung von vorn herein im Sinne von „Prävention und Integration durch Kooperation“ (Heimlich 2003, S. 193) nicht zulassen, verdienen Beachtung (z.B. Markowetz 1996; 1998a, b; 2000b, d; Sack 1999; Sportjugend Hessen 2001, S. 79ff.; Wagner-Stolp 1997). Solche Unterstützungsmodelle fordern den Ausbau eines bürgernahen, quartiersbezogenen Angebots ambulanter und offener Hilfen und Dienstleistungen sowie die Vernetzung der sozialen Altenhilfe, Pflege, Behindertenhilfe, Gesundheitshilfe mit kommunalen Angeboten. Mit der Förderung sozial lebendiger Gemeinwesenarbeit, in die Menschen mit Behinderungen als vollwertige Bürgerinnen und Bürger eingebunden sind, richten sich natürlich Fragen ihrer Finanzierung an die Politik. Persönliche Budgets, die dem individuellen Wunsch- und Wahlrecht behinderter Menschen gerecht werden und Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Behinderten einen maßgeblichen Stellenwert einräumen, dürften deshalb aussondernde Maßnahmen innerhalb der bislang üblichen „Institutionalisierung von Behinderung“ (vgl. Cloerkes 2001, S. 33ff.) zurückdrängen, aber auch in Konkurrenz zu den etablierten Institutionen und ihren Trägern treten. Insgesamt betrachtet bedarf es einer Integrations- und Balanceleistung von 10 institutioneller Förderung und persönlicher Förderung, damit Inklusion nicht zu einem Recht ohne Ressourcen verstummt, das dann zwar Gültigkeit beansprucht, gesellschaftlich aber nicht umgesetzt werden kann! Persönliche Zukunftsplanung (Boban / Hinz 1999, 2003c) darf also nicht nur als Chance für mehr Selbstbestimmung verstanden werden, sondern ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass Menschen mit Behinderungen überhaupt inklusive Lebenswege gehen können! "Inclusion is a right, not a privilege for a selected few" (McGregor 1996, S. 13). Mit diesen Worten begründete ein Richter in New Jersey schulische Inklusion und verpflichtet damit Schulbehörden, bei der Beschulung von Kindern mit Behinderungen die allgemein zugänglichen Regelschulen als allererstes zu berücksichtigen, da jedes Kind das Recht hat, in die jeweils zuständige Regelschule aufgenommen zu werden. Aus diesem Menschenrecht folgt konsequenterweise "die Pflicht der Schulbehörden, behinderte Kinder ganz selbstverständlich in die allgemeinen Schulkonzepte einzubeziehen" (Fachdienst der Lebenshilfe 1995, S. 14). Damit können wir das einst für die Integration so wichtig erachtete Prinzip der Freiwilligkeit (vgl. Markowetz 2001a, S. 180ff. und S. 214f.) für überholt erklären. Inklusion ist ein Menschenrecht und bedarf weder einer Begründung noch der Zustimmung insbesondere nichtbehinderter Gesellschaftsmitglieder, aber auch behinderter Menschen, die sich bisweilen genauso gerne wie Nichtbehinderte von jenen Behinderten abgrenzen, die deutlich schwerer beeinträchtigt sind oder soziologisch gesprochen - noch mehr von der gesellschaftlich kolportierten Vorstellung von Normalität abweichen wie sie. Mir sei an der Stelle erlaubt, darauf hinzuweisen, dass mit Inklusion auch die Abgrenzung der Menschen mit Behinderungen untereinander gemeint sein muss und es einer Annäherung zwischen verschieden stark beeinträchtigter respektive behinderter Menschen genauso bedarf wie der zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen. Inklusion verträgt sich wenig mit Besonderungstendenzen und defizitorientierten Förder- und Therapiemaßnahmen. Menschen mit geistiger Behinderung sollen in allen Bereichen der Gesellschaft leben, ohne dafür besondere Vorleistungen erbringen zu müssen, d.h. sie werden "so wie sie sind" mit einbezogen. Eine Angleichung an gesellschaftliche Normalitätsvorstellungen scheidet dabei aus, denn Menschen mit Behinderungen sind gemäß den aufgezeigten anthropologischen Prämissen ja "normal" und waren dies auch schon immer. Sieht man Inklusion im normativen Kontext von Menschen- und Bürgerrechten, so treten empirische Fragen, wie wir sie als Integrationswissenschaftler über 25 Jahre hinweg brav beantwortet haben, so z.B. ob Kinder in inklusiven Klassen besser lernen oder nicht (vgl. z.B. Dumke / Schäfer 1993; Feuser / Meyer 1987; Wocken Wocken 1987, 1993), absolut in den Hintergrund. Aus behindertensoziologischer Perspektive lautet die zentrale Forschungsfrage anders: wie lassen sich Bilder, Einstellungen, Vorurteile und Stigmata gegenüber Menschen mit einer Behinderung ändern, damit sich das Anliegen unser Tagung “Vom Objekt zum Subjekt“ erfüllt? (vgl. Cloerkes 2003). Das Kleingedruckte unter diesem Titel lässt vermuten, dass dies durch inklusive Pädagogik möglich werden soll. In der Tat bilden Dekategorisierung, Kompetenzund Bedürfnisorientierung den Ausgangspunkt einer inklusiven Pädagogik. Inklusion verlagert den Blickwinkel von der Schädigung auf die notwendigen Hilfen. Nicht die Menschen werden nach Art und Intensität ihrer Behinderungen klassifiziert, sondern die Hilfen nach ihrer Art und Intensität. Anders als in den zurückliegenden Jahrzehnten sollte es keine leichte, mässige, schwere und schwerste (geistige) 11 Behinderung als Kategorie mehr geben, sondern nur noch Menschen, die einen "leichten", "mäßigen", "schweren" und "schwersten" Bedarf an Assistenz und Begleitung haben (vgl. Goll 1998, S. 22ff.). Diese Vorstellung stimmt besonders mit Blick auf die Unteilbarkeit von Integration zuversichtlich. Ich erahne aber, dass auch die Inklusion rasch über den sonderpädagogischen Förderbedarf gesteuert wird und dann nicht mehr die Behinderung, sondern Art und Umfang der zu gewährenden Hilfen als Selektionsinstrument gespielt werden. Angst habe ich davor, dass schwer geistig und mehrfachbehinderte Menschen auch bei Inklusion die Verlierer sein könnten (vgl. Markowetz 2001a, S. 230). Aus diesem Grunde setzen sich Behindertenorganisationen, die vor allem für die Rechte von Menschen mit Behinderungen advokatorisch eintreten, sehr offensiv für Inklusion ein, dies sowohl im wissenschaftlichen als auch im politischen Bereich. Ein Beispiel ist die Association for Persons with severe Disabilities (TASH), die unmissverständlich ihren Auftrag formuliert: "TASH actively promotes the full inclusion and participation of persons with disabilities in all aspects of life" (TASH 2000, S. 2). Zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse und zur Bewältigung von behinderungsbedingten alltäglichen Problemen sind Menschen mit Behinderungen bisweilen erheblich und lebenslang auf die Hilfe und Mitwirkung von Betreuer/-innen angewiesen (vgl. Rödler 2000), die in erforderlichem Umfang den damit verbundenen komplexen Anforderungen kompetent, ganzheitlich und sensibel entsprechen können. Doch auch diese Menschen mit Behinderungen brauchen Assistent/inn/en (vgl. Markowetz 1998a), die sie selbst aussuchen und bestellen können und die ihnen viel Spielraum und Freiheitsgrade für die Lösung ihrer facettenreichen Probleme einräumen, damit sie »ein Leben so normal wie möglich« und vor allen Dingen »selbstbestimmt« führen können. Hierfür ist es notwendig, unsere alten, diskreditierenden und defektorientierten Bilder über Menschen mit Behinderungen (vgl. Markowetz 1993) zu überwinden und Behinderte als gleichberechtigte Subjekte anzuerkennen, mit denen man reden und in Dialog treten kann, statt über sie zu reden und sie mechanisch, unpersönlich und in disziplinierender Absicht sowie einseitiger kompensatorischer Zurüstung auf die Verhältnisse der Nichtbehinderten wie Objekte zu behandeln. Wer die (heil)pädagogische Praxis neu gestalten möchte, muss zunächst das Subjekt (wieder)entdecken und ein egalitäres Menschenbild entfalten. Ein egalitäres Menschenbild ist zugleich ein integrierendes Menschenbild und kennzeichnet einen Paradigmenwechsel vom distanzierenden hin zum integrierenden Menschenbild sowie von der Sonderpädagogik zu einer gemeindewesenorientierten und wohnortnahen, nichtaussondernden inklusiven Pädagogik. Egalitär im Sinne von Schlömerkemper (1989) bedeutet, dass an den Menschen mit einer Behinderung keine Bedingungen zu stellen sind, damit er respektiert und als Mensch für »vollwertig« genommen wird, sondern dass ihm unabhängig von seiner Leistungsfähigkeit ein doppelter Anspruch auf Gleichberechtigung zusteht: Der Anspruch auf optimale Förderung in sozialer Integration und der Anspruch auf gleiche Lebenschancen. Die zentralen Leitbegriffe einer solchen wertgeleiteten und inklusiven Pädagogik der Zukunft lauten: Normalisierung, soziale Integration, Selbstbestimmung, Autonomie, Emanzipation, Antidiskriminierung und Gleichstellung sowie Demokratie und Humanität. Mit diesen Begriffen haben wir uns umfassend und tiefgreifend auseinanderzusetzen, wenn wir die pädagogische Praxis neu denken und gestalten wollen. Als zentrale, handlungsleitende Grundwerte wären zu nennen: 12 Die Achtung der Würde und Gleichheit jedes Menschen und die Nächstenliebe zu jedem Menschen; die Aufhebung der Bedrohung durch das Leitbild der Normalität; die Orientierung am Verständnis einer humanen Umwelt; die Aufgabe der Meinung von der Existenz minderwertigen Lebens; die Anerkennung einer egalitären Gleichwertigkeit trotz extremster individueller Verschiedenartigkeit; die Unverletzbarkeit und Unverlierbarkeit der Würde eines jeden Menschen, unabhängig von Art und Schweregrad einer Behinderung; die Beachtung der Relativität von Behinderung und die Neuorientierung auf einen egalitären Behinderungsbegriff; der Rekurs auf den ethischen Imperativ, wie er verfassungsmäßig in unseren Grundgesetzen festgeschrieben ist; das existentielle Vorhandensein der Identität eines jeden Menschen, die als substantieller Kern das Innerste des Seins bestimmt und jeden Menschen zu einer unverwechselbaren, einzigartigen Person macht; das Grundrecht auf eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe; das Grundrecht auf lebenslange Bildung, Erziehung, Förderung und Entwicklung der Persönlichkeit; die Beachtung des Wesensmomentes des Integrativen in allen Lebensbereichen und Lebenssituationen; das Schaffen einer »solidarischen Kultur«; die vier Grundwerte des menschlichen Zusammenlebens: Selbstbestimmung, Achtung der Person, Förderung der seelischen und körperlichen Funktions- und Leistungsfähigkeit, soziale Ordnung; die ökosystemische Sichtweise; die transdisziplinäre Zusammenarbeit beteiligter Professionen; die Anerkennung der Eltern behinderter Kinder als gleichberechtigte Experten; sowie die Stärkung der Position der Eltern, des Elternwillens und eines uneingeschränkten Elternwahlrechts; die dialogische Grundhaltung, die als Maxime lauten könnte: Nicht über die Behinderten, sondern mit ihnen sprechen! 2.3 Zwischenbilanz Wenn ich an dieser Stelle vorsichtig zwischenbilanziere, dann dürfen wir zunächst nüchtern feststellen, dass Integration und Inklusion zwei zentrale, teilweise synonym und teilweise unterschiedlich verwendete Begriffe sind. Bereits Jakob Muth ventilierte mit Nachdruck, dass auch der Terminus Integration ein „Grundrecht im Zusammenleben der Menschen“ (Muth 1991, S. 1) betont und damit dem heute international favorisiertem Verständnis von Inklusion (vgl. Hinz 2002, 2004; Sander 2002, 2003; Schnell / Sander 2004) zu entsprechen vermag. Inklusion als Konzept zementiert axiomatisch das Einbezogensein von Menschen mit Behinderungen als 13 vollwertiges Mitglied in unserer Gesellschaft. Inklusion ist deshalb Ausdruck einer Vision einer inklusiven Gesellschaft, die es in Anerkennung der Gleichheit und Verschiedenheit der Menschen erst gar nicht zur Ausgrenzung kommen lässt. Solange aber Aussonderung stattfindet und Menschen mit Behinderungen ausgesondert sind, sind soziale Integrationsbemühungen zwingend notwendig und damit auch die Verwendung des Begriffs angebracht und legitim. Integration ist deshalb eine real existierende Vorstufe von Inklusion und als praktisch offensichtlich notwendiger Schritt in Richtung zu einem umfassenden Inklusionsverständnis anzuerkennen. Wir müssen uns also damit abfinden, dass uns noch eine ganze Zeit lang beide Begriffe begegnen werden. Die Gefahr, dass dabei die bestehenden Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen Integration und Inklusion verwässert werden und von gesellschaftlichen Mächten dazu verwendet werden, um sowohl die Integration als auch die Inklusion klein zu halten, Behinderte als Minderheit und soziales Problem zu erhalten sowie Behinderung traditionell wie bisher zu institutionalisieren, muss gesehen werden. Letztlich ist vor übertriebenen Hoffnungen, die der Begriff und das Konzept der Inklusion auszulösen vermag, zu warnen. Weder neue Wortschöpfungen noch der bloße Austausch von Etiketten hat die soziale Wirklichkeit von Menschen mit Behinderungen nachhaltig verbessert. Ich erinnere an die nüchterne Bilanz von Bengt Nirje (1994) nach 25 Jahren der Beachtung des Normalisierungsprinzips, das gleichsam zeitverzögert von Wolf Wolfensberger (1972, 1980, 1986) aus den USA nach Deutschland reimportiert wurde und bis zur Ablösung durch den Begriff Integration als die zentrale Leitidee gehandelt wurde. Vielleicht brauchen wir für große gesellschaftliche Veränderungen und inklusive Visionen noch mehr Geduld. Inklusion sollte eine Aufgabe für Generationen werden, damit es zu Verschiebungen und Umschichtungen in der gesellschaftlichen Wertestruktur kommt. Nach dem gegenwärtigen Stand der behindertensoziologischen Forschung ist schon heute ein uneingeschränktes Zusammenleben und Zusammenhandeln aller Menschen in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit und Einzigartigkeit von klein auf und damit die Inklusion der einzig sinnvolle Weg zu einer positiven Veränderung der sozialen Reaktion auf Menschen mit Behinderungen. Mein bescheidener Versuch der Annäherung an zwei schwierige, wohl aber unverzichtbare Begriffe wäre unvollständig, wenn diese bezugslos zur sozialen Realität und pädagogischen Praxis bleiben würden. Lassen Sie mich deshalb in meinem letzten Vortragsteil den Blick auf ein konkretes Handlungs- und Erfahrungsfeld richten und fragen, ob Inklusion im Lebensbereich Freizeit neue Hoffnungen für die Selbstbestimmung und Partizipation von Menschen mit Behinderung weckt, bzw. was zu tun und zu fordern wäre, damit Inklusion im Freizeitbereich eine Chance hat und die soziale Integration von Menschen mit Behinderung gelingt. 3. Integration und Inklusion im Lebensbereich Freizeit – Hoffnungen, Wünsche und Forderungen für mehr Selbstbestimmung und Partizipation 3.1 Freizeit im postmodernen Leben Neben Arbeit und Wohnen ist Freizeit ein tragender Bereich im Leben behinderter Menschen. Freizeit als "Eigenzeit, Sozialzeit, Bildungszeit und Arbeitszeit" (Opaschowski 1990, S. 17) ist nach dem Konzept der "Lebenszeit" für behinderte 14 Menschen ein genauso wichtiges Anliegen wie für nichtbehinderte Menschen. Freizeit ist ein unverzichtbarer Bestandteil menschlichen Lebens und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung und Identität eines jeden Menschen. Freizeit stellt ein großes Potential zur Entfaltung der persönlichen Lebensqualität dar. Die Freizeitqualität ist ein Spiegelbild der Lebensqualität. Die nüchterne Betrachtung der Freizeitwirklichkeit behinderter Menschen verdeutlicht, dass die individuelle und gesellschaftliche Lebensqualität behinderter Menschen noch erhebliche Mängel aufweist und dem Normalisierungsprinzip folgend (vgl. Adam 1977; Bank-Mikkelsen 1980; Nirje 1994; Thimm 1984; Wolfensberger 1986) noch immer zu verbessern ist. Inklusion können wir als ein perspektivenreiches Modell der Suche nach Lebensqualität auffassen. Im postmodernen Leben wird der Freizeitbereich für alle Menschen eine zentrale Rolle spielen. Lösungen im materiellen Bereich und der uferlose Ausbau von immer vielfältigeren, weitgehend marktwirtschaftlich gesteuerten Freizeitangeboten allein wird nicht zu der gewünschten Lebensqualität führen. Aufgabe zukünftiger Sozialund Gesellschaftspolitik ist es, eine Freizeitinfrastruktur zu schaffen, die zu qualitativen sozialintegrativen und umweltverträglichen Freizeitentwicklungen führen und eine qualitative "integrative", multikulturelle Freizeitkultur hervorbringt. Hierzu muss die Freizeitpädagogik Freizeitkompetenzen vermitteln, die die Menschen nicht nur befähigen, mit ihrer "freien Zeit", der Angebotsvielfalt und dem Überfluss irgendwie zurechtzukommen, sondern die drohende Bewusstlosigkeit und das Ausgeliefertsein selbstreflexiv zugunsten einer sinnerfüllten, selbstbestimmten Freizeitgestaltung abwenden können. Eine solche Freizeitgestaltung wirkt bildend und beinhaltet soziales Lernen. Freizeit wird dann zu einem gewinnbringenden, identitätsstiftenden und die Persönlichkeit stärkenden Erlebnis, das Kultur, Bildung, vielfältige soziale Kontakte und soziales Engagement zur Gestaltung unserer Lebenszeit entdeckt und ein Bewusstsein für die Bewältigung "epochaltypischer Schlüsselprobleme“ (vgl. Klafki 1993, S. 56ff.) schaffen kann, beispielsweise die Friedensfrage, die Umweltfrage, die Gefahren und Möglichkeiten der neuen technischen Steuerungs-, Informations- und Kommunikationsmedien oder die gesellschaftlich produzierte Ungleichheit innerhalb unserer und anderer Kulturen, z.B. zwischen sozialen Klassen und Schichten, Männern und Frauen, behinderten und nichtbehinderten Menschen, arbeitslosen und arbeitenden Gesellschaftsmitgliedern, Ausländern und Einheimischen oder noch globaler zwischen den Ländern einer sog. "Ersten", "Zweiten", "Dritten" oder gar schon "Vierten" Welt. Die Freizeitpädagogik der Zukunft fußt auf diesen Vorstellungen eines neuen Allgemeinbildungskonzepts, das Bildung für alle zulässt, selektive Faktoren abbaut, integrative Strukturen schafft, auf die Ausbildung zwischenmenschlicher Beziehungsmöglichkeiten Wert legt und die Sozialität des Menschen stärkt. Noch aber zeigt sich die Wirklichkeit anders. Die öffentliche wie die auch noch bei professionellen Helfern verbreitete Meinung "behinderter Mensch = behinderte Freizeit" kennzeichnet den traditionellen, defektorientierten Zugang zu unserem Thema und bestimmt bis heute weitgehend die Freizeitsituation behinderter Menschen. So belegen beispielsweise die Ergebnisse einer Befragung zur Freizeit von Mitarbeiter/-innen in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) nachdrücklich die These einer "behinderten Freizeit" für Menschen mit einer geistigen Behinderung (vgl. Ebert / Villinger 1999, S. 272). Das System Sonderpädagogik mit seinen zahlreichen Einrichtungen der Rehabilitation reagierte auf Anormalitäten und spezielle behinderungsbedingte Bedürfnisse mit besonderen Angeboten. Von solchen "Sonderfreizeitmaßnahmen" versprach man sich, dass ihnen die soziale 15 Integration ohne größeres Hinzutun auf dem Fuße folgt. Im Vergleich zu sonderpädagogisch organisierten Maßnahmen der Freizeitgestaltung sind trotz der anhaltenden Integrationsdiskussion grundlegend integrativ angelegte Angebote im Lebensbereich Freizeit quantitativ wie qualitativ nach wie vor eher die Ausnahme, obwohl gerade der Freizeitbereich als leistungsfreier Sektor ein bevorzugtes Feld der sozialen Integration von Menschen mit Behinderungen darstellt. Nur langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass eine Behinderung nicht zwangsläufig und nicht in jedem Fall zu Problemen bei der Freizeitgestaltung führt und die Freizeitbedürfnisse von Menschen mit einer Behinderung auffällig hohe Gemeinsamkeiten zu den nichtbehinderter Menschen aufweisen. Dennoch ist es durchaus angebracht, ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Integration nicht als Gleichmacherei und Gleichbehandlung missverstanden werden darf, sondern behinderungsbedingte Schwierigkeiten ernstzunehmen und selbstverständlich unter integrativen Verhältnissen genauso zu berücksichtigen sind, wie sie traditionell unter separierenden Bedingungen Beachtung finden. Eine ganze Reihe plausibler Zusammenhänge zwischen einer Behinderung und dem Freizeitverhalten eines Menschen mit einer Behinderung müssen berücksichtigt werden. Neben Art und Schweregrad der Behinderung spielen der Zeitpunkt des Erwerbs einer Behinderung, die Sichtbarkeit der Behinderung, die Prognose über den Verlauf der Behinderung, die rehabilitativen Möglichkeiten, die Schulbildung, die Berufsbildung und die Berufstätigkeit, die Lebenslage, die Wohnsituation und Unterbringungsform, die sozio-ökonomischen Verhältnisse der Ursprungsfamilie bzw. das eigene Vermögen und Einkommen, das soziale Netzwerk und die ökosystemischen Verhältnisse sowie das Ausmaß an subjektiv erlebten sozialen Vorurteilen und Stigmatisierungen eine Rolle. Im Kontext sozialintegrativer Freizeitgestaltungsmöglichkeiten gilt es sowohl die Vielzahl möglicher Wirkvariablen, die unmittelbar mit der Behinderung zusammenhängen als auch die sozialen Reaktionen auf die Behinderung in den Blick zu nehmen. Schließlich ist zur Kenntnis zu nehmen, dass das Thema Freizeit auch für Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Lebenslagen und Lebensphasen eine eigene Dynamik entwickelt, die von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, Trends, Klischees, geschlechter- und rollenspezifischen Einflüssen und von der Werbeindustrie protegierten Lebensstilen sowie historisch gewachsenen Ideologien und tradierten Weisheiten abhängt und auch von psychosozialen Problemen wie z.B. Vereinsamung, Langeweile, Stress und anderen Gesundheitsgefährdungen begleitet sein kann. Es ist deshalb von allergrößter Bedeutung, dass die Integrationsfähigkeit behinderter Menschen nicht länger ausschließlich an der behinderten Person festgemacht wird, sondern insbesondere der Blick auf das ihn umgebende vielschichtige System gerichtet wird. Nach dem sozialökologischen Modell des ökosystemischen Ansatzes (vgl. hierzu Markowetz 2001a, S. 188ff.) ist auch die Integrationsfähigkeit der einen behinderten Menschen umgebenden Systeme mit ihren Personen, Rahmenbedingungen, dort wirkenden gesellschaftlich-normativen Werten zu prüfen und entsprechend herzustellen. 3.2 Inklusion und die Integrative Freizeitgestaltung fordert den Wechsel vom Fürsorgeansatz zum Bürgerrechtsansatz Die von mir als Herausgeber des Sammelbandes zur „Freizeit im Leben behinderter Menschen“ (vgl. Markowetz / Cloerkes 2000) exemplarisch aufgegriffenen und ins Bild gesetzten Praxisbeispiele zeigen richtungsweisende Möglichkeiten der integrativen Freizeitgestaltung auf. Sie verdeutlichen bisweilen sehr eindrucksvoll, dass behinderte Menschen mitten im Leben stehen, als gleichberechtigte Bürger am 16 gesellschaftlichen Leben teilhaben und vermehrt Einfluss auf die Lebenszeitgestaltung nehmen wollen. Behinderte Menschen wollen frei wählen können und Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten in Anspruch nehmen. Selbstbestimmung, Autonomie, Emanzipation, Antidiskriminierung, Gleichstellung, Normalisierung, Demokratisierung und Humanisierung sowie umfassende Integration und gesellschaftliche Teilhabe sind dabei die zentralen pädagogischen, bildungsund gesellschaftspolitischen Schlagworte (vgl. Markowetz 1999a, S. 13f.). Es geht darum, den Wechsel vom "Fürsorgeansatz" zum "Bürgerrechtsansatz" zu vollziehen. Hierzu müssen wir die traditionelle Kultur des Helfens in der Sonderpädagogik überwinden und Menschen mit einer Behinderung nicht länger als belieferungs-, anweisungs- und behandlungsbedürftiges Klientel, sondern als Experten in eigener Sache anerkennen. Der Slogan "nichts über uns ohne uns", wie ihn die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben ihrer Philosophie voranstellt (vgl. MilesPaul 1999), macht in besonderer Weise darauf aufmerksam. Statt als helfende Macht aufzutreten sollten wir uns als gleichberechtigte, integre Dialogpartner verstehen, die mit speziellen Hilfen, Diensten und Angeboten aufwarten und an den individuellen Stärken und Kompetenzen bzw. bisweilen noch verborgenen Ressourcen der betroffenen Personen (Theunissen 1999) anknüpfen. Das Konzept des "Empowerment" (vgl. Stark 1996; Theunissen / Plaute 1995) greift diese Sichtweise auf und steht Pate für ein neues Selbstverständnis der Sonderpädagogik. Wir können es als ein weitreichendes Handlungsmodell in der sozialen Arbeit und integrationspädagogischen Behindertenhilfe auffassen, das uns zu professioneller Bescheidenheit aufruft und uns zur Übernahme einer neue Helferrolle, der "subjektzentrierten Assistenz" (Theunissen 1999, S. 279), bewegt. Diese fundamental neue Sicht- und Zugangsweise erwachsener Menschen mit einer Behinderung, wie sie beispielsweise in Deutschland in der "Initiative Selbstbestimmt Leben" (vgl. hierzu Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland e.V. 1995; Miles-Paul 1992; Niehoff 1993; Österwitz 1996) im Sinne der internationalen "Independent Living"-Bewegung vertreten und bereits vielseitig praktiziert wird, beeinflusst in nicht unerheblichen Maße indirekt die freizeitpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Auch hier ist zu beobachten, dass sich die gleichen handlungsleitenden Prinzipien durchsetzen und die integrationspädagogische Praxis definieren, selbst, wenn hier verständlicherweise - wie bei nichtbehinderten Kindern und noch nicht volljährigen Jugendlichen auch - das Maß an Fremdbestimmung noch deutlich spürbar ist und die organisierte inner- und außerfamiliäre Freizeitgestaltung Kindern und Jugendlichen weniger Freiheitsgrade, z.B. bezüglich ihres Mitspracherechtes und ihrer direkten inhaltlichen wie organisatorischen Einflussnahme einräumt (vgl. z.B. Herbst 2000; Baumeister / Hirning 2000). Hier wird deutlich, dass der Erziehungsbegriff für behinderte Menschen einerseits sehr stark unter dem Aspekt der Fremdbestimmung gedacht wird andererseits die "Erziehung zu einem selbstbestimmten Leben" im Kontext inklusionspädagogischer Freizeitförderung und Freizeiterziehung unverzichtbar ist. 3.3 Zur Notwendigkeit Freizeitbereich integrationsstarker Veränderungen im Nach diesen eher grundlegenden zusammenfassenden Anmerkungen stellt sich schließlich die Frage, was nun im einzelnen zu fordern und zu beachten wäre, damit Inklusion im Lebensbereich Freizeit zügiger als bisher vorankommen kann. Die hier in gebotener Kürze skizzierte Auflistung wichtiger und beachtenswerter Punkte soll in erster Linie die Fachdiskussion beleben, den Dialog mit und unter den Betroffenen 17 fördern und mittelfristig zu soliden, integrationsstarken Veränderungen führen. Ein Königsweg kann nicht aufgezeigt werden. Es gibt ihn nicht. Zu vielseitig und zu anspruchsvoll sind auch die Segmente, die den Freizeitbereich als mächtiges Ganzes erscheinen lassen, das nie vollständig und allseits zufriedenstellend erreichbar scheint. Sie reichen von der Freizeitgestaltung in der Familie oder im Heim zu den Angeboten aus dem Bereich der Erwachsenenbildung, vom oft "banalen" alltäglichen Freizeiterleben bis hin zum Thema Reisen, Urlaub und Tourismus. Was wir brauchen ist eine inklusive Landschaft im Freizeitbereich, die diese Vielfalt widerspiegelt und das Wesensmoment des Integrativen erkennen lässt. Insofern geht es zunächst darum, in jedem Einzelfall darüber nachzudenken, ob traditionelle Freizeitangebote für behinderte Menschen nicht in integrative überführt werden können. Neue Sonderfreizeitmaßnahmen sollten nur noch dort pädagogisch verantwortet werden, wo sie ausdrücklich gewünscht sind und sich von den Rahmenbedingungen her vorläufig nicht anders organisieren lassen. Sie sollten in dem Bewusstsein einer Übergangslösung angeboten und so lange durchgeführt werden, bis diese in integrative Strukturen überführt werden können. Eine vordringliche Aufgabe stellt die Öffnung bestehender Freizeitangebote für behinderte Menschen dar. Hierzu bedarf es nicht nur rein organisatorischer Umstellungen. Vielmehr muss erkannt werden, dass für die praktische Gestaltung des Alltags eine integrativen Pädagogik und Didaktik der Freizeit unverzichtbar ist und deshalb schrittweise eingeführt werden muss. An die Gemeinden, Kommunen, Städte, Bezirke, Landkreise, Regierungspräsidien, Landschafts- und Landeswohlfahrtsverbände sowie politische Gremien auf Länderund Bundesebene muss die Forderung nach einer „Stadt für Alle“ gestellt werden, nach einem Wohn- und Lebensraum, der den individuellen Bedürfnissen entgegenkommt und behinderungsbedingte Nachteile so auszugleichen vermag, dass ein Leben in sozialer Integration und die Teilhabe am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben grundsätzlich möglich ist. Soziale Integration ist als ernstzunehmende und vordringlich praktisch zu realisierende Aufgabe in allen Verwaltungsbereichen aufzufassen. Stadtentwicklungspläne und kommunale Kinderund Jugendpläne müssen darauf abgestimmt werden. In alle zentrale Verwaltungsbereiche wie Sozialund Kulturreferate, Kinderund Jugendhilfeausschüsse etc. sind unabhängige Beauftragte für Inklusion zu bestellen, die fachkompetent für eine sukzessive Umsetzung Sorge tragen. Darüber hinaus brauchen wir ein Netz wohnortnaher Beratungsstellen, das sich schnell und unbürokratisch mit aktuellen Problemen bei der Freizeitgestaltung behinderter Menschen beschäftigt und kundenorientiert bearbeitet. Besonders Spiel-, Kultur- und Freizeitangebote, ob in öffentlicher oder privater Hand verwaltet, müssen barrierefrei zugänglich und nutzbar werden. Doch nicht nur Mobilitätsprobleme gilt es, durch vorwiegend technisch-apparative Lösungen auszugleichen. Viel mehr müsste für die Schranken im Kopf getan werden. Öffentlichkeitsarbeit allein wird hierzu nicht ausreichen. Es kommt darauf an, gelebte Kontakte zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen zuzulassen und qualitativ auszubauen, damit die dabei gemachten Erfahrungen anhaltend positiv wirken. Behindertenfreizeitarbeit im klassischen Sinn und Integrationsarbeit im Lebensbereich Freizeit müssen sich ergänzen. Spezielle Freizeitangebote für Behinderte mit nicht zwingend integrativem Charakter haben nach wie vor dort ihre Berechtigung, wo sie nachhaltig gewünscht und vorläufig nicht anders organisiert und finanziert werden können. Sie dürfen nicht eingestellt werden. Dennoch sollten weniger Sonderprogramme für Behinderte den Lebensbereich Freizeit bestimmen. 18 Es ist zu fragen, warum sich die Tourismusbranche mit behinderten Kunden so schwer tut. Wenn wir den Tourismusmarkt öffnen wollen, wenn behinderte Menschen als Marktsegment entdeckt und als Kunden umworben werden sollen, dann müssen wir uns zunächst selbstkritisch eingestehen, dass wir Experten es waren, die zunächst auch für diesen Bereich ein Monopol beansprucht haben und reiselustigen Behinderten eher abgeraten haben, die Reiseangebote der allgemeinen Tourismusbranche in Anspruch zu nehmen. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass auch andere Berufsgruppen verantwortlich und kompetent mit unseren "Schützlingen" umgehen können. Wir brachten es auch nicht fertig, unser Wissen über Behinderung, unsere Erfahrungen im Umgang mit behinderten Menschen und unser "know-how" zur Bewältigung der spezifischen Probleme weiterzugeben. Wir wollten unverzichtbar sein und haben dadurch integrative Wege verbaut. Wir haben deshalb die Tourismusbranche über diesen Irrtum aufzuklären und ihr darüber hinaus unsere uneingeschränkte Hilfe anzubieten, um dieser Zielgruppe gerecht zu werden und neue kundengerechte Angebote zu schaffen. Finanzierungsmöglichkeiten für innovative und integrationsstarke Ansätze und Angebotsformen im Freizeitbereich müssen geschaffen werden. Generell muss der Freizeitbereich als eigen- und nicht randständiges Handlungsfeld ernstgenommen werden und als solches von der sozialpolitischen Gesetzgebung auf eine solide Finanzierungsgrundlage gestellt werden. Die Finanzierungsregelungen des Bundessozialhilfegesetzes für die Bereiche Wohnen und Arbeit könnten hier als Vorbild wirken. Insbesondere den Rechtsanspruch auf finanzielle Förderung von Freizeitangeboten gilt es zu stärken, um behinderten Menschen die Möglichkeit zur uneingeschränkten Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu geben. Außerdem müssen neue, verlässliche und unbürokratischere Regelungen für die Inanspruchnahme und Finanzierung von Assistenzdiensten zur individuellen Freizeitgestaltung und als "Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben Behinderter" getroffen werden. Hierzu ist es aber auch notwendig, dass die Hilfssysteme für Behinderte vor Ort ein eigenes Profil für den Freizeitbereich entwickeln und entsprechende innovative und integrationsorientierte Dienste in ihr Programm aufnehmen. So konnten beispielsweise die sogenannten Familienentlastenden Dienste (FED) die Palette ihrer Angebote um eben diese persönliche Assistenz erweitern. Eine solche konzeptionelle Arbeit bedarf der Unterstützung der Spitzenverbände, der Selbsthilfezusammenschlüsse, der Politik und des Mutes zu struktureller Erneuerung unseres Rehabilitationssystems. Nur so wird man auf Dauer dem hohen Stellenwert der Freizeit in unserer heutigen Gesellschaft gerecht werden und dafür Sorge tragen können, dass sich Freizeitbedürfnisse behinderter Menschen in sozialintegrativen Kontexten erfüllen lassen. 3.4 Eine Liste mit Forderungen Ich komme zu meinem letzten Punkt, einer Liste mit Forderungen, die die Integration behinderter Menschen fördern und die Diskussion um Inklusion im Lebensbereich Freizeit bereichern soll: Behinderte Menschen haben ein Recht gesellschaftlichen Leben im Freizeitbereich. Behinderte Menschen sollten deshalb ihre Freizeitangebote unter Beachtung individueller und gesellschaftlicher Freizeitbedürfnisse im Sinne ihrer Identitätsfindung und Persönlichkeitsentwicklung frei wählen können und die auf umfassende Teilhabe am 19 dabei entdeckten Interessen, Neigungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie vielseitige Kompetenzen sinnerfüllend ausbauen dürfen. Auch im Freizeitbereich muss dem Anspruch behinderter Menschen auf den Erhalt sozialer Kontakte zu ebenfalls behinderten Menschen genauso Rechnung getragen werden wie dem Aufbau sozialer Kontakte zu nichtbehinderten Mitmenschen. Das Freizeiterleben darf nicht länger an der Behinderung festgemacht werden. Kommunikations- und Mobilitätseinschränkungen sowie behinderungsbedingte Probleme dürfen nicht länger als Ausschlusskriterien und Begründungen für die Teilnahme an Sonderfreizeitmaßnahmen herangezogen werden. Behinderte Menschen sind in ihrem Sosein als gleichberechtigte, mündige Mitglieder unserer Gesellschaft zu akzeptieren, die als Experten in eigener Sache selbst bestimmen und entscheiden können, was sie wollen und von wem sie wann, wobei und wozu Hilfe benötigen. Der rehabilitative Förderanspruch und das pädagogisch-therapeutische Einwirken professioneller Systeme auf behinderte Menschen im Lebensbereich Freizeit ist aufzugeben. Inklusion darf dabei aber nicht als Billiglösung missverstanden werden, die nicht mehr angemessen auf Bedürfnisse reagiert und zur unterlassenen Hilfeleistung übergeht. Sofern behinderte Menschen zur individuellen Freizeitgestaltung auf Hilfen und Assistenzdienste angewiesen sind, müssen diese bereitgestellt und bedarfsgerecht finanziert werden. Der Sozialgesetzgebung ist auf der Grundlage der Grundgesetzänderung (Artikel 3 Abs. 3 GG) dringend angeraten, den hierfür notwendigen bundesweit einheitlichen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der dem Wohlwollen der Finanzierung aus öffentlicher Hand und Sozialleistungsträger abschwört. Behindertenverbände, Selbsthilfe-Zusammenschlüsse, die unterschiedlichsten Initiativen haben diesbezüglich den Wechsel vom Fürsorgeanspruch zum Bürgerrechtsanspruch transparent zu machen und dementsprechend, z.B. durch die Erarbeitung realistischer Finanzierungsmodelle, einzuwirken. Das breit gefächerte Spektrum an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten mit seinen spezifischen Freizeitangeboten (beispielsweise Ferienfreizeiten, Städtereisen, Bildungsreisen, Urlaub, regelmäßige Teilnahme an Angeboten der Erwachsenenbildung, des kulturellen und öffentlichen Lebens genauso wie das selbstverständliche Dabeisein und verantwortliche, oft ehrenamtliche Mitwirken in Vereinen, Verbänden, kirchlichen wie politischen Gruppierungen, Kultur- und Jugendzentren oder der lockere, gelegentliche Besuch von Freizeitveranstaltungen, etc.) muss prinzipiell für alle offen sein. Inklusive Freizeitmaßnahmen dürfen sich nicht auf ein Stadtteilfest oder eine integrative Ferienfreizeit beschränken, an der behinderte und nichtbehinderten Menschen teilnehmen können. Auch für Behinderte findet Freizeit täglich statt. Spielplätze, öffentliche Einrichtungen, Kneipen, Kinos etc. sind deshalb baulich und architektonisch so zu gestalten, dass Behinderte allein oder in Begleitung eines Assistenten Zugang haben und in sozialen Kontakt kommen können. 20 Für eine Übergangszeit und solange vor allen Dingen für behinderte Menschen, die im ländlichen Bereich leben oder dort in Einrichtungen der Behindertenhilfe untergebracht sind, angemessene Orte für eine integrative Freizeitgestaltung nicht in erreichbarer Nähe liegen, sind Fahrdienste einzurichten und zu finanzieren. Natürlich muss auch das behindertengerechte öffentliche Personennah- und Fernverkehrssystem verbessert werden. Bislang für Behinderte als ungeeignet deklarierte Freizeittätigkeiten gibt es nicht. Viele Angebote wie z.B. der Besuch eines anspruchsvollen Theaterstückes oder eine Bildungsreise in ein fernes Land, von denen wir denken, dass sie behinderte Menschen überfordern und nur unnötig belasten würden, dürfen wir Behinderten nicht vorenthalten und prinzipiell verneinen. Der Freizeitsektor muss sich im Spannungsfeld zwischen individuellen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, die viel Spielräume für spontane Freizeitaktivitäten bieten, und organisierten Freizeitangeboten zu einem Markt der Möglichkeiten für eine wohnortnahe inklusive Freizeitgestaltung entwickeln, der die jeweiligen Lebensphasen und Lebenslagen berücksichtigt, dem Prinzip der freiwilligen Teilnahme Beachtung schenkt und aus freizeitpädagogischer Sicht didaktisch so organisiert sein muss, dass er den Erwartungen aller, die daran teilnehmen, entspricht. Integrative Freizeitangebote müssen deshalb einerseits flexibel und offen genug sein, andererseits einen hohen Grad an Individualisierung (z.B. nach Alter, Geschlecht, behinderungsbedingter Lebenssituation, spezifischen Interessen, etc.) zulassen und genügend Maßnahmen der innerer Differenzierung (Ziele, Inhalte, Methoden, Medien, etc.) treffen, damit behinderte und nichtbehinderte Menschen in Kooperation miteinander an der gemeinsamen Freizeitaktivität spielen, lernen, arbeiten und sich vergnügen können. Hierzu brauchen wir fachlich qualifiziertes und menschlich kompetentes Personal, das die Teilnehmer/-innen z.B. über Inhalte, Organisationsformen, den Ablauf, etc. mitbestimmen lässt , ihnen Wahl- und Entscheidungsfreiheiten einräumt bzw., diese (z.B. bei Menschen mit einer geistigen Behinderung) auch entfalten hilft und das situativ angemessen entscheiden kann, wieviel pädagogisch Leitungs- und Führungsarbeit verantwortlich zu leisten ist und wie die Heterogenität der Freizeitgruppe didaktisch bewältigt werden kann. Die skizzierten Aufgaben lassen bereits erkennen, dass die integrative Freizeitgestaltung durchaus hohe Anforderungen an freizeitberufstätige Personen stellt. Die Aus- sowie Fort- und Weiterbildung muss darauf abgestimmt werden. Die hauptamtlich Beschäftigten werden auch zukünftig auf die Mitarbeit von nebenamtlichen Kräften angewiesen sein. Deshalb wird es notwendig sein, das bislang ehrenamtlich tätige Personal auf diese neuen Anforderungen hin zu qualifizieren. Darüber hinaus ist zu fordern, dass Fragen, wie sie von der Integrationspädagogik aufgeworfen werden genauso wie das behinderungsspezifisches Fachwissen integraler Bestandteil der Ausbildung aller Freizeitberufe wird. Die Freizeitwissenschaft als erziehungswissenschaftliche Disziplin, in der eine ganze Reihe anderer Teildisziplinen aufgehen, hat als übergreifender Gegenstandbereich und Verbund pädagogischer Teilaufgabengebiete ausbildungscurriculare Vorstellungen zu entwickeln, die theoretisch gelehrt und praktisch umgesetzt werden können. 21 Der Freizeitbereich sollte als eigenständiges Handlungs- und Erfahrungsfeld zu einem autonomen Bereich ausgewiesen werden, der sich eine eigene Geschäftsordnung gibt und eine Infrastruktur mit entsprechenden Planstellen aufbaut. Hierzu ist es notwendig, einen eigenen Haushaltsetat zu bekommen, der bedürfnisorientiert verwaltet werden kann. Integrativ organisierte Freizeitarbeit sollten dokumentiert und entsprechend öffentlich gemacht werden. Der Informationsfluss über integrative Freizeitgestaltungsmöglichkeiten muss nicht nur verbessert, sondern auch systematisch erfasst und auf geeignetem Weg kundenorientiert publiziert werden. Nur so können essentielle Angebote wie offene Treffs, kulturelle Veranstaltungen, Tagesausflüge, Besichtigungen, Urlaubs- und Ferienfreizeiten, Kuren, Kreuzfahrten, Bildungsreisen, Projekte sowie Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, der Erwachsenenbildung, der Arbeit in konfessionellen, freien oder politischen Gremien, von Vereinen, Verbänden, Initiativen, Selbsthilfezusammenschlüssen und zur individuellen Freizeitgestaltung mit Hinweisen auf ambulante Hilfen und Assistenzdiensten für behinderte Menschen wahrgenommen und genutzt werden. Anbieter bereits bestehender integrativer Freizeitangebote sollten sich untereinander vernetzen und eine Diskussionsplattform für den regelmäßigen Fachaustausch schaffen. Damit behinderte und mobilitätseingeschränkte Menschen chancengleich reisen können, müssen zahlreiche Probleme im Tourismusbereich abgebaut werden. Vordringlich zu fordern wäre - der Abbau vorhandener technischer, architektonischer und vorurteilsbedingter Barrieren, - eine Verbesserung der Angebote durch die Tourismusindustrie selbst, - die Anerkennung Behinderter als Zielgruppe und Kunden, - ein ansprechendes Marketing mit entsprechenden Werbestrategien, - der sukzessiven Abbau von "Spezialanbietern" zugunsten Normalisierung durch integrative Angebote von "Regelanbietern", - die Öffnung der Reisebüros und der Palette touristischer Angebote für Menschen mit Behinderungen, - ein besserer Service mit Komplementärangeboten bis hin zur Vermittlung von kompetenten Reisebegleitern, - eine solide Öffentlichkeitsarbeit, - eine Ausbildung touristischer Berufe, die die besonderen Belange behinderter Reisender berücksichtigt. einer Diese "Liste" ließe sich sicher noch weiter fortsetzen, differenzierter betrachten und detailliert erläutern. In ihr spiegelt sich der komplexe und interdependente Stand der Dinge wider (vgl. Markowetz / Cloerkes 2000). Abschließend können wir uns nur eine rege und kritische Diskussion über die angedachten Zusammenhänge und skizzierten Forderungen wünschen. Bleibt zu hoffen, dass sie bald zu konstruktiven Veränderungen in unserer rehabilitativen Landschaft und gesellschaftlichen Wirklichkeit führt und exponierte Abhandlungen über die Integration behinderter 22 Menschen im Lebensbereich Freizeit zunehmend überflüssig machen und Inklusion zur Selbstverständlichkeit wird. Dazu muss das Prinzip der Nicht-Aussonderung und Unteilbarkeit in das gesellschaftliche Leben als perspektivenreiche Herausforderung angenommen und Inklusion zum handlungsleitenden Modell für die pädagogische Praxis erklärt werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe Ihnen einige grundlegende Aspekte nähergebracht zu haben und wünsche Ihnen allen einen interessanten Tagungsverlauf mit noch vielen spannenden Diskussionen, die uns und unser Anliegen – unabhängig davon ob wir es noch Integration nennen oder schon als Inklusion denken – voranbringen. Dankeschön und Auf Wiedersehen ! 4. Literatur: Adam, H.: Das Normalisierungsprinzip und seine Bedeutung für die Behindertenpädagogik. Behindertenpädagogik 16 (1977), S. 73-91. Bank-Mikkelsen, N.E.: A metropolitan area in Denmark: Copenhagen. In: Kugel, R./Wolfensberger, W. (Eds.), Changing patterns in residential services for mental retarded. Washington, D.C. (President´s Committee on Mental Retardation) 1969, S. 227-254. Bank-Mikkelsen, N.E.: Denmark. In: Flynn, R.J./Nitsch, K.E. (Eds.), Normalization, social integration and community services. Baltimore (University Press) 1980, S. 51-70. Baumeister, B./Hirning, H.: Kanusport – eine Möglichkeit zum gleichberechtigten Miteinander. In: Markowetz, R./Cloerkes, G.(Hrsg.): Freizeit im Leben behinderter Menschen. Theoretische Grundlagen und sozialintegrative Praxis. Heidelberg (Winter – Edition S) 2000, S. 303-310. Benkmann, R./Pieringer, G.: Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder und Jugendlocher in der Allgemeinen Schule. Entwicklungsstand und Forschung im In- und Ausland. Berlin (Pädagogisches Zentrum) 1991. Biewer, G.: „Integration behinderter Kinder“ oder „Einbeziehung von Kindern mit speziellem Erziehungs- und Bildungsbedarf?“ Ein Plädoyer für angemessene Begriffe im wissenschaftlichen Diskurs. In: Müller, A. (Hrsg.), Sonderpädagogik provokant. Luzern (Edition SZH/SPC) 2001a, S. 211-221. Biewer, G.: Vom Integrationsmodell für Behinderte zur Schule für alle Kinder. Neuwied/Kriftel/Berlin (Luchterhand) 2001b. Boban, I./Hinz, A.: Persönliche Zukunftskonferenzen. Unterstützung für individuelle Lebenswege. BEHINDERTE in Familie, Schule und Gesellschaft 22 (1999) 4/5, S. 13-23. Boban, I./Hinz, A.: Der Index für Inklusion – eine Möglichkeit zur Selbstevaluation von „Schulen für alle“. In: Feuser, G.: (Hrsg.), Integration heute – Perspektiven ihrer Weiterentwicklung in Theorie und Praxis. Frankfurt am Main (Lang) 2003a, S. 37-46a. Boban, I./Hinz, A.: Index für Inklusion. Lern und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln. Halle (Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg) 2003b. Boban, I./Hinz, A.: Person Centred Planning and Circle of Friends. – Persönliche Zukunftsplanung und Unterstützerkreis. In: Feuser, G.: Integration heute – Perspektiven ihrer Weiterentwicklung in Theorie und Praxis. Frankfurt am Main (Lang) 2003c, S. 285-296. Buber, M.: Das dialogische Prinzip. Heidelberg (L. Schneider) 1965. Bürli, A.: Internationale Tendenzen in der Sonderpädagogik – vergleichende Betrachtungen mit Schwerpunkt auf den europäischen Raum. Hagen (Fernuniversität – Kurseinheit 4098-1-01-51) 1997. Charte de Luxembourg: Vers une école pour tous. Luxembourg et Brussel (Helios II) o.J. Novembre 1996. Cloerkes, G.: Die Kontakthypothese in der Diskussion um eine Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabechancen Behinderter. Zeitschrift für Heilpädagogik 33 (1982) S. 561-568. Cloerkes, G.: Einstellungen und Verhalten gegenüber Behinderten. Eine kritische Bestandsaufnahme der Ergebnisse internationaler Forschung. Berlin 1985 (3.erweiterte Auflage). Cloerkes, G.: Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. Unter Mitwirkung von Reinhard Markowetz. 2.,neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Heidelberg 2001. 23 Cloerkes, G.: Einleitung. Zur Buchreihe und zu diesem Buch. In: Cloerkes, G.(Hrsg.): Wie man behindert wird. Texte zur Konstruktion einer sozialen Rolle und zur Lebenssituation behinderter Menschen. Heidelberg 2003a, S. 7-10. Cloerkes, G.: Zahlen zum Staunen. Die deutsche Schulstatistik. In: Cloerkes, G.(Hrsg.): Wie man behindert wird. Texte zur Konstruktion einer sozialen Rolle und zur Lebenssituation behinderter Menschen. Heidelberg 2003b, S. 11-23. Cloerkes, G./Markowetz, R.: Stigma-Identitätsthese und Entstigmatisierung durch Integration. In: Pädagogische Hochschule Heidelberg (Hrsg.), 5. Forschungsbericht für den Zeitraum von 1994-1996 der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Heidelberg (Hochschuldruck) 1999, S. 40-42. Cloerkes, G./Markowetz, R.: Stigmatisierung und Entstigmatisierung im Gemeinsamen Unterricht. Zeitschrift für Heilpädagogik 54 (2003) 11, S. 452-460. CSIE (Eds.): Index for Inclusion. Developing Learning and Participation in Schools. London 2000. Daniels, H./Garner, P. (Eds.): Inclusive Education. Worlds Yearbook of Education 1999. London 1999. DIMDI (Hrsg.): Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Entwurf der deutschsprachigen Fassung vom Juli 2002 ohne Stichwortverzeichnis. Internettext 2002. (http://www.dimdi.de) Dumke, D./Schäfer, G.: Entwicklungen behinderter und nichtbehinderter Schüler in Integrationsklassen. Einstellungen, soziale Beziehungen, Persönlichkeitsmerkmale, Schulleistungen. Weinheim (Juventa) 1993. Durkheim, E.: De la division du travail social. Paris 1893. Durkheim, E.: Le suicide. Etude des sociologie. Paris 1897. Dreher, W.: Eine Gesellschaft für alle Menschen – ohne besondere Bedürfnisse. BEHINDERTE in Familie, Schule und Gesellschaft 23 (2000) 1, S. 50-57. Ebert, H./Villinger, S.: Freizeit von WfB-Mitarbeiter(inne)n. Ergebnisse einer Befragung. Geistige Behinderung 38 (1999) 3, S. 258-273. Eberwein, H.: Integrationspädagogik als Weiterentwicklung (sonder-)pädagogischen Denkens und Handelns. In: Eberwein, H. (Hrsg.), Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik. Weinheim (Beltz) 1990, S. 45-53. Eberwein, H./Knauer, S. (Hrsg.): Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen lernen gemeinsam. Ein Handbuch. Weinheim (Beltz) 2002. Fachdienst der Lebenshilfe: Inclusion. Marburg (Lebenshilfe) o.Jg. (1995) Heft 2. Feuser, G. (Hrsg.): Integration heute – Perspektiven ihrer Weiterentwicklung in Theorie und Praxis. Frankfurt am Main (Lang) 2003. Feuser, G./Meyer, H.: Integrativer Unterricht in der Grundschule. Solms (Jarick) 1987. Gerben de Jong, P.D.: Independent Living: Eine soziale Bewegung verändert das Bewußtsein. In: Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland e.V. (Hrsg.), Reader. Geschichte und Philosophie der Selbstbestimmt Leben Bewegung behinderter Menschen. Kassel (Eigenverlag) 1995, S. 132-160. Goll, J.: Neuere Ansätze zum Verständnis von geistiger Behinderung. Auf der Suche nach alternativen Begriffen und Zugangsweisen. In: Goll, H./Goll, J. (Hrsg.), Selbstbestimmung und Integration als Lebensziel. Grundfragen, Grundlagen und Umsetzungsmöglichkeiten einer inklusiven, nicht aussondernden Pädagogik für Menschen mit Behinderungen. Hammersbach (Wort und Bild) 1998, S. 15-31. Hähner, U./Niehoff, U./Sack, R./Walther, H.: Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbstbestimmung. Marburg (Lebenshilfe-Verlag) 1997. Heimlich, U.: Integrative Pädagogik. Eine Einführung. Stuttgart (Kohlhammer) 2003. Helle. H.J.: Verstehende Soziologie und Theorie der Symbolischen Interaktion. Stuttgart (Teubner) 1992. Herbst, H.D.: Das Projekt »Integration – Gemeinsame Ferien« beim Jugendfreizeit- und Bildungswerk (jfbw) des Stadtjugendausschuß e.V. Karlsruhe. In: Markowetz, R./Cloerkes, G. (Hrsg.): Freizeit im Leben behinderter Menschen. Theoretische Grundlagen und sozialintegrative Praxis. Heidelberg (Winter – Edition S) 2000, S. 336341. Hildeschmidt, A./Schnell, I. (Hrsg.), Integrationspädagogik. Auf dem Weg zu einer Schule für alle. Weinheim und München (Juventa) 1998. Hinz, A.: Sonderpädagogik im Rahmen von Pädagogik der Vielfalt und Inclusive Education. Überlegungen zu neuen paradigmatischen Orientierungen. In: Albrecht, F./Hinz, A./Moser, V. (Hrsg.), Perspektiven der Sonderpädagogik. Disziplin- und professionsbezogene Standortbestimmung. Neuwied/Kriftel/Berlin (Luchterhand) 2000, S. 124-140. Hinz, A.: Von der Integration zur Inklusion – terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung? Zeitschrift für Heilpädagogik 53 (2002) 9, S. 354-361. Hinz, A.: Vom sonderpädagogischen Verständnis der Integration zum integrationspädagogischen Verständnis der Inklusion!? In: Schnell, I./Sander, A. (Hrsg.), Inklusive Pädagogik. Bad Heillbrunn/Obb. (Klinkhardt) 2004, S. 41-74. Hovorka, H.: Plädoyer für eine umfeldbezogene Integrationspädagogik. In: Hildeschmidt, A./Schnell, I. (Hrsg.), Integrationspädagogik – Auf dem Weg zu einer Schule für alle. Weinheim (Juventa) 1998, S. 277-291. Hovorka, H. (Hrsg.): Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen in allen Lebensbereichen und Lebensphasen. Österreichbericht zum EU-Projekt „From Social Exklusion to Social Integration“. Klagenfurt (Neuer Kaiser Verlag) 1999. 24 Hovorka, H.: Gemeindenahe schulübergreifende (Integrations)pädagogik: Eine bildungs- und sozialpolitische Herausforderung. In: Hovorka, H./Sigot, M. (Hrsg.), Integration(spädagogik) am Prüfstand. Menschen mit Behinderungen außerhalb von Schule. Innsbruck (STUDIENVerlag) 2000, S. 297-319. Hovorka, H./Sigot, M. (Hrsg.), Integration(spädagogik) am Prüfstand. Menschen mit Behinderungen außerhalb von Schule. Innsbruck (STUDIENVerlag) 2000. Hurrelmann, K.: Einführung in die Sozialisationstheorie. Weinheim und Basel (Beltz) 2002. Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland (ISL) e.V. (Hrsg.): Reader - Geschichte und Philosophie der Selbstbestimmt Leben Bewegung behinderter Menschen. Kassel (Eigenverlag) 1995. Jülich, , M: Schulische Integration in den USA. Bad Heilbrunn (Klinkhardt) 1996. Klafki, W.: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik. Weinheim/Basel (Beltz) 1993. Knust-Potter, E.: Community Living: N. den Wohn- und Lebensbedingungen von Erwachsenen, die als geistig behindert bezeichnet werden. Berlin (FU Berlin) 1995. Kobi, E.E.: Modelle und Paradigmen in der heilpädagogischen Theoriebildung. In: Bürli, A. (Hrsg.), Sonderpädagogische Theoriebildung – Vergleichende Sonderpädagogik. Luzern (Edition SZH/SPC) 1977. S. 11-24. Krüger, C.: Supported Living: „Ich bin über 40 Jahre alt. Dies ist mein eigener Schlüssel. Zum aller ersten Mal habe ich einen eigenen Schlüssel.“ Geistige Behinderung 39 (2000) S. 112-124. Kultusministerkonferenz (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland): Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland. Beschluß der KMK vom 6.5.1994. Bonn 1994. Kultusministerkonferenz (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland): Statistische Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz. Dokumentation Nr. 159. Bonn 2002. Lindmeier, B./Lindmeier, C.: Supported Living. Ein neues Konzept des Wohnens und Lebens in der Gemeinde für Menschen mit (geistiger) Behinderung. BEHINDERTE in Familie, Schule und Gesellschaft 24 (2001) 3/4, S. 39-50. Lipsky, D.K./Gartner, A.: Inclusive Education: A Requirement of a Democratic Society. In: Daniels, H./Garner, P. (Eds.), Inclusive Education. World Yearbook of Education 1999. London 1999, S. 12-23. Markowetz, R.: Das Bild Behinderter in der Öffentlichkeit. Selbsthilfe. Zeitschrift der Bundesarbeitgemeinschaft für Behinderte (BAGH), Düsseldorf. o.Jg. (1993) 5/6, S. 6-11. Markowetz, R.: Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen im Lebensbereich Freizeit. Praktische Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem wissenschaftlich begleiteten Modellprojekt PFiFF. Gemeinsam leben. Zeitschrift für integrative Erziehung 4 (1996) 4, S. 155-162. Markowetz, R.: „Assistent/-in für Menschen mit Behinderungen“ - Ein ´neuer´ heilpädagogischer Beruf in einem ´neuen´ Handlungsfeld? Aufgezeigt am Beispiel der wohnortnahen Integration behinderter Kinder und Jugendlicher im Lebensbereich Freizeit. In: Stach, M./Kipp, M. (Hrsg.), Rehabilitationsberufe der Zukunft - Situation und Perspektiven. Ergebnisse der Workshops: Berufliche Rehabilitation. Neusäß (Kieser) 1998a, S. 119-153. Markowetz, R.: Kinder und Jugendliche mit Behinderungen auf ihrem Weg in einen ganz „normalen“ Verein. Grundlagen, Konzeption und Bilanz des Integrationspädagogischen Dienstes (IPD) von PFiFF e.V., einem Fachdienst zur Integration behinderter Kinder und Jugendlicher im Lebensbereich Freizeit und zur Unterstützung integrativer Prozesse in wohnortnahen Freizeitvereinen. Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft 21 (1998b) 3, S. 1-12 (Praxis Teil I). Markowetz, R.: Kinder und Jugendliche mit Behinderungen auf ihrem Weg in einen ganz „normalen“ Verein. Grundlagen, Konzeption und Bilanz des Integrationspädagogischen Dienstes (IPD) von PFiFF e.V., einem Fachdienst zur Integration behinderter Kinder und Jugendlicher im Lebensbereich Freizeit und zur Unterstützung integrativer Prozesse in wohnortnahen Freizeitvereinen. Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft 21 (1998c) 4/5, S. 112 (Praxis Teil II). Markowetz, R.: Dialogische Validierung identitätsrelevanter Erfahrungen. Ein interaktionistisches, beziehungsförderndes und identitätstiftendes Konzept zur Entstigmatisierung von Menschen mit Behinderungen. In: Datler, W./Gerber, G./ Kappus, W./Stein-hardt, K./Strachota, A./Studener, R. (Hrsg.), Zur Analyse heilpädagogischer Beziehungsprozesse. Luzern (Edition SZH/SPC) 1998d, S. 65-71. Markowetz, R.: „Integration“ und „Freizeit“. Behindertensoziologische Überlegungen zu zwei Begriffen der Heilpädagogik. Forum Freizeit 2 (1999a) 2, S. 3-14. Markowetz, R.: Soziale Integration, Identität und Entstigmatisierung. Gemeinsam Leben. Zeitschrift für integrative Erziehung 8 (2000a) 3, S. 112-120. Markowetz, R.: Erfahrungen des Selbsthilfe- und Integrationsprojektes PFiFF bei der Erschließung allgemeiner Angebote für behinderte Kinder und Jugendliche. In: Rische, H./Blumenthal, W. (Hrsg.), Selbstbestimmung in der Rehabilitation. Chancen und Grenzen. Band 9 der DVfR-Reihe „Interdisziplinäre Schriften zur Rehabilitation“. Ulm (Universitätsverlag) 2000b, S. 263-280. Markowetz, R.: Identitätsentwicklung und Pubertät - über den Umgang mit Krisen und identitätsrelevanten Erfahrungen von Jugendlichen mit einer Behinderung. Behindertenpädagogik 39 (2000c) 2, S. 136-174. Markowetz, R.: Soziale Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in wohnortnahe Vereine. In: Markowetz, R./Cloerkes, G. (Hrsg.), Freizeit in Leben behinderter Menschen. Theoretische Grundlagen und sozialintegrative Praxis. Heidelberg (Universitätsverlag C. Winter - Edition S) 2000d, S. 81-105. 25 Markowetz, R.: Soziale Integration von Menschen mit Behinderungen. In: Cloerkes, G., Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. Unter Mitwirkung von Reinhard Markowetz. 2., neu bear. und erw. Auflage. Heidelberg (Universitätsverlag C. Winter Edition S) 2001a, S. 171-232. Markowetz, R.: Freizeit behinderter Menschen. In: Cloerkes, G., Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. Unter Mitwirkung von Reinhard Markowetz. 2., neu bear. und erw. Auflage. Heidelberg (Universitätsverlag C. Winter Edition S) 2001b, S. 259-293. Markowetz, R.: Didaktik des integrativen Unterrichts – (k)eine Frage für die Sonderpädagogik?! In: Müller, A. (Hrsg.), Sonderpädagogik provokant. Luzern (Edition SZH/SPC) 2001c, S. 237-261. Markowetz, R.: Sozialisation. In: Bundschuh, K./Heimlich, U./Krawitz, R. (Hrsg.), Wörterbuch Heilpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis. 2., durchgesehene Auflage. Bad Heilbrunn/Obb. (Klinkhardt) 2002a, S. 262-266. Markowetz, R.: Soziologie, heilpädagogische. In: Bundschuh, K./Heimlich, U./Krawitz, R. (Hrsg.), Wörterbuch Heilpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis. Bad Heilbrunn/Obb. 2., durchgesehene Auflage. (Klinkhardt) 2002b, S. 269-272. Markowetz, R.: Vorurteil. In: Bundschuh, K./Heimlich, U./Krawitz, R. (Hrsg.), Wörterbuch Heilpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis. 2., durchgesehene Auflage. Bad Heilbrunn/Obb. (Klinkhardt) 2002c, S. 308-312. Markowetz, R.: Freizeit ein Stück Lebensqualität. Zusammen 23 (2003a) 5, S. 4-8. Markowetz, R.: Geistige Behinderung und Menschen mit geistiger Behinderung in soziologischer Perspektive. In: Fischer, E. (Hrsg.), Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung – aktuelle Entwicklungen in Theorie und Praxis. Oberhausen (Athena) 2003b, S. 173-226. Markowetz, R.: Maßnahmen der Inneren Differenzierung und Individualisierung im kooperativen Unterricht nach dem Außenklassenmodell in Baden-Württemberg. In: Lamers, W./Klauß, T. (Hrsg.), ...alle Kinder alles lehren! – Aber wie? Theoriegeleitete Praxis bei schwer- und mehrfachbehinderten Menschen. Düsseldorf (Verlag selbstbestimmtes Leben) 2003c, S. 153-186. Markowetz, R.: Maßnahmen der Inneren Differenzierung und Individualisierung im Gemeinsamen Unterricht als Aufgabe von Sonderpädagogik und Integrationspädagogik auf dem Weg zu einer inklusiven Diaktik. In: Sander, A./Schnell, I. (Hrsg.), Inklusive Pädagogik verwirklichen. Bad Heilbrunn/Obb. (Klinkhardt) 2004a., S. 167-186. Markowetz, R.: Soziale Integration, Identität und Entstigmatisierung. Behindertensoziologische Aspekte und Beiträge zur Theorieentwicklung in der Integrationspädagogik. Heidelberg (Universitätsverlag C. Winter - Edition S) 2004b (in Vorbereitung). Markowetz, R./Cloerkes, G. (Hrsg.): Freizeit in Leben behinderter Menschen. Theoretische Grundlagen und sozialintegrative Praxis. Heidelberg (Universitätsverlag C. Winter-Edition S) 2000. McCall, G.J./Simmons, J.L.: Identität und Interaktion. Untersuchungen über zwischenmenschliche Beziehungen im Alltagsleben. Düsseldorf 1974. McGregor, G.: Crossing boundaries. Maps to guide inclusive thinking. TASH-Newsletter 22 (1996) 2, S. 13-15. Mead, G.H.: Geist, Identität und Gesellschaft. Aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1973 (zuerst 1934). Miles-Paul, O./Frehe, U.: Persönliche Assistenz: Ein Schlüssel zum selbstbestimmten Leben Behinderter. Gemeinsam Leben 2 (1994) 1, S. 12-16. Miles-Paul, O.: Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Beratung von Behinderten durch behinderte. Vergleich zwischen den USA und der Bundesrepublik. München (AG SPAK) 1992. Miles-Paul, O.: Nichts über uns ohne uns. Geistige Behinderung 38 (1999) 3, S. 223-227. Muth, J.: Zehn Thesen zur Integration von behinderten Kindern. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN) 60 (1991), S. 1-5. Netzwerk People First Deutschland e.V.: „Klein angefangen – und Mensch, sind wir vorangekommen!!“. Abschlußbericht des Bundesmodellprojektes „Wir vertreten uns selbst!“. Kassel (Eigenverlag) 2002. Neubert, D./Billich, P./Cloerkes, G.: Stigmatisierung und Identität. Zur Rezeption und Weiterführung des Stigma-Ansatzes in der Behindertenforschung. Zeitschrift für Heilpädagogik 42 (1991) S. 673-688. Niehoff, U.: Selbstbestimmt Leben für behinderte Menschen - Ein neues Paradigma zur Diskussion gestellt. Behindertenpädagogik 32 (1993), S. 287-298. Niehoff, U.: Mainstreaming-Inclusion, Ein Beitrag zur Begriffsklärung. Fachdienst der Lebenshilfe o.Jg. (2000) 3, S. 10-12. Niehoff, U.: Ausgrenzung verhindern! Inklusion und Teilhabe verwirklichen. Fachdienst der Lebenshilfe o.Jg. (2002) 1, S. 213. Nirje, B.: The normalization principle and its human management implications. In: Kugel, R./Wolfensberger, W. (Eds.), Changing patterns in residential services for the mentally retarded. Washington, D.C. (President´s Commitee on Mental Retardation) 1969, S. 159-177. Nirje, B.: The normalization principle. In: Flynn, R.J./Nitsch, K.E. (Eds.), Normalization, social integration, and community services. Baltimore (University Park Press) 1980, S. 31-49. Nirje, B.: Das Normalisierungsprinzip – 25 Jahre danach. In: Vierteljahreszeitschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN) 63 (1994) 1, S. 12-32. OECD (Ed.): Implementing Inclusive Education. Paris (OECD) 1999. 26 Opaschowski, H.W: Pädagogik und Didaktik der Freizeit. Opladen (Leske+Budrich) 1990. Österreichische UNESCO-Kommission (Hrsg.): Salamanca-Erklärung: Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Die Salamanca-Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Angenommen von der Weltkonferenz „Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität“, Salamanca, Spanien, 7-10.Juni 1994. Linz (Domino) 1996. Österwitz, I.: Das Konzept Selbstbestimmt Leben - eine neue Perspektive in der Rehabilitatiion? In: Zwierlein, E. (Hrsg.), Handbuch Integration und Ausgrenzung: Behinderte Mitmenschen in der Gesellschaft. Berlin (Luchterhand) 1996, S. 196-206. Opp, G.: Neue Modelle schulischer Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Lern- und Verhaltensstörungen. Zeitschrift für Heilpädagogik 46 (1995) 11, S. 520-530. Opp, G.: Mainstreaming – neue Entwicklungen der Integrationspraxis in den USA: Vergleiche mit der deutschen Diskussion. In: Wittrock, M. (Hrsg.), Sonderpädagogischer Förderbedarf und sonderpädagogische Förderung in der Zukunft. Beiträge zur zukünftigen Entwicklung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, der sonderpädagogischen Arbeit und universitären Ausbildung. Neuwied/Kriftel/Berlin (Luchterhand) 1997, S. 26-42. Pijl, S.j./Meijer, C.J.W./Heagarty, S. (Eds.): Inclusive Education. A global agenda. London/New York (Routledge) 1997. Porter, G.L./Richler, D. (Eds.): Changing Canadian Schools. Perspectives on Disability and Inclusion. North York, Ontario (The Roeher Institute) 1991. Preuss-Lausitz, U.: Soziale Beziehungen in Schule und Wohnumfeld. In: Heyer, P./Preuss-Lausitz, U./Zielke, G.(Hrsg.), Wohnortnahe Integration. Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in der UckermarckGrundschule in Berlin. Weinheim/München (Beltz) 1990. Preuss-Lausitz, U.: Integration und Toleranz. Erfahrungen und Meinungen von Kindern innerhalb und außerhalb von Integrationsklassen. In: Heyer, P./Preuss-Lausitz, U./Schöler, J. (Hrsg.), „Behinderte sind doch Kinder wie wir!“ Gemeinsame Erziehung in einem neuen Bundesland. Berlin (Wissenschaft &Technik Verlag) 1997, S. 171-204. Preuss-Lausitz, U.: Bewältigung von Vielfalt – Untersuchungen zu Transfereffekten gemeinsamer Erziehung. In: Hildeschmidt, A./Schnell, I. (Hrsg.), Integrationspädagogik. Auf dem Weg zu einer Schule für alle. Weinheim und München (Juventa) 1998, S. 223-240. Reiser, H.: Entwicklung der Fragestellung und Untersuchungsplan. In: Deppe-Wolfinger, H./Prengel, A./Reiser, H. (Hrsg.), Integrative Pädagogik in der Grundschule. Bilanz und Perspektiven der Integration behinderter Kinder in der Bundesrepublik Deutschland 1976-1988. München (Deutsches Jugend Institut) 1990, S. 26-34. Reiser, H./Klein, G./Kreie, G./Kron, M.: Integration als Prozeß. Sonderpädagogik 16 (1986) S. 115-122 und S. 154-160. Rödler, P.: Geistig behindert: Menschen, lebenslang auf Hilfe anderer angewiesen. Grundlagen einer basalen Pädagogik. Neuwied/Kriftel/Berlin (Luchterhand) 2000. Sack, R.: Vision und Ausblick – Zur Perspektive der ambulant mobilen Dienstleitung für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen. Fachdienst der Lebenshilfe o.Jg. (1999) 3, S. 5-12. Sander, A.: Internationaler Stand und Konsequenzen für die sonderpädagogische Förderung in Deutschland. In: Hausotter, A./Boppel, W./Meschenmoser, H. (Hrsg.), Perspektiven Sonderpädagogischer Förderung in Deutschland. Dokumentation der Nationalen Fachtagung vom 14.-16.November 2001 in Schwerin. Middelfart (European Agency) 2002, S. 143-164. Sander, A.: Über die Integration zur Inklusion. St. Ingbert (Röhrig) 2003. Schlömerkemper, J.: Pädagogische Integration. Über einen schwierigen Leitbegriff pädagogischen Handelns. Die Deutsche Schule 81 (1989), S. 316-329. Sektion Sonderpädagogik: Bericht zur 37. Arbeitstagung der Dozentinnen und Dozenten der Sonderpädagogik in deutschsprachigen Ländern in Frankfurt, 5.-7.Oktober 2000. Anlage zum Mitgliederrundbrief September 2001. Schnell, I./Sander, A. (Hrsg.): Inklusive Pädagogik. Bad Heilbrunn (Klinkhardt) 2004. Sportjugend Hessen (Hrsg.): Fortbildungs-Programme 2001. Frankfurt am Main (Eigenverlag) 2001. Stark, W.: Empowerment. Neue Handlungskompetenzen in der psychosozialen Praxis. Freiburg (Lambertus) 1996. TASH: Mission statement. TASH-Newsletter 26 (2000) 4, S. 2. Theunissen, G.: Zur Bedeutung von Stärken und Widerstandskraft. Bausteine für eine ‚verstehende‘ Kultur des Helfens als Empowerment-Paradigma für die Arbeit mit behinderten Menschen und ihren Angehörigen. Zeitschrift für Heilpädagogik 50 (1999) 6, S. 278-284. Theunissen, G./Plaute, W.: Empowerment und Heilpädagogik - ein Lehrbuch. Freiburg (Lambertus) 1995. Thimm, W.: Das Normalisierungsprinzip - eine Einführung. Marburg (Eigenverlag Lebenshilfe) 1984. Thimm, W.: Leben in Nachbarschaften. Hilfen für Menschen mit Behinderungen. Freiburg/Basel/Wien (Herder) 1994. UNESCO: The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Adopted by the World Conference on Special Needs Education: Access and Quality, Salamanca, Spain, 7-10 June 1994. Paris (UNESCO) 1994. Vds – Verband Sonderpädagogik e.V. (Hrsg.): Themenheft: Zehn Jahre KMK-Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung. Zeitschrift für Heilpädagogik 55 (2004) S. 81-188. von Lübke, K.: Nichts Besonderes. Essen (Klartext-Verlag) 1994. von Ferber, Ch.: Der behinderte Mensch und die Gesellschaft.. In: Thimm, W. (Hrsg.), Soziologie der Behinderten. Materialien. Neuburgweiher/Karlsruhe (Schindele) 1972, S. 30-41. 27 Wagner-Stolp, W.: ...“und irgendwie steht´s mir ja wohl auch zu!“ Entlastungs- und Unterstützungsangebote für Familien mit behinderten Kindern. Zusammen (1997) 7, S. 13-15. World Health Organisation (WHO): International classification of impairments, diabilities and handicaps. Genf (WHO) 1980. World Health Organisation (WHO): International Classification of Functioning, Diabilities and Health: ICF. Genf (WHO) 2001. Wocken, H.: Am Rande der Normalität. Untersuchungen zum Selbst- und Gesellschaftsbild von Sonderschülern. Heidelberg (Schindele) 1983a. Wocken, H.: Untersuchungen zur sozialen Distanz zwischen Hauptschülern und Sonderschülern. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN) 52 (1983b) 4, S. 467-490. Wocken, H.: Schulleistungen in Integrationsklassen. In: Wocken, H./Antor, G. (Hrsg.), Integrationsklassen in Hamburg: Erfahrungen, Untersuchungen, Anregungen. Solms-Oberbiel (Jarick) 1987, S. 276-306. Wocken, H.: Bewältigung von Andersartigkeit. In: Gehrmann, P./Hüwe, B. (Hrsg.), Forschungsprofile der Integration von Behinderten. Bochumer Symposion 1992. Essen (Neue-Dt.-Schule-Verl.-Ges.) 1993, S. 86-106. Wocken, H.: Integrative Prozesse. In: Rosenberger, M. (Hrsg.), Ratgeber gegen Aussonderung. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. Heidelberg (Winter – Edition Schindele) 1998a, S. 174-181. Wolfensberger, W.: The principle of normalization in human services. Toronto, Canada (National Institute of Mental Retardation) 1972. Wolfensberger, W.: The definition of normalization: Update, problems, disagreements, and misunderstandings. In: Flynn, R.J./Nitsch, K.E. (Eds.), Normalization, social integration, and community services. Baltimore (University Park Press) 1980, S. 71-115. Wolfensberger, W.: Die Entwicklung des Normalisierungsgedankens in den USA und in Kanada. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Geistig Behinderte e.V. (Hrsg.), Normalisierung - eine Chance für Menschen mit geistiger Behinderung. Marburg (Eigenverlag Lebenshilfe) 1986, S. 42-62. 28