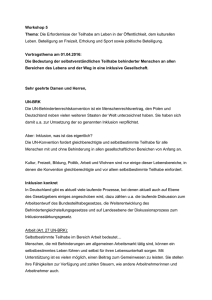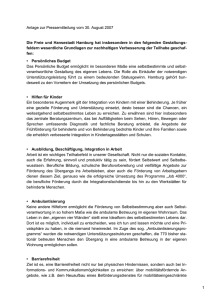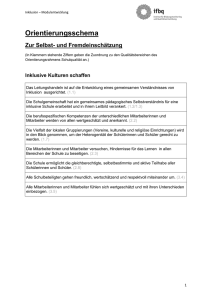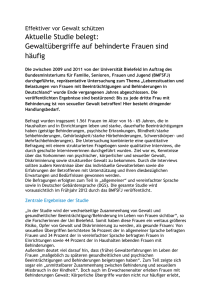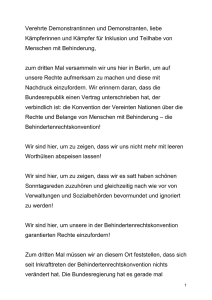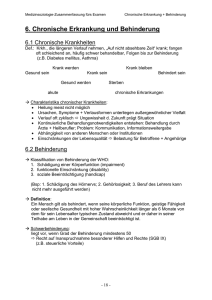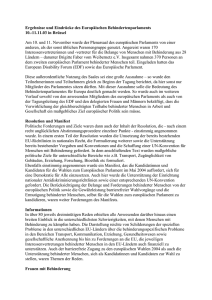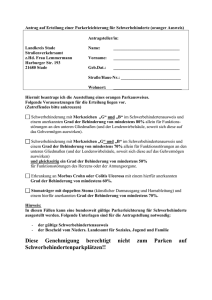Vortrag_von_Prof._Dr._Iris_Beck
Werbung
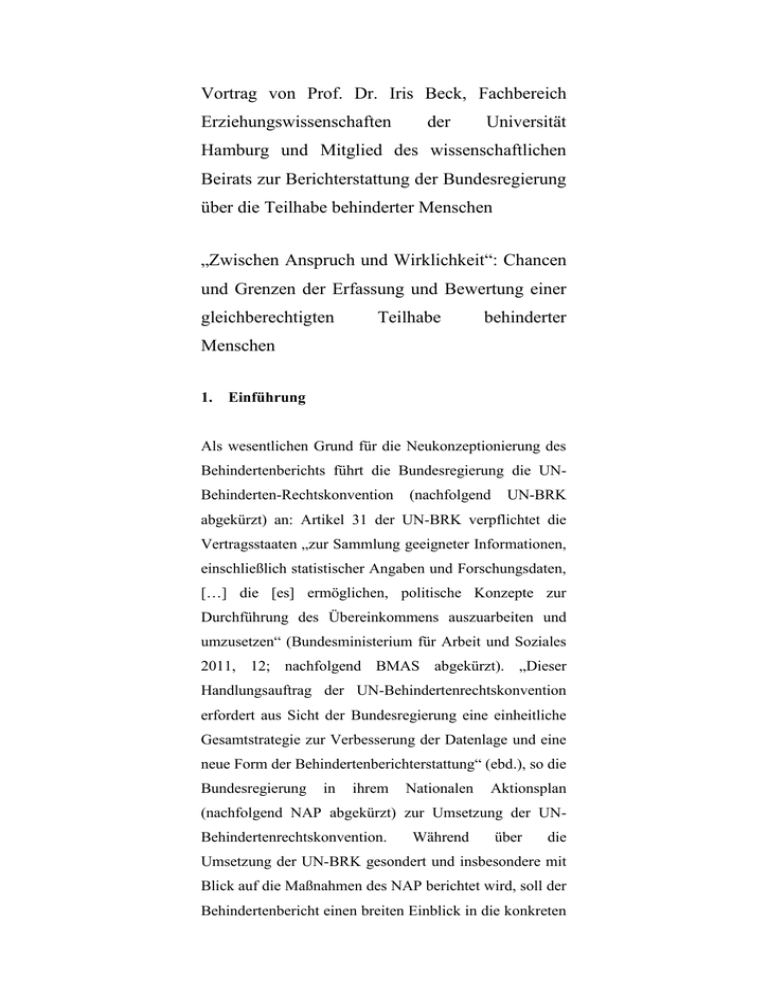
Vortrag von Prof. Dr. Iris Beck, Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universität Hamburg und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats zur Berichterstattung der Bundesregierung über die Teilhabe behinderter Menschen „Zwischen Anspruch und Wirklichkeit“: Chancen und Grenzen der Erfassung und Bewertung einer gleichberechtigten Teilhabe behinderter Menschen 1. Einführung Als wesentlichen Grund für die Neukonzeptionierung des Behindertenberichts führt die Bundesregierung die UNBehinderten-Rechtskonvention (nachfolgend UN-BRK abgekürzt) an: Artikel 31 der UN-BRK verpflichtet die Vertragsstaaten „zur Sammlung geeigneter Informationen, einschließlich statistischer Angaben und Forschungsdaten, […] die [es] ermöglichen, politische Konzepte zur Durchführung des Übereinkommens auszuarbeiten und umzusetzen“ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011, 12; nachfolgend BMAS abgekürzt). „Dieser Handlungsauftrag der UN-Behindertenrechtskonvention erfordert aus Sicht der Bundesregierung eine einheitliche Gesamtstrategie zur Verbesserung der Datenlage und eine neue Form der Behindertenberichterstattung“ (ebd.), so die Bundesregierung in ihrem Nationalen Aktionsplan (nachfolgend NAP abgekürzt) zur Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention. Während über die Umsetzung der UN-BRK gesondert und insbesondere mit Blick auf die Maßnahmen des NAP berichtet wird, soll der Behindertenbericht einen breiten Einblick in die konkreten Lebensverhältnisse ermöglichen. Die Bundesregierung bzw. das mit der Berichterstattung beauftragte und federführende BMAS stellen hierzu fest, der Bericht solle sich künftig auf „ein System von Indikatoren stützen, mittels derer die Lebenswirklichkeit von Menschen mit Behinderung abgebildet wird. Er soll die ganze Bandbreite der Realität widerspiegeln. Diese Indikatoren werden für alle im vorliegenden Aktionsplan genannten Handlungsfelder gebildet. Auf diese Weise wird der künftige Behindertenbericht eine verlässliche Grundlage zur Entwicklung von Zielen und Maßnahmen der Behindertenpolitik sein. Die Politik für Menschen mit Behinderung wird somit auf eine empirische Basis gestellt“ (ebd.). Nun hat die Bundesregierung bereits seit 1984 in jeder Legislaturperiode einen Bericht über die Lage behinderter Menschen vorgelegt, der aber diese Anforderungen offenbar bislang nicht erfüllt. Mit der Neukonzeptionierung werden hohe Ansprüche verknüpft: Das Indikatorensystem soll die Lebenslagen abbilden, eine Bewertung, gemessen am Ziel der gleichberechtigten Teilhabe, ermöglichen und anschlussfähig sowohl an die Sozialberichterstattung insgesamt als auch an europäische und internationale Berichterstattungssysteme zu Behinderung sein. Mit der Zielformulierung wird also ein Maßstab angestrebt, an dem sich die bundesweiten Diskussionen über den Stand der Inklusion ebenso ausrichten, wie ein nationaler und internationaler Vergleich ermöglicht und Maßnahmen abgeleitet werden sollen. Das Verhältnis zwischen Anspruch und Wirklichkeit von Inklusion muss dafür nach zwei Seiten hin beleuchtet werden: die eine Seite bilden Ausgangslage und Konzeption des neuen Berichtes als Form der Sozialberichterstattung, mit ihren Möglichkeiten und Grenzen. Die andere Seite bildet die Lebenslage behinderter Menschen: Was lässt sich darüber derzeit aussagen und woran bemessen sich diese Daten? Und schließlich ist zu fragen, was sich hieraus für die weitere Umsetzung, sowohl mit Blick auf die Erfassung der Lebensrealität als auch mit Blick auf die Verwirklichung gleichberechtigter Teilhabe, ableitet? 2. „Beeinträchtigung, Behinderung, Teilhabe“ - Der neue Bericht über die Lage behinderter Menschen in Deutschland 2.1 Warum ein neuer Bericht? Hintergründe der Neukonzeptionierung mit Blick auf die Berichterstattung des Bundes allgemein Im Auftrag und auf Antrag des Deutschen Bundestages ist die Bundesregierung gehalten, über die Entwicklung der Politik und der Leistungen in den einzelnen Ressorts zu berichten. Damit kommt sie ihrer Informationspflicht dem Parlament gegenüber parlamentarische nach Arbeit und auf unterstützt die Gebiet der dem Gesetzesnovellierung, der Kontrolle und der Planung: So wird die offizielle Funktion der Berichterstattung beschrieben. Neben den vielen Einzeldokumenten, die über die Umsetzung und den Verlauf von Gesetzeseinführungen oder -novellierungen Auskunft geben und jeweils anlassbezogen beantragt und vorgelegt werden, sind für bestimmte Themenfelder in jeder Legislaturperiode umfassende Berichte zu erstellen, deren Vorstellung große politische und öffentliche Aufmerksamkeit findet. Bekannte Beispiele dafür sind der Familien-, der Kinder- Gesundheitsbericht. Die und Jugend- Berichte sollen oder der über die Leistungsentwicklung hinaus, auch über die Lage der Bevölkerung, bezogen auf das Themenfeld Aufschluss geben. Dieser Anspruch der Lebenslagenorientierung hängt mit einer in den 1960er und 1970er Jahren entwickelten Auffassung darüber zusammen, worin sich eigentlich die Sozialstaatlichkeit zeigt und somit dem Anspruch des getragen Ersten Sozialgesetzbuches Rechnung Wirtschaftskraft und wird. Einkommenssicherung sind für die Soziallage tatsächlich eine notwendige, aber eben keine allein hinreichende Bedingung; soziale Problemlagen und soziale Ungleichheit verschwinden dadurch nicht automatisch und auch die Zufriedenheit der Bevölkerung lässt sich nicht nur monetär erreichen und daran bemessen. „Lebensqualität“ und „Chancengleichheit“ rückten bereits in den frühen 1970er zu Programmformeln der Politik auf. Sozialpolitik als Verteilung von Lebenschancen zielt darauf, die Handlungsspielräume des Einzelnen zur Entfaltung und Verfolgung wichtiger Interessen zu vergrößern, indem die äußeren Bedingungen, die den individuellen Handlungsspielraum beeinflussen, verändert und dabei insbesondere die Chancen auf den Zugang zu Ressourcen und Gütern, die für die Lebensführung wichtig sind, gerecht verteilt werden. Damit geht es allgemein um die Verbesserung der Lebenslage der Bevölkerung oder von Bevölkerungsgruppen, die mehr als nur eine ökonomische Dimension umfasst – Stichwort gesellschaftliche Teilhabe – und um die Bekämpfung sozialer Ungleichheit. Ob „der blaue Himmel über der Ruhr“, die Aufnahme „besonderer Lebenslagen“ in das Bundessozialhilfegesetz, die Bildungsreformen der 1960er und 1970er Jahre oder Wohnungsbauprogramme – all diese Maßnahmen stehen exemplarisch für eine solche lebenslagenorientierte Politik, die somit keinesfalls etwas neues ist. So hat die OECD in den frühen 1970er Jahren damit begonnen, das Indikatorenprogramm, mit dem die Lage in den einzelnen Mitgliedsländern gemessen werden sollte, zu erweitern. Sehr bekannt geworden sind die acht Zieldimensionen von Lebensqualität (OECD 1973), die die wesentlichen gesellschaftlichen Handlungsfelder repräsentieren, in denen die Realisierung physiologischer, sozialer, materieller und psychologischer Grundanliegen (basicconcerns) geschieht. Sie sind weitgehend vergleichbar mit den Handlungsfeldern des NAP. Mit den basicconcerns sind grundlegende Bedürfnisse im Sinne zentraler, übergreifender Kategorien gemeint, und zwar nicht als eine „Pyramide“ gedacht, in der nach „Grund“und „höheren“ Bedürfnissen unterschieden wird. „Having, loving, being“ stehen vielmehr gleichberechtigt nebeneinander und repräsentieren das Verständnis von Wohlfahrt und zu erfüllender Anliegen in der Bevölkerung. In der Folge etablierten sich in der Bundesrepublik Forschergruppen Indikatorensysteme und Institute, entwickelten die und Auseinandersetzungen um die angemessene Erfassung sowohl objektiver als auch subjektiver Aspekte von Lebensqualität und die Entwicklung der Sozialberichterstattung führten. Diese nahm einen großen Aufschwung und generierte u.a. die stetig erweiterte Reihe der Berichte der Sozialberichterstattung Bundesregierung. ist, über Ziel der “gesellschaftliche Strukturen und Prozesse sowie über die Voraussetzungen und Konsequenzen gesellschaftspolitischer Maßnahmen regelmäßig, rechtzeitig, systematisch und autonom zu informieren” (Zapf 1977, 11) und zwar in einer Weise, die die Bewertung der Lebensbedingungen einer Bevölkerung(-sgruppe) und deren Wandel über die Zeit möglich macht. Sozialberichterstattung zeichnet sich gegenüber der Sozialstatistik aus “vor allem durch eine spezifische Perspektive und ihren Bezug auf gesellschaftliche Ziele, soziale Probleme oder theoretische Konstrukte sowie die sich daraus ergebenden Anforderungen hinsichtlich der Auswahl, Aufbereitung und Präsentation von Informationen” (Noll 1997, 8). In Deutschland existiert aber kein geschlossenes quantitatives und qualitatives Berichtssystem auf der Grundlage eines anerkannten spezifischen Indikatorensystems, sondern es gibt unterschiedliche amtliche und nichtamtliche, wissenschaftliche Ansätze. Entsprechend ruhen die Berichte der Bundesregierung auch auf unterschiedlichen Indikatorensystemen. Und so, Zugängen wie sich und im gesellschaftlichen Wandel Problemlagen verändern oder die Sicht auf sie, verändert sich auch die amtliche Berichterstattung, sowohl was die Themen betrifft – Beispiel Armuts- und Reichtumsbericht – als auch was ihre Erfassung und Bearbeitung betrifft. Und genau an dieser Stelle stößt man auf ein bemerkenswertes Phänomen: Der für den neuen Bericht formulierte Anspruch der Lebenslagenorientierung, vordergründig ja ganz aktuell durch die UN-BRK ausgelöst, ist nicht nur als politisches Programm „ein alter Hut“, er wurde für eine ganze Reihe der Berichte auch schon längst angelegt. So erlaubt der Kinder- und Jugendbericht schon immer neben der Darstellung der Leistungen einen Einblick in die konkreten Lebensverhältnisse. Allerdings sind für diesen wie für andere Berichte auch immer schon andere Standards gesetzt worden: So wird für den Kinder- und Jugendbericht eine große Expertenkommission eingerichtet, die eine ganze Reihe wissenschaftlicher Expertisen in Auftrag gibt, diese werden auch publiziert und fortgeschrieben; das Deutsche Jugendinstitut, das die Federführung für den Bericht hat, bringt neben der fachlichen Begleitung eine erhebliche Forschungsleistung ein. Der Behindertenbericht hingegen wurde einzig „auf der Grundlage von Zulieferungen der Ressorts, der Länder und Leistungsträger sowie von Stellungnahmen der Verbände“ erstellt, ohne Einbezug von Wissenschaftlern, ohne Vergabe von Expertisen und anhand von Statistiken der Leistungsträger, die in Kategorisierung und Zielsetzung hochgradig variieren. Der Fokus, der sich somit auf das Thema Behinderung bislang gerichtet hat, scheint viele blinde Flecken aufzuweisen und es gibt eine ganze Reihe toter Winkel, die – trotz einer ja auch für das Feld von Behinderung seit Jahrzehnten gelten Programmatik der Teilhabe und Chancengleichheit – nie ausgeleuchtet worden sonderpädagogischen sind: „Haben Sparten die eigentlich einzelnen zureichende Kenntnisse darüber, wie sich primäre Folgen eines Defektes in allen diesen Bereichen [gemeint sind die unterschiedlichen Lebensbereiche wie Wohnen, Arbeit, Bildung, Freizeit, wie sie von der OECD 1973 in ihrem Ansatz zur Untersuchung der Lebensqualität der Bevölkerung entwickelt wurden] darstellen? Haben wir eine klare Vorstellung darüber, welche Standards in den Bereichen als erstrebenswert angezielt werden müssen?“ Diese Frage stellte Walter Thimm 1978 (27)! Er legte bereits damals die Lebensqualitätsansatzes erste auf die Übertragung Lage des behinderter Menschen vor, mit dem Ziel, anhand der empirischen Beschreibung realer Lebensbedingungen, Anhaltspunkte für die tatsächliche Integration zu erhalten und zugleich, ausgehend von der Lebenswirklichkeit, Ableitungen für das Handeln und die Ziele und Aufgaben der Angebote zu ermöglichen. Fast 25 Jahre später erstellte ich für den damaligen 11. Kinder- und Jugendbericht eine Expertise über die Lage der behinderten Kinder und Jugendlichen in Deutschland und konnte für 2002 feststellen, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderung, was amtliche Statistiken und das Sozialberichtswesen betrifft, nahezu ausgeblendet und dort, wo sie berücksichtigt waren, eine nahezu durchgängige institutionelle Sichtweise vorherrschte. Sie tauchten als „Leistungsfälle“ des Hilfesystems, aber kaum als Altersgruppe in der Sozialstruktur auf. Es gab keine Repräsentativstudien und insgesamt einen gravierenden Mangel an empirischen Daten über ihre Lebensbedingungen. Der Behindertenbericht selbst lieferte so gut wie keine empirischen Einblicke außerhalb der Leistungsstatistik und in den anderen Berichten wurden behinderte Menschen ausgeblendet. Die der Logik des gegliederten Systems sozialer Sicherheit folgende Zersplitterung der Zuständigkeiten und Trägerschaften mag für die Ausblendung behinderter Kinder und Jugendlicher im Kinder- und Jugendbericht eine große Rolle spielen; daran hat sich bis heute ebenso wenig geändert wie an der äußerst problematischen Behinderung Datenlage allgemein: dessen zum Thema feststellbare Marginalisierung in der Sozialberichterstattung insgesamt und die Marginalisierung des Behindertenberichtes lassen danach fragen, gesellschaftlichen, inwiefern aber sie auch Spiegel der der politischen Marginalisierung sind. Insofern ist mit der UN-BRK ein Handlungsdruck entstanden, der ihr auf beiden Ebenen entgegenwirkt. Jedoch einzig auf die UN-BRK als Anlass der Neujustierung zu verweisen, halte ich für verkürzt, wenn damit die Verbindung zur Sozialberichterstattung generell und ihren Standards ebenso aus dem Blick gerät wie die Frage nach den Ursachen der Marginalisierung oder der Bedeutung, die der Behindertenpolitik gesellschaftlich und politisch tatsächlich zukommt. Denn wesentlich geht es jetzt erst einmal darum, Anschluss zu finden an Standards, die andernorts erreicht sind. 1.2 Der neue Bericht: Ausgangslage und Vorgehen Zur Sichtung der Datenlage und zur Entwicklung eines neuen Konzeptes und einer neuen Organisationsstruktur, die eine größere Unabhängigkeit der Berichterstattung vom Leistungsträger sicherstellen soll, wurde eine Vorstudie in Auftrag gegeben (Hornberg u.a. 2011). Auf der Basis der Ergebnisse der Vorstudie wurde ein Vergabeverfahren für den Auftrag zur Erstellung des Berichts ausgeschrieben, den die Prognos-AG aufgrund ihres Angebotes erhielt. Prognos stellt somit die Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen, so wie sie sich in gegenwärtig verfügbaren Daten widerspiegeln, dar. Es handelt sich um eine Sekundäranalyse und nicht um eigene empirische Erhebungen. Davon getrennt werden Leistungen und Aktivitäten zur Verbesserung der Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen von der Prognos AG beschrieben. Der neunköpfige Beirat, der sich aus Wissenschaftlern und Interessensvertretern zusammensetzt, der bewertet behinderten und Menschen kommentiert die Berichtsergebnisse im Austausch mit der Prognos AG und dem BMAS und fertigt zu jedem Kapitel eine kurze Stellungnahme an. Eine eigenständige Vergabe von Expertisen oder Studien durch den Beirat hat nicht erfolgen können. Die jetzigen Erfahrungen bilden eine Ausgangsbasis für die künftige Weiterentwicklung der Organisationsstruktur. Die Vorstudie macht deutlich, auf welche Probleme der Versuch der Neukonzipierung derzeit stößt, was die Defizite der bisherigen Behindertenberichterstattung auf nationaler Ebene betrifft. Deshalb ist es auch eine wesentliche Zielsetzung des Berichtes, die Datenlücken insgesamt zu erfassen und den Forschungsbedarf zu analysieren. Die Vorstudie hat diesbezüglich folgende Ausgangslage festgestellt: „Zu diesen Lücken gehören insbesondere: • Das Fehlen von Daten und Informationen zu Diskriminierungen und zu Einschränkungen im Lebensverlauf und im Lebensalltag von Menschen mit Behinderungen [über Bildungsverläufe, Erwerbschancen, Wohnbedingungen usw]; • das Fehlen von Aussagen über die Partizipation am gesellschaftlichen Leben, an der politischen Mitbestimmung und im Arbeitsleben, insbesondere mit Blick auf die Teilhabe und Weiterentwicklung bestehender Potentiale in Ausbildung und Beruf (einschließlich erforderlicher Rahmenbedingungen zur Schaffung tatsächlicher Chancengleichheit); • das Fehlen von Aussagen über Gleichstellung und Unterstützung bei Familiengründung, Elternschaft/Kindererziehung sowie bei der Organisation von Familienleben und Beruf; • das Fehlen von Aussagen über personale und strukturelle Gewalt sowie über Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt und Diskriminierung; • das Fehlen von nach unterschiedlichen Behinderungsformen, Geschlecht und Alter, Eintritt der Behinderung, Migrationshintergrund, Lebensverhältnissen und sozialen Bildungsressourcen differenzierten Daten; • das Fehlen von umfassenden Daten zum Stand der Barrierefreiheit auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie in den Bereichen Bauen, Verkehr, Mobilität, Medien, Zugang zu Recht und Informations- /Kommunikationstechnik; • die unzureichende Einbeziehung der subjektiven Einschätzungen von Menschen mit Behinderungen und der individuell benannten Bedarfe, insbesondere auch mit Blick auf die Einbeziehung der Sichtweisen von Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung, von gehörlosen oder taubblinden Menschen, sowie von Menschen mit eingeschränkten Artikulationsmöglichkeiten, die in bisherige Befragungen aufgrund von begrenzten Erhebungsmethoden kaum einbezogen wurden; • das Fehlen einer Abstimmung der Indikatoren bei der Datenerhebung auf nationaler, internationaler Ebene, Datenabgleiche möglich so dass werden europäischer und Vergleiche und und das Fehlen eigenständiger quantitativer Surveys und qualitativer Studien zur Vertiefung relevanter Themenbereiche sowie zur Fundierung von Maßnahmenvorschlägen.“ (Hornberg u.a. 2011, 15-16). Wenn die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen abgebaut werden soll, ist die Entwicklung von Indikatoren, um die vielfältigen Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen detailliert erfassen zu können, unabdinglich. Die Vorstudie hat vorliegende Statistiken und Studien ebenso Vorschläge zur Nutzbarkeit ausgewertet vorhandener und wie zur Entwicklung von neuen Indikatoren gemacht. Denn auch Indikatoren, die bereits vorhanden sind, wie z.B. die Arbeitslosenquote amtlich anerkannter Schwerbehinderter, sind nicht ohne weiteres aussagekräftig. Sowohl ihr Entstehungs- als auch ihr Verwendungszusammenhang und das ihnen unterliegende Konstrukt müssen geprüft werden. So erfasst die Schwerbehindertenstatistik eben nur die Menschen, die im Besitz eines amtlichen Ausweises sind; Menschen ohne diesen Ausweis, aber mit vergleichbaren Einschränkungen, werden nicht erfasst. Zudem unterliegt dem SGB IX ein enges Behinderungsverständnis, das die erschwerte Teilhabe noch immer kausal aus der Beeinträchtigung herleitet. Für ein Indikatorensystem müssen zudem Bereiche bestimmt werden, die es erfassen soll und es muss einer Zielsetzung folgen: Was soll ausgesagt werden können? Für die Auswahl und Begründung der Daten sowie die Bewertung müssen deshalb konzeptionell und fachlich, aber auch normativ begründete Entscheidungen getroffen werden, die das „wie“ und „was“ der Datenerhebung leiten. Somit ist es grundsätzlich nicht möglich, Lebenswirklichkeit „rein“ und „unverfälscht“ zu erfassen; Vorannahmen und perspektivische Begrenzungen sind immer als Begrenzungen wirksam. Die Interpretation der Ergebnisse geschieht wiederum gefiltert, nämlich durch die Brille des wissenschaftlichen und fachlichen Erkenntnis- und Diskussionsstandes, der ja aber nicht immer eindeutig ist. Und schließlich lassen sich aus diesen Kenntnissen und Interpretationen nie unmittelbar Folgerungen für das Handeln ableiten, weder auf der Ebene der politischen Maßnahmen noch auf der der Praxis. Denn dazwischen liegen nicht nur viele Umsetzungsschritte, die sich weder nahtlos aus den Daten ergeben noch nahtlos in Handlungsanweisungen überführen lassen, sondern auch ein Verständigungsprozess über die Zielsetzung der Verwendung und woran man den erreichten Stand bemessen soll. Diese Grenzen der Leistungsfähigkeit der Sozialberichterstattung gelten generell, nicht nur in Bezug auf diesen Bericht, wenngleich die Dramatik der Datenlage für diesen Bericht in besonderem Maß zu Einschränkungen führt und er eher Aufschluss über das, was wir nicht wissen, erlaubt. Das bedeutet konkret, dass derzeit nur eine begrenzte Anzahl an Indikatoren vorliegt, die verwendet oder in kurzer Zeit entwickelt werden können; die Mehrzahl muss als mittel- oder sogar langfristig nur einzulösen betrachtet werden. 2.3 Die konzeptionellen Eckpfeiler des neuen Berichts Der Bericht fußt auf drei Bausteinen, die die Datenauswahl und –interpretation leiten: den Grundsätzen der UN-BRK, dem Lebenslagenansatz unter Einschluss einer Lebenslauforientierung und einem an der ICF orientierten Behinderungsverständnis. Dabei leiten die BRK-Grundsätze die Bewertung der Anforderungen, die an die Ausgestaltung der Lebensbedingungen behinderter Menschen zu richten sind. 2.3.1 Die Grundsätze der UN-BRK „a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Selbstbestimmung; b) die Nichtdiskriminierung; c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft; d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit; e) die Chancengleichheit; f) die Barrierefreiheit; g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau; h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität“ (Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 2010, 14 f.). 2.3. 2 Die Lebenslagen- und Lebenslauforientierung Die Lebenslage ist der von außen determinierte Handlungsspielraum, der dem Einzelnen zur Entfaltung und Befriedigung seiner Interessen zur Verfügung steht (Nahnsen 1975; vgl. ausführlich zum Lebenslagenkonzept Beck/Greving 2012). Die Handlungsspielräume werden auch als Dimensionen der Lebenslage beschreiben und konstituieren sich auf der einen Seite durch Ressourcen und Bedingungen des Umfelds, auf der anderen durch die des Individuums. Eine Ressource muss also solche erst einmal erkannt werden und sie muss zugänglich sein, vom Einzelnen also nutzbar gemacht werden: Ressourcen können erst über Austauschprozesse mit der sozialen und ökologischen Umwelt verfügbar gemacht werden; zugleich müssen sie dafür im Umfeld aber auch vorhanden und zugänglich sein und auf Seiten des Individuums muss ein Interesse an der Nutzung entfaltet sein. Lebenslagen sind somit das strukturelle Pendant der Umweltpartizipation; Partizipation (verstanden als aktives Teilnehmen, Gestalten, Mitwirken, Mitbestimmen und Teilhaben) sowie Einschluss- und Ausschlusskriterien (Inklusion und Exklusion), die diese Teilnahme und Teilhabe eröffnen oder begrenzen, sind also zentrale Bedingung des Inklusionsbegriff wird Handlungsspielraums. in der Lebenslagen- Der und Ungleichheitsforschung neben, stellenweise mit oder sogar nahezu inhaltsgleich wie der Partizipationsbegriff verwandt, weil beide Begriffe auf die Zugangsfrage als Bedingung der Lebenslageabheben. Sie drücken aus, dass der Einzelne Zutritt zu Lebensbereichen und damit insbesondere zu Institutionen und Organisationen wie Arbeitsstellen, Schulen usw. erhalten muss, wenn die Lebensführung die Inanspruchnahme ihrer Funktionen nötig macht. Inklusion ist kein „Schwarz-Weiß“- Zustand, im Gegenteil: Die Art und Weise, wie man Zugang erhält, kann z.B. nach rechtlichen, zeitlichen, sozialen oder funktionalen Aspekten unterschieden werden. Damit lassen sich also Barrieren sehr differenziert untersuchen. Der Zugang kann begrenzt sein oder gar nicht erfolgen; ob dies tatsächlich negativ, riskant ist und in welcher Hinsicht, lässt sich nicht ohne Bewertung der Frage sagen, ob der Zugang individuell gewünscht und ob er generell für erforderlich gehalten wird. Niemand nimmt ständig überall teil oder will dies; und auch innerhalb einer Inklusion kann es zu partiellen, manchmal auch selbst gewählten oder aber gerechtfertigten, Exklusionen kommen. Entscheidend ist also vielmehr, welche Folgen sich jeweils für die Lebensführung ergeben und ob es zu Exklusionen oder Exklusionsverkettungen kommt, die sich negativ auswirken. Denn Inklusion hat viele Formen, sie vollzieht sich in den für die Lebensführung jeweils im Lebenslauf bedeutsamen Feldern wie: Bildung, soziale Beziehungen und Familie, Kultur, Freizeit, Mobilität, Gesundheit, öffentliches und politisches Leben, Ausbildung und Beschäftigung. Zu fragen ist: Wie wichtig oder wie erwünscht ist die Inklusion in einen Bereich und wie wirkt die Inklusion oder aber Exklusion in einem Bereich auf die in einem anderen Bereich? Denn eine Inklusionsform stellt immer einen Kontextfaktor für eine andere Form dar (Engels 2006). Das Lebenslagenkonzept in der Sozialberichterstattung betrachtet deshalb die Wechselwirkungen zwischen Handlungsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Handlungsfeldern. Wichtig sind nicht nur objektive Merkmale, sondern auch subjektive Einschätzungen, z. B. in Form persönlicher Einstellungen, Selbsteinschätzungen oder der Bewertung der sozialen Einbindung. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass spätere Lebenslagen durch frühere beeinflusst werden. Das ist unmittelbar einsichtig, wenn man etwa an den Zusammenhang von allgemeinen Schulabschlüssen und beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten denkt. Lebenslauforientierung bedeutet, dass alle Altersgruppen und diese wiederum differenziert erfasst werden sollen, indem z.B. ein frühes, mittleres und späteres Erwachsenenalter unterschieden werden. Dies ist deshalb so wichtig, weil viele Beeinträchtigungen erst im Laufe des Erwachsenenlebens auftreten. Weder über Eintrittspunkte noch über Verläufe, die sich in Abhängigkeit der Lebenserfahrungen und Konstellationen der Lebenslagen, wie z.B. Bildungsabschlüsse und Sozialbeziehungen unterscheiden, besteht hinreichend Kenntnis. Aus der Perspektive des Lebenslagenansatzes sind Menschen behindert, wenn ihre Handlungsspielräume in einer oder mehreren Lebenslagedimensionen aufgrund ihrer Beeinträchtigungen geringer sind als bei Menschen ohne Beeinträchtigungen. Im Bericht werden solche Lebenslagedimensionen als Teilhabefelder bezeichnet. Die Bezeichnung Teilhabefelder wurde gewählt, um die behindertenpolitische Bedeutung des Teilhabeziels zu betonen. Die folgenden Teilhabefelder werden im Bericht behandelt: - Familie und soziales Netz - Bildung und Ausbildung - Erwerbsarbeit und Einkommen - Alltagsleben (mit Behandlung der Themen Wohnen, öffentlicher Raum, Mobilität, ambulante Dienstleistungen, persönliche Assistenzen) - Freizeit, Kultur und Sport (mit Behandlung des Themas Reisen) - Politik und Öffentlichkeit - Gesundheit - Sicherheit und Schutz vor Gewalt Zusätzlich werden zwei Schwerpunktthemen behandelt: das Thema Ältere Menschen mit Beeinträchtigungen sowie das Thema Psychische Beeinträchtigungen. Zur Beschreibung der Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen werden die genannten Teilhabefelder zunächst separat betrachtet. Darauf folgt eine mehrdimensionale Sichtweise, durch die berücksichtigt wird, dass Teilhabefelder nicht beziehungslos nebeneinander stehen, sondern sich aufeinander beziehen. Hierdurch können typische Teilhabekonstellationen von Menschen mit Beeinträchtigungen dargestellt werden, in denen Risikofaktoren sich in mehreren Teilhabefeldern kumulieren oder aber durch Ressourcen in anderen Teilhabefeldern kompensiert werden. In den Bericht fließt auch die Erkenntnis ein, dass der „soziale Raum“ die Lebenswirklichkeit der Menschen entscheidend prägt. Ein „sozialer Raum“ ist mehr als ein konkreter Ort, beispielsweise ein Quartier oder ein Stadtteil. Er umfasst größere funktionale Zusammenhänge, u. a. von Wirtschaft und Verwaltung (Makroebene) ebenso wie ortsspezifische soziale Milieus und soziale Netzwerke (Mesoebene) sowie individuelle und gruppenspezifische Verhaltens-, Wahrnehmungs- und Deutungsmuster der am Ort lebenden Menschen (Mikroebene). Für diesen Bericht bedeutet die Berücksichtigung des Sozialraums, dass danach gefragt wird, inwieweit es Maßnahmen und Aktivitäten gibt, die explizit auf den sozialen Raum abzielen, um die Lebensbedingungen von Menschen mit Beeinträchtigungen zu verbessern. 2.3.3 Das Behinderungsverständnis Dem Verständnis der UN-BRK und der ICF zu Folge ist Behinderung als Wechselwirkung zwischen Menschen und ihrer Umwelt mit Blick auf die Beeinträchtigung von Aktivitäten und Partizipation verstehen. Diese relationale Sichtweise wird im SGB IX noch nicht hinreichend berücksichtigt, eine Revision der Definition wird deshalb in Fachkreisen gefordert. Im neuen Teilhabebericht werden Barrieren ermittelt, die Menschen mit Beeinträchtigungen an der vollen und wirksamen Teilhabe am Leben in der Gesellschaft behindern, oder umgekehrt die Ressourcen bestimmt, die ihnen ungehinderte Teilhabe trotz vorhandener Beeinträchtigungen ermöglichen. In den durchzuführenden Analysen wird daher systematisch zwischen Beeinträchtigung und Behinderung unterschieden: Liegt aufgrund einer Schädigung von Körperfunktionen (inkl. psychischen Funktionen) oder Körperstrukturen eine verminderte Leistungsfähigkeit, z. B. beim Sehen, Hören, Gehen etc. vor, handelt es sich um eine Beeinträchtigung. Erst wenn im Zusammenhang mit dieser Beeinträchtigung Aktivitäten oder Teilhabe durch ungünstige Kontextbedingungen dauerhaft eingeschränkt werden, wird von Behinderung gesprochen. Dieses Verständnis ist nicht unumstritten und wird sicher breit diskutiert werden, aber es entspricht nicht nur weitaus besser der ICF als der Schwerbehindertenbegriff des SGB IX, sondern erlaubt es vor allem, auch Personen in die Betrachtung einzubeziehen, die nicht den amtlichen Schwerbehindertenausweis besitzen, Beeinträchtigungen Aktivitäten erfahren. ihrer Diese Entscheidung aber ebenfalls und Teilhabe hat erhebliche Konsequenzen für den Einbezug vorhandener Statistiken und Datensätze gehabt. Denn wesentlich wurde nicht nur auf die Schwerbehindertenstatistik, sondern auch auf andere Erhebungen, insbesondere auf die Daten des SozioÖkonomischen Panels (nachfolgend SOEP abgekürzt) zugegriffen. Das SOEP ist eine repräsentative jährliche Wiederholungsbefragung von über 12.000 Privathaushalten in Deutschland. In diesem Rahmen werden Fragen nach anerkannten Schwerbehinderungen, aber auch zu chronischen Erkrankungen und Teilhabeinschränkungen gestellt. Mit einem absoluten Stichprobenumfang von 4.315 Menschen mit Beeinträchtigungen, ermöglicht das SOEP einen relativ hohen Differenzierungsgrad nach Alter, Geschlecht und Migrationshintergrund. Allerdings sind bestimmte Gruppen nicht oder unterrepräsentiert wie Menschen, die in Wohneinrichtungen leben oder Menschen mit Beeinträchtigungen der Kommunikation. Das SOEP fragt breit Lebenslagendimensionen ab; da eine Differenzierung nach Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund, Einkommen und Haushaltsgrößen vorgenommen wird und zusätzlich subjektive Dimensionen erhoben werden, lassen sich mit den Daten typische Konstellationen abbilden und beschreiben. Diese kann man für bestimmte Lebensbereiche weiter differenzieren; so lassen sich z.B. die Erwerbsbeteiligung und Erwerbseinkommensrisikolagen in Abhängigkeit solcher Faktoren wie Alter, Geschlecht, Eintritt und Art der Beeinträchtigung erfassen. 3. Tendenzen der „Inklusion“ und Folgerungen für die Frage ihrer Erfassung und Bewertung Die Chancen und Grenzen der Erfassung und Bewertung der Lebenslagen und des Stands der Teilhabe sollen abschließend an zwei Beispielen verdeutlicht werden: am Behinderungsverständnis und an typischen Konstellationen im Erwachsenenalter. Geht man von der Begriffsbestimmung des SGB IX und dem Vorhandensein eines Schwerbehindertenausweises aus, dann stellt sich die Zahl der amtlich anerkannten schwerbehinderten Menschen folgendermaßen dar: Die Abbildung enthält sowohl eine Information über die Anzahl zu einem bestimmten Zeitpunkt als auch über deren Entwicklung in den letzten Jahren. Für SchleswigHolstein wurde für das Jahr 2011 eine Zahl von 253 725 Personen als schwerbehindert angegeben, gut zwei Prozent mehr als bei der letzten Erhebung zwei Jahre zuvor. Damit hatten neun Prozent der Bevölkerung einen Grad der Behinderung in Schleswig-Holstein, was dem Bundestrend ebenso entspricht wie die Steigerung der Zahlen der Leistungsfälle in der Eingliederungshilfe in Schleswig-Holstein. Zieht man jedoch die Angaben des SOEP heran, sehen die Zahlen anders aus: Daten der SOEP-Befragungswelle 2010 Amtlich festgestellte Schwerbehinderung oder Erwerbsminderung in Millionen: in Prozent der Bevölkerung: 9,6 14 Das Bild verändert sich dann noch einmal deutlich, wenn man die im SOEP erhobenen Zahlen der Personen hinzunimmt, die die Frage nach dem Vorhandensein chronischer Krankheiten oder Beschwerden, ohne dass eine amtlich eine Behinderung festgestellt wurde, positiv beantwortet haben. Im SOEP wurde in diesem Fall weiter danach gefragt, ob die Person bei alltäglichen Aktivitäten eingeschränkt ist: Chronische Beschwerden / Krankheiten (ohne amtlich festgestellte Behinderung) in Millionen: in Prozent der Bevölkerung: 19, 1 28 davon bei alltäglichen Aktivitäten eingeschränkt: 7,2 11% Amtlich anerkannte Schwerbehinderung plus langfristige Beeinträchtigungen ohne amtliche Anerkennung in Millionen in Prozent der Bevölkerung 16, 8 25 Insgesamt käme man so auf 16,8 Millionen Menschen, also 25% der Bevölkerung, die entweder amtlich als schwerbehindert anerkannt sind oder langfristig Beeinträchtigungen in bestimmten Teilhabedimensionen erfahren. Dass die amtliche Feststellung ungeeignet dafür ist, die tatsächliche Zahl behinderter Menschen wieder zu geben, ist bekannt. Dass aber das SOEP offensichtlich mehr amtlich anerkannte Schwerbehinderte erfasst als das Bundesamt für Statistik oder die Gesundheitsbefragung des Robert Koch-Instituts „Gesundheit in Deutschland aktuell“ (GEDA 2011), wirft Fragen auf, verdeutlicht aber auch die dahinter stehenden Probleme schon bei der Erfassung relativ „harter“ Daten wie der amtlichen Anerkennung. Und wie sehr auch mit reinen (aber durchaus klärungsbedürftigen) Zahlen „Politik“ gemacht wird, zeigt der Umstand, dass die seit geraumer Zeit steigenden Zahlen und die ja bekannte Berechnung des SOEP bereits die öffentliche und die politische Wahrnehmung der Bedeutung behindernder Bedingungen verändert haben. Wenn man eine Orientierung an der ICF verfolgt, wie dies im Teilhabebericht Entscheidungen umgesetzt darüber getroffen wird, müssen werden, welche Dimensionen von Aktivitäten und Partizipation man berücksichtigt und ab wann man von einer Beeinträchtigung dieser Dimensionen spricht. Diese Fragen werden im Teilhabebericht breit diskutiert, so dass eine Basis für eine entsprechende öffentliche Auseinandersetzung dafür geschaffen wird. Letztlich hat dies ja erhebliche Konsequenzen für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen, und zwar in mehrfacher Hinsicht: Nicht nur die Zahlen als Planungsgrundlage sind andere, sondern auch die Maßnahmenbereiche und die arten, denn es würden, wie dies z.B. in Großbritannien anhand des „Life-Opportunity“-Ansatzes schon geschieht, anstelle eine wenig aussagekräftige Zahl über den „Grad der Behinderung“ zu erhalten, ein weitaus differenzierteres Bild davon entstehen, auf welche Barrieren, bezogen auf die einzelnen Handlungsfelder Menschen treffen und wie stark sie davon beeinträchtigt werden. Verknüpft man dies mit Fragen nach dem Eintreten der Beeinträchtigung und stellt man, auch dies wird in Großbritannien so gemacht, diese Fragen auch „nicht beeinträchtigten Menschen“, entsteht langsam eine Annäherung an die Handlungsspielräume von Menschen in einer Gesellschaft und wie sie diese erleben bzw. nutzen oder nicht nutzen können. Somit werden Stufen und Formen von Inklusion und Partizipation sichtbar gemacht und Ursachen für mangelnde Partizipation trotz des Wunsches danach identifiziert. Und noch eines wird hieran deutlich: Die Umsetzung kann dann weder anhand globaler Maßnahmen geschehen, noch reichen dafür Gesetze allein aus. Die tatsächliche Umsetzung in der Form, dass Lebenschancen, Handlungsspielräume für eine selbst bestimmte Lebensführung vergrößert werden, vollzieht sich in der Feinstruktur der sozialräumlichen Bedingungen: vor Ort, an den Orten der Lebensführung, in den Kindergärten, Schulen, Wohngebieten usw. Deshalb ist neben den bundesweiten Daten eine Kenntnis der Bedarfslagen vor Ort ebenso notwendig wie die der Infrastrukturen der Versorgung, ihrer Zugänglichkeit und Leistungsfähigkeit. Ebenso notwendig dafür und auch rechtlich geboten, ist die umfassende Beteiligung der betroffenen Menschen an der Planung und Umsetzung der je vorgesehenen Maßnahmen. Die Situation in SchleswigHolstein scheint mit ihren bereits vielfältig entwickelten Initiativen und Strukturen einer inklusiven kommunalen, aber auch individuellen Teilhabeplanung bereits gute Voraussetzungen dafür zu bieten. Auf der Makro-Ebene können und Voraussetzungen müssen dafür geschaffen die werden, strukturellen damit die Gemeinden und Landkreise in der Lage sind, diese Aufgaben zu erfüllen. Im Rahmen des neuen Teilhabeberichtes erfolgen bereits Annäherungen an die mehrdimensionale Erfassung der Handlungsspielräume, um Stufen und Formen von Inoder Exklusionen differenzierter beschreiben zu können. So werden typische Teilhabekonstellationen mit Hilfe einer Auswahl von Variablen anhand der Daten des SOEP ermittelt. Die Auswahl der für die Analyse heranzuziehenden Variablen orientiert sich an den Faktoren, die das Risiko sozialer Exklusion erhöhen oder mindern. Diese sind die Einkommenshöhe, der Erwerbsstatus und –umfang, der schulische Abschluss, die berufliche Qualifikation, die familiäre Situation bzw. Unterstützung, der Gesundheitszustand und das Vorliegen eines Migrationshintergrundes. Diese Faktoren leiten sich aus den Erkenntnissen der Ungleichheitsforschung sowie der Belastungs- und Bewältigungsforschung ab, haben also eine theoretische und empirische Relevanz. Sie stellen aber nicht per se ein Risiko dar, sondern bilden wichtige Kontextfaktoren, die in ihrer Bedeutung für und Wirkung auf Dimensionen der Lebenslage analysiert und vor allem gewichtet werden müssen. So stellt die Einkommenshöhe z.B. einen Kontextfaktor des Handlungsspielraumes für das Wohnen dar; das Wohnangebot und die Wohnkosten variieren aber wiederum regional, abgesehen davon, dass weitere individuellen Bedingungen wie z.B. das Vorhandensein von Vermögen betrachtet werden müssten oder die Frage geklärt werden muss, ab wann von einer prekären Inklusion oder einer Exklusion vom Wohnungsmarkt gesprochen werden kann. Mit Hilfe einer Clusteranalyse lassen sich Gruppen Beeinträchtigungen bilden, von die Menschen über mit ähnliche Konstellationen von Handlungsspielräumen in verschiedenen Teilhabefeldern verfügen. Eine solche erste und begrenzt aussagekräftige Analyse wird von Prognos durchgeführt, getrennt für Männer und Frauen mit Beeinträchtigungen und differenziert nach drei Altersklassen sowie anhand von folgenden, in der Forschung als einflussreich identifizierten Variablen: dem Gesundheitszustand, der Erwerbstätigkeit äquivalenzgewichteten und dem Haushaltsnettoeinkommen. Innerhalb der Gruppen wird dann nach signifikanten Unterschieden in weiteren Teilhabefeldern Hierfür folgende werden Variablen gesucht. ausgewertet: Partnerschaft, Schulabschluss, beruflicher Abschluss, Selbstbestimmung und die Zufriedenheit. Mit diesem Verfahren lassen sich für Frauen und Männer in den gewählten Altersklassen jeweils drei typische Teilhabekonstellationen ermitteln. Dabei zeigen sich klare Ausprägungen in die eine oder aber andere Richtung einer ganze Reihe von Faktoren, die dann miteinander eine typische Konstellation hervorbringen: Die Faktoren sind die Einkommenshöhe, die Art der Erwerbstätigkeit, das Vorhandensein einer Partnerschaft, der Gesundheitszustand und das subjektive Empfinden der Kontrolle über das eigene Leben. In der Ungleichheitsforschung wird der dominante Einfluss der Erwerbstätigkeit auf die weiteren Dimensionen bestätigt; diese aber hängt wiederum von den Bildungschancen und –abschlüssen ab. Bei Abgängern mit Abschlüssen aus Förderschulen, die unterhalb des Hauptschulabschluss anzusiedeln sind, sind Barrieren beim Übergang von der Schule in den Beruf bzw. in die Ausbildung vorgezeichnet. Ohne eine Ausbildung wiederum sinkt die Chance auf eine dauerhafte Beschäftigung am Arbeitsmarkt, damit wiederum die Chance auf Teilhabe am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben bis hin zur Einbindung in soziale Beziehungen. Genau dies wird als Exklusionsverkettung bezeichnet. Schleswig-Holstein geht den Weg der schulischen Inklusion schon lange und weist derzeit eine weit über anderen Bundesländer liegende Inklusionsquote auf, und dies nicht nur in der Primarstufe, sondern auch in der Sekundarstufe, und genau damit werden die Chancen auch auf einen Ausbildungsplatz und damit ein Ende der Exklusionsspirale erhöht, insbesondere wenn die Schüler zu Hauptschul-, aber auch Real- und Gymnasialabschlüssen geführt werden. Diese Erhöhung der Inklusionsquote in der Sekundarstufe gelingt bundesweit dort besser, wo die Integration früh und breit etabliert wurde. Für ganz zentral halte ich dabei aber die Frage, wie sie etabliert wurde bezüglich der unabdingbaren Vernetzung zwischen schulischen sowie den vor-, außer- und nachschulischen Angeboten und bezüglich der Frage der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Damit aber wird wiederum die große Bedeutung der konkreten sozialräumlichen Handlungsprozesse sowie der Strukturen und Notwendigkeit der einer mehrdimensionalen Sichtweise, die insbesondere die Wechselspiele und Abhängigkeiten zwischen einzelnen Feldern wie der schulischen Angebote, dem Arbeitsmarkt und den vorhandenen Unterstützungsstrukturen bestätigt. Neben der Erwerbstätigkeit zeigt sich aber ein weiterer Faktor als hoch relevant und einflussreich für die Lebenslage und das subjektive Wohlbefinden: die Eingebundenheit in soziale Beziehungen, deren Bedeutung in der Resilienz-, Belastungs- und Bewältigungsforschung ebenso wie in der Lebenslagen- und Ungleichheitsforschung nachgewiesen ist. Deshalb reicht weder eine rein zahlenmäßige „Inklusionsquote“ allein nicht aus, um den Erfolg zu bemessen, noch eine Bewertung, die sich nur einzig an Kriterien wie Erwerbstätigkeitsquoten bemisst. Und schließlich sagt die Ergebnisqualität nichts darüber aus, wie sich die konkreten Prozesse gestalten und wie im Einzelfall der Bedarf erfüllt wird. Insofern muss eine Verständigung über Standards, nicht nur, aber auch und insbesondere für die zentralen Schaltstellen der Umsetzung – die Prozesse und Strukturen auf der sozialräumlichen Handlungsebene – erreicht werden, z.B. in der Frage der Vernetzung und Kooperation, der Beteiligung vor Ort, der Information über und der Zugänglichkeit von Dienstleistungen und Angeboten, der Teilhabeplanung. Soziale Räume sind ebenso sehr Orte der Beheimatung wie sie Felder von Verteilungskonflikten um Ressourcen und Machtpositionen darstellen. Inklusion sollte als ein Prozess begriffen werden, der grundsätzlich Konflikte und Spannungsfelder birgt, die sich nicht sämtlich auflösen lassen, und der vielfältige Stufen und Formen hat und flexible, vielfältige, nicht starre Lösungen erfordert. Im sozialen Raum sind behinderte Menschen auch nur eine von vielen Gruppen, die in Gefahr stehen, exkludiert zu werden, und m.E. wird sich ihre Inklusion auch nicht erfolgreich vollziehen, wenn die Grenzen zwischen den unterschiedlichen Problemlagen, Berufsgruppen, Zuständigkeiten usw. nicht bearbeitet werden. Letztlich sollten aber alle Ziele – Selbstbestimmung, Inklusion, Partizipation usw. – nicht als Zwecke an sich, sondern als Mittel für die Verbesserung von Lebenschancen betrachtet werden und zu deren Fundierung, egal ob es um Bildung, Wohnen oder Arbeit geht, braucht man Vorstellungen darüber, was z.B. Bildungsqualität heißt und wie sie zur Erhöhung von Lebenschancen beiträgt. Literatur Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen (Hrsg.), 2010: Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Berlin Beck, I., 2002: Die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und ihrer Familien in Deutschland: soziale und strukturelle Dimensionen. – In: Sachverständigenkommission 11. Kinderund Jugendbericht (Hrsg.): Gesundheit und Behinderung im Leben von Kindern und Jugendlichen. München: 175-316 Beck, I./Greving, H. (Hrsg.), 2012: Lebenslage, Lebensbewältigung. Band 5 des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik. Stuttgart Beck, I./Greving, H. (Hrsg.), 2011: Gemeinde-orientierte pädagogische Dienstleistungen. Band 6 des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik. Stuttgart Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, 2011: Nationaler Aktionsplan der Bundesregierungzur Umsetzung des Übereinkommensder Vereinten Nationenüber die Rechtevon Menschen mit Behinderungen. Referentenentwurf nach Ressortabstimmung Stand: 27.04.2011. Berlin Hornberg, C. u.a. (2011): Endbericht „Vorstudie zur Neukonzeption des Behindertenberichtes“. Bielefeld, Bochum, Frankfurt a. M. Nahnsen, Ingeborg, 1975: Bemerkungen zum Begriff und zur Geschichte des Arbeitsschutzes, in: Osterland, Martin (Hrsg.): Arbeitssituation, Lebenslage und Konfliktpotential, Frankfurt/M.: 145-166 Noll, H.-H. (Hrsg.), 1997: Sozialberichterstattung: Zielsetzungen, Funktionen und Formen. In: Noll, H.-H. (Hrsg.):Sozialberichterstattung in Deutschland: Konzepte, Methoden und Ergebnisse für Lebensbereiche und Bevölkerungsgruppen. Weinheim/München: 7-18 Robert-Koch-Institut, 2011: Daten und Fakten: Ergebnisse der Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell 2009“. Beiträge zurGesundheitsberichterstattungdes Bundes. Berlin OECD, 1973: List ofsocialconcernscommontomost OECD countries. Paris THIMM, W., 1978: Behinderungsbegriff und Lebensqualität. Ansätze zu einer Vermittlung zwischen sonderpädagogischer Theorie und Praxis. - Brennpunkt Sonderschule: 24-30 Zapf, W. (Hrsg.), 1977: Lebensbedingungen in der Bundesrepublik: sozialer Wandel und Wohlfahrtsentwicklung. Frankfurt/Main Anschrift der Verfasserin Prof. Dr. Iris Beck Universität Hamburg Fakultät IV/Fachbereich 2 Sedanstrasse 19 20146 Hamburg