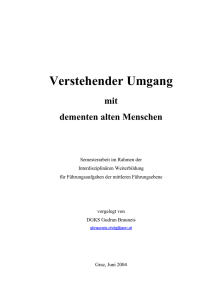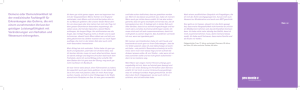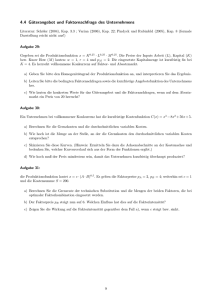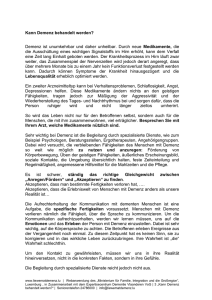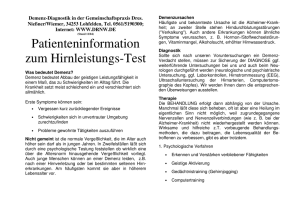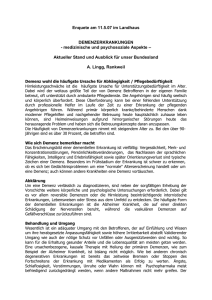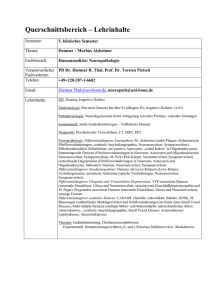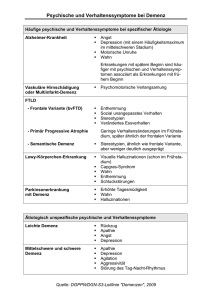10-Minuten-Aktivierung mit Verwirrten
Werbung
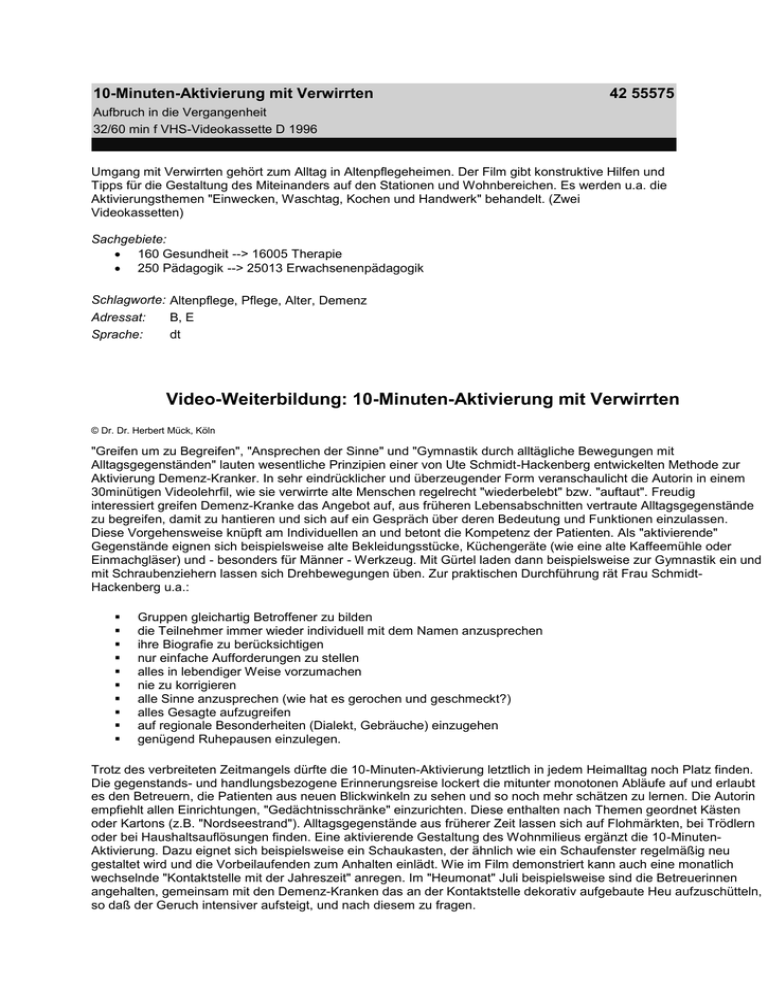
10-Minuten-Aktivierung mit Verwirrten 42 55575 Aufbruch in die Vergangenheit 32/60 min f VHS-Videokassette D 1996 Umgang mit Verwirrten gehört zum Alltag in Altenpflegeheimen. Der Film gibt konstruktive Hilfen und Tipps für die Gestaltung des Miteinanders auf den Stationen und Wohnbereichen. Es werden u.a. die Aktivierungsthemen "Einwecken, Waschtag, Kochen und Handwerk" behandelt. (Zwei Videokassetten) Sachgebiete: 160 Gesundheit --> 16005 Therapie 250 Pädagogik --> 25013 Erwachsenenpädagogik Schlagworte: Altenpflege, Pflege, Alter, Demenz Adressat: B, E Sprache: dt Video-Weiterbildung: 10-Minuten-Aktivierung mit Verwirrten © Dr. Dr. Herbert Mück, Köln "Greifen um zu Begreifen", "Ansprechen der Sinne" und "Gymnastik durch alltägliche Bewegungen mit Alltagsgegenständen" lauten wesentliche Prinzipien einer von Ute Schmidt-Hackenberg entwickelten Methode zur Aktivierung Demenz-Kranker. In sehr eindrücklicher und überzeugender Form veranschaulicht die Autorin in einem 30minütigen Videolehrfil, wie sie verwirrte alte Menschen regelrecht "wiederbelebt" bzw. "auftaut". Freudig interessiert greifen Demenz-Kranke das Angebot auf, aus früheren Lebensabschnitten vertraute Alltagsgegenstände zu begreifen, damit zu hantieren und sich auf ein Gespräch über deren Bedeutung und Funktionen einzulassen. Diese Vorgehensweise knüpft am Individuellen an und betont die Kompetenz der Patienten. Als "aktivierende" Gegenstände eignen sich beispielsweise alte Bekleidungsstücke, Küchengeräte (wie eine alte Kaffeemühle oder Einmachgläser) und - besonders für Männer - Werkzeug. Mit Gürtel laden dann beispielsweise zur Gymnastik ein und mit Schraubenziehern lassen sich Drehbewegungen üben. Zur praktischen Durchführung rät Frau SchmidtHackenberg u.a.: Gruppen gleichartig Betroffener zu bilden die Teilnehmer immer wieder individuell mit dem Namen anzusprechen ihre Biografie zu berücksichtigen nur einfache Aufforderungen zu stellen alles in lebendiger Weise vorzumachen nie zu korrigieren alle Sinne anzusprechen (wie hat es gerochen und geschmeckt?) alles Gesagte aufzugreifen auf regionale Besonderheiten (Dialekt, Gebräuche) einzugehen genügend Ruhepausen einzulegen. Trotz des verbreiteten Zeitmangels dürfte die 10-Minuten-Aktivierung letztlich in jedem Heimalltag noch Platz finden. Die gegenstands- und handlungsbezogene Erinnerungsreise lockert die mitunter monotonen Abläufe auf und erlaubt es den Betreuern, die Patienten aus neuen Blickwinkeln zu sehen und so noch mehr schätzen zu lernen. Die Autorin empfiehlt allen Einrichtungen, "Gedächtnisschränke" einzurichten. Diese enthalten nach Themen geordnet Kästen oder Kartons (z.B. "Nordseestrand"). Alltagsgegenstände aus früherer Zeit lassen sich auf Flohmärkten, bei Trödlern oder bei Haushaltsauflösungen finden. Eine aktivierende Gestaltung des Wohnmilieus ergänzt die 10-MinutenAktivierung. Dazu eignet sich beispielsweise ein Schaukasten, der ähnlich wie ein Schaufenster regelmäßig neu gestaltet wird und die Vorbeilaufenden zum Anhalten einlädt. Wie im Film demonstriert kann auch eine monatlich wechselnde "Kontaktstelle mit der Jahreszeit" anregen. Im "Heumonat" Juli beispielsweise sind die Betreuerinnen angehalten, gemeinsam mit den Demenz-Kranken das an der Kontaktstelle dekorativ aufgebaute Heu aufzuschütteln, so daß der Geruch intensiver aufsteigt, und nach diesem zu fragen. Der Lehrfilm wird ergänzt durch einen "Materialband", der in Videoform und ohne Kommentierung weitgehend ungekürzte Sequenzen aus der Aktivierungsarbeit zeigt. Aufbruch in die Vergangenheit: 10-Minuten-Aktivierung mit Verwirrten + Materialband + Begleitbroschüre. 32 Minuten bzw. 60 Minuten. Vicentz Verlag Hannover 1996. 189 DM Empfehlenswert ist auch ein weiterer 30minütiger Videofilm des gleichen Verlages, der anhand von Modelleinrichtungen in das "Problemfeld Demenz" einführt. Er zeigt den Umgang mit aggressivem und unruhigem Verhalten, kritisiert das klassische Realitätsorientierungstraining und plädiert nicht zuletzt für einen flexiblen Umgang mit den Kranken. Auf der Suche nach Lösungen: Problemfeld Demenz (+ Begleitbroschüre). Vincentz Verlag 1993. 158 DM Wohnen, pflegen, begleiten von verwirrten Leuten Pflegephilosophie in den Pflegewohngruppen "Im Bohl", Aadorf Wohnen - Geborgenheit - Vertrautheit Vertrautheit geben durch die persönliche Zimmereinrichtung mit eigenen Möbeln und Gegenständen aus dem früheren Haushalt, sofern sie noch vorhanden sind, ist für die erkrankte Person wichtig. Vor allem für die Anfangsphase kann es eine gute Hilfe zum Einleben sein. Wir sind bestrebt im ganzen Haus eine möglichst normale Wohnatmosphäre zu bieten, die Wärme und Behaglichkeit ausströmen Durch das Einhalten von möglichst vielen gewohnten Tages- und Jahresabläufen versuchen wir Sicherheit zu vermitteln. Dazu gehört, dass die täglichen Verrichtungen meistens in der gleichen Reihenfolge gemacht werden. "Rituale", wie die z.B. eine tägliche Radiosendung oder die Tagesschau im Fernsehen, auf Wunsch das gewohnte Abendgebet sprechen etc. bringen Geborgenheit. Auf diese Weise können oft Beruhigungs- und Schlafmittel schnell reduziert oder mit der Zeit ganz weggelassen werden. Weglaufgefahr Warum kommen Verwirrte plötzlich auf die Idee wegzulaufen? Meistens haben sie einen triftigen Grund, den nur wir nicht immer verstehen können. Wir stellen fest, dass die Weglaufgefahr am Nachmittag oder Abend meistens verstärkt ist, sie müssen nach Hause, bevor es dunkel wird, sonst ängstigt sich die Mutter. Viele Verwirrte leben in ihrer Gedankenwelt stark in der Vergangenheit, ja sogar in der Kindheit, sie mussten ja als Kind am Abend auch nach Hause gehen. Ein anderer Grund wäre, wenn man müde ist, sucht man sein Bett auf in der Geborgenheit des Elternhauses? Vielleicht erlebte die Person kurz vorher eine Enttäuschung und möchte sich deshalb entfernen, damit sie der Schmach aus dem Wege gehen kann. Eventuell liegt der Grund hinter dem Weglaufen einfach darin, dass die Toilette momentan unauffindbar ist und die richtigen Worte zum Fragen fehlen. Die Ursachen des Weglaufens sind vielschichtig, doch bei einfühlsamer Beobachtung findet die betreuende Person oft den Grund des Weglaufdranges und kann entsprechend reagieren. Ein kleiner Spaziergang genügt oft um wieder "nach Hause" kommen zu können oder das Aufsuchen der Toilette ist die erlösende Tat ect. Trotz eingezäuntem Garten kann es vorkommen, dass jemand entweichen kann. Was tun, wenn sie einer verwirrten Person begegnen? Leute, die weglaufgefährdet sind, tragen in der Regel eine Karte oder Brosche mit Namen und Adresse auf sich (um den Hals oder in einer Kleidertasche) Sprechen sie die Person mit ruhiger, sicherer Stimme an. Meistens sind Verwirrte sehr dankbar für jede Hilfe. Suchen sie nach einer Weile die Identifikationskarte. Dann rufen sie so schnell als möglich die vermerkte Telefonnummer an oder sie bringen die Person an die entsprechende Adresse. Weggelaufene Patienten können ziellos und stur umherirren, jeglichen Verkehr missachten und kennen keine Gefahren! Orientierung Sich "Zurrechtzufinden", sogar in der eigenen Wohnung, kann vielen Erkrankten Mühe bereiten. Bei einem Wechsel in eine neue Umgebung wird das Problem noch akuter. Es erfordert viel Verständnis und Geduld um täglich die immer wiederkehrenden Fragen zu beantworten. Versuchen sie sich vorzustellen, sie werden in eine wildfremde Stadt gestellt und müssten nun ihr Hotel finden und nur wirsche Personen geben ihnen unverständliche Hilfe. So ungefähr fühlt sich eine verwirrte Person. Kennzeichnungen an den Türen können hilfreich sein, aber leider nicht immer. Je nach Krankheitsstadium lernen die Patienten und Patientinnen nach einer gewissen Zeit (einige Wochen bis Monate) die neue Umgebung kennen und finden sich selber zurecht. Im Verlauf der zunehmenden Verwirrtheit können leider die Orientierungsprobleme wieder auftreten. Ausserhalb des Gartens kann bei gewissen Verwirrten die Orientierung trainiert werden, indem täglich der gleiche Spaziergang gemacht wird. Zuerst geht man ein paar mal zusammen, nachher ist die betreuende Person nur noch im Hintergrund, bis man sicher ist, dass der Weg nach Hause allein gefunden wird. Gegenseitiges Verstehen in der Pflege von Verwirrten Verständigungsprobleme zu überwinden ist in der Pflege von Verwirrten die schwierigste Aufgabe. Je nach Erfolg ändert sich die Zufriedenheit des Patienten oder der Pati-entin, der Pflegeaufwand und die Menge der Psychopharmakas reduzieren sich. Für den Umgang mit den Patienten und Patientinnen gibt es bei uns keine eindeutigen Rezepte, jedoch Verhaltensformen, die gewisse Erfolge bringen. Einige Beispiele: - Logotherapie: gib den Wünschen gegenüber dem Patienten einen Sinn. Frau Fink sitzt den ganzen Morgen im Stuhl und will sich nicht bewegen. Der Hunger und der gedeckte Tisch sind aber ein einleuchtender Grund sich vom Stuhl zu erheben. - Validation: eingehen auf das jeweilige Gefühl des Patienten. Fr. Meier zieht mitten in der Nacht den Mantel an. Mögliche Reaktion: "Sie haben den Mantel angezogen, müssen sie nach Hause gehen?, müssen sie dort dringed etwas erledigen,etc.? - Realität ansprechen: Hr. Kreis ist unruhig und möchte unbedingt auf sein Büro gehen. Mögliche Reaktion: "sie dürfen hier bleiben, jemand ist bereits mit ihrer Arbeit beschäftigt. - Mit Reflexen arbeiten: Fr. Ernst sitzt vor ihrem vollen Teller und weiss nicht mehr, wie sie das Besteck benutzen muss. Mögliche Reaktion: "ich gebe ihnen die Gabel in die Hand und führe das Besteck etwas, dann geht das Essen wieder von selbst". - Rhythmus miteinbezeihen: Fr. Lutz hat momentan panische Angst vor dem Laufen. Mit einem rhytmischen Vers, einem Lied oder einigen Takten Musik kann die Aufmerksamkeit auf etwas anderes gelenkt werden und die Bewegungen kommen automatisch zu stande. - Haustiere können verloren geglaubte Fähigkeiten kurzfristig wieder aktivieren, z.B.dass normales Sprechen mit dem Tier wieder möglich ist. Einige Grundregeln im Umgang mit Verwirrten: - Ganz allgmein sollen einfache und kurze Sätze gemacht werden. - Versuchen sie sich in die Lage des Patienten einzufühlen. - Versuchen sie nur bei ganz wichtigen Gründen zu widersprechen oder die Patienten von ihrer Meinung abzuhalten. Alltagsgestaltung, eine Gratwanderung zwischen Erfolgserlebnissen, Enttäuschungen oder ein Leben in grosser Toleranz Hört man in der Küche das Geschirr klappern, steigen angenehme, bekannte Düfte aus den Pfannen, liegen Herbstlaub oder Essresten auf dem Boden, so sind das natürliche Anstösse etwas zu unternehmen was man zeitlebens gemacht hat. Diese Impulse sind zu nutzen und animieren die Erkrankten zu Aktivitäten, die von Erfolg gekrönt sind. Bei der Aktivierung geht es vor allem darum Misserfolge zu vermeiden und Beschäftigungen zu suchen, die zu einem Erfolgserlebnis führen. Fehler werden nicht "angekreidet", wir versuchen sie eher zu umgehen und falls nötig unauffällig zu korrigieren und zu verhindern. Die Erkrankten werden ohnehin täglich mit vielen Unzulänglichkeiten konfrontiert. Inkontinenz: Unvermögen für die kontrollierte Entleerung von Blase und Darm Im späteren Stadium der Krankheit geht auch die Fähigkeit für eine kontrollierte Entleerung von Blase und Darm verloren. Mit Toilettentraining, d.h. mit regelmässiger Aufforderung zum Toilettengang wird die völlige Abhängigkeit von Slipeinlagen solange wie möglich hinausgeschoben. Patientenruf-System/Ueberwachung Die Tätigkeit auf eine Klingel zu drücken um Hilfe anzufordern ist für den grössten Teil unseren Patientinnen und Patienten bereits eine Ueberforderung oder in einer Wahn-vorstellung fühlt sich der Patient nicht hilfsbedürftig, er macht einfach, was er meint tun zu müssen. Das einfachste für uns wäre eine Fernsehüberwachung, vor allem nachts. Doch der Gedanke an eine totale Ueberwachung ist uns zuwider. Solange als möglich soll die Intimssphäre im eigenen Zimmer nicht gestört werden. Zur Sicherheit für gefährdete Leute setzen wir Bewegungsmelder und Mikrophone in den Zimmern ein und ein Funkgerät für die Uebermittlung in beide Häuser. Sterben in den Pflegewohngruppen Leute, die bei uns Aufnahme gefunden haben, begleiten wir bis zum Tode im eigenen Zimmer. Je nach Bedürfnis stellen wir ein Pflegebett bereit. Wir besitzen die technischen Hilfsmittel (Sauerstoff, Absaugapparate etc.) und das Wissen für Schmerzlinderung. Die Technik soll aber nicht im Vordergrund stehen, viel wichtiger ist uns eine möglichst friedliche Zeit des Abschiednehmens und falls erwünscht auch Begleitung der Angehörigen. Quelle: http://www.curadementi.ch/Begleiten.htm Konzepte für die Betreuung dementer Menschen. Theoretische Modelle und ihre Umsetzung in der Praxis am Beispiel von Altenheimen in Marburg Quelle: http://www.we-serve-you.de/anne/index.htm?betreuungskonzepte.htm In diesem Abschnitt werden ausgewählte Betreuungskonzepte vorgestellt, wobei vor allem umfassendeKonzepte berücksichtigt werden, die einen komplexen Ansatz zur Betreuung von dementen Menschen bieten. Auf andereKonzepte, die ebenfalls in der Betreuung eingesetzt werden, aber eher spezielle therapeutische Interventionen darstellen (z.B. Kunsttherapie, Musiktherapie, basale Stimulation), wird nicht näher eingegangen. 5.1 Realitätsorientierungstraining Das Realitätsorientierungstraining (ROT) ist ein verhaltenstherapeutischer Ansatz, der 1958 von J. Folsom, später unter Mitarbeit von L. R. Taulbee, in den USA entwickelt wurde. Zunächst war dieses Konzept zur Rehabilitation von Kriegsopfern gedacht, wurde dann aber auch in die Arbeit mit verwirrten Menschen in Pflegeheimen eingeführt (Kitwood, 2000, S. 87). Es war also nicht speziell für Demenzkranke konzipiert, sondern allgemein für Menschen mit Gedächtnisverlust, Verwirrtheit und Orientierungsschwierigkeiten in Institutionen, unabhängig von der zugrundeliegenden Krankheit (vgl. Egidius, 1997, Kap. V. 2.3.5). Nach Folsom verfolgt das ROT das primäre Ziel, die Gedächtnisleistung zu steigern und die zeitliche, örtliche und personelle Orientierung zu verbessern. Außerdem soll die Identität der Verwirrten erhalten und ihre Selbständigkeit, ihr Wohlbefinden und ihre soziale Kompetenz gefördert werden. Erwähnenswert ist auch die mit der Anwendung des ROT angestrebte Steigerung der Arbeitszufriedenheit des Personals, welche zu den Zielsetzungen des ursprünglichen Konzepts zählt (vgl. Egidius, 1997, Kap. V. 2.3.5). Praktische Umsetzung Das von Folsom entwickelte Konzept wird in seiner ursprünglichen Form nicht mehr angewendet. Es lassen sich aber Teilaspekte daraus in unterschiedlichen, später entwickelten Betreuungskonzepten, z.B. in der Milieutherapie (vgl. Kap. 5.2), wiederfinden. Herbert Mück bemerkt dazu: "Der Begriff ROT diente bislang eher als Sammeltopf für viele unterschiedliche umweltorientierte Behandlungsansätze." (Mück, 2001). Im Folgenden wird die praktische Anwendung des ROT anhand des drei Komponenten umfassenden Konzepts von Folsom vorgestellt. (Quellen: Egidius, 1997, Kap. V. 2.3.5; Schaller, 1999, S. 67-69; Wolter-Henseler, 1999). Komponente 1: Das Einstellungstraining des Personals Für die Anwendung des ROT ist die Vorbereitung des Pflegepersonals entscheidend, "da sich mit einer rein technischen Anwendung des ROT kaum der gewünschte Erfolg erzielen lässt." (Schaller, 1999, S. 67). In Form von Schulungen werden dem Personal Grundgedanken und Prinzipien des Konzepts mit dem Ziel vermittelt, sie für die praktische Umsetzung zu motivieren. Das Einstellungstraining soll dem Personal eine positive Grundhaltung gegenüber verwirrten Menschen nahe bringen, d.h. sie sollen davon überzeugt werden, dass diese Personengruppe gezielt und mit Erfolg unterstützt werden kann. Daneben wird der empathische, respektvolle Umgang mit dementen Menschen und die Wichtigkeit, über biographische Kenntnisse des Einzelnen zu verfügen, betont. Als ausschlaggebend für die erfolgreiche Umsetzung des Konzepts gilt außerdem eine gute Teamarbeit und die Beteiligung des gesamten Personals, da davon ausgegangen wird, dass nur dies eine einheitliche Haltung und Umgangsweise gegenüber den verwirrten Menschen gewährleistet. Die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern soll durch regelmäßig stattfindende Teamsitzungen gefördert werden, die gleichzeitig Gelegenheit geben, über Probleme bei der Anwendung des ROT zu diskutieren. Komponente 2: Das 24-Stunden-ROT Das Ziel des 24-Stunden-ROT ist es, "den Alltag der dementiell erkrankten alten Menschen ‚rund um die Uhr' so zu gestalten, dass ihre Orientierungsfähigkeit unterstützt wird." (Egidius, 1997, Kap. V. 2.3.5). Die orientierungsunterstützenden Maßnahmen betreffen hauptsächlich die Kommunikation und die Umgebungsgestaltung. Jede Interaktion zwischen Pflegekraft und Demenzerkrankten stellt nach diesem Konzept eine Möglichkeit dar, Informationen zur Realität zu geben. Diese beziehen sich z.B. auf die aktuelle Zeit, den Ort oder Personen. Alle Handlungen werden von der Pflegekraft kommentiert und Fragen des Betreuten wahrheitsgemäß beantwortet. Formuliert der demente Mensch falsche Aussagen oder zeigt desorientiertes Verhalten, wird dies von der Pflegeperson korrigiert, sofern es sich nicht um sehr sensible Themenbereiche handelt. In der Anwendung des 24-Stunden-ROT wird die Vermittlung von Erfolgserlebnissen betont, indem z.B. leicht zu beantwortende Fragen gestellt werden und orientiertes Verhalten und der Realität entsprechende Äußerungen der Demenzerkrankten vom Pflegepersonal positiv verstärkt werden. Insgesamt soll durch dieses Vorgehen ein Realitätsbezug und ein Bewusstsein für das reale Geschehen hergestellt und die Kommunikationsfähigkeit des Dementen gefördert werden. Neben der verbalen Kommunikation soll auch die Umgebung die räumliche und zeitliche Orientierung unterstützen. Die Räumlichkeiten sollen einen wohnlichen Charakter aufweisen und überschaubar und anregend gestaltet sein. Empfohlen werden auch Orientierungshilfen, wie das Anbringen großer Uhren und Kalender, Wegweiser, Namensschilder, die farbliche Gestaltung verschiedener Funktionsbereiche im Altenpflegeheim und die freie Verfügbarkeit anregender Materialien, wie z.B. Fotos, Spiele, Zeitschriften und Radio. Zur Umsetzung des 24-Stunden-ROT gehört des weiteren die Strukturierung des Heimalltags, d.h. ein re Musiktherapie mit alten verwirrten Menschen Universität Siegen FB Sozialpädagogik / Musiktherapie Fachvortrag am 01.11.2003 Quelle: http://www.sonoptikon.de/praxis-mt/favo-dem.php 1. Heimat, deine Sterne Berge und Buchten, von Nordlicht umglänzt, Golfe des Südens, von Reben bekränzt, Ost und West hab´ ich durchmessen, doch die Heimat nicht vergessen. Hörst du mein Lied in der Ferne, Heimat. Heimat deine Sterne, Sie strahlen mir auch am fernen Ort. Was sie sagen, deute ich ja so gerne als der Liebe zärtliches Losungswort. Schöne Abendstunde, der Himmel ist wie ein Diamant. Tausend Sterne stehen in weiter Runde, von der Liebsten freundlich mir zugesandt. In der Ferne träum´ ich vom Heimatland. Länder und Meere, so schön und so weit, Ferne, zu Märchen und Wundern bereit, alle Bilder müssen weichen, nichts kann sich mit dir vergleichen! Dir gilt mein Lied in der Ferne, Heimat. Heimat deine Sterne, Sie strahlen mir auch am fernen Ort. Was sie sagen, deute ich ja so gerne als der Liebe zärtliches Losungswort. Schöne Abendstunde, der Himmel ist wie ein Diamant. Tausend Sterne stehen in weiter Runde, von der Liebsten freundlich mir zugesandt. In der Ferne träum´ ich vom Heimatland. Stand ich allein in der dämmernden Nacht, hab´ ich an dich voller Sehnsucht gedacht. Meine guten Wünsche eilen, wollen nur bei dir verweilen. Warte auf mich in der Ferne, Heimat. Heimat deine Sterne, Sie strahlen mir auch am fernen Ort. Was sie sagen, deute ich ja so gerne als der Liebe zärtliches Losungswort. Schöne Abendstunde, der Himmel ist wie ein Diamant. Tausend Sterne stehen in weiter Runde, von der Liebsten freundlich mir zugesandt. In der Ferne träum´ ich vom Heimatland. Erich Knauf Melodie: Werner Bochmann, aus dem Film "Quax, der Bruchpilot" 1942 gesungen von Wilhelm Strienz 2. Alt werden Carlos Castaneda berichtet in seinem Buch "Eine andere Wirklichkeit" über ein Gespräch mit seinem indianischen Freund Don Juan zum Verhältnis des Kriegers zum Tod. Im Leben des Kriegers geht es immer wieder darum, den Tod zu besiegen. Aber eines Tages, so Don Juan, wird der Krieger, der ein Leben lang Sieger geblieben ist, von einem neuen Gegner bezwungen: Es ist das Alter. 2.1. Altern als natürlicher Prozess Wir alle wollen alt werden, im Alter seelisch, geistig und körperlich gesund bleiben und in Würde und mit unserem Leben ausgesöhnt sterben. Es ist für uns eine der schlimmsten Erfahrungen, zu erleben, wie ein Familienmitglied oder ein Freund zum Ende seines Lebens seine Gesundheit, seine Identität und seine Würde verliert und letztlich vom Tod aus endlosen Qualen erlöst wird. Im zweiten Teil des 20. Jahrhunderts ist der Alterungsprozess zunehmend in den Blickpunkt wissenschaftlichen Interesses gerückt. Dass körperlicher und geistiger Abbau den Alterungsprozess begleiten, galt zunächst - vor allem auch im Urteil der wenig informierten Öffentlichkeit - als ausgemacht. Das Defizitmodell der geistigen Entwicklung korrespondierte mit dem Ergebnis von amerikanischen Intelligenztests, die bei zunehmendem Alter fallende Werte aufwiesen (nach Lehr 1977), es geht davon aus, dass der Alterungsprozess notwendiger Weise nicht nur von körperlichen, sondern auch geistigen Abbauprozessen begleitet wird. Wir wissen heute, dass diese Auffassung so nicht stimmt. Sie wird allein durch die offensichtliche Tatsache widerlegt, dass wir viele 70-, 80- und sogar auch 90-jährige kennen, die geistig und körperlich fit sind. Man kann nicht von Intelligenz als solcher sprechen, und es handelt sich auch nicht um ein stati-sches Produkt. Mit dem Lebensalter erfolgt eine Verschiebung von der flüssigen zur kristallinen Intelligenz. Im Jugendalter können sehr schnelle Anpassungen an neue Situationen erfolgen, Kombinationsfähigkeit, Wendigkeit und Orientierungsfähigkeit gehören hier her. Diese Fähigkeiten nehmen im Alter ab, demgegenüber nehmen Fähigkeiten zu, die man zur "Weisheit des Alters" zählen kann: Erfahrungswissen, Allgemeinwissen, Sprachverständnis, Fähigkeit zum "Querdenken". Alte Menschen werden langsamer, aber nicht dümmer. Intelligenztests sind fast immer an Zeit und damit Geschwindigkeit gebunden. Hier werden alte Menschen benachteiligt. Die Lernfähigkeit im Alter ist nicht so sehr einem natürlichen Alterungsprozess unterworfen, sondern in viel stärkerem Maße anderen Bedingungen: Gesundheitliche Probleme bzw. gesunde Ernährung und Lebensweise Einstellungen und Erwartungen: Nur wer auch im Alter noch Interesse an seiner Umwelt hat, wir geistig aktiv und fit bleiben Soziökonomische Bedingungen: Soziale Isolation, Einsamkeit, aber auch Armut grenzen den Lebensradius ein und verhindern eine schöpferische Auseinandersetzung mit der Umwelt. Biografische Fakten: So wie ein Mensch gelebt hat, wird er sich auch im Alter verhalten. Wer zeitlebens interessiert und aktiv war, wird es auch im Alter sein. Das Alter bringt große Veränderungen für die Persönlichkeit, ein alter Mensch muss sich, vor allem, wenn er aus dem Arbeitsprozess entlassen wird, unter Umständen sehr stark umstellen. Verschiedene sozialwissenschaftliche Modelle versuchen diesen Umstellungsprozess zu beschreiben: Die Aktivitätstheorie geht davon aus, dass - nach der Devise "wer rastet, der rostet" - nur der im Alter glücklich und gesund bleiben kann, sich einen aktiven Alltag gestaltet. Die Disengagement-Theorie gehen davon aus, dass der "Rückzug aufs Altenteil" einen natürli-chen Rückzug aus Aktivitäten und Verpflichtungen mit sich bringt. Der alte Mensch und die Ge-sellschaft lösen gleichzeitig ihre Bindungen zueinander allmählich auf. Das Kompetenzmodell (Baltes, 1979, 1992): Der psychologische Mechanismus zur erfolgreichen Bewältigung der Herausforderungen des Alterns lautet Optimierung durch Selektion und Kompen-sation: Selektion: Alte Menschen können sich durch bewusste Auswahl (Selektion) auf die für sie aktuell wichtigen Lebensbereiche beschränken und den Umfang ihrer Aktivitäten den verfügbaren geistigen, körperlichen und sozialen Ressourcen anpassen. Kompensation: Körperlicher und mentale Schwächen können durch Rückgriff auf technische Hilfen und Inanspruchnahme sozialer Unterstützung und Pflege ausgeglichen werden. 2.2. Degenerative Veränderungen als Produkte krankhafter Prozesse Typische Kränkungen im Alter führen zu psychischen Verstimmungen, Störungen und Erkrankungen. Auffallend ist auch eine hohe Suizidrate mit zunehmendem Alter. Einen eindrucksvollen Überblick dazu gibt die Studie des Bundesministeriums für Familie und Senioren (Erlemeier 1992). Es ist vor allem Einsamkeit und Isolation, die alte Menschen in eine Situation treiben, in der sie sich nicht mehr anders zu helfen wissen als psychische und psychosomatische Symptome zu entwickeln. Beobachtet werden Arbeits- und Leistungsstörungen, funktionelle und vegetative Beschwerden sowie Verstimmungs- und Affektreaktionen. Dabei sind Angst- und Depressionsstörungen die häufigsten Erscheinungen. Daneben können auch krankhaft-degenerative hirnorganische Veränderungen einsetzen, die organisch bedingte psychische Symptome hervorbringen. Für diese Störungen finden sich eine große Anzahl von Diagnosen: Hirnorganisches Psychosyndrom (HOPS) Psychoorganisches Syndrom (POS) Senile Demenz Senile Demenz Alzheimer Typ (SDAT) Demenz Alzheimer Typ (DAT) Multiinfarkt-Demenz (MID) ... und andere Symptomkreise. Auffallend ist der Zusammenhang zwischen Isolation, Demenzerkrankung und Depression. Ein alter Mensch, der an einer Demenzerkrankung leidet, bemerkt in der Regel den geistigen Abbau und reagiert mit großer Angst und Depression. Auch dann, wenn es nicht möglich ist, den degenerativen Prozess zum Stillstand zu bringen, ist es notwendig, den Menschen in die dunkle Welt der Verwirrung zu begleiten und ihm so weit wie möglich die Angst zu nehmen. 3. Der biografische Ansatz in der Altenpflege Biografie ist Identität. Wir sind das, was wir sind, durch das, was wir erlebt haben und wie wir es verarbeitet haben. Biografiearbeit heißt, Wertschätzung zu entwickeln für die Erlebnisse und Erfahrungen eines alten Menschen und für das, was er uns mitzuteilen hat. Biografiearbeit hilft dem alten Menschen, seine Identität zu bewahren oder zu retten. Gerade bei Demenzprozessen kann Biografiearbeit helfen, Identität so weit wie möglich zu stabilisieren. 3.1. Gewinn für den alten Menschen Rückblick aus der heutigen Situation leisten, Vergangenes neu bewerten Erinnerungen wachrufen, emotionale Momente nacherleben Lebenserfahrungen weitergeben, Wertschätzung als Zeitzeuge erfahren Vergangenes aufarbeiten, Versprachlichung von Erlebtem hilft verarbeiten Beim Zuhörer Interesse am Vergangenen wecken 3.2. Gewinn für die Pflege Basis für Vertrauen wird geschaffen Im Dienste der geragogischen Praxis sich als Medium einbringen können Erkennen von individuellen Identitäten Den Biografieprozess als einen unabgeschlossenen und dynamischen Prozess sehen Dem alten Menschen Zukunft zugestehen Der biografische Ansatz beschränkt sich nicht nur auf das Gespräch, das überwiegend klientenzentrierten Charakter hat. Die Orientierung auf die Biografie des alten Menschen geht weit über das verbale hinaus. Gute Altenheime sammeln Gegenstände, Bilder, Fotos, Zeitungen aus vergangenen Jahrzehnten. Alte Schallplatten können Anlass sein, sich auf biografische Ereignisse zu erinnern, und auch die gemeinsame Zubereitung von Gerichten, die man als Kind gerne gegessen hat, kann produktive Biografiearbeit sein. Die Vergangenheit ist nicht nur rosig, sondern auch schuld- und konfliktbeladen. So kann Biografiearbeit auch einen Beitrag dazu leisten, Vergangenheit aufzuarbeiten und konflikthafte Prozesse abzuschließen. Gerade die Generation, die jetzt in Altenheimen lebt, ist davon betroffen. Die meisten haben in der Zeit der Nazidiktatur gelebt, viele haben am Krieg teilgenommen. Und wir finden unter dem Klientel der Altenheime nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Immer wieder kann es auch zu einer Täter-Opfer-Begegnung kommen. Eine Aufarbeitung der Vergangenheit ist nur möglich, wenn der Betroffene geistig und psychisch gesund und damit auch in der Lage ist, eine derartige Aufarbeitung aktiv zu leisten. Aber auch bei Verwirrten hat Biografiearbeit einen Sinn: Hier schaffen wir mit Hilfe vorwiegend nonverbaler Medien eine emotionale Brücke zur Vergangenheit und zur eigenen Identität. Zur Erläuterung ein Fallbeispiel: Frau H. Frau H. Ist scheinbar gut orientiert, kommuniziert angeregt - es stellt sich aber heraus, dass sie auch auf recht einfache Fragen keine Antwort geben kann. Sie schafft es, nach außen gut orientiert zu wirken. Sie führt sozusagen eine "interessante Konversation", die geschickt von ihrer Demenz ablenkt bzw. diese verdeckt. In der Musiktherapie wirkt sie manchmal recht kritisch und hinterfragt, was ich da so mache. Sie hat sehr viele biografische Details beigesteuert: Als junges Mädchen hat sie Klavier gespielt, ihr Lehrer war recht streng, und sie hat wohl den ganzen Katalog der Klassik gelernt, Sonatinen, Sonaten usw. Sie ist in einer ostdeutschen Industriestadt aufgewachsen, ihr Vater hat sie in einem Autohaus untergebracht, und dort hat sie es wohl zur Chefsekretärin gebracht. Sie war wohl recht sorgfältig und gewissenhaft. Vieles weiß sie nicht mehr so ganz genau, aber sie erzählt es gut und spannend. Wenn sie auch manchmal etwas kritisch wirkt, so nimmt sie doch aktiv und teilweise sogar begeistert an der Musiktherapie teil. Sie singt engagiert mit, und durch Mimik und Gestik wird deutlich, dass sie sich mit den Texten auseinandersetzt. Wenn ich Akkordeon spiele, bekomme ich auch immer eine positive Rückmeldung von ihr. Sie spricht gerne über die Musik und über ihr Klavier, sie macht denn Eindruck, dass sie gerne etwas "Anspruchsvolleres" hört. Im Krieg hat sie dann alles verloren, das Klavier "war futsch". Frau H. Ist weit über achtzig, fast neunzig Jahre alt. Dennoch war sie die wachste von allen. Sie erinnert sich nicht an ihr Alter, aber an ihr Geburtsdatum. Dies trifft man bei älteren verwirrten Menschen häufig. Als ich nun für eine neue Maßnahme in das Heim gekommen bin, war Frau H. nicht mehr dabei. Sie war in der Zwischenzeit gestorben. Frau R. Frau R. spricht mit lauter Stimme und etwas "roboterhaft": Am Anfang der Stunde gibt sie meist in dieser Weise ihre Stellungnahme ab: "Was soll ich hier?", "Ich will nicht zur Musiktherapie?", "Ich muss essen", "Wann bekommen wir etwas zu essen?". Sie ist blind und sitzt im Rollstuhl. Es gelingt mir eigentlich immer, sie zum Bleiben und mit machen zu motivieren. Wenn wir singen, singt sie laut mit. Bei "Lustig ist das Zigeunerleben" habe ich gefragt, ob denn jemand Kontakt mit Zigeunern hatte. Frau R. erzählte, sie habe auf einem Hof gelebt, und da wären die Zigeuner gekommen. Sie hätten Musik gemacht und wollten aus der Hand lesen. Sie hätte sich gerne aus der Hand lesen lassen, aber die Mutter hat es verboten. Trotzdem hat sie sich doch heimlich die Zukunft sagen lassen. Sie erinnert sich aber nicht mehr daran, was die Zigeuner ihr vorhergesagt haben. Am Ende sagte sie manchmal in ihrer "roboterhaften", lauten Art: "Es war wieder schön heute in der Musiktherapie". Bei Frau R. habe ich Erfahrung mit einer speziellen Problematik gemacht: Die Angehörigen von Frau R. gehören zu Jehovas Zeugen, und sie standen der Musiktherapiestunde misstrauisch gegenüber, da sie nicht sicher waren, ob nicht auch religiöse Inhalte vermittelt würden. Wie man weiß, sind Jehovas Zeugen sehr konsequent in der Ablehnung auch anderer christlicher Strömungen. So vermeiden sie z.B. die Beteiligungen an Weihnachtsfeiern (z.B. in Schule oder Kindergarten). Sie übten auf ihre Mutter bzw. Schwiegermutter Druck aus und diese traute sich nicht mehr zu kommen. Frau R. ging es dann zunehmend schlechter, und sie konnte nicht mehr kommen. Inzwischen ist sie auch verstorben. 4. Validation Die deutschstämmige Amerikanerin Naomi Feil hat bereits in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts den methodischen Ansatz der Validation entwickelt. Es geht dabei darum, alten, verwirrten Menschen in einer angemessenen Weise zu begegnen. Nach Naomi Feil ist Validation: Eine Entwicklungstheorie für sehr alte, mangelhaft/unglücklich orientierte und sorientierte Menschen Eine Methode, ihr Verhalten einzuschätzen Eine spezielle Technik, die diesen Menschen hilft, durch individuelle Validation und Validations-Gruppen ihre Würde wieder zu gewinnen Validationsziele sind: Wiederherstellung des Selbstwertgefühls Reduktion von Stress Rechtfertigung des gelebten Lebens Lösen der unausgetragenen Konflikte aus der Vergangenheit Reduktion chemischer und physischer Zwangsmittel Verbesserung der verbalen und nonverbalen Kommunikation Verhinderung eines Rückzugs in das Vegetieren Verbesserung des Gehvermögens und des körperlichen Wohlbefindens Naomi Feil geht davon aus, dass es vor allem psychische Faktoren sind, die verantwortlich sind für den Demenzprozess. Beim alten Menschen entstehen im Gehirn Eiweißbrücken, die für Fehlfunktionen verantwortlich sind. Man kann sich dies vorstellen wie Deformationen des Lötmaterials bei einer Platine, die für "Kurzschlüsse" und damit Fehlfunktionen der Platine verantwortlich sind. Aufschlussreich ist allerdings eine Beobachtung, die Naomi Feil gerne zitiert: Derartige Eiweißbrücken im Gehirn gibt es bei allen sehr alten Menschen, aber nicht alle sind verwirrt. Sie geht davon aus, dass jemand, der psychisch gesund ist, die Deformationsprozesse im Gehirn ausgleichen kann. Nao-mi Feil bezieht sich sehr stark auf die Entwicklungstheorie von Erikson (1966): Jede Entwicklungsphase ist gekennzeichnet durch einen speziellen Katalog von Aufgaben, die in dieser Phase gelöst werden müssen. Nicht erledigte Aufgaben hinterlassen schädliche Reste, die den Menschen im Alter beeinträchtigen. Zu den Phasen von Erikson hat Naomi Feil noch eine eigene hinzugefügt: Aufarbeiten oder Vegetieren - das Stadium jenseits der Integrität Sehr alte Menschen, die mit ihren tiefen, ungelösten Gefühlen aus der Vergangenheit festsitzen, kehren oft in die Vergangenheit zurück, um diese Gefühle zu lösen. Sie bereiten sich auf die letzte Reise vor und sie kommen ihren tiefen Bedürfnis nach, in Frieden zu sterben. Personen, die im hohen alter noch über Integrität verfügen, gelangen niemals in den Zustand des Vegetierens. Da wir aber immer älter werden, geraten immer mehr Menschen in diesen Zustand. Wenn sie nicht in der Lage sind, ihre Gefühle aufzuarbeiten, werden sie zu "Lebenden Toten". Validation hilft, die aufgestauten Gefühle zu bestätigen und zu zerstreuen, wenn eine Aufarbeitung nicht mehr möglich ist. Naomi Feil nennt die Phasen der Demenz und die Möglichkeiten, in diesen Phasen zu validieren: I. II. III. Mangelhafte/unglückliche Orientierung (orientiert aber unglücklich) Personen in diesem Stadium halten an den gesellschaftlichen Rollen fest, aber sie äußern alte Konflikte in "verkleideter" Form, indem sie Personen der Gegenwart als "Symbole" für Personen und/oder Konflikte in der Vergangenheit verwenden. - In dieser Phase brauchen sie eine vertrau-ensvolle Beziehung, die ihnen diese symbolischen Handlungen nicht wegnimmt, sondern sie ak-zeptiert und einer Lösung zuführt. Zeitverwirrtheit Zeitverwirrte Menschen können die Verluste nicht mehr leugnen, sich nicht mehr an die Realität klammern. Sie versuchen nicht mehr, sich an eine chronologische Ordnung zu halten und ziehen sich zurück. Ein Ding oder eine Person der Gegenwart ist die Fahrkarte in die Vergangenheit. Zeitverwirrte Menschen kehren zu grundlegenden, universellen Gefühlen zurück: Liebe, Hass, Trauer, Angst vor Trennung. - Validations-Anwenderkönnen die Gefühle der alten Menschen nachempfinden, sie verstehen die Trennungsängste, den Schrei nach Identität. Sich wiederholende Bewegungen Menschen, die ihre Gefühle nicht äußern können, ziehen sich in vorsprachliche Bewegungen und Klänge zurück. Körperteile werden zu Symbolen. In diesem Stadium wird die Sprache unver-ständlich, sie dient dem sinnlichen Vergnügen, Klänge zu erzeugen. - Validation kann einer zeit-verwirrten Person Momente rationalen Denkens wieder geben. Validation durch Bestätigung und Teilnahme kann ein weiteres Abgleiten in Phase IV verhindern. IV. Vegetieren In diesem Stadium verschließt sich der Mensch völlig vor der Außenwelt und gibt das Streben, sein Leben zu verarbeiten, auf. - Menschen in diesem Stadium brauchen Berührung, Anerken-nung und Fürsorge. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass Menschen in diesem Stadium positiv auf Validation reagieren. Und die Reaktion auf Musik und Klänge ist eine der letzten Kommunika-tionsmöglichkeiten, die auch in diesem Stadium noch lange erhalten bleiben. Es würde zu weit führen, den Ansatz der Validation und seine praktische Realisierung an dieser Stelle zu erklären. Es gibt dazu Ausbildungs- und Trainingskurse. Ich verweise deshalb in diesem Zusammenhang auf das Buch von Naomi Feil (2002). Stattdessen ein Fallbeispiel: Frau A. Frau A. ist recht freundlich und kommunikativ, spricht aber völlig unverständlich. In der Musiktherapiestunde schläft sie oft. Manchmal aber ist sie aktiv dabei und verfolgt alle Aktivitäten ganz gespannt. Bei aktiver klassischer Musik fängt sie an zu "dirigieren", ich unterstütze sie dabei. Manchmal steht sie auf und tanzt in der Mitte des Raums. Ich tanze dann manchmal mit. Manchmal ist sie recht unruhig. Sie steht dann auf und wechselt den Platz, oder sie möchte den Raum verlassen. Meist gelingt es mir, sie zum Bleiben zu bewegen. Frau A. ist ein wenig wie ein Kind. Sie verhält sich tatsächlich "kindlich-fröhlich", möchte singen, tanzen, klatschen. Manchmal sagt sie völlig unvermittelt einen klaren, verständlichen Satz ("Ach, hör doch auf!"), der aber dann völlig unzusammenhängend im Raum steht. Es ist als hätte sich eine Redensart in ihrer Erinnerung festgesetzt, die sie dann selbst wiedergibt. Validieren heißt in diesem Fall, "sich mit Frau A. bewegen", Körperkontakt halten. Noch deutlich wird es bei der Sprache: Frau A. spricht mich an und hält dabei intensiven Augenkontakt. Ich kann sie aber nicht verstehen, weil sie völlig unverständliche Klänge formuliert. Es wäre falsch, so zu tun, als ob ich sie verstünde, ich kann mich aber auf ihre Mimik und Gestik einlassen und mit ihr sprechen. Herr L. Bei Herrn L. war deutlich, wie er über die Zeit abgebaut hat. Anfangs (vor einem Jahr) war er sehr aufmerksam beteiligt. Er machte Liedvorschläge oder erzählte unaufgefordert etwas aus seinem Leben: "Ich habe auf der Zeche gearbeitet!". Er war immer recht humorvoll, bei der letzten Maßnahme war er viel passiver. Er saß er meist in sich gekehrt da, machte aber dann doch mit, wenn gemeinsam gesungen wurde. Ich konnte ihn aktivieren, wenn ich ihn direkt ansprach und z.B. einen Liedtitel nannte, den er kannte. Einmal kam das Gespräch auf das Tanzen und die Jugendvergnügungen. Die Frauen begann etwas zu schäkern, da stand Her L. auf und begann in der Mitte des Kreises zu tanzen, ganz locker und ganz "cool". Zu Anfang des neuen Kurses war nicht mehr dabei, die Kollegin sagte, er sei zu schwach und dämmere meist vor sich hin. Inzwischen ist er verstorben. 5. Zur Indikation von Musiktherapie bei verwirrten alten Menschen Musiktherapeuten gehen davon aus, dass im Prinzip zunächst einmal bei allen Patienten- bzw. Klientengruppen Musiktherapie indiziert sein kann. Dennoch ist es wichtig, zu fragen, ob unsere Klientengruppe überhaupt von Musiktherapie erreicht werden kann. Die Phasen des musiktherapeutischen Prozesses - Exploration - Differenzierung - Kommunikation Spezialisierung - sind in dieser reinen Form nur bei erwachsenen Klienten sichtbar. Wo bei Erwachsenen die sprachliche Verarbeitung des musikalischen Prozesses eine große Rolle spielt, steht beim Kind die Sprache als Analyseinstrument kaum oder überhaupt nicht zur Verfügung und es ist in sehr viel stärkerem Maße der Prozess selbst, der heilende Wirkung haben soll. Beim verwirrten alten Menschen haben wir es mit einer noch komplizierteren Situation zu tun. Auch hier steht Sprache als Analyseinstrument kaum mehr zur Verfügung, darüber hinaus aber sind verwirrte alte Mensch kaum mehr in der Lage, über die aktive freie Improvisation therapeutische Prozesse zu erleben. Zum einen sind sie häufig nicht mehr in der Lage, ihre Bewegungen so zu koordinieren, dass die Bedienung eines Instrumentes möglich ist, sie "wissen nicht, was sie mit dem Instrument anfangen sollen", darüber hinaus assoziieren sie mit dem Spielen eines Instruments häufig Leistung, und dazu sind sie nicht mehr fähig. Die Fähigkeiten der demenzkranken Menschen, nichtsprachliche Äußerungen zu verstehen und zu benutzen, bleiben sehr lange erhalten. Naomi Feil (2001, S. 30) verwendet als letzte Validationstechnik "Musik einsetzen", und sie zitiert die Auffassung von Musiktherapeuten, dass wir die Fähigkeit, Musik aufzunehmen, als Letztes verlieren. Musik, die uns seit den frühesten Tagen vertraut ist, begleitet uns unser ganzes Leben. Sehr alte Menschen, die wegen mangelnder Betätigung oder durch einen Schlaganfall ihre Sprachfähigkeit eingebüßt haben, können trotzdem noch den ganzen Text alter Lieder singen. Dorothea Muthesius (1999) sieht Musiktherapie als die Methode der Wahl bei demenzkranken Menschen. Die "Sprache Musik" kann gerade für nicht sprechende Menschen vielerlei Kompensationsmöglichkeiten bieten: Musik ist emotionalisierend: Anknüpfen, Erhalten und Reaktivieren emotionaler Fähigkeiten Musik ist ordnend, strukturierend: Handlungen werden synchronisiert, Reize koordiniert Musik ist erinnerungsauslösend: Das Gedächtnis wird unterstützt, Krankheit wird bewältigt, Iden-tität wird gestärkt Musik motiviert zur Kreativität Musik fördert Interaktion: Erleben von Zugehörigkeit Musik ist bewegungsfördernd: Erinnerung und Körperkontakt Musiktherapie ist die Methode der Wahl bei alten verwirrten Menschen. Wir knüpfen dabei zunächst rezeptiv an der vertraute Musikwelt der alten Menschen an, verbunden mit biografischen und validierenden Techniken 6. Musiktherapie als Methode bei alten verwirrten Menschen 6.1. Die Vorgeschichte In einem Teil meiner Arbeitszeit arbeite ich als Dozent in der Ausbildung von AltenpflegerInnen. Bereits 2001 war in dem Fachseminar, in dem ich schwerpunktmäßig arbeitete, bekannt, das ich eine Musiktherapie-Ausbildung mache. So kam auch recht schnell ein Gespräch zwischen der Leiterin meines Fachseminars und einem Heimleiter zu Stande, in dem wohl meine sich entwickelnde Qualifikation thematisiert wurde, denn bald fragte man mich, ob ich denn bereit wäre, ein Projekt "Musiktherapie mit alten Menschen" zu gestalten. Ich sagte zunächst mal zu - dies ist halt meine Art - und suchte mir dann bei Kollegen und Dozenten Hilfe. Kann man mit alten verwirrten Menschen frei improvisieren? Kann man interpretieren, differenzieren, Konflikte bearbeiten? Nein, das ist wohl nicht so einfach. Von meinen Dozenten und erfahrenen Kommilitonen hörte ich: "Singen". Und so packte ich mein Akkordeon, Noten, einen Gedichtband aus meiner Schulzeit, ein Liederbuch ein und machte mich an die Arbeit. Da ich außer "Singen" kaum ein Konzept zur Verfügung hatte, begann ich meine Arbeit mit den schlimmsten Befürchtungen, und vor meiner ersten Stunde mit einer Riesenangst - erst sehr viel später, aus der Praxis heraus, entwickelte sich eine konzeptionelle Idee und , vor allem, meine eigene Wertschätzung für eine vermeintlich so "anspruchslose" Tätigkeit 6.2. Konzepte Sehr wertvolle Hinweise für meine Arbeit bekam ich aus der umfangreichen und einfühlsamen Arbeit von Leidecker (2001). Klaus Leidecker hat zwar überwiegend nicht mit verwirrten Menschen gearbeitet, vieles aus seiner Arbeit ist aber übertragbar auf meine Situation: Lieder sind Bedeutungsträger (wie übrigens auch Märchen). In jedem Volkslied manifestieren sich wesentliche Themen, die im menschlichen Leben immer wieder vorkommen. Solche Themen sind Heimat, Tod, Kindheit, Freiheit und andere. Auch Menschen, die kaum mehr sprechen können, singen bekannte Refrains deutlich mit, und durch die Beobachtung von Mimik und Gestik teilt sich uns mit, dass die Liedzeilen auch eine innere Auseinandersetzung mit dem Thema transportieren, die verbal so nicht mehr möglich wäre. Durch das gemeinsame Singen findet eine symbolische Auseinandersetzung mit wesentlichen Lebensthemen statt und schafft Erleichterung in einer Lebenssituation, in der Bewältigung nicht mehr oder nur noch schwer möglich ist. Katrin Müller (1998) beschreibt ein Vorgehen, in dem die Teilnehmer durch das Singen ermuntert werden, sich zu bewegen. In ihrer Arbeit wird deutlich, dass es kleine und kleinste Erfolge sind, die wir beobachten und beachten müssen. Eine große Bedeutung haben Rituale, die einen festen Rahmen bilden, aber auch emotionale Signale bilden. Wichtig ist natürlich ein Anfangsritual, das den Teilnehmern hilft, sich immer wieder von neuem in die Situation hinein zu finden, und ein Schlussritual, das das Ende der Stunde und den Abschied spielerisch thematisiert. 7. Meine praktische Arbeit 7.1. Vorüberlegungen Die Aufgabe war, fünfundvierzig Minuten so zu strukturieren, dass ca. zehn alte, verwirrte Menschen "unterhalten" werden, angeregt werden, mitzumachen, Freude empfinden und diese Freude auch ein Stück in ihren Heimalltag mitnehmen können. In der Anfangsphase meiner praktischen Tätigkeit habe ich deshalb Ziele formuliert und entsprechende Methoden eingesetzt. Ziele: Anregung, Aktivierung Freude empfinden Struktur vermitteln Erinnerungen wecken und beleben (Biografiearbeit) Wertschätzung für die "andere Welt" entwickeln (Validation) Methoden: Mein eigener Beitrag auf dem Akkordeon und anderen Instrumenten Lieder Alte Schlager Klassische Musik Gedichte und Geschichten Gespräch Validation in Bewegung, Mimik und Sprache 7.2. Technische Voraussetzungen Soziale Arbeit findet immer in einem bestimmten technischen Rahmen statt, der die Arbeit befördern oder auch behindern kann. Die Bedingungen im Philipp-Nicolai-Haus in Marl (Träger ist das Johanniswerk e.V.) waren recht gut, doch gab es auch einige Fallstricke, die erwähnt werden sollen. Zunächst fand ich sehr gute personelle, räumliche und organisatorische Bedingungen vor: Das musiktherapeutische Angebot wurde getragen vom sozialen Dienst des Hauses. Die beiden Mitarbeiter sind sehr interessiert, engagiert und kommunikativ, und es bereitet Freude, mit diesen Kollegen zusammenzuarbeiten, die die Arbeit nicht nur recht professionell vorbereiten, sondern auch Wert auf eine sorgsame Auswertung und Begleitung legen. Der soziale Dienst sucht Bewohner für die Musiktherapie aus. Kriterium ist die Fähigkeit, bei zunehmender Demenz noch an der Gruppe teilnehmen zu können. Dieses Kriterium trifft auf Personen mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten zu, was später noch zu zeigen sein wird. Die Arbeit ist so organisiert, dass jeweils ein Turnus von üblicherweise 10 Veranstaltungen geplant und durchgeführt wird. Danach erfolgt eine Auswertung und ich rechne mit dem Haus ab. Im ersten Durchgang wurde die Maßnahme vom Haus selbst finanziert, drohte dann aber nicht mehr weitergeführt werden zu können, weil keine finanziellen Mittel mehr bereit standen. Inzwischen wird die Teilnahme in Abstimmung mit den Angehörigen vom Taschengeld bezahlt, eine Lösung, die nicht unumstritten ist: In anderen Heimen gilt die Verwendung des Taschengeldes für Maßnahmen innerhalb des Hauses als Tabu: Es wird argumentiert, dass mit den teilweise erheblichen Unterbringungskosten auch entsprechende Leistungen abgedeckt sein sollen und dass es nicht sinnvoll ist, die Bewohner für zusätzliche Leistungen mit zusätzlichen Kosten zu belasten. Andererseits wäre es unsinnig, wenn sinnvolle und wirksame Maßnahmen ausbleiben würden, obwohl die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Da die Teilnehmer im wesentlichen die gleichen bleiben (einige bleiben weg oder sterben, einige kommen dazu), kann ich zu ihnen mittel- und langfristig eine Beziehung aufbauen, was eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Arbeit ist. Uns steht im Untergeschoss des Hauses ein Raum zur Verfügung, der nur geringfügig vorbereitet werden muss (das macht der Hausmeister). Ein wichtiges technisches Problem, das mir vorher nicht bewusst war, ist der Transferprozess: Die Teilnehmer werden von den MitarbeiterInnen der Stationen gebracht, dabei müssen sie durch das "Nadelöhr" eines Aufzugs, vor dessen Tür sich manchmal regelrechte Schlangen bilden. Dies ist ein Problem für den Beginn der Stunde. Manchmal werden Teilnehmer einfach vergessen, oder die Mitarbeiter haben die Idee, jemanden in die Gruppe mitzubringen, der überhaupt nicht angemeldet ist. 7.3. Die Praxis, die Entwicklung des Konzepts und der heutige Stand Wenn die Teilnehmer vollzählig sind, begrüße ich sie in der Regel persönlich mit einem kleinen Instrument, einem Klangstab, einer Kalimba, einer Kantele oder einem anderen kleinen Instrument. Jeder Teilnehmer wird persönlich mit seinem Namen begrüßt. Ich sage ihm, dass ich mich über seine (ihre) Anwesenheit freue und spiele einen Ton, einen Klang oder eine kleine Melodie (je nach Instrument). Manchmal nutze ich diese Möglichkeit, noch mal Namen zu memorieren, die ich vergessen oder mir noch nicht gemerkt habe. Die meisten Teilnehmer kennen ihren Namen und können mir so weiterhelfen. Der erste "Programmpunkt" ist dann ein Akkordeonstück "Das Sandmännchen": Ich erzähle dazu die Geschichte, dass ich dieses Stück immer meiner Tochter vorgespielt habe, als sie noch recht klein war. Heute spielt sie dieses Stück selbst. "Das Sandmännchen" ist ein sehr ruhiges Stück, durchaus auch als Schlaflied geeignet, aber eben auch mit seiner prägnanten, ruhigen Melodie passend für eine beruhigende Einleitung für die Stunde. Die Teilnehmer lieben dieses Stück sehr, und während ich spiele, höre ich, wie einige leise mitsummen. Der Atem beruhigt sich, und am Ende lächeln einige, und es entsteht eine ruhige erwartungsvolle Stille. Danach gibt es manchmal Beifall. Manchmal ist es so, dass es den Teilnehmern schwer fällt, sich in dieser Situation zu orientieren. Sie fragen "Warum bin ich überhaupt hier?", "Was mache ich hier?", "Wann bekomme ich etwas zu essen", "Mir ist kalt". Teilweise fallen solche Bemerkungen auch in mein "Eröffnungsspiel" und ich kann darauf nicht sofort reagieren. Das "Sandmännchen" schafft aber mit der Zeit eine gute Orientierung, die Teilnehmer erinnern sich an die Situation und beruhigen sich. Die TeilnehmerInnen reagieren sehr unterschiedlich. Einige sind recht kommunikativ, und mit ihnen kommt ein Gespräch in Gang, andere dämmern vor sich hin, einige schlafen. Manchmal sind es nur Blicke oder ab und zu ein Lächeln, das mir signalisiert, dass eine Teilnehmerin tatsächlich teilnimmt. Am Ende einer Stunde spiele ich ein lustige finnische Mazurka ("zum Abschluss spiele ich Ihnen eine lustige Mazurka"), und die Teilnehmer werden einzeln mit einem Instrument verabschiedet. Hier nehme ich noch einmal Bezug zur vergangenen Stunde und wie ich den Teilnehmer erlebt habe und wünsche alles Gute für die nächste Woche. Am Anfang eines Durchgangs, wenn einige Zeit verstrichen ist und wir uns länger nicht gesehen haben, ist die Resonanz auf meine Aktivitäten recht gering. Wir müssen uns erst wieder "beschnuppern". Extrem ist diese Situation natürlich bei einer ganz neuen Gruppe: Über 2-3 Wochen bin ich "Alleinunterhalter", d.h. ich versuche ein Programm zu gestalten, ohne dass ich auf meine Aktivitäten ein nennenswertes Feedback bekomme. Ich singe dann Volkslieder, erzähle Geschichten, rezitiere Gedichte, spiele alte Schlager und Klassik. Dazwischen spreche ich die Gruppe oder einzelne Teilnehmer persönlich an. Es kann ziemlich frustrierend sein, ohne nennenswerte Rückmeldung zu agieren, und so bin ich anfangs am Ende einer Stunde immer recht erschöpft und gehe etwas irritiert nach Hause. Diese Situation ändert sich mit der Zeit: Am auffälligsten ist die Reaktion bei den Volksliedern. Diese werden relativ schnell mitgesungen, auch von denen, die so gut wie nicht sprechen. Manche kennen nur die erste Strophe, den Refrain kennen alle. Bei alten Schlagern ist die Reaktion etwas anders. Bei manchen Liedern geht bei einigen ein Lächeln des freudigen Wiedererkennens über das Gesicht. Der Refrain wird dann meistens mitgesungen. Es ist wohl so wie man das heute auch beobachten kann: Die Mehrheit hört Schlager, eine Minderheit hört Klassik. Es wäre natürlich verfehlt, sich in einem Angebot auf Schlager zu beschränken und somit dem Klassikliebhaber eine unerträglich Situation zu bescheren: Ich spiele in der Regel nur einen Schlager vor, aber eben auch ein klassisches Stück, in der Regel aus Vivaldis "Jahreszeiten", einmal habe ich es mit dem "Regentropfen-Prelude" von Chopin versucht. Die Teilnehmer reagieren auf mein Klassik-Angebot unterschiedlich: Die meisten hören ruhig zu, eine Teilnehmerin liebt die Stück und fängt an, sich zu bewegen. Sie macht heftige und fröhliche "Dirigier"-bewegungen. Ich imitiere dann ihre Bewegungen, und so sitzen wir da und "tanzen" zu Vivaldi. Mit Gedichte und Geschichten versuche ich an Biografien anzuknüpfen. Ich verwende Gedichte, von denen ich annehme, dass sie aus der Schule bekannt sind. Es ist hauptsächlich Goethe dabei, aber auch Mörike, Eichendorff und andere. Gedichte sprechen die Teilnehmer an, die noch sprechen können. Häufig ist mir beim ersten Vortrag aufgefallen, dass ein Gedicht zu schwierig war. Dann wurde es wieder aus dem Repertoire gestrichen. Wenn das "Eis gebrochen" ist, mache ich die Erfahrung, dass die Kommunikation in der Gruppe lebendiger und dichter wird. Die meisten singen mit, und ich kann beobachten, wie Liederstrophen und Refrains teilweise inbrünstig mitgesungen werden, wie auf einen Liedbeginn oder auch die ersten Töne eines Schlagers mit einem frohen Lächeln reagiert wird. Und es kommt zwischen den Programmbeiträgen zu biografischen Gesprächen und unterschiedlichen Aktionen. Die Teilnehmer kommunizieren auch ein wenig untereinander. Lieder und Gedichte sind wie Märchen: Für die alten Menschen enthalten sie Symbole, die auf wesentliche Inhalte der Lebensbewältigung verweisen. Eines der Lieder mit der umfassendendsten Thematik ist z.B. "Hoch auf dem gelben Wagen": Es ist ein ganzes Leben, das dort abläuft, mit junger Liebe, Festen und Tanz, am Ende der Tod, den man alleine durchlebt. Der Wagen rollt, alles geht vorbei, nichts bleibt, und alles wird zur Vergangenheit. Es ist kaum mehr möglich, mit alten verwirrten Menschen Lebensbewältigung zu betreiben, aber sie singen und erleben die Inhalte, die hinter den Symbolen der Lieder stehen. Ich habe die Lieder, Schlager und Gedichte, die Bestandteil meines Programms waren, einmal nach verschiedenen Inhalten untersucht: Beherrschende Themen sind hier die Natur und das Leben im allgemeinen, vielfach auch Abschied, die Liebe und die Heimat. Bei den Schlagern ist die Situation etwas anders: Hier ist es die Liebe, die vor allem anderen beschworen wird, darüber hinaus das Leben insgesamt, Abschied, und ein bisschen Heimat. Bei den Gedichten steht die Naturthematik eindeutig im Vordergrund, neben dem Leben allgemein, der Tod tritt meist im Zusammenhang mit einer Naturthematik auf dem Plan, und häufig wird die Natur in einem spirituellen Zusammenhang gesehen. Mir ist in der Arbeit deutlich geworden, dass die Teilnehmer diese Symbole erkennen und mit ihnen umgehen. Es ist keine Bewältigungsarbeit, die betrieben wird, sondern eher kathartisches Erleben: Wenn ich beobachte, wie eine Teilnehmerin singt, "das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder [...] denn jeder Frühling hat nur einen Mai", dann verstehe ich, dass sie das, was sie singt, wirklich erlebt. 8. Nachbetrachtung und Ausblick Es fiel mir am Anfang sehr schwer, meiner eigene Tätigkeit ("nur" singen, "nur" sprechen, "nur" spielen) die nötige Wertschätzung zukommen zu lassen. Ein innerer Konflikt zwischen meiner Tätigkeit und der dafür enthaltenen Bezahlung machte mich anfangs etwas unruhig. Irgendwann fiel mir dann auf, dass ich nach der Stunde etwas erschöpft war: ich musste also doch irgendwie gearbeitet haben. Es ist zunächst einmal die Tatsache, eine ganze Stunde ohne Unterbrechung präsent zu sein. Das ist, was Therapie ausmacht. Zu singen oder zu sprechen, und dabei immer Kommunikationsverbindung zu halten mit den alten Menschen, die meist nur noch rudimentär kommunizieren können. Manchmal spüre ich, dass ein Blickkontakt während des Singens aktivierend wirkt, aber ich kann gleichzeitig immer nur mit einem Teilnehmer Blickkontakt halten. Dennoch benötige ich eine erhöhte Vigilanz, eine Antenne für das, was in der Gruppe passiert, wo Impulse von einer Person kommen, wo fast unmerklich Kommunikation stattfindet. Es passiert in der Regel nicht sehr viel, aber wenn etwas passiert, dann muss ich versuchen, es zu verstehen oder zu validieren: Einige Verhaltensweisen können aufgegriffen werden, so z.B., wenn jemand ein Lied vorschlägt. Wenn ein Lied vorgeschlagen wird, wird es grundsätzlich gesungen. Manche Aussagen können biografisch interpretiert und weitergeführt werden. Aber manche Verhaltensweisen und Aussagen sind nicht ohne weiteres verständlich. Etwas, womit ich in der Arbeit mit alten, verwirrten Menschen fertig werden muss, ist die Tatsache, dass es keine Erfolge im herkömmlichen Sinne gibt: Wir können niemanden "heilen", und es gibt auch keine Fortschritte, sondern die Arbeit endet meist mit dem Tod der Teilnehmer, oder damit, dass sie zu einer Teilnahme nicht mehr in der Lage sind und meist bald darauf sterben. Doch dies kann auch zu einer besonderen Tiefe der Arbeit führen: Wir müssen erkennen, dass auch wir jeden Tag dem Tod ein Stück näher kommen, dass alles, was wir aufbauen, alle unsere Träume und Erfolge letztlich ins Grab führen. Wenn wir dies verstehen, bringen wir der Arbeit die Wertschätzung und Demut entgegen, die sie verdient. 9. Literaturverzeichnis Baltes, P.B. & Danish, S.J. (1979). Gerontologische Intervention auf der Grundlage einer Entwicklungspsychologie des Lebenslaufs. Probleme und Konzepte. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 11. Baltes, P.B. & Mittelstraß, J. (Hrsg.) (1999).Zukunft des Alterns und gesellschaftliche Entwicklung.. Berlin: Walter de Gruyter. Bruhn, Herbert, Oerter, Rolf, Rösing, Helmut (1994). Musikpsychologie, Reinbek: Rowohlt. Bundesministerium für Gesundheit (2001), Wenn das Gedächtnis nachlässt, Ratgeber für die häusli-che Betreuung demenzkranker älterer Menschen, Bonn. Bunt, Leslie, Musiktherapie (1998). Eine Einführung für psychosoziale und medizinische Berufe, Weinheim: Beltz. Decker-Voigt, Hans-Helmut (1991). Aus der Seele gespielt, Eine Einführung in die Musiktherapie, München: Goldmann. Diakonisches Werk Der Evangelischen Kirche von Westfalen (Hrsg.) (2001). Altenhilfe und Demenz, Münster. Erlemeier, Norbert (1992). Suizidalität im Alter, Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Familie und Senioren, Stuttgart: Kohlhammer. Erikson, E. H. (1966), Identität und Lebenszyklus, Frankfurt a.M. Feil, Naomi, (2002).Validation, Ein Weg zum Verständnis verwirrter alter Menschen, München: Rein-hardt. Feil, Naomi (2001), Trainingsprogramm Validation, Band 2, München: Reinhardt. Grossarth-Maticek, Ronald (2000). Autonomietraining, Berlin: Gruyter. Kauffeldt, S., Kühnert, S. Wittrahm, A. (1994). Psychologische Grundlagen der Altenarbeit, Bonn: Dümmler. Kipp, Johannes, Jüngling, Gerd, (1994). Verstehender Umgang mit alten Menschen, Frankfurt/Main: Fischer. Lehr, U. (1977). Psychologie des Alterns. Wiesbaden: Quelle & Meyer. Leidecker, Klaus, (2001). Lieder und Klänge als Lebenserzählungen, Musiktherapie in der Altenarbeit, München: Strube. Muthesius, Dorothea, (1999). Gefühle altern nicht: Musiktherapie mit altersdementen Menschen, Ü-berarbeiteter Vortrag, gehalten auf dem 2. Deutschen Alzheimerkongress, Berlin: http://www.alzheimerforum.de/3/1/6/12/mmadp.html. Schulte, Dietmar, (1991). Therapeutische Entscheidungen, Göttingen: Hogrefe. Schulte, Dietmar, (1996). Therapieplanung, Göttingen: Hogrefe. Schumann, Claudia, (1994). Da Capo, Über Musiktherapie, Trossingen: Hohner. Stanjek, Karl (2001), Altenpflege konkret, Sozialwissenschaften, München: Urban & Fischer. Van Deest, Hinrich, (1997). Heilen mit Musik, Musiktherapie in der Praxis, München: dtv. Wirsing, Kurt, (2000). Psychologisches Grundwissen für Altenpflegeberufe, Weinheim: Beltz. gelmäßig wiederkehrender Tagesablauf. Komponente 3: Gruppensitzungen Das 24-Stunden-ROT wird durch täglich stattfindende Gruppensitzungen für die dementen Heimbewohner unter der Leitung von ein bis zwei Mitarbeitern der Institution erweitert. Das Gruppenangebot soll dabei jeden Tag in den gleichen Räumlichkeiten und zur selben Tageszeit stattfinden und maximal 60 Minuten dauern. Auch die Zusammensetzung der einzelnen Gruppen sollte nicht variieren. Die empfohlene Teilnehmerzahl beträgt 3 bis 6 Personen, die in Bezug auf den Schweregrad der Demenz möglichst homogen sein sollen. In den Gruppensitzungen werden den Teilnehmern Informationen zur Orientierung, z.B. zu Personen, Zeit, Ort und Alltagstätigkeiten, vermittelt. Dies soll auf eine möglichst abwechslungsreiche Art und Weise geschehen, z.B. in Form von Gesprächsrunden, Gedächtnisspielen, Spaziergängen und alltagsnahen Aktivitäten, wie gemeinsames Einkaufen und Kochen. Ziel ist es hier, die Anteilnahme des dementen Menschen an seiner Umwelt und an der Realität zu fördern. Besonders durch die Vermittlung von Erfolgserlebnissen und der Förderung sozialer Kontakte und Kommunikation, soll der soziale Rückzug der dementen Menschen verhindert, ihre kognitive Leistungskraft erhalten und ihr Wohlbefinden insgesamt gesteigert werden. In der praktischen Arbeit mit dementen Menschen wird das ROT in seiner ursprünglichen Form nicht mehr angewandt, da es sich zeigte, dass der korrigierende Ansatz des Konzepts eine Belastung für den Erkrankten darstellt und nur wenig erfolgversprechend ist. Das Konzept hat sich dahingehend weiterentwickelt, dass von dem korrigierendem Ansatz Abstand genommen wurde und die Schwerpunkte heute auf den externen Orientierungshilfen, der Wohnraumgestaltung und der Tagesstrukturierung liegen, die sich auch in anderen Betreuungskonzepten für demente Menschen finden. (vgl. Baier, 2001, S. 392). 5.2 Milieutherapie "Unter Milieutherapie wird ein therapeutisches Handeln zur Anpassung der materiellen und sozialen Umwelt an die krankheitsbedingten Veränderungen der Wahrnehmung, des Empfindens, des Erlebens und der Kompetenzen (der Verluste und der Reserven) der Demenzkranken verstanden." (Wojnar 2001c, S. 155). Die Milieutherapie stellt ein umfassendes Betreuungskonzept dar, in dessen Zusammenhang sich der Begriff "Milieu" sowohl auf die räumliche Umgebung als auch auf Umgangsformen und Aktivitäten bezieht (vgl. Baier, 2001, S. 391). Es soll eine Verbesserung des gesamten therapeutischen Milieus, besonders in Langzeiteinrichtungen (Altenheime, Pflegeheime) erzielt werden, wobei psychische Bedürfnisse der Demenzkranken im Vordergrund stehen. Körperliche Pflege spielt in diesem Konzept ein nachrangige Rolle. Die therapeutische Wirkung resultiert nicht nur aus Einzelkomponenten der baulichen Umgebung als Milieu, "sondern vom Zusammenwirken aller Umweltkomponenten (Bau, psychosoziales Milieu, Organisation)." (Heeg, 2001, S. 111). Theoretischer Hintergrund In der Literatur finden sich unterschiedliche Angaben zur Entstehung bzw. zur konzeptionellen Einordnung der Milieutherapie. Nach Wächtler et al. ist die Milieutherapie eher eine spezifische Form des ROT (vgl. Kap. 5.1). Andere (Lind und Heeg) stellen eher einen Bezug zu Lawtons "Umweltanforderungs-Kompetenz-Modell" her. Dessen Kernaussage lautet, "dass durch altersbedingte Veränderungen die Umweltkompetenz alter Menschen abnehmen kann" (Egidius, 1997, Kap. V. 2.3.1). Umweltkompetenz bedeutet in diesem Zusammenhang eine gelungene Anpassung an Umweltanforderungen, die einen "Anforderungsdruck" auf die betroffene Person ausüben. Die Anpassung an diesen Druck ist von individuellen Ressourcen abhängig und wird durch Außenbedingungen, wie dingliche oder soziale Umwelt, erschwert oder erleichtert. Im optimalen Fall herrscht ein Gleichgewicht zwischen den Anforderungen der Umwelt und der Umweltkompetenz, darauf zu reagieren. Dieses Gleichgewicht stellt die Voraussetzung für eine hohe Lebenszufriedenheit dar. Entspricht die Kompetenz nicht dem Anforderungsdruck, so kann es zu einer Unter- oder Überforderung kommen, die von einer niedrigen Lebenszufriedenheit begleitet wird. Um ein solches Ungleichgewicht zu korrigieren, können sowohl die individuellen Ressourcen gestärkt werden als auch eine Anpassung der Umweltanforderungen (Außenbedingungen) erfolgen (vgl. Egidius, 1997, Kap. V. 2.3.1). Für demente Menschen, die oft eine starke Einschränkung ihrer Umweltkompetenz erfahren, steht, da in diesem Fall die individuellen Ressourcen nur bedingt änderbar sind, die Anpassung der dinglichen und sozialen Umwelt im Vordergrund, um die Lebenszufriedenheit zu verbessern. Durch kognitive Störungen verlieren demente Menschen "die Fähigkeit zu einer realistischen Beurteilung der Umgebung und zur Anpassung ihres Verhaltens an die sozialen Normen und Erwartungen. ... Mit einer abnehmenden Anpassungsfähigkeit wächst die Bedeutung einer flexiblen, ‚prothetischen' Umgebung, die den Kranken akzeptiert, unterstützt und nicht überfordert." (Wojnar, 2001a, S. 40f.). Die adäquate Gestaltung der Umgebung bekommt so eine Schutzfunktion: Sie soll Quellen der Überforderung abbauen und Sicherheit und Geborgenheit ausstrahlen. Die so gestaltete Umgebung hat die Aufgabe, die Selbständigkeit zu erhalten und zu fördern und das Selbstwertgefühl zu stärken. "Die Milieutherapie soll den Demenzkranken ein menschenwürdiges, der persönlichen Lebensgeschichte angepasstes und vom pathologischen Stress befreites Leben, trotz der zunehmenden Adaptationsstörungen an ihre Umwelt, ermöglichen." (Wojnar, 2001c, S. 155). Zusätzlich soll hierdurch die Belastung für die Betreuenden reduziert werden. Praktische Umsetzung Es lassen sich drei Kernelemente der Milieutherapie herausstellen: 1. Soziale Umgebung Es wird ein einheitliches Konzept gefordert, an dessen Planung und Umsetzung sich alle Mitarbeiter beteiligen. Eine enge Zusammenarbeit aller Berufsgruppen ist dabei Voraussetzung für ein günstiges therapeutisches Milieu. Ein weiterer Baustein der sozialen Umgebung ist die sogenannte "Beziehungskonstanz", womit feste Bezugspersonen für die Betreuten gemeint sind. Es soll eine persönliche Beziehung zwischen Demenzerkrankten und Mitarbeitern aufgebaut werden. Die Basis dafür ist die Grundhaltung dem Erkrankten gegenüber (Respekt, Akzeptanz, Partnerschaftlichkeit, Kritikvermeidung, Bestätigung der Realität des dementen Menschen). Der Umgang soll einfühlsam, geduldig und sensibel sein und Biographiewissen wird für einen positiven Umgang und das Verständnis gefordert. "Wenn das Wissen um die ganze Person mit den wesentlichen Lebensereignissen beim Pflegepersonal präsent ist, dann besteht eher die Möglichkeit, vom stereotypen Fremdbild ‚dement, abgebaut, kommunikationsunfähig, schwerstpflegebedürftig' abzukommen." (Lind, 2001, Kap. 1.5). Die Kommunikation soll dem Kommunikationsstil von dementen Menschen angepasst sein. Dies betrifft die verbale Ausdrucksweise (deutlich, langsam, einfache Sätze) genauso wie den Einsatz nonverbaler Kommunikationsmittel (Blickkontakt, Berührungen, Gesten) (vgl. Egidius, 1997, Kap. V. 2.3.1). Lind betont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der Kommunikation während der Pflegehandlungen, d.h. die Einbeziehung des dementen Menschen in die Pflegeprozedur (vgl. Lind, 2001, Kap. 1.3).Obwohl als Gestaltungsprinzipien Stetigkeit, Beständigkeit und Kontinuität als die wichtigsten herausgestellt werden, so ist es gleichzeitig die Flexibilität in der ständigen Anpassung der Handlungen an die Bedürfnisse des Einzelnen, die eine Über- oder Unterforderung vermeiden hilft (vgl. Lind, 2001. Kap. 2 u. 3). Eine weitere Voraussetzung für eine optimale soziale Umgebung ist das Wohlbefinden und die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter, da sich ein schlechtes Arbeitsmilieu negativ auf das Lebensmilieu und somit auf das Wohlbefinden der dementen Menschen auswirkt. "In der Kongruenz beider Teilbereiche liegt der Schlüssel für ein Optimum an Pflegeleistungen u.a. in Gestalt der Zufriedenheit der Bewohner und der Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter, denn zwischen Lebens- und Arbeitsmilieu besteht ein striktes Interdependenzverhältnis." (Lind, 2001, Kap. 1.1). Die Arbeitszufriedenheit ist u.a. abhängig vom Grad der Mitgestaltung und Mitbestimmung des Pflegepersonals, dem Personalschlüssel, Fortbildungsangeboten und Supervision, sowie einer geringen Fluktuation des Personalstammes (vgl. Wojnar, 2001c, S. 159). Ebenfalls in die Betreuung mit einbezogen werden sollen die Angehörigen der Betreuten. Kontakte sollen gefördert werden, damit für die dementen Menschen kein Bruch in ihrem Beziehungsgefüge entsteht. In einem beiderseitigen Lernprozess sollen Angehörige und professionelle Betreuer zu einem besseren Verständnis des Betreuten kommen (vgl. Lind, 2001, Kap. 1.5). 2. Tagesstrukturierung Infolge der gestörten räumlichen, zeitlichen und personellen Orientierung ist es für demente Menschen schwer, ihren Tag eigenständig zu strukturieren oder sich sinnvoll zu beschäftigen. Aus diesem Grund gehört zu einer Optimierung des "Milieus" auch eine fest vorgegebene Tagesstruktur, in der sich Aktivitäten und Ruhephasen abwechseln (Intervallkonzept). Dabei sollte jeder Tag gleich strukturiert sein, um ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Eine weitere Zielsetzung der Tagesstrukturierung ist die Vermittlung des Gefühls der Bestätigung, die Steigerung des Selbstwertgefühls und des Wohlbefindens (vgl. Lind, 2001, Kap. 1.4). Die dementengerechten Angebote im Tagesprogramm sollen vor allem die niedrige Konzentrationsfähigkeit, besonders bei Demenzerkrankten im fortgeschrittenem Stadium, und die Kompetenzen des Einzelnen berücksichtigen. Die aktivierenden Angebote können sowohl vertraute (z.B. Wäsche bügeln) als auch unvertraute Handlungen (z.B. das Sortieren von Gegenständen) beinhalten. Zu beachten ist hier, dass es zu keiner Überforderung durch eine Reizüberflutung, aber auch zu keiner Unterforderung aufgrund einer fehlenden Stimulierung von außen kommt. Lind empfiehlt deshalb eine Vorgehensweise, die dem Intervallkonzept folgt. "In der Praxis hat sich das Intervallkonzept Aktivierungsphase mit anschließender Beruhigungsphase als sehr effektiv und milieufördernd herausgestellt." (Lind, 2001, Kap. 1.4). Zum strukturierten Tagesablauf gehört auch das regelmässige Treffen von Gruppen. Hier sollen Bedürfnisse nach sozialen Kontakten befriedigt und sozialer Isolation entgegengewirkt werden. Wichtig ist das Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein, die allerdings möglichst klein sein sollte, da sonst eher Überforderung die Folge der Gruppenarbeit ist, die z.B. Aktivitäten wie Singen, Spielen, Bastelarbeiten oder auch Spaziergänge beinhalten kann (vgl. Lind, 2001, Kap. 1.4). Trotz des relativ festen Rahmens im Tagesablauf soll der Spontaneität und den Wünschen der dementen Personen keine zu feste Begrenzung gesetzt werden, was auch als "Milieu à la Carte" bezeichnet wird. Außerdem sollte den dementen Menschen die Teilnahme an Aktivitätsangeboten freigestellt sein (vgl. Wojnar, 2001c, S. 159). 3. Architektonisch-räumliche Umgebung Eine dementengerechte räumliche Umgebung muss primär die Funktionen "Schutz" und "Aktivierung" erfüllen. Gelingt die Umsetzung, hat dies sowohl positive Auswirkungen auf die dementen Menschen als auch auf die betreuenden Personen, die von der Überschaubarkeit der Räume und einer höheren Kontaktdichte zwischen Personal und Betreuten profitieren kann (vgl. Lind, 2001, Kap. 1.6). Eine optimierte Raumstruktur beinhaltet daher überschaubare Räumlichkeiten, was z.B. auch durch Glaswände oder Glastüren erreicht werden kann. Weiterhin soll die Raumstruktur möglichst barrierefreie Wege bieten, um dem Bewegungsdrang dementer Menschen entgegenzukommen. Als wichtig wird hier z.B. die Vermeidung von Flurenden (Sackgassen) angesehen, die durch die Bewegungseinschränkung zu Unsicherheit oder Überforderung und damit auch zu unangemessenem Verhalten führen können. Positiv im Sinne der Barrierefreiheit sind beispielsweise Endlosflure und Rundwege (vgl. Heeg, 2001, S. 111). Selbstverständlich erfolgt eine Kontrolle über die Ein- und Ausgänge der Station, dabei sollten die Ein- und Ausgänge allerdings zur psychosozialen Entlastung der Bewohner möglichst versteckt sein (vgl. Lind, 2001, Kap. 1.6). Zusätzlich sorgt eine individuelle und wohnliche Gestaltung durch kleine Wohneinheiten, alte Möbel (auch von zu Hause) oder persönliche Gebrauchsgegenstände für eine vertraute, heimische (und nicht Heim-) Atmosphäre (vgl. Lind, 2001, Kap. 2.4). Ausreichende Beleuchtung verhindert die Entstehung von illusionären Verkennungen und optischen Halluzinationen und durch eindeutige Helligkeit zur Tagzeit wird die Normalisierung des Schlaf-Wach-Rhythmus gefördert (vgl. Wojnar, 2001c, S. 157f.). Ebenso wichtig ist ein niedriger Geräuschpegel, bzw. auch unaufdringliche Musik. Verschiedene gleichzeitig auftretende akustische Signale sollten vermieden werden. Insgesamt kann festgehalten werden, dass eine visuelle und akustische Überreizung vermieden werden soll (vgl. Wojnar, 2001c, S. 157). Durch die Stimulierung mittels des räumlichen Milieus soll eine Anregung zur Eigen- oder Gruppenbeschäftigung erfolgen. Dies kann auf unterschiedlichste Weise erreicht werden. Beispiele sind leicht zugängliche Regale mit Wäsche oder Küchenutensilien, Haustiere, aber auch ein interessanter Fensterausblick oder Bilder u.ä. (vgl. Egidius, 1997, Kap. V. 2.3.4). Der Zugang zu einem Garten oder Freigelände wird kontrovers beurteilt. Während hier einerseits eine bedrohliche Wirkung durch Verlassen des Schutzraums eventuell gefördert wird, kann aber andererseits auch positives Erleben (Naturbezug, Freiheit) gefördert werden (vgl. Egidius, 1997, Kap. V. 2.3.4). 5.3 Validation Das Konzept der Validation wurde von Naomi Feil zwischen 1963 und 1980 entwickelt. Sie arbeitete als Sozialarbeiterin in den USA und gibt als Grund für die Entwicklung ihres Konzepts ihre negativen Erfahrungen mit dem ROT an: "Ich gab das Ziel der Orientierung auf die Realität auf, als ich bemerkte, dass die Gruppenmitglieder sich immer dann zurückzogen oder zunehmend feindselig wurden, wenn ich sie mit der unerträglichen Realität der Gegenwart zu konfrontieren versuchte." (Feil, 2000, S. 9). Das Betreuungskonzept besteht im besonderen aus Kommunikationstechniken, die in der Betreuung von dementen Menschen angewendet werden sollen. Der Schlüssel zu einer adäquaten Kommunikation mit ihnen ist dabei die Validation (von lat. validus = kräftig; engl.: valid = gültig), also das "Für-Gültig-Erklären" der Erfahrung und der subjektiven Wirklichkeit eines anderen Menschen. Die Kommunikation bezieht sich durch das aktive Anerkenn en der Emotionen des dementen Menschen stark auf die Gefühlsebene. Voraussetzung für den damit verbundenen Versuch, den gesamten Bezugsrahmen einer Person zu verstehen, ist ein hohes Maß an Empathie (vgl. Baier, 2001, S. 393; Kitwood, 2000, S. 88). "Es handelt sich dabei eher um Umgangsprinzipien mit dem Erkrankten als um ein Therapieverfahren." (Bernhardt, o.J.). Die persönliche Sichtweise des Demenzerkrankten wird dabei in den Mittelpunkt der Therapie gestellt, wobei wichtige Verhaltensregeln für den zu Betreuenden einzuhalten sind. So soll z. B. die subjektive Realität des Betroffenen nicht korrigiert oder in Frage gestellt werden (vgl. Baier, 2001, S. 393). Zur besseren Erläuterung des Konzepts sollen im Folgenden die wichtigsten Punkte zur Validation aus der Sicht von Naomi Feil dargestellt werden. Die Seitenangaben beziehen sich auf ihr Buch "Validation. Ein Weg zum Verständnis verwirrter alter Menschen" (Feil, 2000). Grundprinzipien Validieren bedeutet, die Gefühle eines Menschen anzuerkennen und für wahr zu erklären. Durch ein gutes Einfühlungsvermögen soll versucht werden, in die innere Erlebniswelt des desorientierten Menschen vorzudringen, "in den Schuhen des anderen [zu] gehen" (S. 11). Dabei kommt es zum Aufbau von Vertrauen, Sicherheit, Stärke und Selbstwertgefühl. Verbale und nonverbale Signale der Erkrankten sollen aufgenommen und in Worten wiedergegeben werden (vgl. S. 11). Anwendung der Technik "Validation" Feil definiert die Validationstechnik und die Validationsziele folgendermaßen (S. 11): "Validation ist: · eine Entwicklungstheorie für sehr alte, mangelhaft/unglücklich orientierte und desorientierte Menschen · eine Methode, ihr Verhalten einzuschätzen · eine spezifische Technik, die diesen Menschen hilft, durch individuelle Validation und Validationsgruppen ihre Würde wiederzugewinnen" "Validationsziele sind: · Wiederherstellen des Selbstwertgefühls · Reduktion von Stress · Rechtfertigung des gelebten Lebens · Lösen der unausgetragenen Konflikte aus der Vergangenheit · Reduktion chemischer und physischer Zwangsmittel · Verbesserung der verbalen und nonverbalen Kommunikation · Verhindern eines Rückzugs in das Vegetieren · Verbesserung des Gehvermögens und des körperlichen Wohlbefindens" (S. 11). Theoretischer Hintergrund Der Validation liegen verschiedene Prinzipien aus dem Bereich der Psychologie zugrunde. Hier werden u. a. Carl Rogers ("Akzeptieren Sie Ihren Patienten, ohne ihn zu beurteilen") und C. G. Jung ("Gefühle, die ausgedrückt und dann von einem vertrauten Zuhörer bestätigt und validiert wurden, werden schwächer, ignorierte oder geleugnete Gefühle stärker") genannt (S. 12). Theoretischer Schwerpunkt der Validation als Betreuungskonzept ist die von dem Psychologen Erik Erikson entwickelte Theorie der Lebensstadien und Aufgaben: Erikson unterteilt den menschlichen Lebenszyklus in acht Entwicklungsstufen mit spezifischen Entwicklungsaufgaben oder Krisen, wobei sich die Aufgaben mit dem Alter ändern. Ob bestimmte Lebensaufgaben gelöst werden, hängt davon ab, wie die Aufgaben in früheren Lebensabschnitten bewältigt wurden. Im letzten Lebensabschnitt "Alter" lautet die Lebensaufgabe: Leben resümieren. Die erfolgreiche Bewältigung besteht in der Wahrung der persönlichen Integrität. "Integrität im Alter heißt, seine Stärken trotz seiner Schwächen zu erkennen." (S. 18). Bestehen unbewältigte Aufgaben aus früheren Lebensabschnitten, so ist die Wahrscheinlichkeit, diese Aufgabe zu lösen, gering, und es ist keine positive Lebensbilanz möglich. Die Folge ist Verzweiflung und das Hervortreten lebenslang unterdrückter Gefühle. "Mit einer Last, die unerträglich wird, gehen wir ins hohe Alter." (S.19). Daraus resultieren Niedergeschlagenheit und Depression, das Leben wird nicht mehr als lebenswert empfunden (vgl. S. 13-20). Feil fügt diesem Stadienmodell von Erikson einen weiteren Lebensabschnitt "hohes Alter" hinzu, da die Lebenserwartung gestiegen ist. Dies ist das "Stadium jenseits der Integrität", in dem die spezifische Lebensaufgabe "Vergangenheit aufarbeiten" lautet. Personen, die im Lebensstadium "Alter" (nach Erikson) die Lebensaufgabe "Leben resümieren" durch "Wahrung ihrer Integrität" erfolgreich lösten, haben im "Stadium jenseits der Integrität" keinen Bedarf an der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit und damit die Voraussetzung, in Frieden zu sterben. Ist dies bei desorientierten oder verwirrten Personen nicht der Fall, so kehren sie in die Vergangenheit zurück, um ungelöste Aufgaben, bzw. ungelöste Gefühle des bisherigen Lebens, aufzuarbeiten. Dieser Aufarbeitungsprozess kann nur mit Unterstützung von außen, mit Validation, erfolgreich verlaufen. Ziel ist eine validierende Begleitung des Aufarbeitungsprozesses, denn "wenn diese verschiedenen Gefühle jedoch bestätigt und validiert werden, zerstreuen sie sich" (S. 21) Erfolgt diese Stimulierung von außen nicht, "werden sie zu den lebenden Toten in unseren Pflegeheimen" (S.21), d.h. sie ziehen sich in das Stadium des Vegetierens zurück. Unterformen im "Stadium jenseits der Integrität" Feil definiert vier Unterformen, wobei jede einem weiteren Rückzug aus der Realität entspricht. Eine Person kann innerhalb von Minuten das "Unterstadium" wechseln, befindet sich jedoch überwiegend in demselben (vgl. S. 49). Unterstadium der mangelhaft/unglücklichen Orientierung: Hier sind kognitive Fähigkeiten weitestgehend intakt, die Betroffenen sind sich ihrer gelegentlichen Verwirrung bewusst. Sie leugnen Gefühle und Erinnerungslücken und suchen die Schuld für Verluste bei anderen, dabei projizieren sie Konflikte aus der Vergangenheit auf Personen der Gegenwart. Die Angst vor weiteren Verlusten führt zu Verhaltensweisen wie "Hamstern" und "Horten" (z.B. Nahrungsmittel, Zeitungen, Servietten). Demente Menschen in diesem Stadium klammern sich an die Realität und halten an ihren gesellschaftlich vorgeschriebenen Rollen fest. Sie sind verletzlich, lehnen Berührungen und Blickkontakt ab und zeigen eine angespannte körperliche Haltung (vgl. S. 52-54). Unterstadium der Zeitverwirrtheit: Dieses Stadium ist geprägt durch die Zunahme an körperlichen und sozialen Verlusten, die nicht mehr geleugnet werden. Vielmehr versuchen die Betroffenen, sich in die Vergangenheit zurückzuziehen und orientieren sich nicht mehr an der Realität. Auf der Gefühlsebene bedeutet dies eine Rückkehr zu universellen Gefühlen wie Liebe, Hass, Trauer, Angst u.a. und den Versuch, angenehme Emotionen aus der Vergangenheit wachzurufen. Demente Menschen in diesem Stadium drücken ihre Gefühle direkt aus. Sie verlieren die Fähigkeit, ihrer gesellschaftlichen Rolle zu entsprechen, und die Fähigkeit zur verbalen Kommunikation ist eingeschränkt. Die Betroffenen zeigen eine entspannte Körperhaltung und reagieren positiv auf Körper- und Blickkontakt (vgl. S. 54-57). Unterstadium "Sich-wiederholende-Bewegungen": Hier erfolgt ein Rückzug in vorsprachliche Bewegungen und Klänge. "Körperteile werden zu Symbolen. Bewegungen ersetzen Worte." (S. 57). Die Sprache wird unverständlich und der Gebrauch von "frühen Sprachformen" und Bewegungen dient als Transportmedium in die Vergangenheit. "Die Person ist nicht mehr allein, mit den Bewegungen des Säuglings, der sprechen lernt, hat sie ihre Mutter wieder zu sich geholt." (S. 58) Gegenstände, Körperteile und Personen gewinnen immer stärkeren Symbolcharakter für Vergangenes. Die Betroffenen ziehen sich in Isolation und Eigenstimulanz, z.B. in Form von sich wiederholenden Bewegungen oder Klangäußerungen, zurück. Sie sind inkontinent und kommunizieren nur bei Blickkontakt und Körpernähe (vgl. S. 57-60). Unterstadium des Vegetierens: In diesem Stadium "verschließt sich der Mensch völlig vor der Außenwelt und gibt das Streben, sein Leben zu verarbeiten, auf." (S. 60). Es besteht ein minimaler Eigenantrieb, der gerade zum Überleben ausreicht. Die Betroffenen zeigen kaum Gefühle, kaum wahrnehmbare Bewegungen und halten die Augen meist geschlossen (vgl. S. 60f.). Zielgruppe für Validation Die Zielgruppe sind desorientierte, sehr alte Menschen (über 80 Jahre), die sich in einem der vier Unterstadien des Lebensabschnitts "Jenseits der Integrität" befinden, welches Feil auch als Stadium "Aufarbeiten oder Vegetieren" bezeichnet (vgl. S. 29-31). Feil wendet sich gegen eine einheitliche Bezeichnung "Demenz" oder "Alzheimer-Demenz". Ihrer Meinung nach ist die senile Demenz im Gegensatz zur präsenilen Demenz keine eindeutige Erkrankung, da Neurofibrillen und Plaques im Alter normal seien. Zudem sei das gezeigte Verhalten beider Gruppen auch im Hinblick auf die Reaktion auf Validation unterschiedlich. "Senile Demente ... sind jene, die ich als desorientierte, sehr alte Menschen bezeichne." (S. 34). Dies ist die Gruppe, die der Validation zugänglich ist (vgl. S. 31-35). Praktische Umsetzung von Validation a) Validationsanwender Die Einstellung gegenüber dementen Menschen ist für die Anwendung von Validation wichtiger als die konkreten Techniken. Es muss akzeptiert werden, dass der Rückzug in die Vergangenheit eine Methode des Überlebens bedeuten kann. "Validations-Anwender, kurz VA genannt, urteilen nicht, sie akzeptieren und achten die Weisheit der alten Menschen." (S. 35). Aufgabe des VA ist die Hilfestellung bei der Erfüllung der letzten Lebensaufgabe. Er soll vertrauensvoll zuhören, Gefühle bestätigen und ernstnehmen, diese aber nicht analysieren. Er soll Gefühle teilen können, und es soll ihm möglich sein "in das Leben des anderen [zu] schlüpfen, weil wir selbst schon viele Verluste erlitten haben." (S. 37). "Ein idealer VA ist jemand, der nach Erikson Erwachsenen-Intimität erlangt hat, Identität besitzt, sich von der elterlichen Autorität abgenabelt hat und sich ohne die Furcht, abgelehnt zu werden, ausdrücken kann." ( S. 37). Feil betont, dass nicht jeder für die Anwendung von Validationstechniken geeignet ist. "Ein VA ist ein ‚Übermensch für 3 Minuten', denn er bringt für sehr alte, desorientierte Menschen Empathie auf und achtet ihre Gefühle als echte, ohne zu wissen, warum der alte Mensch sich so verhält." (S. 38). b) Individuelle Validation Diese erfolgt in den drei Schritten "Sammeln von Informationen", "Bestimmung des Stadiums" und "Anwendung von Validationstechniken". Im ersten Schritt werden über mindestens zwei Wochen Informationen über die betreffende Person, ihr vergangenes Leben, die gegenwärtige Situation und ihre Zukunftsvorstellungen gesammelt. Dies kann durch das Gespräch mit Desorientierten, das Befragen von Angehörigen und das Beobachten der betroffenen Person geschehen. Im Gespräch soll darauf geachtet werden, dass Fragen keine Angst erzeugen. Dies wären z.B. Fragen nach Zeitspannen. Statt dessen sollen allgemeine Formulierungen verwendet werden. Feil unterscheidet "Hier und Jetzt"-Fragen, die sich auf die aktuelle Situation beziehen, (z.B. "Fühlen sie sich manchmal alleine?") von "Damals und Dort"-Fragen. Dies sind Fragen zur Vergangenheit, die sich auf Bewältigungsmechanismen bei schwierigen Situationen (z.B. "Wie überstanden Sie schwierige Zeiten?") und auf unbewältigte Lebensaufgaben (z.B. "Haben Sie eine gute Ehe geführt?") beziehen (vgl. S. 62-65). Durch Beobachten sollen physische Charakteristika (die Art sich zu bewegen, Lachfalten, Sorgenfalten usw.) und nonverbaler Ausdruck (wie z.B. die Körperhaltung und Augenausrichtung) erkannt werden. Ein Ziel ist dabei das Herausfinden des bevorzugten Sinnesorgans (vgl. S. 65-67). Im zweiten Schritt erfolgt die Bestimmung des Stadiums durch die Informationen, die zur Person gesammelt wurden. Da sich die Auswahl der Validationstechnik nach den einzelnen Unterstadien richtet, ist die richtige Zuordnung der desorientierten Person in das entsprechende Unterstadium von ausschlaggebender Bedeutung (vgl. S. 67). Darauf aufbauend erfolgt im dritten Schritt die Anwendung von Validationstechniken, die auf das Unterstadium abgestimmt sind. Prinzipiell kann die individuelle Validation von unterschiedlichen VA praktiziert werden und an allen Orten mit Privatsphäre stattfinden, die ein vertrauliches Gespräch ermöglichen. "Die Putzfrau in einem Heim kann validieren, während sie das Zimmer aufräumt; die Pflegehelferin, wenn sie den alten Patienten zur Toilette bringt; die Schwester beim Austeilen der Medikamente; der Haustechniker, wenn er die Glühbirne auswechselt; der Gärtner beim Grasmähen; Angehörige bei einem Besuch." (S. 68). Die Dauer der Validierung ist abhängig von der Konzentrationsfähigkeit der desorientierten Person. Feil empfiehlt Kontaktzeiten bis maximal fünfzehn Minuten, je nach Stadium der Desorientierung. Die Interaktion sollte jedoch spätestens dann beendet werden, wenn sichtbare Zeichen verminderter Angst zu beobachten sind, z.B. regelmäßiger Atem, Lächeln, Abnahme sich wiederholenden Verhaltens (vgl. S. 67-69). Im Folgenden werden Techniken vorgestellt, die Möglichkeiten zur Anwendung von Validation aufzeigen. "Es gibt keine Universalformel, da jeder Mensch anders ist. Alle VA müssen ihre eigene Methode finden, auf sehr alte, desorientierte Menschen einzugehen." (S. 69). Feil legt dem VA nahe, vor der Validation eine Atemübung zur Konzentrationssteigerung durchzuführen, die sie als "Zentrieren" bezeichnet. Sie soll helfen, sich ganz auf eine andere Person einzulassen und die eigenen Gefühle auszublenden (vgl. S. 45, 116). Außerdem betont sie, dass die körperlichen Charakteristika und Gefühlsäußerungen der verwirrten Person während der Validationsanwendung beobachtet werden sollen. Diese kann der VA mit unerfüllten Grundbedürfnissen (Liebe, Geborgenheit, nützlich sein, tiefe Gefühle ausdrücken) assoziieren (vgl. S. 116). Einen großen Komplex der individuellen Validationsmethode bilden die verbalen Kommunikationstechniken. Feil gibt dazu folgende Empfehlungen (S. 116): "Achten Sie auf die Wortwahl." "Fragen Sie: wer, was, wo, wann, wie. (Vermeiden Sie warum)" "Wiederholen Sie Schlüsselworte, umschreiben Sie sie, fassen Sie sie zusammen." "Fragen Sie nach dem Extrem (Wie schlimm? Schlimmer? Am besten? ...)" "Verwenden Sie mehrdeutige Pronomen (er, sie, es, jemand, der etc.), wenn sie [sic !] das Wortgestammel nicht begreifen." "Rufen Sie in Erinnerung (Wie war es früher?)" "Versuchen Sie das Gegenteil vorstellbar zu machen. (Wann war es besser? Gab es eine Zeit, wo das und das nicht passierte?)" "Können wir gemeinsam eine kreative Lösung finden? Was taten Sie als das früher passierte? Finden Sie eine Methode heraus, die damals funktionierte." "Sprechen Sie die Emotion laut und gefühlvoll aus. Spiegeln Sie das Gefühl." "Singen Sie vertraute Lieder, die gefühlsmäßig passen." Zusätzlich wird vorgeschlagen, Worte zu verwenden, die das bevorzugte Sinnesorgan der verwirrten Person ansprechen (z.B. visuelle Wörter, wie schauen, Bild, wahrnehmen, klar). In der Validation von desorientierten Menschen im Stadium "mangelhafte/unglückliche Orientierung" kommen vor allem verbale Kommunikationstechniken zur Anwendung. In den Stadien "Zeitverwirrtheit" und "Sich-wiederholende-Bewegungen" werden, je nach verbaler Kommunikationsfähigkeit der betroffenen Person, immer mehr nonverbale Kommunikationstechniken eingesetzt. Im Stadium "Vegetieren" findet die Kommunikation fast ausschließlich auf der nonverbalen Ebene statt (vgl. S. 69-80). In Bezug auf die nonverbalen Kommunikationstechniken macht Feil folgende Vorschläge (S. 116): "Spiegeln Sie die Bewegung. Atmen Sie im gleichen Rhythmus." "Berühren Sie: die Wangen, den Hinterkopf, die Kieferlinie, Schultern, Oberarme etc." "Halten Sie echten Blickkontakt." c) Validation in Gruppen Eine Validation in Gruppen ist für Personen im Stadium "Zeitverwirrtheit" und "Sich-wiederholendeBewegungen" geeignet. Diese "haben wenig Energie und Konzentrationsvermögen für Gespräche unter vier Augen." (S. 86) Für Personen im Stadium "Mangelhafte/unglückliche Orientiertheit" ist eine Validationsgruppe weniger geeignet. "Der/die VA müßte eine solche verwirrte Person, die oft weint, klagt oder andere Gruppenmitglieder für ihre Fehler verantwortlich macht, in die Schranken weisen." (S. 86) Aufgrund der extrem reduzierten Kommunikationsfähigkeit kommen auch Betroffene im Stadium "Vegetieren" nicht für eine Gruppenvalidation in Frage. Die Validation soll mindestens einmal wöchentlich zur gleichen Zeit und am gleichen Ort durchgeführt werden. Sie dauert ca. zwanzig bis sechzig Minuten. Voraussetzung sind eine Atmosphäre der Geborgenheit und ein Ort mit Privatsphäre, d.h. ein psychologisch sicherer Ort, an dem Menschen einander nicht verletzen können. Ziel der Gruppenvalidation ist die Aktivierung von Fähigkeiten, die die Kommunikation und die soziale Integration verbessern. Die Betroffenen teilen in der Gruppe gleiche Probleme und können sich eventuell gegenseitig bei Konfliktlösungen unterstützen, sie validieren sich sozusagen gegenseitig. Die Einrichtung einer Validationsgruppe umfasst sieben Schritte (vgl. S. 85-98): 1) Kennen lernen Hier werden Informationen über die desorientierten Personen gesammelt (wie bei Individueller Validation). 2) Auswahl der Mitglieder Eine Gruppe hat fünf bis zehn Mitglieder, von denen höchstens zwei im Stadium "Sich-wiederholende- Bewegungen" sind. Idealerweise sollten unterschiedliche soziale Rollen vertreten sein. 3) Wahl der sozialen Rolle Jedem Gruppenmitglied wird eine soziale Rolle zugeteilt, die der Persönlichkeit der Person entgegenkommt. Dies gibt dem Treffen Struktur und bewirkt, dass alle Teilnehmer mit einbezogen werden. Dabei werden alte Verhaltensmuster stimuliert und das Selbstwertgefühl gesteigert. Mögliche Rollen sind beispielsweise der Vorsänger, der Gastgeber oder der Vorleser. 4) Einbeziehung des gesamten Personals Während individuelle Validation von Einzelpersonen durchgeführt werden kann, wird bei der Gruppenvalidation die Unterstützung der Verwaltung und der Kollegen gebraucht (fester Raum, ungestörte Zeit, Informationen vom Personal über Einzelpersonen und aktuelle Ereignisse, z.B. Streit). 5) Angebote Der Ablauf eines Gruppentreffens ist jedes Mal gleich strukturiert. Der ritualisierte Ablauf vermittelt das Gefühl der Geborgenheit. Hauptkomponenten des Angebots sind: Musik: Das Gruppentreffen sollte mit einem Lied eröffnet und geschlossen werden (stimuliert Interaktion, Wohlbehagen). Gespräch: Bei jedem Treffen wird ein bestimmtes Diskussionsthema gewählt. Bevorzugt werden Themen, die sich auf Gefühle beziehen wie z.B. Liebe, Ärger oder "auf den Kampf um die eigene Meinung und um die eigene Identität." (S. 91) Bewegung: Hier kommt beispielsweise tanzen oder Gymnastik in Frage. Gefördert werden das Gemeinschaftsgefühl, Energie und Spaß. Möglich ist aber auch "Arbeiten mit den Händen" (Gefühle ausdrücken, z.B. Teig kneten). Essen: Steht für Fürsorge und soll soziales und selbständiges Verhalten auslösen. 6) Vorbereitung des Treffens Vor dem Treffen sollte der Leiter des Treffens die Inhalte und die Struktur wie Sitzordnung oder Ablauf festlegen. Zusätzlich gehört dazu das "Zentrieren", also das innere Sammeln und fokussieren des VA auf seine Aufgabe. 7) Das Treffen Ein Treffen soll sich immer aus einer Eröffnung (Einstimmung der Teilnehmer), einem Hauptteil (Gespräch), dem Ende (Wir-Gefühl herstellen, positiver Ausklang) und der Vorbereitung auf das nächste Treffen (z.B. durch Dokumentation von Entwicklungen und Fortschritten der Teilnehmer) zusammensetzen. 5.4 Integrative Validation Nicole Richard (Diplom-Pädagogin, Diplom-Psychogerontologin) aus Kassel propagiert seit 1994 in Deutschland eine Abwandlung der Validationsmethode nach Feil. Die von ihr als "Integrative Validation" (IVA) benannte Methode verfolgt einen sogenannten "ressourcenorientierten Ansatz". Die Validation konzentriert sich hierbei vor allem auf verbliebene Fähigkeiten und Kompetenzen des Demenzerkrankten. Diese "Ressourcen" sollen aktiviert und in die Pflege und Betreuung von dementen Menschen integriert werden. "Ressourcen sind Bodenschätze, Goldadern, nach denen man suchen muß." (Richard, 2001a, S. 57). Richard stellt dabei die zwei zentralen Ressourcen "Antrieb" und "Gefühle" heraus. "Antrieb" bezeichnet früherlernte Normgefühle einer Generation, die eine lebensgeschichtliche Herleitung beinhalten. Sie sind Motiv und Triebfeder des Handelns und erfahren eine persönliche Ausprägung und Gestaltung, z.B. Ordnungssinn oder Fürsorglichkeit (vgl. Richard, 2001a, S. 57). "Gefühle" sind Ausdruck der momentanen Befindlichkeit und beinhalten eine Reaktion auf die Umwelt. Sie stehen oft in Verknüpfung mit der inneren Erlebenswelt und werden von Demenzerkrankten direkt zum Ausdruck gebracht, wie z. B. Angst oder Ärger (vgl. Richard, 2001a, S. 57). Richard kritisiert an anderen Betreuungskonzepten, wie z.B. dem ROT, dass sie sich auf den Versuch konzentrieren, nicht mehr vorhandene oder stark eingeschränkte Fähigkeiten von dementen Menschen zu fördern. Diese von ihr als "defizitärer Ansatz" bezeichnete Konzeption führt ihrer Meinung nach zu Ohnmachtsgefühlen und Hilflosigkeit der betreuenden Personen und stellt ein "hoffnungs-, sinn- und würdeloses Unterfangen" dar (Richard, o.J., S. 3f.). Primär sollte ihrer Ansicht nach das Sicherheitsbedürfnis des dementen Menschen in den Mittelpunkt aller Bemühungen gestellt werden. Dies erfolgt über die Aktivierung von vorhandenen Ressourcen, wodurch das Wohlbefinden des dementen Menschen und die Motivation der Betreuungsperson gefördert werden. Um diese Ressourcen aufzudecken, ist es nötig, sich in die "Zeit- und Erlebnisebene" des Dementen einzufühlen und seine "innere Realität", "seine persönliche Lichtung im Nebel" anzuerkennen (Richard, 1996, S. 219). Antriebe und Gefühle können so wahrgenommen und wertschätzend wiedergegeben werden. "Wir sind das Echo, wir können oftmals isolierten Äußerungsformen Demenzerkrankter eine Sprache geben." (Richard, 2001a, S. 58). Auf diese Weise können negative Gefühle aufgelöst und positive lebendiger erlebt werden. Der Betreute wird emotional aufgefangen und fühlt sich verstanden, da die von ihm geäußerten Gefühle in einer Atmosphäre des Vertrauens ernstgenommen und wertgeschätzt werden. Um Gefühlsmomente, die hinter Äußerungen oder Verhaltensweisen einer dementen Person stehen, richtig einordnen zu können, sind Biographiewissen und Kenntnisse von Symbolen entscheidend und die Voraussetzung für eine dementengerechte Kommunikationsweise (vgl. Richard, 2001a, S. 57f.). Die Kommunikation erfolgt grundsätzlich auf drei Ebenen: Verbal (Sprache), nonverbal (Körpersprache) und paraverbal (Betonung). Richard bemerkt, dass die Kommunikation keine Diskrepanz zwischen diesen drei Ebenen aufweisen darf, da dies zur Verwirrung des dementen Menschen führen kann. Der Schwerpunkt der IVA liegt primär auf der sprachlichen Ebene und ist deshalb vorrangig für Demenzerkrankte im Anfangsstadium sinnvoll. Die Sprache sollte aus kurzen, eindeutig formulierten Sätzen bestehen. Wichtig ist außerdem die Verwendung von Zeitgeistwörtern, d.h. die Wortwahl soll an das Alter der dementen Person angepasst sein. Es sollen Wörter verwendet werden, die der demente Mensch in Kindheit, Jugend und jüngeren Erwachsenenjahren gebraucht hat (z.B. Kummer, Kavalier, versprochen-sein). Günstig ist auch die Verwendung von Metaphern (z.B. mir fällt ein Stein vom Herzen, um den Finger wickeln) oder von Sprichwörtern. Ebenfalls hilfreich ist der Einsatz von Ritualen. Dabei können sowohl alte Rituale erkannt und gepflegt als auch neue geschaffen werden (z.B. Gespräch immer mit den gleichen Startsätzen beginnen). Biographieabhängige Themen und Beschäftigungen erleichtern ebenfalls den Zugang zur "inneren Realität" des dementen Menschen und verbessern so die Kommunikation (vgl. Richard, 2001a, S. 58; Richard, o.J.). Wichtige Effekte, die aus der IVA für die dementen Menschen entstehen, sind Gefühle der Sicherheit und der Zugehörigkeit, ein gesteigertes Selbstwertgefühl und die Verminderung von Angst und Stress. Dies geht mit einer Reduktion von unkontrollierten Gefühlsausbrüchen einher und fördert so die soziale Kontaktaufnahme (vgl. Richard, 2001a, S. 59). Für die Betreuungskräfte ermöglicht der Einsatz der IVA ein strukturierteres Handeln, insbesondere in Bezug auf die Teamarbeit. Eine leichtere Einschätzung von dementen Menschen macht den Umgang miteinander einfacher, da weniger Berührungsängste existieren. Das sehr personenbezogene Arbeiten führt zu einer hohen Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitsleistung und dem Gefühl, eine sinnvolle Arbeit zu leisten (vgl. Richard, 1996, S. 222). 5.5 Biographiearbeit Das Biographiewissen ist ein essentieller Bestandteil in allen vorgestellten Betreuungskonzepten für demente Menschen. Biographiewissen wird durch Biographiearbeit (synonym: Erinnerungsarbeit, Erinnerungspflege, Reminiszieren) erarbeitet bzw. erhalten und kann in die Pflege und Betreuung dementer Menschen integriert werden. Sowohl die Betreuten als auch die Betreuer können vom Einsatz der Biographiearbeit profitieren. Für demente Menschen stellt die Erinnerung an ihre Vergangenheit eine wichtige Ressource dar, weil das Kurzzeitgedächtnis eingeschränkt ist, das Langzeitgedächtnis, in dem sehr gut memorierte und meist lange zurück liegende Informationen gespeichert sind, jedoch häufig noch lange während des Krankheitsfortschritts relativ intakt bleibt (vgl. Kitwood, 2000, S. 88). Typisch für die Demenzerkrankung ist zudem eine eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit und das Leben "in einer traumähnlichen Welt der Erinnerungen" (Wojnar, 2001a, S. 40). Dies bedingt, dass demente Menschen mit Hilfe von Erlebnissen der Vergangenheit in der Jetztzeit kommunizieren. "Es scheint, als böten Erinnerungen den Menschen oft metaphorische Ressourcen, über ihre aktuelle Lage in einer für sie handhabbaren Weise zu sprechen." (Kitwood, 2000, S. 88). Verfügen Betreuungspersonen über kein Biographiewissen, können sie Verhaltensweisen und Äußerungen, die mit der Lebensgeschichte einer dementen Person in Zusammenhang stehen, nicht richtig deuten, und die Kommunikationsversuche des Demenzerkrankten werden fehlinterpretiert. Die Folge davon ist, dass der Betreute sich unverstanden fühlt und seine Bedürfnisse oft unbefriedigt bleiben. Er stellt seine Kommunikationsversuche schließlich ein, und die Erinnerung an sein vergangenes Leben, aus der er sein Selbstwissen und seine Identität bezieht, verblasst zunehmend (vgl. Trilling, 2001, S. 40). Biographiearbeit zielt darauf ab, das Identitätsgefühl des dementen Menschen zu erhalten. Durch geteilte Erinnerungen kann ein Gemeinschaftsgefühl und eine Atmosphäre des Vertrauens entstehen. Außerdem werden die Kommunikation und die soziale Kontaktaufnahme gefördert und die Rückbesinnung auf Erfolge und Leistungen im vergangenen Leben kann die Selbstachtung stärken (vgl. Trilling, 2001, S. 42f.). In der stationären Betreuung spielt die Biographiearbeit eine besonders wichtige Rolle, da durch den Einzug in eine Institution die Zahl wichtiger Repräsentanzen des vergangenen Lebens, die zum Erhalt der Identität beitragen, stark reduziert wird. Es besteht die Gefahr, dass der demente Heimbewohner mit seinen Erinnerungen alleine bleibt und sein Identitätsgefühl abnimmt (vgl. Blimlinger, 1996, S. 3). Biographiearbeit hat zudem eine positive Auswirkung auf die Betreuungspersonen. Mit Hilfe von Biographiewissen finden betreuende Personen leichter Zugang zu einer dementen Person, deren verbales Ausdrucksvermögen eingeschränkt ist. Da auf diese Weise ein Kennen- und Schätzenlernen erleichtert wird, kann sich schneller eine persönliche Beziehung zwischen Betreuer und Betreuten entwickeln. Auch die Kommunikation mit dementen Menschen, die im Pflegealltag oft nur aus Standardfragen und Standardantworten besteht, profitiert von der Biographiearbeit. Gesprächsthemen können sich auf die individuelle Vergangenheit einer Person beziehen und den betreuenden Personen fällt es leichter, Verhaltensweisen und Äußerungen dieser Person zu interpretieren, auf Bedürfnisse einzugehen und Beschäftigungsangebote zu machen, die den Interessen des Demenzerkrankten entsprechen. Insgesamt betrachtet, reduziert Biographiewissen in der Betreuung dementer Menschen die Frustration der Betreuungspersonen und steigert ihre Arbeitszufriedenheit (vgl. Trilling, 2001, S. 40-42; Gereben, 1998, S. 17-26). Formen der Biographiearbeit Gereben unterscheidet zwei Formen der Biographiearbeit: die gesprächsorientierte Biographiearbeit und die aktivitätsorientierte Biographiearbeit (vgl. Gereben, 1998, Kap. 4). Zur gesprächsorientierten Biographiearbeit zählen Einzel- und Gruppengespräche, die zu vorgegebenen Themen angeboten werden. Solche Themen sind z.B.: Familienleben, Schulzeit, Kinderspiele, Feste und Feiertage. Die aktivitätsorientierte Biographiearbeit zeichnet sich durch die Integration der Biographiearbeit in eine Tätigkeit aus. Dies kann beispielsweise ein Museumsbesuch, aber auch das Anfertigen einer Collage, das Singen von Liedern oder das Ausführen von Alltagshandlungen (z.B. Tisch decken) sein. Bei beiden Formen gilt, dass sich das Miteinbeziehen von Angehörigen und eine dementengerechte Kommunikation sehr positiv auf die Erfolgsmöglichkeiten der Biographiearbeit auswirken. Trilling schlägt für die dementengerechte Kommunikation vor, nur einen Sachverhalt im Gespräch gleichzeitig anzusprechen, eine einfache Sprache zu verwenden und vertraute Redewendungen oder Sprichwörter zu benutzen. Weiterhin gehört das aktive Zuhören dazu, bei dem Aufmerksamkeit auch durch nonverbale Mittel ausgedrückt wird, im verbalen Bereich Paraphrasen verwendet und Gesprächspausen zugelassen werden. Beachtet werden muss auch, dass insbesondere Fragen an demente Menschen nicht auf eine absolute Antwort abzielen sollten (z.B. Fragen, die mit "wann", "wer", "wo" beginnen), da die Unmöglichkeit, sie zu beantworten, für demente Menschen sehr belastend sein kann. Eine Frage sollte immer auch den Ausweg einer nicht allzu konkreten Antwort anbieten. In der Biographiearbeit mit dementen Menschen ist es außerdem hilfreich, die Sinne (z.B. Geruchs-, Geschmacks-, Tastsinn) durch Trigger (Erinnerungsschlüssel) anzusprechen. Als Trigger können beispielsweise Gegenstände, Photos, Speisen und Getränke oder Musik eingesetzt werden (vgl. Trilling, 2001, S. 50-61). In Bezug auf die stationäre Biographiearbeit gibt es einige zusätzliche Komponenten, die berücksichtigt werden sollten. Bei der stationären Aufnahme sollte ein "Biographiebogen" erstellt werden, der zentrale persönliche Daten und wichtige Informationen aus dem Leben des dementen Menschen enthält. Dazu wird möglichst auf die Hilfe der Angehörigen zurückgegriffen. Trilling empfiehlt, Lebenserinnerungen in Form eines Lebensbildes, Lebensbuches oder einer Lebenskiste, also plastisch bzw. mit Hilfe von "Reliquien", die sie als "Erinnerungsobjekte" bezeichnet, darzustellen. Diese sollen sich nach Möglichkeit gut sichtbar im Zimmer des Heimbewohners befinden, so dass in der Alltagskommunikation darauf Bezug genommen werden kann und so die Verständigung erleichtert wird. Zusätzlich soll die Einrichtung der Zimmer möglichst aus vertrautem Mobiliar bestehen, und es sollen besondere "Erinnerungsecken" o.ä. eingerichtet werden (vgl. Trilling, 2001, S. 118-121). Ein Betreuungskonzept, welches sich sehr stark auf Biographiewissen stützt, ist die Selbst-ErhaltungsTherapie, die vor allem die Ziele der Biographiearbeit weiter ausformuliert (vgl. Kap. 5.6). 5.6 Selbst-Erhaltungs-Therapie Die Selbst-Erhaltungs-Therapie (SET) wurde Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts insbesondere von Barbara Romero, entwickelt. Das übergeordnete Ziel dieses Betreuungskonzepts ist die Erhaltung des personalen Selbst. Das "Selbst" ist in diesem Zusammenhang als zentrales kognitives Schema zu sehen, welches Informationen über die eigene Person und die Umgebung aufnimmt, verarbeitet und aufrechterhält. Es schafft die Voraussetzungen, um "Entwicklungen von Situationen vorauszusagen, Entscheidungen zu fällen, Einstellungen und Haltungen einzunehmen und sich zu orientieren" (Romero, 1997, Kap. 1). Es ist abhängig von Selbstwert, Selbstsicherheit und Selbständigkeit der eigenen Person. Ein stabiles "Selbst" hat positiven Einfluss auf das Selbstwertgefühl und die Identität und bedingt so auch die Stimmung und die Effizienz des Verhaltens von Menschen. Erfahrungen, die das "Selbst" verletzen (z.B. Konflikte, Misserfolge, Erlebnisarmut), lösen somit negative Gefühle (Angst, Scham, Aggression, Depression) aus, welche in störenden Verhaltensweisen (z.B. Aggressionsausbrüche, starke Unruhe, Tendenz zum Weglaufen) ihren Ausdruck finden können (vgl. Romero, 1997, Kap. 1). Ziel der SET ist der Erhalt dieses personalen "Selbst", damit in der Folge die Effizienz des Verhaltens gefördert und psychischem Leiden entgegengewirkt werden kann. Als Resultat kommt es dann zu einer Reduktion von störendem Verhalten (vgl. Romero, 1997, Kap. 1). Im Verlauf einer Demenzerkrankung ist der Erhalt des stabilen "Selbst" stark bedroht: Veränderte Lebensumstände führen zu Gefühlen des Kontinuitätsverlusts, und erlebnisarme Lebensbedingungen, Verlust von Welt- und Selbstwissen, ein beeinträchtigter Kohärenzsinn und Persönlichkeitsveränderungen bedrohen zudem das Identitätsgefühl. Gelingt es, diesen negativen Einflüssen auf das "Selbst" entgegenzuwirken, so lassen sich auch das Ausmaß psychischer Leiden und die Ausprägung des störenden Verhaltens verändern. Eine adäquate Unterstützung des "Selbst" fördert so die Effektivität des alltäglichen Verhaltens, hat einen günstigen Effekt auf den Verlauf der Krankheit und reduziert auch das Leid der Angehörigen (vgl. Romero, 1997, Kap. 2). Mittel zur verlängerten Erhaltung des Selbst sind die Betreuungsform, psychotherapeutische Interventionen und kognitive Übungsprogramme. Zusätzlich sollten psychotische Symptome medikamentös behandelt werden. Im Folgenden werden Inhalte und Ziele der Maßnahmen zur Selbsterhaltung erläutert. 1. Bewahren der Kontinuität Einfach zusammengefasst, bedeutet dies, "vermeidbare Veränderungen zu vermeiden" (Romero, 1998). Auf das Umfeld bezogen, bedeutet Kontinuität, dass sowohl die räumliche Umgebung und die "Dingwelt" (z.B. Möbel) als auch die personelle Umgebung (Bezugspersonen) möglichst konstant sein sollen. Im sozialen und kulturellen Leben sollen angemessene soziale Umgangsformen herrschen, wobei "es sich oft nur um eine gute, unterstützende, nicht verletzende Ausdrucksweise" (Romero, 1997) und den früheren Interessen des Einzelnen entsprechende Beschäftigungsangebote handelt (vgl. Romero, 1997, Kap. 3.1). 2. Bewahren des Identitätsgefühls Besondere Erlebnisse, wie z.B. die körperliche Erschöpfung nach einer Wanderung, der Besuch beim Friseur oder ein Geschenk fördern das Identitätsgefühl. Insgesamt betrachtet, sind identitätsfördernde Erlebnisse solche, "die mit dem Gefühl, 'sich ganz nahe zu sein' verbunden" sind und die der Erlebnisarmut entgegenwirken (Romero, 1997, Kap. 3.2). 3. Bewahren des Kohärenzsinnes "Kohärenzsinn" ist ein von A. Antonovsky eingeführter Begriff und beschreibt Eigenschaften, die einen Menschen befähigen, trotz großer Belastungen psychisch gesund zu bleiben. Er ist bei Demenzerkrankten durch "kognitive, emotionale und motivationelle Veränderungen primärer und sekundärer Art sowohl beeinträchtigt, als auch besonders gefordert." (Romero, 1997, Kap. 2.2). Der Kohärenzsinn besteht aus drei Komponenten: Verstehen, Zuversicht und Sinn. Das Verstehen Das Verstehen bezieht sich auf Maßnahmen, die es dem dementen Menschen erleichtern, Alltagsabläufe zu verstehen, sie vorauszusagen und nachzuvollziehen. Dazu gehört z.B. die Strukturierung der Umwelt und des Tagesablaufes. Dies ist besonders bei beginnender Demenz sehr wichtig, da hier Beeinträchtigungen bewusst erlebt werden und beunruhigend wirken. Zum Verstehen gehört auch die Aufklärung des dementen Menschen über die Diagnose "Demenz", damit die Veränderungen, die ihm widerfahren, als Krankheit und nicht als persönliches Versagen eingeordnet werden können. Dies schützt die Betroffenen vor Schuldgefühlen und Überforderung. Kommunikationstechniken bilden einen weiteren Teil des Verstehens. Diese sind an die Validationsmethode nach Feil angelehnt, verzichten aber auf die zur Validation gehörende Bewertung. "Psychodynamische Interpretationen der Konflikte und die so begründeten Interventionen, die das Validationskonzept miteinschließt, halten wir allerdings für Alzheimer-Kranke für ungeeignet." (Romero, 1997, Kap. 3.3.1). Die Zuversicht Ziel ist es hier, dem Erkrankten zu vermitteln, dass er trotz Demenz mit den Lebensanforderungen zurechtkommen kann. Dies hängt zu einem großen Teil von der psychosozialen Unterstützung der Betreuungspersonen ab. Die Betreuenden sollen aus diesem Grund auf dementengerechte Umgangsformen vorbereitet werden, damit in der Betreuung des dementen Menschen Überforderungs- und Unterforderungssituationen vermieden werden können und der Betroffene ein Gefühl der Zuversicht und der Sicherheit erfahren kann (vgl. Romero, 1997, Kap. 3.3.2). Der Sinn Ein weiteres Grundelement des Kohärenzsinns ist der Erhalt des Sinngefühls, in Bezug auf das Leben mit einer Demenzerkrankung. In der SET wird deshalb betont, dass der "weise Umgang" mit der Krankheit, die Weiterführung eines "normalen Lebens" und die Hervorhebung von Lebenszielen, die trotz Krankheit unverändert bleiben (z.B. das Familienleben), entscheidend sind (vgl. Romero, 1997, Kap. 3.3.3). 4. Bewahren des Selbst-nahen Wissens Der SET liegt die Annahme zugrunde, dass das Üben von biographischem, selbstbezogenem Wissen zum Erhalt und zur Reaktivierung dieses Wissens beiträgt. Die erste Phase in der praktischen Umsetzung bildet die "Selbstdiagnose". In Form von regelmäßig stattfindenden Therapiesitzungen wird der Demenzerkrankte zum freien Erzählen motiviert. Geschichten und Themen, die über einen längeren Zeitraum wiederholt erzählt werden, bezeichnet Romero als "Erinnerungsfiguren". Sie werden mit Hilfe von Videoaufzeichnungen festgehalten. In der zweiten Phase, dem "Aufbau eines externen Gedächtnisses", werden die Videoaufzeichnungen durch halbstrukturierte Erzählungen zu ausgewählten Themen (z.B. "Elternhaus", "Beruf") erweitert. Neben den Videoaufzeichnungen kann das "externe Gedächtnis" durch andere Dinge, wie alte Photos, Lieder oder Gedichte ergänzt werden. In den Therapiesitzungen der Folgezeit (Phase "Erhalten des Selbst-nahen Wissens") wird die demente Person erneut zum "freien Erzählen" angeregt. Das "externe Gedächtnis" kann in dieser letzten Phase zur Stimulation oder als Gedächtnisstütze eingesetzt werden. Neben dem Erhalt des Selbst-nahen Wissens hat das Erinnern noch weitere positive Auswirkungen auf den Demenzerkrankten. Es kann z.B. ein gesteigertes Wohlbefinden und Selbstwertgefühl erreicht werden (vgl. Romero, 1997, Kap. 3.4). Durchgeführt wurde die SET bisher in der ambulanten, teilstationären und stationären Betreuung von dementen Menschen. Der ambulante Einsatz der SET wurde bislang primär in der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in München erprobt. Die regelmäßig stattfindenden Therapiesitzungen (einmal wöchentlich) sollten dabei die Dauer von jeweils 1,5 Stunden nicht überschreiten, sich insgesamt jedoch über einen sehr langen Zeitraum erstrecken (mehrere Jahre). Die Vorgehensweise der ambulanten psychologischen Behandlung nach dem Konzept der SET kann verschiedene Komponenten beinhalten, wie z.B. den Durchlauf der Therapiephasen "Selbst-Diagnose", "Aufbau eines externen Gedächtnisses" und "Erhalten des Selbst-nahen Wissens", das Herausfinden von individuell geeigneten Beschäftigungsaufgaben im Alltag und in der Freizeit oder die Förderung des Krankheitsverständnisses. Der Erfolg der ambulanten Therapie ist besonders von der Unterstützung durch Familienangehörige und Betreuungspersonen abhängig. Aus diesem Grund sind Beratungsgespräche mit dieser Personengruppe unerlässlich (vgl. Romero, 1997, Kap. 4.2). In der teilstationären Betreuung dementer Menschen, wurde das Konzept der SET z.B. in der Tagesstätte "Münchner Altenwohnstift e.V." eingeführt. Romero betont, dass die Einführung der SET unter psychologischer Supervision der Mitarbeiter stattfinden soll. Im teilstationären Bereich kommen verschiedene Selbst-erhaltende Maßnahmen zum Einsatz. Dies sind z.B. biographieorientierte Gespräche mit den dementen Menschen und ihren Angehörigen, Raumgestaltung (z.B. Photo-Ecke, vertraute Gegenstände von zu Hause) oder Beschäftigungsangebote, die den individuellen Interessen des Einzelnen entsprechen und nicht so wirken, als wären sie "Programmen für Kinder- bzw. Jugendgruppen entnommen" (Romero, 1997, Kap. 4.1). Stationär wird die SET in dem 1999 gegründeten Alzheimer Therapiezentrum der Neurologischen Klinik Bad Aibling unter der Leitung von B. Romero praktiziert. Das stationäre Behandlungsprogramm erstreckt sich über vier Wochen und sieht die Aufnahme des Demenzerkrankten und der ihn betreuenden Person vor. Im Mittelpunkt der Behandlung stehen die Diagnoseüberprüfung, die medikamentöse Therapie und die SET. Hier werden täglich, innerhalb eines Zeitrahmens von fünf Stunden, Einzel- und Gruppentherapien angeboten (u.a. Therapie zur Erhaltung von biographischem Wissen, Kunsttherapie, Sport, Alltags- und Freizeitaktivitäten). Ergänzt werden diese Angebote durch Beratungsgespräche, die z.B. Themen wie die individuelle Planung der Alltagsbeschäftigungen und der Lebensgestaltung zu Hause oder die Möglichkeiten von externen Hilfen (z.B. ambulante Pflege, Tagespflegeeinrichtungen, Selbsthilfegruppen) aufgreifen (vgl. Jahresbericht 1999). Die praktische Umsetzung der SET befindet sich noch in der Probephase, die Weiterentwicklung des Konzepts wird jedoch angestrebt. Um die Anwendung in Institutionen (stationäre und teilstationäre) und in der familiären Betreuung auszudehnen, sollen zukünftig die Schulungs- und Beratungsangebote für die Vermittlung der Betreuungsprinzipien der SET verbessert werden. Außerdem ist der Einsatz von Multimedia-PCs als Träger des "externen Gedächtnisses" geplant, um den Zeitaufwand der Erstellung zu reduzieren. Gleichzeitig soll die Bedienung des Computerprogramms so unkompliziert sein, dass die regelmäßige Anwendung des SET-Programms für den dementen Menschen auch zu Hause möglich wird (vgl. Romero, 1997, Kap. 5). 5.7 Personenzentrierter Ansatz 5.7.1 Theoretischer Hintergrund Der personenzentrierte Ansatz wurde von Tom Kitwood, einem englischen Sozialpsychologen, in den Jahren 1987 bis 1995 entwickelt. Da sich dieses Konzept auf ein etwas anderes theoretisches Modell stützt als die vorgenanntenKonzepte, sollen zuerst die zentralen Aussagen Kitwoods vorgestellt werden. Im Mittelpunkt seiner Überlegungen steht ganz eindeutig der demente Mensch als Person. Im Gegensatz zu vielen anderenKonzepten ist Kitwoods Auffassung einer optimalen Betreuung weniger vom Versuch beherrscht, in irgendeiner Weise auf den Betreuten einzuwirken. Optimale Betreuung in seinem Sinne zeigt eher die Tendenz, das komplette "Rundherum", insbesondere die Pflegebeziehung, so auf den Betreuten auszurichten, dass dieser möglichst wenig durch sein "Betreutwerden" beeinträchtigt und das Wohlbefinden der Betreuten und der Betreuenden gesteigert wird. Das Konzept baut auf drei Hauptaussagen auf, die im Folgenden erläutert werden. 1) Depersonalisierung als Abwehrmechanismus Hauptthema im personenzentrierten Ansatz Kitwoods ist das "Personsein": "Es ist ein Stand oder Status, der dem einzelnen Menschen im Kontext von Beziehung und sozialem Sein von anderen verliehen wird. Er impliziert Anerkennung, Respekt und Vertrauen." (Kitwood, 2000, S. 27). Nach Kitwood hat sich heute infolge des Einflusses der Individualisierung das Personsein auf zwei Kriterien reduziert: Autonomie und Rationalität. Menschen, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden aus dem Kreis der "Personen" ausgeschlossen. Das betrifft insbesondere Menschen mit seelischen oder schweren körperlichen Behinderungen, zu denen in besonderem Maße gerade Demenzerkrankte gehören. Noch dazu sind demente Menschen alte Menschen, die von vornherein als gesellschaftliche Last gelten, abgewertet werden und Diskriminierungen ausgesetzt sind. Dies führt dazu, dass sie sehr rigoros aus dem Kreis der "Personen" ausgeschlossen werden, ein Vorgang, den Kitwood als Depersonalisierung bezeichnet (vgl. Kitwood, 2000, S. 25-34). In diesem Zusammenhang spielt die Tatsache, dass "Demenz" ein Angstthema ist, welches unzureichend geschulte Betreuer zu inadäquaten Verhaltensweisen veranlassen kann, eine große Rolle. Zweierlei Ängste können vom Thema Demenz ausgelöst werden: Erstens die Angst vor Gebrechlichkeit und damit verbundener Abhängigkeit, vor einem langen Sterbeprozess und allgemein vor dem Tod. Zweitens die Angst vor geistiger Instabilität, vor dem Wahnsinnigwerden (vgl. Kitwood, 2000, S. 34). Diese Ängste fördern in Verbindung mit dem Wissen, dass jeder an Demenz erkranken kann und dass die Zahl der Neuerkrankungen zunimmt, spezifische Abwehrreaktionen, die einer dementengerechten Betreuung abträglich sind. Diese Abwehrreaktion (Depersonalisierung) bedeutet, dass die Betroffenen nicht mehr als "Personen" gesehen und damit aus der Wahrnehmung ausgeblendet werden. Sie erscheinen dann nicht mehr als dem eigenen Personenkreis zugehörig, was die Bedrohung durch die Krankheit Demenz subjektiv reduziert. Kitwood nennt solche entpersonalisierenden Tendenzen im Pflegealltag "maligne, bösartige Sozialpsychologie". Aufgrund von dokumentierten Vorkommnissen im Pflegealltag ordnet er solche Verhaltensweisen in 17 verschiedene Kategorien ein, zu denen beispielsweise zählt: · das Einschüchtern: "durch Drohungen oder körperliche Gewalt bei jemanden Furcht hervorrufen." (Kitwood, 2000, S. 75). · das Entwerten: "die subjektive Realität des Erlebens und vor allem die Gefühle einer Person nicht anerkennen." (Kitwood, 2000, S. 76). · das Ignorieren: "in jemandes Anwesenheit einfach in einer Unterhaltung oder Handlung fortfahren, als sei der bzw. die Betreffende nicht vorhanden." (Kitwood, 2000, S. 76). Mit der Depersonalisierung geht meistens eine Vernachlässigung einher: "Belege aus vielen Studien zeigen, dass Menschen mit Demenz in Heimpflege typischerweise sehr lange Zeiten ohne menschlichen Kontakt zubringen." (Kitwood, 2000, S.79). Eine Studie von Tessa Perrin (1997) belegt beispielsweise, dass demente Menschen in stationären Einrichtungen etwa 50% des Tages ohne direkten menschlichen Kontakt zubringen und Interaktionen überwiegend sehr kurz und oberflächlich sind (vgl. Perrin, 1997, S. 937f.). 2) Standardparadigma Unter Standardparadigma versteht Kitwood "das gesamte Rahmenwerk, in das Forschungsergebnisse gewöhnlich eingeordnet werden" (Kitwood, 2000, S. 63) und das von der Psychiatrie und anderen wissenschaftlichen Disziplinen in Bezug auf Neuropathologie, Biochemie und Genetik der Demenz geschaffen wurde. Kitwood kritisiert vor allem, dass im allgemeinen nur neurologische, nicht aber auch sozialpsychologische Veränderungen beleuchtet werden. So beinhaltet die Stadieneinteilung für den Schweregrad von Demenz zwangsläufig eine Verschlechterung aufgrund neuropathologischer Befunde, obwohl nicht unbedingt ein Zusammenhang zwischen Symptomen einer Demenz und neuropathologischen Veränderungen bestehen muss. "Es können beträchtliche neuropathologische Zustände ohne Demenz vorliegen, und es kann eine Demenz ohne signifikante Neuropathologie bestehen." (Kitwood, 2000, S.61). Vor allem beanstandet Kitwood, dass dabei die Einzigartigkeit der Person, nämlich wie sich Demenz individuell äußert, verschleiert wird. Er geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er die Möglichkeiten, Demenz zu diagnostizieren, prinzipiell in Frage stellt. Seiner Ansicht nach kann mit den bestehenden Diagnosemethoden gar keine klare Diagnose gestellt werden. Zur Diagnostik eingesetzte Tests, wie z.B. der MMSE, geben lediglich Auskunft über die kognitive Leistungsfähigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt (vgl. Kitwood, 2000, S. 42-52). Problematische Merkmale des Standardparadigmas entstehen aus der technischen Herangehensweise, bei der nicht die Person mit Demenz im Mittelpunkt steht, sondern das Krankheitsbild. Gefördert wird hierdurch eine negative, deterministische Sichtweise, nach der eine Verbesserung nur durch einen medizinischen Durchbruch erzielt werden kann und der Beitrag des Pflegeprozesses und die Qualität der Betreuung zweitrangig wird. Eine ähnliche Problematik erwächst nach Kitwood aus den geltenden Vorstellungen über die organische Grundlage von Demenz. Die Theorie der Verursachung (genetische Grundursache) ist seiner Meinung nach unsolide: "In gewissem Sinne ‚verursachen' Gene nichts; sie sind einfach nur ein Hintergrund, vor dem andere Ursachen operieren." (Kitwood, 2000, S. 62). Kitwood geht davon aus, dass alle Ereignisse im Erleben einer Person ihr Gegenstück in der Hirnaktivität haben und dass der Prozess der Demenz daher ein dialektisches Wechselspiel zwischen Faktoren der Neuropathologie und solchen der Sozialpsychologie ist. Während die neurologische Beeinträchtigung und die "maligne, bösartige Sozialpsychologie" das Personsein untergraben, kann seiner Meinung nach gute Pflege eine bessere Nervenfunktion fördern und eventuell sogar eine Nervenregeneration ermöglichen (vgl. Kitwood, 2000, S. 79-84). Medizinische Forschungsergebnisse belegen Kitwoods These, dass die Pflegepraxis, beziehungsweise das psychosoziale Umfeld, das neuronale Wachstum beeinflussen kann. Zu diesen Ergebnissen kommen u.a. Forschungsgruppen aus Schweden, wie Karlsson et al. (1988) oder Brane et al. (1989) (vgl. Kitwood, 2000, S. 96). 3) Organisationsstil Neben dem "Standardparadigma" trägt auch die Struktur der "für- und versorgenden Organisationen" dazu bei, die depersonalisierenden Tendenzen in der Demenzpflege zu untermauern. Kitwood geht davon aus, dass die Situation der Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung einen großen Einfluss auf die Situation der Betreuten hat. "Werden Angestellte alleingelassen und mißbraucht, so werden es die Klienten vielleicht auch." (Kitwood, 2000, S. 151). Die Arbeitssituation wird stark von der Struktur und dem Stil der versorgenden Organisation geprägt. Weist die Organisation ein hohes Machtgefälle zwischen den unterschiedlichen Mitarbeitergruppen (Manager, leitende Pflegekräfte, Pflegepersonal) auf, so wirkt sich diese stark hierarchische Struktur auf die zu Betreuenden, die den niedrigsten Status innehaben, aus. "Diese Unterteilungen erzeugen eine Schranke zwischen dem Personal und den Klienten, welche leicht zu Fremden oder Unpersonen gemacht werden." (Kitwood, 2000, S. 153). Eine solche Organisationsstruktur behindert eine befriedigende Kommunikation sowohl unter den Mitarbeitern als auch zwischen dem Pflegepersonal und den dementen Personen. Die Kommunikation kann lediglich auf einem unpersönlichen, emotionslosen Weg ablaufen und demenztypisches Problemverhalten wird nicht als Kommunikationsversuch oder Ausdruck unbefriedigter Bedürfnisse gesehen, sondern rein technisch, in Form der medikamentösen Therapie, behandelt (vgl. Kitwood, 2000, S. 152-155). Ein weiterer Faktor, der die Arbeitssituation von Betreuungspersonen in der Demenzpflege beeinflusst, bildet die Unterstützung der Mitarbeiter durch organisatorische Maßnahmen. Dazu gehören nach Kitwood u.a. eine angemessene Bezahlung, eine gute Einarbeitung, das Angebot von Supervision und Fortbildungen, die Förderung der Teamarbeit, die Möglichkeit der beruflichen Beförderung und eine effiziente Qualitätssicherung in der Pflegeplanung, d.h. Pflegekräfte sollen an der Pflegeplanung und -weiterentwicklung mitwirken (vgl. Kitwood, 2000, S. 159-163). Das Fehlen von Unterstützungsmaßnahmen dieser Art hat negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden der betreuenden Personen. Die Arbeit wird als belastender wahrgenommen, und die Arbeitszufriedenheit ist insgesamt gering. In diesem Zusammenhang steigt die Gefahr des Burn-out. "In der Praxistradition, die wir geerbt haben, in der das Personal bei seiner Arbeit sehr wenig Unterstützung und Hilfe bekam, war die Mehrzahl derer, die dies überlebt haben, möglicherweise in einen chronischen Zustand des Burn-out auf niedrigem Level gelangt." (Kitwood, 2000, S. 158). Diese Problematik hat zur Folge, dass die unbefriedigende Situation der Mitarbeiter Auswirkungen auf das Wohlbefinden der dementen Personen hat. Aus Gründen des Selbstschutzes vor Arbeitsüberforderung wird die Betreuung Demenzerkrankter auf ein Minimum reduziert, d.h. die Versorgung beschränkt sich im Wesentlichen auf die Körperpflege und die Befriedigung von Grundbedürfnissen, wie z.B. Ernährung und Kleidung (vgl. Kitwood, 2000, S. 156-159). Vor diesem Hintergrund können leicht depersonalisierende Tendenzen in den Pflegealltag integriert und durch die "kollektive Anwendung" des Pflegepersonals besonders verfestigt werden. Aus den genannten Aspekten resultiert eine Pflegepraxis, die Kitwood als "alte Pflegekultur", "eine Kultur des Sich-Abwendens und der Entfremdung" (Kitwood, 2000, S. 196) bezeichnet. Dieser Begriff steht für eine inadäquate Betreuung dementer Menschen, die das Personsein ignoriert und das Wohlbefinden sowohl der Betreuten als auch der Betreuenden negativ beeinflusst. 5.7.2 Personenzentrierte Pflege Kitwood stellt die Hypothese auf, dass eine personenzentrierte Pflege den Prozess einer Demenzerkrankung positiv beeinflussen kann. "In einem optimalen Kontext von Pflege und Fürsorge wird jedes Fortschreiten der neurologischen Beeinträchtigung ... , das bei einer nichtunterstützenden Sozialpsychologie potentiell extrem schädigend sein kann, durch positive Arbeit an der Person ... kompensiert." (Kitwood, 2000, S. 103). Der Erhalt des Personseins stellt für ihn das oberste Ziel einer qualitativ hochwertigen Demenzpflege dar. Eine Grundvoraussetzung dafür ist die Befriedigung von Bedürfnissen dementer Menschen, da "ein Mensch ohne dessen Befriedigung nicht einmal minimal als Person funktionieren kann." (Kitwood, 2000, S. 121). Unter die demenzspezifischen Bedürfnisse fasst er eine Gruppe von Bedürfnissen, die sich nicht klar voneinander trennen lassen, sondern kooperativ funktionieren. Das Bedürfnis nach Liebe stellt dabei ein allumfassendes Bedürfnis dar, welches von dementen Menschen deutlich zum Ausdruck gebracht wird. Demenzerkrankte zeigen "oft ein unverhülltes und beinahe kindliches Verlangen nach Liebe." (Kitwood, 2000, S. 121). Ein zweites Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Trost, das infolge von starken Verlusten, z.B. der Verlust von Fähigkeiten oder des bisherigen Lebensstils, bei dementen Menschen besonders stark ausgeprägt ist. Die Demenzerkrankung löst außerdem Gefühle der Angst und der Unsicherheit bei der betroffenen Person aus. Um ein Sicherheitsgefühl zu erhalten, ist das Bedürfnis nach einer primären Bindung bedeutend. Als viertes Bedürfnis nennt Kitwood das Bedürfnis nach Einbeziehung. Darunter versteht er das Bestreben der dementen Person, sich als Teil einer Gruppe zu fühlen, das sich z.B. in "aufmerksamkeitheischendem Verhalten", wie Unruhe oder Schreien, äußert. Ein weiteres Bedürfnis ist das nach Beschäftigung, d.h. danach, etwas Sinnvolles zu tun, "eine Art von Projekt zu haben." (Kitwood, 2000, S. 124). Ausdruck findet dieses Bedürfnis beispielsweise in Form von Hilfsbereitschaft oder Aktivität der dementen Menschen. Das sechste Bedürfnis dementer Menschen ist das nach Identität. Durch die Krankheit Demenz wird das Identitätsgefühl stark bedroht, so dass der Wunsch nach identitätserhaltenden Maßnahmen besonders ausgeprägt ist. Die Befriedigung der genannten Bedürfnisse ermöglicht es dem dementen Menschen, sich als Person wahrzunehmen und positive Gefühle (sich wertvoll und geschätzt zu fühlen) zu erleben (vgl. Kitwood, 2000, S. 121-125). Laut Kitwood hängt die Pflegequalität in der Demenzbetreuung primär von der Qualität der Pflegebeziehung und der Interaktionsfähigkeit des Pflegepersonals ab. Positive Interaktion ist in seinen Augen "die wahrhaft heilende Komponente der Pflege." (Kitwood, 2000, S. 195). Kitwood führt unterschiedliche Arten der positiven Interaktion auf, die im Folgenden dargestellt werden (vgl. Kitwood, 2000, S. 133-137): · Anerkennen: Der demente Mensch wird als Person anerkannt, dies kann verbal (z.B. jemanden grüßen) oder nonverbal (z.B. durch Blickkontakt) zum Ausdruck gebracht werden. · Verhandeln: Der demente Mensch wird direkt nach seinen Wünschen und Bedürfnissen gefragt und diese werden im Betreuungsalltag berücksichtigt. · Zusammenarbeiten: Der demente Mensch erhält die Möglichkeit, sich aktiv an der Pflege und Alltagsbeschäftigungen zu beteiligen (z.B. Haushaltsarbeiten, Körperpflege). · Spielen: Der demente Mensch hat die Möglichkeit, an nicht zielgerichteten Aktivitäten teilzunehmen, die die Spontaneität und den Selbstausdruck fördern. · Timalation: Interaktionen mit Hilfe von Aktivitäten, welche die Sinne ansprechen (z.B. Massage, Aromatherapie). · Feiern: Interaktion, bei der in geselliger Stimmung ein Gefühl der Nähe und Gleichheit zwischen Betreuten und Betreuern aufkommt. · Entspannen: Demente Menschen können oft nur in Gesellschaft oder bei Körperkontakt entspannen. Drei weitere Interaktionsformen sind psychotherapeutisch ausgerichtet. Dazu zählen: · Validation: Die subjektive Realität und die Gefühle einer Person werden anerkannt und die Kommunikation findet auf der Gefühlsebene statt. · Halten: Das Schaffen einer Atmosphäre, die einer Person den Halt und die Sicherheit bietet, auch negative Emotionen auszudrücken. · Erleichtern: Handlungen einer dementen Person unterstützen, aber nur soweit, wie es notwendig ist. Die folgenden Interaktionsarten sind Beispiele für Interaktionen, die von dem dementen Menschen ausgehen: · Schöpferisch sein: Die demente Person bietet spontan eine Interaktion an (z.B. singen, tanzen). · Geben: Die demente Person bringt ihre persönliche Beziehung zu einer Betreuungskraft zum Ausdruck (z.B. Zuneigung, Dankbarkeit). Die Umsetzung der oben genannten positiven Interaktionsarten hängt überwiegend von den äußeren Arbeitsbedingungen der versorgenden Organisation, welche das Wohlbefinden der Pflegekraft beeinflussen (siehe oben) und von der Person selbst ab. Kitwood ist der Auffassung, dass nicht jeder für die Betreuung dementer Menschen geeignet ist. Das wichtigste Kriterium stellt für ihn die grundlegende Einstellung und Haltung einer Person dar. Des weiteren spielt die Interaktionsfähigkeit einer Pflegeperson eine entscheidende Rolle. Diese ist stark von der Fähigkeit der Person geprägt, dem Betreuten "freie Aufmerksamkeit" zu schenken, d.h. "für eine andere Person ohne Ablenkung von außen und Störung von innen präsent zu sein und den anderen mit weitaus weniger Verzerrung, Projektionen und von Vorurteilen getragenen Reaktionen, wie sie echte Begegnungen oft hemmen, wahrzunehmen." (Kitwood, 2000, S. 172). Dies kann erst dann gelingen, wenn eine Auseinandersetzung mit den eigenen emotionalen Belastungen und dem eigenen Lebenskonzept, worunter er die Entwicklung von Verhaltensmustern seit der Kindheit fasst, stattgefunden hat. Außerdem muss sich die Betreuungsperson selbst wohlfühlen, offen und flexibel sein und nicht als "kontrollierend-kritisches Elternteil" gegenüber dem dementen Menschen agieren (Kitwood, 2000, S. 174). Die Fähigkeit zur Empathie gehört ebenfalls zu den Voraussetzungen einer positiven Interaktion. Empathie bedeutet für Kitwood nicht die Fähigkeit, das zu fühlen, was eine andere Person fühlt, sondern ein Verständnis für das Erleben und Leben eines dementen Menschen zu haben. Das Bewusstsein von eigenen demenzartigen Erfahrungen, wie z.B. das Gefühl des Verlassenseins oder der Machtlosigkeit, erleichtern es der Pflegekraft, die Gefühle einer dementen Person zu verstehen. Der von Kitwood entwickelte Ansatz der personenzentrierten Pflege stellt die Einzigartigkeit der Person in den Mittelpunkt, und der Erhalt und die Stärkung des Personseins ist sein oberstes Ziel in der Betreuung dementer Menschen. Die aus diesem Konzept resultierende Grundhaltung gegenüber Demenz und dementen Menschen und die "positive Arbeit an der Person" bilden die Basis für den Wandel der "alten" in eine "neue" Pflegekultur (vgl. Kap. 6.1). Ein weiterer elementarer Bestandteil des personenzentrierten Ansatzes ist das von Kitwood entwickelte Dementia Care Mapping-Verfahren. 5.7.3 Dementia Care Mapping Das Verfahren des "Dementia Care Mapping" (DCM) wurde von Tom Kitwood und einer Arbeitsgruppe zur Qualitätssicherung in der Demenzpflege an der Universität Bradford entwickelt. Es bestimmt anhand standardisierter Parameter das relative Wohlbefinden, bzw. das Unwohlsein Demenzerkrankter, da sich diese Personen darüber selbst nicht gut äußern können. DCM dient "diesem Personenkreis sozusagen als Sprachrohr" (Strunk-Richter, 2001). Dabei soll der Pflegeprozess möglichst detailliert erfasst und eine "landkartenähnliche Darstellung des Verhaltens von Menschen mit Demenz" (Strunk-Richter, 2001) erstellt werden. Die gesammelten Daten geben dann Auskunft über Wohlbefinden und Zufriedenheit der dementen Menschen. Anwendung findet dieses Verfahren in stationären und teilstationären Einrichtungen der Altenhilfe. Als Evaluierungsinstrument der Pflegepraxis dient es einerseits dazu, den Ist-Zustand festzustellen, es eignet sich bei wiederholtem Einsatz andererseits aber auch sehr gut dazu, Änderungen zu dokumentieren und zu evaluieren (vgl. Strunk-Richter, 2001). Ziel des DCM ist die Steigerung des Wohlbefindens dementer Menschen durch die Verbesserung der Pflegequalität, da die Messung durch ihre Möglichkeit, den Pflegeprozess gezielt und kontinuierlich zu beobachten, Anhaltspunkte gibt, wie die Pflege verbessert werden kann. Dahinter steht die Grundhypothese, dass Pflegequalität über das Wohlbefinden der Betreuten indirekt gemessen werden kann. "Wenn es dem Menschen mit Demenz relativ gut geht, dann ist dies ein wesentliches Kriterium für eine gute Pflegequalität." (Müller-Hergl, 2001b) Personen, die DCM durchführen, werden "Mapper" (Abbildner) genannt. Sie beobachten eine demente Person, bzw. Personen und den Pflegeablauf in einer Einrichtung der Altenhilfe kontinuierlich für mindestens sechs Stunden. Als Mapper kommen Personen mit unterschiedlicher Ausbildung, z.B. Pflegekräfte (jedoch nicht von der Einrichtung, die "gemappt" wird), in Frage. Sie sollten die formale Qualifikation zum Mapper durch Ausbildung bzw. Schulung erlangt haben, als noch wichtiger wird aber "Kommunikationsfähigkeit, Gruppengespür, Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen" erachtet, denn "wenn die Mapper sich nicht um die Pflegenden kümmern, dann kümmern sich die Pflegenden auch nicht um die Daten des Mappers." (Müller-Hergl, 2001b). Praktische Anwendung Alle fünf Minuten wird das Verhalten der beobachteten Personen (jede Person separat) vom Mapper nach einem bestimmten System kodiert. Dieses Kodierungssystem umfasst 24 Kategorien, die Wohlbefinden oder Unwohlsein spiegeln, wie beispielsweise · C (cool): Sozial unbeteiligt, in sich gekehrt · E (expression): Kreativ beschäftigt, Selbstausdruck · L (labour): Mitarbeiten · U (unresponded to): Kommunikationsversuch ohne Antwort Jeder Verhaltenskategorie wird ein Wert (+5, +3, +1, -1, -3, -5) zugeordnet, wobei der Wert +5 ein hohes Wohlbefinden und der Wert -5 ein hohes Unwohlsein ausdrückt Ergänzt wird die Datensammlung durch Beobachtungen von "Personal Detractions", d.h. Verhaltensweisen von Betreuungspersonen, die das Personsein eines dementen Menschen untergraben und sich negativ auf dessen Wohlbefinden auswirken. Diese entsprechen den 17 depersonalisierenden Tendenzen, die in Kapitel 5.7.1 näher erläutert wurden. Sie werden vom Mapper bewertet (mild, mäßig, schwer, sehr schwer) und notiert. Daneben werden auch besonders positive Ereignisse (z.B. Interaktionen, die das Wohlbefinden sichtbar steigern) schriftlich festgehalten (vgl. Strunk-Richter, 2001). Aus den so gesammelten Daten werden verschiedene Summenwerte errechnet. Für jede Einzelperson ein "individual care score", für die beobachtete Gruppe ein "group care score" und ein Quotient für die Demenzpflege (DCQ), der die Pflegebeziehung zwischen Betreuten und Betreuern abbildet (vgl. Perrin, 1997, S. 935). "Die Analyse der Daten ist wie ein Fingerabdruck: Stärken und Schwächen im Prozess werden offenbar, Bevorzugungen bestimmter Bewohner oder Vernachlässigung anderer manifest, der Erfolg von Maßnahmen wird transparent und der Zusammenhang von Tagesstruktur und Wohlbefinden analysierbar." (Müller-Hergl, 2001b). Zusätzlich erfolgt ein Feedbackgespräch, in dem die Messergebnisse dem Pflegeteam mitgeteilt werden und ein Handlungsplan, der Strategien zur Optimierung der Pflegequalität beinhaltet, gemeinsam erarbeitet wird. Nach einem gewissen Zeitabstand soll ein erneutes Mappen erfolgen, um die Entwicklungsziele zu überprüfen. Außerdem soll ein DCM-Verfahren durch einen dreitägigen Lehrgang für Betreuungspersonen ergänzt werden (vgl. Müller-Hergl, 2001b). Während DCM in England weit verbreitet ist, beginnt die Einführung in Deutschland nur zögerlich. Momentan wird ein Bundesmodellprojekt zur Verbesserung der Situation Demenzkranker in Pflegeheimen durchgeführt. In diesem drei Jahre dauernden Projekt soll die Anwendung von DCM, die praktische Erprobung und Analyse des Verfahrens erfolgen. Das Projekt startete im Januar 2002 im Landkreis Marburg-Biedenkopf und dem Main-Kinzig Kreis und soll später in den Städten Aachen, Münster und Brandenburg zur Anwendung kommen (vgl. Kap. 6.2). 5.8 Kritische Betrachtung der Betreuungskonzepte In diesem Kapitel sollen die vorgestellten Betreuungskonzepte hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Unterschiede betrachtet werden. Dies soll aus verschiedenen Blickwinkeln geschehen. Zum einen soll dargestellt werden, welche Effekte bestimmte Betreuungskonzepte in Bezug auf demente Menschen erzielen. Zum anderen soll gezeigt werden, welche Rolle der betreuenden Person in bestimmtenKonzepten zukommt. Außerdem soll die praktische Umsetzbarkeit einzelnerKonzepte bewertet werden. 5.8.1 Betreuungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf demente Menschen Grundsätzlich lassen sich die Ziele der Betreuungsmaßnahmen, wie sie in den verschiedenen theoretischen Betreuungskonzepten postuliert werden, zwei Gruppen zuordnen. Auf der einen Seite steht das Lager der "Interventionisten". Ihre Betreuungskonzepte bauen darauf, durch gezielte Maßnahmen auf Defizite und Ressourcen des dementen Menschen einzuwirken und somit das Wohlbefinden dieses Personenkreises zu bewahren, bzw. zu steigern. Diese Form der Demenzpflege steht für eine "dementengerechte Betreuung". Auf der anderen Seite steht das Lager der "Interagierenden". Ihre Betreuungskonzepte verfolgen das Ziel, durch spezielle Interaktionen primär auf das Wohlbefinden des dementen Menschen einzuwirken. Das Wohlbefinden wirkt sich dann im zweiten Schritt positiv auf Symptome der Demenzerkrankung aus. Bei der Demenzpflege nach "interagierenden"Konzepten handelt es sich also eher um eine "demenzgerechte Begleitung". Zu den "Interventionisten" zählen meiner Einschätzung nach die das Realitätsorientierungstraining, die Milieutherapie, die Selbst-Erhaltungs-Therapie und die Biographiearbeit. Realitätsorientierungstraining Auf das Ziel, kognitive Fähigkeiten zu steigern und Orientierung (zeitliche, personelle, örtliche) zu verbessern wirkt die Intervention "orientierungsunterstützende Maßnahmen" (vgl. Kap. 5.1) hin. Das ROT war im Prinzip der erste klare Versuch der positiven Interaktion mit dementen Menschen und Ausdruck dafür, "daß es die Mühe lohnt zu versuchen, sie zu einer 'normalen' Lebensweise zurückzuführen" (Kitwood, 2000, S. 87). Mit der Entwicklung des ROT wird erstmals die Einzelperson mit Demenz berücksichtigt und nicht nur die Krankheit Demenz gesehen. Nachteile sind, dass es leicht zur Überforderung der Demenzerkrankten kommen kann, wenn sie mit Zwang aus ihrer subjektiven Realität herausgerissen und mit ihren Defiziten konfrontiert werden. Unter anderem ist das ROT aus diesem Grund recht umstritten. Forschungsergebnisse zeigen letztlich kaum positive Auswirkungen des ROT. J. T. Dietch führt aus, dass positive Effekte lediglich in Form einer gesteigerten verbalen Orientierung nachzuweisen sind (vgl. Dietch, 1989, S. 974). "For those patients with dementia, the constant relearning of the material necessary to remain oriented is a difficult task that can lead to frustration, anxiety, depression, and a lowering of selfesteem." (Dietch, 1989, S. 974). M. People fand in einem Vergleich der Auswirkungen von ROT und Validation in einem Pflegeheim weder positive noch negative Auswirkungen durch die Anwendung von ROT (vgl. Feil 2000, S. 41). Naomi Feil beschreibt negative Erfahrungen bei der Anwendung des ROT: "Ich gab das Ziel der Orientierung auf die Realität auf, als ich bemerkte, daß die Gruppenmitglieder sich immer dann zurückzogen oder zunehmend feindselig wurden, wenn ich sie mit der unerträglichen Realität der Gegenwart zu konfrontieren versuchte." (Feil, 2000, S. 9) Heute findet das ROT als alleiniges Konzept kaum noch Anwendung, da der korrigierende Ansatz sich auf den dementen Menschen belastend auswirkt (vgl. Baier, 2001, S. 392). Milieutherapie Ziel der Milieutherapie ist die Kompensation von Defiziten durch die Intervention "Umweltanpassung" (soziales Milieu, Tagesstrukturierung, räumliches Milieu). Dabei wird die Umgebung der Demenzerkrankten entsprechend ihrer Defizite und Ressourcen gestaltet. Die Milieutherapie stellt ein sehr umfassendes Konzept dar, welches viele Teilaspekte der Demenz und des Individuums (biographieorientiert, kompetenzorientiert) berücksichtigt. Negativ kann der primär defizitäre Ansatz eingestuft werden, der an der eingeschränkten Umweltkompetenz ansetzt. Somit richtet sich das Augenmerk vor allem auf das, was der Betroffene nicht mehr kann und nicht auf die Fähigkeiten, die ihm noch erhalten geblieben sind, was meiner Ansicht nach genau umgekehrt sein sollte. Die Milieutherapie ist in der praktischen Umsetzung oft nur ein Bestandteil in der Betreuung dementer Menschen, das bedeutet, dass oft nur Teilbereiche der Milieutherapie in der Praxis berücksichtigt werden. Für Untersuchungsergebnisse hat dies zur Folge, dass oft keine genauen Rückschlüsse auf die ursächliche Wirkung der Milieutherapie hinsichtlich des Wohlbefindens der Demenzerkrankten gezogen werden kann. So ist im Projekt "Seniorenheim Polle" und im "Hamburger Modellprojekt" die Milieutherapie jeweils Teil des Gesamtkonzepts. In beiden Projekten wird eine allgemeine Steigerung des Wohlbefindens der Betreuten beschrieben, der Anteil der Milieutherapie an diesem Effekt ist aber nicht genau definierbar. Direkte Studien zur Milieutherapie belegen aber deren positive Auswirkungen (mehr Aktivität, Kommunikation, weniger Unruhe, "Katastrophenreaktionen") (Heeg, 2001, S. 110). Wenige Studien untersuchten die Auswirkungen des architektonisch-baulichen Milieus. Es konnte aber der positive Effekt von Orientierungshilfen und "Szenarien mit Aufforderungscharakter", wie z.B. Speisesaalmöblierung (positive Auswirkung auf Kommunikation und Essverhalten) oder "dementengerechte" Beleuchtung (stimmungsaufhellend, aggressionsdämpfend) gezeigt werden (Wojnar, 2001c, S. 156f.). Selbst-Erhaltungs-Therapie und Biographiearbeit Ziel beiderKonzepte ist es, die Identität, die durch die Erkrankung Demenz bedroht ist, zu erhalten. Dazu werden sogenannte "identitätsstabilisierende" Interventionen eingesetzt, welche das Erhalten des personalen Selbst anstreben. BeidenKonzepten ist gemeinsam, dass man sie als ressourcenorientierte Ansätze einstufen kann, wobei ein zentraler Aspekt die Stützung des Langzeitgedächtnisses ist. Insgesamt gesehen steht bei beiden Modellen, die jeweils einen sehr umfassenden Ansatz darstellen, das Individuum im Mittelpunkt. Als negativ kann sich die Konfrontation der Betroffenen mit der Vergangenheit auswirken, da hieraus eine Überforderung resultieren kann. Ähnliches gilt auch für die zur SET gehörende Konfrontation mit der Diagnose "Demenz", da die Auswirkung dieses Vorgehens schwer kalkulierbar und sehr stark von der Einfühlsamkeit des Anwenders abhängig ist. Zusätzlich wird bei der SET eine eher "künstliche" Atmosphäre, besonders durch die Verwendung von Videoaufnahmen, geschaffen. Die Effektivität beiderKonzepte ist stark sympathieabhängig, da die Betreuten über sich selbst erzählen sollen und sie bedürfen intensiver Unterstützung durch die Angehörigen, insbesondere bei Demenzerkrankten im fortgeschrittenen Stadium. Zur Evaluation der SET liegen noch keine kontrolliert durchgeführten Studien vor. Es gibt aber den Zwischenbericht einer Studie, in der die Erfahrungen beim stationären Einsatz der SET veröffentlicht wurden. In dieser Untersuchung wurde die unmittelbare Wirkung von durchgeführten Behandlungen durch eine Erhebung vor Beginn der Behandlung und vor der Entlassung (ca. 3 Wochen Zeitintervall) ermittelt. Es wird über eine signifikante Verbesserung der Stimmung, signifikante Reduktion der Depressivität und Abnahme von Verhaltensauffälligkeiten (Unruhe, Aggressivität, unkooperatives Verhalten, Antriebsmangel) berichtet. Die Erfahrungen, die im ambulanten Bereich mit der SET gemacht wurden, zeigen einen verlangsamten Krankheitsverlauf, geringere Depressivität und die Zunahme der sozialen und selbständigen Freizeitaktivitäten. Biographiearbeit ist oft Bestandteil andererKonzepte, weshalb es schwierig ist, ihre direkten Auswirkungen zu erfassen. Es zeigen sich aber positive Ergebnisse in Bezug auf die Kommunikationsfähigkeit (vgl. Kitwood, 2000, S. 88). Zu den "interagierenden" Betreuungskonzepten zählen meiner Ansicht nach die Validation, die Integrative Validation und der personenzentrierte Ansatz nach Kitwood. Validation Ziel ist es, demente Menschen beim Lösen von unausgetragenen Konflikten aus ihrer Vergangenheit zu begleiten, damit sie ihren "Seelenfrieden" erlangen können. Dies ist primär eine Unterstützungsaufgabe, da davon ausgegangen wird, dass der demente Mensch weiß, was gut für ihn ist (Weisheit des alten Menschen). Die Interaktionen findet über die direkte Kommunikation, das "InBeziehung-Treten" mit dem Demenzerkrankten, statt. Positive Inhalte sind, dass der demente Mensch ernst genommen wird und sich die Interaktion an der subjektiven Realität und den Bedürfnissen des Einzelnen orientiert. Die Grundhaltung gegenüber dem Betreuten ist geprägt von Achtung, Würde, Empathie, Respekt und Ehrlichkeit. Negativ fällt vor allem das schwache theoretische Gerüst, auf dem das Konzept der Validation aufbaut, ins Gewicht: "Wie bei der Realitätsorientierung fällt es auch bei Feils Arbeit leicht, sie lächerlich zu machen." (Kitwood, 2000, S. 88). Dies betrifft sowohl die einseitige Interpretation von Verhalten und Gefühlen dementer Menschen, als auch die aus psychoanalytischen Modellen entlehnten, in diesem Zusammenhang eher fragwürdigen Interpretationen von Symbolen (z.B.: Socke = Kind, mächtiger Sessel = Penis, Mann, Ehemann, Sex). Einschränkungen erfährt die Validation durch die Definition der Zielgruppe, da nur über 80jährige berücksichtigt werden und auch die abwertende Haltung gegenüber medizinischen Diagnosen erschwert die Akzeptanz der Methode. Zusätzlich wird durch die Einstellung gegenüber der präsenilen Demenz, die nach Feil nicht positiv beeinflusst werden kann, die Größe der Zielgruppe noch einmal reduziert. Obwohl sich das Konzept eigentlich auf das eigenständige Individuum konzentriert und Hilfestellung beim Lösen von "Lebensaufgaben" geben soll, kann es durch die einseitige und einheitliche Interpretation von Desorientierung, Gefühlen und Verhaltensweisen Demenzerkrankter schnell dazu kommen, dass Umweltfaktoren und die aktuelle Situation des dementen Menschen weitestgehend unberücksichtigt bleiben. Die recht strikte Stadieneinteilung unterbindet bei konsequenter Umsetzung ebenfalls den Individualitätsanspruch der Betreuten. Es fehlt außerdem die Förderung von alltagsnahen Kompetenzen und somit der Selbständigkeit. Zur Validation liegen kaum Forschungsergebnisse vor. Einige wenige empirische Untersuchungen berichten über Erfolge durch ihre Anwendung. Naomi Feil beruft sich hauptsächlich auf ihre eigenen Erfahrungen in der praktischen Anwendung von Validation und auf eine von ihr 1971 durchgeführte Untersuchung, die folgende Ergebnisse in Bezug auf desorientierte Menschen hatte: "Sie wurden weniger inkontinent, das störende Verhalten (schreien, schlagen) nahm ab, das positive (lächeln, sprechen, anderen helfen) nahm zu; sie wurden sich ihrer Außenwelt bewusster, sprachen auch außerhalb von Gruppentreffen miteinander und waren zufriedener." (Feil, 2000, S. 40). Feil führt weitere Untersuchungen an, welche die Erfolge der Validation belegen, geht jedoch nicht näher auf einzelne Untersuchungsmethoden ein. Sie nennt unter anderem Stan Alprin (1980), Paul A. Fritz (1986), Jean Prentczynski (1991), James T. Dietch (1989) und Colin Sharp (1989) (vgl. Feil, 2000, S. 40-42). Allerdings sind die überprüften "Studien" methodisch eher zweifelhaft, so besteht beispielsweise die Untersuchung von J. T. Dietch nur aus einem case-report mit drei Beispielen, und die "Schlussfolgerungen" sind äußerst vage formuliert: "Despite positive anecdotal reports, there is still no controlled research assessing the efficacy of VT [Validation Therapy]." (Dietch, 1989, S. 976). Integrative Validation Das Ziel der von Nicole Richard entwickelten IVA ist es, Ressourcen dementer Menschen zu aktivieren, mit ihnen in Kontakt zu treten und die Kommunikation zu fördern. Die Interaktion konzentriert sich daher auf die Anwendung adäquater Kommunikationstechniken. Die IVA, die aus dem Konzept von Naomi Feil weiterentwickelt wurde, ähnelt diesem in vielen Aspekten. Dies betrifft vor allem die Grundhaltung (Ernstnehmen, Wertschätzung, Akzeptieren) gegenüber Demenzerkrankten und den biographieorientierten individuellen Zugang. Das Konzept hebt sich aber meiner Meinung nach durch einige Änderungen sehr positiv von der Validationsmethode nach Feil ab. Grundsätzlich anders ist der Ansatz, der in diesem Fall ressourcenorientiert ist und der Verzicht auf eine strenge Stadieneinteilung, wodurch ein individueller Zugang tatsächlich möglich wird. Die Validation ist sich zwar in beiden Ansätzen sehr ähnlich, bei der IVA wird jedoch im Unterschied zu Feil auf eine ständige Interpretation des Verhaltens vor dem Hintergrund der Biographie verzichtet. Eine deutliche Einschränkung erfährt das Konzept durch den Schwerpunkt auf der Kommunikationstechnik, da es aus diesem Grund nur für Demenzerkrankte im Anfangsstadium geeignet ist, mit denen eine ausreichende verbale Kommunikation möglich ist. Forschungsergebnisse, die nicht von Nicole Richard stammen, sind in der einschlägigen Literatur nicht zu finden. Sie selbst berichtet über positive Erfahrungen, z. B. veränderte Verhaltens- und Äußerungsformen (weniger Stress, kontaktfähiger, zufriedener) (vgl. Richard, 2001a, S. 59). Personenzentrierter Ansatz Die Förderung des Wohlbefindens dementer Menschen durch Erhalt des Personseins ist das Ziel des personenzentrierten Ansatzes, der von Tom Kitwood entwickelt wurde. Die Interaktion dient sowohl der Bedürfnisbefriedigung als auch einer Verbesserung der Pflegebeziehung. Positiv kann bewertet werden, dass in diesem Konzept die einzigartige Person und nicht die Krankheitssymptomatik im Mittelpunkt steht. Trotz einer eher kritischen Einstellung zum "medizinischen Blickwinkel" wird dieser aber nicht grundsätzlich abgelehnt. Zusätzlich ist dieses Konzept das einzige, welches die Erkrankung Demenz auch als gesellschaftliches Problem betrachtet und daher einen sehr umfassenden Ansatz bietet. Als Schwerpunkt lässt sich das "In-Beziehung-Treten" mit einer dementen Person herausstellen, gleichzeitig kann aber als negativ gewertet werden, dass andere Aspekte der Betreuung (z.B. räumliche Gestaltung) kaum angesprochen werden. Nach Kitwood selbst ist der Forschungsstand zum personenzentrierten Ansatz bisher unzureichend. Es gibt jedoch Studien, die positive Auswirkungen der personenzentrierten Pflege belegen. Dazu zählen zum Beispiel Publikationen von Janet Bell und Iain McGregor (1991, 1995), die über Stabilität im Krankheitsverlauf und hohe Grade des Wohlbefindens berichten, sowie eine Untersuchung von Ann Netten (1993), die eine signifikant bessere örtliche Orientiertheit, geringere soziale Gestörtheit und geringere Grade an Apathie fand. Die Bradford Dementia Group wies 1995 in einer Querschnittstudie in 26 Pflegeheimen und 51 Einrichtungen für betreutes Wohnen hohe Grade an Wohlbefinden beim Einsatz dieses Konzepts nach. Karlson et al. (1988) und Brane et al. (1989) konnten signifikant positive Veränderungen bei psychologischen und neurochemischen Variablen nachweisen. Kitwood selbst führte eine retrospektive Studie durch, in der er positive Auswirkungen der personenzentrierten Pflege auf das Wohlbefinden dementer Heimbewohner betont (vgl. Kitwood, 2000, S. 95-98). 5.8.2 Die Rolle der betreuenden Personen Es besteht ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den verschiedenenKonzepten, wenn sie unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, welche Rolle die betreuende Person (und ihr Wohlbefinden) als Voraussetzung für eine adäquate Dementenpflege spielt. So existieren Betreuungskonzepte, die ihre Umsetzung stark an die Betreuungsperson koppeln. DieseKonzepte konzentrieren sich auf den Betreuer, der Wohlbefinden nur an demente Menschen "vermitteln" kann, wenn auch sein eigenes Wohlbefinden berücksichtigt wird. Im Gegensatz dazu stehen die Betreuungskonzepte, in denen die Betreuungsperson eher eine Nebenrolle spielt. DieseKonzepte konzentrieren sich primär auf die Demenzerkrankten, und eine höhere Arbeitszufriedenheit des Personals ist eher ein Nebeneffekt der Umsetzung des Konzepts. Zu denKonzepten, in denen der Betreuer die Hauptrolle zugewiesen bekommt, gehören meines Erachtens die Validation und die personenzentrierte Pflege. Im Prinzip ist bei der Validation die spezielle Technik nachrangig, als wichtig werden vor allem Haltung und Eigenschaften von Validationsanwendern, wie Ehrlichkeit, Respekt vor der "Weisheit der alten Menschen" (Feil, 2000, S. 35), Empathie (in das Leben des anderen schlüpfen) angesehen. Naomi Feil nennt als beste Voraussetzungen des VA beispielsweise, selbst schon demenzähnliche Zustände erlebt zu haben (z.B. Verlusterlebnisse). Für die zentrale Rolle des Betreuers spricht auch, dass Feil ganz klar formuliert, dass nicht jeder als VA geeignet ist. Studien zeigen, dass aus der Anwendung von Validation eine geringere Fluktuation des Personals (vgl. Feil, 2000, S. 41f.) resultiert, was an der prominenten Rolle liegen kann, die dem Pflegepersonal bei diesem Konzept zugewiesen wird. Beim personenzentrierten Ansatz wird von vorneherein als Grundvoraussetzung gefordert, dass sich die Betreuungsperson wohlfühlt und ihr eigenes Lebenskonzept aufgearbeitet hat, um mit dementen Personen eine zwischenmenschliche Beziehung aufbauen und Empathie zeigen zu können. Betont wird außerdem, dass das Wohlbefinden der Mitarbeiter stark von der Unterstützung der "für- und versorgenden Organisation" abhängt (vgl. Kap. 5.7.1). Eine Folge dieser Maßnahmen und Bedingungen ist eine hohe Arbeitszufriedenheit von Betreuern, die nach dem personenzentrierten Ansatz arbeiten. Zu denKonzepten, in denen das betreuende Personal eher die "Nebenrolle" zugeschrieben bekommt, beziehungsweise "Medium" zur Umsetzung des Konzepts ist, gehören meiner Auffassung nach das Realitätsorientierungstraining, die Milieutherapie, und die Selbst-Erhaltungs-Therapie (bzw. die Biographiearbeit). Für die praktische Umsetzung des ROT ist ein sogenanntes Einstellungstraining des Personals ausschlaggebend (vgl. Kap. 5.1). Daraus soll sich eine höhere Arbeitszufriedenheit der Betreuer ergeben. "In fact, one of the original purposes of RO[T] was to give staff a sense of 'doing something' with patients that have bleak futures." (Dietch, 1989, S. 974). Andererseits zielen diese Maßnahmen aber nicht auf den Betreuer direkt ab, sie sollen ihn aber dazu bringen, den Umgang mit den Betreuten zu verbessern. Voraussetzung für die Umsetzung der Milieutherapie ist ein gutes Arbeitsmilieu, da nur so die Schaffung eines dementengerechten Milieus möglich ist. Biographiewissen, räumliches Milieu und Beziehungspflege sind Anforderungen an den Betreuer zur Verbesserung der Pflege. Auf den Betreuer bezogene Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz wie bewältigbare Pflege- und Betreuungsaufgaben, pflegerische Gestaltungsautonomie, fachbezogene Weiterbildung und praxisnahe Fallbesprechung dienen zwar dem Betreuer, ihr Ziel ist aber weniger dessen persönliches Wohlbefinden, sondern eher die Sicherstellung der Arbeitsleistung. Kempe et al. (1992, 1993) beschreiben in diesem Zusammenhang, dass die Arbeit mit Dementen psychisch sehr belastend sei und diese Belastung auf Dauer nicht bewältigt werden könne. Daher müsse die Möglichkeit des Berufswechsels gegeben sein (vgl. Lind, 2001, Kap. 2.2). Dies spricht nicht unbedingt für eine optimale Unterstützung der Mitarbeiter. In der SET ist die Aufgabe des Betreuers die Unterstützung des Betreuten. Im Konzept finden sich keine Aussagen über professionelle SET-Anwender. Arbeitsbedingungen oder Voraussetzungen werden nicht erwähnt. Es wird lediglich bemerkt, dass bei der Einführung von SET in teilstationäre Einrichtungen eine Supervision erfolgen soll. Die IVA stellt gewissermaßen den Mittelweg dar. Einerseits ist die Anwendung von IVA für den Anwender sehr effektiv. Durch die Verbesserung des Umgangs mit dementen Menschen und ein personenbezogeneres Arbeiten kommt er in eine persönlichere, individuelle Beziehung zu den Betreuten, was seinen Stellenwert in der Betreuung erhöht. Für die prominentere Rolle des Betreuers sorgen auch die aus der Validation übernommenen Grundlagen, beispielsweise dass die Grundhaltung zum dementen Menschen wichtig ist. Andererseits berücksichtigt die IVA, insbesondere im Vergleich zur Validation, stärker die konkreten Bedürfnisse der Betreuten. Insgesamt ist die IVA ein sehr teamorientiertes Konzept mit "Werkstattcharakter", d.h. ihre Umsetzung richtet sich nach Ressourcen des Teams und den äußeren Rahmenbedingungen der Einrichtungen (z.B. Förderung der Teamarbeit, Biographiearbeit, Einbindung in Dokumentation, Weiterführung und Begleitung der Mitarbeiter) (vgl. Richard, 2001a, S. 60). Meiner Meinung nach wird dieses Konzept momentan Betreuten und Betreuern gleichermaßen gerecht und bietet eine gute Mischung der Anforderungen für beide Gruppen. 5.8.3 Umsetzbarkeit Zum Schluss soll in aller Kürze herausgestellt werden, wie es um die praktische Umsetzbarkeit der einzelnenKonzepte bestellt ist. Da bei dem ROT das gesamte Personal das Konzept anwenden sollte, ist eine umfangreiche Vorbereitung (Schulung des Personals) unumgänglich. Das stellt für die praktische Umsetzung eine große Hürde dar. Wenig aufwändig ist im Gegensatz dazu das 24-Stunden-ROT (Orientierungshilfen, z.B. große Uhren, Kalender, Namensschilder und "realitätsorientierende Kommunikation" während der normalen Pflege), das bezogen auf Zeit, Personal und Kosten in der Umsetzung sehr sparsam ist. Für die Milieutherapie ist wegen des geforderten Zusammenwirkens aller Umweltkomponenten (Bau, psychosoziales Milieu, Organisation) bei konsequenter Einführung mit einem maximalen Aufwand und maximalen Kosten, besonders durch die baulichen Maßnahmen, zu rechnen. Aus diesem Grund ist eine konzeptgerechte Umsetzung nicht zu erwarten. Die SET fordert das spezialisierteste Personal und ist daher vor allem von Personal bzw. Personalkosten abhängig, zu denen sich Schulungen und Supervision addieren. Ebenso wie bei ROT und Milieutherapie ist die flächendeckende bzw. konzeptgetreue Einführung dieser Betreuungsmaßnahmen momentan wie auch in Zukunft nicht vorstellbar. Im genauen Gegensatz dazu steht die individuelle Validation nach Feil. Sie selbst beschreibt, dass jeder, der geeignet sei, bei seiner Arbeit validieren könne, wenn er mit dementen Menschen in Kontakt kommt. Dies könne auch die Putzfrau sein, die das Zimmer säubert oder der Gärtner, wenn er den Rasen mäht. Dazu kommt, dass der VA nicht von äußeren Ressourcen abhängig sind, mit Ausnahme der Validation in Gruppen. Die Anwendung des Konzepts ist daher zu jedem Zeitpunkt und ohne finanziellen Aufwand möglich. Aufwändiger sind die Integrative Validation und der personenzentrierte Ansatz. Hier dürften Kosten vor allem im Bereich der Ausbildung von Personal anfallen. Positiv ist jedoch, dass dieseKonzepte in einem Heim auch für Teilbereiche eingeführt werden können und dass die Möglichkeit einer stufenweisen Einführung besteht, so dass sich die Umsetzung an die äußeren Gegebenheiten anpassen lässt. BeideKonzepte haben aus diesem Grund meiner Meinung nach die besten Chancen, aus dem Stadium des Modellversuchs herauszukommen und eine weitere Verbreitung zu finden, wie dies beim personenzentrierten Ansatz im Prinzip in England schon der Fall ist.