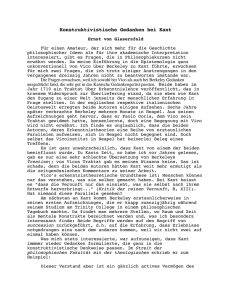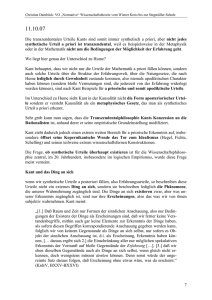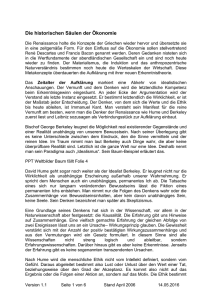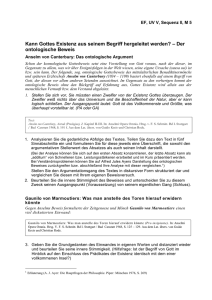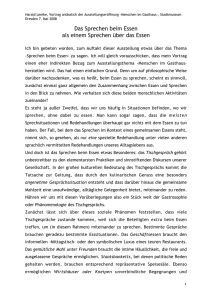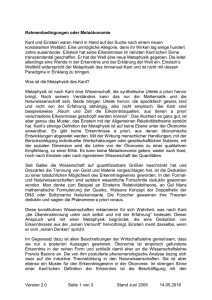Erkenntnisphilosophie
Werbung
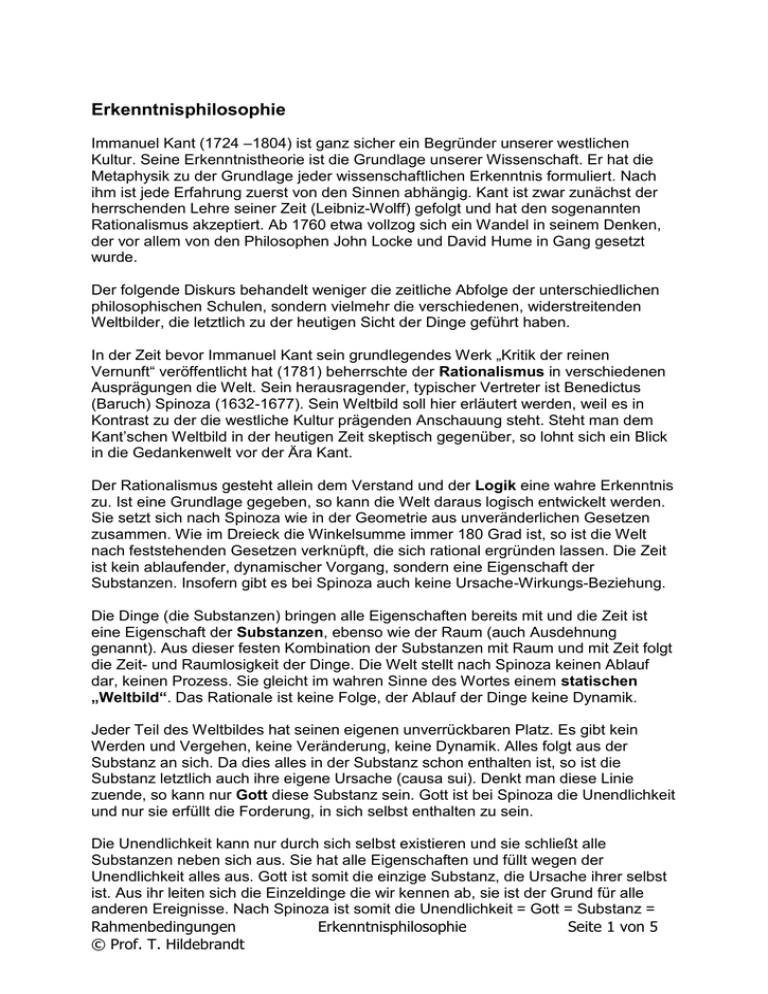
Erkenntnisphilosophie Immanuel Kant (1724 –1804) ist ganz sicher ein Begründer unserer westlichen Kultur. Seine Erkenntnistheorie ist die Grundlage unserer Wissenschaft. Er hat die Metaphysik zu der Grundlage jeder wissenschaftlichen Erkenntnis formuliert. Nach ihm ist jede Erfahrung zuerst von den Sinnen abhängig. Kant ist zwar zunächst der herrschenden Lehre seiner Zeit (Leibniz-Wolff) gefolgt und hat den sogenannten Rationalismus akzeptiert. Ab 1760 etwa vollzog sich ein Wandel in seinem Denken, der vor allem von den Philosophen John Locke und David Hume in Gang gesetzt wurde. Der folgende Diskurs behandelt weniger die zeitliche Abfolge der unterschiedlichen philosophischen Schulen, sondern vielmehr die verschiedenen, widerstreitenden Weltbilder, die letztlich zu der heutigen Sicht der Dinge geführt haben. In der Zeit bevor Immanuel Kant sein grundlegendes Werk „Kritik der reinen Vernunft“ veröffentlicht hat (1781) beherrschte der Rationalismus in verschiedenen Ausprägungen die Welt. Sein herausragender, typischer Vertreter ist Benedictus (Baruch) Spinoza (1632-1677). Sein Weltbild soll hier erläutert werden, weil es in Kontrast zu der die westliche Kultur prägenden Anschauung steht. Steht man dem Kant’schen Weltbild in der heutigen Zeit skeptisch gegenüber, so lohnt sich ein Blick in die Gedankenwelt vor der Ära Kant. Der Rationalismus gesteht allein dem Verstand und der Logik eine wahre Erkenntnis zu. Ist eine Grundlage gegeben, so kann die Welt daraus logisch entwickelt werden. Sie setzt sich nach Spinoza wie in der Geometrie aus unveränderlichen Gesetzen zusammen. Wie im Dreieck die Winkelsumme immer 180 Grad ist, so ist die Welt nach feststehenden Gesetzen verknüpft, die sich rational ergründen lassen. Die Zeit ist kein ablaufender, dynamischer Vorgang, sondern eine Eigenschaft der Substanzen. Insofern gibt es bei Spinoza auch keine Ursache-Wirkungs-Beziehung. Die Dinge (die Substanzen) bringen alle Eigenschaften bereits mit und die Zeit ist eine Eigenschaft der Substanzen, ebenso wie der Raum (auch Ausdehnung genannt). Aus dieser festen Kombination der Substanzen mit Raum und mit Zeit folgt die Zeit- und Raumlosigkeit der Dinge. Die Welt stellt nach Spinoza keinen Ablauf dar, keinen Prozess. Sie gleicht im wahren Sinne des Wortes einem statischen „Weltbild“. Das Rationale ist keine Folge, der Ablauf der Dinge keine Dynamik. Jeder Teil des Weltbildes hat seinen eigenen unverrückbaren Platz. Es gibt kein Werden und Vergehen, keine Veränderung, keine Dynamik. Alles folgt aus der Substanz an sich. Da dies alles in der Substanz schon enthalten ist, so ist die Substanz letztlich auch ihre eigene Ursache (causa sui). Denkt man diese Linie zuende, so kann nur Gott diese Substanz sein. Gott ist bei Spinoza die Unendlichkeit und nur sie erfüllt die Forderung, in sich selbst enthalten zu sein. Die Unendlichkeit kann nur durch sich selbst existieren und sie schließt alle Substanzen neben sich aus. Sie hat alle Eigenschaften und füllt wegen der Unendlichkeit alles aus. Gott ist somit die einzige Substanz, die Ursache ihrer selbst ist. Aus ihr leiten sich die Einzeldinge die wir kennen ab, sie ist der Grund für alle anderen Ereignisse. Nach Spinoza ist somit die Unendlichkeit = Gott = Substanz = Rahmenbedingungen Erkenntnisphilosophie Seite 1 von 5 © Prof. T. Hildebrandt Natur. Die Ur-Substanz ist der Ur-Grund allen Seins und lässt logischerweise neben sich in der Welt keinen Platz mehr für etwas Anderes. Es kann also keinen Gott geben, der die Welt von außen regiert. Gott und die Substanz sind die Welt, sie sind mit ihr identisch. Nicht identisch ist allerdings der Mensch. Er ist eine unvollkommene physische Darstellung eines ewigen in Gott (der Natur) enthaltenen Wesens. Der Mensch ist eine von der Unendlichkeit abstehende, aber nicht abgetrennte Repräsentation der Ur-Substanz. Die unendliche Substanz hat zwei Eigenschaften: Denken und Ausdehnung. Jedes Einzelwesen ist in Gott und hat ebenfalls diese zwei Eigenschaften, nämlich einen Körper als begrenzte Ausdehnung und einen Geist als Träger des Denkens. Beide gehören zusammen und damit behauptet Spinoza, ebenso wie sein Zeitgenosse Descartes, den Dualismus von Körper und Geist. Die Welt ist nach Spinoza untrennbar mit dem Unendlichen verbunden und der Mensch ist der endliche Repräsentant. Das gleiche gilt für das Denken des Menschen innerhalb der Unendlichkeit. Beides sind zwei Seiten ein und desselben Wesens. In Teilen der modernen anthroposophischen Weltbilder findet sich dieses Bild wieder. Das menschliche Handeln ist damit von der Natur gegeben und folgerichtig. Der Schluss, den Spinoza aus alledem zieht, ist jedoch gewagt. Er schließt ebenso wie Descartes aus diesen Erkenntnissen, dass das menschliche Wesen eindeutig und logisch (rational) mit mathematischer Genauigkeit zu beschreiben ist. Dieser Irrtum führt zu einer mechanistischen Weltanschauung, die den gesamten Lauf der Welt berechenbar und steuerbar wie eine Maschine macht. Der Rationalismus wurde von nachfolgenden Philosophen gründlich in Zweifel gezogen. Kant kam auf Teile der rationalistischen Weltanschauung zurück, wollte aber den Dogmatismus seiner Vorgänger nicht gelten lassen. Der Dogmatismus, der mangels einer besseren Erklärung den Beginn des rationalen Denkens dogmatisch als von Gott gegeben festsetzt. Nach Spinoza folgten die Vorreiter Kant’s, die den Empirismus, also die Erfahrung an den Beginn der Erkenntnis setzten. Die Verbindung zum Urgrund hatte durchaus etwas Mystisches und sie gab dem Menschen in dieser Mystik Sicherheit. Die Kommunikation oder der interpersonelle Abgleich der Weltbilder wurde zwar negiert, aber mit dem Ersatz einer Sicherheit durch die Verbindung zur Unendlichkeit. Die nachfolgenden Philosophen haben den Menschen dieser Sicherheit beraubt. David Hume (1711-1776) wird oftmals als Skeptiker bezeichnet, der die Vernunft des Menschen als Quelle der Erkenntnis anzweifelt. Nach ihm lässt sich kein Grund dafür finden, warum ein Satz, den ein einzelner Mensch sich ausdenkt, wahr sein soll. John Locke (1632-1704) hat dem Bewusstsein verschiedene Kategorien zugeordnet, die an den Aufbau des menschlichen Gehirns erinnern – Denken – Fühlen – Wollen. Letztlich ist aber auch Locke ein Idealist in dem Sinne, dass er die selbstständige Existenz von Dingen leugnet. Also besitzen die Dinge der gewöhnlichen Realität keine von unserem Bewusstsein unabhängige Existenz. Wenn wir sie nicht wahrnehmen, sind sie so nicht da. Möglicherweise sind sie anders da oder werden jedenfalls von anderen Menschen nicht in unserer Form wahrgenommen. Rahmenbedingungen © Prof. T. Hildebrandt Erkenntnisphilosophie Seite 2 von 5 Man erhöht die Sicherheit über die Existenz, indem man mit anderen kommuniziert. Der Vergleich von Erfahrungen ergibt eine höhere Sicherheit über die Realität um uns. Die Kommunikation über Realität hat aber keinen Platz in Lockes Weltbild. Bei ihm entsteht die Erkenntnis (Realität) in jedem Menschen neu. Er bestreitet ebenso vehement die rationalistische Theorie der angeborenen Vorstellungen. Nach ihm ist der Mensch eine Tabula rasa, die erst mit den Erfahrungen beschrieben wird. Locke und Hume sind beide der Ansicht, dass Vorstellungen (ideas) durch Erfahrungen entstehen und diese wiederum als Eindrücke (impressions) zur Wahrnehmung des Menschen kommen. In dem gleichen Schema werden Vorstellungen oder Erfahrungen auch miteinander verknüpft. Die Erfahrung lehrt uns etwas über Ursache und Wirkung, die der Mensch zu einer Kausalität verknüpft. Eine über die Erfahrung hinausreichende (transzendente) Erkenntnis ist nach Hume unmöglich. Die Sinne können uns keine Welt unabhängig von unseren Eindrücken bezeugen. Jeder Sinneseindruck führt zu einem subjektiven Bild der Welt. Wie können wir aber in einer Welt überleben, über deren Existenz wir keine Gewissheit haben? Wer malt uns unser Bild der Welt? Theoretisch muss man nach Hume sogar die Vernunft des Menschen im Sinne eines rationalen Denkens mit einem wahren Ergebnis anzweifeln. Der Zweifel an der Wahrheit eines Satzes ist ja auch erdacht. Mithin kommt man als Zweifelnder nicht zu einer Gewissheit. Hume hinterlässt also nichts als Unsicherheit, denn wir können weder unseren Sinnen trauen, noch unserem Verstand. Wer gibt uns Sicherheit über die Welt außerhalb unserer Wahrnehmung? Hier enden die theoretischen Überlegungen des Empirismus wie die des Rationalismus ohne Ergebnis, sondern mit einem pragmatischen Kompromiss. Wir sollten vielmehr an der Existenz von Körpern nicht zweifeln, weil die Frage nach der Existenz sinnlos sei. Der Idealismus leugnet die selbständige Existenz von Dingen. Die Wahrnehmung nimmt also Dinge wahr, die außerhalb unserer Person existieren. Erlaubt sie aber einen Schluss von der Wahrnehmung auf die Existenz? Es scheint nicht so zu sein, dass der Mensch ein eigenes Bewusstsein hat, das ihm zweifelsfrei die Welt erklärt, so wie sie auch von Anderen wahrgenommen wird. Man kann nicht beweisen, dass die Wahrnehmung von einem wahrgenommenen Ding herrührt. In Träumen oder spirituellen Erfahrungen, in der Erinnerung oder auf schamanischen Reisen wird ohne Zweifel ebenfalls eine Realität wahrgenommen, die keine Gegenstände als Ursache hat. Die daraus folgende Leugnung von Dingen bezieht sich auf die Materie oder die Quantität. Der Idealismus geht einen Schritt weiter, indem er beweist, dass es im Bewusstsein wahrgenommene „Qualitäten“ gibt, die es so nicht geben kann. Farben, Geschmack, Gefühl, Töne, Neigungen, Abneigungen, kurz: jede Form von Sinneseindrücken ist nicht interpersonell vergleichbar. Jede Form von daraus abgeleiteten Bewusstseinsinhalten ist rein subjektiv, oder wie Berkeley sagt, ist eine reine Idee. Diese Sichtweise wird im Subjektivismus noch weiter vorangetrieben, indem die Qualität alle Gegenstände vollständig charakterisiert. Ohne die Qualität gibt es keine Substanz „an sich“. Eine Kirsche wird durch ihre Farbe, ihren Geschmack, ihr Aussehen, ihr Gewicht, ihren Geruch und weitere Qualitäten bestimmt. Zieht man das alles ab und versucht die Kirsche ohne diese Qualitäten zu beschreiben, so Rahmenbedingungen © Prof. T. Hildebrandt Erkenntnisphilosophie Seite 3 von 5 bleibt nichts übrig. Zumindest Nichts, über das man Sicherheit in der interpersonellen Kommunikation erzielen kann. Es gibt nicht die Kirsche „an sich“. Dieser reine Spiritualismus wird von George Berkeley mit dem Idealismus kombiniert. Demnach bleibt keine materielle Welt mehr übrig, wenn Berkeley zu Ende gedacht hat.1 Berkeley nennt das auch „Immaterialismus“. Das kommt uns in unserem materiellen Leben paradox und unmöglich vor. Es scheint, dass die reine Qualität mit unserem materialistischen Weltbild nicht in Einklang zu bringen ist. In letzter Konsequenz entsteht dann die Welt, wenn man die Augen öffnet und vergeht, wenn man sie wieder schließt. Das erschien auch Albert Einstein nicht möglich, wie sein Biograph Abraham Pais in der Einleitung schilderte: „Es muß um 1950 gewesen sein. Ich begleitete Einstein auf seinem Weg vom Institute for Advanced Studies nach Hause, als er plötzlich stehenblieb, sich mir zuwandte und mich fragte, ob ich denn wirklich glauben würde, der Mond existiere nur, wenn ich auf ihn blicke.“ In der Tat lassen sich die Erkenntnisse der abendländischen Naturwissenschaft und insbesondere der Physik nur mit philosophischem Realismus und strengem Determinismus erklären. Dafür steht Albert Einstein. Ohne diese Grundlagen gibt es keine Relativitätstheorie. Man entwickelt Verständnis für die Vehemenz, mit der Einstein diese Sicht der Dinge vor allem auch gegen die wissenschaftlichen Vertreter der Quantenphysik verteidigt hat. Aus den bisherigen Ausführungen lassen sich zwei Fragen ableiten: Welchen Weg hat die Philosophie genommen von dem strengen Idealismus eines Bischof Berkeley zu dem Materialismus der abendländischen Kultur? Liegt dem Weltbild der Quantenphysik und des „Immaterialismus“ die Metaphysik des Berkeley und seiner Vorgänger und Nachfolger zugrunde? Woraus die abgeleiteten Fragen erwachsen: Ist Quantenphysik Qualität? Ist Qualität ein mögliches Paradigma (oder eine Metaphysik) für eine andere Wissenschaft und in der übernächsten Folge für eine andere Gesellschaft (eine andere Ökonomie)? Zur ersten Frage führt kein Weg an Kant vorbei, den man aber ansatzweise erst verstehen kann, wenn man die losen Enden des Rationalismus, des Empirismus, des Idealismus und des Subjektivismus in der Hand hält. Vom Rationalismus hat Kant die logischen, verstandesgemäßen Schlussfolgerungen akzeptiert und übernommen. Das sagte ihm und seiner Denkweise zu. Der Mensch fällt auf der Basis gesicherter Erkenntnisse synthetische (zusammengesetzte) Urteile a posteriori, also auf Erfahrungen begründet. Das sind zum Beispiel Kausalurteile. Wenn der Mensch viele Erfahrungen macht, dann steigt seine Urteilskraft und die Sicherheit der Kausalurteile nimmt zu. Damit gibt Kant der Gesellschaft die Sicherheit der Kausalität oder der Abfolge von Ursache und Wirkung. 1 Bei Leibniz gibt es hinter der menschlichen Wahrnehmung wenigstens noch geistige Dinge (Monaden), die ihren Widerschein in das Bewusstsein übertragen. Rahmenbedingungen © Prof. T. Hildebrandt Erkenntnisphilosophie Seite 4 von 5 Die meiste Zeit in der Entstehung seiner „Kritik der reinen Vernunft“ verwandte Kant aber in die Ergründung der synthetischen Urteile a priori, also der Voraussetzungen für wissenschaftliche Theorien. Wenn diese Basis aber auf empirischen Pfeilern ruht, dann kann sie leicht durch subjektive Wahrnehmungen (Sinnlichkeit) ins Wanken geraten, denn auf die Sinne kann man keine eindeutige Gewissheit aufbauen. Die Sinne können täuschen. Im Unterschied zu den Rationalisten war Kant aber auch nicht bereit, das Dogma des göttlichen Beginns alles Denkens zu akzeptieren. Er verspottete die Dogmatiker als „Geisterseher“. Dann machte er sich auf die Suche nach einer neuen Metaphysik, die eine Grundlage für Mathematik und Physik darstellen sollte. Dazu braucht er aber eine Basis für synthetische Urteile a priori, wie er sie in seinem Beispiel 7+5=12. Die 12 ist nach Kant offensichtlich ein synthetisches Urteil, weil sie nicht eine Eigenschaft der beiden anderen Zahlen ist. Gäbe es nicht die synthetischen Urteile a priori, so gäbe es nach Kant auch keine exakte Wissenschaft der Mathematik und der Physik. Die Mathematik wäre von den Erfahrungen abhängig und hätte nur eine eingeschränkte Allgemeingültigkeit. Die Grundlagen wären widerlegbar. Das wiederum erschien Kant unmöglich und inakzeptabel. Das ist das wirklich Neue an Kants kritischer Auseinandersetzung. Er hat 15 Jahre angestrengt gedacht und an der Basis seiner Philosophie gebaut. Am Ende fand er die Grundlagen der synthetischen Urteile a priori, mit denen sich seine Schrift zur „Kritik der reinen Vernunft“ hauptsächlich befasst. Weil es diese transzendentalen, von der Erfahrung unabhängigen Urteile gibt, sind auch mathematische und naturwissenschaftliche Urteile als exakte Wissenschaft möglich. Das ist sein Hauptanliegen. Es führt direkt zu der Frage: „Wie sind die synthetischen Urteile a priori möglich?“ Kant weist in seiner transzendentalen Ästhetik nach, dass Raum und Zeit die reinen Formen der Anschauung sind, die jeder in sich trägt. Ohne Raum kann man sich keine Körper vorstellen, aber sehr wohl einen leeren Raum. Ohne Zeit kann man sich keine Ereignisse vorstellen, sehr wohl aber eine ereignislose Zeit. Alle Dinge und jede Materie wird erst wahrnehmbar und erklärbar in einem raumzeitlichen Kontext. Ohne den Raum-Zeit-Zusammenhang gibt es keine Wahrnehmung. Damit ist Kant wieder beim Empirismus angelangt. Diesmal aber auf einer anderen Basis. Innerhalb von Raum und Zeit nimmt der Mensch die Materie wahr. Außerhalb unserer Welt ist keine empirische Erkenntnis und Wahrnehmung möglich. Die Welt „an sich“ hat keinen Raum und keine Zeit. Sie ist lediglich als Idee zu verstehen. Hier öffnet Kant die Tür zu einer erweiterten Realität. Innerhalb der Wahrnehmung unserer Welt ist nach Kant nunmehr alles erklärbar, aber es beschränkt sich auch auf diese. Das gilt ebenso für die zwei Formen des Ich, die wir erkennen können. Das von uns erlebte empirische Ich und das für uns unerkennbare, zeitlose Ich, das sich möglicherweise in einer zeit- und raumlosen Welt wieder findet. Rahmenbedingungen © Prof. T. Hildebrandt Erkenntnisphilosophie Seite 5 von 5