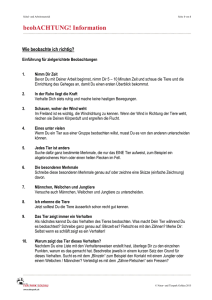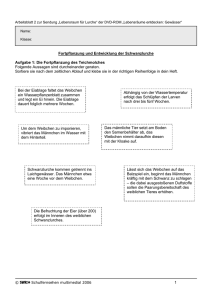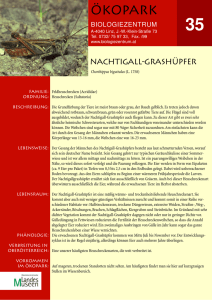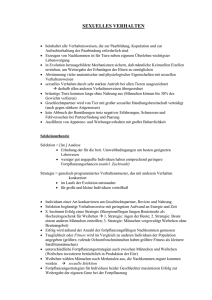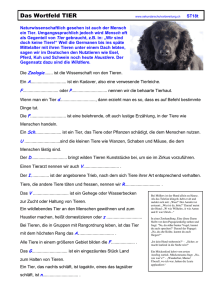Document
Werbung

51. Die Biologie des Verhaltens Kapitel 50 im deutschen Buch Verhalten bezeichnet was ein Tier tut und wie es dies tut. Es bedeutet ausgelöst durch einen Reiz in bestimmter Weise handeln, reagieren und funktionieren. Verhalten beinhaltet die nichtmotorischen Komponenten (Abläufe im Gehirn) ebenso wie die beobachtbaren Handlungen. Die Grundlagen des Verhaltens liegen in der Evolution. Die Beobachtung des tierischen Verhaltens steigerte die Darwin-Fitness (=Fortpflanzungserfolg) unserer Vorfahren. Die heutigen Biologen nehmen die Fitness ihrer tierischen Forschungsobjekte als Leitprinzip ihrer Arbeit. Das Prinzip ist einfach: Die natürliche Auslese greift an die genetische Variation an, die durch Mutation und Selektion geschaffen wurde. Es folgt die Annahme, dass Lebewesen Eigenschaften besitzen, die den Anteil ihrer Gene am Genpool der nächsten Generation maximieren. Wir erwarten also von den Tieren ein Verhalten, das ihre Fitness maximiert. Die Erwartung eines optimalen Verhaltens ist nur dann sinnvoll, wenn das Verhalten von Genen beeinflusst wird. Nur dann unterliegt es der natürlichen Auslese und kann sich evolvieren. Auch erlernte Verhaltensweisen sind in der Regel von Genen abhängig, die ein Nervensystem produzieren, das Lernen ermöglicht. Verhaltensökologie geht davon aus, dass Tiere ihre Darwin-Fitness durch optimales Verhalten steigern. Sie liefert oft überprüfbare Hypothesen. Die sich daraus ergebenden Voraussagen lassen sich unter günstigen Voraussetzungen durch Experimente und Beobachtungen überprüfen. Jede Verhaltensweise hat sowohl eine ultimate als auch eine proximate Ursache Ultimate Ursache: Warum zeigt ein Tier ein bestimmtes Verhalten? Also der Grund warum etwas existiert und Fragen über die Evolution. Auch letzte, mittelbare oder evolutionäre Ursache genannt. Proximate Ursache: Wie sieht ein bestimmtes Verhalten bei einem Tier aus? Welche Mechanismen liegen einem bestimmten Verhalten zu Grunde (Verhaltensphysiologie). Auch unmittelbare Ursachen genannt. Zu den proximaten Ursachen gehören sowohl Aussenreize, die ein bestimmtes Verhalten auslösen, wie auch die internen Prozesse des neuromuskulären, des endokrinen und anderer physiologischer Systeme des Tieres, welche die proximaten Mechanismen darstellen. Zur Erforschung der proximaten Ursachen, muss man die Biologie der betreffenden Spezies genau kennen und wissen, wie sie Aussenreize wahrnimmt. Dies führt zu Eingrenzung der Verhaltensoptionen auf das physisch Mögliche und zur Begrenzung der Anzahl Hypothesen. Der Begriff „Umwelt“ beschreibt in der Verhaltensbiologie den Teil der Aussenwelt der für ein Tier unmittelbar von Bedeutung ist. Eine identische Aussenwelt kann für verschiedene Tierarten eine andere Umwelt bedeuten, das sie zum Teil verschiedene Sinnesorgane, Umweltansprüche und Gefährdungsfaktoren haben. Beide Ursachenebenen sind miteinander verknüpft. Dessen muss man sich bei der Erforschung des Verhaltens stets bewusst sein. Beispiel: Fortpflanzung der Dreistachligen Stichling im Frühling oder Frühsommer. • ultimate Ursache: Hypothese -> Produktion von Nachkommen in dieser Jahreszeit besonders erfolgsversprechend oder angepasst. (Wärme des Wassers und Nahrungsangebot führen zum schnellen Wachstum der Jungfische) 1 • proximate Ursache: Hypothese -> Fortpflanzungsverhalten wird durch Einwirkung der zunehmenden Tageslänge auf die Photorezeptoren des Fisches ausgelöst. • Experiment: Verlängerung der Dauer der täglichen Lichtexposition. Diese Reize bewirken neuronale und hormonelle Veränderungen, die Nestbau und andere mit der Fortpflanzung zusammenhängende Verhaltensweisen induzieren. Die längere Hellphase hat nur geringe adaptive Bedeutung. Da die Tageslänge der zuverlässigste Indikator für die Jahreszeit ist, wurde ein proximater Mechanismus selektiert, der von ihr gesteuert wird. Zusammenfassung: Wie und Warum des tierischen Verhaltens sind evolutionsgeschichtlich miteinander verknüpft. Proximate Mechanismen erzeugen Verhaltensweisen, die sich letztlich evolviert haben, weil sie auf irgendeine Weise die Fitness steigern. Bestimmte Reize lösen angeborene Verhaltensweisen aus, die man als Erkoordination bezeichnet Ethologie (vergleichende Verhaltensforschung, Verhaltensbiologie) erforscht tierisches und daraus auch menschliches Verhalten aus biologischer Sicht und mit biologischen Methoden. Die von Europa ausgehende Ethologie ist primär am natürlichen Verhalten der verschiedenen Tierarten interessiert. Daneben existiert, von Amerika kommend, eine weitere Wissenschaft, die sich mit dem Verhalten von Tieren befasst: Der Behaviorismus setzt systematisch Tierexperimente ein, um menschliches Verhalten zu verstehen und beschränkt sich dabei auf wenige Labortiere. Dieser wird hier aber nicht weiter behandelt. Erbkoordination Angeborenes, starr ablaufendes Verhaltensmuster. Wenn Erbkoordinationen einmal begonnen sind, werden sie in der Regel vollständig ausgeführt, auch wenn dabei neue Reize auf das Tier einwirken oder die Handlung der Situation nicht mehr angemessen ist. Sie wird durch externe Sinnesreize ausgelöst, diese werden Schlüsselreize oder Auslöser genannt. Erbkoordination ist eine Kombination aus der angeborenen Fähigkeit eines Tieres, einen bestimmten in seiner Umwelt vorkommenden Reiz wahrzunehmen, und einem durch den Reiz aktivierten Verhaltensprogramm, das ein bestimmtes Bewegungsmuster steuert. Beispiel: Das Dreistachlige Stichlingmännchen, das andere Männchen angreift, sobald diese in ihr Revier eindringen. Schlüsselreiz ist der rote Bauch. Eine Atrappe kann noch so schlecht sein, mit einem roten Fleck am Bauch wird sie angegriffen. (Abb. 50.5 bzw. 51.3) Weiteres Beispiel: (Abb. 50.6) Einrollen eines Eies, das aus dem Nest gefallen ist bei den Graugänsen. Rutscht das Ei während der Einrollaktion weg, fährt die Gans mit der Einziehbewegung des Halses fort, lässt aber die seitliche Bewegung des Kopfes sein. Daraus folgt, dass die Einziehbewegung Erbkoordination ist und die Balancierbewegungen Orientierungsaktionen. Die Gans bemerkt das Fehlen des Eies erst, wenn sie wieder in ihrem Nest sitzt und führt die ganze Bewegung von neuem wieder aus. Auch Bälle und Türknäufe wirken als Schlüsselreize und werden im Nest sogar längere Zeit bebrütet. Tierverhalten beruht, im Gegensatz zu menschlichem Verhalten, auf einer begrenzten Teilmenge der verfügbaren Informationen der Sinne. Tiere handeln häufig nicht durchdacht oder ‚intelligent‘ (intelligentes Verhalten: Entscheidungen fällen, nach dem Verrechnen verschiedener Informationen). Bei der Erbkoordination verhalten sich Tiere eher wie Roboter. Erbkoordination gibt es bei allen Tieren, auch beim Menschen. Säuglinge greifen kräftig zu, wenn sie an den Händen berührt werden, auch das Lächeln ist Erbkoordination, es lässt sich durch einfache Reize 2 wie Geräusche oder durch einen weissen Kreis mit zwei dunklen Flecken, die an ein Gesicht erinnern, auslösen. In all diesen Fällen wurde angepasstes Verhalten auf spezifische Reize selektiert. Die Verhaltensforscher verwendeten verschiedenartige Auslöser und konfrontierten die Versuchstiere oft mit Situationen, die in der Natur nicht vorkommen. Würden öfters eiähnliche Gegenstände in der Nähe von Gänsenestern vorkommen, so hätte die natürliche Auslese vermutlich einen Entscheidungsmechanismus entstehen lassen. Beispiel dafür sind die Vogelarten, welche die Eier von Brutparasiten erkennen. Dies zeigt, dass die natürliche Auslese unter starkem Selekionsdruck komplexe Verhaltensmechanismen hervorbringen kann. Die natürliche Selektion hat bei Tieren zwar viele angepasste Verhaltensweisen entstehen lassen, aber das Verhalten dieser Tiere scheint von krasser Unfähigkeit zu zeugen, wenn sie mit neuartigen Situationen konfrontiert werden. Die Fähigkeit, mit neuartigen Reizen geeignet umzugehen, aus ihnen zu lernen und das Verhalten an das Gelernte anzupassen ist ein Zeichen von Intelligenz und Bewusstsein. Die Evolution von Intelligenz ist kostspielig (Entwicklung des für die Informationsverarbeitung erforderlichen Nervengewebes und dessen Erhaltung). Für die Evolution von Intelligenz muss die Biologie verändert werden (längere Jugendphase, weniger Junge pro Elternteil). Die Kosten dazu wären viel höher (Abnahme der reproduktiven Fitness) als der gelegentlich falsche Einsatz von Erbkoordination. Ausgeprägte Intelligenz hat sich daher nicht in vielen Tiergruppen evolviert. Schlüsselreize Besteht generell aus einem oder wenigen einfachen, für die jeweilige Situation charakteristischen Umweltreizen. Oft das offensichtlichste oder einzige Charakteristikum für eine bestimmte Situation. Die natürliche Auslese hat vermutlich Merkmale begünstigt, bei denen die Wahrscheinlichkeit der Assoziation mit dem relevanten Objekt oder der Aktivität relativ hoch ist. Bei mehreren möglichen Reizen ist wahrscheinlich der Zufall miteintscheidend, welcher Schlüsselreiz für die Erbkoordination fixiert wird. Sensibilität einer Tierart für allgemeine Reize und spezifische Schlüsselreize auf die sie reagiert, haben einen engen Zusammenhang. Bsp: Sehr empfindlichen Netzhautzellen von Fröschen, die sehr gute Bewegungen erkennen und sich bewegende Beute. Eine Steigerung des auslösenden Reizes ruft eine stärkere Reaktion hervor (Bsp: Aufgesperrte Schnäbel der Jungvögel. Der Hungrigste hat den Schnabel am weitesten offen und bekommt am ehsten Futter.). Lernen ist auf Erfahrung basierende Modifikation von Verhalten Lernen findet oft auch bei angeborenen Verhaltensweisen statt. Angeborenes-Kontra-Erworbenes-Kontroverse Konflikt zwischen Ethologen (angeborenes Verhalten) und Psychologen (Lernen) welcher der beiden Faktoren wichtiger ist für das Verhalten. Wo stehen die genetischen Faktoren im Vordergrund und wo Umwelteinflüsse. Lernen kontra Reifung Manche Verhaltensweisen, die angeboren sind, werden mit der Zeit schneller oder effektiver ausgeführt. Sie haben sich durch entwicklungsbedingte Veränderungen in neuromuskulären Systemen vervollkommnet -> Reifung. Bsp: Das Fliegen der Jungvögel muss durch neuromuskuläre Reifung erfolgt sein. Experiment: Vögel wurden an Fliegversuchen gehindert und erst zu dem Zeitpunkt losgelassen, als die Gleichaltrigen schon flogen. Sie flogen direkt los, ohne zuerst Fliegversuche zu machen. 3 Habituation Sehr einfache Form von Lernen: Das Abgewöhnen angeborener Reaktionen auf unwichtige Reize oder auf Reize, auf die das verbundene Ereignis nicht folgt. Bsp: Küken, die nach mehrmaligem Auftreten eines „Schein-Feindes“ nicht mehr reagieren, bei einem neuen aber wieder. -> Die Fluchtreaktion ging nicht verloren, wurde nur modifitiert. Prägung Enge Interaktion von Lernen mit angeborenem Verhalten. Bsp: (Abb. 50.8 bzw. 51.7) Konrad Lorenz und seine Graugänse. Lorenz teilte ein Graugansgelege auf. Die eine Hälfte verbrachte die ersten Stunden ihres Lebens bei der Mutter. Die Jungen verhielten sich normal, folgten der Mutter überall hin und zeigten als adulte Tiere ein normales Sozial- und Paarungsverhalten. Die Küken, die im Brutschrank schlüpften und die ersten Stunden mit Lorenz verbrachten, folgten ihm und beachteten die Mutter und andere adulte Artgenossen nicht (-> kein Erkennen). Auch als adulte Tiere zogen sie die Gesellschaft von Menschen der der Artgenossen vor und zeigten ihnen gegenüber sogar Ansätze von Balzverhalten. Offenbar ist ihnen die Vorstellung ihrer Art nicht angeboren. Sie reagieren auf das erste mit bestimmten Eigenschaften ausgestattete Objekt, das sie sehen und identifizieren sich mit ihm. Diesen Vögeln ist die Fähigkeit oder Neigung auf solche Objekte zu reagieren angeboren. Die Aussenwelt liefert den prägenden Reiz - etwas auf das die Reaktion gerichtet ist. Bei den Graugänsen war der wichtigste prägende Reiz die Bewegung eines Objekts vom Jungen weg. Der Effekt wurde noch verstärkt, wenn das Objekt irgendwelche Töne von sich gab. Die Prägung ist irreversibel. Für die Prägung gibt es eine sensible Phase, auch kritische Periode genannt: Ein begrenzter Zeitraum im Leben eines Tieres, während dessen verschiedene Verhaltensweisen erlernt werden können. Vorher und nachher ist dies nicht möglich. Prägung ist auch bei älteren Tieren möglich (Prägung auf Junge). Durch Prägung auf ihre Eltern lernen Jungvögel, wer für sie sorgen wird, welcher Spezies sie angehören und mit welcher Art Vögel sie sich später paaren sollten. Diese sexuelle Prägung erfolgt später und die sensible Phase dafür dauert länger. Durch Prägung kommt es zur dauerhaften Identifikation auch mit einer fremden Art. Obwohl die sensible Phase und die Irreversiblität für Prägung sehr charakteristisch sind, ist das durch Prägung nicht immer starr fixiert. Bsp: Finken einer Art, die während der sensiblen Phase für die sexuelle Identität mit einer anderen Art zusammengebracht wurden, wollten sich nur mit Finken der anderen Art paaren. Mit ihrer Art paarten sie sich nur widerstrebend aber schlussendlich trotzdem. Gesangsentwicklung bei Vögeln: (vergl. 50.9 bzw 51.8) Da zwischen den Vögeln soziale Interaktionen möglich sind, bietet ein lebendes, singendes Individuum sehr viel stärkere und vielfältigere Reize als eine Bandaufnahme. Diese starken Reize können sich gegen angeborene Tendenzen (nur eigene Gesänge aufzunehmen) durchsetzen. Das heisst, dass angeborene Tendenzen durch Erfahrung modifiziert werden können. Die sensible Phase wurde länger, wenn die Reize stärker waren, also von einem lebenden Vogel ausgingen. Auch der Mensch hat eine sensible Phase um Sprachen zu lernen. -> Kindheit. Diese ist aber nicht stark festgelegt. Ältere Leute können immer noch eine Sprache erlernen, haben aber grössere Mühe dafür als Kinder. Klassische Konditionierung Viele Tiere können lernen, einen Reiz mit einem anderen zu assoziieren. Man spricht dabei von assoziativem Lernen. Versuche des Russen Iwan Pawlow: Anregung des Speichelflusses bei 4 Hunden durch Fleisch. Gleichzeitig ertönte eine Glocke. Mit der Zeit genügte die Glocke allein, um den Speichelfluss anzuregen. Operante Konditionierung Eine andere Art des assoziativen Lernens: ‚Lernen durch Versuch und Irrtum‘. Dabei lernt ein Tier, eine seiner Verhaltensweisen mit einer Belohnung oder einer Strafe zu assoziieren und neigt dazu, dieses Verhalten zu wiederholen, bzw. zu vermeiden. Bsp: Versuche von B. F. Skinner. Eine Ratte wird in eine Box gesperrt. Dort betätigt sie in der Regel durch Zufall, einen Hebel und wird durch Futter belohnt. Das Tier lernt schnell, dass die Betätigung des Hebels und das Futter zusammenhängen. Die Dressur von Tieren verläuft nach dem selben Prinzip. Die operante Konditionierung kommt in der Natur sehr häufig vor. Auch hier beeinflussen Gene das Ergebnis der operanten Konditionierung. (Etwas gut Schmeckendes, also folgt diese Verhaltensweise; Der Geschmack ist von der natürlichen Selektion beeinflusst.) Beobachtungslernen Viele Wirbeltiere registrieren das Verhalten von Artgenossen und erhalten damit wichtige Informationen. Dadurch können sich auch neue Traditionen etablieren und an folgende Generationen weitergegeben werden. Bsp: Gesang der Vögel. Spielen Kommt bei vielen Säugetieren und einigen Vögeln vor. Solche Verhaltensweisen haben keinen erkennbaren äusseren Zweck, beinhalten aber Bewegungen, die eng mit zweckmässigem Verhalten assoziiert sind. Bsp: Raubtierarten, die sich gegenseitig anschleichen und spielerisch anspringen. Typischerweise ist spielen potentiell gefährlich (Verletzungen, angegriffen werden, „herumalbern“ bei Kindern). Spielen verbraucht Energie und die damit verbundenen Risiken für Leib und Leben bedeuten zusätzliche Kosten. Ultimate adaptive Grundlage dafür? • „Übungshypothese“: Spielen ist eine Art von Lernen zur Perfektionierung von Verhaltensweisen. -> Spielen ist am häufigsten bei Jungtieren zu beobachten. •“Trainingshypothese“: Spielen ist adaptiv, da es die Muskulatur und das Herz- Kreislaufsystem in Hochform hält. -> Vor allem Jungtiere spielen. Sie müssen sich noch nicht für nützliche Aktivitäten anstrengen, da sie von den Eltern geschützt und versorgt werden. Lernen durch Einsicht Wenn ein Tier in einer Situation, mit der es noch keine unmittelbare Erfahrung besitzt, beim ersten Versuch das richtige oder passende Verhalten zeigt (Auch einsichtiges, planvolles oder vernunftbegabtes Handeln genannt). Bsp: Schimpanse, der über seinem Kopf, ausser Reichweite, eine Banane sieht und neben sich einige Kisten hat, findet selber heraus, wie er an die Bananen heran kommt. Einsicht ist am stärksten bei Säugetieren entwickelt, vor allem bei Primaten und Raben. Aber auch dort variiert sie extrem. Kognitive Fähigkeiten von Tieren / Kognition Verwandt mit Thema Einsicht. Kognitive Leistungen sind unter anderem die bewusste Wahrnehmung der Umwelt, sowie die Fähigkeit, diese Umwelt zu beurteilen. -> Hat nur der Mensch kognitive Fähigkeiten? Oder können auch Tiere denken? Unterschiedliche Ansichten von Wissenschaftlern. 5 RhytmischeVerhaltensweisen synchronisieren die Aktivitäten von Tieren mit Veränderungen der Umwelt im Tages- und Jahresgang Bei Tieren findet man alle Arten regelmässig wiederholter Verhaltensweisen (Bsp: Essen am Tag, Schlafen in der Nacht; Fortpflanzung im Frühling; Wanderungen im Frühling und Herbst.). > Welche proximaten Mechanismen steuern die Verhaltensrhythmen? Die ultimaten Ursachen sind meist offensichtlich, dass bestimmte Verhaltensweisen in der Regel dann auftreten, wenn die entsprechenden Nischen mit einem Höchstmass an Sicherheit und Gewinn genutzt werden können. Die proximaten Ursachen sind weder offensichtlich noch einfach. -> Wie würde ein Tier reagieren wenn es in eine Umgebung versetzt würde, in der es keine Anhaltspunkte für die Tageszeit oder die Jahreszeit geben würde? -> Also: Ist rhythmisches Verhalten von externen Zeitgebern (exogene Rhythmen) oder von inneren Faktoren (endogene Rhythmen) abhängig? Circadiane (Tages-) Rhythmen besitzen in der Regel eine stark endogene Komponente (innere Uhr). Da aber der endogene Rhythmus nicht exakt mit dem Aussenzyklus übereinstimmt, muss er durch einen zyklischen Umweltfaktor (Zeitgeber) mit dem 24-Stunden-Tag synchronisiert werden. Der wichtigste Zeitgeber ist der tägliche Wechsel von Licht und Dunkelheit (=Photoperiode). Solche synchronisierte biologisch Vorgänge bezeichnet man als Photoperiodismus. Fehlt der Zeitgeber, bleibt die rhythmische Aktivität erhalten, aber die Periodendauer variiert. Über die Rolle endogener Zeitmesser (biologische Uhren) bei rhythmischem Verhalten mit längerer Periodendauer ist sehr wenig bekannt. Bei vielen Arten beruhen jahresperiodische Verhaltensweisen zumindest zum Teil auf physiologischen und hormonellen Veränderungen, die direkt mit Aussenfaktoren verknüpft sind. Ob dabei endogene Jahresrhythmen (circanuale Rhythmen) eine Rolle spielen, ist noch wenig erforscht. -> Durchführbarkeit der entsprechenden Experimente. Bei Tieren sind auch circatidale Rhythmen (von den Gezeiten abhängig) und circalunare Rhythmen (vom Mond abhängig) bekannt. Aussenreize steuern die Bewegungen von Tieren Der Schwerpunkt liegt auf den proximaten Ursachen, vor allem auf den Mechanismen, mit deren Hilfe Tiere bewegungssteuernde Aussenreize wahrnehmen und darauf reagieren. Die ultimaten Gründe sind oft offensichtlich. Verschiedene Tierarten sind an verschiedene Umweltbedingungen angepasst und besitzen in der Regel Verhaltensweisen, durch die sie, oft zu einer bestimmten Jahreszeit, in die entsprechende Umwelt gelangen. Kinese und Taxis Tiere orientieren sich bei der Fortbewegung an vielen Umweltreizen. Bei der Kinese (einfachste Form einer Bewegung) ändert sich die Aktivitätsrate als Reaktion auf einen Reiz. Bsp: Befindet sich ein Tier in einer für sich günstigen Umgebung, verlangsamt es seine Fortbewegung und bleibt dadurch meistens in dieser Umgebung. Gelangt es in eine ungünstige Umgebung, beschleunigt es seine Fortbewegung um möglichst bald in eine günstige Umgebung zu kommen. Bsp: Asseln. Taxis: Mehr oder weniger automatisch ablaufende gerichtete Bewegung auf einen Reiz zu (positive Taxis) oder von einem Reiz weg (negative Taxis). Bsp: Fliegenlarven, die nach dem Fressen negativ phototaktisch sind und sich automatisch vom Licht weg bewegen. -> So bleiben sie vermutlich für Feinde schwer erkennbar. Forellen, die sich automatisch stromaufwärts bewegen und so nicht von der Strömung fortgetragen werden. 6 Migrationsverhalten (= Zugverhalten) Regelmässige Wanderung von Tieren über relativ weite Entfernungen. Charakteristisch ist, dass die Tiere jedes Jahr zwischen zwei Gebieten hin und her ziehen. Bsp: Vogelzug, Wanderung von Walen, Schmetterlingsarten und bestimmten Fischen. Wandernde Tiere finden den Weg mittels eines von drei Mechanismen oder auch einer Kombination: Pilotieren Tier wandert von einer vertrauten Landmarke zur nächsten, bis es sein Ziel erreicht -> vor allem zur Überwindung kurzer Entfernungen. Kompassorientierung: Tier kann Himmelsrichtungen wahrnehmen und bewegt sich über eine bestimmte Entfernung, oder bis es sein Ziel erreicht, geradlinieg in eine bestimmte Richtung. (vergl. 50.15 bzw. 51.13) Navigation: Zusätzlich zur Himmelsrichtung, wird auch der eigene Standpunkt relativ zu anderen Orten bestimmt. Tiere benutzen als Anhaltspunkte für die Navigation und die Kompassorientierung den Stand der Sonne bzw. der Sterne. Dafür ist ein innerer Zeitmesser nötig, damit die Bewegungen der Himmelskörper im Laufe des Tages kompensiert werden können. Verhaltensökologen untersuchen vor allem Ernährungsverhalten mit Hilfe von Kosten-Nutzen-Analysen Die Nahrungsaufnahme ist zweifellos ein für das Überleben und für den Fortpflanzungserfolg entscheidendes Verhalten. Aber was entscheidet darüber, was ein Tier frisst? Tiere ernähren sich auf viele verschiedene Arten, dabei besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Art des Nahrungserwerbs und morphologischen Strukturen. Auch ökologische und evolutionsbiologische Gesichtspunkte sind von äusserster Wichtigkeit. Die Ernährungsgewohnheiten sind ein wichtiger Teil der ökologischen Nische einer Art und können zumindest teilweise durch die Konkurrenz mit anderen Arten geprägt sein. Viele Tierarten haben theoretisch die Wahl zwischen einer Vielzahl potentieller Nahrungsquellen. Manche Tiere sind Generalisten, die ein breites Nahrungsspektrum nutzen, andere sind Spezialisten, die auf eine ganz bestimmte Art von Nahrung spezialisiert sind. Spezialisten besitzen in der Regel Anpassungen der Morphologie und des Verhaltens, die hochspezifisch für ihre Nahrung sind. Dadurch sind sie extrem erfolgreich im Nahrungserwerb. Generalisten können sich spezifische Nahrungen nicht mit der gleichen Effizienz sichern, dafür bleiben ihnen aber Ausweichmöglichkeiten, falls eine bevorzugte Nahrungsquelle nicht mehr verfügbar ist. Die Wahl der Nahrung ist bei den meisten Generalisten nicht zufällig. Oft konzentrieren sie sich auch auf ein ganz bestimmes Objekt, solange dieses häufig ist. Grund dafür ist die Entwicklung eines Suchbildes, welches aus einer Reihe spezifischer Merkmale besteht, die das Tier zur gewünschten Nahrung leiten. Wird das bevorzugte Nahrungsobjekt relativ selten, entwickelt das Tier ein neues Suchbild. Dieses versetzt ein Tier in die Lage, effiziente kurzfristige Spezialisierung mit der Flexibilität des Generalistentums zu vereinen. Nach der Theorie des optimalen Nahrungserwerbs (optimal foraging), begünstigt die Selektion Tiere, deren Strategien des Nahrungserwerbs die Differenz zwischen Kosten und Nutzen maximieren. Als Nutzen betrachtet man die gewonnene Energie, manchmal auch andere Optimierungskriterien wie zum Beispiel bestimmte Nährstoffe. Die Kosten bestehen aus der Energie, die für das Finden, Fangen und Fressen der Nahrung gebraucht wird, wie auch dem Risiko selber gefangen zu werden und die Zeit, die dafür verloren ging und für andere wichtige Aktivitäten hätte eingesetzt werden können. 7 Für den optimalen Nahrungserwerb müssen viele Faktoren gegeneinander abgewogen werden. Dazu gehören die Energiemenge, die ein Beutetier liefert, die Kosten um es zu fangen und die relative Häufigkeit der verschiedenen Beutetiere. Verhaltensökologen sagen aufgrund dieser Faktoren das optimale Ernährungsverhalten eines Tieres voraus. Zahlreiche Studien zeigen, dass viele Tiere ihr Verhalten tendenziell so modifizieren, dass der Quotient aus Gesamtenergieaufnahme und Gesamtenergieaufwand hoch bleibt. Dabei sind sie manchmal zu erstaunlichen Leistungen fähig. Die Soziobiologie untersucht Sozialverhalten im evolutionsbiologischen Kontext Unter Sozialverhalten im weitesten Sinne versteht man jede Art von Interaktionen zwei oder mehreren - in der Regel artgleichen - Tieren. Die Komplexität des Verhaltens ist bei Interaktionen zwischen Individuen erheblich höher als bei anderen Verhaltensweisen. Zum Sozialverhalten gehören unter anderem Agression, Balzverhalten, Kooperation und sogar Täuschung. Bei Arten mit ausgeprägter Interaktion entstehen dem Individuum durch das Sozialverhalten sowohl Kosten, als auch Nutzen. Der Soziobiologie dient die Evolutionstheorie als Grundlage für die Erforschung und Interpretation von Sozialverhalten. Alle Angehörigen einer Population nutzen dieselbe ökologische Nische. Daher besteht ein erhebliches Konfliktpotential, vor allem bei Arten, deren Dichte normalerweise nahe der Tragfähigkeit ihres Lebensraumes liegt. Manchmal scheint Kooperation ein Teil des Sozialverhaltens zu sein, etwa wenn ein bestimmtes Verhalten in der Gruppe erfolgreicher ist als bei einem Einzeltier. Aber auch bei Verhaltensweisen, bei denen sich die die Beteiligten gegenseitig nützen (Bsp. Paarungsverhalten), handelt jdes Individuum in der Regel so, dass sein eigener Nutzen maximal ist, selbst wenn dies auf Kosten des anderen geschieht. Beim konkurrierenden Sozialverhalten geht es oft um die Verteilung von Ressourcen Agonistisches Verhalten Bei diesem Verhalten entscheidet ein Wettstreit, in dem sowohl Droh- als auch Demutverhalten eine Rolle spielen, welches von zwei konkurrierenden (kompetitiven) Individuen Zugang zu einer Ressource erhält, etwa Nahrung oder ein Geschlechtspartner. Manchmal messen die Gegner dabei ihre Kräfte, häufiger aber beschränken sie sich auf Drohverhalten: Drohhaltung und -mimik lassen sie grösser oder gefährlicher aussehen, oft werden ausserdem Drohlaute produziert. Schliesslich stellt einer der Gegner das Drohen ein und geht zu Demuts- oder Beschwichtigungsverhalten über, was einer Niederlage gleichkommt. Das Beschwichtigungsverhalten hemmt die Agression des Gegners. Ein Grossteil dieses Verhaltens ist ritualisiert, das heisst es besteht aus symbolischen Handlungen so dass die Gegner keine ernsthaften Verletzungen davontragen. Das Ausmass der Ritualisierung von Zweikämpfen (Kommentkämpfen) hängt von der Knappheit und der zukünftigen Verfügbarkeit der Ressuorce ab. Bei Arten, bei denen die Gegner sich Verletzungen zufügen, fördert die natürliche Auslese eine starke Tendenz, die Auseinandersetzung zu beenden, sobald der Sieger feststeht, denn bei einer Fortsetzung des Kampfes könnte er ebenfalls verletzt werden. Jedes zukünftige Zusammentreffen der ehemaligen Gegner wird in der Regel sehr viel schneller zugunsten des Gewinners geregelt. 8 Rangordnungen Bei Hühnern und Rudeln von Wölfen zum Beispiel wird sehr schnell eine Rangordnung (auch Dominanzhierarchie) hergestellt. An der Spitze dieser Hierarchie steht das Alpha-Tier, welches das Verhalten aller anderen Gruppenmitglieder kontrolliert, zum Teil nur noch durch Drohen. Das in der Rangfolge unmittelbar folgende Beta-Tier unterjocht alle anderem mit Ausnahme des Alpha-Tiers. Ihm folgt das Gamma-Tier und so fort. Das ranghöchste Tier hat alle Vorteile. Ihm ist der Zugang zu Ressourcen, wie Futter, sicher. Rangniedere Tiere schützt das System vor Energieverschwendung und Verletzungen in sinnlosen Kämpfen. Bei Wölfen wird zum Beispiel auch das Paarungsverhalten von der Alpha-Wölfin bestimmt. Je nach Nahrungsangebot paart sie sich und gestattet dies auch den anderen Wölfinnen. Fehlt aber sie Nahrung, paart nur sie sich und lässt dies bei den anderen nicht zu, damit ihre Jungen die besten Bedingungen haben, aufzuwachsen. Territorialität Ein Territorium oder Revier ist ein Gebiet, das von einem Individuum oder einer Gruppe verteidigt wird, und zwar meist gegen Artgenossen. Territorien dienen in der Regel der Nahrungssuche, der Paarung, der Jungenaufzucht oder einer Kombination dieser Aktivitäten. Normalerweise sind Territorien ortsfest. Ihre Grösse variiert je nach Tierart, Funktion des Reviers und Menge der verfügbaren Ressourcen. Das Territorium eines Tieres ist nicht mit seinem Streifgebiet zu verwechseln. Der Heimbereich ist das Gebiet, in dem das Tier umherstreift, er wird aber oft nicht verteidigt. Zum Teil sind Territorium und Heimbereich identisch, manchmal sind sie jedoch nicht klar unterscheidbar. Territorien werden durch agnostisches Verhalten besetzt und verteidigt. Individuen, die ein Territorium erobert haben, sind schwer daraus zu vertreiben. Revierbesitzer gewinnen Kämpfe in der Regel, weil sie mit ihrem Teriitorium bereits vertraut sind und mehr Gewinn daraus ziehen. Sie neigen daher auch eher dazu, einen Kampf eskalieren zu lassen. Sie sind im Durchschnitt auch älter und in agonistischen Interaktionen erfahrener. Der Besitz eines Territoriums wird meistenes wiederholt angezeigt, sei es durch Vogelgesang, Duftmarken oder durch Patroulieren entlang der Reviergrenzen. Einige Tierarten benutzen auch eine Kombination verschiedener Signale um so die Grenzen eindeutiger kennzeichnen zu können. Territorien werden in der Regel nur gegen Artgenossen verteidigt, da verschiedene Arten normalerweise verschiedene ökologische Nischen besetzen und so keine unmittelbare Konkurrenten sind. Ein weiterer Grund ist, dass ein Artgenosse sich eventuell mit dem Geschlechtpartner des Revierbesitzers paaren könnte. Rangordnungen und Territorien haben sich zwar aufgrund ihrer Vorteile für die Individuen evolviert, haben aber auf der Populationsebene eine wichtige Funktion, da sie stabilisierend auf die Populationsdichte wirken. Würden die Ressourcen auf alle Populationen gleichmässig verteilt, könnte es sein, dass der gerechte Anteil für ein Individuum zu klein ist um zu Überleben und eine ganze Population könnte zusammenbrechen. So aber haben immer einige Individuen eine ausreichende Menge an Ressourcen. Da immer einige untergeordnete Individuen bereit sind, beim Tod eines erfolgreicheren Tieres, in der Rangordnung aufzusteigen, bleiben die Populationen über Jahre relativ stabil. 9 Zwischen dem Paarungsverhalten und der Fitness eines Tieres besteht ein direkter Zusammenhang Balzverhalten Die meisten Tiere nehmen die Fortpflanzung vermutlich nicht bewusst als wichtigen Vorgang in ihrem Leben wahr, auch fühlen sie sich nicht ständig vom anderen Geschlecht angezogen, es besteht oft viel eher eine Tendenz jeden Artgenossen als Konkurrenten anzusehen. Bei vielen Arten müssen potentielle Geschlechtspartner vor der Paarung ein komplexes, artspezifisches Balzritual (Balzkette) durchlaufen. Dieses besteht oft aus einer Serie von Erbkoordinationen, von denen jede durch eine Handlung des Partners ausgelöst wird. Diese Abfolge versichert den beiden Partnern, dass der andere keine Bedrohung darstellt, der richtigen Art und dem richtigen Geschlecht angehört und im richtigen physiologischen Zustand für die Paarung ist. Bei eingen Arten ist das Balzverhalten auch wichtig für die Partnerwahl. Weibchen sind oft wählerischer als Männchen, da ihr Elternaufwand (Zeit und Ressourcen, die ein Individuum aufbringen muss um Nachkommen zu produzieren) pro Nachkommen meist höher ist als für das Männchen. Männchen der meisten Tierarten hingegen, paaren sich mit sovielen Weibchen wie möglich. Sie konkurrieren sich, um die Weibchen zu beeindrucken. Daher ist die Balz auch viel ausgeprägter und auch die sekundären Geschlechtsmerkmale sind sehr viel auffälliger. Bei manchen Arten entscheidet fast ausschliesslich die Konkurrenz untereinander, welche Individuen des jeweiligen Geschlechts sich paaren dürfen. Bei anderen Arten dagegen wählen Individuen - meist die Weibchen - aktiv zwischen potentiellen Geschlechtspartnern aus und zwar aufgrund spezifischer Eigenschaften der Männchen, oder von ihnen kontrollierten Ressourcen. Für diese Wahl gibt es zwei ultimate Grundlagen. Erstens ist es für Arten, bei denen das andere Geschlecht bei der Jungenaufzucht mithilft, wichtig, dass das Weibchen einen möglichst fähigen Partner auswählt. Proximater Indikator dafür kann, das Füttern des Weibchens mit viel Nahrung sein. Einige Arten bevorzugen auch Männchen, die eine extreme und energieaufwendige Balz vollführen oder die, die besonders ausgeprägte sekundäre Geschlechtsmerkmale haben. Dies sind vielleicht proximate Indikatoren für die Vitalität und Gesundheit der Männchen. Die zweite proximate Grundlage für die Partnerwahl ist die genetische Qualität. Wahrscheinlich ist die besonders wichtig, wenn sich das Männchen nicht bei der Aufzucht beteiligt. Die Wahl fällt wahrscheinlich auch hier auf das Männchen mit dem grössten Balzverhalten und den ausgeprägtesten sekundären Geschlechtsmerkmalen. Ein besonders wichtiger Aspekt der genetischen Qualtität von Männchen ist die Fähigkeit, Krankheitserregern und Parasiten zu widerstehen. Ritualisierte Handlungen, ob in der Balz oder beim agonistischen Verhalten, haben sich wahrscheinlich aus Handlungen evolviert, die früher eine unmittelbare Bedeutung hatten. (s. a. 50.21 bzw. 51.19) Paarungssysteme Innerhalb de Tierreichs gibt es sehr unterschiedliche Paarungsbeziehungen zwischen Männchen und Weibchen. Viele Arten paaren sich promiskuitiv, das heisst, es gibt keine starre Paarbindung oder dauerhafte Beziehung zwischen den Geschlechtspartnern. Bei Arten, bei denen die Partner für einen längeren Zeitraum zusammenbleiben, kann die Beziehung monogam (Paarung mit jeweils nur einem Partner) oder polygam (jedes Individuum eines Geschlechts paart sich mit mehreren Individuen eines anderen) sein. Polygame Beziehungen bestehen meist zwischen einem Männchen und vielen Weibchen (Polygynie), was sich durch den unterschiedlichen 10 Elternaufwand erklären lässt. Es gibt aber auch Arten, bei denen ein Weibchen sich mit mehreren Männchen paart (Polyandrie). Die Bedürfnisse der Jungen sind ein wichtiger ultimater Faktor für die Evolution der Paarungssysteme. Die meisten frisch geschlüpften Vögel können noch nicht selbst für sich sorgen und brauchen soviel Nahrung, wie ein einziger Elternteil alleine nicht herbeischaffen kann. Unter Umständen überleben mehr Nachkommen eines Männchens, wenn dieses bei der Aufzucht hilft, als wenn es sich mit mehreren Weibchen paart. Dies erklärt wahrscheinlich auch, warum die meisten Vögel monogam sind. Die Vogelarten, die sich nach dem Schlüpfen selber versorgen, sind nicht auf den Vater angewiesen. Diese Männchen maximieren ihren Fortpflanzungserfolg durch Paarung mit möglichst vielen Weibchen. Bei solchen Arten ist Polygynie relativ verbreitet. Bei Säugern ist die Muttermilch oft die einzige Nahrung für die Jungen. Männchen spielen in der Regel keine Rolle in der Jungenaufzucht ausser sie beschützen Weibchen und Junge, tun dies aber meistens für ein Harem. Ein weiterer Faktor, der Einfluss auf Paarungssysteme und elterliche Fürsorge hat, ist die Gewissheit über die Vaterschaft. Ein Weibchen ist sich immer sicher, dass ihre Jungen oder Eier ihre Gene enthalten. Aber die Identität des Partners ist selbst bei einer normalerweise monogamen Beziehung nicht immer eindeutig. (Vaterschaftstests mit DNA-Fingerprinting -> Methoden: Die Klärung verhaltensbiologischer Fragen mithilfe molekularbiologischer Methoden ist beschrieben auf S.1303 dt., bzw. auf P.1073 engl.) Bei den meisten Arten mit innerer Befruchtung ist die Gewissheit über die Vaterschaft relativ gering, weil Paarung und Geburt bzw. Eiablage zeitlich getrennt erfolgen. Dies erklärt möglicherweise, warum nur bei sehr wenigen Vogel- und Säugerarten ausschliesslich das Männchen für die Jungen sorgt. Dagegen ist die Gewissheit über die Vaterschaft sehr viel höher, wenn Eiablage und Paarung Hand in Hand gehen, wie es bei äusserer Befruchtung der Fall ist. Das könnte erklären, warum die elterliche Fürsorge bei Fischen und Amphibien, sofern sie überhaupt gegeben ist, mindestens genauso wahrscheinlich durch Männchen wie durch Weibchen erfolgt. Bei der Formulierung „Gewissheit über die Vaterschaft“ wird nicht gemeint, dass den Tieren dieser Faktor bewusst ist, wenn sie sich auf eine bestimmte Weise verhalten. Das elterliche Verhalten ist mit der Gewissheit über die Vaterschaft korreliert, weil die natürliche Auslese diese Beziehung über viele Generationen hinweg verstärkt hat. Bei sozialen Interaktionen werden verschiedene Kommunikationsweisen eingesetzt Bei vielen dem konkurrierenden Sozialverhalten oder dem Paarungsverhalten zuzurechnenden Gelegenheiten übermitteln Tiere absichtlich, wenn auch nicht unbedingt bewusst, Informationen durch spezielle Verhaltensweisen. Von dieser Schaustellung gehen Signale aus, die ihrerseits beim Weibchen wieder bestimmte Verhaltensweisen auslösen können. Die in der Verhaltensforschung übliche Definition von Kommunikation ist die absichtliche Informationsübermittlung zwischen Individuen. Ob Kommunikation zwischen zwei Individuen stattgefunden hat, merkt man wenn eine Handlung des „Senders“ bei einem anderen Individuum, dem „Empfänger“, eine erkennbare Verhaltensänderung hervorgerufen hat. Bsp: Der Gesang eines Vogelmännchens in seinem Revier bedeutet „Geh weg, hier bin ich!“. Wenn einem Vogelmännchen in seinem Revier eine Tonbandaufnahme eines anderen Männchens vorgespielt wird, nähert sich das Männchen und greift den Lautsprecher z.T. sogar an. Dies zeigt, 11 dass Kommunikation stattgefunden hat und der Gesang eine erkennbare Reaktion hervorgerufen hat. Nach der klassischen ethologischen Lehrmeinung evolvieren sich Kommunikationssysteme, indem die Menge und Genauigkeit der übermittelten Informationen maximiert wird. Moderne Verhaltensforscher haben eine andere Sichtweise der Evolution. Ihrer Ansicht nach evolvieren sich diese Signale, weil die Fitness des Senders durch die Auswirkungen der Nachricht auf die Empfänger gesteigert wird. Dadurch lassen sich Anpassungen erklären, bei denen die Funktion der Kommunikation Täuschung zu sein scheint, vor allem wenn die Empfänger der Botschaft einer anderen Spezies angehören. Ein anderer wichtiger Gesichtspunkt bei der Evolution der Kommunikation ist die Sinnesmodalität, die zur Informationsübermittlung eingesetzt wird. Tiere übermitteln Information mit Hilfe von optischer, akustischer, chemischer (olfatorischer), taktiler und elektrischer Signale. Welche Modalität zum Austausch von Information verwendet wird, hängt eng mit der Lebensweise einer Tierart zusammen. (Bsp. tagaktive und nachtaktive Tiere). Tiere, die über Düfte miteinander kommunizieren, senden chemische Signale aus, die man als Pheromone bezeichnet. Diese sind besonders unter Säugern und Insekten verbreitet und spielen oft im Zusammenhang mit der Fortpflanzung eine Rolle. Zu den kompliziertesten Kommunikationssystemen - zumindst unter Wirbellosen - gehört das der staatenbildenden Bienen. (vergl. 50.22 bzw. 51.21) Die meisten altruistischen Verhaltensweisen lassen sich durch den Begriff der Gesamtfitness erklären Viele soziale Verhaltensweisen sind egoistisch, das heisst, sie nützen dem Individuum auf Kosten von anderen, vor allem Konkurrenten. Wenn man davon ausgeht, dass die natürliche Auslese das Verhalten formt, ist dies auch verständlich. Die Selektion begünstigt Verhalten, das den individuellen Fortpflanzungserfolg maximiert, unabhängig davon, wie sehr dieses Verhalten anderen Artgenossen schadet. Ein Gegenteil davon ist der Altruismus. Altruismus bedeutet, dass Tiere Verhaltensweisen zeigen, die ihre individuelle Fitness senken und die Fitness des Nutzniessers steigern. Doch wie ist dieser erklärbar? Wieso opfern beispielsweise Bienen ihr Leben indem sie einen Eindringling stechen? Oder wieso pfeift ein Belding-Ziesel wenn es gejagt wird so laut, dass der Feind seine Position erkennt, aber die Artgenossen gewarnt werden? Wie kann die Evolution altruistisches Verhalten begünstigen, wenn es den Fortpflanzungserfolg der sich opfernden Individuen nicht steigert, sondern ihn sogar senken kann? Die natürliche Auslese fördert die Verhaltensweisen, die dazu beitragen, die Gene die dazu verantwortlich sind zu vermehren. Wenn ein verwandtes Tier dazu beiträgt, dass sich verwandte Tiere vermehren, so steigert es auch den Anteil seiner Gene am Genpool, denn die Gene verwandter Individuen sind zu einem grossen Teil gleich. Dies führt zum Begriff der Gesamtfitness, der den Gesamteffekt bezeichnet, den ein Individuum auf die Vermehrung seiner Gene erzielt, indem es eigene Nachkommen produziert und dazu beiträgt, dass andere nahe Verwandte ihre Nachkommenzahl steigern können. Ein wichtiges quantitatives Mass für die Gesamtfitness ist der Verwandschaftskoeffizient: Der Anteil der Gene, die bei zwei Individuen aufgrund gemeinsamer Vorfahren identisch sind. Bei Geschwistern ist dieser 0,5 und bei Cousins 0,125. es ist zu erwarten, dass Individuen einander um so eher helfen, je höher ihr Verwandtschaftskoeffizient ist. Dieser Mechanismus zur Steigerung der Gesamtfitness bezeichnet man als Familien- oder Verwandtschaftsselektion. 12 Wenn sich Altruismus durch Verwandtschaftsselektion erklären lässt, so müssten die Beteiligten bei den vorangehenden Beispielen für selbstloses Verhalten, nahe Verwandte sein. Dies ist auch der Fall, aber auf eher komplizierte Weise. Die Belding-Ziesel-Weibchen siedeln sich oft an ihrem Geburtsort an, während die Männchen weiter fortgehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Nachbarn mit ihnen verwandt sind, ist daher höher. Es sind auch mehr Weibchen, welche die Warnpfiffe ausstossen. Weibchen, die aber keine lebenden Verwandten mehr haben, stossen viel seltener Warnrufe aus. Manche Tiere verhalten sich gelegentlich altruistisch gegenüber anderen, die nicht mit ihnen verwandt sind. Ein solches Verhalten kann angepasst sein, wenn der Empfänger der Hilfe sich später revanchiert. Bei dieser gegenseitigen Hilfe spricht man von reziprokem Altruismus. Bei Tieren ist dieser selten, er kommt vor allem bei sozialen Arten vor, deren Gruppen so beständig sind, dass die Individuen häufig Gelegenheit haben, sich gegenseitig zu helfen. Wahrscheinlich steigern alle Verhaltensweisen, die altruistisch erschienen, in Wirklichkeit auf irgendeine Weise die eigene Fitness. Manche Verhaltensökologen sind daher der Meinung, dass es gar keinen echten Altruismus gibt - ausser vielleicht beim Menschen. 13