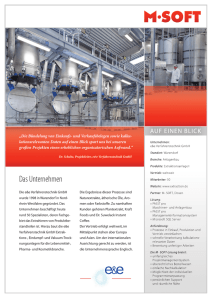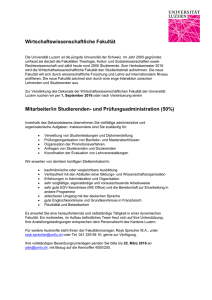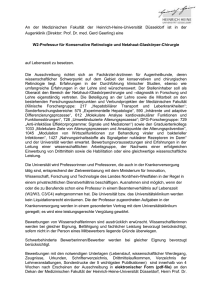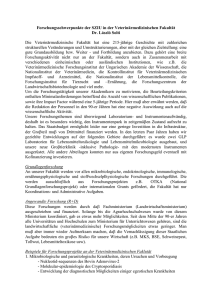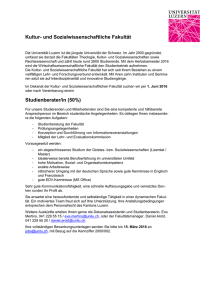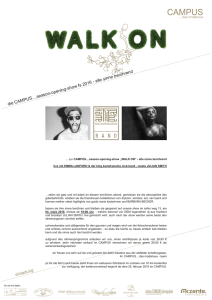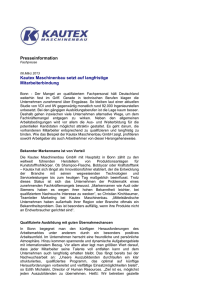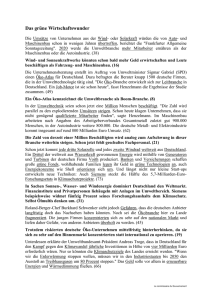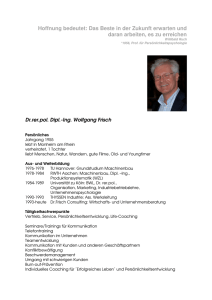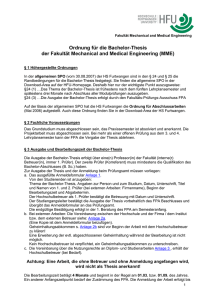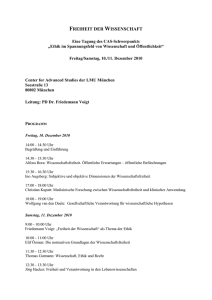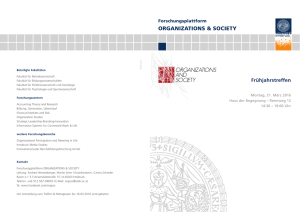Ordnung Projektarbeit BPT
Werbung

HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INFORMATIK, TECHNIK, WIRTSCHAFT, MEDIEN Campus VILLINGEN-SCHWENNINGEN Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik Ordnung für die Projektarbeit im 6. Semester des Studiengangs BPT Grundlage dieser Ordnung ist die gültige SPO der Hochschule Furtwangen für Bachelor-Studiengänge mit dem speziellen Teil für den Studiengang Bio- und Prozess-Technologie (§ 33). Da die Projektarbeit eine reguläre Veranstaltung des 6. Semesters ist, erfolgt dementsprechend eine automatische Belegung! Die Studierenden des 6. Semesters müssen auf jeden Fall tätig werden: entweder wird die Projektarbeit aktiv angemeldet (siehe unten, die aktive Anmeldung ist zur Bestätigung des Prüfers und des Korreferenten unbedingt notwendig) oder die Belegung wird im Studentensekretariat abgemeldet! Ansonsten werden 6 Leistungspunkte wegen nicht bestandener Projektarbeit auf das Maluspunktekonto eingetragen! §1 Lernziele bei der Projektarbeit In der Projektarbeit wird den Studierenden unter der Anleitung einer Betreuerin / eines Betreuers vermittelt, wie eine gestellte Aufgabe zielorientiert bearbeitet wird und wie die Ergebnisse dokumentiert und in einem Poster präsentiert werden sollen. Als Prüfungsleistungen werden von den Studierenden eine schriftliche Ausarbeitung und eine Posterpräsentation gefordert. §2 Ausgabe und Bearbeitungszeit der Projektarbeit (1) Die Projektarbeit findet im 6. Semester statt. Die Bearbeitungszeit beginnt üblicherweise mit dem Beginn der Vorlesungen, frühestens jedoch mit Semesteranfang (1. März bzw. 1. September). Die Projektarbeit ist im Prüfungsamt mit dem Anmeldeformular (Anlage 1) anzumelden. Der späteste Anmeldetermin wird vom Dekanat bekannt gegeben. Er liegt üblicherweise in der vierten Vorlesungswoche (siehe Aushang Semestertermine). (2) Die Anmeldung erfolgt in fünf Schritten (bitte unbedingt einhalten): 1. Thema, Betreuer und Korreferent suchen. 2. Anmeldeformular und Vereinbarung über die Nutzungsrechte ausfüllen. 3. Anmeldeformular vom Betreuer unterschreiben lassen. 4. Anmeldung vom Studiendekan genehmigen lassen. 5. Anmeldung beim Prüfungsamt. (3) Der Umfang der Projektarbeit beträgt 8 SWS und ergibt 6 Leistungspunkte. Das bedeutet eine Bearbeitungszeit von etwa 180 Stunden. (4) Projektthemen werden am Schwarzen Brett für Projektarbeiten ausgehängt und auf der Homepage der Fakultät veröffentlicht. Außerdem können die Betreuer/innen aus der Fakultät direkt nach Themen gefragt werden. Auch Themen aus der Industrie können in begrenztem Umfang bearbeitet werden. Es besteht aber keinerlei Anspruch darauf, dass ein/e Betreuer/in aus der Fakultät ein Industriethema übernimmt. In erster Linie sollen Themen des Studienganges BPT an der Hochschule bearbeitet werden. Betreuen können alle Professoren/-innen und Mitarbeiter/innen der Fakultät sowie externe (Firmen-) Betreuer mit einer Qualifikation, die mindestens dem Bachelor-Abschluss entspricht. (5) Die Projektarbeit ist eine Prüfungsleistung. Sie muss vom Betreuer (= Prüfer) und einem Korreferenten (= Zweitprüfer) beurteilt und benotet werden. Ein Prüfer soll ein/e Professor/in sein. (6) Grundsätzlich ist eine Projektarbeit im Ausland möglich, sofern sich ein/e Professor/in als Betreuer/in findet. Ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht. Die Betreuung im Ausland muss vor Beginn der Arbeit mit dem Studiendekan genau geklärt werden. HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INFORMATIK, TECHNIK, WIRTSCHAFT, MEDIEN Campus VILLINGEN-SCHWENNINGEN Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik § 3 Abgabe und Bewertung der Projektarbeit Die Projektarbeit wird mit einer Posterpräsentation abgeschlossen. Der Termin dafür wird vom Dekanat festgesetzt und liegt üblicherweise am Ende der Prüfungszeit. Die Organisation der Postersession obliegt den Studierenden in Absprache mit dem Studiendekan. Das Poster ist in elektronischer Form beim Betreuer abzugeben. Zusätzlich ist es als PDF per email oder direkt bei der für die MuV-News zuständigen Mitarbeiterin Frau Karin Lachner abzugeben! Die schriftliche Arbeit ist fristgerecht (siehe unten) im Dekanat abzugeben (in der Regel zwei Exemplare, zusätzlich die Ausarbeitung und ggf. Anlagen in digitaler Form auf CD-ROM). Eine Kurzfassung der Arbeit (1 bis max. 2 Seiten DIN A4) zur internen Veröffentlichung in den MuV-News ist obligatorisch (Layout siehe Anlage 10). Die Frist zur Abgabe der Arbeit endet am letzten Werktag des Semesters (also Ende Februar bzw. Ende August). Die Abgabe wird im Dekanat dokumentiert. Eine Verlängerung ist nicht möglich! Die Bewertung erfolgt durch die beiden Prüfer. Als Bewertungshilfe kann (Anlage 3) verwendet werden. Die Bewertung ist durch eine Note zu dokumentieren. § 4 Aufbau der Ausarbeitung Die Ausarbeitung muss gebunden sein und soll folgenden Aufbau haben : Format DIN A4 Einband frei gestaltbar Schriftgröße, in Absprache mit dem Betreuer 11 bis 12 Zeilenabstand, in Absprache mit dem Betreuer 1 – bis 1 ½ - zeilig Titelblatt Seite 1 Anlage 4 Abstract (deutsch und englisch) Seite 2 und 3 Anlage 5a,und 5b Eidesstattliche Erklärung Seite 4 Anlage 6 Liste der verwendeten Symbole und Formelzeichen ab Seite 5 Anlage7 Text möglichst in Dezimalklassifikation Literaturverzeichnis Anlage 8 Anhang (keine Kapitelnummer in der Klassifikation!) Vordrucke der Anlagen sind bei den Betreuern (als Word-Doc bzw. PDF) erhältlich oder in Form dieser Ordnung von der Homepage der Fakultät herunter ladbar. Literaturhinweise für das Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten finden sich in Anlage 9a, ein Beispiel für die Gestaltung von Abbildungen in Anlage 9b. § 5 Inkrafttreten Diese Ordnung gilt ab Beginn des SS 2008. HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INFORMATIK, TECHNIK, WIRTSCHAFT, MEDIEN Campus VILLINGEN-SCHWENNINGEN Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik Vereinbarung über die Nutzungsrechte an Projekt- und Thesisarbeiten Die Einräumung von Nutzungsrechten an der Projektarbeit / Bachelor- oder Master-Thesis richtet sich nach §§ 31 ff des Urheberrechtsgesetzes. Durch Rechte Dritter kann die Möglichkeit einer vertraglichen Einräumung eingeschränkt werden bzw. entfallen. Durch Unterschrift überträgt der Student / die Studentin ................................................................................................................ an den Betreuer / die Betreuerin als Vertreter der FH Furtwangen ................................................................................................................ die nachstehend aufgeführten Nutzungsrechte an der Arbeit mit dem vorläufigen Thema ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ................... a) das Recht zur Eingliederung der Arbeit in die Bibliothek, b) das Recht zur Vervielfältigung und zum Gebrauch für die Lehre durch die ProfessorInnen der Fachhochschule (§ 16 Urheberrechtsgesetz), c) das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht für Lehrzwecke durch ProfessorInnen der Fachhochschule (§ 19 Urheberrechtsgesetz), d) das Recht der Wiedergabe durch Bild oder Tonträger (§ 21 Urheberrechtsgesetz) für Lehrzwecke e) das Recht auf Nutzung des gesamten Inhalts der Arbeit für Zwecke der Forschung und Lehre. Villingen – Schwenningen, den Student/ Studentin ................................................. Betreuer/ Betreuerin HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INFORMATIK, TECHNIK, WIRTSCHAFT, MEDIEN Campus VILLINGEN-SCHWENNINGEN Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik Schema zur Beurteilung von Projekt- und Thesis-Arbeiten Kriterium Persönlicher Einsatz (Hauptgesichtspunkte): Eigeninitiative? Eigenen Ideen, Vorschläge? Selbständigkeit? Verhalten? Zielstrebigkeit (Hauptgesichtspunkte): Aufgabe weitgehend gelöst? Soll erfüllt? Erschwerte Bedingungen? Zügige Durchführung? Einhalten Abgabetermin? Fachliche Fähigkeiten (Hauptgesichtspunkte): Grundkenntnisse? Experimentelles Geschick? EDV- Kenntnisse? Bereitschaft zu lernen? Sorgfalt bei der Bearbeitung (Hauptgesichtspkt.): Systematik` Arbeitsunterlagen (Pläne, Zeichnungen, Protokolle, EDVProgramme)? Dokumentation der Arbeitsunterlagen? Zuverlässige Messungen? Gründlichkeit? Schriftliche Ausarbeitung (Hauptgesichtspunkte): Klare, verständliche Darlegung? Vollständigkeit? Eigener Beitrag erkennbar? Form der Endfassung? Vortrag (Verteidigung) (Hauptgesichtspunkte): Klarer Aufbau? Form der Präsentationsunterlagen? Klare, verständliche Sprache? Inhalt repräsentativ für Arbeit? HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INFORMATIK, TECHNIK, WIRTSCHAFT, MEDIEN Campus VILLINGEN-SCHWENNINGEN Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik Projektarbeit Titel der Arbeit von Vorname, Name StudentIn Prüfer 1. Prüfer (Akad. Grad, Vorname, Name) 2. Prüfer (Akad. Grad, Vorname, Name) Villingen- Schwenningen, den ................................... HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INFORMATIK, TECHNIK, WIRTSCHAFT, MEDIEN Campus VILLINGEN-SCHWENNINGEN Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik Thema der Projektarbeit: Verfasser: 1. Betreuer: 2. Betreuer: Semester: Kurzfassung: Schlüsselwörter: HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INFORMATIK, TECHNIK, WIRTSCHAFT, MEDIEN Campus VILLINGEN-SCHWENNINGEN Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik Title of Project : Author: 1. Examiner: 2. Examiner: Semester: Abstract: Keywords: HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INFORMATIK, TECHNIK, WIRTSCHAFT, MEDIEN Campus VILLINGEN-SCHWENNINGEN Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik Eidesstattliche Erklärung Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne unzulässige fremde Hilfe angefertigt habe. Die verwendeten Literaturquellen sind im Literaturverzeichnis vollständig zitiert. Villingen- Schwenningen, den Adresse: .............................................................................. .............................................................................. Unterschrift: .................................................................... HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INFORMATIK, TECHNIK, WIRTSCHAFT, MEDIEN Campus VILLINGEN-SCHWENNINGEN Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik Verzeichnis der Formelzeichen und Symbole (Beispiel) Formelzeichen: a A BR ci c´i D E E0 frep F G0 K KS kL LR N Q ri r T t u V V w Y m2/m3 m2 g/l/d mg/l; mol/l; % mg/l; mol/l; % m/s V V --kJ/kg -mg/l m/s g/l/d mol J mol/l/s -K s % l l/h; l/min cm/s -- spezifische Phasengrenzfläche Fläche Raumbelastung Konzentration der Komponente i Sättigungskonzentration der Komponente i in Wasser Diffusionskoeffizient Redoxpotential Normalpotential Repressionsfaktor Verweilzeitsummenfunktion Freie Standard-Enthalpie gerätespezifische Konstante Halbsättigungskoeffizient Stoffdurchgangskoeffizient Raumabbauleistung Stoffmenge Wärmemenge Reaktionsgeschwindigkeit der Komponente i Rückführverhältnis Temperatur Zeit Umsatz Reaktorvolumen Volumenstrom Leerrohrgeschwindigkeit Ertragskoeffizient griechische Symbole: µ m s-1 -h Grenzschichtdicke spezifische Wachstumsgeschwindigkeit relative Verweilzeit mittlere Verweilzeit Indizes: C ECA G I IA i m L O P Kohlendioxid EC-Abwasser gasförmig Inhibitor Industrieabwasser Komponente Mischung flüssig Sauerstoff Produkt HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INFORMATIK, TECHNIK, WIRTSCHAFT, MEDIEN Campus VILLINGEN-SCHWENNINGEN Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik Literaturverzeichnis (Beispiel) [1] Hartmann, L.: Biologische Abwasserreinigung. Springer Verlag, Berlin Heidelberg (1992) [2] Schlegel, H. G.: Allgemeine Mikrobiologie. 7. Aufl. Thieme Verlag Stuttgart (1992) [3] Wiesmann, U.: Kinetik der aeroben Abwasserreinigung durch Abbau von organischen Verbindungen und durch Nitrifikation. Chem.-Ing.-Tech. 58 (1986) Nr. 6, S. 464 – 474 [4] Hagen, J.: Chemische Reaktionstechnik: Eine Einführung mit Übungen. VCH, Weinheim (1992) [5] Siemens, W.; Worthoff, R.: Grundbegriffe der Verfahrenstechnik. Hüthig Buch Verlag, Heidelberg (1991) [6] Si-Salah, A.; Geissen, S.-U.; Vogelpohl, A.: Einflußparameter auf die biologische Nitrifikation in Festbettreaktoren. WLB Wasser, Luft und Boden 9/1991, S. 60 – 64 [7] Deckwer, W.-D.: Reaktionstechnik in Blasensäulen. Otto Salle Verlag, Frankfurt am Main (1985) Literaturhinweise wie (Deckwer, 1985) sollte man wegen der Unübersichtlichkeit unbedingt vermeiden! Ebenso sollte man vermeiden, Literaturhinweise als Fußnote anzugeben. HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INFORMATIK, TECHNIK, WIRTSCHAFT, MEDIEN Campus VILLINGEN-SCHWENNINGEN Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik Hinweise für die Organisation und Ausarbeitung der schriftlichen Arbeit In der Bibliothek der HFU, Abt. VS, sind Bücher über Planung und Verfassen wissenschaftlicher und technischer Arbeiten verfügbar: 1. Bänsch, Axel: Wissenschaftliches Arbeiten: Seminar- und Diplomarbeiten. R. Oldenburg Verlag München Wien 1992 2. Grieb, Wolfgang: Schreibtips für Diplomanden und Doktoranden in Ingenieur- und Naturwissenschaften. vde-verlag Berlin Offenbach 1993 3. Krämer, Walter: Wie schreibe ich eine Seminar, Examens- und Diplomarbeit: UTB 1633 G. Fischer Verlag Stuttgart Jena 1992 4. Poenicke, Klaus (Hrsg.): Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten. Duden 2. Aufl. Dudenverlag 1988 5. Holzbaur, U. D., M. M. Holzbaur: die Wissenschaftliche Arbeit - Leitfaden für Ingenieure, Naturwissenschaftler, Informatiker und Betriebswirte. Carl Hanser Verlag München Wien 1998 Ausserdem sei die Wahlvorlesung „Technisch-Wissenschaftliches Schreiben“ von Prof. Dr. Thomas Oppenländer empfohlen. Richtlinien für den Schriftsatz findet man im Rechtschreib-Duden. Einige Prinzipien: a) Es wird die Dezimal-Klassifikation empfohlen. Danach wird nach DIN die letzte Ziffer nicht mit einem Punkt abgeschlossen (muss in der Formatvorlage von WORD korrigiert werden); 3 Grundlagen der Membrantechnik 3.1 Mikrofiltration b) Nur so viele Gliederungsebenen wie nötig! Mehr als 3 Gliederungsebenen möglichst vermeiden. Die Gliederungsebenen ergeben sich aus der inhaltlichen Hierarchie. c) Es gibt kein Kapitel ohne Text! Das Aneinanderreihen von Kapitel- und UnterkapitelÜberschriften ohne zugeordneten Text ist nur im Inhaltsverzeichnis zulässig! d) Zwischen Zahlenwert und Einheit einer Größe steht immer ein Leerzeichen (auch bei °C und %). Nur das Gradzeichen bei Winkeln ( = 5°) wird direkt an die Zahl angehängt. e) Einheiten in eckiger Klammer nur in Verbindung mit dem Symbol oder dem Namen der Größe, nie mit dem Zahlenwert (VG [m³]; aber VG = 5 m³/h). f) Tabellen erhalten Tabellen-Überschriften („Tabelle 4: Dimensionslose Kennzahlen“ über der Tabelle anordnen), Abbildungen (Diagramme, Zeichnungen, Fotos) erhalten BildUnterschriften („Abbildung 8: Zusammenhang zwischen der....“; oder „Bild 3.2: Einfluss der ........“ g) Jede Abbildung und jede Tabelle, die im Hauptteil erscheint, muss im Text ”angezogen”, d. h. beschrieben oder in einem Hinweis erwähnt werden. Abb. 8. bzw. Tab. 4. ist jeweils zum besseren Auffinden beim ersten Auftauchen zu unterstreichen. h) Verzeichnisse (Formelzeichen-Verzeichnis, Literatur-Verzeichnis...) sind keine Kapitel und erhalten daher auch keine Kapitelnummern. Der Anhang kann in die Nummerierung einbezogen werden. i) Die Seitennummerierung beginnt nach DIN mit 1 auf der Seite nach dem Deckblatt. HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INFORMATIK, TECHNIK, WIRTSCHAFT, MEDIEN Campus VILLINGEN-SCHWENNINGEN Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik Beispiel für Abbildung und Bildunterschrift: .... linearer Zusammenhang zwischen der Adsorption und der Konzentration des DOC bis zu einem DOC von 139 g/m³ festgestellt. 3.1.2 Ergebnisse der Adsorptionsversuche Die Tabellen 4 bis 7 im Anhang enthalten die gemessenen Werte. Die Adsorptionsisothermen sind in den Abbildungen 6 bis 8 dargestellt. Isothermen: Die höchste Beladung weist hier die Kohle ROW 0,8 Supra von Norit (Abb. 6) auf. Bei einem DOC von 100 g/m³ entsprechend ca. 300 g/m³ CSB werden ca. 90 g/kg für DOC erreicht. Eine Extrapolation auf größere Konzentrationen läßt eine maximale Beladung von ca. 110 g/kg an DOC erkennen. Umgerechnet auf den CSB ergibt dies eine maximale Beladung von ca. 350 g CSB je kg Aktivkohle ROW 0,8 (ca. 35 %). Die Chemviron-Industrie-Poolkohle erreicht nur etwa 70 % der Beladung der Norit ROW. Adsorptionsisothermen für Aktivkohle NORIT ROW 0,8 Supra, Chemviron Industrial Reakt, Norit Pool und Chemviron Pool der FHF 100 Beladung / g DOC/kg AK 80 Norit ROW 0,8 Supra g/kg Chemviron Industr. Reakt Norit Pool (Falschlieferung) Chemviron Pool der FHF 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100 120 140 DOC / g/m³ Abb. 6: Adsorptionsisothermen der zuerst untersuchten Aktivkohlen Die ursprünglich als Abwasser-Poolkohle von Norit gelieferte Aktivkohle ergab absolut schlechte Ergebnisse: die Beladung erreicht nicht einmal 20 g/kg an DOC. Diese Werte sind nur vergleichbar mit der Abwasserkohle von Chemviron, die an der FHF zur Reinigung der schwachbelasteten Laborabwässer der Abteilung Schwenningen eingesetzt ist. Die Kapazität dieser beiden Kohlen ist also nicht besonders groß; für die Behandlung..... HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INFORMATIK, TECHNIK, WIRTSCHAFT, MEDIEN Campus VILLINGEN-SCHWENNINGEN Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik Studiengang Bio- und Prozess-Technologie Bachelor-Thesis bzw. Studien-/Projektarbeit Musterthema für die Arbeit Bei den Science Days, die vom 26. bis 28. September im Europapark in Rust stattfanden, prä-sentierte der Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik der FHF ein Ausstellungsobjekt, dem man seine Verfahrensfließbild des Membran-Bioreaktors durchschlagende Wirkung auf den ersten Blick nicht ansieht. Von Studenten und Mitarbeitern des Fachbereichs selbst geplant und gebaut, war da eine Anlage von Mittwoch bis zum Samstag rund um die Uhr im Einsatz und produzierte ein im Schwäbischen und Badischen wie auch im Frankfurter Raum unter verschiedenen Namen bekanntes Getränk auf bisher wenig oder nicht Kapillar-Membranmodul gekannte Art und Weise: Apfelmoscht bzw. Äppelwoi; aber kontinuierlich, wohlgemerkt. Und dies nicht nur zum Anschauen, sondern auch zum Probieren, schön gekühlt auf 10 °C. Und, als eine Besonderheit für die Jugend: hier im Europapark zum ersten Mal ein „Most Light“, mit ganz wenig Alkohol, dafür aber mit Kohlensäure wie beim Cidre, unter Druck fermentiert und aus dem EdelstahlDruckmostfass frisch gezapft. Kontinuierliche Fermentationsprozesse sind in der Biotechnologie, der Lebensmittelund Getränkeindustrie nicht gerade weit verbreitet, oft aber der Wunschtraum so mancher Betriebe. Aber gerade die Betriebe der Lebensmittel- und Getränkeherstellung sind guter Tradition verbunden und daher neuen, kontinuierlichen Prozessen gegenüber nicht immer aufgeschlossen. So wird bis heute Saft im Fass oder im Tank zu Most und Wein vergoren. Das dauert normalerweise viele Tage, bis der Zucker von der Hefe zum Alkohol umgewandelt und der Most gereift ist. Nicht so auf dem FHF-Stand. In der Versuchsanlage der Schwenninger Ingenieurinnen und Ingenieure der Verfahrenstechni k verweilt der Apfelsaft, bis der Zucker vergoren ist, im Mittel nur etwa 48 Stunden im Fermenter oder „Bioreaktor“, einem mit Mantelkühlung versehenen Glasgefäß, dem der Apfelsaft, aus Saftkonzentrat mit Wasser vorverdünnt, kontinuierlich mit einer Pumpe als Feed zugeführt wird. Dabei ist die Verdünnung so gewählt, daß im Produkt, dem Most, ein Alkoholgehalt von normalerweise gerade 5,5 % vol erreicht wird, nicht zu stark, nicht zu schwach. Das Produkt wird in ein gekühltes Getränkefass geleitet, kontinuierlich (genauer: quasikontinuierlich, d. h. etwa alle 5 Minuten eine Portion durch automatisches Öffnen eines Magnetventils für ein paar Sekunden) produziert, golden und klar filtriert, wie der gespendet von Ernst Kumpf Fruchtsäfte GmbH & Co. KG, 71706 Markgröningen; http://www.kumpf-saft.de/ HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INFORMATIK, TECHNIK, WIRTSCHAFT, MEDIEN Campus VILLINGEN-SCHWENNINGEN Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik Studiengang Bio- und Prozess-Technologie Most sein soll (und sofort auf Flasche gezogen werden könnte). Das Geheimnis dieses Qualitätsmerkmals ist ein Membran-Filtermodul aus Polypropylen. Durch diesen Filtermodul wird Hefesuspension aus dem Bioreaktor mit einer Exzenterschneckenpumpe hindurchgeschickt. Der größte Teil der Hefesuspension fließt zurück in den Bioreaktor, eine bestimmte Menge vergorener Apfelsaft, Most eben, tritt unter dem Einfluss des Pumpendrucks durch die Poren der Filtrationsmembran hindurch, sobald das Magnetventil öffnet. Das Magnetventil wird durch einen Regelkreis gesteuert, der das Niveau im Bioreaktor als Führungsgröße benutzt, wodurch der Fermenterinhalt konstant gehalten und der Produktstrom dem Feedstrom angepasst wird. Die Membran lässt also Bioreaktor mit Hefe für den Most passieren, hält Rotwein aber den „Biokatalysator“, die Hefezellen, die Glukose und Fruktose zu Ethanol vergären und auch noch einige Aromastoffe ins Produkt abgeben, im Fermenter zurück. Damit schlagen die Betreiber einer solchen Anlage zwei Fliegen mit einer Klappe: Einmal wird der wertvolle Biokatalysator, die Hefe „Saccharomyces cerevisiae“, die unter den gewählten Fermentationsbedingungen nur sehr langsam wächst, im Bioreaktor zurückgehalten, so dass sie für lange Zeit in hoher Konzentration zur Stoffumwandlung zur Verfügung steht. Zum Zweiten wird aber der Most unmittelbar klar filtriert, und zwar, ohne dass das Produkt gespeichert und dann in Verfasser: Betreuer: Membran-Bioreaktor mit Reaktor-und Produktkühlaggregat einer separaten Filtrationsstufe behandelt werden muss. Eine solche Membran-Bioreaktoranlage ist bestimmt für viele Hersteller von Apfel-, Birnen- und Traubensaft und anderen Fruchtsäften von Interesse. Jedoch ist der Anwendungsbereich dieses Bioreaktors nicht nur auf die Produktion von Most oder Wein aus Fruchtsaft beschränkt: alle anaeroben Prozesse mit langsam wachsenden Mikroorganismen können damit sehr vorteilhaft durchgeführt werden. So sollte die Versuchsanlage insbesondere auch zur Aufarbeitung organisch hochbelasteter Prozessabwässer, zum Beispiel aus der Chemischen Industrie, aber auch aus der Lebensmittelund Getränkeherstellung, eingesetzt werden mit dem Ziel, aus den organischen Inhaltsstoffen „Biogas“, ein Gemisch aus Methan und Kohlendioxid, herzustellen, das in vielen Fällen in der Produktion umgehend als Energieträger eingesetzt werden kann und somit wertvolles Erdgas oder Erdöl ersetzt. Aber eins ist klar: Der Einsatz des Verfahrens in der Getränke-Technologie, so wie hier bei den Science Days, ist natürlich viel interessanter, weil die Produkte eben schmecken, nicht riechen... Übrigens: Mit der Anlage wurde bisher nicht nur Apfelmost oder Apfelwein hergestellt, sondern in einer Studienarbeit auch Traubenwein. An die 80 Flaschen haben Sabine, Oliver und Thomas im letzten Semester produziert und abgefüllt. Die Studentinnen und Studenten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Maschinenbau und Verfahrenstechnik der FHF stehen gern mit Informatione n über ihre Anlagen und Arbeiten und im Rahmen von Projekten auch für Anwendungs versuche zur Verfügung.