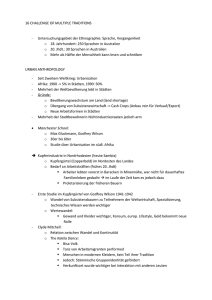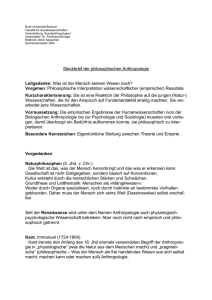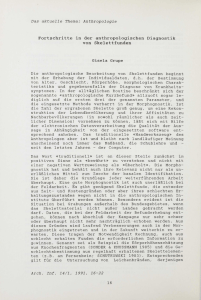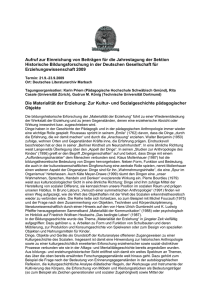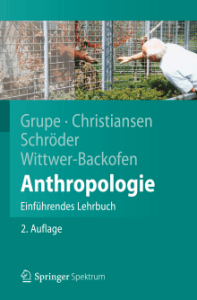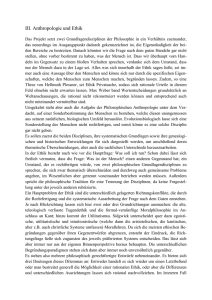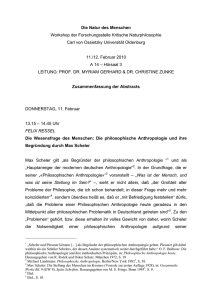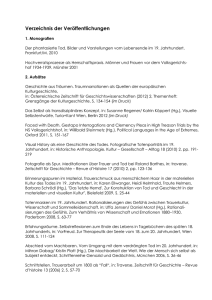Christliche Anthropologie
Werbung

Prof. Dr. Hermann Stinglhammer WS 2015/2016 Christliche Anthropologie 1. Die Frage nach dem Menschen innerhalb der Pluriformität anthropologischer Thesen Immanuel Kant (1724-1804) – der Philosoph des neuzeitlichen Weltverstehens des Menschen in seiner endlichen Subjektivität eröffnet seine Logik mit den vier wesentlichen Fragen, die den Menschen umtreiben. Und diese lauten: „ Was kann ich wissen? (Erkennen) Was soll ich tun? (Ethik) Was darf ich hoffen? (Religion) Und schließlich: „ Was ist der Mensch?“ (Logik, Werke Band 5, Darmstadt 1968, 448). Die Frage „ was ist der Mensch?“ bildet in dieser Frageanordnung den Zentralpunkt, auf den alle anderen konvergieren. Alles Erkennen, alle Ethik und Praxis des Menschen, und alle Religion sind letztlich getragen von der grundlegenden Frage des Menschen nach sich selbst. Zugleich wird darin deutlich, dass der Mensch in allen seinen Lebensvollzügen stets nach sich selbst frägt, um auszuloten, wer er denn wirklich ist. Anders gesagt: der Mensch ist seinem Wesen nach die Frage nach sich selbst. Der Mensch ist gerade nicht in feste Koordinaten hineingestellt, die sein Wesen definieren. In seiner Geistigkeit und Freiheit ist er in einen offenen Horizont hineingestellt, in dem er selbst immer neu die Antwort darauf geben muss, wer er sein soll. Alles Tun des Einzelnen wie der Menschheit als ganzer ist zuletzt nichts anderes als das Durchexperimentieren der Frage nach sich selbst, wie sie bereits in der griechischen Antike über den Eingang zum Orakel des Apoll in Delphi geschrieben war: „ Gnoti seauton“ - „ erkenne dich selbst“ !. Der Mensch scheint jene Frage zu sein, die er nicht letztgültig auflösen kann, weil er selbst gerade nicht hinter sich selbst kommen kann. Er ist schon immer als Frage da. Er ist sich als Frage gegeben und aufgegeben – und mit ihm, sofern er um seine Welt weiß, wird ihm auch diese selbst fraglich. Letztlich blickt der Mensch in einen Abgrund, der sich in seiner freien Vernunft auftut. In prägnanter Weise formuliert dies der Philosoph Friedrich Wilhelm Schelling (1775-1854), wenn er schreibt: „ Weit entfernt also, dass der Mensch und sein Tun die Welt begreiflicher mache, ist er selbst der Unbegreiflichste... gerade er, der Mensch, treibt mich zur letzten verzweiflungsvollen Frage: Warum ist überhaupt etwas? Warum ist nicht Nichts?“ (Philosophie der Offenbarung 1,7, Darmstadt 1966). Kant und Schelling legen gerade für den modernen Menschen die Frage frei, die der Mensch seinem Wesen nach ist. Es ist dies aber eine Frage, die bereits am Anfang alles Nachdenkens steht, denn es ist ja stets der Mensch, der über sich nachdenkt. Und in der Geschichte der abendländischen Tradition, in der wir uns bewegen, sind auch verschiedene Antworthorizonte aufgezeigt worden. Wir blicken ein wenig in diese Geschichte hinein. Am Beginn der europäischen Geistesgeschichte steht die grundlegende Definition des Menschen in der sokratischplatonischen Tradition als einem „ Wesen, das Vernunft hat“ . Er ist ein „ zoon logon echon“ : Lateinisch: er ist ein animal rationale: Der Mensch ist das Lebewesen, das – als spezifische Differenz zum Tier 2 (animal) Vernunft besitzt, wobei sich dieser Vernunftbesitz zugleich in seiner Sprache (logos) manifestiert, sofern er darin seine Welterkenntnis allererst möglich wird. Diese begreifende Rationalität bezeichnet in der griechischen Philosophie die spezifische Differenz des Menschen zu allem übrigen Sein. Damit hat die Philosophie Griechenlands eine grundlegende Charakterisierung des Menschen vorgenommen, die als solche das große Vorzeichen der gesamten abendländischen Kultur bildet. Der Mensch als das denkende Wesen, das in seiner Vernunft offen ist auf die Wahrheit und seine eigene Welt bauen kann. Dies zeigt sich in einer Weiterentwicklung dieser grundlegenden Vernunftbestimmung des Menschen durch den Platonschüler Aristoteles im vierten Jahrhundert vor Christus. Er bestimmt den Menschen als zoon politikon. Der Mensch ist jenes Vernunftwesen, das sich seine politische Existenz selbst organisieren kann. Also nicht instinktgebunden, sondern in einer freien Vernunft regelt der Mensch sein Zusammenleben und schafft sich dadurch alles als seinen sozialen Lebensraum. Letztlich zeigt sich in den bestimmenden Perspektiven der griechisch-antiken Philosophie eine idealistische Sicht auf den Menschen: In seiner Vernunft partizipiert er an der göttlichen Vernunft (-Idee), ohne mit ihr letztlich zur Deckung zu kommen. Als wesentlicher Lebensentwurf ergibt sich die Theorie, durch die der Mensch sich immer mehr diesem (göttlichen) Ideal annähert. Es geht hier also wesentlich um Vergeistigung und Autonomie im Denken. Das Christentum greift diese antiken Perspektiven vor allem des Platonismus auf, führt aber die Frage des Menschen nach sich selbst in seinem Horizont einer neuen und weit ausgespannten Lösung zu. Der Mensch findet die Antwort auf sich selbst, die Wahrheit über sein 3 Leben nicht einfach in seiner Vernunft. Vielmehr wird er in seinem Nachdenken einer Sehnsucht gewahr, die sein Verhältnis zu Gott als seinem Schöpfer offenlegt. Und letztlich ist Jesus Christus als der Menschgewordene das Modell der Beziehung zu Gott, in der sich seine Sehnsucht und seine Frage nach sich selbst erfüllt. Der Mensch findet so die Bestimmung seiner Existenz in Gott. Augustinus von Hippo (354-430) drückt dies aus mit jener existentiellen Sprache, in der sich sein eigenes Lebensdrama niederschlägt: „ Unruhig ist des Menschen Herz, bis es Ruhe findet in dir, oh Gott“ (Confessiones I). Das bedeutet, dass der Mensch die Antwort nach sich selbst nicht in der Welt finden kann. Er selbst ist in seiner leibhaftigen und geschichtlichen Existenz über sich selbst hinausgerufen in die Gemeinschaft mit Gott. Der Mensch ist in und mit seinem In-derWeltsein wesentlich zur Gottesgemeinschaft bestimmt. Gott ist als Grund auch das Ziel der menschlichen Frage nach sich selbst. Dies bedeutet in Bezug auf die menschliche Identität zweierlei: Zunächst – ganz positiv – ist die menschliche Existenz in ihrer wesenhaften erstens vollendungsfähig durch Gott. Sie ist – theologisch gesprochen – als kreatürliche, ja sogar als durch die Sünde entfremdete Schöpfung, capax dei, sie ist Weg zu Gott. Endliches Sein ist nicht negativ belegt, wie dies dann schon bei Augustin und in der augustinischen Tradition des Mittelalters dominant spürbar wird. Zweitens heißt dies aber kritisch und in einem nochmaligen Überstieg über den antiken Idealismus: Der Mensch kann sich nicht in seinen horizontalen Weltbezügen vollenden. Die Welt und er selbst sind ihm nicht genug. Er findet zu sich selbst im Anderen seiner Selbst, das Gott ist. Anders formuliert: Der Mensch ist das Wesen der Transzendenz, das erst im Überstieg über sich selbst in Gott zu sich selbst findet. Er hat sein Menschsein in einer grundlegenden Weise 4 theologisch-spirituell zu kultivieren. Letztlich ist dies dem endlichen Menschen aus sich selbst heraus nicht möglich. So gehört in den Begriff einer christlichen Anthropologie von Anfang an die Gnade, also die Hilfe Gottes, durch die der Mensch in seine Identität bei Gott gehoben wird. Diese ebenso idealistische wie gnadentheologische Perspektive bleibt das theologische Mittelalter im Wesentlichen in Geltung. So gilt etwa für Thomas von Aquin, dass die gesamte Schöpfungs- und Heilsgeschichte mit dem Menschen als Zentrum nicht anders zu lesen ist, als der Weg, auf dem er als der Sünder, zu dem er sich bestimmt hat, durch die Menschwerdung Jesu Christi, d.h. aus Gnade zu Gott als dem Ziel seiner selbst zurückfindet (vgl. dazu das Exodus-Reditus-Schema der thomanischen Theologie). In der Spätscholastik – etwa bei Duns Scotus - ist das Verhältnis des Menschen zu Gott bereits ganz modern gedacht worden als ein Verhältnis der Freiheit. Demnach kann die endliche Freiheit sich in ihrem Ausgriff auf Unendlichkeit erst in der Freiheit Gottes selbst gewinnen. Auch hier handelt es sich um ein Gnadengeschehen, insofern der Mensch letztlich nicht in den Raum der göttlichen Freiheit hineinfindet, sofern er stets im Gestrüpp der Endlichkeit „ hängen“ bleibt. Sofern aber der Mensch im Christentum im Horizont der Inkarnation zur Unendlichkeit bestimmt ist und das erlöste Menschsein der Weg zur Verähnlichung mit Gott ist – so spricht etwa die Theologie der griechischen Patristik von der Erlösung als der Theosis/Vergöttlichung des Menschen - , kann es nicht ausbleiben, dass der Mensch versucht, sich ohne Gott absolut zu setzen. Mit anderen Worten ATheismus ist ideengeschichtlich nur als ein postchristliches Phänomen möglich, das etwa in dem berühmten Satz Friedrich 5 Nietzsches (+ 1900) zum Ausdruck kommt: „ Wenn es einen Gott gibt, wie könnte ich es ertragen, kein Gott zu sein!“ Mit der neuen Epoche der Neuzeit verändert sich diese theonome Konstellation grundlegend, mit weitreichenden Folgen bis heute. Sie ist zu anfanghaft zu beschreiben als Herauslösung des Menschen aus seiner Gottesbeziehung. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Philosophie der Renaissance, die den Menschen ganz aus sich selbst groß und schön sein lässt (Pico della Mirandola: De diginitate hominis als das Manifest der Selbstverherrlichung des Menschen im Renaissancehumanismus, 100 Jahre vorher besteigt F. Petrarca den Mont Ventoux, er setzt als erster als Mensch den Fuß auf den Ort der Goetter, wird der Begründer des Alpinismus). In profilierter Weise führt René Descartes (1596-1650) diese These in der sog. Neuzeit fort. Der Mensch ist nunmehr nicht mehr in seiner Vernunft und Freiheit von Gott her bestimmt. Er ist nicht auf eine transzendente Wahrheit bezogen, nach der er sich in seinem Handeln ausrichten soll. Er wird aus seinem göttlichen Bezug herausgelöst und nun selbst zum Mittelpunkt der Wahrheit, die er aus sich selbst entwirft und der Natur aufdrängt. „ Cogito, ergo sum“ (statt: „ cogitor, ergo sum“ ) ist das Motto dieser neuen, immanenten Anthropologie. Der Mensch ist es nun, der Gott als Schöpfer ablöst und mittels der naturwissenschaftlichen Vernunft einer universalen Mathematik – mathesis universalis – die Welt zu bauen beginnt. Das Zeitalter des „ Machers“ , des „ homo faber“ beginnt. Der Mensch wird zum „ maitre et posseseur de la nature)“ . Mit Descartes ist so – sehr vereinfacht gesprochen – der Grundstein für die rasante Entwicklung der Moderne auf der Ebene einer experimentell abgesicherten Weltbewältigung gelegt. Damit ist der 6 Mensch einerseits in seine höchste Autonomie gesetzt. Zugleich hat Descartes diesem Denken ein Gift beigemischt, das umgekehrt dazu beiträgt, den Menschen in seiner Sonderstellung aufzulösen, wie wir gleich sehen werden. Warum? Er bestimmt die außermenschliche Welt als „ res extensae“ , als die messbare Dingwelt der Materie (das Zeitalter der Automaten). Dieser setzt er den Menschen als „ res cogitans“ gegenüber, um den Menschen als freie Vernunft zu bestimmen. Das Problem dabei ist, dass er auch den Menschen als eine „ res“ , eine Sache charakterisiert. Genau hier setzt der Prozess der Verdinglichung und Naturalisierung des Menschen ein, die wir heute verschärft beobachten. So ist also Decartes in zweifacher Hinsicht der Vater der Moderne. Er denkt den Menschen ohne transzendenten Bezug und beginnt – was damit zusammenhängt – den Menschen in die Dingwelt (Materie) einzuordnen. Es sind dann vor allem die Denker der französischen und englischen Aufklärung, die den Menschen immer weiter aus einem ideal bestimmten Horizont herauslösen. So etwa, als prominenter unter vielen, Julian Offray de LaMettrie (1709-1751), dessen 1747 erschienene Schrift den Titel trägt: L’ homme machine: der Mensch eine Maschine. Ein Jahrhundert später formuliert Ludwig Feuerbach in Deutschland (1859) seinen Fundamentalsatz der Religionskritik, die jedes metaphysische und theologische Wesen des Menschen bestreitet. Dieser Satz lautet: „ Der Mensch ist, was er isst“ , ein Satz der heute wieder in der Werbung auftaucht. Feuerbach drückt damit aus: Der Mensch ist nicht mehr als die anderen Lebewesen. Er ist reine Biologie, er ist nicht mehr als Natur. Er hat keine Bestimmung, die über seine vorfindbare Existenz hinausführt. Der Mensch ist – radikal 7 betrachtet - nichts anderes als ein physiologischer Prozess, der Mensch ist ein „ trickreiches Tier“ . Im Jahr 1859, als Feuerbach diesen materialistischen Grundsatz formulierte, erschein Darwins epochemachendes Werk „ Von der Entstehung der Arten“ . Es waren vor allem seine Nachfolger - wie etwa in Deutschland der Zoologe und Freidenker Ernst Haeckel (+1919), die den Darwinismus in einen atheistischen Biologismus umformten. Diese naturalistische Reduktion des Menschen wurde schließlich die leitende Perspektive des evolutionstheoretischen Denkens, wie sie das gesamte 19. Jahrhundert prägte und bis heute - und gerade in unserer Gegenwart - in entscheidenden Weise wirksam ist (vgl. dazu nur die mechanistische Logik der Medizin!). Sie findet ihren Niederschlag etwa in der populär gewordenen nihilistischen Philosophie Schopenhauers (Die Welt als Wille und Vorstellung) und seines Schülers Nietzsche: Es gibt keine transzendente Welt, es gibt keinen Sinn, alles ist nur ein blindes Werden. Bestenfalls kann man sich im Willen zur Macht durchsetzen. Dieser Blick auf den Menschen prägt auch die Psychoanalyse Freuds: Der Mensch ist im Letzten nichts anders als ein Triebwesen. Darauf ruht als seine vermeintliche Kultur auf. Es bleibt ihm daher nicht anderes, als sich in bewusster Weise damit zu versöhnen und sich mit seiner kleinen Existenz zu bescheiden. Einen Versuch, angesichts der zunehmenden Naturalisierung des Menschen an seiner Sonderstellung festzuhalten und diese von biologischen Gründen her aufzuzeigen, bildete die Anthropologie des beginnenden 20. Jahrhunderts in Deutschland, die mit den Namen Scheler, Portmann, Plessner und Gehlen benannt wird. Max Scheler sucht in seinem Werk: „ Die Stellung des Menschen im Kosmos“ (1928) eine einheitliche Idee des Menschen unter Einbeziehung 8 biologischen Denkens zu entwickeln. Scheler versuchte er ausgehend von der naturhaften Existenz des Menschen das Phänomen des Geistigen - seine Weltoffenheit - als die eigentliche, die zweite Natur des Menschen zu erfassen. Der Mensch zeichnet sich demnach dadurch aus, dass er in Distanz zur Welt steht und darin Umwelt hat. Der Mensch ist das Tier, das Geist hat. Einen ähnlichen Versuch unternahm Helmut Plessner in seiner philosophischen Anthropologie mit dem Titel: „ Die Stufen des Organischen und der Mensch“ (1928). Unter der Leitperspektive der „ exzentrischen Positionalität“ versucht er die Geistigkeit des Menschen aus der körperlichen Unangepasstheit des Menschen selbst verstehbar zu machen. Sie ist aus der Instinktarmut des Mängelwesens Mensch zu begründen. Denn der Mensch ist biologisch gesehen eine Frühgeburt. Zugleich ist er im Gegensatz zum Tier an keine bestimmte ökologische Nische angepasst. Diese Unangepasstheit gleicht eher durch seine Geistigkeit aus, die im Grunde als die Fähigkeit des Menschen zu bestimmen ist, Welt zu seiner Umwelt zu gestalten. Eine ganz ähnliche Richtung verfolgte auch Portmann in seinem Denken. Hier ist vom „ extrauterinen Frühjahr“ des Menschen die Rede. Der Mensch ist – im Unterschied zum Tier – unfertig. Er muss sich seine eigene Welt bauen und durch Menschen in sie eingeführt werden. Diese Perspektive greift das 1940 erschienene Werk von Arnold Gehlen auf: „ Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt“ . Bei Gehlen wird das Leben in Institutionen und in Verbindung damit das Leben als sprachliches Wesen, als Konsequenz der Unangepasstheit des Menschen an eine bestimmte ökologische Nische, die das Handeln eines Lebewesen steuert, herausgearbeitet. Diese Institutionen und Sprache sind nach Gehlen eine „ biologische Notwendigkeit“ des unangepassten Menschen. 9 Diese Betonung der Sonderstellung des Geistwesens Mensch wurde im Verlauf des 20. Jahrhunderts immer mehr bestritten zugunsten einer reinen Biologisierung. Der Mensch geht nun ganz auf im Reich der evolutiven Natur. Er ist nicht mehr Ziel eines Weges, sondern nur noch ein Moment darin. So schreibt etwa Jacques Monod, Nobelpreisträger für Medizin und Physiologie von 1975, in seinem Buch: „ Zufall und Notwendigkeit“ (1971) in paradigmatischer Weise „ Er – der Mensch – weiß nun, dass er seinen Platz am Rande des Weltalls hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden und Verbrechen“ (a.a.O. 211).Und zusammenfassend heißt es: „ ...der Mensch weiß endlich, dass er in der teilnahmslosen Unendlichkeit des Universums, aus dem er zufällig hervortrat, allein ist. Nicht nur sein Los, auch seine Pflicht steht nirgendwo geschrieben.“ (a.a.O. 219). Und ebenso schreibt Claude Levi- Strauss, ein Hauptvertreter des französischen Strukturalismus, also jener Philosophie, die das Ich des Subjekts in größere Strukturzusammenhänge hinein auflösen will, 1955: „ Die Welt hat ohne den Menschen angefangen und wird ohne ihn enden. Die Institutionen, Sitten und Gebräuche... sind vergängliche Blüten einer Schöpfung, mit der verglichen sie keinerlei Bedeutung haben“ (Tristes tropiques, Paris 1955, 405). Der Mensch also nur als ein Moment von vielen im großen Prozess der kosmischen Entwicklungen und Strukturen. So Michel Foucault: „ Heute kann man nur noch denken an die leeren Stellen, die der verschwundene Mensch hinterlässt... allen, die noch vom Menschen, seiner Herrschaft, seiner Befreiung reden wollen, allen die fragen, was der Mensch ist... kann man nur noch mit einem philosophischen Lächeln antworten“ . (Les mots et les choses, Paris 1966, 353). Am Ende unserer wirklichen und skizzenhaften Reise durch die Geschichte der abendländischen 10 Anthropologie zeigt sich also: Der Mensch hat sich im heutigen philosophischen Denken zu verabschieden von seiner Sonderstellung, wie sie ihm durch idealistische Positionen – zumal in der christlichen Tradition – zuerkannt wurde. Auch die Philosophie ist – jenseits des Christentums – bereits in das Stadium des Posthumanismus. Der Mensch wird – in extremen Positionen der sog. Gehirnphilosophie (mind-brain-Debatte) – als ReizReaktionsmechanismus gesehen. Gerade die neurophysiologische Zugehensweise auf den Menschen bestreitet heute jegliche besondere geistige Verfasstheit des Menschen, die die qualitative Differenz des Menschen im Vergleich zum rein biologischen Dasein ausmachen würde. Es gibt keine spezifische Differenz des Humanen. Darum kann sich der Mensch selbst optimieren ohne bestimmte anthropologische Normvorgaben. „ Der Mensch ist sein eigenes Experiment“ , so Mark Jongen in der Nr. 33 der Zeit vom 9. August 2001. Er diagnostiziert hier einen Mentalitätswandel, der jede Selbstzwecklichkeit des Menschen im kantischen Sinn aufgebe. Maßstab seiner Möglichkeiten ist allein die pragmatische Vernunft. Daher, so schließt Mark Jongen: „ Der Gott, der allein uns retten kann... ist kein moralischer Deus ex machina, sondern schlummert nirgendwo anders, als in den kybernetischen Lernflächen selbst, die sich in Laboratorien einstellen“ (31). Was der Mensch ist, ist wozu er sich hineinexperimentiert. Aus einer Transzendenz „ nach oben“ wird eine Transzendenz „ nach vorne“ (vgl. élan vital) der Gattung. Wie weit diese Naturalisierung des Menschen voranschreitet, zeigt sich in der biologistischen Bestreitung seiner Freiheit. Der freie Wille ist demnach eine Illusion. In dieser Hinsicht darf ich auf den Artikel von Manuela Lenzen in der 38. Nummer der Zeit vom 13. September 2001 auf Seite 37 verweisen: „ Wie viel Freiheit darfs denn sein?“ 11 Die grundlegende These lautet: Unser Bewusstsein von Freiheit ist ebenfalls ein Scheinphänomen: „ Alle mentalen Prozesse beruhten vielmehr auf rein materiellen Vorgängen und seien daher rein deterministisch“ (37). Das heißt, das was wir als unsere Freiheit bewusstseinsmäßig wahrnehmen, ist bereits in einem neuronalen Prozess aktiviert. Diese Erkenntnis lautet dann in griffiger Weise: „ Wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun“ (37). Damit wären alle Phänomene wie Schuld, Reue und Sühne und Wiedergutmachung hinfällig. Dieser Position stellen nun aber Philosophen entgegen, dass diese biologistische Beurteilung von Freiheit bzw. Nichtfreiheit selbst wieder ein Akt der Freiheit sei. Wo der Mensch sich als das determinierte Wesen der Nichtfreiheit bestimmt, setzt er nun gerade einen Akt der Freiheit. Hinter diesen Akt kann man begründungslogisch nicht zurück. Selbst wo ein Verfechter des Biologismus die Realität der Freiheit bestreitet, setzt er einen Akt von Freiheit. An dieser Stelle stehen sich nun das posthumanistische Menschenbild und das humanistische Menschenbild in einer unmittelbaren Weise gegenüber. Es besteht gegenwärtig eine Situation, in der die biologistische Anthropologie für ihre Position die besseren Argumente in der Hand zu halten glaubt. Ihr Ergebnis lautet daher: „ Der Mensch ist nichts mehr als seine biologische Natur. Es gibt kein spezifische Dignität des Menschseins.“ In diesem mechanistisch-materialistischen Menschenbild ist es daher posthumanistisch auch wieder möglich, von Menschenzüchtung zu sprechen, wie dies etwa 1999 in Peter Sloterdijks berühmter Elmauer Rede „ Regeln für den Menschenpark“ der Fall war. Entscheiden wird dann der Philosophenkönig über die Auswahlkriterien dieses Menschenzuchtprogramms. Dies markiert den gegenwärtigen Ist12 Stand der philosophisch-naturwissenschaftlichen Sicht vom Menschen. Überblickt man die mehr als 2500jährige Geschichte der Frage nach dem Menschen innerhalb der großen geistesgeschichtlichen Horizonte, lässt sich feststellen, dass sie sich im Wesentlichen auf zwei Alternativen eingrenzen lässt. Die eine heißt, „ der Mensch ist mehr als...“ : Der Mensch ist mehr als die übrigen Lebewesen, er ist mehr als Bios. In seiner geistigen Freiheit ragt er hinaus in einen Mehrwert, von dem her er als Mensch bestimmt wird, sei dieser Mehrwert nur geistiger oder dezidiert religiöser Natur. Die andere Alternative lautet: „ der Mensch ist nicht mehr als...“ : Der Mensch ist einzureihen in die Entwicklungsgeschichte der Natur, der Mensch fällt aus den Regelkreisen und Strukturen der Evolution nicht heraus, der Mensch ist nichts weiter als ein gut angepasster Lebensorganismus. Alles, was vermeintlich Kultur und Religion scheint, ist im Grund nichts anderes als seine evolutive Natur. Alles andere ist falsches Bewusstsein. Diese Enttäuschung ist dem Menschen als seine Wahrheit zuzumuten. Insgesamt erscheint die Selbstauslegung des postmodernen Menschen radikal eindimensional: Der Mensch als radikal naturwissenschaftliche Vernunft, die alle seine Lebenshorizonte durchprägt: Philosophie, Biologie, Ökonomie, Politik etc. Es entfällt beinahe vollständig die Dimension des homo symbolicus und religiosus. Es bleibt die radikale Immanenz (vgl. Umfragen zur Bedeutung von Religion im Westen). Dennoch werden andere Stimmen laut. Es war z. B. der 11. September, der tiefe Schneisen in das glatte Design postmoderner Anthropologie und ihrer vermeintlichen Erfolgsgeschichte schlug. Es 13 ist die Klimaerwärmung, die verdeutlicht, dass der Mensch in Zusammenhänge der Verantwortung hineingestellt ist. Und es regt sich ein Unwohlsein des Menschen in Bezug auf sich selbst, sofern er sich die Frage stellen muss, ob es für ihn noch eine Sinnwirklichkeit gibt, die ihm erlaubt, unvertauschbar er selbst zu sein und nicht ein beliebiger und damit auswechselbarer „ Fall von Mensch“ . Psychologen stellen in dieser Hinsicht fest: „ Die derzeitige Stimmung in unserer Gesellschaft ist für manchen die Chance, bis zur Sinnfrage des Lebens vorzustoßen.“ (Vgl. Die Zeit, Nr. 39, 20. September 2001, Seite 67). Es stellt sich heute zunehmend die Frage nach der Qualität des Menschseins überhaupt. Darin scheint das Projekt der Moderne an ihr Ende gekommen zu sein. Die Frage nach dem Mehrwert des Lebens wird neu gestellt (mindestens in sog. Peergroups). Auch das Religiös-Spirituelle wird wieder entschiedener nachgesucht (wenn auch – aus verschiedenen Gründen – an den Kirchen vorbei). Dennoch werden Menschen wieder sensibel für ihre symbolische und religiöse Dimension. Auch das Verhältnis von Vernunft und Glaube wieder neu diskutiert und dabei dem Glauben Unvertretbarkeiten für das Humanum zuerkannt (vgl. das Habermasdiktum: unsere Gesellschaft lebt von religiösen Gründen, die sie selber nicht generieren kann). Die Frage der Theologie an die Philosophie lautet daher, ob sie in ihrem Denken den Menschen und die Welt wirklich stimmig erklären kann. Gerade so ist die Frage nach dem Menschsein des Menschen ein Schauplatz des konkurrierenden Wettbewerbs um die richtige Antwort. In diesem Diskurs erhebt auch die christliche Anthropologie ihre Stimme. Was aber bedeutet christliche Anthropologie? Und welche Rolle spielt sie im Projekt dieses Masterstudiengangs Caritaswissenschaften und werteorientiertes Management und den 14 damit verbundenen Praxisgestalten? Was meint also zunächst der Begriff einer „ theologischen Anthropologie?“ 2. Zum Begriff der theologischen Anthropologie Unter theologischer Anthropologie versteht man diejenige Perspektive, in der der Glaube den Menschen erkennt und wahrnimmt. Im Gegensatz etwa zu den naturalistischen Positionen hält der Glaube an einem Mehrwert des Menschen fest, der in seiner Gottesbeziehung begründet liegt. Diese bestimmt den Menschen in seinem Dasein in einer spezifischen und grundlegenden Weise. Daher kann es bei einer theologischen Anthropologie nicht um einen theologischen Sonderbereich, der – im Sinne einer Übernatur – noch zum naturalen Bestand des Menschen dazukommt. So wäre eine theologische Anthropologie völlig falsch verstanden, wenn sie lediglich durch ein „ und“ an ein in sich vollständiges Menschsein angefügt würde (im Sinne einer superadditums, das dann ja gerade nicht notwendig für den Menschen wäre, es ginge auch ohne diese theologische Bestimmung). Theologische Anthropologie bezieht sich auf die gesamte Wirklichkeit des Menschen, dies aber in theologischer Perspektive: weil der eine und ganze Mensch von seiner Beziehung zu Gott, oder besser: von der Beziehung Gottes zu ihm betroffen ist. Das heißt: theologische Anthropologie bezieht sich auf alle Dimensionen des Menschseins, seien sie etwa biologischer, soziologischer, ethischer und psychologischer Art. Sie fügt diesen Realitäten nicht noch die ihre hinzu, sondern interpretiert sie im Licht des Glaubens. Denn die Botschaft des Glaubens von Gott und dem menschgewordenen Jesus Christus bezieht sich ja gerade auf den konkreten Menschen, sonst wäre der Glaube auch nicht das Heil des Menschen, sondern ein anderes, ihm fremdes Heil. Allerdings werden 15 im Licht des Glaubens neue Dimensionen des Menschseins sichtbar, die der Glaube kritisch-produktiv „ um des Menschen willen“ zu benennen hat. Theologische Anthropologie versteht sich als eine kritische Theorie humanen Menschseins im Horizont der Gottesbeziehung. Sie versteht sich so als Lebenskultur aus dem Glauben, sofern Gott notwendig in die Definition des Menschseins gehört. Denn in der Perspektive des Glaubens ist er unhintergehbar Mensch von Gott her und auf Gott hin, so dass er zu seinem rechten Selbstvollzug auf seine Gottesbeziehung verwiesen ist. Mit anderen Worten: Gott ist nicht der Konkurrent menschlicher Freiheit und Identität, sondern vielmehr das Medium dazu. Das heißt, das Menschsein des Menschen ruht in seinem Selbst- und Weltbezug bis hinein in die Erkenntnisordnung positiv oder negativ auf seinem Gottesbezug, sofern er ihn bejaht oder verneint. Positiv beschreibt theologische Anthropologie das Glücken einer menschlichen Existenz vor Gott als das „ Heil schon in der Geschichte“ als Ahnung des Heils über den Tod hinaus. Negativ beschreibt es die Aporien und das Unglück eines Menschen in der Entfremdung, die aus seiner Abkehr, konkret aus seinem Sündersein erwächst. Theologisch Anthropologie macht darin geltend, dass der Mensch in einen Horizont gestellt ist, der weiter reicht als die Sichtweite seiner eigenen Vernunft und dieser Horizont das unhintergehbare Milieu humaner Praxis- und Sinngestalten ausmacht. Augustin formuliert dies so: „ fecisti nos ad te“ - auf dich hin hast du uns geschaffen. Menschliche Existenz ist so eingespannt in eine dialektisches Zueinander von Ichsein (Zentralität) und Gottesbezug (Exzentrizität, Transzendenz), in dem sich der geschichtlich Mensch in seinem In-der-Welt-Sein ergreifen oder verfehlen kann. 16 In der Perspektive katholischer Theologie ist deshalb diejenige Wirklichkeit, die mit den Begriffen Gott, Jesus Christus, Geist und Gnade anvisiert wird, gerade nicht der heteronome Gegensatz zum endlichen Menschsein. Sie ist vielmehr die erfüllende Vollendung, der heilsame Raum, der vielgestaltigen Formen menschlicher Selbstergreifung im Raum der Geschichte. Insofern lässt sich eine theologische Anthropologie als theologische Freiheitslehre verstehen. Dies ist der Ansatz, den ich in dieser Vorlesung vertrete. Es soll innerhalb der verschiedenen anthropologischen Sachverhalte aufgezeigt werden, wie der Glaube den Menschen den Menschen in eine neue Freiheit, die sich in heilsamer Weise in seinem Umgang mit sich, den anderen und mit der Welt auswirkt. Insofern ist theologische Anthropologie konkrete Gnadentheologie. Mit Eugen Biser gesprochen: Theologie Anthropologie ist „ Modalanthropologie“ , sie zeigt auf, zu welchen Möglichkeiten seines Menschseins der Glaube den Menschen freisetzt. Und insofern ist theologische Anthropologie kein abstraktes, sondern ein theopragmatisches Wissen, das sich bewährt, wo es in seiner Wahrheit gelebt wird. Gerade so bringt sie theologisch den „ Mehrwert“ des Menschen zur Geltung und gibt – in Anknüpfung und Widerspruch zum gesellschaftlichen Lebenswissen - Impulse zur Kultivierung humanen Menschenseins. In einem ersten großen Hauptteil soll der Erfahrungswirklichkeit des Menschen breiter Raum gegeben werden. Dies gilt zumal für die Handlungsfelder christlich-diakonischen und caritativen Handelns im Raum der Kirche. Sofern der Mensch im Sinne einer theologischen Anthropologie der Adressat des Heilshandelns der Kirche im Namen Gottes ist, bildet diese die entscheidende Kriteriologie, anders formuliert: das theologische Leitbild, auf dem caritatives – und darüber hinaus – humanes Handeln aufruht, sofern er den eben 17 benannten „ Mehrwert“ des Menschen im Blick hat, der mehr ist als seine eindimensionale Einschätzung als z.B. Schüler, Arbeitnehmer oder Betreuungsfall. Er steht theologisch in größeren Zusammenhängen, die etwa mit seinen unveräußerlichen Rechten als unvertauschbarer Person im Sinne einer gottgewollten und gottgegründeten menschlichen Individualität. 3. Phänomenologie des Menschseins – eine kleine Analyse menschlicher Existenz 3. 1. Die großen Urwünsche Wenn ich mich einer Phänomenbeschreibung des Menschen zuwende, geht es nun um die inneren Antriebe des Menschen in ihrer lebensprägenden Wirklichkeit. Religionssoziologisch wurden diese als die großen Urwünsche und Ursehnsüchte des Menschen benannt, als „ Lebensheiligtümer“ (P. M. Zulehner), die gegeben sein müssen, damit der Mensch sein Leben als heil und gut empfinden kann. Umgekehrt, wo eines der Lebensheiligtümer fehlt, empfindet sich der Mensch als lebensbehindert, bis dahin, dass er sagen muss: „ dies ist kein Leben mehr!“ In einem zweiten Schritt sollen diese unabdingbaren Urwünsche mit der konkreten Lebenswirklichkeit des einzelnen Menschen in Beziehung gesetzt werden. Es wird sich – was nicht verwundert – zeigen, dass immer eine Differenz zwischen Ideal und Wirklichkeit bleibt. Sie ist es ja, die uns – wenn sie nicht zu groß wird – „ in Bewegung“ hält. Ich stütze mich im Zusammenhang der Urwünsche des Menschen auf valide Umfrageergebnisse ein breit angelegten 18 pastoralsoziologischen Umfrage (Paul-Michael Zulehner: Zur statistischen Analyse vgl.: G. Schmidtchen: Was den Deutschen heilig ist, München 1979; Paul-Michael Zulehner: Religion im Leben der Österreicher, Wien 1982; ders.: Leutereligion, Wien 1982; ders:. Leibhaftig glauben. Lebenskultur nach dem Evangelium, Freiburg 3. Auflage 1989, Seite 15-30.) Der Umfrage zufolge lassen sich diese „ Lebensheiligtümer“ in der Sinntrias von „ Name, Macht und Heimat“ zusammenfassen. In ihnen bündeln sich die Hoffnungen auf gelingendes, glückendes und gutes Leben. 3.1.1. Name Eine der großen Sehnsüchte jedes Menschen ist es, dass er einen – seinen - Namen habe. Jeder Mensch will unverwechselbar und einmalig sein – und darin von den anderen an-erkannt werden. In der Sehnsucht nach einem Namen artikuliert sich zugleich die Sehnsucht nach gelingenden Beziehungen aus. Wo der Mensch als er selbst wertgeschätzt wird und keine Rollen spielen muss. Der Namen steht für Identität die gelebt werden darf unter dem liebenden Blick des anderen. Einen Namen zu haben, bedeutet nicht ein Nichts zu sein, sondern ein Ich, wertvoll zu sein für jemand, jenseits aller Leistung. Die Bibel nennt daher die erotische Begegnung von Mann und Frau als ein „ Einander- Erkennen“ , als Anerkennen im Horizont einer Beziehung, in der mein Name gut aufgehoben ist und geschützt wird. die das Du des andren . Mit der Sehnsucht nach einem individuellen, einmaligen Namen sind damit verbunden die Sehnsucht nach vertrauensvoller Beziehung, nach körperlicher und emotionaler Nähe, nach Verständnis und Zärtlichkeit, Zuwendung und dem Gefühl der 19 Geborgenheit, in der er Ich sein darf. Denn es gehört zur belastenden Alltagserfahrung des Menschen, dass er ansonsten in seinem persönlichen Namen, in seinem unverwechselbaren Ich gerade nicht nicht gefragt ist. Er wird in vielen Bereichen zur Nummer, zur anonymen Person, zum No-Body, zum Rollen- und Funktionsträger, zum beliebigen Konsumenten, dem Einmaligkeit nur suggeriert wird, ohne dass er als Einzelner gemeint ist. Auf der Ebene der Gesellschaft und der beruflichen Existenz wird nicht gefragt, wer er ist, sondern was er leistet und was er sich leisten kann. Diese gesellschaftliche Wirklichkeit erlebt der Mensch als defizitär, als Lebensbehinderungen in denen er sein eigenes Ich nicht leben darf. Dies umso mehr als die verschiedenen sozialen Räume ein pluriformes Ich, die sog. „ multiple Persönlichkeit“ (vgl. Richard David Precht: Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?“ 2007) hervorrufen. Anders gesagt, der Mensch erlebt sein Leben wesentlich als persönlichkeits- und identitätszersetzend. Er bewegt sich permanent in Lebenswelten, die ihn daran hindern, seinen vollen Namen, sein eigenes Ich als ernstgenommen und als bejaht zu erleben. In dieser Hinsicht sagen nach Zulehner 88 % der Befragten: „ Heilig ist: - dass ich Menschen um mich habe, die ich lieben kann und die auch mich lieben“ (88 %); - dass ich als Mensch allein wertvoll bin, und nicht erst, wenn ich etwas leiste im Sinne von Funktionieren (76 %); d.h. dem Menschen gilt die Verkürzung seines Reichtums als liebenswert – einmaliger Person auf Arbeits- oder Kaufkraft, als bürokratisch steuerbaren Bürger, als verwerflich und unheilig; - dass jemand mich ganz persönlich liebt und ich nicht beliebig 20 austauschbar bin (77 %); und - dass ich von anderen nicht ständig ausgenützt werde (72 %). 3.1.2. Macht Die zweite Hoffnungsperspektive des Menschen bündelt sich in der Sinnbedeutung des Wortes „ Macht“ . Macht bedeutet zunächst ganz: etwas machen können, etwas tun können, lebendig sein, aktiv auf die Welt ausgreifen. Macht bildet so das Gegensatzwort zu Ohnmacht, wo der Mensch eben nichts machen kann, wo er sich fremden Mächten ausgeliefert fühlt, bis dahin, dass er resigniert sagen muss: „ da kann man nichts mehr machen!“ – „ da sind Lebensmöglichkeiten unwiederbringlich verloren. Es gehört zum großen Lebenswunsch für ein gutes Leben persönliche Selbstmächtigkeit zu erleben, gestalten zu können, seiner selbst mächtig zu sein, d.h. auto-nom zu sein und nicht in repressiven oder entfremdenden Verhältnissen leben zu müssen. So gilt in der Analyse der Glücksforschung die Demokratie als der beste Staats- und Gesellschaftsform in Bezug auf das Glück der Menschen. Denn sie garantiert die Lebensheiligtümer von Freiheit, Selbstbestimmung und Menschenwürde und der damit verbundenen Personrechten. Macht steht daher für eigenverantwortliche Lebensgestaltung. Im Hoffnungswort „ Macht“ bündelt sich die Sehnsucht des Menschen jenseits lebensbehindernder Strukturen und Situationen leben zu dürfen, sei dies nun im Raum der Gesellschaft oder auch in Bezug auf die unmittelbare private und persönliche Existenz. Es ist daher verständlich, wenn den Leuten heilig ist: „ dass ich meine persönliche Freiheit besitze, (ca. 90 %) 21 – dass ich mein Leben leben kann, wie ich es mir vorstelle“ , (90 %). Die beiden hochrangigen Symbolworte des eigenen individuellen Namens und der kreativen Selbstmächtigkeit münden ein in den dritten Begriff für gelingendes Leben: „ Heimat“ . 3.1.3. Heimat Kaum ein Begriff ist so positiv emotional besetzt wie „ Heimat“ (vgl. die gleichlautende Filmserie dazu) Mit dem Begriff „ Heimat“ verbinden Menschen heute vor allem emotionale Orte und Beziehungen, die die Möglichkeit des Daheimsein ermöglichen. Denn das ständige Unterwegssein ist nur in der Werbung schön. Ansonsten ist es belastend, beziehungs(zer)störend und führt in die Einsamkeit (unter der gerade der mobile Managertyp zu leiden hat). Viele Menschen haben „ Heimweh“ . Denn Heimat, das bedeutet den vertrauten und geschützten Ort, wo der Mensch aus den vielfachen Entfremdungen seiner Existenz aussteigen kann, um ein Obdach für seine Seele zu finden. Heimat ist in dieser Weise ein Sehnsuchtswort für einen Ort, wo ich sein darf, ich nicht im Kampf des Lebens stehen muss, sondern ausrasten darf. Heimat bedeutet das Wissen darum, dass ich einen Ort habe, wo mein Leben verwurzelt ist, wo ich einfach hingehöre, so dass ich einen Ort im Leben habe. Von daher ist das eigene Haus eines der großen Lebensheiligtümer gerade der Deutschen. Heimat, das ist der Fixpunkt meiner Existenz, der mir immer neu ein Nach-Hause-Kommen möglich macht (vgl. ET „ nach Hause…“ ) darf. Kaum etwas trifft den Menschen mehr, als von seiner Heimat, seinem Besitz, seinen Leuten vertrieben zu werden. Heimat, das bedeutet den Wunsch nach Verwurzelung, nach einem letzten Halt im Leben. Der Begriff Heimat ist daher zugleich 22 verbunden mit den Begriffen Familie, sozialer Gruppe, religiöser oder nationaler Identität. Heimat, das ist der sichere Boden, auf dem sich die verschiedenen Wechselfälle des Lebens zusammen mit anderen bestehen lassen, wo man zusammen mit anderen weiß, wie das Leben gelebt werden So ist es den Leuten durchaus heilig: - „ einer bestimmten Nation anzugehören; - dass ich auf meine Heimat stolz sein kann und ich sie liebe; - dass meine Familie und Verwandtschaft eng zusammenhalten“ (ca. 70 %). Paul Zulehner fasst diese Lebenshoffnungen als Ahnungen von einem guten Leben zusammen in einer lyrischen Verdichtung seine statischen Erhebungen. - Was es braucht, damit menschliches Leben gutes, glückendes Leben sein kann. “ Unausrottbar ist unser Wunsch nach Leben. Wer wählte in seinen Träumen, gestellt vor die Wahl zwischen Leben und Tod, nicht das Leben? Leben, wie wir es erträumen, erhoffen, und wünschen: Namen zu haben, einmalig, geachtet, Gesichter zu haben, einander zugewandt, 23 was Ansehen stiftet; wir lieben einander und werden geliebt, und dies vor jeder Leistung, unbedingt, einfach, weil Mensch, nicht gebunden an Jugend, Schönheit und Macht, zwecklos, und doch voller Sinn. Leben, wie wir es erträumen, erhoffen, uns wünschen: Wir wollen frei sein, beweglich und mächtig: Welt zu gestalten nach unserem Bild, uns anzueignen Zeit und Raum, Körper und Wunsch; nicht zerstückelt durch Zwänge, ganz und heil; nicht behindert zu wachsen; Männer und Frauen, selbstmächtig, Leben zu gestalten; zur Gestaltung gebracht, 24 so aber frei, andre gelten zu lassen. Leben, wie wir es erträumen, erhoffen, uns wünschen: Heimat dem Leben, ein Boden für Wurzeln, Welt, uns zu eigen, Besitz, um zu sitzen, doch auch Geben und Nehmen. Geborgenheit und ein Zuhause. Das Land unserer Träume, das Haus unserer Hoffnung: es ist diese Welt und ihre Geschichte, die unsre, die deine, die meine. Gute Arbeit und Spiel, Ruhe und Liebe, Feste des Lebens, geborgen im Alltag, aus ihm kommend und doch ihm enthoben. Bevorzugter Ort unserer Wünsche: die Feste der Liebe, die Männer und Frauen 25 einander zugewandt erleben. All diese Feste sind eine Verheißung, dass Hoffnung auf Leben kein Trug, keine Täuschung Spuren gelungenen Lebens; sie geben uns eine Ahnung von dem, was noch aussteht: von gutem, ewigem Leben.“ (Leibhaftig glauben, 27f.). 26