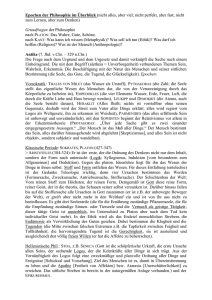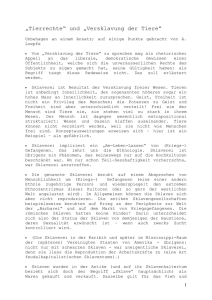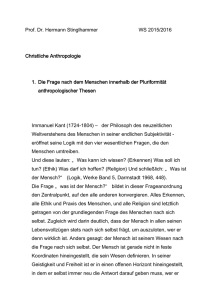IV. Argumente für die Existenz Gottes - UK
Werbung

PD Dr. Achim Lohmar, VL Einführung in die Religionsphilosophie, WS 04/05 Im folgenden finden Sie den Texte meiner Vorlesung. Ich habe ihn nicht mehr extra durchgesehen, und so kann es durchaus sein, dass orthographische und Interpunktionsfehler auftauchen. Die Literaturangaben über die in der Vorlesung verwendeten Texte werden noch zum Ende des Semesters nachgeliefert. Inhalt (wird noch weitergeführt) I. Sprache, Realität, Religion 2 a) Ist religiöse Rede sinnlos? 2 b) Ist Gott unaussprechlich? 13 c) Ist religiöse Rede wesentlich bekundend? Wittgenstein über Religion. 19 II. Glaube und Vernunft 39 a) Evidentialismus 43 b) Fideismus 49 c) Zur Beurteilung von Fideismus und Evidentialismus 56 III. Die Attribute Gottes 71 a) Einleitung 71 b) Allmacht (Omnipotenz) 84 IV. Argumente für die Existenz Gottes 98 1) Das ontologische Argument 102 a) Anselms Argument aus Kapitel 2 des Proslogion 102 b) Anselm, Descartes und Kants Kritik des ontologischen Arguments 113 V. Die Übel in der Welt als ein Problem für den Theismus 125 2 I. Sprache, Realität, Religion a) Ist religiöse Rede sinnlos? Theismus und Atheismus, sollte man zumindest meinen, sind beides zwar nicht nur, aber im Kern durchaus kognitive Einstellungen des Für-wahr-Haltens. Theisten halten für wahr, was Atheisten für falsch halten, und umgekehrt. Dass Theismus und Atheismus einander ausschließen oder logisch miteinander unvereinbar sind, gehört dabei auch zum Selbstverständnis von Theisten und Atheisten selbst. „Atheism“, schreibt Julian Baggini in seinem kleinen Büchlein Atheism. A Very Short Introduction, „ is in fact extremely simple to define: it is the belief that there is no God or gods.” (S. 3) In seiner Arguing for Atheism betitelten Einführung in die Religionsphilosophie interpretiert Robin Le Poidevin Atheismus als eine bestimmte Doktrin – eine Lehre also, durch die man sich auf die Wahrheit oder Falschheit bestimmter Aussagen festlegt: „An atheist is one who denies the existence of a personal, transcendent creator of the universe, rather than one who simply lives life without reference to such a being.” Ein Theist dagegen ist jemand, der gerade das behauptet, was der Atheist verneint: “ A theist is one who asserts the existence of such a creator.“ (S.xvii) Und in ihrer berühmten Debatte über Atheismus und Theismus äußern sich John Smart und John Haldane im gleichen Sinne. Smart, der für den Atheismus argumentiert, schreibt: „ Atheism I take to be the denial of theism[…]“ (S. 8) – eine Auffassung, die Haldane mit ihm teilt, wenn er Atheismus und Theismus als “opposing view[s]“ bezeichnet. (S. 77). Vielleicht werden Sie diese Darstellung als eine Selbstverständlichkeit oder sogar als trivial ansehen. So ist es aber nicht. Denn die soeben skizzierte Auffassung – das soeben skizzierte Selbstverständnis von Theisten und Atheisten selbst – ist durch eine bestimmte Sicht der religiösen Rede in Frage gestellt worden. Wie ist das möglich? Was kann man hier in Frage stellen, ohne sich zugleich auf eine der beiden miteinander konkurrierenden Ansichten festlegen zu müssen? Man kann das Selbstbild von Theisten und Atheisten unterminieren, indem man zeigt, dass gar keine echte Konkurrenz zwischen beiden besteht bzw. bestehen kann. Das war die Auffassung der logischen Positivisten des Wiener Kreises und des logischen Empirismus eines Alfred J. Ayer. In seinem bekanntesten Werk Sprache, Wahrheit und Logik von 1935 schreibt Ayer: [...] die Aussage „Gott existiert“ ist eine metaphysische Äußerung, die weder wahr noch falsch sein kann. [Ebenso] kann kein Satz, der vorgibt, das Wesen eines transzendenten Gottes zu beschreiben, irgendeine wissenschaftliche Bedeutung haben. (153) 3 Diese Position ist nun offenbar nicht nur von der des Theisten, sondern auch von der des Atheisten und sogar von der des Agnostikers grundsätzlich zu unterscheiden. Ayer hebt das im Anschluss an die eben zitierte Stelle selbst hervor: Es ist wichtig, diese Auffassung von religiösen Behauptungen nicht mit der von Atheisten und von Agnostikern zu verwechseln. Denn für einen Agnostiker ist die Meinung bezeichnend, dass die Existenz gottes eine Möglichkeit ist, an die zu glauben oder nicht zu glauben es keinen guten Grund gibt; und für einen Atheisten ist der Standpunkt bezeichnend, dass die Nichtexistenz Gottes zumindest wahrscheinlich ist. Unsere Ansicht jedoch, dass alle Äußerungen über das Wesen Gottes unsinnig sind, ist weit davon entfernt, mit ihnen identisch zu sein oder auch nur einer dieser gängigen Meinungen irgendwelche Unterstützung zu geben; sie ist mit ihnen unvereinbar. Denn wenn die Behauptung, dass es einen Gott gibt, unsinnig ist, dann ist die Behauptung des Atheisten, dass es keinen Gott gibt, gleichermaßen unsinnig ... (153) Die Stoßrichtung von Ayers Kritik an der Theologie sieht demnach so aus: (1) Der religiöse oder theologische Diskurs ist in dem Sinne sinnlos, dass religiöse Äußerungen/Sätze keine genuinen Aussagen oder Propositionen zum Inhalt haben. Das bedeutet (2), dass religiöse Sätze weder wahr noch falsch sind. Daher befinden sich (3) nicht nur Theisten, sondern auch Atheisten und Agnostiker im Irrtum. Denn wenn ein Satz S unsinnig ist oder keine faktuale Bedeutung hat, dann muss auch die Negation von S (das, was der Atheist sagt, um seine Nicht-Übereinstimmung mit dem Theisten auszudrücken) unsinnig sein und kann keine faktuale Bedeutung haben. Und wenn mit dem Verdikt der faktualen Bedeutungslosigkeit nicht nur der Theismus, sondern auch der Atheismus fällt, fällt auch der Agnostizismus. Denn Agnostizismus behauptet, dass es rational unentscheidbar sei, ob der Theismus oder ob der Atheismus wahr ist, setzt dabei aber voraus, dass entweder Theismus oder Atheismus wahr ist. Die Grundlage für Ayers Kritik ist das sogenannte Verifikationskriterium der Bedeutung (VKB). Mit seiner Hilfe sollen genuine Behauptungen oder Aussagen von Pseudopropositionen unterschieden werden – sollen Aussagen also von Sätzen unterschieden werden, die aufgrund ihrer syntaktischen Struktur zwar wie echte Aussagen aussehen, in Wirklichkeit aber gar keine Aussagen sind. Ayers Kritik an der Theologie geht daher aus der Anwendung eines allgemeinen Sinnkriteriums auf einen besonderen Diskursbereich hervor. Seine verifikationistische Bedeutungstheorie entwickelt Ayer direkt im ersten Kapitel seines Buchs, das den bezeichnenden Titel Die Elimination der Metaphysik trägt. An der entscheidenden Stelle heißt es dort: Das Kriterium, das wir zur Prüfung der Echtheit scheinbarer Tatsachenaussagen [apparent statements of fact] anwenden, ist das Kriterium der Verifikation [criterion of verifiability]. Wir sagen, dass ein Satz für jemand tatsächlich von Bedeutung ist, wenn – und nur wenn – er weiß, wie die Proposition, die der Satz ausdrücken will, 4 verifizierbar ist, das heißt, wenn er weiß, welche Beobachtungen ihn unter bestimmten Bedingungen veranlassen würden, die Proposition als wahr anzuerkennen oder als falsch zu verwerfen. (44; vgl. engl. Ausgabe S. 35) Bevor wir dieses Prinzip diskutieren, zunächst zwei Bemerkungen, um zwei recht naheliegende Missverständnisse zu vermeiden. Erstens ist es klar, dass falsche Aussagen unmöglich verifiziert werden können – wenn wir unter Verifikation einer Aussage durch eine Beobachtung verstehen, dass sie durch die Beobachtung als wahr erwiesen wird. Da nun offenbar auch falsche Aussagen wie z. B. Die Erde ist scheibenförmig faktuale Bedeutung haben, darf man das VK der Bedeutung nicht so lesen, als würde es implizieren: Eine Aussage ist nur dann bedeutungsvoll, wenn sie wahr ist. Der Gedanke, den das VK zum Ausdruck bringen will, ist vielmehr der, dass eine Aussage S dann und nur dann faktuale Bedeutung hat, wenn es erfahrungsmäßig zugängliche Umstände gibt oder wenn Beobachtungen möglich sind oder wenn es Beobachtungssätze gibt, die für oder (!) gegen S sprechen. Der zweite Punkt ist etwas subtiler. An der genannten Stelle formuliert Ayer sein VK so, als würde es nicht darüber entscheiden, ob ein Satz bedeutungsvoll ist oder nicht, sondern so, als würde es darüber entscheiden, ob ein Satz für eine Person bedeutungsvoll ist oder nicht. Aber das ist ziemlich verwirrend. Denn das Verifikationskriterium soll ein Kriterium der Bedeutung sein, nicht ein Kriterium des Verstehens oder der sprachlichen Kompetenz einer Person. Nach Ayers Formulierung hat ein Satz S genau dann faktuale Bedeutung für eine Person A, wenn A weiß, welche Beobachtungen A dazu bringen würde, S für wahr oder falsch zu erachten. Nun kann es aber durchaus sein, dass eine bestimmte Person nicht die geringste Vorstellung von den Verifikationsbedingungen eines Satzes hat, dass es solche Bedingungen nichtsdestotrotz aber gibt. Dass ein Satz Bedeutung hat kann daher auch nach dem VK sinnvoller Weise nicht abhängig gemacht werden von dem Wissen einer bestimmten Person zu einer bestimmten Zeit. Dennoch ist zu beachten, dass die Bedeutung eines Satzes dem VK zufolge von einem Wissen über verifizierende Umstände abhängig ist – wobei als verifizierende Umstände wirkliche oder mögliche Beobachtungen gelten. Um nun dem Vorwurf faktualer Bedeutungslosigkeit des religiösen Diskurses zu effektiv zu begegnen kann man offenbar zweierlei tun. Die eine Alternative ist: Versuchen, das verifikationistische Sinnkriterium zurückzuweisen. Die zweite Alternative ist: Zeigen versuchen, dass religiöse Aussagen das verifikationistische Kriterium erfüllen. Betrachten wir die Angriffe auf das VK selbst. Hier sind vor allem drei Argumentationsweisen herauszuheben: (1) Es sind Schwierigkeiten in der genauen Formulierung des VK aufgetreten. Das Problem besteht generell darin, dass das Kriterium entweder zu eng oder zu weit auszufallen droht. Im 5 ersten Fall droht es Aussagen auszuschließen, die vollkommen unproblematische Fälle von genuinen Aussagen zu sein scheinen. Im zweiten Fall droht es Aussagen in die Klasse der genuinen Propositionen einzuschließen, die gemessen an paradigmatischen Fällen verifizierbarer Aussagen als problematisch gelten müssen. Auf eine genaue Formulierung kommt es aber ganz entscheidend an: Denn ob religiöse Sätze das VK erfüllen oder nicht, lässt sich definitiv nicht beantworten, wenn die Formulierung des Kriteriums vage ist und in wichtigen Aspekten unexplizit bleibt. (2) Ein sehr grundsätzliches Problem ist das der selbstreferentiellen Konsistenz des VK: Da dieses Prinzip wie es scheint, selbst weder analytisch, noch durch Beobachtung verifizierbar ist, scheint es aufgrund dessen was es sagt, selbst als eine Pseudoproposition eingestuft werden zu müssen. (3) Das ganze Prinzip ist arbiträr in dem Sinne, dass es keine unabhängige Rechtfertigung für sein Annahme gibt, weil es auf der Basis und im Geiste einer vorgängig akzeptierten wissenschaftlichen Weltauffassung eingeführt wird, welche von vorneherein die Möglichkeit einer transzendenten Wirklichkeit ausschließt. Ad 1) Fangen wir mit der Schwierigkeit der genauen Formulierung des VK an. Ein erstes Problem mit der genauen Formulierung von VK ist Ayer schon selbst aufgefallen. Eine dringlich Frage bestand für ihn darin, ob unter Verifizierbarkeit eines Satzes die Möglichkeit der Verifikation unter kontingenten faktischen Bedingungen verstanden werden sollte, oder ob der Begriff der Verifizierbarkeit sinnvoller Weise mehr umfassen sollte – die Möglichkeit der Verifikation einer Behauptung unter kontrafaktischen Bedingungen. In Ayers eigener Terminologie handelt es sich hierbei um die Frage, ob sein Kriterium für faktualen Informationsgehalt tatsächliche oder grundsätzliche Verifizierbarkeit fordert. Ayer entschied sich für das letztere – für Verifizierbarkeit im ‚grundsätzliche’ Sinn – da die erste Interpretation von „Verifizierbarkeit“ in der Tat zu extrem unplausiblen und unerwünschten Thesen führen würde. Das Problem der ersten Interpretation besteht darin, dass, ob eine Aussage sinnvoll ist, dem VK zu Folge dann über Zeiten, über Räume, über Personen und sogar in Abhängigkeit von den technischen Mitteln, welche bestimmten Personen zu bestimmten Zeiten zur Verfügung stehende, variieren würde. Das ist aber aus verschiedenen Gründen extrem unplausibel. Der vielleicht wichtigste Grund ist der, dass man dann annehmen muss, dass eine Aussage wie Auf der Rückseite des Mondes gibt es Berge zu bestimmten Zeitpunkten in der Menschheitsgeschichte keinen Wahrheitswert hat – und also eine Pseudoproposition wäre –, zu anderen Zeitpunkten jedoch einen Wahrheitswert hat, 6 während es sowohl zum einen als auch zum anderen Zeitpunkt klarerweise auf der Rückseite des Mondes Berge gibt. Das Problem mit dieser Interpretation besteht also, kurz gesagt darin: Wie sollte Auf der Rückseite des Mondes gibt es Berge zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Pseudoproposition sein, wenn zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt wird, dass es sich tatsächlich eben so verhält, wie der Satz sagt! Tatsächliche Verifizierbarkeit führt also zu Absurdität. Aber auch grundsätzliche oder Verifizierbarkeit unter kontrafaktischen Bedingungen bringt ihre Probleme mit sich. Das prinzipielle Problem besteht hier darin, zu entscheiden, wie weit die kontrafaktischen Bedingungen der Verifikation gefasst werden können, ohne dass das gesamte VK seinen Sinn und intendierten Zweck verliert. Wenn die nämlich die kontrafaktischen Bedingungen, unter denen eine Aussage verifiziert werden können muss, um als genuine Aussage zu gelten, sehr weit gefasst werden, so dass nur logische Unmöglichkeit der Verifikation einer Aussage im Weg steht, dann würden durch das VK auch theistische Aussagen kaum noch als sinnlos eingestuft werden können. Betrachten wir dazu eine kleine Geschichte von John Hick aus seinem Aufsatz „Theology and Verifikation“ – eine Geschichte die zeigen soll, dass religiöse Aussagen sehr wohl einen faktualen Gehalt im Sinne des VK haben können. Denken wir uns zwei Reisende, die auf einer Straße entlang gehen. Der eine glaubt, dass die Strasse zu einer Himmlischen Stadt führt, der andere, dass sie nirgendwo hinführt, sondern im Niemandsland enden wird. Während ihrer Reise erleben die beiden sowohl Momente der Freude und des Glücks als auch Momente von Angst und Gefährdung. Der eine interpretiert die guten Zeiten als Anzeichen und Hinweise auf eine kommende himmlische Freude und die Bedrohungen als Hindernisse, deren Überwindung ihn würdig machen, dieser künftigen Freude teilhaftig zu werden; der andere betrachtet die gesamte Reise als ein zielloses Dahintappen. Während der Reise lässt sich keine der Auffassungen der beiden Reisenden bestätigen, und so lässt sich während der Reise nicht entschieden, welcher von beiden recht hat. „And yet“, schreibt Hick, when they do turn the last corner it will be apparent that one of them has been right all of the time and the other wrong. It is at this point that verification and falsification become relevant. Althought the issue between the two has not been experimental, it has nevertheless from the start been a real issue. Das Problem für den Verifikationisten ist offenbar, dass er, um mit Hilfe seines Kriteriums einen interessanten Unterschied zwischen Pseudopropositionen genuinen Propositionen treffen zu können, nicht zulassen kann, dass Aussagen über ein Leben nach dem Tod irgendeine Chance haben, für echte Propositionen zu gelten. Wenn er aber die Bedingungen, unter denen eine Verifikation als grundsätzliche Verifikation gilt, so weit fasst, dass auch Verifikation in logisch möglichen Szenarien dazuzählt, hat er keine Chance mehr, religiöse Behauptungen als sinnlos einzustufen. Er wird deshalb den Begriff einer grundsätzlichen oder 7 möglichen Verifikation enger fassen müssen und als mögliche Verifkationssituationen nur solche zulassen, die von der Warte unseres gegenwärtigen empirischen Wissens aus beschrieben werden. Das bringt aber, wie wir sehen werden, einige Folgeprobleme mit sich. Eine zweite Frage, die Ayer beschäftigte, war die, ob unter Verifikation einer Aussage zu verstehen ist, dass sie als wahr erwiesen wird, oder ob darunter zu verstehen ist, dass durch Erfahrung ihre Wahrscheinlichkeit erwiesen werden kann. Das erste nennt er den starken, das zweite den schwachen Sinn von „verifizierbar“. Ayer entscheidet sich hier für die zweite Option. Der Grund ist auch hier der, dass die andere Option zu unplausiblen und unerwünschten Resultaten führt. Legen wir nämlich den starken Sinn von verifizierbar zugrunde, dann würde das VK alle allgemeinen Propositionen mit Gesetzescharakter als sinnlos ausschließen. Dass Arsen giftig ist oder dass sich Gase bei Erhitzung ausdehnen sind beides Allaussagen, die durch keine endliche Reihe von Beobachtungen als wahr erwiesen werden kann. Sie können aber auf der Grundlage endlicher Beobachtungsreihen durchaus als wahrscheinlich erwiesen werden (bzw. es kann erwiesen werden, dass sie eine Wahrscheinlichkeit haben). Gleiches gilt für Aussagen über die ferne Vergangenheit oder auch über die ferne Zukunft – Aussagen etwa, die den Zustand der Erde vor der Entstehung des Menschen beschreiben. Auch diese sind nicht im starken Sinne verifizierbar. Da die starke Lesart des VK mit Allaussagen, mit Aussagen über Vergangenheit oder Zukunft offenbar wesentliche Bestandteile der Wissenschaft für bedeutungslose Pseudopropositionen erklären würde, sah sich Ayer gezwungen, die schwache Lesart zugrundezulegen. Eine Aussage gilt als verfizierbar, wenn sie durch Erfahrung (durch Beobachtung) als wahrscheinlich erwiesen werden kann (wobei „kann als wahrscheinlich erwiesen werden“ soviel heißt wie „es kann angeben werden, was die Aussage wahrscheinlich macht, und was sie unwahrscheinlich macht). Das Problem ist nun: Kann das VK, wenn wir diese Zusatzqualifikationen beachten und nicht von tatsächlicher und starker, sondern von grundsätzlicher und schwacher Verifizierbarkeit sprechehn, akzeptiert werden. Und angenommen, es wäre akzeptabel – würde dann der religiöse Diskurs als sinnlos qualifiziert werden müssen? Nehmen wir einmal an, das VK wäre in der genannten Interpretation akzeptierbar. Wenn es akzeptiert wird, könnte ein Satz wie „Gott existiert“ nur dann als bedeutungslos erwiesen werden, wenn gezeigt werden kann, dass es unmöglich Evidenz für oder gegen diesen Satz geben kann. Dass dies gezeigt werden könnte, ist aber alles andere als offensichtlich. Hier ist auf zweierlei hinzuweisen. Erstens ist es alles andere als offensichtlich, ob die Konzeption Gottes als eines allmächtigen, allgütigen, allwissenden Wesens überhaupt kohärent ist, und es 8 ist auch alles andere als offensichtlich, ob die Existenz Gottes mit den erfahrbaren Übeln der Welt verträglich ist. Einige atheistische Denker neigen zu der Auffassung, dass die Idee Gottes inkonhärent ist, und einige sind überzeugt, dass die Existenz von Übeln in der Welt gegen die Existenz Gottes spricht. Wenn es jedoch Argumente dieser Art geben kann, dann kann es auch eine Art von Beleg gegen die Existenz Gottes geben – etwas also, das gegen die Existenz Gottes spricht. Und folglich kann „Gott existiert“ nicht sinnlos sein. [Beachten Sie hier, dass es nach Ayers Auffassung keinen Widerspruch zwischen Pseudopropositionen geben kann. Lässt sich also ein Widerspruch konstruieren zwischen theologischen und anderen Aussagen, dann können theologische Aussagen nicht sinnlos sein!] Zweitens haben einige Denker in der Tradition der natürlichen Theologie Argumente für die Existenz Gottes entwickelt, die von Aussagen über die uns empirisch zugängliche Welt ausgehen. Namentlich Richard Swinburne hat dafür argumentiert, dass die Gestalt der wirklichen Welt die Aussage, dass Gott existiert, sehr wahrscheinlich bzw. wahrscheinlicher als ihre Negation macht. Da es nun alles andere als offensichtlich ist, dass ein solches probabilistisches Argument nicht funktionieren kann, ist es auch nicht offensichtlich, dass es keine Belege für religiöse Ansprüche geben kann. Ein letzter Punkt. Die Aussage „Gott hat sich den Menschen in Jesus Christus offenbart“ wäre offenbar falsch, wenn Jesus von Nazareth überhaupt nicht gelebt hätte. Also können wir uns Aussagen und sie stützende Beobachtungen denken, durch welche die besagte Aussage als falsch erwiesen werden könnte. Zusammengenommen bleibt es daher unklar, ob das Verifikationskriterium jedwede religiöse Aussage als sinnlos einstufen kann und wird. Ad 2) Ein schwerwiegender Einwand gegen das Verifikationsprinzip ist der Einwand der selbstreferentiellen Inkonsistenz. Das bedeutet, dass das sich verifikationistische Sinnkriterium, wenn man es auf den Satz, durch den es ausgedrückt wird, anwendet, selbst als eine Pseudoproposition herausstellt. Das VK ist erstens kein analytischer Satz, da die Negation dieses Kriteriums keinen Widerspruch enthält. Zweitens aber kann das VK auch nicht als eine Tatsachenaussage im Sinn des VK gelten. Denn es gibt offenbar keine Beobachtung, die Evidenz für oder gegen dieses Prinzip liefern würde. Daher gilt, dass das VK, wenn es sinnvoll ist, dann falsch ist und wenn es nicht falsch ist, dann nicht sinnvoll ist. Entweder also ist es falsch oder sinnlos. Den Vorwurf, dass die verifikationistische Theorie der Bedeutung selbstwiderlegend sein, haben einige Autoren zurückzuweisen versucht. So schreibt Michael Martin (The 9 Verificationist Challenge, S. 208), dass man das Sinnkriterium nicht als eine Theorie interpretieren darf. Es handele sich vielmehr um „a proposal about how to separate factually meaningless sentences from factual meaningful ones and is to be judged in terms of how well it does the job.” Dieser Gegeneinwand scheint mir aber nicht besonders überzeugend zu sein. Der Selbstwiderlegungsvorwurf soll hier dadurch umgangen werden, dass das VK nicht als eine Aussage mit faktualer Bedeutung, sondern als ein Vorschlag – als eine Art von Maxime oder Handlungsanweisung oder als terminologische Festlegung interpretiert wird. Und so als konstruktiver Vorschlag verstanden, kann man nicht sinnvoll fragen, ob das VK selbst wahr oder falsch ist, sondern man muss danach fragen, ob dieses Kriteriums nützlich ist und ob seine Anwendung zum gewünschten Ergebnis einer effektiven Scheidung von echten und unechten Propositionen führt. Selbst wenn man auf diese Weise – was ich nicht für ausgemacht halte – dem Vorwurf der Selbstwiderlegung entgehen könnte, wird man sich dann aber den Vorwurf der Willkürlichkeit des Vorschlags einhandeln. Ad 3) In seinem Buch God and other Minds hat Plantinga diesen Vorwurf folgender Maßen formuliert: But suppose the criterion could be stated in a way which satisfied the verificationist. (We could after all, say simply thet the statements of science and “common sense” are meaningful and those of transcendental metaphysics and theology meaningless.) Why should anyone accept it? Why should the theist not retort as follows: “Your criterion is obviously mistaken; for many theological statements are not empirically verifiable; but theological statements are meaningful; hence it is false that all and only verifiable statements are meaningful”? What could the verificationist reply? What sort of argument could he bring forward to show the theologian that he ought to accept the verifiability criterion and stop proclaiming these meaningless theological pseudo-statements? About all he could say here would be that his criterion does fit scientific and common-sense statements and does not fit theological statements. And to this the theologian could agree with equanimity; there are, no doubt, many properties which distinguish scientific and commonsense statements from theological statements. But of course that does not suffice to show that theological statements are meaningless or logically out of order or anything of the sort. (167/8). Das Problem, auf das Plantinga hier aufmerksam macht, ist das Problem, aus welchen Gründen der Verifikationist eigentlich berechtigt ist, theologische Aussagen nicht als Gegenbeispiele zum VK zuzulassen. So könnte man ja argumentieren, dass ein Satz wie „Die Welt ist durch Gott erschaffen worden“ wahr oder falsch und dennoch – in einem qualifizierbaren Sinn von „verifizierbar“ – nicht empirisch verifizierbar ist, und dass dieser Satz daher als ein klares Gegenbeispiel zum VK anzusehen ist. Um unplausiblen Restriktionen zu entgehen, hatte Ayer nicht tatsächliche und starke, sondern grundsätzliche und schwache Verifizierbarkeit gefordert. Wenn er jedoch Gegenbeispiele gegen zu strikte Varianten des 10 VK anführt, was, kann man dann fragen, berechtigt ihn dann, eine Aussage wie „Gott existiert“, die intuitiv gesehen sehr wohl einen Wahrheitswert hat, als Gegenbeispiel auszuklammern. Der Verdacht, der sich hier aufdrängt, ist der, dass das VK im Dienste einer vorgängigen weltanschaulichen Entscheidung steht und eben so formuliert ist, dass es diese bestätigt – so formuliert ist, heißt das, dass es gerade die und nur die Aussagen als echte Aussagen selektiert, die im Rahmen dieser Weltanschauung als sinnvoll zugelassen werden dürfen. [Plantinga bemerkt das in der ironischen Einfügung: “We could after all, say simply that the statements of science and “common sense” are meaningful and those of transcendental metaphysics and theology meaningless.”] Wenn der einzige Grund zur Annahme des VK jedoch das ist, was die Mitglieder des Wiener Kreises die wissenschaftliche Weltanschauung (WWA) genannt haben, dann ist die Nichtakzeptanz des religiösen Diskurses nicht Konsequenz, sondern Motiv und Voraussetzung dafür, das VK zu akzeptieren (und so zu formulieren, dass religiöse Aussagen nicht als genuine Aussagen gelten können). In einer 1929 erschienenen gemeinsamen Publikation gleichen Titels haben Rudolf Carnap, Hans Hahn und Otto Neurath die wissenschaftliche Weltauffassung zunächst als eine Auffassung beschrieben, die „nicht so sehr durch eigene Thesen [...] als vielmehr durch die grundsätzliche Einstellung, die Gesichtspunkte, die Forschungsrichtung charakterisiert [ist]“ und der als Ziel die Einheitswissenschaft vor[schwebt].“ Klingt das nach einem Primat der Methodologie, finden sich aber schnell auch Charakterisierungen der WWA durch substantielle Thesen, wie die folgenden: (1) Die wissenschaftliche Weltauffassung kennt keine unlösbaren Rätsel. (2) Alles ist dem Menschen zugänglich; und der Mensch ist das Maß aller Dinge. (3) Traditionelle philosophische Probleme sind entweder Scheinprobleme oder können in empirische Probleme umgewandelt werden. (4) Die wissenschaftliche Weltanschauung kennt nur Erfahrungssätze über Gegenstände aller Art und die analytischen Sätze der Logik und Mathematik. (5) Etwas ist wirklich dadurch, dass es eingeordnet wird dem Gesamtgebäude der Erfahrung. (6) Der Sinn eines jeden Begriffs [...] muss sich angeben lassen durch eine schrittweise Rückführung auf andere Begriffe, bis hinab zu den Begriffen niederster Stufe, die sich auf das Gegebene selbst beziehen. („Wissenschaftliche Weltauffassung – der Wiener Kreis“, in: Otto Neurath, Wissenschaftliche Weltauffassung, Sozialismus und Logischer Empirismus, S. 86 – 90) 11 Betrachtet man diese Thesen, so wird einem klar, dass das VK keine unabhängige Kraft hat, sondern selbst integraler Bestandteil der sogenannten wissenschaftlichen Weltauffassung ist. Gibt es keinen zwingenden Grund diese Auffassung zu akzeptieren, dann gibt es auch keinen zwingenden Grund das VK zu akzeptieren. Der Logische Positivismus enthält, wie sie an den aufgezählten Thesen sehen können, selbst eine Metaphysik. Besonders die Aussagen über die Wirklichkeit und ihre Zugänglichkeit sind offenbar keine wissenschaftlichen Aussagen – Aussagen also der Wissenschaft selbst. Es ist schwer zu sehen, wie diese Aussagen nun selbst als sinnvolle Aussagen im Sinne des VK sollten verstanden werden können. Sind es aber nicht genuine Aussagen, sondern nur Vorschläge zur Konstruktion eines Rahmens für die wissenschaftliche Theoriebildung, dann stellt sich die Frage Plantingas: Warum in aller Welt sollten der Theist und der Atheist diese Vorschläge akzeptieren. Zusammengefasst ergibt sich damit das folgende Bild. Nach Ayers Auffassung schließt das verifikationistische Sinnkriterium religiöse oder theologische Aussagen aus der Menge der sinnvollen Aussagen aus, so dass diese weder wahr noch falsch sein können. Dieses Sinnkriterium ist aber selbst mit erheblichen Problemen konfrontiert. Das erste Problem ist die genaue Formulierung dieses Sinnkriteriums. Dieses Problem hat sich als so widerspenstig erwiesen, dass Zweifel daran angebracht sind, ob es genau formuliert werden kann. Davon abgesehen ist es alles andere als ausgemacht, dass dieses Kriterium wirklich alle theologischen Aussagen als sinnlos aus dem rationalen Diskurs ausschließen kann – ohne dadurch auch Aussagen auszuschließen, die Bestandteile der Wissenschaften im engeren Sinn sind. Selbst wenn das Problem zur Zufriedenheit des Verifikationisten gelöst werden könnte, stellt sich das weitere Problem ein, dass das VK selbstwiderlegend und damit notwendig falsch zu sein scheint. Die einzige Möglichkeit, das VK gegen diesen Vorwurf in Schutz zu nehmen besteht darin, es auf eine Weise zu interpretieren, nach der es nicht selbst als eine Aussage intendiert ist. Es soll dann allein als eine praktischer Vorschlag darüber verstanden werden, welche Sätze als Gegenstände einer rationalen Diskussion zugelassen werden können. Abgesehen davon, dass diese Interpretation des VK ad hoc zu sein scheint und nur vorgelegt wird, um den Vorwurf der selbstreferentiellen Inkonsistenz unschädlich zu machen, stellt sich nun die Frage, warum und in welchem Sinne dieser Vorschlag denn akzeptiert werden sollte. Was für diesen Vorschlag letztlich in Anschlag gebracht wird, ist die wissenschaftliche Weltanschauung des logischen Positivismus. Diese Weltanschauung ist aber selbst oder enthält selbst eine Metaphysik – eine allgemeine Ansicht darüber, was wirklich ist. Ein Atheist muss zwar nicht, aber könnte diese Auffassung (diese Metaphysik, aber freilich nicht 12 die Sinnlosigkeitsbehauptung) akzeptieren, ein Theist kann sie nicht akzeptieren. Beides aber zeigt, dass entweder Atheismus und Theismus genuine Wahrheitsansprüche erheben oder dass auch der wissenschaftlichen Weltauffassung kein echter kognitiver Gehalt zugeschrieben werden kann. Im letzteren Fall ist die WWA selbst keine rationale Option, sondern eine rational nicht mehr begründbare Bindung; im ersteren Fall ist sie nicht berechtigt, die Diskussion zwischen Theisten und Atheisten als ein nicht-kognitives Spiel abzutun, das mit ernsthaften Diskussionen nur die grammatische Oberfläche der Äußerungen teilt. Mein Fazit ist also, dass es keinen guten Grund für und gute Gründe gegen die Akzeptanz des VK gibt. Das Selbstverständnis von Theisten, Atheisten und Agnostikern ist also durch das Verdikt des logischen Positivismus nicht bedroht. Nicht unerwähnt bleiben sollte hier, dass der Verifikationist für den Gläubigen einen Trost – aber, wie zu betonen ist, einen schwachen und eigentlich nur scheinbaren Trost bereithält: Den Trost nämlich, unmöglich jemals widerlegt werden zu können. Denn nach Ayers Auffassung kann der religiöse Glaube ja unmöglich als falsch erwiesen werden. Aber natürlich nicht deshalb, weil er wahr ist, sondern deshalb weil er ebenso wenig wahr wie falsch sein kann und jeder kognitiven Valenz entbehrt. Ayer schreibt: „So spenden wir dem Theisten den gleichen Trost, den wir dem Moralisten spendeten. Seine Behauptungen können unmöglich gültig sein; sie können aber auch nicht ungültig sein. Da er überhaupt nichts über die Welt sagt, kann man ihn folglich nicht anklagen, etwas Falsches zu sagen oder etwas unzureichend Begründetes. Nur wenn der Theist geltend macht, dass er mit der Existenzbehauptung eines transzendenten Gottes eine echte Proposition ausdrückt, sind wir berechtigt, anderer Meinung als er zu sein.“ (154). Die Sinnlosigkeitsbehauptung immunisiert in der Tat den Theismus gegen jede Form von Atheismus. Aber das ist kein echter Trost, da die Immunisierung den Glauben zugleich trivialisiert: Wenn es weder Gründe für, noch gegen den Glauben geben kann, dann ist es einfach gleichgültig ob man glaubt oder nicht glaubt. Da weiterhin der Sinnlosigkeitsvorwurf impliziert, dass Gott nicht existieren kann – weil „Gott existiert“ ja nicht wahr sein kann – ist die These der Sinnlosigkeit des religiösen Diskurses in einem weiteren Sinne auch als atheistisch zu bezeichnen. Und das freilich kann kein Gläubiger einfach als tröstende Interpretation seiner eigenen Glaubenseinstellung akzeptieren. Im ersten Korintherbrief 15, 12 - 14 sagt Paulus daher zurecht: 13 b. Ist Gott unaussprechlich? Ich vermute, dass der geheime Hintergrund der positivistischen Sinnlosigkeitskritik der folgende ist: Weil Gott in der Tradition als transzendent gedacht wird – als ein Wesen, das nicht selbst Teil der erfahrbaren Wirklichkeit ist – können keine unserer Begriff auf ihn Anwendung haben. Wenn aber keine Begriffe Anwendung haben können, dann kann es keine sinnvollen Aussagen über Gott geben. Ist das richtig, dann träfe sich der Positivismus mit der These der negativen Theologie, dass Gott unaussprechlich ist. Der Positivist zieht nur andere Konsequenzen daraus: Die Rede von einer transzendenten Wirklichkeit ist sinnlos und kann folglich nicht wahr sein, da wir ja durch keinen Satz irgendetwas darüber aussagen können. Die negative Theologie andererseits behauptet die Unaussprechlichkeit, die Unsagbarkeit oder die Unbeschreibbarkeit Gottes, sieht darin – und das ist der entscheidende Unterschied – aber nichts Sinnloses, sondern im Gegenteil eine korrekte und zwingende Konsequenz der Tatsache, dass Gott anders als alles ist, was es sonst noch gibt. Oftmals ist diese Auffassung mit einer tiefsitzenden moralischen Überzeugung verbunden, der Überzeugung nämlich, dass es irgendwie anmaßend sei, dass es eine Form von Hybris, von Selbstüberhebung sei, wollte man Gott beschreiben. Einen Eindruck von dieser typischen Mischung bekommen Sie etwa bei dem bekannten Theologen Hans Küng. In seinem Buch Credo. Das Apostolische Glaubensbekenntnis – Zeitgenossen erklärt schreibt er: [S. 20 f.] Im folgenden möchte ich mich aber der These der Ineffabilität Gottes unabhängig von den moralischen Aspekten der Frage seiner Beschreibbarkeit zuwenden. [Trotzdem eine kleine Bemerkung nebenbei. Küng wählt in seinen Ausführungen ein stark tendenziöse und appelative Sprache – so etwa wenn er davor warnt, Gott als ein Objekt betrachten, weil dies dazu verführen würde, Gott als etwas dem Menschen Verfügbares aufzufassen – und sei es auch nur in der Erkenntnis Verfügbares.] Halten wir nun zunächst fest, welche Bedeutung die These der Ineffabilität im allgemeinen hat. (1) Festzuhalten ist nocheinmal, dass die Ineffabilitätsthese – nach dem Verständnis derjenigen, die sie vertreten zumindest – weder mit der Sinnlosigkeitsthese identisch ist, noch die Sinnlosigkeitsthese implizieren soll. (2) Es ist klar, dass der Ineffabilist nicht mit dem Agnostiker verwechselt werden darf. Denn die Ineffabilitätsthese ist allgemein betrachtet zunächst einmal keine These über die Erkennbarkeit Gottes. Es handelt sich vielmehr um eine semantische und ontologische These. Was ist der Unterschied? Ich könnte die Auffassung haben, dass folgendes wahr ist: dass Gott entweder existier oder nicht existiert, dass er entweder gütig oder nicht gütig ist, dass er die 14 Ungläubigen entweder verdammen wird oder dass er sie nicht verdammen wird, dass ich aber nichts von dem wissen kann, dass ich also kurz gesagt nicht in der Lage bin, zu entscheiden, welche dieser Aussagen wahr und welche falsch sind. Die Ineffabilitätsthese ist dagegen eine Behauptung über die Möglichkeit nicht des Wissens, sondern der Rede über Gott. Sie betrifft die Frage, ob solche Konzepte wie Güte, Existenz, Handlung usw. überhaupt auf Gott zutreffen können – ob es also überhaupt eine Aussage über Gott geben kann, von der gilt, dass sie wahr ist. Nun ist jede Aussage über Gott (zumindest jede Aussage, die ein sachhaltiges Prädikat enthält) natürlich eine Beschreibung Gottes. Da Ineffabilität soviel heißt wie Unaussprechlichkeit, Unsagbarkeit oder Unbeschreibbarkeit, ist die These der Ineffabilität Gottes eine These, durch die zum Beispiel behauptet wird, dass Aussagen wie Gott ist allwissend oder Gott ist gütig irgendwie inadäquat sind, dass sie als Aussagen über Gott nicht wirklich zutreffend sein können. Solche Sätze sind der Ineffabilitätsthese zu Folge zwar nicht sinnlos aber trotzdem semantisch irgendwie nicht in Ordnung, und das betrifft dann natürlich auch ihre Negationen. Man sieht dann sofort, dass das nicht nur eine semantische, sondern auch eine ontologische These ist. Gott ist gütig schreibt Gott die Eigenschaft zu gütig zu sein. Wenn es zwar nicht sinnlos, aber semantisch dennoch irgendwie inadäquat ist, von Gott zu sagen, dass er gütig ist, dann muss es auch ontologisch gesehen nicht in Ordnung sein, von Gott zu sagen, dass er eine Eigenschaft wie Güte besitzt. Halten wir also fest: Die Ineffabilitätsthese betrifft die Rede von Gott und ist damit eine semantische und ontologische These. Sie hat aber natürlich auch epistemologische Konsequenzen. Denn wenn wir mit einer Behauptung über Gott beanspruchen, dass ein bestimmtes Konzept auf ihn zutrifft, dies Konzept aber nicht zutreffen kann, dann ist das von uns Behauptete nicht wahr und dann können wir – eine triviale Konsequenz – das Behauptete auch nicht wissen. Der Agnostiker behauptet, man könne nicht wissen, ob Gott existiert, oder man könne nicht wissen, welche Eigenschaften Gott hat. Er stellt damit aber nicht das in Frage, was der Ineffabilist in Frage stellt – dass Aussagen wie Gott existiert oder Gott ist gütig semantisch vollkommen in Ordnung sind, dass also die Konzepte der Existenz oder der Güte auf Gott zutreffen können. (2) Die Ineffabilitätsthese darf nicht verstanden werden als die These, dass es für uns nicht möglich ist, Gott vollständig zu beschreiben. Eine solche Interpretation würde die These trivialisieren. Denn offenbar können auch ganz gewöhnliche Dinge wie Haselnüsse, Knollenblätterpilze oder Menschen nicht vollständig beschrieben werden, da sie unbestimmt viele Eigenschaften haben oder da es unbestimmt viele Wahrheiten – unbestimmt viele wahre Aussagen – über jedes Ding gibt. Dieser Punkt ist wichtig, um dem Gegner der Ineffabilitätsthese nicht die offenbar falsche und auch von niemandem und auch keinem Gläubigen 15 vertretene These in die Schuhe zu schieben, es sei für uns möglich alles über Gott zu wissen, wenn er denn existiert. Festzuhalten ist hier, dass partielle Beschreibbarkeit Ineffabilität ausschließt: Was immer wir beschreiben können, ist nicht ineffabel. (3) Die Ineffabilitätsthese sollte auch nicht so gelesen werden, dass mit ihr behauptet würde, es sei uns nicht möglich, uns in die Lage Gottes selbst zu versetzen, und damit nicht möglich ihn wirklich zu verstehen – verstehen hier in einem emphatischen Sinne des Nachvollzugs der Eigenperspektive der göttlichen Person verstanden. Denn auch diese Lesart würde die Ineffabilitätsthese trivialisieren. Denn in dem hierbei in Anschlag gebrachten emphatischen Sinn von ‚Verstehen’, der eine Identifikation oder ein Sich-Hineinversetzen in den zu Verstehenden meint, ist uns nicht nur Gott, wenn er denn existiert, sondern auch vieles andere nicht wahrhaft verständlich. Wie es, um an den berühmten Aufsatz von Thomas Nagel zu erinnern, wie es ist eine Fledermaus zu sein, wie es sich von der Innensicht der Fledermaus anfühlt Dinge per Sonar zu orten, das lässt sich für Wesen wie wir es sind, kaum bewerkstelligen. Das verhindert aber offenbar nicht, dass wir Fledermäuse beschreiben und ihr Verhalten erklären können. Daher ist es auch nicht ausgeschlossen, dass etwa das Konzept der Allwissenheit auf Gott zutrifft und dass wir dieses Konzept besitzen, auch wenn wir nicht die geringste Vorstellung davon haben, wie es ist alles zu wissen, oder wie man sich selbst fühlen muss, wenn man alles weiß. Allgemein gesagt – eigentlich eine Trivialität, die meiner Erfahrung nach aber auch von Leuten, die es aus Profession heraus besser wissen sollten, nicht immer berücksichtigt wird – allgemein gesagt gilt: Es ist möglich, ein Konzept zu besitzen und es korrekt anzuwenden, auch wenn dieses Konzept auf einen selbst überhaupt nicht zutrifft. Die beiden Problem der Ineffabilitätsthese sind: (1) das Problem der Konsistenz: Wie kann diese These selbst konsistent formuliert werden und kann sie überhaupt formuliert werden (2) das Problem der Begründung: Wie kann man diese These begründen und kann man sie überhaupt begründen. Obwohl ich hier nicht ins Detail gehen kann, ist meine Einschätzung die, dass diese These nicht begründet werden kann, noch auf eine interessante Weise konsistent formuliert werden kann. Um die Schwierigkeiten des Ineffabilismus zu sehen, müssen wir uns zunächst an die Bedeutung des Widerspruchsprinzip – das Prinzip des zu vermeidenden Widerspruchs – erinnern. Das ist hier insofern von besonderer Relevanz, als der Ineffabilist offenbar beides will – er will daran festhalten, dass theologische Aussagen durchaus sinnvoll sind, beharrt aber andererseits darauf, dass keine Aussage, durch die Gott beschrieben wird, auf Gott zutrifft. Wenn religiöse oder theologische Rede aber überhaupt sinnvoll ist, dann muss sie wie jede andere sinnvolle Rede der Bedingung der Konsistenz oder 16 Widerspruchsfreiheit genügen. Vielleicht werden sie jetzt auf den Gedanken kommen, dass es durchaus Sinn macht zu sagen, dass Gott derart – nämlich so einzigartig und so ganz anders ist – dass Widersprüchliches von ihm ausgesagt werden kann. Aber das kann nicht sein. Denn in einem bestimmten Sinn von behaupten, kann man nichts Widersprüchliches behaupten – weil dann nämlich nicht mehr bestimmt ist, was man eigentlich behauptet. Allgemein und unabhängig von speziellen Fragen der Religion liegt das Problem einer Zurückweisung des Widerspruchsprinzips darin, dass man gerade dann, wenn man es zurückweist, es nicht zurückweist. Und in diesem Sinne ist es in der Tat unmöglich ist zu behaupten, das Gesetz der Widerpruchsfreiheit sei falsch. Betrachten wir dazu die kleinen Geschichte, die Harry J. Gensler in seinem Buch Formal Ethics erzählt: (36 f.) Gehen wir aber weg von den allgemeinen Überlegungen über die Gültigkeit des Gesetzes der Widerspruchsfreiheit zu spezielleren theologischen Fragen über. Nehmen wir an Gott könnte, anders als allen anderen Wesen kontradiktorische Eigenschaften haben. Schließlich ist Gott ein so besonderes, einzigartiges Wesen, dass wir diese Annahme einmal berücksichtigen sollten. Gott könnte also beispielsweise sowohl allmächtig als auch nicht allmächtig sein. Keith Yandell hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Annahme, dass dies für Gott eine Möglichkeit ist, nicht aber, sagen wir, für Moses, erhebliche Schwierigkeiten mit sich bringt. Moses, der nur ein Mensch und endlich ist, kann nicht zugleich gerettet und nicht gerettet werden. Nun ist gerettet worden sein eine Eigenschaft, die Moses entweder hat oder nicht hat. Wenn Gott nun aber Moses zugleich rettet als auch nicht rettet, dann folgt daraus, dass Moses selbst zugleich gerettet und nicht gerettet worden ist. Sprechen wir also Gott kontradiktorische oder inkompatible Eigenschaften zu, dann müssten wir auch Moses kontradiktorische oder inkompatible Eigenschaften zusprechen. Damit aber wäre der Ausgangspunkt und die Pointe dieser Art von Theologie verletzt – dass nämlich Gott und Gott allein aufgrund seiner Einzigartigkeit kontradiktorische Eigenschaften zugesprochen werden könnten. Als Konsequenz daraus ergibt sich: Wenn Moses keine kontradiktorischen Eigenschaften haben kann, dann kann auch Gott keine kontradiktorischen Eigenschaften haben. Die Auffassung, dass Gott kontradiktorische Eigenschaften haben könnte ist weiterhin auch kaum mit dem religiösen Glauben vereinbar. Jemand, der glauben würde, dass Gott inkompatible Eigenschaften haben kann, ist zum Beispiel in keiner guten Position, was etwa seine Hoffnung auf Erlösung usw. betrifft. Wenn Gott inkompatible Eigenschaften haben kann, dann schließt Gott hält sein Versprechen, die Gläubigen ins Himmelreich zu führen nicht aus: Gott schickt die Gläubigen in die Hölle. Denn dies beides kann ja problemlos zusammen 17 bestehen, wenn Gott inkompatible Eigenschaften haben kann. Was daraus folgt ist klar: Kontradiktorische Behauptungen sind falsch und zwar notwendig falsch allein kraft der Tatsache, dass sie kontradiktorisch sind. Und in dieser Hinsicht unterscheiden sich, wie Yandell zurecht bemerkt, Behauptungen über Gott in keiner Weise von Behauptungen über Frösche, Bäume oder Türgriffe. Kommen wir nun zu der Behauptung der Ineffabilität Gottes. Ist dies eine konsistent formulierbare Position? Das Konsistenzproblem ergibt sich sehr schnell, wenn wir die Rede von der Unsagbarkeit wörtlich nehmen. Metaphorisch verstanden macht sie dagegen überhaupt kein Problem. Ein unbeschreibbar leckerer Kuchen ist ein Kuchen, der leckerer ist als die meisten anderen und so lecker, das kein anderer ihn in seiner Leckerkeit übertrifft. Aber das ist offenbar ein nicht wörtlicher Gebrauch von „Unbeschreibbarkeit“ – was man bereits an der adverbialen Konstruktion sieht: „unbeschreibbar lecker“ oder „unaussprechlich schmerzhaft“ treffen auf irgendetwas nur dann zu, wenn auch „lecker“ oder „schmerzhaft“ darauf zutreffen. Unbeschreiblich Leckeres ist also durchaus nicht etwas das unbeschreiblich ist. Wörtlich und im engsten Sinn verstanden würde „Gott ist unbeschreibbar/unaussagbar usw.“ jedoch bedeuten: Es gibt kein Konzept, das auf Gott Anwendung hat. So verstanden, ist die Behauptung jedoch selbstwidersprüchlich. Denn „unaussprechlich sein“ ist offenbar ein Konzept. Wenn „unaussprechlich sein“ auf Gott zutrifft, dann trifft aber ein Konzept auf Gott zu, und dann ist Gott nicht unaussprechlich. Da weiterhin und trivialer Weise gilt, dass Gott auch dann nicht unaussprechlich ist, wenn das Konzept „unaussprechlich sein“ nicht auf ihn zutrifft, folgt dass Gott nicht unaussprechlich ist – und das ist, wie wir jetzt sehen, sogar eine notwendige Wahrheit. Nehmen sie nun einmal an, wir würden die Ineffabilitätsthese so einschränken, dass sie nur besagt, dass außer dem Konzept der Unsagbarkeit kein weiteres Konzept auf Gott zutrifft. Da aber für den Ineffabilisten religiöse Rede dennoch sinnvoll sein soll, kommt er kaum darum herum Gott kontradikorische Eigenschaften zuschreiben zu müssen oder kontradiktorische Aussagen von Gott zu behaupten. Denn der Ineffabilist muss es ja vermeiden zu behaupten, dass die Behauptung, das Konzept der Güte träfe nicht auf Gott zu, die Behauptung impliziert, dass Gott nicht gütig ist. Das führt aber, wie wir am Beispiel von Nikolaus von Kues sehen können zu einer nicht einsichtigen Theologie. In seiner Schrift De Coniecturis (Mutmaßungen) finden wir im Kapitel fünf des ersten „Die erste Einheit“ überschriebenen Teil die folgenden Überlegungen: Zunächst kann man auf jede Frage, die man über Gott stellen kann, antworten, jede Frage über ihn sei ungereimt. Denn jede Frage lässt zu dass von dem gefragten nur einer von zwei Gegensätzen als wahr bewiesen werden kann, oder dass von dem Gefragten etwas verneint oder bejaht wird, was bei etwas anderem nicht bejaht oder 18 verneint werden kann. Das aber von der absoluten Einheit anzunehmen, ist einfach sinnlos; von ihr wird weder einer von zwei Gegensätzen als wahr behauptet, noch einer eher als das andere bejaht, was es auch sei. [...] Nun hält man es für wahr, dass jeder Bejahung eine Verneinung entgegensteht [...] Auf die Frage, ob Gott ist, ist folgendes die am meisten ausgrenzende Antwort: dass er weder ist, noch nicht ist, noch dass er zugleich ist und nicht ist. Das ist die eine, höchste, einfachste, am wenigsten eingeschränkte, am ehesten zutreffende antwort auf jede Frage nach der ersten, einfachsten, unaussagbaren Seinsheit. Cusanus Auffassung ist offenbar die, das Gott unaussagbar ist, und das Unaussagbarkeit einschließt, dass keine Proposition P über Gott wahr ist, dass aber auch keine Verneinungen Non-P über Gott wahr sind, dass aber schließlich drittes auch nicht etwa P und Non-P zugleich als wahr zu gelten haben. Letzteres würde offenbar, wie schon gesehen zu Absurdität führen, und Cusanus scheint – das ist eine recht freischwebende Vermutung von mir – auch das Gefühl zu haben, dass Gott nicht unaussprechlich wäre, wenn es wahr wäre, dass ein Konzept auf ihn sowohl zutrifft als auch nicht zutrifft. Cusanus Position ist aber nicht weniger absurd als die Auffassung, dass Gott kontradiktorische Eigenschaften haben könnte. Die von Cusanus favorisierte Antwort auf die Frage, ob Gott existiert, ist nämlich selbst notwendig falsch. Seine Antwort ist: Weder Gott existiert, noch Gott existiert nicht, noch Gott existiert und Gott existiert nicht. Übertragen in formale Schreibweise: P & P & (P & P) Ineffabilismus ist in meinen Augen nicht aufrecht zu erhalten. Seine Position führt entweder zu Inkonsistenz, so dass er zugestehen muss, dass es korrekte Beschreibungen von Gott geben kann. Oder er gibt seine Theologie insgesamt auf, indem er die Auffassung der Sinnlosigkeit übernimmt, der zu Folge auch die Intution des Ineffabilisten, dass Gott Einzigartig und anders ist, und daher nichts über ihn ausgesagt werden könne, als sinnlos gelten muss. Es lässt sich daher kein guter Grund für und sehr gute Gründe gegen die Ineffabilitätsthese anführen. Wir sollten sie aufgeben. Implizite ist außerdem klar geworden, dass der Ineffabilismus als Interpretation des religiösen Glaubens, als Explikation der in ihm enthaltenden Metaphysik, vollkommen ungeeignet ist. Der Gott der großen monotheistischen Religionen ist nicht ineffabel. 19 c) Ist religiöse Rede wesentlich bekundend? Wittgenstein über Religion. Betrachten wir einmal das Apostolische Glaubensbekenntnis. Es beginnt mit den Worten: Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben [...] Und in den letzten Worten dieses Bekenntnisses wird gesagt: Ich glaube [...] Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen Das Apostolische Glaubensbekenntnis enthält die zentralen oder konstitutiven Dogmen des Christentums. Wem der christliche Glaube ganz unbekannt wäre, den könnte man anhand des Credo sicherlich auf kurze und bündige Weise über den christlichen Glauben informieren. „Das ist es, was ich glaube“, könnte ein Christ einem Fremden sagen, der wissen will, was denn den christlichen Glauben ausmacht. Beachten Sie nun folgendes. Die Situation, in der ein vollkommen ahnungsloser Mensch von einem Christen erfahren möchte, was er glaubt, und dieser Christ ihm das anhand des Credo mitzuteilen versucht, ist nicht vergleichbar mit der Situation des Gottesdienstes, in dem sich die Gläubigen alle erheben und gemeinsam das Apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Was ist der Unterschied? Zunächst einmal ist klar, dass das Sprechen des Glaubensbekenntnisses im zweiten, aber nicht im ersten Fall ein Ritual ist. Das heißt nichts anderes, als dass das Sprechen des Bekenntnisses im Gottesdienst eine andere Funktion hat als die Äußerung desselben Bekenntnisses gegenüber dem ahnungslosen Fremden. So könnten wir uns etwa gut vorstellen, dass in der Situation, in der ein Christ 20 einem Fremden mitteilen will, was er als Christ glaubt, nicht das „Amen“ spricht, mit dem das Bekenntnis im Gottesdienst abgeschlossen wird. Das deshalb, weil das schließende „Amen“ offenbar keinen eigenständigen Informationsgehalt besitzt. Das „Amen“ dient der Bekräftigung des zuvor Gesagten, ergänzt das zuvor Gesagte aber nicht um einen weiteren Glaubensgehalt. Das „Amen“ drückt also anders gesagt nicht einen Teil des Inhalts des christlichen Glaubens aus, sondern die Einstellung des Gläubigen zu seinem Glauben – die Einstellung nämlich der rückhaltlosen Bejahung dessen, was zuvor gesagt wurde. Kurz gesagt: das schließende „Amen“ ist ein wesentlicher Bestandteil des Credo, insofern es als ein Bekenntnis gesprochen wird. In der Situation, in der ein ahnungsloser Fremder fragt, was der Christ glaubt, wäre das „Amen“ daher vollkommen fehl am Platz. Es wäre etwa so, als würde ich jemandem auf seine Frage, wie viel Uhr es ist, antworten: „Es ist jetzt genau 10 Uhr, ja das glaube ich wahrhaftig!“ Außer dem „Amen“ gibt es aber noch weitere Bestandteile des Credos, die zwar im Kontext des Gottesdienstes wesentlich und unverzichtbar, im Kontext der Beantwortung der Frage über den christlichen Glauben jedoch überflüssig und irrelevant sind. Diese Bestandteile sind das zweimalige Auftreten von „Ich glaube“. Wenn der Christ dem Fremden antworten will, ist die Äußerung von „Ich glaube“ aus den gleichen Gründen und im selben Sinne überflüssig und fehl am Platz wie das „Amen“. Denn der Fremde fragt nach dem Inhalt oder Gehalt des christlichen Glaubens, nicht nach der Einstellung des Gläubigen zu diesem Glauben. Und diesen Inhalt kann der Christ etwa mitteilen, indem er das Glaubensbekenntnis nicht spricht, sondern zitiert. Er könnte also etwa sagen: „Was wir Christen glauben, kann ich Dir am besten anhand unseres Glaubensbekenntnisses mitteilen. Es lautet so: „Ich glaube an Gott [...].““. Beachten Sie hier, dass das Bekenntnis zitieren nicht das gleich ist, wie das Bekenntnis sprechen. Das Bekenntnis zitieren kann auch jemand, der es niemals sprechen würde – auch Atheisten oder Gläubige anderer Religionszugehörigkeit können dieses Bekenntnis zitieren, aber nicht aufrichtig sprechen. Mit dem Zitieren des Bekenntnisses informiert man jemanden über das Bekenntnis, man bekennt sich damit aber nicht. Das „Ich glaube“ ist durch das Zitieren, durch den indirekten Kontext, gleichsam neutralisiert, es hat nicht mehr die Funktion, die es hat, wenn das Bekenntnis direkt gesprochen wird. Daher wird das „Ich glaube“ eigentlich überflüssig: Anstatt durch wörtliche Wiedergabe des Credo könnte der Christ dem Fremden seine Frage nämlich auch so beantworten: „Was wir Christen glauben, ist in unserem Glaubensbekenntnis enthalten. Dieses Glaubensbekenntnis besagt, dass es einen (und nur einen) Gott gibt, dass Gott allmächtig ist, dass er Himmel und Erde erschaffen hat [...]“. Hier ist das „Ich glaube“ nicht nur neutralisiert, sondern sprachlich getilgt, und trotzdem hat diese Formulierung der Antwort denselben Wert 21 wie die Antwort durch Zitieren des Bekenntnisses. Es sind sprachlich verschiedene, aber funktional äquivalente Antworten. Beide erfüllen, wenn auch auf verschiedene Weise, denselben Zweck – den Zweck nämlich der Information über den Gehalt des christlichen Glaubens. Und eben danach hatte der Fremde ja gefragt: Was ein Christ glaubt. Warum ich das alles sage, hat einen simplen Grund: Wittgenstein sieht es anders, er versteht die religiöse Rede anders als es in meiner bisherigen Beschreibung impliziert ist. Daher kann diese Beschreibung als eine gute Folie dienen, um die Besonderheit von Wittgensteins Auffassung herauszuheben. Bevor wir zu Wittgenstein kommen, sollten wir deshalb einige für das folgende relevante Punkte hervorheben. (1) Der wichtigste Punkt ist der, dass die Sprache des Apostolische Glaubensbekenntnis, wenn es im Gottesdienst gesprochen wird, wesentlich expressiv, kundgebend oder eben bekennend ist, dass es aber möglich ist, die expressive oder kundgebende Funktion zu neutralisieren oder zu eliminieren. (2) Die Neutralisierung oder Eliminierung der expressiven Sprachfunktion führt nicht zu einer vollkommenen Aufhebung des Sinns dieses Bekenntnisses. Vielmehr bleiben die Inhalte, das heißt die deskriptiven Aspekte des Credo zurück. (3) Der deskriptive Gehalt des Bekenntnisses kann verwendet werden, um jemandem, der nicht die geringste Ahnung vom christlichen Glauben hat, über den christlichen Glauben zu informieren. Daher kann man (4) Den christlichen Glauben verstehen ohne ihn selbst übernommen zu haben. Man kann das Bekenntnis verstehen ohne selbst bekennen zu müssen. Kommen wir nun zu Wittgensteins Auffassung über religiöse Rede und über den religiösen Glauben. Beides hängt offenbar eng zusammen. Die Epistemologie religiösen Glaubens hängt nämlich sehr stark ab von der Frage wie wir die Sätze oder Ausdrücke verstehen mit denen der religiöse Glauben zum Ausdruck gebracht wird. Zunächst einmal müssen wir uns über etwas sehr Grundsätzliches verständigen – nämlich die Wittgenstein’sche Auffassung von Sprache. Diese Auffassung hat sich im Laufe seines Lebens ziemlich stark verändert. In der Wittgensteinrezeption ist es daher sogar üblich geworden von Wittgenstein I und Wittgenstein II zu reden. Was uns interessiert ist Wittgenstein II – die Sprachphilosophie, die Wittgenstein ab den 1930er Jahren entworfen hat und die vor allem in den posthum veröffentlichten Philosophischen Untersuchungen ihren Niederschlag gefunden hat. Wir müssen uns hier mit einer groben Skizze, ja mit einer schlagwortartigen Darstellung zufrieden geben. Im Zentrum 22 der Sprachphilosophie stehen semantische Fragen, Fragen nach der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke. Als zentrale Frage können wir dabei die Frage ansehen: Wie ist Bedeutung möglich oder worin besteht die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks? Was ermöglicht es zum Beispiel, dass der Name „Marilyn Monroe“ Marilyn Monroe bezeichnet, und was ermöglicht es, dass ein Ausdruck wie „grün“ Grünes bezeichnet. Oder worin besteht, anders gesagt die Bedeutung solcher Ausdrücke. Von solchen Fragen kann man vollständig paralysiert sein und nicht einmal im Ansatz verstehen, was eine geeignete Antwort darauf sein könnte. Deshalb ist es ganz hilfreich diese Fragen etwas anders zu formulieren. Alle neueren Sprachphilosophen sind von einer simplen und offenkundigen Tatsache beeindruckt. Die Tatsache nämlich der Arbitrarität sprachlicher Ausdrücke. Damit ist gemeint, dass es keinen natürlichen und erklärenden Zusammenhang gibt zwischen dem Ausdruck – sei es dem Laut „grün“ oder dem aus vier Buchstaben komponierten Schriftzeichen „grün“ – und der Bedeutung, die dieser Ausdruck nun einmal hat. Die Bedeutung von „grün“ ist, wenn Sie so wollen, diesem Ausdruck nicht angeheftet, es lässt sich ihm in keiner Weise ansehen, was er bedeutet. Wenn wir die Tatsache der Arbitrarität sprachlicher Ausdrücke berücksichtigen, dann stellt sich das Bedeutungsproblem auf eine ziemlich klare Weise: Warum bedeutet eine beliebiger sprachlicher Ausdruck gerade das, was er bedeutet, und nicht vielmehr irgend etwas anderes? Kürzer gesagt: Was ist es, das die Bedeutung eines Ausdrucks fixiert, wo dieser selbst es doch nicht tut. Die Antwort, die Wittgenstein in seinen Philosophischen Untersuchungen darauf gegeben hat, ist aufs Wesentlichste reduziert diese: Was die Bedeutung der Wörter oder Sätze fixiert, das ist der Gebrauch, der von ihnen in einer Sprache gemacht wird. Die Bedeutung eines Wortes oder Satzes ergibt sich, anders gesagt, aus der Rolle, die es/er in einer Sprache spielt, wobei die Rolle durch den Zweck bestimmt ist, dem das Wort oder der Satz dient, der Zweck, zu dem es gebraucht wird. Was wir tun müssen, um die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks richtig zu beschreiben ist dann, diesen Ausdruck in seiner Verwendungsweise beschreiben. Daher verlangt die akkurate Beschreibung der Bedeutung eines Ausdrucks eine Beschreibung dessen, was Wittgenstein ein Sprachspiel nennt. Dieser sehr bekannte Ausdruck von Wittgenstein ist sicherlich an keiner Stelle der Philosophischen Untersuchungen im Sinne eines strikten terminus technicus eingeführt. Was Wittgenstein hier im Sinn hat, ist dennoch recht klar. Zunächst einmal soll damit darauf hingewiesen werden, dass eine Sprache kein von der menschlichen Tätigkeit des Sprechens oder Schreibens losgelöstes System von bedeutungsvollen Zeichen ist. Denn wenn Bedeutung im Gebrauch besteht, kann kein Ausdruck eine seine Verwendung transzendierende Bedeutung haben. Eine Sprache besteht in Tätigkeiten des Sprechens und Schreibens, eine Sprache 23 ist also eine Form von Praxis. Zweitens soll der Ausdruck Sprachspiel aber auch darauf verweisen, dass die Sprache keine isolierte, für sich bestehende Art der Tätigkeit ist. Sprache ist wesentlich verwoben mit anderen Tätigkeiten, zum Beispiel der schlichten Tätigkeit des Zeigens oder Hinweisens. Eine Sprache ist also eine Praxis aber wesentlich Teil einer sie umfassenden Weise des Tätigseins. Und diese eine Sprache umfassende Tätigkeit oder Praxis nennt Wittgenstein auch eine Lebensform. In § 23 der Philosophischen Untersuchungen heißt es etwa: „Das Wort „Sprachspiel“ soll hier hervorheben, dass das Sprechen einer Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit; oder einer Lebensform.“ (S. 250). Eine weitere von Wittgenstein mit dem Ausdruck „Sprachspiel“ intendierte Assoziation ist die der Regel. Sprechen oder Schreiben sind, wenn Sie so wollen, Züge im Spiel der Sprache; um ein Zug in einem Sprachspiel sein zu können, muss ein Wort- oder Satzgebrauch aber einer in diesem Spiel etablierten Verwendungsweise gehorchen – und das können wir die Regel des Gebrauchs nennen. Woraus übrigens folgt, dass die Verwendung eines Ausdrucks ohne Regel gar kein Sprachgebrauch ist. Was ich soeben skizziert habe, ist sehr knapp in den §§ 61, 62 und 65 von Über Gewissheit ausgedrückt. Ich zitiere: 61. ... Eine Bedeutung eines Wortes ist eine Art seiner Verwendung. Denn sie ist das, was wir erlernen, wenn das Wort zuerst unserer Sprache einverleibt wird. 62. Darum besteht eine Entsprechung zwischen den Begriffen „Bedeutung“ und „Regel“. 65. Wenn sich die Sprachspiele ändern, ändern sich die Begriffe, und mit den Begriffen die Bedeutungen der Wörter. ( S. 132). Der letztgenannte § 65 sagt etwas über die Änderung und damit auch über die Verschiedenheit von Sprachspielen. Für uns interessanter ist hier der grundsätzlichere Begriff der Verschiedenheit. Einige Regeln eines Spiels sind offenbar für ein Spiel konstitutiv. Nimmt man solche Regeln weg oder ändert man diese Regeln, ändert man das Spiel. Es kommt hier übrigens nicht darauf an, notwendige und hinreichende Bedingungen zu finden, unter denen eine Regel als konstitutiv gilt. Wichtig ist nur, dass wir sehen können, dass einige Regeln für die Beschreibung eines Spiels in der Weise relevant sind, dass eine Beschreibung, die sie nicht enthält, nicht als Beschreibung des Spiels gelten würde. Betrachten wir zum Beispiel das Schachspiel. Wir können uns vorstellen, dass bei Schachturnieren ausschließlich schwarze und weiße Figuren als Spielfiguren zugelassen sind. Obwohl damit das Spiel wirklich einer Regelung unterworfen wird, handelt es sich dennoch nicht um eine Regelung, die zur Beschreibung des Spiels selbst gehört. Es ist sozusagen eine Zusatzregel. Die Regeln dagegen, die bestimmen, mit welchen Figuren welche Züge erlaubt sind, gehören zur Beschreibung des Schachspiels dazu – diese Regeln muss man jemandem beibringen, wenn 24 man ihm Schach beibringen will. Gehen wir nun von den Spielen zur Sprache über. Wir hatten gesehen, dass eine gemeinsame Sprache sprechen oder ein gemeinsames Sprachspiel spielen für Wittgenstein so etwas heißt wie eine Lebensform zu teilen. Was heißt es nun für Wittgenstein, eine Sprache und damit eine Lebensform zu teilen? Man könnte nun meinen, dass das ungefähr folgendes besagen müsste: Wir teilen eine Sprache und damit eine Lebensform genau dann, wenn wir miteinander in Bezug auf die Definitionen der Wörter übereinstimmen. Der § 242 der Philosophischen Untersuchungen belehrt uns da aber eines besseren. Dort heißt es: „Zur Verständigung durch die Sprache gehört nicht nur eine Übereinstimmung in den Definitionen, sondern (so seltsam das klingen mag) eine Übereinstimmung in den Urteilen.“ (356). Und diese Übereinstimmung in den Urteilen ist, wie Wittgenstein im vorangehenden § 241 sagt, „keine Übereinstimmung der Meinungen, sondern der Lebensform.“ Bedenken Sie, dass das überaus fremdartig anmutet. Denn normalerweise sind wir geneigt, die Dinge anders zu sehen: Ob wir in unseren Urteilen übereinstimmen, sollte man meinen, kann doch nicht dafür erforderlich sein, eine gemeinsame Sprache zu sprechen; es scheint vielmehr so zu sein, dass wir von einer Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung im Urteil erst sprechen können, wenn entschieden ist, ob wir in der Verwendung der Termini übereinstimmen, die unser Urteil konstituieren. Der springende Punkt für das Verständnis von Wittgenstein ist hier die Unterscheidung zwischen Meinung und Urteil. Was Wittgenstein hier ein Urteil nennt, das entspricht den konstitutiven Regeln eines Spiels. Um sagen zu können, dass ein Schachspieler falsch gezogen hat, müssen wir eine Übereinstimmung in Bezug auf die Regeln haben, die zur Beschreibung des Schachspiels selbst gehören. Gäbe es gar nicht solche Regeln, durch die das Spiel selbst beschrieben werden könnte, dann gäbe es auch gar keine richtigen und falschen Züge im Spiel und entsprechend auch keine Meinung über richtiges und falsches Ziehen. Mit seinem Begriff einer Übereinstimmung in Urteilen will Wittgenstein also einen Unterschied markieren zwischen den eine Sprache charakterisierenden Zügen und den Zügen innerhalb eines Sprachspiels. Diese Unterscheidung ist der Punkt, um den seine ganzen Überlegungen in Über Gewissheit kreisen. Dort setzte er sich mit dem Versuch George Edward Moores auseinander, den Common Sense gegen den philosophischen Skeptizismus zu verteidigen. Moore wollte gegen den Skeptizismus ins Feld führen, dass es eine ganze Anzahl von Aussagen gibt, die er mit Sicherheit wisse. Aussagen wie zum Beispiel: „Die Erde bestand langer Zeit vor meiner Geburt“, „Ich habe mich niemals weit von der Erdoberfläche entfernt“. Wittgensteins grundlegende Intuition war nun die, dass sowohl der philosophische Skeptizismus als auch Moores Versuch einer Verteidigung des Common Sense einer 25 grundsätzlich fehlgeleiteten Philosophie entspringen. Beide Unternehmen führen in die Irre, weil sie (um in der eben verwendeten Terminologie zu sprechen) Urteile behandeln als wären es Meinungen, weil sie, anders gesagt, die ein Sprachspiel charakterisierenden Züge mit Zügen innerhalb eines Sprachspiels verwechseln. Wittgenstein wies in Bezug auf das Skeptizismusproblem darauf hin, dass die Ausdrücke und Begriffe des des Zweifelns, der Gewissheit des Irrtums und insbesondere auch der Rechtfertigung sinnvoll nur innerhalb eines Sprachspiels zu verwenden sind, und dass die Urteile, in denen wir übereinstimmen müssen, um überhaupt etwa das epistemologische Sprachspiel spielen zu können, mit Hilfe dieser Begriff nicht adäquat beschrieben werden können: Alle Prüfung, alles Bekräftigen und Entkräften einer Annahme geschieht schon innerhalb eines Systems. Und zwar ist dieses System nicht ein mehr oder weniger willkürlicher und zweifelhafter Ausgangspunkt aller unsrer Argumente, sondern es gehört zum Wesen dessen, was wir ein Argument nennen. Das System ist nicht so sehr der Ausgangspunkt, als das Lebenselement der Argumente. (§ 105, S. 141). Was Wittgenstein in den PU Urteile nannte, nennt er in Über Gewissheit etwas eigenwillig grammatische Sätze, Sätze also, die die Grammatik oder, wie er auch sagt, die Logik eines Sprachspiels beschreiben. Bei grammatischen Sätzen denkt Wittgenstein dabei nicht etwa an abstrakte logische oder ontologische Prinzipien, sondern durchaus an solche Sätze wie „Die Erde hat schon vor meiner Geburt existiert“ oder „Hier ist eine Hand“. So heißt es in § 83: „Die Wahrheit gewisser Erfahrungssätze gehört zu unserem Bezugssystem“ – wobei der „Bezugssystem“ hier das gleiche meint wie „Lebensform“. Warum solche Sätze einen besonderen Status haben, warum es sich um grammatische Sätze handelt und nicht etwa um Hypothesen oder Vermutungen, hat für Wittgenstein seinen Grund darin, dass der Erwerb und Gebrauch einer Sprache – das Verstehen einer Sprache also – nur zusammen mit der Übernahme solcher Urteile möglich ist. Den Ausdruck „Hand“ etwa kann man nicht verwenden und verstehen lernen, ohne solch ein Urteil zu übernehmen wie „Das hier ist eine Hand“. Dass das Verstehen einer Sprache für Wittgenstein nicht unabhängig von der Übernahme grammatischer Sätze ist, zeigen sehr deutlich die §§ 80 und 81 in ÜG: 80. Man prüft an der Wahrheit meiner Aussagen mein Verständnis dieser Aussagen. 81. D. h. wenn ich gewisse falsche Aussagen mache, wird es dadurch unsicher, ob ich sie verstehe. (135) Dass solche Urteile, wie „Das hier ist meine rechte Hand“ übernommen werden müssen, um Sätze über Hände überhaupt verstehen zu können, schließt aus, dass man an einer solchen 26 Aussage zweifeln kann, schließt aber auch aus, dass man sagen kann, man wüsste mit Sicherheit, dass es so ist. So heißt es im § 24: Die Frage des Idealisten wäre etwa so: „Mit welchem Recht zweifle ich nicht an der Existenz meiner Hände?“ (Und darauf kann die Antwort nicht sein: „Ich weiß´, dass sie existieren.“) Wer aber so fragt, der übersieht, dass der Zweifel an einer Existenz nur in einem Sprachspiel wirkt. (124). Ein wichtiger Punkt ist nun der, dass die grammatischen Sätze oder die Urteile, wie ich sagte, Urteile sind, die übernommen werden, ihre Übernahme gehört zur Einübung in die Sprache. Dass sie übernommen werden heißt, dass sie zu akzeptieren nicht auf einer Begründung beruht. Und das können sie nach Wittgensteins Auffassung über die Bedingungen des Verstehens auch nicht. Wir verwenden, sagt Wittgenstein an einer Stelle „Urteile als Prinzipien des Urteilens.“ (§ 124) Aber diese Urteile, die als Prinzipien dienen, sind jene Urteile im engeren Sinn grammatischer Sätze; und diese akzeptieren wir nicht, weil wir Gründe für sie haben, sondern wir übernehmen sie einfach. 128. Ich habe von Kind auf so urteilen gelernt. Das ist Urteilen. 129. So habe ich urteilen gelernt; das als Urteil kennen gelernt. Die Übernahme von Urteilen, die für das Verstehen einer Sprache erforderlich ist, ist zugleich die Übernahme einer Lebensform oder, wie Wittgenstein auch sagt, eines Bezugssystems oder eines Weltbildes. Eine Lebensform übernehmen wir, ein Weltbild haben wir, aber nicht, weil wir uns irgendwie überzeugt hätten, dass es richtig sei: 94. Aber mein Weltbild habe ich nicht, weil ich mich von seiner Richtigkeit überzeugt habe; auch nicht, weil ich von seiner Richtigkeit überzeugt bin. Sondern es ist der überkommene Hintergrund, auf welchem ich zwischen wahr und falsch unterscheide. Wittgenstein zieht damit der alten epistemologischen Kontroverse über den Skeptizismus und seine mögliche Widerlegung gleichsam den Zahn, indem er die sprachphilosophischen Voraussetzungen dieser Kontroverse zu unterminieren versucht. Die Möglichkeit von Bedeutung und die Möglichkeit des Verstehens hängen an der Übernahme von Urteilen und außerhalb einer solchen Übernahme kann das epistemologische Sprachspiel der Rechtfertigung, des Zweifels usw. gar nicht erst in Gang kommen – einfach deshalb, weil es unverständlich bleibt. Die Schwierigkeit – und damit meint Wittgenstein wohl die philosophische Schwierigkeit, sich von der Verhexung des traditionellen Skeptizismusproblems zu befreien – „die Schwierigkeit ist, die Grundlosigkeit unseres Glaubens einzusehen.“ (§ 166). Ist es dann aber aus Wittgensteins Sicht unmöglich, in Urteilen nicht überein zu stimmen? Nein – Wittgenstein sagt nicht, dass es unmöglich sei in Urteilen nicht überein zu stimmen, er 27 deutet das Nicht-Übereinstimmen in Urteilen nur anders als das Nicht-Übereinstimmen in Meinungen. In Urteilen nicht übereinstimmen kann aus der Sicht Wittgensteins nur heißen: In der Lebensform nicht übereinstimmen: 92. Man kann nun aber fragen: „Kann Einer einen triftigen Grund haben zu glauben, die Erde existiere erst seit kurzem, etwa erst seit seiner Geburt?“ – Angenommen, es wäre ihm immer so gesagt worden, – hätte er einen guten Grund, es zu bezweifeln? Menschen haben geglaubt, sie könnten Regen machen; warum sollte ein König nicht in dem Glauben erzogen werden, mit ihm habe die Welt begonnen? Und wenn nun Moore und dieser König zusammenkämen und diskutierten, könnte Moore wirklich seinen Glauben als den richtigen erweisen? Ich sage nicht, dass Moore den König nicht zu seiner Anschauung bekehren könnte, aber es wäre eine Bekehrung besonderer Art: der König würde dazu gebracht, die Welt anders zu betrachten. (S. 138/9) Beachten Sie, dass Wittgenstein hier von der Möglichkeit einer Konversion spricht – wobei er unter Konversion die Übernahme eines anderen Weltbildes versteht, und das heißt die Akzeptanz eines anderen Weltbildes ohne Gründe. Das kann freilich nur deshalb so sein, wenn er die Sätze „Die Erde hat schon lange vor meiner Geburt existiert“ und „Die Erde hat mit meiner Geburt angefangen zu existieren“ als grammatische Sätze in seinem Sinn deutet. Und das wiederum würde bedeuten, dass Moore und der König in dem Sinne in Bezug auf die Dauer der Existenz der Erde nicht übereinstimmen, dass sie die Ausdrücke „Erde“ oder „Existenz“ oder „Geburt“ unterschiedlich verwenden – dass diese Ausdrücke also eine unterschiedliche Bedeutung haben. Als Gesamtbild ergibt sich aus Wittgensteins sprachphilosophischen Auffassung daher das Folgende: Da Sprechen und Schreiben menschliche Aktivitäten sind, die nur innerhalb einer Lebensform stattfinden und nur innerhalb einer solchen Lebensform Bedeutung haben, kann die Frage, was ein sprachlicher Ausdruck – ein Wort oder ein Satz – bedeutet nur durch die Beschreibung der ihn einbettenden Lebensform bestimmt werden. Wir müssen also, um die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks angeben zu können, seinen Gebrauch untersuchen, und der Gebrauch eines Ausdrucks ist eine Praxis, die Teil einer Lebensform ist. Das Konzept der Lebensform deutet dabei darauf hin, dass die Verwendungsweise eines sprachlichen Ausdrucks letztendlich nichts ist, was man als eine rationale Wahl verstehen oder rekonstruieren könnte. Verwendungsweisen sind an gemeinsame oder geteilte Urteile oder grammatische Sätze gebunden, die ihrerseits keine Basis in anderen Urteilen haben, durch die sie gerechtfertigt würden. Das aber nicht deshalb, weil die von Spielern eines Sprachspiels geteilten Urteile im traditionellen Sinne unbezweifelbare, weil selbstevidente Urteile wären, sondern deshalb, weil es sich um Urteile handelt, die akzeptiert sein müssen, damit ein Ausdruck die Bedeutung haben kann, die er hat. Eine Sprache sprechen oder verstehen heißt für Wittgenstein daher die grammatischen Sätze, durch welche ein Sprachspiel beschrieben wird, als Urteile zu übernehmen. Ein wichtiger Punkt ist hierbei der, dass es nach 28 Wittgenstein offenbar keine intrinsische Eigenschaft bestimmter Sätze ist, dass sie grammatische Sätze sind und Urteile ausdrücken. Ein grammatischer Satz oder ein Urteil zu sein heißt: eine bestimmte Rolle für ein Sprachspiel zu spielen. Sie sind die Grundlage eines Sprachspiels, insofern sie zur Instruktion eines Sprachspiels gehören. Sprachspiele werden sich daher unterscheiden je nachdem wie die Instruktion in sie erfolgt: Unterschiedlichen Arten der Instruktion korrespondieren unterschiedliche Sprachspiele. Wittgensteins religionsphilosophische Überlegungen lassen sich nun auf dem Hintergrund des bisher Gesagten anhand der Begriffe des Sprachspiels und der Lebensform rekonstruieren. Was Wittgenstein über die religiöse Rede und über den religiösen Glauben sagt, der in solcher Rede artikuliert wird, zielt insgesamt darauf, einer, wie er meint, irreführenden Assimilation der Religion an das Sprachspiel des Behauptens, Begründens, Vermutens, Belegens – kurz an den deskriptiv faktenbezogenen Sprachgebrauch anzugleichen. Religiöse Sprache hat in Wittgensteins Sicht einen anderen Sinn, sie ist Teil einer besonderen Lebensform, und obwohl viele Sätze der Religion so aussehen, als würde damit beschrieben, wie die Welt ist, oder als würde damit erklärt, warum irgendetwas der Fall ist, haben sie diese Funktion nicht. Beides: dass religiöse Rede für Wittgenstein eine Sprachspiel eigener Art und dass die Religion eine besondere Lebensform darstellt, können wir uns zunächst anhand zweier Texte verdeutlichen. Dass religiöse Sprache ein Sprachspiel eigner Art ist, will Wittgenstein in einem Text aus seinen Vorlesungen über den religiösen Glauben durch Hinweis auf die Besonderheit der Instruktion in die religiöse Rede verdeutlichen: Das Wort „Gott“ gehört zu denen, die am frühesten gelernt werden – Bilder, Katechismen usw. Aber diese Bilder haben nicht dieselben Folgen wie die Bilder von Tanten. Man hat mir nicht gezeigt, [was das Bild abbildet]. Dieses Wort wird wie ein Wort gebraucht, das eine Person repräsentiert. Gott sieht, belohnt usw. „Hast Du nicht, nachdem man die alle diese Dinge gezeigt hat, verstanden, was dieses Wort bedeutet?“ Ich möchte sagen: „Ja und Nein. Ich habe gelernt, was es nicht bedeutet. Ich habe mich selbst dazu gebracht, das zu verstehen. Ich konnte Fragen beantworten, Fragen verstehen, wenn sie auf verschiedene Weisen gestellt wurden – und in dem Sinn könnte man sagen, dass ich es verstanden habe.“ Wenn sich die Frage nach der Existenz eines Gottes oder Gottes stellt, dann spielt sie eine ganz andere Rolle als Fragen nach der Existenz aller Menschen oder Dinge, von denen ich sonst noch gehört habe. Man sagte, hatte zu sagen, dass man an seine Existenz glaubte, und wenn man nicht daran glaubte, galt dies als etwas Böses. Wenn ich sonst nicht an die Existenz von etwas glaubte, hätte das niemand irgendwie verkehrt gefunden. Außerdem ist da dieser ganz außerordentliche Gebrauch des Worten „Glauben“. Man spricht vom Glauben und gebraucht „Glauben“ dabei nicht in der Alltagsbedeutung. Man könnte (in der Alltagsbedeutung) sagen: „Du glaubst das nur ... Ach so!“ Hier wird das Wort anders gebraucht, und andererseits wird es nicht so gebraucht, wie wir im allgemeinen das Wort „Wissen“ gebrauchen. Wenn ich mich auch nur vage an das erinnere, was mir über Gott beigebracht wurde, würde ich doch sagen: „Was immer der Glaube an Gott sein mag, es kann kein Glaube an etwas sein, das wir nachprüfen oder durch Nachschauen herausfinden können.“ (S. 95/6) 29 Worauf Wittgestein hier aufmerksam machen will, ist dass der religiöse Sprachgebrauch ganz anderer Natur ist als etwa unser Alltagssprachgebrauch. Die Besonderheit der religiösen Rede sieht er dabei in der besonderen und außerordentliche Art der Instruktion in das religiöse Sprachspiel begründet. An dieser Stelle weist er auf drei für die religiöse Rede konstitutive Redeelemente hin: den Gebrauch des Ausdrucks „Gott“, den Gebrauch des Satzes „Gott existiert“ und den Gebrauch des Ausdrucks „glauben“. Der Ausdruck „Gott“, sagt Wittgenstein gleich zu Anfang, wird wie ein Wort gebraucht, das eine Person repräsentiert, wird also wie ein Name – wie ein singulärer Terminus – gebraucht. Das ist aber offenbar nicht Wittgensteins eigene Auffassung. Denn er weist uns sofort darauf hin, dass Namen – genuine Namen – ganz anders in die Sprache eingeführt werden als der Ausdruck „Gott“. Namen werden nämlich durch Ostension – durch Hinzeigen auf den Referenten des Namen oder auch durch Hinzeigen auf ein Bild des Referenten des Namens – eingeführt. Aber das ist bei dem Ausdruck „Gott“ gerade nicht der Fall. Vor dem Hintergrund von Wittgensteins Sprachphilosophie muss das aber bedeuten, dass der Ausdruck „Gott“ gar keinen referierenden Gebrauch hat. Denn nach Wittgensteins Auffassung kann ja die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks seine Verwendung oder seinen Gebrauch nicht transzendieren. Und da die Einführung des Ausdrucks „Gott“ in die Sprache nicht der typischen Einführung referierender Ausdrücke durch Ostension entspricht, kann der Ausdruck „Gott“ daher nicht als ein referierender Ausdruck interpretiert werden – also auch nicht als ein Ausdruck, mit dessen Gebrauch die Intention verbunden sein kann, auf eine Entität zu referieren. Wenn wir aber von „Gott“ keinen referierenden Gebrauch machen, kann ein Satze wie „Gott existiert“ nicht deskriptiv verstanden werden – es kann sich nicht um einen Satz handeln der eine Bedeutung hat wie „Schmitz existiert“ oder „Es gibt Planeten“. Diesen Punkt hebt Wittgenstein hervor, wenn er sagt, dass die Frage, ob Gott existiert, eine ganz andere Rolle spielt als die Frage, ob Menschen oder andere Dinge existieren. Der Unterschied zwischen „Gott existiert“ und, sagen wir „Die Venus existiert“ zeigt sich für Wittgenstein daran, dass eine Zurückweisung der Existenz Gottes als etwas Böses gilt, während die Zurückweisung der Existenz irgendeines Planeten nicht als etwas Böses gilt. Offenbar will Wittgenstein damit sagen, dass es zu den Verstehensbedingungen und damit zur Bedeutung von „Gott existiert“ gehört, dass diesen Satz zu akzeptieren etwas Gutes, ihn nicht zu akzeptieren etwas Schlechtes ist. „Gott existiert“ zu verstehen heißt also eine bestimmte Sichtweise zu übernehmen, in der Gut- und Bösesein an die Akzeptanz dieses Satzes gebunden ist. Das bedeutet aber, dass Wittgenstein „Gott existiert“ gar nicht als eine Existenzaussage interpretiert, die wahr oder falsch ist, je nachdem ob Gott existiert oder nicht existiert. 30 Entsprechend muss dann natürlich auch der Begriff der Existenz hier ein anderer sein. „Existenz“ im Zusammenhang mit dem Ausdruck „Gott“ verwendet hat eine andere Bedeutung eben deshalb, weil es im Zusammenhang mit dem Ausdruck „Gott“ verwendet wird. Dieser Zusammenhang scheint für Wittgenstein in der Tat so eng zu sein, dass den Ausdruck „Gott“ nur derjenige verstehen kann, der „Gott existiert“ im eben angegebenen Sinne akzeptiert. Wir lernen die Bedeutung von „Existenz“ nicht kontextunabhängig sondern im Zuge einer Sprachspielinstruktion, und da die Übernahme von „Gott existiert“ selbst zur Instruktion gehört, kann sich hier die Frage, ob Gott denn wirklich existiert eigentlich gar nicht mehr stellen. Wenn nun „Gott existiert“ nicht als genuine Existenzaussage verstanden werden kann, dann – und damit kommen wir zum dritten Punkt Wittgensteins – kann natürlich auch der religiöse Glaube nicht als Glauben im üblichen Sinne verstanden werden. Im üblichen Sinne verstanden ist Glauben eine epistemische Einstellung, die propositionale Einstellung des Für-wahr-Haltens nämlich. Glauben, dass Gott existiert, wäre in diesem Verständnis allein durch den Gehalt oder Inhalt des Glaubens, nicht aber qua Einstellung von dem Glauben, dass die Venus existiert, unterschieden: In beiden Fällen handelte es sich um das Für-wahr-Halten einer Existenzproposition. Da nun Wittgenstein zu Folge „Gott existiert“ gar nicht als Existenzpropositon interpretiert werden kann, weil ja da der Gebrauch von „Gott“ und „Existenz“ in diesem Satz überhaupt nicht als ein deskriptiver Sprachgebrauch interpretiert werden kann, kann man Glauben an Gott auch nicht als eine epistemische Einstellung interpretieren. Wenn Wittgenstein sagt, dass das Wort Glauben im religiösen Kontext ganz anders gebraucht wird als im Alltag, dann meint er damit eben nichts anderes als dass es nicht im epistemischen Sinn gebraucht wird. Im epistemischen Sinn verstanden ist Glauben nämlich etwas, das wahr oder falsch ist, je nachdem, ob der propositionale Gehalt wahr oder falsch ist, und damit auch ein Zustand, der irgendwelche epistemische Tugenden haben kann. Alles das aber wird von Wittgenstein ausgeschlossen. Weil religiöse Sprache ein eigenständiger Sprachgebrauch ist, ist auch der religiöse Glaube etwas Eigenständiges, ein Glauben sui generis. Das bedeutet letztendlich, dass die religiöse Bedeutung des Worts Glauben nur erfassen und verstehen kann, wer – und das ist sicherlich überaus paradox – im religiösen Sinne glaubt. Hier sehen wir nun Wittgensteins Verknüpfung von religiösem Sprachspiel und religiöser Lebensform am Werk. Das religiöse Sprachspiel sprechen können, kann nichts anderes heißen als in eine bestimmte Lebensform hinein versetzt zu sein. Dieser Punkt wird besonders an einer Stelle aus Wittgensteins Vermischten Bemerkungen deutlich. Dort schreibt er: 31 Es kommt mir vor, als könne ein religiöser Glaube nur etwas wie das leidenschaftliche Sich-entscheiden für ein Bezugssystem sein. Also obgleich es Glaube ist, doch eine Art des Lebens, oder eine Art das Leben zu beurteilen. Ein leidenschaftliches Ergreifen dieser Auffassung. Und die Instruktion in einem religiösen Glauben musste also die Darstellung, Beschreibung jenes Bezugssystems sein und zugleich ein in’s-Gewissen-reden. Und diese beiden müssten am Schluß bewirken, dass der Instruierte selber, aus eigenem, jenes Bezugssystem leidenschaftlich erfasst. Es wäre, als ließe mich jemand auf der einen Seite meine hoffnungslose Lage sehen, auf der andern stellte er mir das Rettungswerkzeug dar, bis ich, aus eigenem, oder doch jedenfalls nicht von dem Instruktor an der Hand geführt, auf das zustürzte und es ergriffe. (S. 541). Hier beschreibt Wittgenstein den religiösen Glauben als ein leidenschaftliches Sich-Entscheiden für ein Bezugssystem. Der entscheidende Ausdruck ist hier der des leidenschaftlichen Sich-Entscheidens. Der Übergang von einem Zustand des Nicht-Glaubens zu einem Zustand des Glaubens wird damit als etwas Extraordinäres charakterisiert. Es handelt sich dabei nämlich nicht um einen gewöhnlichen Prozess der Meinungsbildung, in dem Gründe für und wider die einer Proposition ausschlaggebend für ihre Akzeptanz sind, sondern um eine Entscheidung. Diese Entscheidung ist aber wiederum ebenfalls extraordinär, insofern sie nicht von einer Überlegung regiert wird, durch die der Wert alternativer Handlungsmöglichkeiten bestimmt wird. Es handelt sich aber auch nicht um eine impulsive ad hoc Entscheidung, von der man sagen könnte, dass sie besser auf eine überlegte Weise hätte herbeigeführt werden sollen. Wittgensteins Rede von einem leidenschaftlichen Sich-Entscheiden scheint vielmehr andeuten zu sollen, dass der Übergang zum religiösen Glauben ein Übergang ist, der aus der Perspektive des Nicht-Glaubens allenfalls ahnungsvoll antizipiert, nicht aber als eine unter mehreren rationalen Alternativen adäquat beschrieben werden kann. Denn die Folge eines solchen Sich-Entscheidens ist die Übernahme eines anderen Bezugssystems – es handelt sich um einen Wechsel der Perspektive selbst, um einen Wechsel in der Art zu leben und das Leben zu betrachten. Es handelt sich also um einen extremen Fall von Konversion, einen Sprung in eine andere Art die Welt und das Leben in ihr zu betrachten. Zu beachten ist hierbei, dass diese Konversion aus Wittgensteins Sicht nicht von dem Inhalt des religiösen Glaubens abhängig sein kann. Denn erstens ist das, was Wittgenstein eine Instruktion in den Glauben nennt, kein rechtfertigender Prozess, bei dem Gründe für den religiösen Glauben angeführt werden, und zweitens kann eine Instruktion den Glauben nicht zum Resultat haben, da sie nicht in der Lage ist, zu beschreiben, was es heißt, an Gott zu glauben. Wie radikal Wittgensteins Auffassung hier ist, lässt sich daran ablesen, wie er das Verhältnis des religiösen Glaubens zum gewöhnlichen epistemischen Sprachspiel beschreibt. Betrachten wir dazu einige Stellen wiederum aus seinen Vorlesungen über den religiösen Glauben 32 Angenommen, jemand wäre gläubig und sagte „Ich glaube an das Jüngste Gericht“ und ich sagte „Nun, ich bin da nicht so ganz sicher. Vielleicht“. Man würde doch sagen, dass ein Abgrund uns trennt. Wenn er sagte „Das da oben ist ein deutsches Flugzeug“, und ich antwortete „Vielleicht, ich bin nicht ganz sicher“, würde man sagen, dass unsere Ansichten sich ziemlich nahe kommen. Es handelt sich hier nicht um eine Frage des sich irgendwie Näherkommens; die Sachen liegen auf einer ganz anderen Ebenen; man könnte das ausdrücken, indem man sagt: „Du meinst etwas ganz und gar anderes, Wittgenstein!“(87/8) Wenn man mich fragt, ob ich an das Jüngst Gericht glaube oder nicht, in dem Sinne, in dem religiöse Menschen daran glauben, dann würde ich nicht sagen „Nein, ich glaube nicht, dass es so etwas geben wird.“ Es würde mir ganz verrückt vorkommen, das zu sagen. Und dann erkläre ich „Ich glaube nicht an ...“, aber dann glaubt der Religiöse niemals, was ich beschreibe. Ich kann es nicht sagen. Ich kann ihm nicht widersprechen. (90) Diese beiden Stellen verdeutlichen noch einmal Wittgensteins Auffassung, dass religiöser Glaube sui generis ist und dass im religiösen Sinne zu glauben etwas vollkommen anderes ist als glauben, verstanden als eine epistemische Einstellung. Hier lässt sich aber auch die Radikalität dieser Auffassung ablesen. Wittgenstein erläutert hier den Sinn der Differenz von religiösem und nicht-religiösem Glauben, indem er sie mit einer Meinungsverschiedenheit kontrastiert und hebt hervor, dass ein Nicht-Gläubiger nicht als jemand beschrieben werden kann, der anderer Meinung ist als ein Gläubiger. Wer sagt: „Ich glaube nicht an Gott“ oder „Ich glaube nicht an das Jüngste Gericht“ widerspricht dadurch dem Gläubigen nicht, da der Ausdruck „glauben“ im Munde des Nicht-Gläubigen einen vollkommen anderen Sinn hat als im Munde des Gläubigen. Den inkommensurablen Bedeutungen von „glauben“ korrespondieren dabei inkommensurable Beschreibungen des Glaubens: Der Nicht-Gläubige und der Gläubige können sich also nach Wittgenstein unmöglich auf ein und denselben Glaubensinhalt beziehen, denn der Religiöse glaubt, wie Wittgenstein hervorhebt, niemals das, was ich beschreibe, wenn ich so etwas sage wie „ich glaube nicht an das Jüngste Gericht“ Daher, und das ist die Spitze Wittgenstein’scher Religionsphilosophie, ist es unmöglich dem Gläubigen zu widersprechen! Wenn es aber unmöglich ist, dem Gläubigen zu widersprechen, indem man sagt „Ich glaube nicht an Gott“, dann ist es auch unmöglich Gründe für eine Ablehnung religiösen Glaubens zu geben. So finden wir in Wittgensteins Vermischten Bemerkungen finden wir folgende Notiz: So sonderbar es klingt: Die historischen Berichte der Evangelien könnten, im historischen Sinn, erweislich falsch sein, und der Glaube verlöre doch nichts dadurch [...] weil der historische Beweis (das historische Beweis-Spiel) den Glauben gar nichts angeht. (495) Der Unmöglichkeit falsifizierender Gründe korrespondiert aber auch die Unmöglichkeit von Gründen, durch die der Glaube gestützt werden könnte. In den Vorlesungen über den religiösen Glauben schreibt Wittgenstein entsprechend: 33 Nehmen wir an, wir kennen Leute, die die Zukunft voraussehen, deren Voraussagen sich über lange Jahre erstrecken und die zu guter Letzt so etwas wie den Tag des Jüngsten Gerichts beschreiben. Es ist ganz merkwürdig, aber selbst wenn es so etwas gäbe, und wenn es überzeugender wäre als ich es beschrieben habe, wäre der Glaube an dieses Ereignis doch kein Glaube im religiösen Sinne. (91) Die Vorstellung, dass der religiöse Glaube durch Gründe gestützt werden könnte, ist nach Wittgenstein irreführend, weil sie einem anderen, dem epistemischen Sprachspiel der Rechtfertigung entstammt. So schreibt er, dass es „der Witz der Sache [ist], dass die ganze Geschichte zerstört würde, sobald es Beweise gäbe.“ (91) Die Assimilation des religiösen Sprachspiels an das wissenschaftliche ist nach Wittgenstein gerade das Charakteristikum des Aberglaubens: „Religiöser Glaube und Aberglaube sind ganz verschieden. Der eine entspringt aus Furcht und ist eine Art falsche Wissenschaft. Der andere ist Vertrauen.“ (VB 551) Wittgensteins religionsphilosophische Sicht steht, wie wir jetzt sehen können, in scharfem Kontrast zu der Beschreibung religiöser Rede, die ich am Anfang am Beispiel des Apostolischen Glaubensbekenntnisses gegeben habe. Zur Erinnerung: ich hatte vier Punkte hervorgehoben: (1) Die Sprache des Apostolische Glaubensbekenntnis ist, wenn es im Gottesdienst gesprochen wird, wesentlich expressiv, kundgebend oder eben bekennend, es ist aber möglich, die expressive oder kundgebende Funktion zu neutralisieren oder zu eliminieren. (2) Die Neutralisierung oder Eliminierung der expressiven Sprachfunktion führt nicht zu einer vollkommenen Aufhebung des Sinns dieses Bekenntnisses. Vielmehr bleiben die Inhalte, das heißt die deskriptiven Aspekte des Credo zurück. (3) Der deskriptive Gehalt des Bekenntnisses kann verwendet werden, um jemandem, der nicht die geringste Ahnung vom christlichen Glauben hat, über den christlichen Glauben zu informieren. Daher kann man (4) Den christlichen Glauben verstehen ohne ihn selbst übernommen zu haben. Man kann das Bekenntnis verstehen ohne selbst bekennen zu müssen. Wie sollen wir die Situation einschätzen? Ich selbst halte Wittgensteins Interpretation der religiösen Sprache und des religiösen Glaubens für wenig überzeugend. Betrachten wir einige Probleme, die seine Sicht mit sich bringt. 1) Wittgensteins Interpretation entzieht den Glauben jeder rationalen Auseinandersetzung. Eine Immunität gegen möglicherweise widerlegende Instanzen erweist sich aber schnell als ein Bärendienst für den Glauben, indem der Glaube dadurch provinzialisiert und privatisiert wird. Wenn religiöser Glaube eine selbstgenügsame Praxis, ein in sich geschlossenes 34 Sprachspiel ist, dann ergibt sich die Frage, wie eine Religion dann noch Anspruch auf öffentliche Anerkennung erheben kann. Einen Anspruch auf öffentliche Anerkennung auch nur erheben setzt voraus, dass die Religion einen informativen Gehalt hat, der auch dem Nicht-Gläubigen zugänglich sein kann. Und einen begründeten Anspruch auf öffentliche Anerkennung erheben können setzt voraus, dass es Gründe dafür geben kann, eine von der Religion vermittelte Beschreibung und Diagnose der menschlichen Situation zu akzeptieren. Ist Religion selbstgenügsam und eine jeder rationalen Auseinandersetzung gegenüber entzogene Lebensform, kann sie folglich nicht einmal sinnvoll öffentliche Anerkennung beanspruchen. 2) Damit hängt unmittelbar ein weiterer Punkt zusammen. Wenn Religion provinziell ist, dann sehe ich nicht, dass es irgendeinen interessanten Grund geben könnte, der dafür spräche, Kinder religiös anstatt areligiös zu erziehen, noch kann ich sehen, dass es dann irgendeinen Grund geben könnte, der dafür spräche, sie eher in dieser als in jener Religion zu erziehen. 3) Wenn Religion jeder rationalen Auseinandersetzung entzogen ist, dann gibt es damit unmittelbar Gründe, ihr öffentliche Anerkennung zu verweigern, oder jedenfalls eine Stützung und Beförderung des Glaubens zu unterlassen. 4) Wenn eine rationale Auseinandersetzung über religiösen Glauben unmöglich ist, dann spricht alles für eine naturalistische Erklärung religiösen Glaubens, die das Faktum religiösen Glaubens aus außerrationalen Mechanismen der menschlichen Psyche erklären. Diese vier Punkte können natürlich nicht als entscheidende Einwände gegen Wittgensteins Auffassung gelten. Sie machen aber deutlich, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen der Möglichkeit einer rationalen Auseinandersetzung über Religion und der Vorstellung, dass Religion eine bedeutende Rolle im Leben der Menschen spielen kann. Immunisierung führt zur Provinzialisierung und verdammt Religion damit zur Rolle eines lediglich psychologisch und soziologisch interessanten Phänomens. Es gibt aber freilich weiter Punkte, die Wittgensteins Auffassung unmittelbar betreffen: 5) Der Satz „Gott existiert“ ist sicherlich keine wissenschaftliche Hypothese. Aber daraus folgt freilich nicht, dass es sich um keine Existenzaussage, sondern um bloß um einen Satz handelt, durch den eine Bindung an ein Bezugssystem kundgegeben wird – die Bindung, heißt das an eine Lebensform oder Praxis. Der entscheidende Punkt ist hier nämlich der, dass einer Person nur dann ein Grund gegeben ist, ein religiös orientiertes Leben zu führen und an einer religiösen Praxis teilzunehmen, wenn sie glaubt, dass Gott existiert. Natürlich ist es so, dass die Praxis oder Lebensform nicht aus dieser Überzeugung entspringt; es ist aber so dass der Glaube an Gott nicht in der Teilnahme an einer religiösen Praxis besteht. Niemand von uns 35 hat Schwierigkeiten zu verstehen, dass sich eine Person gegenüber einer religiösen Praxis entfremdet, dass sich diese Praxis zu einer Menge leerer Rituale für sie wird, weil sie den Glauben an Gott verloren hat. Hätte Wittgenstein recht, dann müssten wir sagen, dass derjenige, der den Glauben an Gott verliert, die religiöse Lebensform und die religiöse Sprache nicht mehr verstehen kann. Aber das ist zweifellos nicht der Fall. Die Sache sieht vielmehr so aus, dass derjenige, der den Glauben an Gott verloren hat, damit keinen Grund mehr hat, an einer religiösen Praxis teilzunehmen. Er könnte in einem bestimmten Sinne natürlich noch immer daran teilnehmen und beispielsweise das Glaubensbekenntnis sprechen, aber er kann es nur noch unaufrichtig sprechen. Daher kann, um es noch einmal zu betonen, der Glaube an Gott nicht in der Praxis bestehen, das Glaubensbekenntnis zu sprechen. 6) Argumentieren und Gründe geben ist nicht das Vorrecht der Wissenschaft. Daher kann man nicht sagen, dass der Versuch einer rationalen Auseinandersetzung mit der Religion zu einer fehlerhaften Modellierung der Religion als einer Art Wissenschaft führen würde. So impliziert zum Beispiel der Satz „Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube vergeblich“ den Satz „Entweder ist Christus auferstanden oder unser Glaube ist vergeblich“ – und diese Implikation gilt aus ganz genau denselben Gründen, aus denen aus dem Satz „Wenn Schmitz nicht gewählt wird, dann war unser Wahlkampf umsonst“ den Satz impliziert „Entweder wird Schmitz gewählt oder unser Wahlkampf war umsonst.“ Wenn religiöse Rede aber in sich rational strukturiert ist, dann hat sie rational artikulierte oder artikulierbare Gehalte und dann ist nicht zu sehen, warum sie jenseits der Möglichkeit rationaler Bewertung stehen sollte. 7) Wittgensteins Interpretation der religiösen Sprache lässt uns im unklaren darüber, welche Äußerungen zum religiösen Diskurs zu zählen sind. Betrachten Sie dazu noch einmal den Satz des Apostel Paulus: „Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube vergeblich.“ Nehmen Sie nun an ein Nicht-Gläubiger würde sagen „Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist Euer Glaube vergeblich“. Nach Wittgensteins Auffassung könnte der letztere Satz gar nicht als Bestandteil des religiösen Diskurses aufgefasst werden. Aber das ist natürlich extrem unplausibel. Denn warum sollte Paulus Äußerung als religiös, die des anderen aber als nicht-religiös interpretiert werden, obwohl beide genau den gleichen Gehalt haben. Der einzig Unterschied in diesen Sätzen besteht im Personalpronomen – wir können aber sehen, dass diese Sätze genau das gleiche sagen, weil aus ihnen nämlich genau das gleiche folgt. Das zeigt aber, dass nicht nur Gläubige, sondern auch Nicht-Gläubige am religiösen Diskurs teilnehmen können. Es zeigt auch, dass ein Nicht-Gläubiger einem Gläubigen zustimmen kann. 36 8) Wittgensteins Auffassung scheint die Unterschiede zwischen Atheismus und anderen Formen des Nicht-Glaubens einzuebnen. Wittgenstein muss jeden nicht-religiösen Standpunkt als einen Standpunkt interpretieren, der dem der religiöse semantisch unzugänglich ist. Aber das ist wenig überzeugend. Denn diese Beschreibung würde uns dazu zwingen, den Atheisten semantisch in die selbe Lage zu versetzen wie eine Person, der die Religion völlig unbekannt ist. Betrachten Sie als Analogie etwa drei Einstellungen zum Leib-Seele-Dualismus: (a) Zurückweisung: „Der Dualismus ist falsch“; (b) Epistemische Zurückhaltung „Ich weiß nicht/wir können nicht wissen, ob der Dualismus wahr oder falsch ist“ (c) Unkenntnis der dualistischen These: „Ich weiß nicht, was Leib-Seele-Dualismus besagt.“ Diese drei unterschiedlichen Einstellungen lassen sich unschwer auch in Bezug auf die Religion konzipieren. Das Problem ist nun, dass Wittgenstein zwischen Zurückweisung, Zurückhaltung und Unkenntnis offenbar nicht mehr grundsätzlich unterscheiden kann. Denn da der Versuch der Zurückweisung wie auch der Versuch einer Urteilsenthaltung nach Wittgenstein ja prinzipiell misslingt ist beides von der Situation einer Person, die gar nicht versteht, worum es in religiösen Dingen geht, ununterscheidbar. Aber das ist natürlich ein absurde Konsequenz. 9) Wittgensteins Interpretation versagt, sobald wir als Zielpunkt unserer Beschreibung nicht nur Gläubige und Nicht-Gläubige kontrastieren, sondern darüber hinaus auch Gläubige verschiedener Religionszugehörigkeit ins Spiel bringen. Wittgensteins Auffassung scheint es auszuschließen, dass es so etwas wie eine partielle Übereinstimmung in religiösen Dingen geben kann. Wenn nämlich der Glaube ein leidenschaftliches Sich-Entscheiden für ein Bezugssystem ist, dann kann christlicher Glaube und jüdischer Glaube keine partielle Übereinstimmung aufweisen, weil Christen sich an ein anderes Bezugssystem binden als Juden. Das bringt aber ein enormes Problem mit sich. Denn nun wären wir gezwungen es nicht nur für unmöglich zu erklären, dass der Nicht-Gläubig den Gläubigen versteht, sondern auch die Unmöglichkeit eines interreligiösen Diskurses zu behaupten. Abgesehen davon, dass das extrem unplausibel ist, hat das zur Konsequenz, dass die Begriffe des religiösen Sprachspiels, der religiösen Praxis und der religiösen Lebensform entleert werden. An die Stelle des Bilds einer semantisch eigenständigen religiösen Rede tritt nun das Bild unbestimmt vieler semantisch eigenständiger Sprachen. Wenn aber andererseits auch im Wittgenstein’schen Rahmen die Möglichkeit einer partiellen Übereinstimmung zwischen Personen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit eingeräumt wird, dann ist nicht zu sehen, warum Möglichkeit wechselseitigen Verständnisses ausschließlich im Rahmen eines interreligiösen Diskurses nicht aber auch für das Gespräch zwischen Gläubigen und Nicht-Gläubigen eingeräumt werden kann. Betrachten wir dazu noch 37 einmal das Apostolische Glaubensbekenntnis. Wenn wir die Möglichkeit partieller Übereinstimmung und damit wechselseitigen Verständnisses zwischen, sagen wir, Christen und Juden einräumen, dann wird das etwa den Anfang des christlichen Glaubensbekenntnisses betreffen: „Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.“ Nun enthält das Glaubensbekenntnis unter anderem auch Sätze die besagen, dass Jesus unter Pontius Pilatus gelitten hat, dass er gekreuzigt worden ist, dass er gestorben und begraben worden ist. Auch Sätzen, können wir uns vorstellen, kann auch ein Jude ohne weiteres zustimmen. Nun ergibt sich die Frage, warum sollte nicht auch ein Nicht-Gläubiger diesen Jesus betreffenden Sätzen zustimmen können, wo doch ein Gläubiger, der kein Christ ist, ihnen zustimmen kann? Wittgenstein könnte vielleicht sagen, dass die Aussagen über Jesus gar nicht als historische Aussagen zu verstehen sind, und das die Zustimmung des Nicht-Gläubigen diesen Aussagen nur gelten kann, insofern sie als historische Aussagen interpretiert werden. Für den Christen, kann er sagen, bedeuten diese Sätze etwas ganz anderes, da sie für ihn ihren Sinn nur im Zusammenhang mit dem Glauben an die Auferstehung Jesus’ und dem Glauben, dass Jesus die Lebenden und die Toten richten wird, erhalten. Dieser Einwand führt aber dazu, dass wir dann auch nicht mehr sagen könnten, ein Jude könnte dem Satz, dass Jesus unter Pontius Pilatus gelitten hat und gekreuzigt worden ist, zustimmen. Denn er glaubt nicht an Jesus Christus als dem eingeborenen Sohn Gottes, der von den Toten auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist und dereinst die Lebenden und die Toten richten wird. Und dies würde aus den gleichen Gründen dazu führen, dass er auch nicht mehr dem Anfang des christlichen Glaubensbekenntnisses zustimmen kann. Räumen wir also ein, es könne partielle Übereinstimmung und damit wechselseitiges Verstehen zwischen religiösen Konfessionen geben, müssen wir auch die Möglichkeit wechselseitigen Verstehens zwischen Gläubigen und Nicht-Gläubigen einräumen. Damit können wird die Darstellung und Diskussion von Wittgensteins Interpretation der religiösen Sprache und des religiösen Glaubens abschließen. Kumulativ zumindest wiegen die Argumente meiner Einschätzung nach so schwer, dass wir allen Grund haben sollten, Wittgensteins Sicht nicht zu akzeptieren. Als Fazit der gesamten Diskussion über Sprache, Realität und Religion ergibt sich damit das folgende Bild. Religiöse Rede ist nicht sinnlos im Sinne der logischen Positivisten; religiöse Rede ist aber auch nicht semantische inadäquat im Sinne der negativen Theologie oder der These der Ineffabilität Gottes; religiöse Rede ist aber schließlich auch nicht, wie Wittgenstein es gesehen hat, in einem ganz anderen Sinne bedeutungsvoll als es unsere alltagsprachlichen oder wissenschaftlichen Beschreibungen der Welt sind. Es ist zweifellos zwar richtig, dass religiöse Rede nicht ausschließlich deskriptiv 38 ist, sondern in vielen Kontexten auch expressiv und kundgebend ist. Sie ist aber definitiv auch deskriptiv. „Gott existiert“ beispielsweise ist eine echte Existenzaussage, der ein Wahrheitswert zukommt. Und wer an Gott glaubt, der muss auch diese Existenzaussage für wahr halten. Daher ist religiöser Glaube, wenn sicherlich auch nicht ausschließlich, so doch immer auch ein faktualer Glaube – glauben, dass etwas der Fall ist. Der Ausdruck „Gott“ wird entsprechend als ein referierender Terminus gebraucht, und diesen Ausdruck kann auch jemand ohne semantische Verzerrung verwenden, der nicht gläubig ist. Weiterhin gilt, dass viele religiöse Sätze nicht nur deskriptivistisch, sondern auch realistisch interpretiert werden müssen. Dass Gott existiert, oder dass Gott der Schöpfer der Welt ist, sind nicht nur echte Aussagen, es handelt sich um Aussagen, durch die die Wirklichkeit beschrieben werden soll, wie sie unabhängig von uns selbst ist, es handelt sich dezidiert nicht um eine Beschreibung unserer Vorstellungen, Gefühle oder Erlebnisse und auch nicht um eine Beschreibung die irgendeinen konstitutiven Beitrag zu dem leistet, was von ihr beschrieben wird. 39 II. Glaube und Vernunft Das Verhältnis von Glauben und Vernunft gehört – vollkommen zurecht übrigens – zu den thematischen ‚Evergreens’ nicht nur der Religionsphilosophie, sondern natürlich auch der Theologie. Bevor wir uns gleich näher mit der Frage beschäftigen, was das recht vage formulierte Problem einer Bestimmung des Verhältnisses von Vernunft und Glaube, besagt, möchte ich zunächst einmal betonen, dass es dabei nicht um das Verhältnis von Philosophie und Theologie geht und dass wir das Problem, das wir hier betrachten wollen, nicht als einen Streit der Fakultäten stilisieren dürfen. Der Punkt ist hier einfach der, dass es weder zur Definition der Philosophie gehört, dass sie in Opposition zur Theologie steht, noch zur Definition der Theologie gehört, dass sie in Opposition zur Philosophie steht. Sowohl Philosophen als auch Theologen können höchst unterschiedliche Ansichten über das Verhältnis von Glauben und Vernunft vertreten ohne damit ihrer Profession irgendwie untreu werden zu müssen. Das Bild, dass der Philosoph sich aus Profession heraus skeptisch gegenüber den Ansprüchen des religiösen Glauben verhalten müsse, der Theologe andererseits ein professionelles Interesse an der Zurückweisung der Philosophie haben müsse, entspricht nicht den Tatsachen und ist einfach naiv. Um Ihnen kurz ein Beispiel dafür zu geben, dass die Theologie nicht eo ipso irgendwie vernunftfeindlich ist, genügt ein Zitat aus der 1998 von Papst Johannes Paul II herausgegebenen Enzyklika Fides et ratio: Nachdem die Vernunft ohne den Beitrag der Offenbarung geblieben war, hat sie Seitenwege eingeschlagen, die die Gefahr mit sich bringen, dass sie ihr letztes Ziel aus dem Blick verliert [...] Es ist illusorisch zu meinen, angesichts einer schwachen Vernunft besitze der Glaube größere Überzeugungskraft; im Gegenteil, er gerät ernsthaft in Gefahr, auf Mythos bzw. Aberglauben verkürzt zu werden. Nicht unangebracht mag deshalb mein entschlossener und eindringlicher Aufruf erscheinen, dass Glaube und Philosophie die tiefe Einheit wiedererlangen sollen, die sie dazu befähigt, unter gegenseitiger Achtung der Autonomie des anderen ihrem eigenen Wesen treu zu bleiben. [zitiert nach: Rochus Leonhardt, Grundinfomation Dogmatik, S. 101]. Um andererseits Beispiele dafür zu finden, dass die Philosophie nicht eo ispo glaubensfeindlich ist, bedarf es nur einer kurzen Erinnerung an die verschiedenen Strömungen der christlichen oder theistischen Philosophen von den mittelalterlichen Scholastikern angefangen bis zu christlichen Existentialisten wie Gabriel Marcel. Nachdenken über das Verhältnis von Glaube und Vernunft ist weiterhin, wie ich schon sagt, auch keine Vorrecht der Philosophie, sondern natürlich auch ein integraler Bestandteil der Theologie selbst. Wie dieses Verhältnis zu bestimmen ist, ist dabei in keiner Weise dadurch vorentschieden, ob man zur Zunft der Theologen oder zur Zunft der Philosophen gehört. Es gibt einfach nicht die philosophische Auffassung zu diesem Problem, sowenig wie es die theologische Auffassung dazu gibt. Es ist 40 daher auch nicht a priori auszuschließen, dass ein Philosoph zu der Auffassung kommen kann, der theistische Glaube sei kognitiv und epistemisch eine vollkommen respektable Weltsicht, obwohl er keine Stütze in irgendwelchen sinnvoll nicht bezweifelbaren Überzeugungen hat. Beginnen wir nun mit einer Klärung der Frage nach dem Verhältnis von Vernunft und Glauben. Bei ernsthaften und ernstzunehmende religiöse Denkern finden wir wiederholt Beschreibungen, die nahe legen, dass Vernunft und Glauben miteinander unverträglich sind, dass das Verhältnis beider nur das der Feindschaft und der Zurückweisung sein kann. Im Kollosserbrief des Apostel Paulus finden wir etwa die folgende Stelle (2:8): „Sehet zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und lose Verführung nach der Menschen Lehre und nach der Welt Satzungen und nicht nach Christo.“ Der frühe christliche Theologe Tertullian stellte die berühmt gewordene Frage. „Was hat Athen mit Jerusalem zu tun?“ – wobei Athen für die griechische Philosophie, Jerusalem für die christliche Kirche steht. Die Frage ist natürlich rhetorisch gemeint und legt als Antwort nahe: „Sie haben gar nichts miteinander zu tun, sondern sind einander vollkommen entgegengesetzt.“ Bei Pascal finden wir den Gegensatz von Glauben und Vernunft als Gegensatz zwischen Herz und Vernunft dargestellt: „Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt [...]“ (FR 277) und „Es ist das Herz, das Gott spürt, und nicht die Vernunft. Das ist der Glaube: Gott spürbar im Herzen und nicht in der Vernunft.“ (FR 278). Dies scheint zu implizieren, dass es zwischen Vernunft und Herz eine Opposition gibt, die dazu führt, dass derjenige, der sich allein auf seine kognitiven Fähigkeiten zu verlassen versucht, den Glauben – die Liebe zu Gott – nicht finden kann, und dass daher der Gläubige gut beraten ist, den Glauben nicht zur einer Angelegenheit der Vernunft zu machen. Es ist nun aber gar nicht leicht, eine überaus scharf geschnittene Unterscheidung und Trennung zwischen Vernunft und Glauben vorzunehmen. Oder sie ist vielmehr sinnvoll gar nicht vorzunehmen, wenn das besagen würde, dass es im Glauben überhaupt keinen Platz für die menschliche Vernunft geben könnte. Aber das wollen die genannten Denker auch nicht sagen. Die Warnung des Apostel Paulus zielt nicht auf eine vollständige Abdankung vernünftigen Denkens in Glaubensangelegenheiten, sondern auf eine bestimmte Art des Denkens, nämlich eines rein weltlich orientierten Denkens und dessen Anspruch auf alleinige Autorität. Seine Warnung gilt also einem ausschließlichen Vertrauen auf die Philosophie verstanden als Weltweisheit: „Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht Weisheit dieser Welt, auch nicht der Obersten dieser Welt, welche vergehen.“ (1. Kor. 2:6) Das besagt aber nicht, dass Paulus der Vernunft überhaupt keinen Platz im Glauben 41 einräumen würde. Eine Lektüre seiner Briefe zeigt uns etwa, dass er in seinen religiösen Unterweisungen Gebrauch von Argumenten macht, dass er den Sinn des Glaubens analysiert, dass er begriffliche Unterschiede markiert, Überlegungen über die Basis des Glaubens anstellt und sich um eine Abgrenzung des rechten von falschem Glauben bemüht. Pascal wiederum, ein zweifellos überaus scharfsinnigster Denker, behauptete ebenfalls nicht, dass die Vernunft keinen Platz im Glauben hat, auch ihm geht es in seiner Gegenüberstellung von Vernunft und Herz um eine Kritik an einer bestimmten Auffassung über die Rolle der Vernunft und an einer bestimmten Art des Vernunftgebrauchs: Die Auffassung nämlich, dass ausschließlich eine nicht vom Glauben informierte und den, wie er es nennt, Gründen des Herzens gegenüber indifferente Vernunft als Richterin über den Glauben auftreten dürfe. Dass nichtsdestotrotz auch für Pascal die Vernunft im Glauben einen Platz hat, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass eins seiner wichtigsten Lebensprojekte in der Konstruktion einer Apologie – einer rationalen, argumentativen Verteidigung – des Christentums bestand. Aus unserer Diskussion von Wittgenstein hat sich übrigens ergeben, dass es für die Ausübung der rationalen Kapazitäten, über die Gläubige wie Nicht-Gläubige gleichermaßen verfügen, einfach deshalb einen Platz in der Religion gibt, weil diese einen deskriptiven Gehalt hat und ihre Aussagen wahr oder falsch sein können. Tatsächlich macht auch jede religiöse Gemeinschaft, welche Vorstellung auch immer sie über das Verhältnis ihres Glaubens zur Vernunft hat, bei der Lehre und Unterweisung und Interpretation religiöser Lehren Gebrauch von rationalen begrifflichen Kapazitäten, die sie auch mit Leuten teilen, die ihrer Gemeinschaft nicht angehören. Dieser Punkt – dass die Vernunft einen Platz im Glauben hat – ist also in keiner Weise kontrovers und nicht der Punkt, um den es in der Frage nach dem Verhältnis von Vernunft und Glauben geht. Der kontrovers diskutierte Punkt ist also nicht der, dass Vernunft eine Rolle im Glauben spielt, sondern die Frage, welche Rolle die Vernunft in Bezug auf den Glauben spielt. Sehr allgemein gesprochen, geht es bei der Frage nach dem Verhältnis von Glauben und Vernunft also um die Maßstäbe der Bewertung religiösen Glaubens. Dabei ist es äußerst wichtig, die Frage nach den Maßstäben der Bewertung von der Frage nach der Wahrheit eines religiösen Glaubens zu unterscheiden. Von den Maßstäben der Bewertung hängt es etwa ab, ob die Wahrheit des Glaubens erwiesen werden können muss, damit er anerkannt werden kann. Von einer Entscheidung über die Maßstäbe der Bewertung hängt damit auch entscheidend ab, ob die sogenannten Gottesbeweise – Argumente für die Existenz Gottes – überhaupt irgendeine interessante Rolle für die Akzeptabilität des Glaubens spielen, und welche Rolle sie spielen, wenn sie denn eine spielen können. Auch wenn es klar ist, dass es bei der Frage nach dem Verhältnis von Glauben und Vernunft um die Maßstäbe der 42 Bewertung des Glaubens geht, ist es nicht leicht, diese Frage weiter so zu spezifizieren, dass alle interessanten Verzweigung einer Debatte über Maßstäbe erfasst werden. Eine grobe Skizze soll deshalb hier genügen. Unter Maßstäben der Bewertung sollen im Folgenden Maßstäbe der epistemischen Bewertung verstanden werden. Und wenn es um die Frage der Akzeptierbarkeit des Glaubens geht, soll es daher um die Frage der epistemischen Akzeptierbarkeit gehen. Vor diesem Hintergrund können wir die Kontroverse über das Verhältnis von Glauben und Vernunft als eine Kontroverse über die Frage stehen, ob man gute Gründe für die Wahrheit eines religiösen Glaubens haben muss, um epistemisch zum Glauben berechtigt zu sein. Gute Gründe für die Wahrheit des Glaubens werden dabei solche sein, die vom Glauben selbst in geeigneter Weise unabhängig sind. Und daher können wir die Frage auch so formulieren: Ist eine Person nur dann zu einem religiösen Glauben epistemisch berechtigt, wenn es vom Glauben selbst (in geeigneter Weise) unabhängige Gründe für den Glauben gibt? Anhand dieser Frage lässt sich schnell verdeutlichen, an welchen Stellen ungefähr die Kontroversen verlaufen. Eine Kontroverse entspinnt sich natürlich über die Frage, ob der Glaube guter Gründe im Sinne glaubensunabhängiger Gründe bedarf um akzeptabel zu sein. Vielleicht reicht es ja zum Beispiel schon aus, dass es keine guten Gründe gegen den Glauben gibt, damit er akzeptabel ist. Eine weitere, daran anschließende Frage wäre die, ob es solche unabhängigen Gründe geben muss oder ob der Gläubige, um epistemisch zu seinem Glauben berechtigt zu sein, diese Gründe selbst kennen und angeben können muss. Diese Frage würde uns in sehr spezielle Probleme der allgemeinen Erkenntnistheorie führen – und ich werde sie daher nicht weiter verfolgen. Eine weitere Kontroverse entspinnt sich angesichts der Frage, was es denn heißt ein guter Grund für den Glauben zu sein. Ist ein guter Grund ein in dem Sinne ein unabhängiger Grund, dass er auch für Nicht-Gläubige einsehbar sein muss. Oder ist ein guter Grund in dem Sinne ein unabhängiger Grund, dass er für Nicht-Gläubige sowohl einsehbar sein als auch zwingende Zustimmung erfahren können muss? Ist also ein guter Grund für den Glauben, ein Grund, der jede rationale Person bewegen müsste, den Glauben zu übernehmen, oder ist ein guter Grund ein Grund, der den Gläubigen berechtigt an seinem Glauben festzuhalten, auch wenn er für einen Nicht-Gläubigen nicht zwingend überzeugend ist? Diese Batterie von Fragen verdeutlicht, dass die Kontroverse über Vernunft und Glauben auf mehreren Ebenen verläuft., und überaus subtil gestalten werden kann. Im folgenden möchte ich zwei sehr grundsätzliche Positionen vorstellen, deren Geist sich schon an der Frage scheidet, ob es unabhängiger Gründe für den Glauben bedarf. 43 a) Evidentialismus Die erste Position, die ich Ihnen vorstellen möchte, wird oftmals als Evidentialismus, von einigen Autoren auch als starker Rationalismus bezeichnet. Als exemplarisch für diese Position kann die von John Locke in seinem Essay Concerning Human Understanding dargestellt Auffassung gelten. Die für unseren Zusammenhang relevanten Erörterungen finden sich im 4. Buch des Locke’schen Hauptwerks und da insbesondere in den Kapiteln XVIII (Of Faith and Reason and their distinct Provinces) und XIX (Of Enthusiasm – Über die Schwärmerei). Gleich zu Beginn des 18. Kapitels verdeutlicht Locke zunächst sowohl den Charakter als auch die Relevanz einer Bestimmung des Verhältnisses von Glauben und Vernunft. Irrtümer und Streitigkeiten in religiösen Dingen, glaubte Locke, haben ihre Ursache letztlich darin, dass man sich über die Gebiete und Grenzen von Glauben und Vernunft im Unklaren ist und dass man meinte, die Frage der Grenzbestimmung außer Acht lassen zu können. Streitigkeiten in religiösen Dingen sind endlos und ohne Chance, jemals für alle Parteien zufrieden stellen gelöst zu werden, wenn keine Klarheit darüber herrscht, wo die Stimme der Vernunft und wo die Stimme des Glaubens Gehör gegeben werden muss. Denn ohne eine klare Grenzbestimmung von Glauben und Vernunft muss die Rechtmäßigkeit der Ansprüche streitender Parteien unentschieden bleiben, da jede Partei sich auf den Glauben oder auf die Vernunft berufen kann so wie es ihrem eigenen Anliegen gerade passt: Ich finde, dass jede Schule gern von der Vernunft Gebrauch macht, soweit diese ihr zu Hilfe kommt; wo sie aber versagt, ertönt der Ruf: Das ist Glaubenssache und übersteigt die Vernunft. Ich sehe nicht ein, wie solche Leute mit jemandem argumentieren oder einen Gegner, der zu derselben Ausrede greift, jemals überzeugen können, wenn sie nicht die Grenzen zwischen Glauben und Vernunft genau festlegen. Meiner Ansicht nach ist dies ein Punkt, der bei allen Fragen, die irgendwie mit dem Glauben zu tun haben, zu allererst festgesetzt werden müsste. (Locke IV, XVIII, 2 – S. 393). Anhand dieses Zitats können wir festhalten, worin für Locke der Charakter und die religionsphilosophische Relevanz einer Bestimmung der Grenzen von Vernunft und Glauben besteht: (1) Was den Charakter einer solchen Untersuchung betrifft, sagt Locke, dass bei allen den Glauben betreffenden Fragen die Grenzen von Glauben und Vernunft zu aller erst festgesetzt werden müssen. Die Bestimmung der Grenzen von Glauben und Vernunft betrachtet Locke also als ein alle Debatten in Glaubensfragen vorgeordnetes Problem, und das heißt insbesondere, dass eine solche Bestimmung gegenüber kontroversen Ansichten in religiösen Dingen unparteiisch ist oder dass die Klärung des Verhältnisses von Glauben und Vernunft gegenüber den religiösen Gehalten des Glaubens neutral und unabhängig von ihnen ist. Nach 44 Lockes Auffassung handelt es sich bei der Bestimmung des Verhältnisses von Glauben und Vernunft also um eine epistemologische und methodologische Untersuchung, die in religiösen Fragen nicht unmittelbar Partei ergreift, sondern den Rahmen oder ein Verfahren zur Beurteilung der Ansprüche kontroverser religiöser Standpunkte bereitstellt. Dass die Bestimmung der Grenzen von Glauben und Vernunft religiösen Fragen vorgeordnet ist und als vorgeordnete Untersuchung von solchen Fragen unabhängig und den verschiedenen religiösen Standpunkten gegenüber neutral ist, ist charakteristisch für Lockes Auffassung und unterscheidet sie von der Position des sogenannten Fideismus, die wir später noch kennen lernen werden. (2) Die Relevanz einer Festsetzung der Grenzen von Glauben und Vernunft besteht für Locke, wie schon gesehen, darin, dass eine solche Festsetzung die Grundlage liefert, auf welcher sonst endlose und unauflösliche Streitigkeiten in religiösen Dingen entschieden und damit zu einem Ende gebracht werden können. Die Festsetzung der Grenzen befreit vor allem vor einer rein strategisch und nicht im Dienst der Wahrheitsfindung stehenden Berufung auf die Vernunft oder den Glauben, indem sie uns verdeutlicht, unter welchen Bedingungen wir uns auf die Vernunft und unter welchen wir uns auf den Glauben berufen dürfen. Es ist unschwer zu erkennen, dass es aus Lockes Sicht einen engen Zusammenhang zwischen diesen beiden Punkten gibt. Die Beendigung von Streitigkeiten in religiösen Dingen kann für Locke nur deshalb von einer Grenzbestimmung zwischen Glauben und Vernunft und auch nur von dieser erwartet werden, weil sie eben unabhängig und neutral gegenüber kontroversen oder nicht gemeinsam geteilten religiösen Auffassungen ist. Sind die Berufungsinstanzen in religiösen Dingen einmal festgelegt, dann können sich kontrovers diskutierende Parteien mit Argumenten wirklich überzeugen und zu einer einhelligen Auffassung kommen. Nicht unwichtig ist in diesem Zusammenhang übrigens, dass Locke den Atheismus als eine der in religiösen Dingen miteinander streitenden Parteien nicht mit berücksichtigt. Denn seine gesamte Erörterung über das Verhältnis von Glauben und Vernunft entwickelt Locke vor dem Hintergrund seiner im Kapitel X des vierten Buchs dargelegten Überzeugung, dass die Existenz Gottes evident, weil beweisbar ist. Dass Gott existiert, steht für Locke also außer Frage, und Atheismus wie auch Agnostizismus sind für ihn daher keine Positionen, über deren Berechtigung auf der Basis einer Grenzziehung zwischen Glauben und Vernunft zu entscheiden ist, sondern Positionen, die aufgrund der Beweisbarkeit der Existenz Gottes gar nicht zur Menge der Parteien zählen können, deren Streit allein durch die Erstellung eines epistemologischen Rahmens geschlichtet werden kann. Religiöser Glaube ist daher für Locke keineswegs etwas per se Außerrationales. „Das ist Glaubenssache!“ darf für Locke weder als ein Abwehr unberechtigter Ansprüche der Vernunft im Namen von angeblich vollkommen 45 autonomen religiösen Wahrheiten verstanden werden, noch als polemische Bemerkung im Sinne von „Das ist bloße Glaubenssache!“ verstanden werden, durch welche auf die essentielle Unvernünftigkeit und Unverbindlichkeit des religiösen Glaubens verwiesen wird. Für Locke stellt sich das Problem der Grenzziehung zwischen Glauben und Vernunft als das Problem festzulegen, unter welchen Bedingungen wir berechtigt sind, bestimmte Aussagen zu glauben – und das heißt, berechtigt sind, Aussagen, deren Wahrheit durch den Glaubenden selbst nicht erwiesen werden kann, dennoch als wahr anzuerkennen. Religiöser Glauben, darum geht es Locke, muss als glaubwürdig gelten können, und die Grenzziehung zwischen Vernunft und Glauben besteht in der Angabe der Bedingungen der Glaubwürdigkeit religiösen Glaubens. Diesen Punkt können wir besser verstehen, wenn wir zunächst einmal Lockes allgemeine Charakterisierung von Vernunft und Glauben betrachten: Ich verstehe [...] unter Vernunft [reason] hier, wo sie als Gegensatz zum Glauben aufgefasst wird, die Ermittlung der Gewissheit oder Wahrscheinlichkeit solcher Sätze oder Wahrheiten, zu denen der Geist durch Ableitung aus solchen Ideen gelangt, die er durch die Betätigung seiner natürlichen Fähigkeiten erworben hat, nämlich durch Sensation und Reflexion. Der Glaube [faith] andererseits ist die Zustimmung zu irgendeinem Satze, der nicht in der geschilderten Weise durch die Herleitungen der Vernunft ermittelt ist, sondern im Vertrauen auf die Glaubwürdigkeit dessen, der ihn aufstellt, akzeptiert wird, weil er auf einem außerordentlichen Wege der Mitteilung von Gott kommt. Diese Art, den Menschen Wahrheiten zu verkündigen, nennen wir Offenbarung. (Locke, ebd.) Locke unterscheiden Vernunft und Glauben hier als zwei Prozesse der Meinungsbildung oder der Festlegung von Meinungen – Prozesse, heißt das, die in der Zustimmung zu einem Satz oder einer Aussage terminieren. Wie Locke sie charakterisiert, handelt es sich dabei nicht nur um verschieden Arten, sondern durchaus um einander ausschließende Arten der Festlegung von Meinungen. Der „Vernunft“ genannte Prozess ist wesentlich ein Prozess der Ableitung von Sätzen aus, wie Locke sagt, Ideen, die aufgrund natürlicher Fähigkeiten erworben worden sind. Eine vernunftgemäße oder vernünftige Zustimmung zu einer Aussage ist daher wesentlich ein Zustimmung, die aufgrund einer Ableitung – aufgrund eines Arguments – erteilt wird. Der „Glaube“ genannte Prozess ist dagegen gerade nicht ein Prozess der Ableitung: Die Meinungsfestlegung erfolgt hier auf der Basis des Vertrauens in die Glaubwürdigkeit oder Wahrhaftigkeit desjenigen, der die betreffende Aussage mitteilt. Die Zustimmung zu einer Aussage erfolgt also in diesem Fall, weil sie mitgeteilt worden ist – wobei die Mitteilung der Aussage als Offenbarung einer Wahrheit durch Gott verstanden wird. Bis hierher liefert Lockes Unterscheidung eine Beschreibung zweier Arten der Meinungsfestlegung. Damit ist aber noch nichts über die Berechtigung der Zustimmung zu einer Aussage gesagt. Was die Vernunft betrifft, so ist klar, dass die Berechtigung der Zustimmung 46 einerseits von der Akzeptierbarkeit der Prämissen der Herleitung und andererseits von dem Ausmaß abhängt, in welchem die Prämissen die in Frage stehende Aussage stützen. Wie aber steht es mit dem Glauben – sind hier ganz andere als die Kriterien rationaler Akzeptanz in Anschlag zu bringen? Lockes Auffassung ist die, dass der Glaube zwar Aussagen zum Gegenstand hat, deren Wahrheit durch Vernunft nicht zu ermitteln ist und dass diese sogar den eigentlichen Gegenstand des Glaubens ausmachen, dass die die Vernunft übersteigenden Aussagen aber nur akzeptiert werden können, wenn es sich dabei wirklich um Offenbarungen Gottes handelt. Offenbarungen Gottes, unterstreicht Locke selbst, sind nicht anzweifelbar – was immer Gott den Menschen mitteilt, ist wahr und dabei über jeden Zweifel erhaben. Der für Locke entscheidende Punkt ist aber der, dass es durch Vernunft ermittelt werden können muss, ob es sich in einem gegebenen Fall überhaupt um eine Offenbarung handelt. Daher ist religiöser Glaube nur dann und nur in dem Maße berechtigt, als es Evidenzen dafür gibt, dass die Texte oder Aussagen oder Ereignisse, auf die er sich stützt, Offenbarungen Gottes sind. In der folgenden Passage drückt sich Locke unzweideutig in dieser Richtung aus: Alles, was Gott geoffenbart hat, ist sicherlich wahr; daran ist jeder Zweifel ausgeschlossen. Das bildet den eigentlichen Gegenstand des Glaubens. Ob aber etwas als göttliche Offenbarung anzusehen ist oder nicht, darüber muß die Vernunft entscheiden. Und sie kann dem Geist niemals erlauben eine größere Augenscheinlichkeit zu verwerfen, um etwas weniger Einleuchtendes zu akzeptieren; auch kann sie ihm nicht gestatten, im Gegensatz zur Erkenntnis und Gewissheit an der Wahrscheinlichkeit festzuhalten. (S. 402) Um eine offenbarte Wahrheit anzunehmen, brauchen wir, sagt Locke hier, keine Evidenz. Wir brauchen aber Evidenz dafür, dass es sich um eine Offenbarung handelt. Das heißt aber nichts anderes, als dass wir nur unter der Bedingung berechtigt sind, einer nicht selbstevidenten religiösen Aussage P ohne Ableitung zuzustimmen, dass wir aufgrund von Evidenzen berechtigt sind, der Aussage „Es ist durch Gott offenbart worden, dass P“, zuzustimmen. Der vernünftige oder rationale Prozess der Festlegung einer Überzeugung wird damit auch zur rechtfertigenden Basis des Glaubens. Daher kann nichts als Evidenz für „Es ist durch Gott offenbart worden, dass P“ gelten, wenn P selbst – der Inhalt der vermeintlichen Offenbarung – entweder selbstevident oder demonstrierbar falsch ist. Selbstevidente oder demonstrierbare Falschheit einer Aussage P ist vielmehr gerade eine zwingende Evidenz dafür, dass Gott P nicht offenbart hat. Lockes Argument dafür ist offenbar dieses: 1. Wenn Gott offenbart, dass P, dann ist es wahr, dass P. 2. Es ist falsch, dass P. 3. Dass P, ist nicht von Gott offenbart worden. Schwieriger wird die Sache, wenn der Inhalt einer vermeintlichen Offenbarung weder selbstevident oder demonstrierbar falsch, sondern seine Wahrheit im Lichte unserer weltli- 47 chen Überzeugungen betrachtet unwahrscheinlich ist. In diesem Fall – Locke drückt sich hier nicht eindeutig aus – müssen wir die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Offenbarung Gottes handelt, gegen die Wahrscheinlichkeit des Inhalts der vermeintlichen Offenbarung abwägen. Diese Angelegenheit ist trickreich und kompliziert, entspricht aber dem von Locke akzeptierten Prinzip, dass die Zustimmung zu einem Satz immer in Proportion zur Kraft der Beweise stehen muss, auf welche sich die Zustimmung stützt. Ohne diesen Punkt vertiefen zu müssen, können wir festhalten, dass religiöser Glaube für Locke nur dann und in dem Maße akzeptierbar ist, als er den Prinzipien der vernünftigen Zustimmung und den durch die Vernunft selbst ermittelten Wahrheiten nicht entgegensteht. Obwohl Glaubenssätze wie etwa die Überzeugung von der Auferstehung der Toten, die Vernunft übersteigen, können sie, sofern akzeptierbar, die Vernunft nicht einengen, da ihre Akzeptierbarkeit auf einer vorgängigen Zustimmung der Vernunft zum Offenbarungscharakter etwa der Bibel beruhen. Andere religiöse Überzeugungen, wie die Grundüberzeugung von der Existenz Gottes, sind dagegen für Locke gar nicht Sache des Glaubens, sondern demonstrierbare Wahrheiten und damit vollständig Sache der Vernunft. Daher wird insgesamt die Vernunft durch den Glauben nicht eingeschränkt, der Glaube aber durch die Vernunft, insofern kein religiöser Glaube akzeptierbar ist, der keine evidentielle Basis hat. Nun könnte man freilich fragen, warum das alles so sein sollte, wie Locke es darstellt? Warum insbesondere sollte es allgemein zulässig oder sogar gefordert sein, den Offenbarungen Gottes ohne Argument zuzustimmen, nicht aber zulässig sein, zum Beispiel das Neue Testament ohne Argument als eine Offenbarung Gottes zu akzeptieren? Locke begründet das damit, dass wir sonst dem Enthusiasmus – d. h. der religiösen Schwärmerei – Tür und Tor öffnen würden, wodurch der Begriff eines berechtigten oder akzeptierbaren Glaubens entleert würde. Schwärmerei ist für Locke eine Geisteshaltung, welche „die Vernunft beiseiteschiebt und die Offenbarung allein, ohne die Vernunft, auf den Thron setzen möchte.“ (Locke IV, XIX, 3 – S. 406). Ihr Kennzeichen besteht darin, die Stärke der Überzeugung selbst für deren Richtigkeit, das Gefühl des Erleuchtetseins als untrügliches Kennzeichen des Erleuchtetseins nehmen. Wenn man diese Gemütsverfassung nüchtern betrachtet, ergibt sich aber die Frage: Wie kann ich wissen, dass es Gott ist, der mir dies offenbart, dass dieser Eindruck auf meinen Geist durch seinen heiligen Geist hervorgebracht ist und ich ihm deshalb gehorchen muss? Wenn ich das nicht weiß, so ist meine Überzeugung – wie stark sie auch sein mag – grundlos; welches auch die Erleuchtung sei, die ich beanspruche: sie ist nichts als Schwärmerei. (411) Wenn man etwas als wahr ansieht, weil Gott es geoffenbart hat, dann ist es, hebt Locke hervor, eine „Pflicht, zu untersuchen, auf welche Gründe hin [man] das Betreffende als eine 48 Offenbarung von Gott [ansieht.]“ (ebd.; meine Hervorh.) Andernfalls wird man wie die Schwärmer in einem schlechten Zirkel herumgeführt, für die etwas eine Offenbarung ist, weil sie es fest glauben, und die wiederum so fest glauben, weil es eine Offenbarung ist. (ebd.) Lockes Auffassung ist also klarerweise die, dass der Glaube zu einem selbstbestätigenden Geisteszustand degeneriert, würde die Offenbarung zur Basis des Glaubens gemacht – wobei selbstbestätigend eben auch heißt: für niemanden bestätigend außer für die glaubende Person selbst. Das aber führt zu vollkommener Beliebigkeit im Glauben, was zur Konsequenz hat, dass der religiöse Glaube gar nicht als etwas rational Akzeptierbares gelten kann. Ein Glaube aber, der nicht rational akzeptierbar ist, muss fallen gelassen und darf nicht übernommen oder auch verbreitet werden. Lockes evidentialistische Auffassung über die Akzeptierbarkeit religiösen Glaubens können wir in drei Sätzen zusammenfassen: (1) Wenn es nicht rational oder vernünftig ist eine Aussage über Gott oder irgendeine andere religiöse Aussage zu akzeptieren, dann darf man ihr nicht zustimmen. (2) Eine Aussage über Gott oder irgendeine andere religiöse Aussage ist nur dann rational akzeptierbar, wenn man ihr auf der Basis anderer Aussagen oder Überzeugungen zustimmen kann, die eine adäquate Evidenz für sie bilden. (3) Das Ausmaß der Zustimmung zu einer Aussage darf die Stärke der Evidenz für diese Aussage nicht übersteigen. Übersteigt die Zustimmung die Stärke der Evidenz, so ist sie nicht rational. Diese drei Prinzipien drücken die Locke’schen Kriterien für die Akzeptierbarkeit des Glaubens aus. Locke selbst war zuversichtlich, dass der christliche Glaube diesen Kriterien genügen kann. Er war weiterhin zuversichtlich, dass die von ihm vorgenommene Grenzziehung zwischen Glauben und Vernunft den Rahmen bildet, in dem religiöse Streitigkeiten ein für allemal geschlichtet werden können. Im Hintergrund seiner Zuversicht steht die Überzeugung, dass die Existenz Gottes demonstrierbar ist. Ist diese nicht demonstrierbar, dann – und das ergibt ein Problem für Locke’s umfassende Weltsicht – dann kann es natürlich auch keine adäquate Evidenz dafür geben, dass Gott irgendetwas offenbart hat. Das zeigt schon, dass Locke an den religiösen Glauben Kriterien der Akzeptierbarkeit legt, die so stark sind, dass sie den Glauben als eine annehmbare Weltsicht insgesamt gefährden können. Insbesondere werden durch Lockes Evidentialismus Argumente für die Existenz Gottes zum Prüfstein der Annehmbarkeit und rationalen Verantwortbarkeit religiösen Glaubens. Die Kritik an solchen Beweisversuchen hat unter den Kriterien Lockes unmittelbar die Zurückweisung jeden religiösen Glaubens zur Folge. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass einige religiöse Denker 49 die evidentialistische Auffassung, welche die Vernunft zur Basis des Glaubens macht, insgesamt zurückweisen, und den Glauben als eine Einstellung beschreiben, deren Sinn verfehlt wird, sobald man sie unter dem Gesichtspunkt der rationalen Akzeptierbarkeit diskutiert. Diese dem Evidentialismus entgegengesetzte Position heißt Fideismus. b) Fideismus Fideismus ist eher eine Familie von Auffassungen über das Verhältnis von Glauben und Vernunft, denn eine vollkommen einheitliche Sicht. Trotzdem lässt sich bei allen Unterschieden zwischen fideistischen Denkern ein minimaler gemeinsamer Kern ausmachen. Sehr allgemein gesprochen könnten wir Fideismus als die Auffassung definieren, dass der Glauben – der religiöse Glaube – nicht Gegenstand einer glaubensunabhängigen rationalen Bewertung ist. Religiöser Glaube, heißt das, unterliegt in fideistischer Sichtweise nicht den Kriterien oder Standards der Bewertung, denen unsere sonstigen Überzeugungen – seien es Alltagsüberzeugungen oder wissenschaftliche Überzeugungen – unterliegen. Das ganze Locke’sche Programm, die Vernünftigkeit des christlichen Glaubens aufzuweisen, hält der Fideist daher für verfehlt, weil darin Standards der Akzeptanz angelegt werden, denen der Glauben nicht unterliegt – und zwar deshalb nicht unterliegt, weil er ihnen nicht unterliegen kann. Der Fideist will also nicht behaupten, dass gewöhnliche epistemische Bewertungskriterien auf den Glauben nicht angewendet werden, sondern dass sie auf den Glauben nicht angewandt werden können. Die Antwort auf die Frage, warum das in fideistischer Sicht so ist, bringt uns zum zweiten Teil der fideistischen Auffassung. Der erste Teil der Antwort ist, dass der Glaube keine Basis oder Stütze in glaubensunabhängigen Überzeugungen hat; der zweite Teil der Antwort ist, dass er einer solchen Basis oder Stütze auch nicht bedarf; der dritte Teil der Antwort ist, dass sich die Unabgeleitetheit des Glaubens nicht dem Umstand verdankt, dass der Glaube selbstevidente Propositionen zum Gegenstand hat. Der Glaube an Gott hat also weder den Status einer abgeleiteten Überzeugung, noch den Status einer selbstevidenten Überzeugung, welche zu den Basispropositionen eines rational geordneten Systems von Überzeugungen gehört. Der Glaube hängt also in fideistischer Sicht weder von anderen glaubensunabhängigen Überzeugungen ab, noch spielt er im System der Überzeugungen einer Person irgendeine Rolle, die mit der Rolle nicht-religiöser Überzeugungen vergleichbar wäre. Mit einem Wort: Religiöser Glaube ist sui generis – eine Einstellung eigener Art. Die Auffassung, religiöser Glaube sei eine Einstellung sui generis, die weder mit unserem gängigen epistemischen Vokabular beschrieben, noch an den gängigen Standards rationaler Akzeptierbarkeit gemessen werden kann, ist, wie wir schon gesehen hatten, auch die 50 Auffassung Wittgensteins gewesen. Einige Autoren haben Wittgensteins Auffassung deshalb auch als „Fideismus“ bezeichnet und von einem Wittgensteinianischen Fideismus gesprochen. Das hat durchaus seine Berechtigung; ich möchte aber die Wittgenstein’sche Form eines Fideismus hier nicht betrachten. Wittgensteins Position ergab sich, wie wir gesehen hatten, aus einer nicht-kognitivistischen Deutung der religiösen Rede. Der Fideismus, den ich hier besprechen möchte ergibt sich aber nicht auf Grund einer solchen semantischen Deutung – oder Umdeutung. Es handelt sich vielmehr um eine Auffassung, die daran festhält, dass mit dem Glauben ein Wahrheitsanspruch verbunden ist, die aber zugleich behauptet, dass der Wahrheitsanspruch des Gläubigen nicht von der Art eines gewöhnlichen Für-wahr-Haltens ist. Der Unterschied zu Wittgenstein lässt sich sehr schön an einer Stelle aus der Abschließenden unwissenschaftlichen Nachschrift zu den Philosophischen Brocken (kurz: Unwissenschaftliche Nachschrift) des dänischen Philosophen Sören Kierkegaard ablesen. Kierkeegard schreibt dort: Objektiv lässt sich wohl danach fragen, was Christentum sei, wenn der Fragende dies objektiv vor sich hinstellen und es bis auf weiteres dahingestellt sein lassen will, ob es Wahrheit ist oder nicht [...]. Der Fragende verbittet sich dann alle Hochehrwürden-Geschäftigkeit, dessen Wahrheit zu beweisen [...] er wünscht Ruhe, wünscht weder Empfehlungen noch Eilfertigkeit, sondern möchte gern zu wissen bekommen, was das Christentum ist. Oder kann man nicht zu wissen bekommen, was Christentum ist, ohne selbst ein Christ zu sein? Alle Analogien scheinen dafür zu sprechen, dass man es zu wissen bekommen kann; aber das Christentum selbst muss ja die als falsche Christen betrachten, die bloß wissen, was Christentum ist. [...] Dass man wissen kann, was Christentum ist, ohne Christ zu sein, muss also wohl bejaht werden. Etwas anderes ist es, ob man wissen kann, was das ist, Christ zu sein, ohne es zu sein, was verneint werden muss. (UN, Bd. 2 S. 75/6) Kierkegaard konzediert hier, dass man in einer distanziert objektiven Weise danach fragen kann, was Christentum ist, und dass diese Frage auch beantwortet werden kann, ohne dass der Fragende dadurch seine anfänglich distanziert objektive Einstellung verlieren würde. Man kann also wissen, was Christentum ist, ohne Christ zu sein. Wittgenstein dagegen vertrat die Auffassung, dass man nicht wissen kann, was Christentum ist, ohne selbst zu glauben. Wittgensteins Sicht war die, dass der Nicht-Gläubige, wenn er so etwas sagte wie „Ich glaube nicht an das Jüngste Gericht“ mit seiner Rede vom Jüngsten Gericht niemals das meint, was der Gläubige meint, wenn er sagt „Ich glaube an das Jüngste Gericht.“ Gerade diese Auffassung teilt Kierkegaard offensichtlich nicht. Aus seiner Sicht kann der Nicht-Gläubige durchaus wissen, was der Gläubige meint, wenn er vom Jüngsten Gericht spricht. Was Kierkegaard nur ausschließt ist, dass der Nicht-Gläubige wissen kann, was das ist, ein Christ zu sein – dass also, auf unseren Fall angewendet, der Nicht-Gläubige wissen könne, was es heißt, an das Jüngste Gericht zu glauben. Das muss daran liegen, dass für Kierkegaard der christliche Glaube sui generis ist. Das betont er in seiner Spätschrift Einübung im 51 Christentum, wenn er sagt, dass der Begriff des Glauben eine ganz eigentümliche christliche Bestimmung sei.1 Wenn nun der Glaube eine Einstellung sui generis ist, das aber nicht an seinen Inhalten liegt – denn diese kann man ja kennen, ohne zu glauben –, dann muss der Glaube als Einstellung betrachtet in irgendeinem Sinne nicht mitteilbar sein, obwohl seine Inhalte es sind. Wie ist das möglich? Oder wie begründet Kierkegaard seine Auffassung von der Eigenart des christlichen Glaubens? Ein Glauben im neutralen Sinne des Für-wahr-Haltens ist immer mitteilbar und zwar auch in dem Sinne, dass man einer anderen Person verständlich machen kann, warum man das und das für wahr hält. Man gibt also, kurz gesagt, Gründe für eine Überzeugung an. Wenn Kierkegaard nun sagt, es sei nicht möglich, dass ein Nicht-Gläubiger wissen könne, was das ist, ein Christ zu sein, dann schließt er damit offenbar aus, ein Nicht-Gläubiger könne die Einstellung des Gläubigen nachvollziehen, indem man ihm Gründe für den Glauben angibt. Und das wiederum macht nur Sinn, wenn man unterstellt, dass es solche Gründe nicht gebe und auch nicht geben kann. Daher müssen wir Kierkegaard so verstehen, dass der Glaube grundlos ist ohne dass dies als ein Einwand gegen den Glauben aufgefasst werden darf. Es scheint für ihn vielmehr zur Natur des Glaubens zu gehören, grundlos zu sein – grundlos in dem Sinne, dass der Glaube nicht als Endpunkt eines Meinungsbildungsprozesses aufgefasst werden kann, bei dem wir nach Abwägung der Gründe oder der Evidenzen, die für und wider eine Weltsicht sprechen, dieser unsere Zustimmung erteilen. Trotzdem müssen wir Kierkegaard wie dem Fideismus, den wir hier betrachten, im allgemeinen die Auffassung zuschreiben, dass mit dem Glauben ein Wahrheitsanspruch verbunden ist. Es muss sich deshalb auch um ein Für-wahr-Halten handeln. Der für den Fideisten springende Punkt ist aber der, dass der Glaube nicht nur ein Für-wahr-Halten ist, und dass das Für-wahr-Halten ein Aspekt des Glaubens ist, der nicht isoliert betrachtet werden kann. Glauben an Gott, wird etwa hervorgehoben, müssen wir eher und jedenfalls immer auch als eine personale Einstellung des Vertrauens verstehen; und so verstanden lässt sich der Glaube an Gott nicht identifizieren mit der Zustimmung zu der Existenzaussage „Gott existiert“. Natürlich werden wir sagen müssen, dass der Glaube an Gott, verstanden als ein Vertrauen in Gott, nicht mit einer Zurückweisung der Aussage, dass Gott existiert, oder auch nur mit einer Enthaltung der Zustimmung zu dieser Aussage verbunden sein kann: „Ich vertraue auf Gott, Gott existiert allerdings nicht“ wie auch das etwas schwächere „Ich vertraue auf Gott, ob Gott existiert ist für mich aber nicht ausgemacht“ sind entweder Ausdruck von Schizophrenie oder von Selbsttäuschung. Der Fideist wird aber sagen, dass die Zustimmung zu dieser Existenzaussage 1 Einübung, S. 109. 52 weder die Basis oder Voraussetzung des Glaubens an Gott ist, noch von diesem Glauben, als einem Vertrauen verstanden, sinnvoll isoliert und für sich betrachtet werden kann. So wird es der Fideist insbesondere entschieden zurückweisen, dass Vertrauen in Gott als eine Einstellung zu betrachten, die nur in Proportion zum berechtigten Grad der Zustimmung zu der Aussage „Gott existiert“ als berechtigt gelten kann. Denn Vertrauen in Gott ist eine Allesoder-Nichts-Angelegenheit, man kann nicht ein bisschen oder in dem und dem Ausmaß Vertrauen in Gott haben. Und da nun das Für-wahr-Halten von „Gott existiert“ ein nicht-isolierbarer oder unselbständiger Aspekt des Glaubens eines Gläubigen ist, ist diese Zustimmung, sofern jemand glaubt, vorbehaltlos und vollständig. Sobald die Zustimmung nicht vorbehaltlos ist und lediglich in Proportion zur Stärke irgendwelcher Evidenzen erfolgt, ist man nicht wirklich im Zustand des Glaubens, selbst wenn man sagen würde: alles spricht dafür, dass ein Gott existiert. Dass der Glaube eine Alles-oder-Nichts Angelegenheit ist, drückt Kierkegaard an einer Stelle der Unwissenschaftlichen Nachschrift besonders pointiert aus: Es ist viel Wunderliches, viel Beklagenswertes, viel Empörendes vom Christentum gesagt worden; aber das dümmste, was man jemals gesagt hat, ist, dass es bis zu einem gewissen Grade wahr sei. Es ist viel Wunderliches, viel Beklagenswertes, viel Empörendes von der Begeisterung gesagt worden; aber das dümmste, was man von ihr gesagt hat, ist, dass es sie bis zu einem gewissen Grade gebe. Es ist viel Wunderliches, viel Beklagenswertes, viel Empörendes über die Liebe gesagt worden; aber das dümmste, was man von ihr gesagt hat, ist, dass es sie bis zu einem gewissen Grade gebe. (UN, Bd. 1, S. 220) Diese Art der Zustimmung, dass das Christentum zu einem gewissen Grade wahr sei, ist in Kierkegaards Sicht gerade nicht die Haltung des Christen, des Gläubigen. Es ist eine halbherzige Zustimmung, die außerhalb des Vertrauens steht, die daher nicht wirklich bestätigt und mit der man sich mit dem Gläubigen nicht ins Einvernehmen setzt. Der Unterschied zwischen dem Glauben und einer graduellen Zustimmung ist nach dieser Auffassung ebenso groß wie der Unterschied zwischen dem Glauben und der Ablehnung des Christentums. Das bedeutet vor allem, dass es aus Kierkegaards Sicht nicht so etwas wie eine stufenweise Annäherung an den Glauben gibt: Der Existierende, der den objektiven Weg wählt, betritt nun den ganzen Weg der approximierenden Betrachtung, die Gott objektiv hervorbringen will, was in alle Ewigkeit nicht erreicht werden kann, weil Gott Subjekt ist und daher nur für die Subjektivität in Innerlichkeit da ist. Der Existierende, der den subjektiven Weg wählt, erfasst in demselben Augenblick die ganze dialektische Schwierigkeit, die darin liegt, dass er einige Zeit, vielleicht lange Zeit, gebrauchen wird, um Gott objektiv zu finden; er erfasst diese dialektische Schwierigkeit in ihrem ganzen Schmerze, weil er Gott ja in demselben Augenblick gebrauchen soll und weil jeder Augenblick, in dem er Gott nicht hat, vergeudet ist. In demselben Augenblick hat er Gott nicht kraft einer objektiven Betrachtung, sondern kraft der unendlichen Leidenschaft der Innerlichkeit [...] An diesem dialektisch so schwierigen Punkt geschieht es, dass der Weg für den abbiegt, der weiß, was dialektisieren und existierend dialektisierend heißt, was nämlich 53 etwas anderes ist, als wie ein phantastisches Wesen am Schreibtisch sitzen und schreiben, und zwar über etwas, was man selbst niemals ausgeführt hat [...] hier biegt der Weg ab, und die Veränderung besteht darin, dass, während das objektive Wissen gemächlich auf dem langen Weg der Approximation vorgeht, selbst nicht getrieben durch Leidenschaft, für das subjektive Wissen jeder Aufenthalt lebensgefährlich ist und die Entscheidung so unendlich wichtig, dass er sofort eine solche Nötigung ausübt, als wäre die Gelegenheit schon ungenutzt vorübergegangen. (UN Bd. 1, S. 191) Kierkegaard kontrastiert hier eine objektive und eine subjektive Einstellung zur Frage des Glaubens. Die objektive Betrachtung – wir können hier einfach an den Versuch einer rationalen Rechtfertigung der Glaubensinhalte des Christentums denken – beschreibt er als einen approximierenden Weg, als einen Versucht also, sich der Wahrheit des Glaubens anzunähern. Das für Kierkegaard Entscheidende ist aber, dass eine solche Approximation niemals zum Glauben führen kann. Und daher ist der objektive Weg vollkommen irrelevant für den Existierenden. Die objektive Betrachtung blendet den Schmerz, das Verlangen, die Leidenschaft des existierenden Subjekts aus, damit aber das, was Kierkegaard das existierende Dialektisieren nennt. Kierkegaard meint damit, dass jedem, dem es um den Glauben geht, sich in der Situation findet, dass der Glauben oder das Glauben-Können etwas für seine Existenz unbedingt Wichtiges derart ist, dass jeder Aufschub für ihn ein Verlust ist, dass die objektive Betrachtung, durch die der Glaube als vernünftig erwiesen werden könnte, aber nichts als ein solcher beständiger Aufschub ist. Diese Situation kommt in der objektiven Betrachtung gar nicht vor; sie wird abgeblendet. Für das Subjekt, das seine eigene Existenz nicht neutralisiert und überspielt, stellt sich die Frage, was es für es selbst bedeutet, den Weg der objektiven Betrachtung zu gehen. Der Weg der objektiven Betrachtung verliert damit aber seine Selbstverständlichkeit und wird für das existierende Subjekt zum Gegenstand einer Wahl. Und Kierkegaard betont sogleich, dass der Weg für das seine Existenz nicht abblendende Subjekt von der objektiven Betrachtung abbiegen muss: Für das existierende Subjekt ist die objektive Betrachtung kein gangbarer Weg, da man sich in der objektiven Betrachtung gerade nicht Gott selbst zuwendet – Gott nicht hat, wie Kierkegaard sagt –, sondern immer nur dabei bleibt, über die Wahrheit des Glaubens nachzudenken. Der Glaube ist daher für Kierkegaard wesentlich eine Entscheidung und zwar eine existentielle Entscheidung, die den Einsatz der ganzen Existenz verlangt. Und es ist auch in dem Sinne eine existentielle Entscheidung, als sie durch die objektive Betrachtung – durch den Versuch, die Vernünftigkeit des Glaubens zu erweisen – nicht (und auch nicht näherungsweise) vorbereitet werden kann: denn der Weg biegt offenbar an jeder beliebigen Stelle ab, da die objektive Betrachtung die Situation des Existierenden, den wesentlichen Konflikt des Menschen, unmöglich auflösen kann. Es gibt daher für Kierkegaard keinen Punkt, an dem man ohne Einsatz der eigenen Existenz zum 54 Glauben kommen kann. Der Glaube ist immer Entscheidung – und als unvorbereitete Entscheidung so etwas wie ein Sprung. Entsprechend ist die Gewissheit des Glaubens oder des Gläubigen für Kierkegaard wesentlich subjektiv. Objektiv gewiss kann der Glaube niemals sein, ja es gehört für Kierkegaard zum Wesen des Glaubens objektiv ungewiss zu sein, und der wirklich Gläubige glaubt an Gott gerade im Bewusstsein der objektiven Ungewissheit der Wahrheit seines Glaubens: Ohne Risiko kein Glaube. Glaube ist gerade der Widerspruch zwischen der unendlichen Leidenschaft der Innerlichkeit und der objektiven Ungewissheit. Kann ich Gott objektiv greifen, so glaube ich nicht; aber weil ich das eben nicht kann, deshalb muss ich glauben. Und will ich mich im Glauben erhalten, so muss ich beständig darauf Acht geben, die objektive Ungewissheit festzuhalten, dass ich in der objektiven Ungewissheit [...] bin, und doch glaube. (UN Bd. 1, S. 195). Einen größeren Kontrast zu Lockes Auffassung kann man sich kaum vorstellen. Aus Lockes Sicht ist jede Zustimmung, welche die Evidenzen übersteigt, irrational und aus dunkler Leidenschaft geboren – und eben deshalb zurückzuweisen. Ein Risiko eingehen heißt, sich selbst epistemisch mehr zuzumuten, als man sich zumuten darf. Kierkegaard dagegen behauptet, dass es zum Wesen des Glaubens selbst gehört ein solches Risiko einzugehen und dass es zum Wesen des Glaubens gehört, dass man nur dann wirklich glaubt, wenn man sich der objektiven Ungewissheit seines Glaubens bewusst ist. Dieses Bewusstsein zu haben, heißt aber nichts anderes als das Bewusstsein zu haben, dass die Vernunft keine Autorität in Glaubensdingen hat. Der Glaube ist in Kierkegaards Sicht also in dem Sinne sui generis, dass er übervernünftig ist. Er unterliegt nicht dem Vorwurf der Irrationalität, weil es seine Natur ist, die Beziehung zur Vernunft abgebrochen zu haben. Der Vorwurf der Irrationalität ist also verfehlt, weil er die Natur des Glaubens verkennt. Neben diesem Gedanken findet sich bei Kierkegaard bemerkenswerter Weise aber noch ein anderer Strang der fideistischen Interpretation und Begründung der Besonderheit religiösen Glaubens. Bisher hatten wir das Bild, in dem der Glaube von der Vernunft unabhängig ist und nicht in den Zuständigkeitsbereich der Standards rationaler Bewertung fällt. Kierkegaard zeichnet aber außerdem auch noch das Bild des Gläubigen als einer Person, die aufgrund ihres Glaubens in direkter Opposition zur Vernunft steht. Dieses ganz andere Bild über das Verhältnis von Glauben und Vernunft ergibt sich in Anbetracht nicht des Glaubens als einer besonderen Einstellung, sondern in Anbetracht des Inhalts des christlichen Glaubens. Kierkegaard war der Auffassung, dass der christliche Glaube paradox ist – nicht nur paradox erscheint, sondern wirklich paradox ist und sich jedem Versuch einer Rationalisierung, jedem Versuch der Auflösung des Paradoxes widersetzt. So ist für Kierkegaard insbesondere die Lehre von der Inkarnation, der Fleischwerdung Gottes in Jesus Christus, ein Paradox: „Der 55 Gott-Mensch ist das Paradox, absolut das Paradox; deshalb ist es selbstverständlich, dass der Verstand daran stillstehen muss.“ (EimChr, S. 110). Und dieses Paradox ist ausdrücklich nicht rationalisierbar, der Gott-Mensch oder die Möglichkeit, dass Gott ein Mensch und ein Mensch Gott sein kann, ist nicht begreiflich zu machen: Die Spekulation [Kierkegaard meint hier natürlich Hegel oder den Hegelianismus] hat natürlich gemeint, den Gott-Menschen „begreifen“ zu können – was man gut begreifen kann, indem die Spekulation die Bestimmung der Zeitlichkeit, der Gleichzeitigkeit und der Wirklichkeit vom Gott-Menschen entfernt. [...] Nein, die Situation gehört mit zum Gott-Menschen, diese Situation, dass ein einzelner Mensch, der neben dir steht, der Gott-Mensch ist. Der Gott-Mensch ist nicht die Einheit von Gott und Mensch; eine solche Terminologie ist tiefsinnige Augenverblendung. Der Gott-Mensch ist die Einheit von Gott und einem einzelnen Menschen. (a. a. O. S. 109 f.) Der für Kierkegaard entscheidende Punkt klingt hier in seiner polemischen Spitze gegen die Spekulation an. Die Spekulation, die meint begreiflich machen zu können, wie Gott ein Mensch und ein Mensch Gott sein kann, verfehlt einerseits den christlichen Sinn der Rede von der Inkarnation Gottes, weil der Begriff einer Einheit von Gott und Mensch – selbst wenn dieser kohärent wäre – überhaupt nicht verständlich macht, dass „ein einzelner Mensch, der neben dir steht, der Gott-Mensch ist.“ Die Spekulation – und das ist der wichtigere Punkt – bringt aber andererseits in ihrem Versuch die Inkarnationslehre begreiflich zu machen, das zum Verschwinden, was Kierkegaard das „Ärgernis“ nennt. Zum Glauben, sagt Kierkegaard, komme man nur durch die Möglichkeit des Ärgernisses. Was versteht Kierkegaard unter „Ärgernis“. Ärgernis ist die Reaktion einer Person auf den Anspruch, dass dieser Mensch neben dir, der Gott-Mensch ist: „Das Ärgernis im strengsten Sinn [...] bezieht sich also auf den Gott-Menschen.“ Das Ärgernis tritt dabei in zwei Formen auf: Es bezieht sich entweder auf die Hoheit oder auf die Niedrigkeit. Im ersten Fall wird es zum Ärgernis, „dass ein einzelner Mensch sagt, er sei Gott, und auf eine Weise spricht und handelt, durch die Gott verraten wird“, im zweiten Fall wird es zum Ärgernis, „dass der, welcher Gott ist, dieser geringe Mensch sei, der als ein geringer Mensch leide.“ (a. a. O. S. 110). Im ersten Fall entspringt also das Ärgernis aus dem Anspruch der unvergleichlichen Hoheit des Niedrigen, im zweiten aus dem Anspruch der Niedrigkeit des Höchsten. Der Versuch den Gott-Menschen begreiflich zu machen, kommt dann einer Domestizierung dieses Ärgernisses gleich – das Ärgernis wird einfach zum Verschwinden gebracht. Bringt man aber das Ärgernis oder die Möglichkeit des Ärgernisses zum Verschwinden, „so bedeutet dies, dass auch Christus weggenommen ist, indem er dann zu etwas anderem gemacht worden ist, als was er ist: nämlich das Zeichen des Ärgernisses und der Gegenstand des Glaubens.“ (120) Kierkegaards Gedanke ist also der, dass Christus, der Gott-Mensch, gerade deshalb und nur deshalb Gegenstand des Glaubens ist, weil er im Lichte unserer natürlichen Erkenntnisfähigkeiten 56 betrachtet ein ewiges Ärgernis ist. Dem Glaubenden ist Christus freilich kein Ärgernis, er ist aber nur Glaubender im Bewusstsein, dass Christus den Nicht-Gläubigen ein ewiges Ärgernis ist. Christus ist ein, wenn man so sagen will, logischer Skandal, ein unauflösbares Paradox und eben deshalb Gegenstand des Glaubens. Der Glaube selbst ist damit in doppelter Weise paradox: Sein Gegenstand oder Inhalt ist essentiell paradox und er selbst als Einstellung ist ebenfalls paradox: nämlich eine Anerkennung des paradoxen Inhalts im Bewusstsein davon, dass er paradox ist – im Bewusstsein davon, dass es nicht nur keine adäquate Evidenz für die Wahrheit der Inkarnation gibt, sondern im Bewusstsein davon, dass der Begriff der Inkarnation in sich selbst widersprüchlich ist. Das ist nun Fideismus in seiner radikalsten Form. Der Glaube wird hier so präsentiert, dass er nicht nur in dem Sinne von der Vernunft unabhängig ist, als er nicht in den Kompetenzbereich rationaler Bewertung fällt, sondern so, dass er der Vernunft entgegensteht – und zwar seinem Wesen nach der Vernunft entgegensteht. Das bedeutet, dass der Glaube nicht nur in dem Sinne grundlos ist, dass er keiner Gründe bedarf um anerkannt werden zu können, sondern dass wo immer Gründe für eine Einstellung gegeben werden können, diese Einstellung nicht als Glaube gelten kann. Könnte der Glaube rationalisiert werden, würde er damit zerstört. Wem also am Glauben gelegen ist, für den darf es auch keine Rationalisierung seiner Einstellung geben. Eine radikalere Auffassung vom religiösen Glauben lässt sich schwerlich denken. c) Zur Beurteilung von Fideismus und Evidentialismus Obwohl es noch weitere Spielarten des Evidentialismus und insbesondere des Fideismus gibt, können wir Lockes und Kierkegaards Auffassungen durchaus als repräsentativ ansehen, insofern sie die Geist dieser beiden Positionen deutlich zum Ausdruck bringen. Konfrontieren wir diese beiden Positionen direkt miteinander, so zeigt sich zunächst einmal eine besondere dialektische Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Fideist gerade die Maßstäbe der Bewertung des Glaubens zurückweist, die aus der Sicht des Evidentialisten notwendig sind, um überhaupt sinnvoll von der Akzeptierbarkeit des Glaubens sprechen zu können. Das Besondere an dieser Situation liegt also nicht darin, dass der Evidentialist den Glauben zurückweisen würde, während der Fideist ihn als anerkennungswürdig einstuft. Das Besondere der Situation liegt darin, dass der Fideist die Zuständigkeit der Vernunft bestreitet. Locke, hatten wir gesehen, war der Auffassung, dass Glaubensfragen erst dann mit Gewinn 57 diskutiert werden können, wenn man zuvor die Grenzen von Glauben und Vernunft genau festlegt. Es ging ihm darum, einen Rahmen oder ein Verfahren zur Beurteilung religiöser Ansprüche zu erstellen, so dass ohne Parteinahme entschieden werden kann, ob religiöse Wahrheitsansprüche zurecht bestehen und welche religiösen Ansprüche zurecht bestehen. Die Vernunft betrachtete er dabei als ein inhaltlichen Ansprüchen – das heißt: besonderen Meinungen – gegenüber neutrales Verfahren der Meinungsfestlegung. Welchen Meinungen zuzustimmen ist und in welchem Maße ihnen zuzustimmen ist, wird auf der Basis dieses epistemisch legitimierenden Verfahrens entschieden. Wenn der Fideist nun die Zuständigkeit der Vernunft in Glaubensdingen bestreitet, bestreitet er damit nichts anderes als eben die epistemisch legitimierende Kraft eines an Evidenzen orientierten Verfahrens der Meinungsfestlegung. Im Bild des Gerichtshofes gesprochen, lehnt es der Fideist als eine unberechtigte Forderung des Richters ab, der Gläubige müsse, um Recht zu bekommen und seinen Glauben behalten zu dürfen, Evidenzen für seinen Glauben geltend machen, über deren Beweiskraft das Gericht dann entscheiden kann. Als Anwalt des Gläubigen macht er also gegen den die Evidenzlage verhandelnden Gerichtshof geltend, dass dieser, wenn er über den Glauben urteilen will, seine Befugnisse überschreitet. Der Fideist tritt damit gar nicht als eine Partei in Glaubensfragen auf, deren Streitigkeiten Locke hoffte durch eine vorgängige Festlegung der Grenzen von Glauben und Vernunft ein für allemal schlichten zu können. Er ist, aus der Perspektive des Evidentialisten gesehen, vielmehr ein Radikaler, der die für streitende Parteien gleichermaßen gültigen Gesetze – hier also die in Meinungskonflikten gleichermaßen gültigen Maßstäbe der epistemischen Beurteilung – für den Fall des religiösen Glaubens nicht anerkennt. Die Situation ist also äußerst brisant. Wie soll man hier entscheiden? Zunächst müssen wir dazu einige wichtige Vorfragen klären. Als erstes ist zu fragen, ob Evidentialismus und Fideismus nicht nur miteinander inkompatibel sind, was zweifellos der Fall ist, sondern auch kontradiktorisch. Im letzteren Falle wäre eine der beiden Positionen auf jeden Fall richtig, so dass die Zurückweisung der einen die Akzeptanz der anderen mit sich bringt. Nun ist es sicherlich so, dass Fideismus und Evidentialismus in einigen Punkten durchaus kontradiktorisch sind, wie etwa in Bezug auf die grundlegende Frage, ob es vom Glauben selbst unabhängiger Gründe bedarf, damit dieser akzeptiert werden kann. Das reicht aber keineswegs aus, um Evidentialismus und Fideismus als ein vollständig disjunktes Alternativenpaar zu beschreiben. Und aufgrund der vielen Fragen, die sich stellen und die beantwortet sein müssen, um eine in jeder Hinsicht bestimmte Position über das Verhältnis von Glauben und Vernunft zu haben, ist zu erwarten, dass an mehreren Stellen ein Spielraum für Alternativen besteht, welche weder mit der Locke’schen, 58 noch mit der Kierkegaard’schen Position deckungsgleich sind. Später werden wir eine solche Position noch kennen lernen. Eine zweiter Punkt, den man klären muss ist der, ob der Fideismus selbstwiderlegend ist. Auf diesen Gedanken kann man relativ schnell und ohne große Umwege kommen. Der Fideist argumentiert dafür, dass es keiner den Glauben stützenden Argumente bedarf, damit dieser anerkennungswürdig sei. Und liegt darin – dafür argumentieren, dass Argumente keine den Glauben stützende Funktion haben – nicht eine Paradoxie? Nimmt der Fideist durch sein eigenes Argument nicht etwas in Anspruch, was er selbst verwirft? Die Antwort ist aber klarerweise: Nein das ist nicht der Fall – Fideismus ist nicht selbstwiderlegend. Fideismus wäre in der Tat selbstwiderlegend, wenn er die Gründe, die er dafür anführt, dass der Glaube grundlos ist und keiner ihn stützenden Gründe bedarf, als solche Gründe präsentieren würde, die für den Glauben sprechen. In diesem Fall würde er ja seine Gründe dafür, dass es keine Evidenzen für den Glauben gibt, als Evidenz für den Glauben präsentieren – und das wäre eine offenkundig selbstwiderlegende Auffassung. Nun hatten wir aber gesehen, dass der Grund, den der Fideist dafür anführt, dass der Glaube weder Gründe für sich hat, noch solcher Gründe bedarf, der ist, dass der religiöse Glaube sui generis ist. Dass religiöser Glaube sui generis ist, ist aber natürlich kein Grund, der für den religiösen Glauben spricht, kein Grund heißt das, der für die Wahrheit (und gegen die Falschheit) des Glaubens spricht. Das heißt aber, dass dieser Grund keine Evidenz für den Glauben ist und vom Fideisten auch nicht in diesem Sinne angeführt wird. Und deshalb ist der fideistische Versuch einer Begründung der Grundlosigkeit des Glaubens in keiner Weise selbstwiderlegend. Er ist nicht einmal in einem schwachen alltäglichen Sinne paradox – so wenig paradox wie etwa der Versuch paradox wäre, Gründe dafür zu geben, dass sexuelle Attraktivität grundlos ist. Wenn nun der Fideismus nicht selbstwiderlegend ist, stellt sich als eine daran anschließende dritte Frage, wie man mit dem Fideisten denn überhaupt noch argumentieren kann. Nach fideistischer Auffassung ist der Glaube dem rationalen Diskurs ja entzogen – es ist seine Natur oder sein Wesen, von Argumenten nicht abhängig zu sein. Wie aber soll man mit jemandem noch diskutieren können, der sich der Grundlage und dem Sinn jeder Diskussion entzieht, indem er die Grundlosigkeit seines Glaubens konzediert ohne darin irgendeinen Mangel zu sehen? An dieser Stelle wird eine kleine, aber feine Unterscheidung wichtig: die Unterscheidung zwischen dem Fideismus als einer bestimmten Interpretation des Glaubens und dem religiösen Glauben selbst als dem Gegenstand dieser Interpretation. Dramatisch verkörpert entspricht dem die Unterscheidung zwischen dem Fideisten (als dem Interpreten und Anwalt des Gläubigen) und dem Gläubigen selbst. Beachten wir diese Unterscheidung, 59 wird das Problem der Diskutierbarkeit entschärft oder es verschwindet sogar. Denn jetzt wird klar, dass man, wenn gläubig zu sein im fideistischen Sinne verstanden werden muss, zwar nicht sinnvoll mit dem Gläubigen diskutieren kann, dass man aber nichtsdestotrotz mit dem Fideisten sinnvoll diskutieren kann. Wenn der Fideist recht hat, dann ist jedes Argumentieren mit dem Gläubigen nicht nur verlorene Liebesmüh, sondern ein hoffnungslos irreführendes Unterfangen. Aber das ist eben nur dann der Fall, wenn der Fideist recht hat. Ob der Fideist recht hat, steht aber zur Debatte. Selbst wenn der religiöse Glauben wirklich im Sinne des Fideisten sui generis wäre, wäre darum noch lange nicht der Fideismus selbst eine Einstellung sui generis. Fideismus ist daher ebenso wenig selbstbestätigend, wie er selbstwiderlegend ist. Obwohl der Fideismus wirklich eine radikale Position ist, indem er die Zuständigkeit rationaler Meinungsbildungsverfahren in Fragen religiösen Glaubens ablehnt, unterliegt er selbst den Maßstäben rationaler Meinungsbildung oder -festlegung – worin auch immer genau diese Maßstäbe bestehen mögen. Mit diesem Punkt wird übrigens nicht Partei für einen Evidentialismus im Stile Lockes ergriffen. Und zwar nicht nur deshalb, weil die Behauptung, auch der Fideismus unterliege Maßstäben rationaler Bewertung von Meinungen, offen lässt, ob Lockes Kriterien oder Maximen richtig sind. Sondern auch deshalb, weil die Behauptung, der Fideismus unterliege den Maßstäben rationaler Meinungsfestlegung mit dem Fideismus selbst ja gar nicht in Konflikt steht. Nach diesen wichtigen Vorbereitungen können wir jetzt Fideismus und Evidentialismus etwas näher betrachten und diskutieren. Zunächst möchte ich mich mit dem Fideismus beschäftigen. Die Motivationen fideistischer Denker sind sicherlich nicht vollkommen gleichartig. Ein Anliegen, das sie alle – oder zumindest die Fideisten des 19. und 20. Jahrhunderts – verbindet, ist aber sicherlich folgendes: Sie wollten die Besonderheit des religiösen Glaubens betonen, weil sie unter dem Eindruck standen, dass eine ausschließlich von unseren natürlichen rationalen Kapazitäten ausgehende Philosophie eine Beschreibung des religiösen Glaubens enthält, in der sich der Gläubige selbst gar nicht wiederfinden kann. Die Betonung der Besonderheit oder Eigenart des religiösen Glaubens sollte dabei der vorschnellen Assimilation des Glaubens an die distanziert objektive Haltung der Zustimmung zu einer Aussagenmenge vorbeugen. An Gott zu glauben, und darin gebe ich dem Fideisten vollkommen recht, ist nicht das gleiche wie eine kosmologische Vermutung anstellen, eine Hypothese erproben, oder der metaphysischen Theorie zuzustimmen, dass die Realität sich nicht in der Realität des natürlichen Universums erschöpft. Dieser Angleichung steht vor allem der existentielle Ernst entgegen, der mit dem Glauben verbunden ist. Daher betonen Fideisten, dass der Glaube wesentlich ein personale Bindung ist oder als eine personale Bindung erlebt wird. 60 Eine weiterer Punkt, den Kierkegaard durch die Betonung des paradoxalen Charakters des Glaubens herausheben wollte, war der, dass es einer im weitesten Sinne rationalistischen Betrachtung des Glaubens mit dem Glauben niemals wirklich ernst sein kann, weil der rationalistisch gesonnene Mensch sich niemals vorbehaltlos und ganz an den Glauben bzw. an das bindet, woran der Gläubige sich bindet. Der rationalistisch Gesonnenen bindet sich an die Vernunft als einer letzten Autorität und muss daher immer in Distanz zum Glauben stehen. Kierkegaards Hervorhebung des absolut paradoxen Charakters der christlichen Lehre von der Inkarnation Gottes in Jesus Christus war dabei vor allem gegen den Anspruch Hegels gerichtet, den Gott-Menschen begreifen zu können. Sie hat aber auch einen theologiegeschichtlich interessanten Hintergrund und kann als eine Absage an den im 19. Jahrhundert verbreiteten liberalen Protestantismus gelesen werden, den dann auch die sogenannte protestantische Neo-Orthodoxie des 20. Jahrhunderts vehement zurückgewiesen hat. Eine typische Äußerung des liberalen Protestantismus ist die von Theodor Munger, der 1883 schrieb: „Wenn das Christentum irgendeine menschliche Grundlage hat, dann ist es seine völlige Vernünftigkeit. Es muss für den Intellekt nicht nur leicht annehmbar sein, sondern muss sich mit ihm bei all seinen normalen Handlungen verbünden.“2 Hier ist sowohl die Betonung der Vernünftigkeit, als auch die der menschlichen Grundlage des Christentums kennzeichnend. In der Betonung der Vernünftigkeit wie auch der menschlichen Grundlage, der Grundlage in der menschlichen Vernunft, hallt deutlich die Kantische Philosophie nach, die das Wesen der Religion in der Moral erblickt zu haben meinte. So lesen wir etwa bei einem anderen liberalen Protestanten, dem amerikanischen Theologen Theodor Parker: „Christentum ist ein einfache Sache, sehr einfach. Es ist absolute, reine Moralität [...] All das ist sehr einfach – ein kleines Kind kann es verstehen.“3 Befeuert von sozialreformerische Bestrebungen und in der Hoffnung auf eine kulturelle Erneuerung inmitten der industriellen Revolution, suchten die liberalen Protestanten im historischen Jesus einen Verbündeten. Das war der Beginn einer überaus emsigen historischen Jesusforschung (der Leben-Jesu-Forschung), die sozusagen beauftragt war, das Christentum der liberalen Protestanten zu stützen. Das Jesus-Bild, das die Liberalen dann gezeichnet haben, war ein entzaubertes, vollkommen säkularisiertes Bild. Jesus wurde zu einem reinen Morallehrer, einem überragend guten Menschen, der die Bruderschaft der Menschen lehrte, ohne irgendwelche übernatürlichen Behauptungen aufzustellen. Insbesondere die eschatologische Dimension, die Vorstellung vom Wirken Gottes in der Person, im Wort und im Handeln von Jesus, sowie die apokalytische Vision eines neuen Zeitalters, wurden als legendenhafte Ornamente, als mythologische 2 3 Zitiert nach: W. W. Barteley III, Flucht ins Engagement, S. 16. Zitiert nach a. a. O. S. 18. 61 Ausschmückungen der reinen Morallehre aus dem Zentrum des Christentums eliminiert. In theologischen Worten wurde so eine Opposition zwischen Jesus und Christus aufgebaut – zwischen dem historischen Jesus und dem Jesus der kirchlichen Verkündigung. Das angeblich historisch gesicherte Bild des liberalen Protestantismus ist freilich später auf der Basis bibelkritischer Untersuchungen selbst zusammengebrochen. Aber das sollte alles nur im Vorbeigehen gesagt sein, um zu verdeutlichen, warum Kierkegaard so sehr auf dem paradoxalen Charakter des Glaubens beharrt. Er sah die Substanz des christlichen Glaubens bedroht, sobald der Glaube nur noch im säkularen Blick des Moralisten, des Historikers oder des Psychologen betrachtet wird. Dadurch wird sein Fideismus freilich nicht gerechtfertigt. Die dahinter stehende Motivation und sein Gespür für die Gefährdung des Glaubens ist jedoch vollkommen nachvollziehbar. Die liberale protestantische Theologie ist der Versuch den Glauben durch eine Umdeutung – durch eine Entkleidung des Glaubens von seinem dogmatischen Gehalt – in einer säkularen Welt zu retten. Aber Kierkegaard hatte hier das richtige Gespür, dass dieser Rettungsversuch den Untergang des Glaubens einleitet und eigentlich nichts als die Strategie des Verlierers ist, seine Niederlage vor sich selbst und den anderen zu verbergen: Den Glauben so umzudeuten, dass er bequem – ohne dass sie ihre Ansichten in einer tiefen Weise verändern müssten – auch von den Nicht-Gläubigen angenommen werden kann, heißt den Glauben zu trivialisieren und damit aufzugeben. Wenn wir zugestehen, dass religiöser Glaube durchaus seine Besonderheiten hat, geben wir damit aber nicht dem Fideisten recht. Wir hatten gesehen, dass es bei Kierkegaard mindestens zwei Stränge einer Begründung des Fideismus und damit auch zwei Formen des Fideismus gibt. Betrachten wir zunächst die radikale Version. Dieser Version zufolge ist der Glaube von der Vernunft nicht nur unabhängig, weil er keiner Gründe bedarf, um angenommen werden zu können. Der Glauben steht vielmehr im Gegensatz zur Vernunft, so dass er, wenn es unabhängige Gründe für ihn gäbe, dadurch zerstört würde. Kierkegaard hat in seiner Betonung des paradoxalen Charakters des Glaubens jedoch etwas ganz Entscheidendes übersehen. Nehmen wir einmal an, der Glaube würde keiner Stützung durch Evidenzen bedürfen. Wir sind dann im Recht an die Wahrheit einer Religion zu glauben, ohne Gründe für deren Wahrheit zu haben. Aber das impliziert nicht, dass wir immer noch im Recht wären zu glauben, wenn es Evidenzen gibt, die gegen den Glauben sprechen. Die Situation ist sogar noch unvorteilhafter für den Fideisten. Es gilt nämlich auch folgendes: Wenn es Beweise für die Falschheit des Glaubens gibt, dann kann man nicht epistemisch im Recht sein, an dessen Wahrheit zu glauben. Einige Atheisten – ich meine hier philosophisch raffinierte und gebildete Atheisten – glauben über Argumente zu verfügen, welche die Falschheit des theistischen Glaubens zur 62 Konsequenz haben. Angesichts solcher Argumente reicht es offenbar nicht aus, zu behaupten, der Glaube brauche keiner Gründe. Das reicht nicht aus, solange daran festgehalten wird, dass der Glaube echte Wahrheitsansprüche erhebt. Aber das ist unsere Diskussionsbasis des Fideismus. Das besagt nun aber, dass zumindest negative Apologie für den Glauben vonnöten ist, wenn er als glaubwürdig eingestuft werden soll. Kierkegaards radikaler Begründungsstrang für seinen Fideismus und seine radikale Version des Fideismus müssen daher zurückgewiesen werden. Denn wenn der Begriff der Menschwerdung Gottes oder die Vorstellung des Gott-Menschen, wie Kierkegaard behauptet, wirklich paradox, also wirklich inkonsistent wäre, dann hieße an Jesus Christus als einer Verkörperung Gottes glauben, definitiv etwas Falsches glauben – etwas glauben, was notwendig falsch ist. Eine notwendige Falschheit ist aber sicherlich nicht glaubwürdig. Der Glaube bedarf also wenigsten negativer Apologie – einer argumentativen Verteidigung seiner Glaubwürdigkeit angesichts von seriösen Einwänden, die gegen seine Wahrheit sprechen. Daher kann keine Rede davon sein, dass der Glaube Maßstäben rationaler Bewertung überhaupt nicht unterliegt. Denn ein Prinzip rationaler Bewertung ist sicherlich, dass ein nachweislich falscher Glaube aufgegeben oder nicht angenommen werden soll. Vielleicht, könnte man einwenden, trifft das Kierkegaards Auffassung nicht, insofern er den Sprung in den Glauben ja als eine Entscheidung für den Glauben und gegen die Vernunft interpretiert. Der Glaubende bricht sozusagen die Brücken der Vernunft hinter sich ab – und das ermöglicht, dass er etwas glauben kann, was nach den Maßstäben rationaler Bewertung nicht angenommen werden kann. Aber das Bild des Brücken-Abbrechens hilft nicht wirklich weiter. Es kann sein, dass eine Person eine inkonsistente Doktrin akzeptiert, ohne zu realisieren, dass sie inkonsistent ist. Inkonsistenzen liegen schließlich nicht immer offen zu Tage, und es ist zu vermuten, dass viele von uns Überzeugungen haben, von denen einige nicht miteinander konsistent sind. Anders sieht die Sache aber aus, wenn eine Person sich des paradoxen Charakters einer ihrer Überzeugungen bewusst ist. Sich des paradoxen Charakters bewusst zu sein, heißt sich bewusst zu sein, dass die betreffende Überzeugung falsch ist. Kierkegaard verlangt nun, dass Gläubigkeit in einer vorbehaltlosen Bindung im Bewusstsein des paradoxalen Charakters ihres Inhalts besteht. Er verlangt also die vorbehaltlose Bindung bei gleichzeitigem Bewusstsein der Falschheit. Und er beschreibt die Situation weiter so, dass, sobald wir uns für den Glauben entscheiden haben, sobald wir also den Sprung gewagt hat, dass dann diese zweite Paradoxie: an das absolute Paradox im Bewusstsein seiner Widersprüchlichkeit zu glauben, harmlos und aufgelöst wird. Die Paradoxie steht sozusagen nur dem Sprung im Wege, solange wir also an die Vernunft gebunden sind; ist der Sprung aber 63 einmal getan, verschwindet dieses Hindernis, das Paradox ist für den Gläubigen gelöst, weil man den Glauben und eben nicht die Vernunft gewählt hat. Aber eben das kann nicht sein, wenn der Glaube vom Bewusstsein seiner Paradoxie begleitet ist. Das Bewusstsein der Paradoxie oder Falschheit der eigenen tiefsten Überzeugungen muss sich für den Gläubigen als ein innerer Konflikt darstellen. Zu behaupten, dass für den Gläubigen hier kein Konflikt bestünde, eben weil er glaubt, kann nur besagen, dass der Glaube in der Unterdrückung des Bewusstseins der Paradoxie oder in Selbsttäuschung besteht. Der radikale Fideismus führt daher zu einer Interpretation des Glaubens als einem falschen Bewusstsein. Das zeigt nun auch, dass die Beschreibung, dass wir uns entweder an den Glauben oder an die Vernunft binden können, falsch ist. An die Vernunft bindet man sich nicht im Sinn einer grundlosen Entscheidung für eine bestimmte Sicht der Dinge. Denn die Vernunft ist operativ auch im Bewusstsein des Gläubigen, solange er nicht geisteskrank ist oder sich selbst täuscht. Der Gebrauch unserer natürlichen rationalen Kapazitäten ist also nicht eine besondere Gesinnung, die gegen eine andere einfach eingetauscht werden kann. Vor dem Hintergrund des bisher Gesagten können wir nun noch einen Schritt weiter gehen. Wir hatten gesehen, dass radikaler Fideismus nicht aufrecht zu erhalten ist, weil er impliziert, dass religiöser Glaube auch dann noch epistemisch akzeptabel ist, wenn es Evidenzen für seine Falschheit gibt. Wenn nun aber nachweisliche Falschheit den Glauben zerstört – da man ja nicht glauben kann im Bewusstsein der Falschheit des Glaubens –, ist nicht zu sehen, warum Evidenz für die Wahrheit des Glaubens ihn auch zerstören würde. Zunächst einmal ist klar, dass negative Apologie den Glauben nicht zerstört, denn negative Apologie bewahrt den Glauben gerade vor seiner Zurückweisung. Wenn nun aber negative Apologie den Glauben nicht zerstört, warum sollte positive Apologie – der Versuch einer Stützung des Glaubens durch Gründe, die für seine Wahrheit sprechen – den Glauben zerstören? Kierkegaards Auffassung rührt hier von der fehlerhaften Vorstellung, dass eine positive Apologie den Glauben notwendigerweise umdeuten müsste, dass es also keine Apologie für den Glauben geben könnte, so wie er ist. Diese Vorstellung speist sich aus seiner Hegelkritik – und was Hegel betrifft mag Kierkegaard auch recht haben. Unabhängig von diesem Kontext betrachtet ist Kierkegaards Auffassung aber klarerweise fehlerhaft. Denn unter welcher Bedingung muss eine positive Apologie notwendigerweise den Gehalt des Glaubens umdeuten, damit sie funktioniert? In meinen Augen gibt es hier nur zwei Möglichkeiten. Entweder dann, wenn der Glaube wesentlich unverständlich ist – so dass nicht gesagt werden kann, worin die mit ihm verbundenen Wahrheitsansprüche bestehen. Oder dann, wenn der Glaube, so wie er aus der 64 Perspektive des Gläubigen selbst beschrieben werden muss, notwendigerweise falsch ist. Das bedeutet, dass der religiöse Glaube, sofern er nicht essentiell unverständlich oder notwendigerweise falsch ist, durch positive Apologie nicht zerstört werden kann. Und das bedeutet weiterhin, dass der Glaube, wenn er eine Einstellung ist, die durch positive Apologie notwendig zerstört wird, unseriös ist und weder aufrechterhalten werden kann, noch angenommen zu werden verdient. Der radikale Fideismus, der behauptet, dass der Glaube mit der Vernunft wesentlich in Konflikt steht, derart, dass er zerstört würde, wenn er als nach rationalen Maßstäben akzeptabel beurteilt werden könnte, ist also falsch. Wäre religiöser Glaube so etwas, wie der radikale Fideist ihn beschreibt, dann ist man auch in existentieller Dimension gut beraten sich dem Glauben nicht zu verschreiben – denn Glauben wäre dann eine Krankheit des Geistes. Wie steht es mit dem anderen Strang des Fideismus, der sich nicht auf einen angeblich essentiell paradoxalen Charakter des Glaubens beruft und der nicht behauptet, dass der Glaube mit der Vernunft in einem unlösbaren Konflikt steht, sondern nur behauptet, dass der Glaube unabhängig von der Vernunft ist und keiner Stütze in glaubensunabhängigen Gründen bedarf? Die Unabhängigkeit des Glaubens von der Vernunft begründete Kierkegaard damit, dass wir auf dem objektiven Weg oder ausgehend von einer säkularen Einstellung, in der wir nach Gründen für den Glauben suchen, den Glauben niemals erreichen können. Der Kern seiner Auffassung ist also der, dass Argumente nicht zum Glauben führen können und dass das zeigt, dass der Glaube wesentlich grundlos ist. Das ist aber klarerweise und in mehrerer Hinsicht falsch. Betrachten wir dazu zunächst einmal den umgekehrten Fall: nämlich den einer Person, die eine Zeit ihres Lebens gläubig war, und nun nicht mehr glaubt. So schreibt der australische Philosoph Jack Smart: „I was once a theist and I would still like to be a theist if I could reconcile it with my philosophical and scientific views.“ Wir können uns Smart als jemanden vorstellen, der zu einem Atheisten geworden ist, nachdem er sich durch Argumente überzeugt hat, dass ein theistisches Weltbild falsch ist. Es wäre klarerweise absurd zu behaupten, dass so etwas nicht möglich ist, weil man dann niemals wirklich geglaubt hat. Wenn wir diese Möglichkeit zugestehen, dann heißt das aber, dass Argumente eine Rolle für die Aufgabe des Glaubens spielen können. Warum aber sollten sie dann aber nicht auch eine Rolle für die Annahme des Glaubens spielen können? Smart ist ein Materialist, und er beschreibt sich als jemanden, der gerne glauben würde, wenn der Theismus mit seinen philosophischen Auffassungen vereinbar wäre. Wenn dies das einzige Hindernis für Smart ist, und man ihm zeigen würde, dass Theismus und Materialismus miteinander kompatibel sind, könnte Smart dadurch zum Glauben zurückkehren. In diesem Fall würde also ein Argument 65 eine wichtige Rolle für eine Person in der Übernahme des Glaubens bestehen. Insofern ist Kierkegaards Beschreibung der psychologischen Prozesse bei der Übernahme des Glaubens nicht adäquat. Das bedeutet natürlich nicht, dass man durch Argumente für den Glauben, jede Person zwangsläufig zum Glauben bringen könnte. Ohne eine Disposition oder ein Bedürfnis wie Smart zu haben, kann das sicher nicht funktionieren. Der Punkt ist aber, dass Argumente eine Rolle sowohl für die Annahme als auch für die Aufgabe des Glaubens spielen können. Und daher ist Kierkegaards Behauptung, der Glaube sei wesentlich grundlos, weil man niemals aus Gründen glauben kann. Kierkegaards Auffassung ist aber auch noch in einer anderen und sehr wichtigen Hinsicht falsch. Nehmen wir einmal an, dass sein Beschreibung des psychologischen Mechanismus der Glaubensübernahme richtig wäre. Den Glauben zu übernehmen hieße dann: sich ohne Gründe für den Glauben entscheiden. Dass der Glaube in diesem Sinne grundlos ist, impliziert aber nicht, dass der Glaube keiner glaubensunabhängigen Gründe bedarf. Es liegt hier eine Ambiguität in der Rede vom Bedürfnis von Gründen. Wenn Kierkegaards Darstellung der Psychologie der Glaubensübernahme richtig wäre, dann ist es wirklich so, dass der Glaube keiner Gründe bedarf in dem Sinne, dass Gründe für die Wahrheit des Glaubens keine psychologisch wirksamen Kräfte für die Übernahme des Glaubens sind – sie gehören dann nicht zur Erklärung der Einstellung des Gläubigen. Das bedeutet aber nicht, dass der Glaube keiner unabhängiger Gründe im Sinne der Rechtfertigung des Glaubens bedarf. Und dieser de iure Sinn von „Gründe bedürfen“ ist ja der eigentlich interessante Punkt in der Debatte. Die Frage, um die sich die Debatte dreht ist, die Frage, ob der Glaube unabhängiger Gründe bedarf, um epistemisch akzeptabel zu sein. Und der Fideist beantwortet diese Frage mit einem eindeutigen Nein. Wir sehen aber, dass hier ein klares non sequitur vorliegt, weil sich die epistemische Berechtigung unabhängig von Gründen zu glauben, nicht daraus ergibt, dass die Übernahme des Glaubens nicht aus Gründen geschieht. Würde hier eine Implikation bestehen, dann wäre jeder epistemisch berechtigt beliebiges zu glauben, sofern sein Meinungserwerb nur einem Mechanismus unterliegt, in dem Gründe keine Rolle spielen. Aber das ist klarerweise absurd – so absurd wie die Auffassung jeder sie moralisch berechtigt einen anderen zu töten, sofern er für seine Handlung nur keine Gründe hat. Zwei letzte Punkte. (1) Wenn Kierkegaard recht hätte und der Glaube grundlos ist und auch keiner Gründe bedarf, wird es beliebig, welchen Glauben man wählt und ob man überhaupt einen Glauben wählt. Denn nach Kierkegaards fideistischem Bild kann es nichts geben, was eine Entscheidung für den Glauben stützen könnte, und damit nichts geben was eine Entscheidung für eher diesen als jenen Glauben stützen könnte. Ob ich ein Christ, ein Jude, 66 ein Moslem, ein Hindu oder Anhänger irgendeiner Naturreligion, irgendeiner Sekte in meiner Stadt usw. werde, ist alles vollkommen gleichgültig. Es ist ein Sprung in die Andersheit – aber wohin ich da springe, macht keinen Unterschied. Und wenn es für den Glauben prinzipiell keinen Grund geben kann, dann kann es natürlich auch keinen Grund zur religiösen Erziehung geben: Denn warum sollte man ein Kind in dieser anstatt in jener Religion erziehen oder schließlich überhaupt nicht religiös erziehen? Darauf hat der Fideist keine Antwort, und dass er kein Antwort hat, zerstört dann auch seine eigene Auffassung, dass der Glaube etwas Wichtiges sei. Denn das Bewusstsein der Wichtigkeit kann nicht mit dem Bewusstsein der Beliebigkeit zusammen bestehen. (2) Natürlich war es für Kierkegaard in keiner Weise beliebig, ob man in den Glauben springt und in welchen Glauben man springt. Er redet aus der Perspektive eines gläubigen Christen und beschreibt die Situation der Glaubensentscheidung als die existentiell bedeutsamste und tiefste Entscheidung, vor der jeder in seinem Leben steht. Das deutet nun darauf hin, dass die Behauptung der Grundlosigkeit des Glaubens eher verbaler Natur ist, und nicht so strikt genommen werden kann. Denn selbst wenn es aus Kierkegaards Sicht keine theoretischen Gründe für den Glauben gibt – Gründe heißt das, die für die Wahrheit des Glaubens sprechen – so lässt sich seine Beschreibung der existentiellen Situation doch nicht aufrechterhalten, wenn wir nicht annehmen würden es gäbe praktische Gründe für den Glauben – Gründe heißt das, die zwar nicht für die Wahrheit aber doch für den Wert des Glaubens sprechen. Aber das einzuräumen heißt schon den Fideismus aufzugeben und einzuräumen, dass der Glaube sui generis ist, indem durch keine Argument angefochten und auch durch kein Argument gestützt werden kann. Die praktischen Erwägungen sind dabei aber nicht unabhängig von der Wahrheitsfrage zu sehen: denn auch von praktischer Rationalität wird die Übernahme eines Glaubens nicht im Bewusstsein seiner Falschheit empfohlen werden können. Kommen wir nun zum Evidentialismus. Ich werde mich hier kürzer fassen, weil wir noch später, wenn wir die Reformierte Epistemologie besprechen, ausgiebig Gelegenheit haben, diese Position zu diskutieren. Im meinem Urteil über den Evidentialismus bin ich mir nicht so sicher wie in Bezug auf den Fideismus. Ich möchte daher hier eher einige tentative Überlegungen anstellen und an dieser Stelle zumindest noch nicht zu einem abschließenden Urteil kommen. Zunächst einmal führt, wie ich schon gesagt hatte, die Zurückweisung des Fideismus nicht notwendig zu einer Annahme des Evidentialismus. Die Reformierte Epistemologie ist weder fideistisch im hier besprochenen Sinn, noch evidentialistisch im Sinn der Locke’schen Position. 67 Dem Bild des Evidentialismus zufolge befinden wir uns alle – Gläubige wie Nicht-Gläubige epistemisch in der gleichen Situation, insofern die Maßstäbe der Bewertung gleich sind. Das scheint mir nicht ganz richtig zu sein. Betrachten wir etwa die Maximen, dass man einer Proposition nur in dem Maße zustimmen kann, wie es die verfügbare Evidenz zulässt. Nehmen wir nun einmal, wie Richard Swinburn zu zeigen versucht hat, an, dass die Wahrscheinlichkeit dass Gott existiert größer ist als die Wahrscheinlichkeit dass Gott nicht existiert, gegeben die Welt weist eine bestimmte Ordnungsstruktur auf. Nehmen wir an, wie könnten die Wahrscheinlichkeit auch numerisch bestimmen, so dass die Proposition „Gott existiert“ eine Wahrscheinlichkeit von 0,7 hat. Es ist daher rational an Gottes Existenz zu glauben. Nach Lockes Maxime dürften wir der Aussage, dass Gott existiert, unter diesen Bedingungen nur im Grade ihrer Wahrscheinlichkeit zustimmen, denn eine Zustimmung die über das Maß ihrer Stützung durch die Evidenzen hinausgeht, ist bloße Schwärmerei. Nun kann sich ein Gläubiger in dieser Beschreibung sicherlich nicht wiederfinden. Zum Glauben, darin gebe ich Kierkegaard recht, gehört eine gewisse Vorbehaltlosigkeit der Zustimmung, und das unterscheidet den religiösen Glauben von Glaubenseinstellungen gegenüber, sagen wir, Wettervorhersagen. Von dem Gläubigen zu verlangen, er solle den Glaubensinhalten nur in Proportion zur Stützung durch Evidenzen zustimmen, hieße deshalb verlangen, seine Einstellung sehr stark zu revidieren – so stark, dass er selbst es als eine Abkehr vom Glauben ansehen würde. Der Nicht-Gläubige andererseits würde, wenn er diese Maxime befolgt, niemals zu jener Vorbehaltlosigkeit kommen, die den Gläubigen kennzeichnet. Die epistemische Situation von Gläubigen und Nicht-Gläubigen ist also durchaus verschieden, da die Befolgung der Locke’schen Maxime unterschiedliche Konsequenzen für sie hätte. Der Gläubige insbesondere hat einen Grund, diese Maxime abzulehnen, weil sie so restriktiv ist, dass der Glaube in seiner Vorbehaltlosigkeit dann immer als Schwärmerei diskreditiert zu werden droht. An dieser Maxime scheint daher in der Tat etwas nicht zu stimmen. Eine bessere Beschreibung scheint mir die folgende zu sein: Wenn wir zeigen könnten, dass die Wahrscheinlichkeit von „Gott existiert“ größer ist als die Wahrscheinlichkeit von „Gott existiert nicht“, dann ist damit der Glaube an Gott als rationale Einstellung erwiesen. Und das ist hinreichend für die epistemische Berechtigung zum Glauben. Das heißt, der Glaube muss sich dann nicht noch dem Grad der Wahrscheinlichkeit anmessen, um rational zu sein. Die Auffassung, dass die Zustimmung in Proportion zum Maß der Stützung durch Evidenzen erfolgen müsse, um rational zu sein, entspringt nach meiner Einschätzung aus der Perspektive des Nicht-Gläubigen oder eines skeptisch zurückhaltenden Denkers. 68 Dieser Maxime liegt deshalb eine weitere zugrunde: Die Maxime als allererstes Irrtümer zu vermeiden. Das heißt dass die Maxime der Proportionalität mit einer bestimmten Sicht über epistemische Ziele und daraus entspringenden epistemischen Verpflichtungen verknüpft ist. Das vorrangige Ziel ist Irrtümer zu vermeiden, und die entsprechende vorrangige epistemische Pflicht ist, sich gegen Irrtümer zu wappnen. Aber diese Ethik der Meinungen ist alles andere als offensichlich korrekt. In seiner berühmten Vorlesung The Will to Believe hat William James zu zeigen versucht, dass die skeptische Zurückhaltung gegenüber Wahrheitsansprüchen nicht wirklich das ist, als was sie sich präsentiert – als eine Zurückhaltung, bei der keine Partei ergriffen wird: Der Skeptizismus besteht also nicht in der Vermeidung einer Option; er ist die Option einer bestimmten, besonderen Art von Risiko. Lieber den Verlust der Wahrheit, als die Möglichkeit des Irrtums riskieren! – Das ist der eigentliche Standpunkt dessen, der gegen den Glauben sein Veto einlegt. (Der Wille zu Glauben, S. 153) Die skeptisch zurückhaltende Person folgt der Maxime, Irrtümer um jeden Preis zu vermeiden. Dieser Maxime zu folgen, birgt aber, wie James hervorhebt, selbst ein Risiko. Denn was ist, wenn eine Aussage, der ich nicht zustimmen, weil nicht ausreichend Evidenz für sie da ist – was ist, wenn diese Aussage wirklich wahr ist. Der skeptische Mensch vermindert das Risiko des Irrtums, geht damit aber das Risiko des Verlusts der Wahrheit ein. Und zu den epistemischen Zielen gehört sicherlich nicht nur die Vermeidung von Irrtum, sondern auch der Besitz von Wahrheiten. Wenn die Maxime der Proportionalität lediglich in der Auffassung ihren Rückhalt hat, dass das oberste epistemische Ziel darin besteht, Irrtümer zu vermeiden, bedarf sie selbst einer Stützung. Es muss begründet werden, warum die Vermeidung von Irrtümern gegenüber dem Besitz von Wahrheiten das vorrangige epistemische Ziel ist. James hat seine eigene Auffassung vor dem Hintergrund des Essays „The Ethics of Belief“ von William Clifford entwickelt. Clifford gehört zu den in Anthologien am meisten repräsentierten Vertretern des Evidentialismus. Und an seiner extremen Version können wir nun ein weiteres Problem des Evidentialismus aufzeigen. Das Problem besteht allgemein gesagt darin, dass der Evidentialismus zu einer extrem restriktiven Sicht tendiert, die konsequent befolgt, vielen von dem, was wir für vernünftig halten, aus dem Bereich der akzeptablen Überzeugungen verdrängen würde. James Reaktion darauf ist diese: [...]eine Denkregel, die mich vollständig verhinderte, gewisse Arten von Wahrheit, wenn diese Arten von Wahrheit wirklich beständen, anzuerkennen, [wäre] eine vernunftwidrige Regel. Betrachten wir ein solche Denkregel. James hat, wie gesagt, sicherlich Cliffords Auffassung im Sinn. Und Clifford hatte in seinem Essay The Ethics of Belief folgende Regel aufgestellt: 69 It is Wrong, Everywhere, Always, and for Anyone, to Believe Anything upon Insufficient Evidence. Clifford spricht also einer Person das Recht ab, eine Proposition zu glauben, wenn sie keine hinreichende Evidenz für die Wahrheit der Proposition hat. Dass diese Regel irgendwie problematisch sein muss, lässt sich an den Konsequenzen ihrer Befolgung ablesen. Ohne ins Detail gehen zu müssen, reichen sicherlich die folgenden Hinweise. Der erste Punkt betrifft die reale epistemische Lage, in der wir uns befinden. Ich meine damit folgendes. Vieles von dem, was wir glauben, glauben wir nicht auf der Basis zureichender Evidenz. Wir glauben es nicht, weil wir zureichende Evidenz für unsere Überzeugung haben. Denn viele unserer Meinungen erwerben wir einfach auf eine ganz andere Weise: wir lernen einfach vieles durch andere – durch unsere Eltern, durch Lehrer usw. Wir verlassen uns dabei implizite auf die Vertrauenswürdigkeit derjenigen Personen, von denen wir Überzeugungen übernehmen. Dass man mir in der Schule beigebracht hat, dass Cäsar ein großer römischer Feldherr war, ist aber sicherlich keine Evidenz für die Wahrheit der Proposition, dass Cäsar ein großer römischer Feldherr war. Ich habe diese Meinung übernommen im Vertrauen darauf, dass mein Lehrer weiß, was er sagt. Ich habe diese Meinung aber auch nicht übernommen, weil ich eine vorgängige Evidenz dafür habe, dass mein Lehrer in Fragen der antiken Geschichte, eine vertrauenswürdige Autorität ist. Es gibt also einen Mechanismus der Meinungsfestlegung, in dem Evidenzen für die Wahrheit der Meinungen keine fundamentale Rolle spielen. Und da dieser soziale Mechanismus eine de facto große spielt, hieße Cliffords Regel zu folgen, diesen sozialen Meinungsbildungsprozess aufzugeben. Damit aber würden wir den Umfang unseres Wissens offenkundig extrem beschränken, da einfach niemand in der Lage ist, durch eigene Forschung Evidenzen für all die Dinge zu entdecken, die er selbst glaubt. Ein zweiter Punkt betrifft die Situation der Meinungsverschiedenheit. Wie wirkt sich Cliffords Regel hier aus? Betrachten wir etwa philosophische Meinungsverschiedenheiten. Lassen wir dabei beiseite, dass sich manche Meinungsverschiedenheiten aufgrund von Unkenntnis, Uninformiertheit, mangelnder logischer Kompetenz, von Rechthaberei oder auch aufgrund intellektueller Unredlichkeit ergeben und erhalten. Es gibt sicherlich Fälle, in denen zwei Philosophen unterschiedliche Meinungen haben, obwohl sie keines dieser intellektuellen Laster haben. Sind diese Meinungen kontradiktorisch, so ist eine von ihnen von ihnen wahr, eine von ihnen falsch. Sollen wir nun sagen, dass keiner von beiden berechtigt ist, seine Meinung zu haben, weil keiner den anderen dazu bringen kann, seine Meinung zu teilen? In diesem Falle würden wir den Begriff der zureichenden Evidenz als den Begriff einer Evidenz interpretieren, durch den eine andere unvoreingenommene Person zur Zustimmung gezwungen wird. Aber das würde natürlich dazu führen, dass man in philosophischen Dingen nichts mehr glauben kann, was nicht unumstritten ist – und das heißt, nichts mehr glauben kann, was 70 nicht trivial ist. Oder sollen wir die Lage so beschreiben, dass die Lage so ist, dass würde die Meinungsverschiedenheit behoben, dies dennoch kein Grund für die Zustimmung ist, weil ja nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein späterer Philosoph ein Argument konstruiert, das eine Gegenevidenz bildet. In diesem Fall müssten wir zureichende Evidenz so verstehen, dass jede mögliche rationale Person dadurch zur Zustimmung gezwungen wird. Das kann aber nur heißen, dass nichts als zureichende Evidenz für eine Proposition gelten kann, was nicht selbstevident und absolut gewiss ist, so dass die betreffende Proposition dadurch ebenfalls den Status absoluter Gewissheit erhält. Das wäre eine so starke Forderung, dass wir fast alles aufgeben müssten, was wir glauben. Das Problem, das sich hier versteckt, ist also klarerweise das Problem einer adäquaten Interpretation zureichender Evidenz. So extrem interpretiert, wie ich es hier getan habe, unterstellen wir selbst wissenschaftliche Überzeugungen nicht dem Kriterium Cliffords. Und es wäre klarerweise ungerecht, den religiösen Glauben anspruchsvolleren Kriterien für rationale Akzeptierbarkeit zu unterstellen als wissenschaftliche Überzeugungen. 71 III. Die Attribute Gottes a) Einleitung Bei einer Darstellung und Analyse der Attribute Gottes geht es um das Wesen oder die Natur Gottes, nicht um Argumente für die Existenz Gottes. Nun könnte man sich natürlich fragen, warum eine philosophische Beschäftigung mit den göttlichen Attributen von Interesse sein könnte, solange nicht sichergesellt ist, dass ein solches Wesen wie Gott überhaupt gibt. Wäre es nicht sehr viel sinnvoller zunächst einmal zu entscheiden, ob es Gott überhaupt gibt, bevor man sich der Frage zuwendet, welche Charakteristika Gott besitzt? Diese Frage hat sicherlich etwas für sich. So würde sich ja auch kein Biologe und kein Anthropologe ernsthaft auf die Frage einlassen, welche Eigenschaften der Yeti hat, solange nicht sichergestellt ist, ob es jenen legendären Schneemenschen überhaupt gibt. Beachten Sie nun aber die folgende Gegenfrage: Wie soll man sicherstellen können, dass es den Yeti gibt, wenn es völlig unklar ist, was ein Yeti denn sein soll? Es muss ja zumindest ausgemacht sein, unter welchen Bedingungen eine Beobachtung als eine Beobachtung von einem Yeti gelten kann, damit so etwas wie die Entdeckung des Yeti überhaupt möglich ist. Und es muss natürlich auch ausgemacht sein, unter welchen Bedingungen eine Beobachtung als eine Beobachtung von einem Yeti gelten kann, damit man sagen kann, dass eine bestimmte Beobachtung nicht als Beobachtung eines Yeti gilt. Mit dem Ausdruck „Yeti“ muss also, kurz gesagt, eine Beschreibung verbunden sein, damit die Frage nach der Existenz des Yeti überhaupt informativ und beantwortbar ist. Nicht anders verhält es sich in Bezug auf die Frage, ob Gott existiert. Wenn man der Ansicht ist, dass die Existenz Gottes eine verständliche und dringliche Frage ist, dann liegt das einfach daran, dass man bereits eine Vorstellung davon hat, wie Gott beschaffen ist oder was für ein Wesen Gott ist. Der Sache nach hieße es jedoch, den Karren vor das Pferd spannen, wollte man die Existenzfrage unabhängig von der die Konzeption Gottes betreffenden Frage nach seinen Attributen zu beantworten versuchen. Das Prinzip das hier am Werk ist lautet: Keine Entität ohne Identität, keine Entität, heißt das, ohne Charakteristika, welche sie zu gerade dieser Entität machen, oder, um es noch einmal anders auszudrücken, keine Entität ohne identitätskonstituierende Charakteristika. Die Frage, welche Attribute Gott zukommen, ist daher von eminenter Wichtigkeit sowohl für die Konstruktion als auch für die Bewertung von Argumenten für die Existenz Gottes. Nehmen sie etwa an, es sei beweisbar, dass das Universum eine erste Ursache hat – ein Ursache heißt das, die nicht selbst Teil des Universums ist und die nicht selbst wiederum durch etwas anderes verursacht ist. Wäre dieser Beweis zugleich ein Beweis für die Existenz 72 Gottes? Rundum zufriedenstellend wäre dieser Beweis offenbar nur dann, wenn unsere Konzeption Gottes sich in der Konzeption einer ersten unbedingten Ursache des Universums erschöpfen würde, so dass „Gott existiert“ nichts anderes heißt als „Es gibt eine erste unbedingte Ursache des Universums.“ Wäre dieser Beweis aber ein Beweis für die Wahrheit des Theismus – ein Beweis, der den Theisten zufrieden stellen könnte? Offenbar nicht. Denn für den Theismus ist Gott zwar die selbst nicht bedingte Ursache des Universums, aber Gott wird darüber hinaus auch als Schöpfer gedacht – und das heißt als eine Person oder als ein personales Wesen. „Gott existiert“ ist daher für den Theismus nicht äquivalent mit „Es gibt eine erste Ursache des Universums“, und daher kann ein Beweis für die kausale Abkünftigkeit des Universums nicht als ein vollständiger Beweis für die Existenz Gottes gelten. Was für Argument für die Existenz Gottes gilt, gilt natürlich auch für Argumente gegen die Existenz Gottes: Auch die Konstruktion und Bewertung atheistischer Argumente bedarf einer klaren Vorstellung von den Charakteristika Gottes. Wenn Sie etwa beweisen wollten, dass Gott nicht existiert, indem sie sich auf das Prinzip berufen, dass alle Körper vergänglich sind, werden sie den Theisten damit wenig beeindrucken, weil in theistischem Verständnis Gott überhaupt keine körperlichen Eigenschaften hat. Würden Sie dagegen beweisen können, dass es einen unverkörperten Geist – ein körperloses geistiges Wesen – nicht geben kann, würde ihr Argument sicherlich einigen Eindruck auf den Theisten machen, da Gott als ein sowohl geistiges als auch unkörperliches Wesen gedacht wird. Vor diesem Hintergrund stellt sich natürlich nicht nur die Frage nach den Attributen Gottes, sondern auch die Frage nach der Auswahl der Attribute. Die letztere Frage betrifft die Quellen und den Spielraum für Konzeptionen Gottes. Hier handelt es sich um ein sehr schwieriges Problem, insofern es sich um das sehr viel allgemeinere semantische Problem von Referenz und Bedeutung handelt. So müssen wir etwa sicherstellen können, dass die Referenz des Ausdrucks Gott fix und stabil bleiben kann auch angesichts einer Veränderung der mit diesem Ausdruck assoziierten Bedeutung. Andererseits aber wollen wir nicht sagen, dass die Referenz unbeschadet jeder beliebigen Veränderung der mit dem Ausdruck „Gott“ verbundenen Vorstellungen fix und stabil bleiben kann. Theologisch gesprochen, wollen wir einerseits verhindern, dass noch so geringfügige Veränderungen in theologischen Ansichten eine Veränderung im Glauben bewirken: Wir wollen also etwa verhindern, dass wir zu der Auffassung gezwungen sind, dass Protestanten und Katholiken oder dass Calvinisten und Lutheraner aufgrund der zwischen ihnen bestehenden theologischen Differenzen unterschiedliche Gottheiten verehren. Andererseits wollen wir aber auch verhindern, dass wir zu der Auffassung gezwungen sind, Christen und, sagen wir, die Verehrer des Baal, glaubten 73 beide an Gott oder an dieselbe Gottheit. Religionspsychologisch und politisch gesprochen wollen wir also sowohl die machtheischende Arroganz derjenigen vermeiden, für die jeder sich von Gott abkehrt, der theologisch abweichende Auffassungen hat, als auch die vielleicht wohlmeinende, aber konfuse Harmoniebedürftigkeit derjenigen vermeiden, für die jeder an Gott glaubt, sofern er nur an irgendetwas glaubt – an Baal, an Manitou, an die Sterne, an eine man-weiß-nicht-welche Energie oder an den Gott der Christen, der Juden und des Islam. Eine weitere Dimension anzusprechen, in der sich das semantische Problem auswirkt, ist die der Unterscheidung zwischen Glauben und Aberglauben. Das ist klarerweise eine normative Dimension, die aber trotzdem eine Verankerung in der semantischen Frage hat. Aberglauben ist ja so etwas wie ein irrgeleiteter Glauben – und zwar nicht in dem Sinne, in dem religiöser Glauben für den Atheisten überhaupt irregeleitet ist, sondern in dem innertheologischen Sinn, dass der Abergläubige irgendetwas, was definitiv nicht als Gott betrachtet werden kann, so verehrt, als wäre es Gott. Betrachten wir die Sache ein bisschen genauer. Ich hatte die Frage als eine Frage nach der Auswahl der Attribute beschrieben. Das ist natürlich ein bisschen salopp formuliert, weil damit ja der Eindruck entstehen könnte, es sei irgendwie beliebig, welche Charakteristika mit dem Ausdruck „Gott“ assoziiert sind, so dass es nur darauf ankommen würde, sich zu entscheiden, welche Attribute man denn nun Gott zuschreiben möchte. Trotzdem ist die Rede von einer Auswahl oder Selektion von Attributen nicht vollkommen unangemessen. Sie weist auf die Frage hin, durch welche Bedingungen Konzeptionen von Gott eingeschränkt sind, d.h. unter welchen Bedingungen eine Konzeption überhaupt als eine Konzeption von Gott verstanden werden kann. Und das ist eben das semantische Problem, wie die Referenz des Namens Gott über unterschiedliche Konzeptionen hinweg stabil bleiben kann. In Begriffen der Kommunikation ausgedrückt, ist das das Problem, wie Leute unterschiedliche theologische Ansichten haben können, ohne darum aneinander vorbeireden zu müssen – was der Fall wäre, würde etwa die Tatsache, dass Thomas von Aquin und Kierkegaard unterschiedliche theologische Ansichten haben, implizieren, dass das Wort „Gott“ im Munde von Thomas eine andere Referenz hätte als das Wort „Gott“ im Munde von Kierkegaard. Ohne jetzt in die verschiedenen Theorien der Referenz genauer eingehen zu müssen, ist folgendes ziemlich offensichtlich. „Gott“ ist semantisch betrachtet zweifellos ein Eigenname, wie etwa auch „Aristoteles“ oder „der Abendstern“. Nun gibt es eine Theorie der Referenz, die, grob gesagt, Referenz historisch und kausal ohne Rückgriff auf assoziierte Beschreibungen erklärt. Was etwa die Referenz von „Aristoteles“ erklärt, das ist die Tatsache, dass einem bestimmten Kind von seinen Eltern der Name „Aristoteles“ gegeben worden ist, und nicht so etwas wie 74 eine mit dem Namen „Aristoteles“ assoziierte Beschreibung wie „der Lehrer von Alexander dem Großen“. Diese Theorie hat gegenüber der sogenannten Beschreibungstheorie der Referenz einige Vorteile. Sie umgeht vor allem ein sehr schwerwiegendes Problem. Nehmen wir nämlich an, dass der Name „Aristoteles“ auf Aristoteles kraft der mit dem Namen assoziierten Beschreibung „der Lehrer von Alexander dem Großen“ referiert. Das würde implizieren, dass die Aussage „Aristoteles war der Lehrer Alexanders des Großen“ notwendig, weil analytisch wahr ist, und dass die Aussage „Aristoteles war nicht der Lehrer Alexanders des Großen“ notwendig, weil analytisch falsch ist. Dass Aristoteles der Lehrer Alexanders des Grossen war, ist aber zweifellos eine historisch kontingente Tatsache – Aristoteles hätte auch existieren können, wenn er nicht Lehrer Alexanders des Großen geworden wäre – und daher hat die Beschreibungstheorie ein echtes Problem, was mit der historisch-kausalen Theorie der Referenz beseitigt ist. Vor allem kann die historisch-kausale Theorie problemlos erklären, wie man unterschiedliche, voneinander abweichende Aristotelesbilder haben kann und wie man historische Entdeckungen über Aristoteles machen kann, ohne dass sich damit die Referenz des Namens „Aristoteles“ verändern würde. Ja, die Möglichkeit von Entdeckungen über Aristoteles ist sogar an die Möglichkeit der Stabilität der Referenz bei gleichzeitiger Veränderung der Beschreibung der Person gebunden. Warum ich das alles sage, hat folgenden Grund. Mit den Namen „Gott“ ist es sicherlich ganz anders bestellt als mit dem Namen „Aristoteles“ so wie ihn die kausale Theorie der Referenz semantisch interpretieren würde. Denn der Name „Gott“ hat sicherlich einen deskriptiven Sinn, der mit seinem Gebrauch verbunden ist, so dass gilt, dass nichts der Referent dieses Namens sein kann, was die mit ihm assoziierte Beschreibung nicht erfüllt. Die Beschreibung nun, die ein Objekt erfüllen muss, um als Referent des Namens „Gott“ gelten zu können, besteht aus nichts anderem als den definierenden Charakteristika von Gott. Die Frage nach der Selektion der Attribute stellt sich daher semantisch als die Frage nach den Bedingungen, welche die mit dem Namen „Gott“ assoziierte Beschreibung einschränken. Und was die Frage der Koreferentialität betrifft – die Frage, wie gleiche Referenz angesichts unterschiedlicher theologischer Ansichten aufrecht erhalten wird – was diese Frage betrifft, so wird sie durch eine Unterscheidung zwischen harten und weichen deskriptiven Charakteristika Gottes erklärt werden können. Als hart würden dabei solche Charakteristika gelten, die zur Beschreibung Gottes in dem Sinne gehören, dass eine Revision in diesem Bereich zu einer Veränderung der (intendierten) Referenz führt. Ist also eine Eigenschaft F eine harte – ein zum harten Kern gehörige – Eigenschaft, dann würde jemand, der den Namen „Gott“ verwendet ohne ihm die Eigenschaft F zuschreiben zu wollen, einfach über etwas anderes reden, als worüber wir 75 reden, wenn wir von Gott sprechen. Die Eigenschaft F würde also als harte Eigenschaft eine Eigenschaft sein, die irgendetwas besitzen muss, um Gott zu sein. Ist eine Eigenschaft G dagegen ein weiche – nicht zum harten Kern gehörige – Eigenschaft, dann kann jemand, der den Namen Gott verwendet, ohne ihm die Eigenschaft G zuschreiben zu wollen, dennoch über ein und dasselbe Objekt wie wir reden, wenn wir von Gott reden. Damit hätten wir einerseits erklärt, wie es unterschiedliche Konzeptionen von Gott geben kann, so dass Differenzen in theologischen Ansichten nicht notwendig zu einer Veränderung der Referenz von „Gott“ führen. Andererseits hätten wir damit erklärt, warum nicht jede Vorstellung, die man vielleicht in einem soziologischen Sinn eine Gottesvorstellung nennen könnte, auch wirklich eine Vorstellung oder eine Konzeption von Gott ist. [Im Vorbeigehen bemerkt, sehen Sie auch hier wieder, warum der Ineffabilismus oder Mytizismus offensichtlich scheitern müssen. Der Ineffabilist bestreitet die Beschreibbarkeit Gottes. Dann aber kann es auch keine mit dem Namen Gott verbundene Beschreibung geben, durch welche die Referenz von „Gott“ fixiert wird. Wenn aber die Referenz von „Gott“ nicht fixiert ist, können wir einfach nicht wissen, wovon wir reden, wenn wir von Gott reden – und das heißt insbesondere auch, dass der Ineffabilist und der Mystiker selbst nicht wissen, wovon sie reden, wenn sie von Gott reden. Es gibt daher wenig Grund, sie ernst zu nehmen.] Aber zurück zu unserem Problem. Was wir bisher gesagt haben, ist natürlich nur die semantische Basis für eine theologische oder religionsphilosophische Darstellung der Attribute Gottes. Damit ist das Selektionsproblem aber noch nicht gelöst – die Frage nämlich, was denn zur Definition Gottes gehört, was also zu der Beschreibung gehört, die ein Objekt erfüllen können muss, um als Gott bezeichnet werden zu können. Damit kommen wir noch einmal zu der Frage der einschränkenden Bedingungen oder der Quellen einer Darstellung der göttlichen Attribute. Teilweise ist das eine Frage der Geschichte und der Tradition. Wenn wir Religionen verstehen und religiöse Wahrheitsansprüche beurteilen wollen, dann müssen wir natürlich diejenigen Charakteristika betrachten, die in der theologischen Tradition Gott tatsächlich zugeschrieben worden sind. Daran ist sicherlich etwas wahres. Aber es kann nicht die ganze Geschichte sein. Und zwar schon deshalb nicht, weil viele von den zu dieser Tradition gehörenden Denker selbst der Auffassung waren, dass die Konzeption Gottes eine interne Kohärenz aufweist, die über eine bloße Liste von Attributen hinausgeht, welche Gott in der einen oder anderen Tradition zugeschrieben werden. Sie waren also der Auffassung, dass die Liste der Attribute Gottes einer einschränkenden Bedingung unterliegt, und dass diese Bedingung verständlich macht, warum bestimmte Attribute als Attribute Gottes gelten. Betrachten wir die Angelegenheit also einmal unter der Leitfrage, welche Eigenschaften etwas haben muss, um zurecht als „Gott“ bezeichnet zu werden. Einen Zugang zur Antwort finden wir, wenn wir uns eine ebenso offenkundige, wie äußerst wichtige Tatsache vor Augen 76 führen: Dass Gott für den Gläubigen in erster Linie und vor allem ein Objekt der Verehrung ist. Genauer gesagt, ist Gott für den Gläubigen, das Objekt eminenter Verehrung, d. h. das Objekt, das in höchstem Maße – vorbehaltlos oder unbedingt – verehrungswürdig ist. Diese Eigenschaft der unbedingten Verehrungswürdigkeit gehört sicherlich zum harten Kern der Beschreibung Gottes, so dass nichts als Gott gelten kann, was nicht in eminenter Weise oder in höchstem Maße verehrungswürdig ist. In höchstem Maße verehrungswürdig sein heißt natürlich auch anbetungswürdig sein. Nichts kann daher Gott sein, was nicht anbetungswürdig ist. Würdig angebetet zu werden ist die Basis der Praxis des Gebets. Wie auch immer man das Gebet genauer analysiert, es ist auf jeden Fall folgendes: Der Betende richtet sich an Gott als dem schlechthin anbetungswürdigen, weil unbedingt verehrungswürdigen Wesen. Darin liegt offenbar eine strikte Asymmetrie. Der Gläubige ist gläubig und betet im Bewusstsein, dass er selbst mit Gott als dem schlechthin anbetungswürdigen Wesen nicht auf gleichem Fuße verkehrt. Das liegt bereits im Begriff der Anbetung und damit natürlich auch im Begriff der unbedingten Anbetungswürdigkeit. Eine asymmetrische Relation ist nun wie folgt definiert: R ist asymmetrisch genau dann wenn gilt: steht a in der Relation R zu b, so steht b nicht in der Relation R zu a. Angewendet auf den Fall der Anbetungswürdigkeit heißt das: Ist Gott würdig von den Menschen angebetet zu werden, so ist kein Mensch würdig von Gott angebetet zu werden. Diese Asymmetrie zwischen Gott und Mensch gehört offenbar selbst zur Beschreibung Gottes dazu. Diese im Begriff der Anbetungswürdigkeit liegende Asymmetrie besagt nun auch, dass Gott dasjenige Wesen ist, dem vorbehaltloser Gehorsam gebührt oder das würdig ist, dass man ihm vorbehaltlos gehorcht. Das besagt, dass man nicht an Gott glaubt, wenn man sich in seinem Glauben auf ein Wesen bezieht, dessen Weisungen zu folgen, irgendwelchen objektiven Vorbehalten unterstehen könnte. Alles zusammen genommen: höchste Verehrungswürdigkeit, Anbetungswürdigkeit und des vorbehaltlosen Gehorsams würdig zu sein, sind konstitutiv für einen Glauben an Gott – ich meine an dieser Stelle nicht konstitutiv für den Glauben als Einstellung betrachtet, sondern konstitutiv dafür, dass es sich tatsächlich um einen Glauben an Gott im Unterschied sagen wir zu einem Glauben an den Fortschritt, den Glauben an die emanzipatorische Kraft der Aufklärung usw. handelt. Da der Anbetung und des vorbehaltlosen Gehorsams würdig zu sein Implikationen der höchsten Verehrungswürdigkeit sind, ist auch klar, dass der Glaube an Gott der Glaube an ein einzigartiges Wesen ist. So ergibt sich die Einzigkeit Gottes aus der definierenden Eigenschaft der eminenten oder höchsten Verehrungswürdigkeit. Damit kommt auch eine weitere Implikation der Asymmetrie zwischen Mensch und Gott ins Spiel. Daraus, dass Gott anbetungswürdig ist und als anbetungswürdig einzig ist, folgt natürlich, dass kein Mensch anbe- 77 tungswürdig ist. Auch das gehört offenbar konstitutiv zum religiösen Glauben, verstanden als ein Glauben an Gott und entspricht der Eigenschaft, des vorbehaltlosen Gehorsams würdig zu sein. Es folgt natürlich auch, dass nichts außer Gott anbetungswürdig ist. Gott muss deshalb als das höchst verehrungswürdige und einzig anbetungswürdige, das größte aller Wesen sein. Und zwar nicht nur das Wesen das, wenn es existiert, tatsächlich das größte Wesen ist, sondern das Wesen, das das denkbar größte Wesen – dasjenige Wesen über das hinaus ein größeres nicht gedacht werden kann. Zwischen de facto das größte aller Wesen zu sein und denkbarerweise das größte aller Wesen zu sein, besteht offenbar ein himmelweiter Unterschied. Ein de facto größtes Wesen zu dem ein größeres denkbar ist, ist ein Wesen, das mit allerlei Mängeln behaftet sein kann. Und ein solches Wesen kann nicht Gott sein, wenn Gott notwendig dasjenige Wesen ist, dass im höchsten Maße verehrungswürdig ist und das einer vorbehaltlosen Ergebenheit würdig ist. Denn wie sollte ein mit irgendwelchen Mängeln behaftetes Wesen der vorbehaltlosen Ergebenheit würdig sein? Das macht wenig Sinn, da Vorbehalte gegen Ergebenheit und Gehorsam ja gerade eine rationale Basis in Mängeln dessen haben, dem gegenüber Ergebenheit und Gehorsam verlangt wird. Daher kann nichts kann vorbehaltlose oder unbedingte Ergebenheit und Gehorsam verlangen, was nicht das denkbar größte Wesen ist. Dass Gott das Wesen ist, über das hinaus größeres nicht gedacht werden kann, ist nun eine sehr berühmt Formulierung von des mittelalterlichen Denkers Anselm von Canterbury. Wir können sehen, dass diese Definition nicht irgendwie blindlings konstruiert oder irgendeine phantastische private Idee von Anselms war, sondern durch einige Schritte plausibel aus der Eigenschaft Gottes als des höchst verehrungswürdigen Wesens entwickelt werden kann. Die Rede von dem größten Wesen ist dabei zu verstehen als Rede von dem vollkommenen Wesen. Gott ist also, dieser Definition nach, das absolut vollkommene Wesen, das ens perfectissimum, wie es in der Schulsprache des Mittelalters dann auch heißt. So lässt sich also schon relativ viel über Eigenschaften Gottes sagen, sobald wir nur ausbuchstabieren, was es heißt, im höchsten Maße verehrungswürdig zu sein. Nun gibt es aber hier einen weiteren Schritt. Denn der Verehrung würdig zu sein ist ja offenbar keine Eigenschaft, die für sich bestehen kann. Und genau dasselbe gilt auch für die die Eigenschaft das größte oder vollkommenste Wesen zu sein. Es handelt sich bei beiden um eine Eigenschaften höherer Stufe oder um emergente Eigenschaft. Das besagt, dass etwas verehrungswürdig oder das vollkommenste Wesen ist auf der Basis anderer Eigenschaften, so dass, wenn diese Eigenschaften nicht gegeben sind, auch die Eigenschaft der Verehrungswürdigkeit nicht gegeben ist. Wir können also als eine weitergehende Frage die Frage anschließen: Welche 78 Eigenschaften oder Attribute muss denn eine Wesen besitzen, um im höchsten Maße verehrungswürdig oder um anbetungswürdig oder um des vorbehaltlosen Gehorsams würdig zu sein? Oder welche Eigenschaften muss ein Wesen besitzen um das größte oder vollkommenste Wesen zu sein? Was sind, anders gefragt, Größe oder Vollkommenheit verleihende Eigenschaften? Nun, zu den traditionellen theistischen Attributen zählen bekanntlich Eigenschaften wie Allmacht, Allwissenheit und Allgüte. Und es ist nicht unplausibel, diese Attribute als Vollkommenheit verleihende Eigenschaften zu interpretieren, so dass ein Wesen, was diese Eigenschaften nicht besitzt, kein vollkommenes Wesen ist. So werden wir etwas sagen wollen, dass ein Wesen, das manchmal ungerecht handelt, kein vollkommenes Wesen ist, so dass niemals ungerecht handeln eine Perfektion ist, die einem Wesen zukommen muss, soll es Gott sein. Ähnliches gilt plausibler Weise auch in Bezug auf epistemische Eigenschaften. Ein Wesen, das sich manchmal irrt, ist in epistemischer Hinsicht nicht vollkommen, und daher scheint eine Eigenschaft, die zu haben Irrtum ausschließt, eine Größe oder Vollkommenheit verleihende Eigenschaft zu sein. So ist nun der Gedanke naheliegend, wir könnten ausgehend vom Anselm’schen Begriff Gottes als eines Wesens, über dem Größeres nicht gedacht werden kann, mit zwingender Stringenz eine kohärente Gesamtkonzeption Gottes entwickeln, in der alle Attribute enthalten sind, die als Größe verleihende Eigenschaften sowohl notwendig als auch hinreichend für die Identität Gottes sind. Wir hätten dann, ausgehend vom Begriff des denkbar vollkommensten Wesens, eine Beschreibung entwickelt, die ein Wesen erfüllen muss, um Gott zu sein, so dass nichts, was diese Beschreibung nicht erfüllt Gott sein kann. Darüber hinaus würde gelten, dass Charakteristika, die nicht in dieser Beschreibung vorkommen notwendigerweise auch keine Charakteristika Gottes sein können. Denn diese Beschreibung enthielte ja alle und nur die Größe verleihenden Eigenschaften. Charakteristika, die in dieser Beschreibung nicht enthalten sind, würden also gar nicht zu den Größe verleihenden Eigenschaften zählen und daher nicht Charakteristika Gottes sein können. Obwohl das ein philosophisch verführerisches Bild ist, bekommen wir hier ein Problem. Denn wir hätten nach diesem Bild plötzlich nur noch das, was ich vorhin, harte oder zum harten Kern gehörige Charakteristika Gottes genannt habe. Weiche und ohne Veränderung der Referenz revidierbare Charakteristika würde es nach diesem Bild gar nicht mehr geben. Das heißt, dass wir unfähig werden, zu erklären, wie Personen oder wie Glaubensgemeinschaften unterschiedliche Konzeptionen Gottes haben können – sich auf ein und dasselbe Wesen beziehen können, obwohl sie diesem Wesen unterschiedliche Charakteristika zuschreiben. 79 Mit diesem Bild stimmt daher etwas nicht. Das Problem liegt in der verführerischen Annahme, es gäbe ausschließlich strikte logische oder semantische Beziehung zwischen den höherstufigen emergenten Eigenschaften Gottes und den niederstufigen Eigenschaften, auf denen diese basieren. Aber das ist nicht der Fall. Denn zunächst einmal ist klar, dass es unterschiedliche Intuitionen über Größe verleihende Eigenschaften geben kann. Obwohl der Begriff des denkbar vollkommensten oder des denkbar größten Wesens sicherlich sehr viele Eigenschaften als mögliche Charakteristika Gottes ausschließt, kann es an einigen Stellen eine rein semantisch unentscheidbare Frage sein, ob eine bestimmte Eigenschaft Vollkommenheit verleihend ist oder nicht. So können verschiedene religiöse oder theologische Traditionen für sich reklamieren wollen, ein Bild von Gott zu zeichnen, das seinem Begriff als einem höchst vollkommenen Wesen angemessener ist als das einer anderen Tradition. So war es etwa für Anselm selbst wie auch für viele andere mittelalterliche Denker klar, dass Gott, um als das höchst vollkommene Wesen verstanden werden zu können, notwendig leidensunfähig ist: Nach ihrer Vorstellung hat Gott keine Emotionen und insbesondere empfindet er mit den Elenden und leidenden kein Mitleid, da sie der Auffassung waren, dass Mitleiden wie jedes Leiden eine Begrenzung, eine Abhängigkeit und eben damit eine Unvollkommenheit sei. So diskutiert Anselm etwa im 8. Kapitel seines Proslogion die Frage: Wie er barmherzig und leidensunfähig ist, und er sagt dort über Gott, dass er, wenn er sich den Elenden zuwendet, keine Rührung verspürt und von keinem Mitleiden und Elend berührt wird. Neuere Theologen haben gegen diesen Bild jedoch opponiert. Sich nicht vom Schicksal der Elenden berühren zu lassen oder vielmehr von einem solchen Schicksal gar nicht berührt werden zu können schien ihnen gerade eine Unvollkommenheit zu sein: Gerade das Bild des liebenden Gottes erfordert in ihren Augen, dass Gott auch des Mitleidens fähig ist. Hier haben wir klarerweise eine erhebliche Uneinigkeit in theologischen Dingen. Trotzdem wollen wir nicht sagen, dass sich die christlichen Theologen des Mittelalters auf etwas ganz anderen beziehen als christliche Theologen des 20. Jahrhunderts, nur weil sie über die Frage der sogenannten Impassibilität Gottes uneinig sind. Gerade an diesem Beispiel können wir etwas sehr wichtiges lernen. Die Uneinigkeit über die Leidensfähigkeit Gottes hat erstens eine tiefgehende Gemeinsamkeit: Sie entspringt dem Versuch, ein angemessenes Porträt eines höchst vollkommenen Wesens zu geben. Nur vor diesem Hintergrund wird die Uneinigkeit verständlich. Zweitens ist damit klar, dass diese Uneinigkeit nicht aus irgendwelchen persönlichen Vorlieben der Theologen entspringt: Der Begriff des höchst vollkommenen Wesens ist für sie der Leitfaden für die Entwicklung ihrer verschiedenen Konzeptionen. Drittens scheint aber klar zu sein, dass die Uneinigkeit nicht behoben werden kann durch eine weitere vertiefte Diskussion der 80 Bedeutung von „vollkommen“ oder von „höchst vollkommen“. Denn was die einen als Merkmal der Unvollkommenheit sehen – das Mitleiden können – sehen die anderen gerade als Merkmal eine vollkommenen Wesens an. Und es ist daher unplausibel anzunehmen, dass die Semantik von „Vollkommenheit“ uns hier weiterhelfen könnte. Das Attribut der Impassibilität gehört also zur Anselm’schen Gotteskonzeption. Dieses Charakteristikum zählt aber zweifellos nicht zum harten Kern der Attribute Gottes. Es zählt zu einem Bereich, der revidiert werden kann, ohne dass dadurch die Referenz des Terminus „Gott“ verändert wird. Und es kann hier eine Revision stattfinden, weil Impassibilität offenbar nicht aus dem Begriff eines höchst vollkommenen Wesens erschlossen werden kann. Eine weitere Möglichkeit für unterschiedliche Gotteskonzeptionen eröffnet sich nicht angesichts der Frage, ob eine bestimmte Eigenschaft wie Impassibilität eher eine Vollkommenheit als eine Unvollkommenheit verleihende Eigenschaft ist, sondern angesichts der Frage, was dazu erforderlich ist, um höchste Vollkommenheit zu verleihen. „Bei allen anderen Dingen“, schreibt Descartes in der 5. Meditation seiner Meditationen über die Erste Philosophie, [bin] ich gewohnt [...] das Dasein vom Wesen zu unterscheiden, [und] so rede ich mir leicht ein, dass es auch vom Wesen Gottes getrennt werden könne und Gott sich so als nicht existent denken lässt. Achte ich indessen sorgfältiger darauf, so wird deutlich, dass sich das Dasein vom Wesen Gottes ebenso wenig trennen lässt, wie vom Wesen des Dreiecks, dass die Größe seiner drei Winkel zwei rechte beträgt, oder von der Vorstellung des Berges die Vorstellung des Tales. Es widerspricht sich daher ebenso sehr, sich einen Gott, d. h. ein höchst vollkommenes Wesen zu denken, dem das Dasein fehlte, d. h. dem eine gewisse Vollkommenheit mangelte, als einen Berg zu denken ohne Tal. Descartes behauptet hier, die Aussage, das höchst vollkommene Wesen existiert nicht, sei in sich selbst widersprüchlich – und zwar widersprüchlich aufgrund der Bedeutung von „höchst vollkommenes Wesen“. Einem Wesen könnten also alle Vollkommenheiten zugeschrieben werden und es wäre dennoch nicht das höchst vollkommene Wesen, wenn möglich wäre, dass es nicht existiert. Also gehört nach Descartes Auffassung Existenz zu den notwendigen Attributen eines höchst vollkommenen Wesens. Nun ist es, gelinde gesagt, äußerst umstritten, ob man Existenz überhaupt als Eigenschaft verstehen kann. Aber es gibt auch heute Philosophen, die es so sehen. Gehen wir also einmal davon aus, dass das eine verständliche Position ist. In diesem Fall ist es aber immer noch eine offene Frage, ob die Konzeption eines allmächtigen, allwissenden und allgütigen Wesens nicht die Konzeption eines höchst vollkommenen Wesens ist, wenn die Eigenschaft der Existenz nicht darin eingeschlossen ist. 81 Denn selbst wenn Existenz eine echte Eigenschaft wäre, ist damit noch nicht klar, ob sie Vollkommenheit verleiht: Denn es ist zwar zweifellos der Fall, dass ein allwissendes Wesen einem epistemisch begrenzten Wesen sehr viel voraus hat, aber zweifelhaft, ob ein existierendes Wesen hätte einem nicht-existierenden etwas voraus hat. Selbst wenn man daher die Auffassung teilen würde, dass Existenz eine echte Eigenschaft ist, kann man von Descartes Konzeption des höchst vollkommenen Wesens darin abweichen, dass man die Eigenschaft der Existenz gar nicht zu den Vollkommenheiten zählt. Eine dritte Möglichkeit unterschiedlicher Gotteskonzeptionen eröffnet sich angesichts der Möglichkeit unterschiedlicher Interpretationen der Vollkommenheit verleihenden Attribute. Zu den traditionellen theistischen Attributen Gottes gehört zum Beispiel das Attribut der Ewigkeit. Ewigkeit selbst kann aber auf verschiedene Weisen interpretiert werden: Eine Interpretation interpretiert sie so, dass Gott ewig in dem Sinne ist, dass er außerhalb der Zeit existiert, eine andere so, dass Gott in dem Sinne ewig ist, dass es keinen Zeitpunkt gibt, zu dem Gott nicht existiert. So können wir sagen, dass zwei Theologen unterschiedliche Gotteskonzeptionen haben, indem sie unterschiedliche Auffassungen darüber vertreten, was es heißt, ewig zu sein. Dennoch impliziert das nicht, dass sie auf verschiedene Objekte referieren, wenn sie von Gott sprechen. So können wir also sagen, dass der Begriff des höchst vollkommenen Wesens in verschiedenen Konzeptionen Gottes eine heuristische Funktion hat. Höchste Vollkommenheit ist eine emergente Eigenschaft und daher stellt sich die Frage, wie ein Wesen beschaffen sein muss, um als höchst vollkommenes Wesen zu gelten. Es gibt dann einen Spielraum für unterschiedliche Konzeptionen, insofern durch den Begriff der höchsten Vollkommenheit für sich betrachtet nicht zwingend entschieden werden kann, wie die Klasse der Vollkommenheit verleihenden Eigenschaft genau aussieht. Trotzdem werden einer Konzeption Gottes durch den Begriff des höchst vollkommenen Wesens ausreichend Grenzen gesetzt, um unterschiedliche Konzeptionen als eben das – als unterschiedliche Konzeptionen ein und desselben Referenten: nämlich Gottes beschreiben zu können. Wenn ich bisher von der Möglichkeit unterschiedlicher Konzeptionen Gottes gesprochen habe, ist damit freilich noch nichts über die Bewertung solcher Konzeptionen gesagt. Und damit kommen wir zu einem letzten Punkt in dieser Einleitung. Bisher hatten wir über Grenzen gesprochen, denen eine Konzeption Gottes unterliegt, um überhaupt als eine Konzeption Gottes betrachtet werden zu können. Solche Grenzen waren erforderlich, um sicherzustellen und verständlich zu machen, wie sich verschiedene Personen oder Glaubensgemeinschaften trotz unterschiedlicher Auffassungen über die Natur Gottes dennoch 82 von ein und demselben Gott sprechen. Nun gibt es aber auch noch andere Grenzen, denen jede Konzeption Gottes gehorchen muss: denn eine Konzeption Gottes muss ja auch sicherstellen, dass es überhaupt einen Referenten für die entsprechende Beschreibung geben kann. Es muss einen solchen Referenten nicht geben, aber es muss ihn geben können, damit wir sinnvoll von Konzeptionen Gottes sprechen können, welche die Natur einer möglichen Entität beschreiben. Ist eine gegebene Konzeption Gottes inkohärent, so dass es nichts geben kann, was unter die entsprechende Beschreibung fällt, dann können wir schwerlich sagen, dass jemand, der eine solche Konzeption hat, sich auf denselben Referenten bezieht, wie jemand, der eine kohärente Gotteskonzeption hat. Denn mit einer nicht kohärenten Beschreibung kann man sich ja auf gar nichts beziehen und daher kann man auch nicht sinnvoll von Koreferenz sprechen, wenn eine Beschreibung kohärent, die andere jedoch inkohärent ist. Jede Analyse und Darstellung der Natur Gottes muss daher sicherstellen, dass die entwickelte Beschreibung kohärent ist. Und eben das ist ein wesentlicher und der wahrscheinlich interessanteste Punkt in der Analyse der göttlichen Attribute. Es gibt hier insgesamt drei Problemfelder: (1) Sind die traditionellen theistischen Attribute miteinander kompatibel? Manche haben hier unüberwindliche Schwierigkeiten gesehen. Nehmen Sie zum Beispiel das Attribut der Allmächtigkeit und das der moralischen Vollkommenheit oder der Allgüte. Ein moralisch vollkommenes Wesen ist natürlich ein Wesen, das niemals etwas schlechtes tut. Aber das ist plausibler Weise nicht hinreichend für moralische Vollkommenheit: denn ein Wesen das niemals etwas schlechtes tut, scheint in moralischer Hinsicht weniger vollkommen zu sein, als ein Wesen, das unmöglich etwas schlechtes tun kann und daher notwendiger Weise, wann immer es handelt, gut handelt. Das, könnte man aber meinen, ist nicht verträglich mit der Allmacht Gottes. Denn wie kann Gott allmächtig sein, wenn er gewisse Dinge unmöglich tun kann – wobei es sich dabei noch um Dinge handelt, die wenigstens die meisten Menschen fähig sind zu tun? (2) Ein weiteres Problemfeld ist das der internen Kohärenz der einzelnen Attribute selbst. Betrachten wir etwa Allmacht. Nach einer unmittelbar intuitiven Lesart könnte man ja meinen, dass ein Wesen genau dann allmächtig ist, wenn es nichts gibt, was es nicht tun kann. Es ist aber andererseits sofort einleuchtend, dass es einiges gibt, was nicht getan werden kann, weil es einfach unmöglich ist, so etwas zu tun. So kann niemand einen logisch unmöglichen Weltzustand realisieren und zwar einfach deshalb weil er logisch unmöglich ist. Und ebenso scheint es auch nicht möglich zu sein, etwas das in der Vergangenheit passiert ist, nachträglich abzuändern. Wenn das aber der Fall ist, dann kann es kein Wesen geben das 83 allmächtig ist, weil es eben Grenzen für jede Macht gibt – und eine begrenzte Macht scheint eben keine Allmacht zu sein. (2) Neben dem Problem der Kohärenz der Attribute Gottes untereinander und der inneren Kohärenz der Attribute selbst, stellt sich das Problem der Kohärenz der göttlichen Attribute mit evidenten Fakten über die Welt. Das hier bekannteste Problem ist natürlich das sogenannte Theodizeeproblem: Kann Gott die Attribute, die ihm zugeschrieben werden überhaupt haben angesichts der Übel in der Welt. Eine schon auf Epikur zurückgehende Ansicht ist die, dass das nicht sein kann. Denn wenn es Übel in der Welt gibt, dann zeigt das entweder, dass Gott nicht allmächtig ist, oder es zeigt, dass er nicht allgütig ist, oder es zeigt, dass er weder allmächtig, noch allgütig ist. In allen drei Fällen haben wir es mit dem Problem der Kohärenz zu tun. Lässt sich Kohärenz nicht gewinnen, so kann es keinen Referenten solcher Konzeptionen geben. Sie sehen daher wie wichtig die Diskussion göttlicher Attribute ist. Man kann aber auch hier ermessen wie wichtig die Frage nach möglichen Revisionen in der Konzeption Gottes ist – Revisionen bei denen dennoch die Referenz erhalten bleibt. Denn nehmen wir an, ein bestimmtes Attribut Gottes sei in der Tat nicht kohärent analysierbar. Das würde nur dann ein atheistisches Argument ergeben, wenn dieses Attribut eine harte Eigenschaft ist. Wenn es dagegen eine weiche Eigenschaft ist, können wir die Zuschreibung dieses Attributs aufgeben, ohne damit die theistische Sicht aufgeben zu müssen. Die Diskussion über die Attribute Gottes ist äußerst komplex, schon deshalb weil sie sich, wie gesehen, auf mehrere Problembereiche erstreckt. Ich möchte mich im folgenden exemplarisch nur mit der Darstellung des Attributs der Allmacht und den damit zusammenhängenden Problemen, sowie mit dem Attribut der Allwissenheit beschäftigen. Die anderen Gott zugeschriebenen Attribute werden uns dann später bei der Diskussion der theistischen und atheistischen Argumente beschäftigen. So zum Beispiel die angebliche göttliche Eigenschaft der Existenz im Zusammenhang mit dem ontologischen Gottesbeweis und das Problem der Kohärenz der göttlichen Attribute mit der Tatsache der weltlichen Übel im Zusammenhang mit dem Problem der Theodizee. 84 b) Allmacht (Omnipotenz) Zu den Gott traditionell zugeschriebenen Attributen zählt das der Omnipotenz oder Allmacht. Auch das Apostolische Glaubensbekenntnis schreibt Gott Allmacht zu. Es beginnt ja mit den Worten „Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde“. Es ist dennoch darauf hinzuweisen, dass die Konzeption Gottes als eines omnipotenten Wesens, eine theologisch-philosophische Rekonstruktion der impliziten Metaphysik des Christentums oder der impliziten Metaphysik theistischer Religionen ist. Daher ist es immer eine Frage, ob die philosophisch-theologische Konzeption der Omnipotenz genau das trifft, was etwa die christliche Glaubensgemeinschaft meint, wenn sie von Gott dem allmächtigen spricht. Rekonstruktionen können ja den Sinn des rekonstruierten Glaubens auch verfehlen. Und daher kann es durchaus sein, dass eine philosophisch-theologische Gotteslehre problematisch ist, ohne dass dadurch auch der Glaube, den diese Lehre zu rekonstruieren beansprucht, problematisch ist. Es ist allerdings ebenso zu beachten, dass der von einer Gemeinschaft geteilte Glaube sicherlich nicht vollständig bestimmt ist. Wir haben deshalb mit Vagheiten zu rechnen – und wir können philosophisch-theologische Rekonstruktionen zum Teil auch als Vorschläge auffassen, wie solche Vagheiten am besten beseitigt werden. So mag etwa die Rede von Gott, dem allmächtigen, für sich genommen zu vage sein, als dass wir genau und unmissverständlich sagen könnten, was der intendierte Gehalt der Rede von der Allmacht ist. Daher kann eine Rekonstruktion auch als ein Stück Selbstaufklärung des Glaubens verstanden werden. Eine philosophisch-theologische Gotteslehre will also einerseits beanspruchen den Glauben, dessen Gehalt sie rekonstruieren will, auch zu treffen, andererseits wird sie aber auch beanspruchen wollen, diesen Gehalt auf eine Weise explizit zu machen, dass dadurch klar wird, worin der rekonstruierte Gehalt des Glaubens eigentlich besteht. Betrachten wir vor diesem Hintergrund die religiöse Rede von Gott als dem Allmächtigen. Welche Konzeption von Gott hat eine Glaubensgemeinschaft, welche an Gott als dem Allmächtigen glaubt oder welche ihrem Glauben selbst unter anderem dadurch Ausdruck gibt, dass sie Gott als den Allmächtigen bezeichnet? Die Antwort scheint hier unmittelbar auf der Hand zu liegen – und zwar allein aufgrund der grammatischen Konstruktion des Wortes „Allmacht“. Ein allmächtiges Wesen scheint aber klarerweise ein Wesen zu sein, das jeder Tat mächtig ist oder ein Wesen zu sein, welches Macht über alles hat, dem also alles zu tun zu Gebotes steht. Die religiöse Rede von der Allmacht scheint also klarerweise im Sinne der 85 Omnipotenz übersetzt werden zu müssen, und Allmacht ist daher strukturell genauso wie Allwissenheit (omniscientia) zu analysieren zu sein. Aber ist das wirklich so eindeutig wie es scheint? Denn es könnte sein, dass wir den Gläubigen, der von Gott als dem allmächtigen spricht, anders verstehen müssen: Er will damit vielleicht nicht sagen wollen, dass Gott allmächtig ist, sondern dass Gott maximal mächtig oder dass er unüberbietbar mächtig ist. Beides ist offenbar nicht dasselbe. Denn maximale Mächtigkeit erfordert zumindest intuitiv gesehen nicht so etwas wie Allmächtigkeit. Interpretieren wir die religiöse Rede von Gott als dem Allmächtigen in diesem Sinne, dann werden wir sagen müssen, dass der Gläubig an ein Wesen glaubt, das, wenn es existiert, von keinem anderen an Macht übertroffen wird und dem kein anderes Wesen an Macht gleichkommt. Anders als mit dem Begriff der Omnipotenz würden wir die religiöse Rede von der Allmächtigkeit Gottes dann in einem komparativen Sinn interpretieren. Und in diesem komparativen Sinn verstanden würde es Sinn machen Gott als das allmächtige Wesen anzusprechen, zugleich aber einzuräumen, dass es Dinge geben kann, die selbst Gott nicht zu tun oder zu bewirken vermag. Wie steht es aber mit dem Begriff der unüberbietbaren Mächtigkeit? Wenn Gott als das maximal mächtige Wesen verstanden wird, dann wird er verstanden als das Wesen, das, wenn es existiert, von keinem anderen an Macht übertroffen wird. Aber das scheint für unüberbietbare Mächtigkeit noch nicht hinreichend zu sein. Wir müssen auch sagen, dass er dann als ein Wesen verstanden wird, das von keinem anderen in seiner Macht übertroffen werden kann. Insofern scheint maximale Mächtigkeit unüberbietbare Mächtigkeit zu implizieren. Sobald wir diesen Schritt tun, drängt sich uns unwillkürlich aber wieder der Gedanke der Omnipotenz auf. Denn wie, fragen wir uns, könnte ein Wesen unüberbietbar mächtig und dennoch nicht omnipotent sein? Denn ein Wesen, das omnipotent ist, würde doch offenbar jedes andere Wesen an Macht übertreffen. Also müssen wir doch sagen, dass unüberbietbar mächtig sein und omnipotent sein ein und dieselbe Eigenschaft sind; und damit würde maximale Mächtigkeit Omnipotenz zur Voraussetzung haben und somit hätten wir gar nicht zwei verschiedene Interpretationen der religiösen Rede geliefert, sondern nur zwei Aspekte ein und derselben Interpretation herausgestellt. Das ist aber nur eine Richtung, in welche unserer Intuitionen uns drängen können. Eine andere ist diese. Es ist ja durchaus nicht ausgemacht, ob irgendein Wesen omnipotent sein kann. Vielleicht ergibt sich aus dem Nachdenken über Omnipotenz, dass der Begriff der Omnipotenz inkohärent ist, so dass Omnipotenz unmöglich realisiert sein kann. Das würde aber klarerweise nicht verhindern, dass ein Wesen denkbar ist, das maximal oder unüberbietbar mächtig ist. Denn wenn Omnipotenz unmöglich realisiert sein kann, kann Gott unüberbietbar mächtig sein, obwohl auch Gott nicht omnipotent ist. 86 Die Diskussionssituation über das Attribut der Allmacht ist also ziemlich komplex. Wir sollten daher mit einer Analyse der Allmacht beginnen. Wie sollte man dabei vorgehen? Nun, die Sache scheint auf der Hand zu liegen. Sobald wir uns darüber verständigt haben, was Macht ist oder was es heißt mächtig zu sein, sollte der Begriff der Allmacht überhaupt keine Schwierigkeiten mehr bereiten. So gesehen scheint die Sache nicht viel anders zu liegen als beim Begriff der Allwissenheit. Gehen wir also einmal so vor. Was ist Macht oder unter welchen Bedingungen hat ein Wesen Macht? Macht erfordert offenbar mindestens zwei Komponenten. Erstens Fähigkeiten etwas zu tun oder etwas zu bewirken, zweitens Gelegenheiten für die Ausübung solcher Fähigkeiten. Diese zwei Komponenten ergeben sich, wenn wir einmal darüber nachdenken, wodurch Macht eingeschränkt wird oder unter welchen Bedingungen jemand machtlos oder ohnmächtig (ohne Macht) ist. Wenn Sie eine Segeltour machen und ihr Schiff kentert und wenn sie nicht die Fähigkeit haben zu schwimmen, sind sie der Situation ausgeliefert: Sie haben nicht die Macht, sich über Wasser zu halten, weil Sie nicht die Fähigkeit haben zu schwimmen. Wenn Sie aber schwimmen können, sich aber durch irgendeinen dummen Zufall in der Takelage des Schiffs so verheddert haben, dass Sie ihr Arme und Beine nicht mehr bewegen können, sind sie durch externe Faktoren an der Ausübung Ihrer Fähigkeit zu schwimmen gehindert. Auch in diesem Fall sind sie der Situation ausgeliefert und ohne machtlos: Sie können nichts tun, um sich zu retten; aber diesmal nicht, weil es Ihnen an einer besonderen Fähigkeit fehlte, sondern weil sie an der Ausübung Ihrer Fähigkeit gehindert werden. Wenn wir nun unter einer Gelegenheit nicht nur Umstände verstehen wollen, die der Ausübung einer Fähigkeit förderlich sind, sondern umfassender Umstände verstehen, welche die Ausübung einer Fähigkeit zulassen, dann ist das letztere ein Beispiel für Machtlosigkeit aufgrund fehlender Gelegenheit. Wir müssen aber auch noch weitere Dinge bedenken. Ein weiterer Punkt, der für die Analyse von Mächtigkeit interessant sein könnte ist der, dass außer externen auch interne Hindernisse für die Ausübung einer Fähigkeit bestehen können. Wenn ein ausgezeichneter Schwimmer in einer Notsituation wie der eben beschriebenen in Panik gerät, kann er nicht tun, was er unter normalen Umständen tun kann – lange und ausdauernd schwimmen. Oder wenn jemand extreme Prüfungsangst hat, kann es passieren, dass er in einer Prüfung nicht sagen kann, was er weiß – wobei sagen können, was man weiß, eine Fähigkeit ist, die er wie jeder andere Mensch auch besitzt. Damit hätten wir drei Erklärungen für die Limitation von Mächtigkeit gefunden, so dass wir zu dem Vorschlag kommen können: 87 Ein Wesen ist genau dann in seiner Macht limitiert ist, wenn ihm Fähigkeiten fehlen oder wenn es keine Gelegenheit für die Ausübung seiner Fähigkeiten hat oder wenn es interne Hindernisse gibt, welche verhindern, dass es seine Fähigkeiten immer ausüben kann. Daraus würde sich dann für den Begriff einer unlimitierten Macht ergeben, dass die Macht eines Wesens genau dann unlimitiert ist, wenn ihm keine Fähigkeiten fehlen und wenn es immer Gelegenheit für die Ausübung seiner Fähigkeiten hat und wenn es keine internen Hindernisse gibt, durch die es in der Ausübung seiner Fähigkeiten verhindert werden könnte. Ist diese Analyse befriedigend? Ist sie befriedigend als eine Analyse von Allmacht? Wenn wir diese Analyse annehmen, identifizieren wir Allmacht mit unlimitierter Macht: Gott ist dann allmächtig, weil seine Macht unlimitiert ist, und dies besagt soviel wie: Gott kann alles tun oder es gibt nichts, was Gott nicht tun kann. Nun hat die Identifikation von Allmacht mit unlimitierter Macht sicherlich eine hohe Anfangsplausibilität. Denn wenn es etwas gibt, was Gott nicht tun kann, dann ist er in seiner Macht beschränkt – und wie kann ein in seiner Macht beschränktes Wesen allmächtig sein. Wenn es etwas gäbe, was auch Gott nicht tun kann – lässt sich dann nicht ein Wesen denken, das eben alles das, was Gott tun kann, auch tun kann, und das darüber hinaus auch noch das tun kann, was Gott nicht tun kann? Die Plausibilität dieser Analyse von Allmacht ergibt sich also aus der Intuition, dass nur ein allmächtiges Wesen ein unüberbietbar mächtiges Wesen ist und dass jede Limitation von Macht unüberbietbare Mächtigkeit ausschließt, so dass Allmacht schlicht unlimitierte Macht heißt. Aber ist das richtig? Können wir uns auf diese Intuitionen verlassen? Hier liegt ein Problem. Ist denn jede Limitation von Handlungsmöglichkeiten eo ipso eine Limitation von Macht? Impliziert also ein Satz der Form „A kann nicht H tun“, dass A in seiner Macht limitiert ist – einfach deshalb, weil es etwas – H – gibt, was A nicht tun kann. Das scheint nicht so zu sein. Denn nehmen wir an, die Beschreibung von H ist die Beschreibung einer logisch unmöglichen Handlung. Betrachten wir ein Beispiel. Wenn ich jemandem die Aufgabe stelle, zu beweisen, dass 2 + 4 = 13 ist, dann stelle ich eine Aufgabe, die unmöglich erfüllt werden kann. Denn es ist offenbar nicht möglich etwas zu beweisen, was falsch ist. Denn das hießt ja demonstrieren, dass etwas Falsches wahr ist. Eine solche Aufgabe kann also unmöglich gelöst werden. Würden wir nun sagen wollen, dass eine Limitation von Macht ist, wenn man eine solche Aufgabe nicht lösen kann? Das wäre natürlich vollkommen ungereimt. Und zwar deshalb, weil ein Wesen offenbar unüberbietbar mächtig sein kann, obwohl es keinen Beweis für 2 + 4 = 13 vorbringen kann. Da nämlich kein Wesen denkbar ist, das eine solche Aufgabe lösen kann, kann man daraus, dass Gott sie nicht lösen kann nicht schließen, dass er nicht 88 unüberbietbar mächtig ist. Das würde uns zu einer substantiellen Einschränkung in der Definition der Allmacht führen. Anstatt zu sagen, dass ein Wesen genau dann allmächtig ist, wenn es keine Handlung H gibt, die es nicht tun kann, würden wir sagen: Ein Wesen ist genau dann allmächtig, wenn es keine logisch mögliche Handlung H gibt, die es nicht tun kann. Dass die Einschränkung auf das Mögliche keine Einschränkung der göttlichen Macht impliziert hat Thomas von Aquin in seiner Summa Theologica herausgestellt. Ich zitiert aus Teil I, Quaestio 25, Artikel 3: Im allgemeinen bekennen alle, dass Gott allmächtig ist. Den Grund aber der Allmacht anzugeben, scheint schwierig. Denn es kann zweifelhaft sein, was unter dieser Aussage verstanden ist, wenn es heißt: Gott könne alles. Da „Vermögen“ in Bezug auf mögliche Dinge ausgesagt wird, so kann man bei richtigem Zusehen den Satz „Gott kann alles“ nicht richtiger auffassen als dahin: Er kann alles, was möglich ist. Und deswegen wird Er allvermögend genannt. Nach dem Philosophen wird nun das Mögliche doppelt genommen; einmal mit Bezug auf ein Vermögen; so heißt das, was dem menschlichen Vermögen untersteht, menschenmöglich. Man kann nicht sagen, dass Gott allvermögend genannt wird, weil Er alles vermag, was der geschaffenen Natur möglich ist, da die göttliche Allmacht sich auf mehr erstreckt. Wenn man aber sagt, Gott ist allmächtig, weil Er alles kann, was in seiner Macht steht, so hat man bei der Erklärung der Allmacht sich im Kreise bewegt. Denn das wäre nichts anderes, als wenn man sagt: Gott ist allmächtig, weil Er alles kann, was Er kann. Es bleibt also nur übrig Gott allvermögend zu nennen, weil Er alles vermag, was schlechthin möglich ist. [...] Es wird aber etwas schlechthin möglich oder unmöglich genannt nach dem Verhältnis der Begriffe, und zwar möglich, sofern die Satzaussage dem Satzgegenstand nicht widerspricht, z. B. Sokrates sitzt; schlechthin unmöglich aber, wenn die Satzaussage dem Satzgegenstand widerspricht, z. B. der Mensch ist ein Esel. Thomas sagt also, dass Gott allvermögend oder allmächtig in dem Sinne ist, dass er alles vermag, was schlechthin möglich ist. Mit schlechthin möglich meint Thomas absolute oder nicht-relative Möglichkeit. Eine relative Möglichkeit – eine, wie Thomas sagt, Möglichkeit in Bezug auf ein Vermögen – ist zum Beispiel eine Möglichkeit für Menschen. Thomas hebt nun hervor, dass in der Definition der Allmacht von Möglichkeit im absoluten und nicht im relativen Sinn die Rede sein muss. Denn als allvermögend kann das, was Gott vermag, sich nicht in dem erschöpfen, was endliche Wesen zu tun vermögen. Wir dürfen göttliche Allmacht aber auch nicht als das Vermögen definieren, alles zu tun, was für Gott zu tun möglich ist, da diese Definition zirkulär und damit wertlos wird. Daher ist Gott allmächtig zu nennen, weil er alles vermag, was schlechthin, d. i. absolut möglich ist. 89 Von der zunächst naheliegenden Vorstellung, dass Allmacht als unlimitiertes Tun-Können verstanden werden muss, sind wir nun zu der Vorstellung gelangt, dass Allmacht bedeutet, alles tun können, was zu tun möglich ist. Unmögliche Handlungen, wie die Handlung für die Aussage 2 + 4 =13 einen Beweis zu geben, werden dadurch ausgeschlossen. Und das zurecht. Denn die Restriktion auf mögliche Handlungen ist offenbar keine Limitation von Macht – da ein Wesen, das alle möglichen Handlungen auszuüben vermag, zweifellos an Macht nicht überboten werden kann. Also könnte man als den nun zu diskutierenden Vorschlag von Allmacht die folgende Definition ansehen: X ist genau dann allmächtig, wenn X fähig ist, jede logisch mögliche Handlung auszuführen. Aber auch diese Definition ist problematisch und nicht wirklich befriedigend. Es gehört zur Konzeption Gottes, dass Gott ein unkörperliches Wesen ist. Das impliziert, dass Gott keine körperlichen Fähigkeiten hat. Gott kann also beispielsweise nicht Radfahren, da Radfahren die Bewegung von Beinen einschließt, Gott aber keine Beine hat, da er ein unkörperliches Wesen ist. Gott kann sich auch nicht an der Nase kratzen – einfach deshalb, weil Gott keine Nase hat, da er ein unkörperliches Wesen ist. Sollten wir deshalb sagen, dass Gott nicht allmächtig oder nicht unüberbietbar mächtig ist? Nach der soeben vorgeschlagenen Definition müssten wir das tun. Denn offenbar sind Radfahren und Sich an der Nase kratzen logisch mögliche Handlungen – Handlungen die manche Menschen manchmal ausüben. Wir würden also zu der Auffassung kommen, das ein Wesen, das sich nicht an der Nase kratzen kann, nicht allmächtig ist. Und das hat irgendwie auch eine gewisse Plausibilität. In der eben zitierten Stelle sagt Thomas, dass man Gott nicht allvermögend nennt, weil er alles vermag, was der geschaffenen Natur möglich ist, da die göttliche Macht sich auf mehr erstreckt. Die Vorstellung scheint hier die zu sein, dass die göttliche Macht die Macht der geschaffenen Natur in sich schließt und darüber hinaus noch weitere Vermögen beinhaltet, welche über die Macht der geschaffenen Natur hinausgehen. Nun ist aber Radfahren und sich an der Nase kratzen etwas, das die geschaffenen Naturen vermögen, was aber Gott nicht vermag. Also, so scheint es, ist er nicht allmächtig. Andererseits ist diese Vorstellung aber auch irgendwie ungereimt. Wenn wir denken, dass Gott nicht allmächtig sein könne, wenn es eine Handlung H gibt, die zwar ein Mensch, aber nicht Gott ausüben kann, lassen wir uns von der Vorstellung leiten, dass ein allmächtiges Wesen in dem Sinne allmächtig ist, dass seine Macht alle möglichen Fähigkeiten in sich schließt und damit alle Fähigkeiten in sich schließt, über die in ihrer Macht begrenzte Wesen verfügen. Aber das scheint bei näherer Betrachtung recht 90 unplausibel zu sein. Denn damit würden wir unterstellen, dass so etwas wie sich an der Nase kratzen zu können, eine Größe verleihende Eigenschaft ist. Und das würde implizieren, dass das Attribut der Allmacht mit dem Attribut der Unkörperlichkeit logisch unverträglich wäre, so dass wenn irgendetwas allmächtig ist, es dann ein körperliches Wesen ist. Aber das ist offenbar falsch. Denn es ist gerade die Körperlichkeit des Menschen, durch die seine Macht in vielerlei Hinsicht limitiert ist. Menschliche Individuen entstehen und vergehen, sie können krank werden, sie sind schutzbedürftig, sie brauchen eine ihnen günstige Umwelt, um gedeihen zu können, usw. – kurz Menschen sind, weil sie Organismen oder körperliche Wesen sind, auch wesentlich abhängige Wesen. Daher kann Körperlichkeit keine Vollkommenheit verleihende Eigenschaft und auch keine notwendige Bedingung für Allmacht sein. Und daher kann auch eine Fähigkeit wie sich an der Nase kratzen zu können keine Fähigkeit sein, durch die unüberbietbare Mächtigkeit konstituiert wird. Unsere Intuitionen treiben uns hier also in zwei entgegengesetzte Richtungen. Auf der einen Seite ist es plausibel anzunehmen, dass die Macht eines allmächtigen Wesens die Macht aller nicht allmächtigen Wesen umfasst. Auf der anderen Seite ist es plausibel anzunehmen, dass die Macht eines allmächtigen Wesens diejenigen Fähigkeiten nicht allmächtiger Wesen nicht umfasst, deren Besitz eine Folge ihrer Unvollkommenheit ist. Auf der einen Seite ist also unsere Intuition die, dass einem Wesen, das etwas nicht kann, damit auch eine Fähigkeit fehlt – wobei wir das Fehlen einer Fähigkeit als einen Mangel an Fähigkeit verstehen. Auf der anderen Seite drängt uns unsere Intuition dahin, dass etwas nicht tun können nicht eo ipso ein Mangel an Fähigkeit ist, weil „X kann nicht H tun“ nur dann „X mangelt es an der Fähigkeit H zu tun“ impliziert, wenn H tun können irgendwie bedeutsam oder Vollkommenheit verleihend ist. So wollen wir beispielsweise nicht sagen wollen, dass Gott unvollkommen ist, weil er sich nicht irren kann. Wir wollen nicht sagen, dass ihm, weil er sich nicht irren kann, eine Fähigkeit oder eine Vermögen fehlt, welches Menschen haben.4 Nun stellt sich die Frage, wie wir weitergehen können und ob wir überhaupt weitergehen können. Klar ist nur, dass die vorgeschlagene Definition der Allmacht unbefriedigend ist. Und wir würden auch nicht weiter kommen, wenn wir sie etwa so modifizieren würden, dass wir Klasse der Handlungen, die ein Wesen auszuführen fähig sein muss, um als allmächtig zu gelten, weiter einschränkten. Denn jede Einschränkung wird unweigerlich die Intuition auf den Plan rufen, dass damit eben 4 Der konzeptuell wichtige Punkt ist hier, dass „nicht fähig sein zu tun“ nicht identisch ist mit „unfähig sein zu tun“. Unfähigkeit ist ein Mangel, aber „nicht die Fähigkeit haben X zu tun“ muss nicht unbedingt ein Mangel sein. Wenn das soweit richtig ist, so folgt daraus, dass allmächtig oder unüberbietbar mächtig zu sein nicht einschließt alles tun zu können, was getan werden kann oder jede denkbare Fähigkeit besitzen. 91 Macht limitiert wird: denn etwas nicht tun können, was möglich ist, scheint limitierend zu sein. Wenn wir aber die Einschränkung unter Zuhilfenahme der Vorstellung vornehmen, dass nicht alles Tun-Können eine Macht verleihende Fähigkeit ist, wird die ganze Angelegenheit zirkulär, wenn nicht tautologisch. Denn zu sagen, dass ein allmächtiges Wesen alle Handlungen auszuführen fähig ist, die ausführen zu können eine machtverleihende Fähigkeit ist, würde nichts anderes besagen als dass einem allmächtigen Wesen keine machtverleihende Fähigkeit fehlt, und das würde besagen, dass ein allmächtiges Wesen alles tun kann, was ein allmächtiges Wesen tun kann. Und diese Tautologie ist wie jede Tautologie offenbar wenig erklärungsstark. Wir sind also in eine Sackgasse geraten. Wenn man nun nach einem Ausweg sucht, ist es sinnvoll zu überlegen, was wir bei unserem Versuch einer Definition der Allmacht immer vorausgesetzt haben. Bisher haben wir immer versucht, Macht und damit auch Allmacht mit Hilfe von „Tun-Können“ zu definieren. Die Frage war immer: was muss ein Wesen alles tun können, um als allmächtig zu gelten. Und die Antwort schien dann einfach auf der Hand zu liegen: alles, was zu tun möglich ist. Macht lässt sich aber auch anders analysieren. Anstatt den Begriff des Tun-Könnens zur Hilfe zu nehmen, können wir Macht auch mit Hilfe des Begriffs des Bewirken-Könnens analysieren. Warum das naheliegend ist, können wir uns zunächst an ganz irdischen Dingen klar machen. Denken wir etwa an einen an den Rollstuhl gefesselten General, der seiner Truppe den Angriff auf die gegnerischen Stellungen befiehlt. Als Befehlshaber hat dieser General Macht und ist sicherlich mächtiger als jeder seiner Soldaten. Und das obwohl er selbst nicht das tun kann, was seine Soldaten tun. Er selbst kann, weil an den Rollstuhl gefesselt, die gegnerischen Truppen sicherlich nicht angreifen. Er kann aber dennoch bewirken, dass die gegnerischen Truppen angegriffen werden. Die Einschränkungen denen er unterliegt – Umstände die verhindern, dass er bestimmte Dinge tun kann – sind also nicht eo ipso auch Einschränkungen für das, was er bewirken kann. Wenn Thomas an der zitierten Stelle sagt, dass Gott alles kann, was möglich ist, so hat er offenbar eben dies im Sinn. Er will nicht sagen, dass Gott alles tun kann, was zu tun möglich ist, sondern, dass er alles bewirken kann, was zu bewirken möglich ist. Das geht hervor aus seiner Erklärung der absoluten Möglichkeit. Absolut oder schlechthin möglich, sagt er, wird etwas genannt nach dem Verhältnis der Begriffe – etwas ist absolut möglich, wenn die Satzaussage dem Satzgegenstand nicht widerspricht. Sein Beispiel dafür war „Sokrates sitzt“. Nun ist „Sokrates sitzt“ sicherlich nicht etwas, was Gott tun kann, genauso wenig wie „Sokrates hat eine hässliche Nase“ etwas ist, was Gott tun kann. Weil es sich aber um mögliche Sachverhalte handelt, handelt es sich um etwas, das Gott bewirken kann, wenn er allmächtig 92 ist: Gott kann bewirken, dass Sokrates sitzt, und Gott kann bewirken, dass Sokrates eine hässliche Nase hat. Thomas Beispiel für etwas schlechthin Unmögliches ist „Der Mensch ist ein Esel.“ Etwas schlechthin oder absolut Unmögliches kann von Gott nicht bewirkt werden. D. h. Gott kann nicht bewirken, dass Menschen Esel sind. Aber das ist keine Einschränkung seiner Macht, da der Begriff des Bewirkens von etwas absolut Unmöglichem, selbst widersprüchlich ist. Um das klar zu stellen und unsere modalen Intuitionen ein wenig zu festigen können wir „Es ist möglich, dass P“ als „Es gibt eine mögliche Welt, in der der Sachverhalt P besteht“ paraphrasieren, „Es ist unmöglich, dass P“ als „Es gibt keine mögliche Welt, in welcher der Sachverhalt P besteht“ und „Es ist notwendig, dass P“ als „Der Sachverhalt P besteht in allen möglichen Welten.“ Wenn wir nun sagen, Gott kann bewirken, dass P, dann heißt das soviel wie „Es gibt eine mögliche Welt, in der der Sachverhalt P besteht“. Wenn aber P ein unmöglicher Sachverhalt ist – ein Sachverhalt, der in keiner möglichen Welt besteht – dann ist es eine glatte Kontradiktion zu sagen, Gott kann bewirken, dass P. Denn das hieße ja: „Es gibt eine mögliche Welt, in der P, und es gibt keine mögliche Welt, in der P.“ Indem wir den Begriff des Tun-Könnens fallen lassen und den des Bewirken-Könnens einführen, bekommen wir eine kraftvolles uns sehr viel besser zu handhabendes Analyseinstrument in die Hand. Denn müssen wir nicht mehr über Handlungen reden, sondern können über Sachverhalte – propositionale Entitäten – reden, die entweder bestehen oder nicht bestehen. Sehen wir zu, ob wir damit weiterkommen. Wenn wir von Thomas ausgehen könnten wir Allmacht nun als eine Fähigkeit mögliche Sachverhalte zu bewirken verstehen. Und Gott wäre dann allmächtig, insofern es keinen möglichen Sachverhalt gibt, den er nicht bewirken kann. Unmögliche Sachverhalte, Sachverhalte also, die in keiner möglichen Welt bestehen, sind Sachverhalte, die logisch unmöglich bewirkt werden können, und daher ist es keine Limitation von Macht, wenn man sagt, dass Gott nicht bewirken kann, dass 2 + 4= 13. Betrachten wir nun, um diese Analyse zu erproben, das Problem, das wir eben hatten. Gott hatten wir gesagt kann sich nicht an der Nase kratzen. Sich an der Nase kratzen ist jedoch eine mögliche Handlung, und daher bekamen wir ein ernsthaftes Problem. Warum kann sich Gott nicht an der Nase kratzen? Einfach deshalb weil er keine Nase hat. Und mehr noch: Gott ist essentiell unkörperlich. Das heißt es ist notwendig wahr, dass er keine körperlichen Eigenschaft hat, und folglich notwendig war, dass er keine Nase hat. Der Sachverhalt „Gott kratzt sich an der Nase“ ist daher ebenso unmöglich wie der Sachverhalt „Ein Wesen das keine Nase hat kratzt sich an der Nase.“ Also kann es Gott nicht bewirken, dass Gott sich an der Nase kratzt. Aber das ist nun keine Limitation seiner Macht, da Macht eben ein Bewirken-Können ist. Dagegen ist der 93 Sachverhalt „Sokrates kratzt sich an der Nase“ möglich, und Gott kann bewirken, dass Sokrates sich an der Nase kratzt. Auf diese Weise wird das Problem elegant gelöst. Denn beachten Sie: Unser Problem entstand daraus, dass Sich an der Nase kratzen eine mögliche Handlung ist, und dabei eine Handlung, die Menschen, aber nicht Gott ausüben können. Der Sachverhalt „Gott kratzt sich an der Nase“ ist aber ein Sachverhalt der nicht bestehen kann. Deshalb kann nicht nur Gott, sondern auch kein anderes Wesen bewirken, dass Gott sich an der Nase kratzt. Und folglich kommt uns unser Intuition nicht mehr in die Quere: Dass Gott unüberbietbar mächtig ist, kann nun nicht mehr problematisch sein, da wir nichts identifiziert haben, was zwar Menschen, aber nicht Gott tun kann. Ein weiterer Punkt ist der, dass es aber auch nicht möglich ist, notwendige Sachverhalte hervorzubringen. Der Sachverhalt etwa, dass alle Vierecke vier Seiten haben, ist ein notwendiger Sachverhalt – Vierecke haben in jeder möglichen Welt vier Seiten. Was heißt es nun zu sagen ein Akteur A kann einen notwendigen Sachverhalt S bewirken oder hervorbringen. Es heißt, dass es möglich ist, dass (1) A bringt S hervor, und (2) hätte A nicht gehandelt, würde S nicht bestehen. Nun ist aber ein notwendiger Sachverhalt ein Sachverhalt der in allen möglichen Welten besteht, ein Sachverhalt also, der besteht egal, was sonst noch der Fall ist oder geschieht – ein Sachverhalt also, der besteht egal ob irgendjemand irgendetwas tut oder nicht tut. Die zweite Bedingung für eine mögliche Hervorbringung notwendiger Sachverhalte ist also unerfüllbar. Folglich ist es nicht möglich, notwendige Sachverhalte hervorzubringen. Allmacht kann daher nicht in der Macht bestehen, alle möglichen Sachverhalte hervorzubringen oder zu bewirken. Denn jeder notwendige Sachverhalt ist auch ein möglicher Sachverhalt. Allmacht so verstanden – als Macht alle möglichen Sachverhalte hervorzubringen – ist klarerweise ein inkohärenter Begriff. Wir können, so weit wie wir bisher sind, aber trotzdem Kohärenz bewahren, solange wir Allmacht im Sinne unüberbietbarer oder maximaler Macht verstehen. Denn da notwendige Sachverhalte ebenso wie unmögliche Sachverhalte, nicht hervorgebracht oder bewirkt werden können, kann es nichts geben, was ein Wesen an Macht übersteigt, welches alle möglichen Sachverhalte hervorbringen kann, die nicht notwendig sind. Wir könnten also sagen: X ist allmächtig/maximal mächtig genau dann, wenn X jeden Sachverhalt S hervorbringen oder bewirken kann, der möglich aber nicht notwendig ist. Ist das eine kohärente Definition von Allmacht? Es gibt ein berühmtes Problem durch das die Kohärenz des Begriffs der Allmacht überhaupt in Frage gestellt wird. Dabei handelt es sich um ein Paradoxon, aus dem hervorgehen soll, dass Allmächtigkeit unmöglich instanziiert sein 94 kann, dass es als keine mögliche Welt gibt, in der irgendetwas Allmacht genießt. Das ist das sogenannte Paradox des Steins. In der von Wade Savage vorgestellten Version lautet es so: (1) Entweder kann Gott einen Stein hervorbringen den Er nicht heben kann, oder er kann einen Stein, den er nicht heben kann, nicht hervorbringen. (2) Wenn Gott einen Stein hervorbringen kann, den er nicht heben kann, ist Er nicht allmächtig (denn er kann den hervorgebrachten Stein nicht heben) (3) Wenn Gott keinen Stein hervorbringen kann, den er nicht heben kann, ist Er nicht allmächtig (denn er kann einen solchen Stein nicht hervorbringen) Folglich (4) Gott ist nicht allmächtig. Beachten Sie, dass es hier nicht um die Frage geht, ob Gott allmächtig ist, sondern um die Frage ob Allmacht eine Eigenschaft ist, die überhaupt instanziiert sein kann. Wenn das Paradoxon nicht gelöst werden kann, dann würde nämlich gelten, dass Allmacht ein inkohärenter Begriff ist. Weiterhin ist klar, dass bei dem Paradox des Steins nichts an dem Beispiel mit dem Stein hängt. Wir können beliebige andere Dinge zur Illustration des Paradoxes heranziehen. Die hinter dem Paradox des Steins stehende Intuition ist die, dass es Allmacht nicht geben kann, weil ein allmächtiges Wesen etwas hervorbringen können muss, wodurch seine eigene Macht begrenzt wird, es aber andererseits nichts geben kann, was die Macht eines allmächtigen Wesens begrenzt. Weiterhin können wir das Paradox, so wie Savage es formuliert hat, problemlos in unser Idiom des Bewirkens von Sachverhalten übersetzen. Es sieht dann so aus. Kann Gott bewirken, dass es einen Stein gibt, dessen Masse so groß ist, dass Gott ihn nicht bewegen kann? Wenn die Antwort Ja ist, dann gibt es einen Sachverhalt, den Gott nicht hervorbringen kann: den Sachverhalt, dass Gott den Stein bewegt. Ist die Antwort dagegen Nein, dann gibt es ebenfalls einen Sachverhalt, den Gott nicht bewirken kann: den Sachverhalt nämlich, dass es einen Stein gibt, den Gott nicht bewegen kann. Dieses Paradox hat ein Flut von Literatur hervorgebracht. Eine Lösung ist von George Mavrodes in seinem Aufsatz „Some Puzzles Concerning Omnipotence“ vorgeschlagen worden. Mavrodes wies darauf hin, dass wir, wenn wir fragen, ob Gott einen Stein hervorbringen kann, den er selbst nicht heben kann – dass wir dann zu berücksichtigen haben, dass es Gott ist, dem wir diese Aufgabe sozusagen stellen. Gott ist dabei aber nicht nur der Adressat der Aufgabe, sondern auf Gott wird auch in der Beschreibung der Aufgabe selbst Bezug genommen. Und das gibt uns, wie Mavrodes meint, die Lösung an die Hand. Der Stein wird in der Aufgabe beschrieben als ein Stein, den Gott nicht bewegen kann. Nun ist Gott aber per 95 definitionem fähig jeden beliebigen Stein zu bewegen – egal welche Masse er hat. Das heißt aber, dass die Beschreibung der Aufgabe selbstwidersprüchlich ist – ebenso selbstwidersprüchlich wie die Aufgabe einen viereckigen Kreis hervorzubringen. Und da Allmacht nicht verlangt einen unmöglichen Sachverhalt hervorzubringen, gibt es für die Behauptung der Allmacht Gottes hier kein Problem. Da der Begriff eines Steines, den Gott nicht bewegen kann, inkonsistent ist, können wir nicht sagen, dass seine Macht dadurch limitiert ist, dass er etwas, was unter diesen Begriff fällt nicht hervorbringen kann. Diese Lösung des Paradoxes ist keine Taschenspielerei. Sie scheint mir recht überzeugend zu sein. Der Ausgangspunkt der Lösung ist die Konzeption Gottes als eines essentiell allmächtigen Wesens. Und wenn Gott essentiell allmächtig ist, kann es keinen möglichen Sachverhalt über die Masse von Steinen geben, welchen er nicht hervorbringen kann. Und es kann ebenso keinen möglichen Sachverhalt über die Bewegung von Steinen geben, welchen er nicht hervorbringen kann. Damit wird aber die erste Prämisse von Savages Paradox falsch und das Paradox bricht zusammen. Würden wir dagegen nicht davon ausgehen, dass Gott essentiell, sondern kontingenterweise allmächtig ist, scheint sich das Paradox ebenfalls aufzulösen. Wenn Gott kontingenter Weise allmächtig ist, dann kann Gott existieren ohne allmächtig zu sein. Er kann dann den Sachverhalt hervorbringen, dass er selbst nicht allmächtig ist, d. h. er kann Sachverhalte hervorbringen, die seine Macht limitieren. Das würde aber nicht besagen, dass Gott nicht allmächtig ist, sondern nur dass er nicht allmächtig ist, nachdem er den und den Sachverhalt bewirkt hat. In traditioneller Sicht ist Gott jedoch essentiell allmächtig, daher ist die von Mavrodes angebotene Lösung die eigentlich interessante. Bis jetzt waren wir so weit Allmacht im Sinn unüberbietbarer Macht als die Fähigkeit oder das Vermögen zu definieren, jeden möglichen Sachverhalt, der nicht notwenig ist, hervorzubringen. Damit haben wir eine generelle Strategie an der Hand, um weitere Probleme zu betrachten. So hatte Thomas zum Beispiel die Frage gestellt, ob es Gott möglich sei, die Vergangenheit zu ändern oder ob er Geschehenes ungeschehen machen kann (Buch I, Quaestio 25, Artikel 4). Thomas meint, dass es eine Unmöglichkeit sei Geschehenes ungeschehen zu machen, weil das ja soviel heißt wie das Geschehenes nicht geschehen ist, was widersprüchlich ist. Daher könne auch ein allmächtiges Wesen die Vergangenheit nicht ex post facto noch abändern. Wenn es eine Tatsache ist, dass Sokrates zum Zeitpunkt T sitzt, dann kann Gott es nicht bewirken, dass Sokrates zum Zeitpunkt T nicht sitzt. Denn dass würde implizieren, dass Sokrates zum Zeitpunkt T sitzt und dass er zum Zeitpunkt T nicht sitzt, was unmöglich ist: Es kann keine Welt geben, in welcher ein Sachverhalt sowohl besteht als auch nicht besteht. Thomas erwägt dabei jedoch einen Einwand: dass, weil Gott so etwas 96 tun kann wie einen Blinden sehend machen oder einen Toten auferwecken, was an sich unmöglich sei, er doch auch so etwas tun kann wie Geschehenes ungeschehen machen, was nur akzidenteller Weise unmöglich sei. Thomas Antwort ist: Dass Geschehenes nicht geschehen sei, ist freilich ein zufällig Unmögliches, wenn man das betrachtet, was vergangen ist, nämlich den Lauf des Sokrates. Wenn man aber das Vergangene als Vergangenes betrachtet, so ist es unmöglich, dass es nicht geschehen ist, und zwar unmöglich nicht nur an sich betrachtet, sondern schlechthin, weil es einen Widerspruch besagt. Und so ist es in höherem Maße unmöglich als einen Toten auferwecken, was keinen Widerspruch in sich schließt; denn dieses heißt unmöglich auf Grund eines bestimmten Vermögens, nämlich des natürlichen. Unmöglichkeiten solcher Art sind nämlich der göttlichen Macht unterworfen. Thomas unterscheidet hier zwei Aspekte in der modalen Beurteilung vergangener Ereignisse oder Tatsachen. Sokrates sitzt zum Zeitpunkt T (wobei T ein vergangener Zeitpunkt ist) ist sicherlich eine kontingente Tatsache: Sokrates hätte zum Zeitpunkt T auch nicht sitzen können. Insofern es sich aber um eine vergangene Tatsache handelt oder besser um eine Tatsache über Vergangenes ist es nicht möglich, dass Sokrates zum Zeitpunkt T nicht sitzt. Das Prinzip von dem Thomas hier ausgeht könnte man das Prinzip der Fixiertheit des Vergangenen nennen. Thomas beruft sich dabei nicht auf die Unmöglichkeit einer rückwärtsgewandten Verursachung. Denn die könnte ja nur eine Unmöglichkeit für uns sein, nicht aber für Gott. Er beruft sich, so wie ich ihn lese, allein auf die Tatsache, dass wenn Sokrates zum Zeitpunkt T sitzt, es dann wahr ist dass Sokrates zum Zeitpunkt T sitzt. Und das schließt aus, dass es falsch ist, dass Sokrates zum Zeitpunkt T sitzt. Selbst Gott kann nicht Wahres Falsch und Falsches Wahr machen. Es gibt hier freilich noch weitere Komplikationen, auf die ich nicht mehr im einzelnen eingehen kann. Ein Problem, das können wir schon bei Thomas sehen, betrifft die genaue Bestimmung möglicher Sachverhalte in der Definition der Allmacht. Thomas will offenbar physikalisch oder natürlich unmögliche Sachverhalte wie dass ein Toter wieder lebendig wird nicht zu den Unmöglichkeiten rechnen, auf die sich Allmacht nicht erstreckt. Das besagt aber, dass Allmacht verlangt, dass der Allmächtige Sachverhalte hervorbringen kann, die unter den herrschenden natürlichen Gegebenheiten und den herrschenden Naturgesetzen nicht möglich sind. Solche Sachverhalte sind zwar logisch möglich, so dass es eine mögliche Welt gibt, in der sie bestehen, sie sind aber nicht physikalisch möglich – sie können nicht Sachverhalte in der aktualen Welt oder in einer anderen Welt sein, die der aktualen im Hinblick auf die herrschenden Naturgesetze gleicht. Das zeigt, dass in eine umfassende Analyse von Allmacht auch das Problem der Möglichkeit von Wundern eine erhebliche Rolle spielt. Wunder scheinen möglich sein zu müssen, damit Allmacht ein kohärenter Begriff ist. Denn wir würden nicht mehr von 97 Allmacht reden wollen, wenn ein allmächtiges Wesen in seinem Vermögen etwas zu bewirken durch externe Umstände wie Naturgesetze beschränkt ist. Zum Schluss möchte ich noch ein letztes Problem ansprechen, dass eventuell auch unsere bisherige Definition der Allmacht betreffen könnte. Wir sagten, dass ein Wesen genau dann allmächtig ist, wenn es jeden möglichen Sachverhalt hervorbringen kann, der nicht notwendig ist. Nehmen wir nun an wie seien in einem starken Sinn frei. Das besagt ungefähr, dass unser Wollen, unsere Entscheidungen und unsere Handlungen von nichts weiterem abhängen, von keinen kausalen Antezedenzien bestimmt sind. Wenn wir Freiheit in diesem starken Sinne einräumen, und wir sagen, dass einige unserer Entscheidungen frei sind, dann ist „Sokrates hat sich frei entschieden den Schierlingsbecher zu trinken“ ein möglicher Sachverhalt. Kann nun aber Gott solche Sachverhalte hervorbringen? Das scheint nicht so zu sein. Denn wenn Gott es hervorbringt, dass Sokrates den Schierlingsbecher trinkt, dann ist Sokrates Trinken des Schierlingsbechers keine von Sokrates frei ausgeübte Handlung – keine auf einer freien Entscheidung beruhende Handlung. 98 IV. Argumente für die Existenz Gottes Es hat sich eingebürgert, nicht von Argumenten für die Existenz Gottes, sondern von Gottesbeweisen zu sprechen. Die Rede von Gottesbeweisen ist jedoch ein wenig irreführend. Und das aus mehreren Gründen. Wenn Sie jemandem sagen, dass einige Philosophen Gottesbeweise, d. h. Beweise für die Existenz Gottes vorgelegt hätten, wird Ihr Gegenüber unweigerlich zu der Annahme verleitet, es gebe Beweise dafür, dass Gott existiert – es sei also bewiesen, dass Gott existiert. Wenn Sie dagegen sagen, einige Philosophen hätten Argumente für die Existenz Gottes vorgelegt, legen Sie diese Auffassung nicht nahe. Das liegt daran, dass die Ausdrücke „Beweis“ und „beweisen“ anders als die Ausdrücke „Argument“ und „argumentieren“ sogenannte Erfolgsausdrücke sind. Man kann zwar ohne Erfolg für etwas argumentieren, aber man kann nicht ohne Erfolg etwas beweisen. So kann ein Arzt zwar ohne Erfolg einen Patienten behandeln, aber nicht ohne Erfolg einen Patienten heilen. Entsprechend macht es zwar Sinn zu sagen, ein Philosoph hätte für die Existenz Gottes argumentiert, es sei jedoch weiterhin eine offene Frage, ob es wahr ist, dass Gott existiert; es macht dagegen aber offenbar keinen Sinn zu sagen, ein Philosoph hätte bewiesen, dass Gott existiert, ob Gott existiert sei aber weiterhin eine offene Frage. Dieser Unterschied lässt sich auch festmachen an den Konsequenzen von Kritik. Wenn ein Philosoph etwas als einen Beweis für die Existenz Gottes präsentiert und ein anderer kritisiert ihn, dann zeigt die Kritik, wenn sie berechtigt ist, dass es sich bei jenem angeblichen Beweis gar nicht um einen Beweis handelt. Kritik an einem Argument dagegen zeigt nicht, dass es sich nicht um ein Argument handelt. Wenn sie berechtigt ist, zeigt sie nur, dass es sich nicht um ein gutes Argument handelt. Auch schlechte Argumente sind noch immer Argumente; von einem schlechten Beweis zu sprechen macht jedoch unüberwindliche Schwierigkeiten – eben weil „Beweis“ und „beweisen“ Erfolgswörter sind. Ein zweiter mit dem ersten unmittelbar zusammenhängender Grund, aus dem die Rede von Gottesbeweisen etwas irreführend ist, ist der folgende. „In Descartes’ Meditationen gibt es einen Beweis für die Existenz Gottes“, impliziert „Jemand hat die Existenz Gottes bewiesen“, und das impliziert wiederum „Es ist bewiesen, dass Gott existiert“. Wenn Sie also jemandem mitteilen, dass es in Descartes Meditationen einen Beweis für die Existenz Gottes gibt, dann geben Sie ihm oder ihr zu verstehen, dass es bewiesen ist, dass Gott existiert. Für Ihr Gegenüber wird es dann als eine Überraschung kommen, wenn Sie dann die Information hinzufügen, dass es bei Descartes nicht nur einen sondern mehrere Beweise gibt und dass auch andere Philosophen noch andere Beweise vorgelegt haben. Die Überraschung kommt 99 natürlich daher, dass Ihr Gegenüber sich fragen wird: Wozu alle diese weiteren Beweise, wenn es denn einen Beweis für die Existenz Gottes gibt? Was können denn all diese anderen Beweise noch leisten, wenn es denn bewiesen ist, dass Gott existiert? Wenn es bewiesen ist, dass Gott existiert, sollte man doch meinen, erübrigt sich jeder weitere Beweis, da die Wahrheit von „Gott existiert“ ausgemacht ist, wenn diese Proposition bewiesen ist. Auch diese Überraschung hängt mit der Tatsache zusammen, dass „Beweis“ und „beweisen“ Erfolgswörter sind. Es mag zwar verschiedene Beweismöglichkeiten für P geben, wenn es aber bewiesen ist, dass P, dann ist es nicht erforderlich, nach weiteren Beweisen zu suchen, da erstens kein Beweis die Beweiskraft eines anderen Beweises übersteigen kann und da zweitens die Beweiskraft mehrerer Beweise zusammen auch nicht die Beweiskraft eines einzigen Beweises übersteigen kann. Ein dritter Grund, der wiederum direkt mit dem ersten zusammenhängt, ist folgender. Was üblicherweise als Gottesbeweise bezeichnet wird umfasst auch induktive oder probabilistische Argumente: Argumente bei denen die Prämissen die Konklusion nicht logisch implizieren, sondern in einem bestimmten Maße wahrscheinlich machen. Bei solchen Argumenten ist die Wahrheit der Konklusion selbst dann nicht ausgemacht, wenn es ausgemacht ist, dass ihre Prämissen wahr sind. Und weiterhin kann sich bei solchen Argumenten die Wahrscheinlichkeit der Konklusion verändern, wenn wir bestimmte Aussagen zu ihrer Prämissenmenge hinzufügen. Beides ist aber mit der Bedeutung von „Beweis“ und „beweisen“ schwerlich zu vereinbaren. Wenn die Wahrheit einer Aussage P nicht entschieden ist, würden wir nicht sagen wollen, dass P bewiesen ist. Und wenn die Erweiterung der Prämissenmenge eines Arguments zu einer Veränderung der Beweiskraft des Arguments führt, würden wir ebenfalls nicht sagen wollen, dass P durch das Argument bewiesen ist. Aus diesen Gründen sollte man besser von Argumenten für die Existenz Gottes als von Gottesbeweisen sprechen. Nun haben Beweise und Argumente offenbar etwas miteinander zu tun. Jeder Beweis ist ein Argument, aber nicht jedes Argument ist ein Beweis. Das gibt uns die Möglichkeit von Argumenten und ihrer Beweiskraft zu reden und die Diskussion über Gottesbeweise als eine Diskussion über die Beweiskraft von Argumenten zu verstehen. Mit dem Begriff der Beweiskraft führen wir dabei ein epistemisches – wissensbezogenes – Element in die Betrachtung von Argumenten ein, ein Element, das in der rein logischen Betrachtung und Bewertung von Argumenten keine Rolle spielt. Wovon ist die Beweiskraft eines Arguments abhängig? Wir können uns hier mit einigen Hinweisen begnügen. Betrachten Sie das folgende Argument: (1) Wenn 2 + 2 = 4, dann existiert Gott. 100 (2) 2 + 2 = 4 Also (3) Gott existiert. Dieses Argument ist offenbar gültig: Seine Konklusion kann nicht falsch sein, wenn seine Prämissen wahr sind. Trotzdem ist es, intuitiv gesehen, von äußerst geringer Beweiskraft, ja, es ist, was seine Beweiskraft angeht, bei genauerer Betrachtung schlicht wertlos. Das liegt daran, dass wir seine erste Prämisse – die Aussage, dass Gott, wenn 2 + 2 = 4 ist, existiert – entweder nicht als wahr einräumen können, oder jedenfalls nicht als wahr einräumen können im Rahmen eines Arguments für die Existenz Gottes. Warum wir es nicht als wahr einräumen können, erklärt sich daraus, dass wir nach demselben Muster offenbar die Existenz beliebiger Entitäten ‚beweisen’ könnten. Etwa so: (1) Wenn 2 + 2 = 4, dann existieren Einhörner. (2) 2 + 2 = 4 Also: (3) Einhörner existieren. Wir könnten aber, und das ist noch aufschlussreicher, nach einem ähnlichen Muster dann auch ein atheistisches Argument konstruieren: (1) Wenn 2 + 2 = 4, dann existiert Gott nicht. (2) 2 + 2 = 4 Also (3) Gott existiert nicht. Dass wir sowohl beliebige andere Entitäten, als auch die Nicht-Existenz Gottes darlegen könnten, würden wir uns als berechtigt betrachten, ein Argument wie das zuerst genannte zu benutzen, zeigt uns, dass dieses Argument vollkommen wertlos ist. Es liefert uns, anders gesagt, nicht den geringsten Grund, seine Konklusion zu akzeptieren. Das heißt, dass die Prämissen, aus denen die Existenz Gottes erschlossen werden soll, uns auch wirklich berechtigen sollten oder uns auch wirklich eine guten Grund dafür geben sollten, die Aussage „Gott existiert“ anzunehmen. Sie können uns aber dazu nur dann berechtigen oder uns nur dann einen guten Grund dafür liefern, wenn das Muster der Argumentation nicht auch für die Darlegung der Existenz beliebiger Entitäten oder auch für die Darlegung der Nicht-Existenz Gottes ausgebeutet werden kann. Ein weiteres offenbar wertloses Argument wäre das folgende: (1) Gott existiert. Also 101 (2) Gott existiert. Auch dieses Argument, muss betont werden, ist definitiv ein gültiges Argument: Seine Konklusion kann nicht falsch sein, wenn seine Prämisse wahr ist. Es ist aber wertlos, weil es zirkulär ist: Da seine Prämisse mit seiner Konklusion identisch ist, setzt es das zu Beweisende als wahr voraus. Auch hier können wir uns die Wertlosigkeit wieder dadurch veranschaulichen, dass wir das Muster dieses Arguments ausbeuten könnten sowohl für die Darlegung der Existenz beliebiger Entitäten als auch für die Darlegung der Nicht-Existenz Gottes. Zirkularität, durch die ein Argument wertlos wird, kann natürlich auch etwas versteckter sein. So zum Beispiel in folgendem Argument: (1) Im Gebet spricht Gott mit mir. Also: (2) Gott existiert. Auch dieses Argument ist in einem schlechten Sinne zirkulär, insofern die Wahrheit der Prämisse nur derjenige akzeptieren kann, der die Konklusion akzeptiert. Die Konklusion ist hier der Grund oder einer der Gründe, aus denen die Prämisse akzeptiert wird, und daher liefert die Prämisse keinen selbst unabhängigen Grund für die Akzeptanz der Konklusion. Aus einem noch ganz anderen Grund wäre das folgende Argument ohne Beweiskraft: (1) Wenn 2 + 2 = 5, dann existiert Gott nicht. (2) Es ist nicht so, dass 2 + 2 =5 Also (3) Gott existiert. Dieses Argument ist wertlos, weil nichts für seine erste Prämisse spricht und weil es darüber hinaus auch noch unschlüssig ist. Es handelt sich nämlich um einen Fehlschluss. Ein letztes Beispiel: (1) Alles hat eine Ursache Also: (2) Es gibt eine Ursache von allem. (3) Die Ursache von allem ist Gott. Also: (4) Gott existiert. Auch dieser Schluss ist ein Fehlschluss. Die erste Prämisse „Alles hat eine Ursache“ ist für viele akzeptabel. Aber aus „Alles hat eine Ursache“ folgt nicht, dass es eine Ursache von allem gibt. 102 Was die Frage der Beweiskraft eines Arguments betrifft, haben wir damit zwei Aspekte herausgehoben. Die Beweiskraft eines Arguments ist erstens abhängig von der Akzeptierbarkeit oder dem Ausmaß der Akzeptierbarkeit seiner Prämissen und zweitens abhängig von dem Ausmaß der Stützung, welche die Konklusion durch die Prämissen erfährt. So folgt daraus, dass ein Argument logisch gültig ist, noch lange nicht, dass es beweiskräftig ist. Was die Beweiskraft betrifft, kann ein Argument sogar logisch gültig und zugleich vollkommen wertlos sein. Beweiskraft wird aber natürlich auch unterminiert durch logische Fehler. Ein Fehlschluss wie der von der Verneinung des Antezedenz auf die Verneinung des Konsequenz macht ein Argument wertlos. Es können aber Argumente durchaus wertvoll sein, auch wenn sie ihre Konklusion nicht logisch implizieren. In diesem Fall handelt es sich um gute induktive oder probabilistische Argumente. Betrachten Sie einmal folgendes Argument: (1) Alle Philosophen sind sich darüber einig, dass Gott existiert. (2) Bisher haben sich alle Aussagen, die alle Philosophen einhellig für wahr hielten, als wahr erwiesen. Also. (3) Die Aussage, dass Gott existiert, ist wahr. Das ist ein induktives Argument. Seine Prämissen implizieren seine Konklusion nicht, da die Wahrheit seiner Prämissen mit der Falschheit seiner Konklusion verträglich ist. Dennoch wäre dieses Argument – nehmen wir einmal kontrafaktisch an, dass seine Prämissen wahr wären – dennoch wäre dieses Argument von einigem Wert und könnte nicht ohne weiteres von der Hand gewiesen werden. Alles, was wir bisher gesagt haben, gilt natürlich auch für atheistische Argumente. Die Frage der Beweiskraft von Argumenten müssen wir von der Frage der Überzeugungskraft unterscheiden. Es kann sein, dass ein beweiskräftiges Argument eine Person nicht überzeugt, und es kann umgekehrt auch sein, dass ein wertloses Argument eine Person überzeugt. 1) Das ontologische Argument a) Anselms Argument aus Kapitel 2 des Proslogion Das berühmteste, philosophisch faszinierendste, vielleicht aber auch berüchtigtste Argument für die Existenz Gottes ist das ontologische Argument oder der sogenannte ontologische Gottesbeweis. Es handelt sich dabei genau genommen nicht um genau ein Argument, sondern um einen bestimmten Typus von Argument. Allen Argumente dieser Art ist gemeinsam, dass sie beanspruchen, die Existenz Gottes aus dem Begriff Gottes zu erschließen. Allein ein 103 genaues Verständnis der Konzeption Gottes, heißt das, soll uns zeigen, dass die Aussage „Gott existiert“ wahr ist. Zum ersten Mal in der Geschichte der Philosophie ist ein ontologisches Argument von Anselm von Canterbury im 11. Jahrhundert entwickelt worden. Das ist das vielleicht bekannteste, und mit ihm werden wir uns auch ausführlich beschäftigen. Schon zu Anselms Zeiten wurde sein ontologisches Argument diskutiert und auch starker Kritik ausgesetzt und spielte im späteren Mittelalter keine bedeutende Rolle mehr. Bezeichnenderweise fand es keinen Eingang in die fünf Wege des Thomas von Aquin – in die fünf Wege, auf denen nach Thomas’ Auffassung die Existenz Gottes bewiesen werden kann. Einen prominenten Rückgriff auf das ontologische Argument finden wir erst wieder bei Descartes in seiner 5. Meditation. Aber schon in der neuzeitlichen Philosophie, besonders in der Aufklärung, konnte es seinen Platz nicht behaupten; und viele sahen dann in Kants prinzipieller Kritik am ontologischen Beweis den endgültigen Niedergang dieser Art für Gottes Existenz zu argumentieren. Dabei war Kants Kritik am ontologischen Beweis keineswegs neu. Denn den Grundgedanken von Kants Kritik finden wir schon bei David Hume, und Einwände, die einigen Punkten von Kants Kritik ähneln sogar schon bei Thomas von Aquin. Sehen wir von einigen wenigen positiven Einschätzungen des ontologischen Beweises ab, die keine nachhaltige Wirkung ausüben konnten, ist ein Interesse an einer erneuten und ernsthaften Beschäftigung mit ontologischen Argumenten eigentlich erst im 20. Jahrhundert insbesondere mit der Arbeit von Alvin Plantinga in Gang gekommen. In seinem Buch The Nature of Necessity von 1974 hat er eine neuartige Version eines ontologischen Arguments vorgelegt, das sogenannte modale ontologische Argument, bei dem er sich die Errungenschaften des 20. Jahrhunderts in der Entwicklung einer Semantik für den modalen Diskurs zunutze macht. Auf dieses Argument von Plantingas werde ich leider nicht eingehen können, obwohl es ein echter Meilenstein in der Geschichte des ontologischen Arguments ist.5 Auch nach Plantinga haben einige Philosophen Vorschläge zu einem verbesserten ontologischen Argument gemacht. So etwa Eric Gale in seinem Aufsatz „A new argument for the existence of god: one that works, well, sort of“ von 1999. Auch diesen neueren Beitrag können wir hier nicht besprechen. Ich nenne diesen, übrigens ziemlich anspruchsvollen Aufsatz nur, um darauf hinzuweisen, dass einige Philosophen ernsthaft an Dingen weiterarbeiten, die andere für vollkommene Sackgassen halten. In diesem ersten Teil werde ich mich mit dem wahrscheinlich berühmtesten ontologischen Argument, dem von Anselm von Canterbury (1033 – 1109) 5 Es ist auch deshalb von besonderem Interesse, um zu sehen, ob die prinzipielle Kritik, die etwa Kant am ontologischen Argument geübt hat, stichhaltig ist: Können wir wirklich behaupten, dass ontologische Argumente unmöglich sind, oder trifft die Kritik am ontologischen Argument, wenn Sie denn überhaupt etwas trifft, nur bestimmte Versionen dieses Arguments 104 auseinandersetzten. Im nachfolgenden Teil stehen dann ein anderes Argument von Anselm im Zusammenhang mit Descartes Argument und die Kantische Kritik an allen ontologischen Argumenten im Mittelpunkt. Das berühmte Anselm’sche Argument findet sich in seiner Schrift Proslogion im 2. Kapitel „Dass in Wahrheit Gott existiert“, wo er es wie folgt präsentiert: Also, Herr, der Du die Glaubenseinsicht gibst, verleihe mir, dass ich, soweit Du es nützlich weißt, einsehe, dass Du bist, wie wir glauben, und das bist, was wir glauben. Und zwar glauben wir, dass Du etwas bist, über dem nichts Größeres gedacht werden kann. Gibt es also eine solches Wesen nicht, weil „der Tor in seinem Herzen gesprochen hat: es ist kein Gott“? Aber sicherlich, wenn dieser Tor eben das hört, was ich sage: „etwas, über dem nichts Größeres gedacht werden kann“, versteht er, was er hört; und was er versteht, ist in seinem Verstande, auch wenn er nicht einsieht, dass dies existiert. Denn ein anderes ist es, dass ein Ding im Verstande ist, ein anderes einzusehen, dass das Ding existiert. Denn wenn ein Maler vorausdenkt, was er schaffen wird, hat er zwar im Verstande, erkennt aber noch nicht, dass existiert, was er noch nicht geschaffen hat. Wenn er aber schon geschaffen hat, hat er sowohl im Verstande, als er auch einsieht, dass existiert, was er bereits geschaffen hat. So wird also auch der Tor überführt, dass wenigstens im Verstande etwas ist, über dem nichts Größeres gedacht werden kann, weil er das versteht, wenn er es hört, und was immer verstanden wird, ist im Verstande. Und sicherlich kann „das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann“, nicht im Verstande allein sein. Denn wenn es wenigstens im Verstande allein ist, kann gedacht werden, dass es auch in Wirklichkeit existiere – was größer ist. Wenn also „das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann“, im Verstande allein ist, so ist eben „das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann“, über dem Größeres gedacht werden kann. Das aber kann gewiss nicht sein. Es existiert also ohne Zweifel „etwas, über dem Größeres nicht gedacht werden kann“, sowohl im Verstande als auch in Wirklichkeit. Betrachten wir Anselms Argument, so scheint klar zu sein, dass es sich um ein indirektes oder Reductio-ad-absurdum-Argument handelt. D. h. es ist ein Argument bei dem als Ausgangspunkt das Gegenteil von dem angenommen wird, was bewiesen werden soll, und welches zeigt, dass die Ausgangsannahme zu einem Widerspruch führt. Diese Interpretation bietet sich ganz von selbst an, da Anselm in seiner Argumentation an einer Schlüsselstelle sagt: „So wird also auch der Tor überführt“. Die Überführung des Toren – desjenigen also, der in seinem Herzen spricht „Es ist kein Gott“ – besteht für Anselm aber offenbar in dem Aufweis der 105 Unmöglichkeit, die Existenz Gottes zu leugnen. Dem Tor soll also gezeigt werden, dass er die Existenz Gottes unmöglich leugnen kann, da dies zu leugnen zu einem manifesten Widerspruch führt. Zum Hintergrund des Arguments gehört die Definition Gottes als das Wesen über dem/über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Der Tor ist dann derjenige, der in seinem Herzen spricht, dass das Wesen, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann nicht, existiert. Und die Überführung des Toren besteht in dem Nachweis, dass der Tor sich in einen logischen Widerspruch verwickelt, wenn er eben dies behauptet. Denn würde das Wesen über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann nicht in Wirklichkeit existieren, könnte es etwas geben, was größer ist als dasjenige Wesen über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Und eben das ist nicht möglich. Wenn wir uns recht nahe an Anselms Formulierungen halten, kann das Argument vielleicht so rekonstruiert werden: (1) Gott existiert im Verstand. [Prämisse, die auch der Tor akzeptiert, nachdem ihm das Zugeständnis abgerungen wurde, dass, was auch immer verstanden wird, im Verstande ist] (2) Gott existiert nicht in Wirklichkeit. [Das ist die Behauptung des Toren und im Argument die Annahme zum Zwecke der reductio] (3) Was in Wirklichkeit existiert, ist größer, als was nur im Verstande ist. [Prämisse] (4) Wenn Gott im Verstande ist, dann ist es denkbar, dass Gott in Wirklichkeit existiert. [Prämisse] (5) Es ist denkbar, dass Gott in Wirklichkeit existiert. [Aus 1 und 4] (7) Wenn Gott nicht in Wirklichkeit existiert, dann ist es denkbar, dass Größeres gedacht werden kann als das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann [Aus 3, 5 und der Definition Gottes] (7) Es kann Größeres gedacht werden als das über dem Größeres nicht gedacht werden kann. [Aus 2 und 7, Widerspruch] (8) Es ist nicht so, dass das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann, nicht in Wirklichkeit existiert. (9) Gott existiert in Wirklichkeit. Das Argument soll uns also zeigen, dass die Annahme, dass Gott nicht in Wirklichkeit existiert in einen Widerspruch führt und daher aufgegeben werden muss. Aus dem Begriff bzw. der Definition Gottes alleine, können wir übrigens sehen, ergibt sich diese Konklusion bei Anselms Argument nicht. Die Definition Gottes als das Wesen, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, spielt natürlich eine wichtige und entscheidende Rolle, aber alleine – ohne weitere Prämissen – funktioniert das Argument offenbar nicht. Die 106 Beschreibung des ontologischen Arguments als Argument, bei dem alleine aus dem Begriff Gottes auf die Existenz Gottes geschlossen wird ist also nicht ganz korrekt – wenn denn Anselms Argument als ontologisches gelten soll (und es wird ja in der Tat als ein paradigmatisches Beispiel des ontologischen Arguments angeführt). Ein weiterer zwar offenkundiger, aber dennoch wichtiger Punkt ist der, dass Anselm im Kontext dieses Arguments Existenz nicht zu einem das göttliche Wesen definierenden Attribut macht. Die Definition, von der er Gebrauch macht, lässt es für sich betrachtet erst einmal offen, ob Gott existiert. Dass Gott existiert ist in der Tat die Konklusion des Arguments, so dass die Anselm’sche Definition akzeptieren nicht schon die Existenzaussage „Gott existiert“ akzeptieren heißt. Wie sollen wir das Argument bewerten? Der entscheidende Schritt scheint die Prämisse (3) zu sein, die Behauptung, dass was in Wirklichkeit existiert größer ist, als was nur im Verstande existiert. An dieser Stelle müssen wir noch einhaken. Darüber hinaus haben aber einige Autoren auch Probleme gesehen mit der ersten Prämisse, dass Gott im Verstand ist. Muss der Tor diese Prämisse akzeptieren? John Mackie hat hier ein erhebliches Problem gesehen. Mackie wies darauf hin, dass Anselms Übergang von so etwas wie „Der Tor versteht den Ausdruck: das über dem hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ zu „Das über dem hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, ist im Verstand des Toren.“ nicht so unschuldig und unproblematisch ist, wie es vielleicht erscheinen mag. Und in der Tat drückt sich Anselm so aus, dass der Tor eben dadurch überführt würde, „dass wenigstens im Verstande etwas ist, über dem nichts Größeres gedacht werden kann“. Und er begründet letzteres damit, dass was auch immer verstanden wird, im Verstand ist. Mackie interpretiert nun Anselms Rede von „im Verstande sein“ oder „im Verstande existieren“ als ein Bewusstseinsgegenstand oder ein intentionales Objekt sein. „Gott ist im Verstand“ würde dann paraphrasiert werden können als „Gott ist ein Bewusstseinsgegenstand/ein intentionales Objekt“. Der Tor, behauptet nun Anselm, müsse sich in einen Widerspruch verstricken, wenn er behauptet, Gott sei ein Gegenstand des Bewusstseins, der nicht wirklich existiert, weil dann ja Größeres gedacht werden könnte als das über dem Größeres nicht gedacht werden kann. Mackie bemerkt nun aber, dass, wenn hier überhaupt ein Widerspruch besteht, er dann doch auch Anselm selbst treffe: Aber muss nicht auch Anselm sich in diesen Widerspruch verstricken, wenn es sich dabei überhaupt um einen Widerspruch handeln sollte? Denn auch er sagt, ein Wesen über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, existiere im Bewusstsein des Toren, gleichzeitig aber behauptet er, dass etwas Größeres als dieses gedacht werden kann. Dies ist ebenfalls ein 107 Widerspruch, ob man nun sagt, dieses größere Wesen existiere tatsächlich oder nicht. (Mackie, Das Wunder des Theismus, S. 84) Mackies Bemerkung ist äußerst raffiniert. Er stellt in Frage, ob unter Anselms eigenen Prämissen die Beschreibung des Toren überhaupt konsistent sein kann. Wie kann Anselm denn behaupten, dass das über dem hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, im Verstande des Toren ist, wenn er zugleich behauptet, dass was im Verstande ist, geringer ist, als was in Wirklichkeit ist? Der springende Punkt ist der, dass das Prinzip: Was in Wirklichkeit existiert, ist größer als was nur im Verstande existiert, selbst die Möglichkeit ausschließt, dass das über dem Größeres nicht gedacht werden kann, im Verstande ist. Wenn das richtig ist würde Anselms Argument in der soeben rekonstruierten Form zusammenbrechen. Denn entweder ist die erste Prämisse dann falsch, oder sie steht im Widerspruch zu der dritten Prämisse. Vielleicht könnte man hier einwenden, dass Anselm nicht sagt, dass im Verstand sein geringer ist als in Wirklichkeit sein, sondern dass, was nur im Verstand und nicht in der Wirklichkeit existiert, geringer ist als was in Wirklichkeit existiert. Aber das hilft nicht wirklich weiter. Denn Anselm unterscheidet offenbar zwischen Gott als einem Bewusstseinsgegenstand und Gott als einer in Wirklichkeit unabhängig vom Bewusstsein existierenden Entität. Und das von Mackie aufgezeigte Problem ist: dass der Bewusstseinsgegenstand unter Anselms eigenen Prämissen entweder gar nicht unter die Beschreibung „das über dem hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ fällt, oder darunter fällt, in welchem Falle es dann aber inkonsistent wäre zu behaupten, dass Gott, wenn er in Wirklichkeit existiert, größer ist als Gott nur im Verstand. Ist damit das ganze Argument hinfällig? Nur dann, wenn wir keine Rekonstruktion liefern können, die die Rede von der Existenz im Verstand vermeidet und den Sinn von Anselms Argumentation dennoch erhält. Und in der Tat sollten wir die Rede von Existenz im Verstand aufgeben. Es ist ein ziemlich obskurer Redestil, der uns zu abwegigen Vorstellungen einlädt. Was zum Beispiel sollte es überhaupt heißen, dass Gott, das allmächtige Wesen, im Verstand ist? Es kann sinnvoll nicht mehr und nichts anderes heißen, als dass irgendjemand den Gedanken denkt, dass Gott allmächtig ist. Von dem Toren zu sagen, dass er die Definition Gottes versteht heißt dann nichts anderes als zu sagen, dass er den Gedanken, dass Gott das ist, über dem hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, erfassen kann. Anselm hat aber in seiner Argumentation noch etwas weiteres im Sinn, was wir uns für eine bessere Rekonstruktion seines Arguments zunutze machen können. Denn er sagt, dass was im Verstande ist, von dem kann gedacht werden, dass es in Wirklichkeit existiert. Also können wir seine Rede von im Verstande sein einfach mit „kann gedacht werden“ oder schlicht „ist möglich“ übersetzen. Entsprechend können wir dann „in Wirklichkeit existieren“ schlicht mit 108 „existieren“ übersetzen, da wir nun die Suggestion, dass im Verstande sein, für ein Objekt bedeutet, in einer besonderen Art zu existieren, beseitigt haben. Damit bekämen wir eine Version seines Arguments, die ungefähr so aussieht (ich halte mich hier eng an Eric Gales Version): (1) Es ist möglich, dass das, über dem hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, existiert. [Prämisse, zugestanden vom Toren] (2) Das, über dem hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, existiert nicht. [Annahme für den indirekten Beweis und Behauptung des Toren] (3) Für jedes Individuum x gilt: Wenn es möglich ist, dass x existiert, und x existiert nicht, dann kann x größer sein. [Prämisse] (4) Wenn es möglich ist, dass Gott existiert, und Gott existiert nicht, dann kann das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann, größer sein. [Instanz von 3] (5) Das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann, kann größer sein als es ist. [Aus 1, 2 und 4 Widerspruch] (6) Es ist nicht der Fall, dass das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann, nicht existiert. (7) Gott existiert. In dieser Formulierung ist die von Mackie aufgezeigte Schwierigkeit vermieden. Es erreicht dieselbe Konklusion auf der Basis von reformulierten Prämissen und der reformulierten Annahme. Welche Probleme lauern hier noch? Der entscheidende und bei genauerer Betrachtung auch einzig problematische Schritt liegt in der zweiten Prämisse. Denn um die erste Prämisse zurückzuweisen, müsste der Tor zeigen, dass es logisch unmöglich ist, dass ein Wesen existiert, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Er müsste also zeigen, dass das Konzept eines solchen Wesens inkonsistent ist. Da dies bisher noch niemand gezeigt hat, dürfen wir die erste Prämisse von unserer Betrachtung ausnehmen. Da dieses Argument auch schlüssig ist, scheint also das ganze Problem auf der zweiten Prämisse zu lasten. Macht es Sinn und ist es wahr, dass ein Individuum – eine bestimmte individuelle Entität –, wenn es existiert, größer ist als wenn es nur möglich ist? Oder macht es Sinn, um bei Anselms Formulierung zu bleiben, zu sagen, dass in Wirklichkeit existierendes größer sei als nur im Verstande Existierendes? Schon Gaunilo, ein Mönch der Anselms Argument in einer kleinen Schrift aus mehreren Gründen angegriffen hat, hatte hier seine Zweifel (er hatte freilich nicht die Formulierung vor Augen, die wir hier haben). Er glaubte, dass Anselms Argument einfach absurd ist, weil es uns auch berechtigen würde, irgendwelche phantastischen Entitäten als 109 existierend zu beweisen. Seine kleine Geschichte ist einfach zu schön, um hier übergangen zu werden: Man erzählt sich, irgendwo im Ozean gebe es eine Insel, die einige wegen der Schwierigkeit oder vielmehr der Unmöglichkeit, das, was nicht existiert, aufzufinden, ergänzend verschwundene Insel nennen und die, so geht die Sage, noch weit mehr, als es von den Inseln der Glückseligen berichtet wird, unermesslich reich sei an lauter kostbaren Gütern und Annehmlichkeiten, niemandem gehöre, von keinem bewohnt werde und alle anderen bewohnten Länder durch ein Übermaß an Besitztümern allenthalben übertreffe. Dass dies so sei, könnte mir jemand sagen, und ich vermöchte diese Rede, die ja keine Schwierigkeiten aufweist, ohne weiteres zu verstehen. Wenn er dann aber, als ergebe sich dies folgerecht, mit der Zusatzbehauptung fortführe: Du kannst nun nicht mehr daran zweifeln, dass diese unter allen Ländern vortrefflichste Insel wahrhaft irgendwo in Wirklichkeit existiert, steht es doch für die außer Zweifel, dass sie auch in deinem Verstande ist; und weil es vortrefflicher ist, nicht allein im Verstande, sondern auch in Wirklichkeit zu sein, deshalb existiert sie notwendig so, denn wenn das nicht der Fall wäre, wäre jedes andere Land, das in Wirklichkeit existiert, vortrefflicher als sie, und so wäre sie obwohl von dir bereits als unter allen Ländern vortrefflichste verstanden, nicht das vortrefflichste – wenn er, so sage ich, mir dadurch einreden wollte, an der wahrhaften Existenz dieser Insel dürfe nicht mehr gezweifelt werden, nähme ich entweder an, er erlaube sich einen Scherz, oder ich wäre unschlüssig, wen ich törichter halten sollte, mich, wenn ich ihm beipflichte, oder ihn, wenn er glaubte, für das wesentliche Sein dieser Insel auch nur irgendwie einen sicheren Beweis erbracht zu haben [...].6 Gaunilos Kritik erklärt also Anselms Argumentation für offenkundig irregeleitet, da man, appliziert man diesen Stil einer Beweisführung in anderen Kontexten, auch so etwas wie die Existenz einer höchst vortrefflichen Insel beweisen könnte, was absurd ist. Obwohl Gaunilo hier nicht explizit sagt, an welcher Stelle Anselms Argument problematisch ist, ist doch klar, dass er die zweite Prämisse meint – die Prämisse, dass was in Wirklichkeit existiert größer oder vortrefflicher ist, als das, was nur im Verstand allein ist. Wie Gaunilo diese Behauptung Anselms interpretiert, sieht man an der Begründung, die er Anselm bzw. der wie Anselm argumentierenden Person in den Mund legt: Wenn jene allervortrefflichste Insel, sagt er, nicht in Wirklichkeit existierte, dann „wäre jedes andere Land, das in Wirklichkeit existiert, vortrefflicher als sie“ und so wäre dann die allervortrefflichste Insel nicht die allervortrefflichste Insel. Gaunilo interpretiert Anselm also so, dass Anselm sagen möchte, alles was in Wirk6 Kurt Flasch (Hg.), Kann Gottes Nicht-Sein gedacht werden? Die Kontroverse zwischen Anselm von Canterbury und Gaunilo von Marmoutiers, S. 76/77. 110 lichkeit existiert sei vortrefflicher als was nur im Verstand existiert, woraus dann unmittelbar folgen würde, dass nichts von dem, was nur im Verstand existiert, Wirklichem an Vortrefflichkeit gleichkommen könnte. Damit sind genau drei Voraussetzungen gemacht: (1) Existenz ist eine Eigenschaft. (2) Existenz ist eine Vollkommenheit oder Größe verleihende Eigenschaft. (3) In den Vollkommenheit verleihenden Eigenschaften rangiert Existenz an erster Stelle, so dass, was nicht existiert auf jeden Fall geringer ist, als was existiert. In der Begründung seines Einwands bezieht sich Gaunilo offenbar auf den dritten Punkt. Aber beruft sich Anselm selbst darauf? Zunächst können wir sehen, dass der dritte Punkt offenbar falsch ist, selbst wenn wir die ersten beiden Punkte zugeben würden. Der rein fiktionale Comic-Held Supermann ist sicherlich vortrefflicher als irgendwelche leider nicht nur fiktionalen Massenmörder, die ihr Unwesen in der Wirklichkeit treiben. Und ein rein fiktionales Land, in dem Milch und Honig fließen, ist sicherlich vortrefflicher, als irgendein leider nicht nur fiktionales Land, in dem Dürre, Hunger und Seuchen herrschen. Der dritte Punkt ist also so offenkundig falsch, dass wir Anselm möglichst nicht unterstellen sollten, er würde sich auf ein Prinzip dieser Art berufen. Werfen wir noch einmal einen Blick in Anselms Text. Dort heißt es an der hier entscheidenden Stelle: „[...] wenn es [das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann] wenigstens im Verstande allein ist, kann gedacht werden, dass es auch in Wirklichkeit existiere – was größer ist.“ Hier wird deutlich dass Anselm nicht einen Vergleich zwischen irgendetwas A, was allein im Verstand ist, und irgendwelchen anderen Dingen B, C, D, welche in Wirklichkeit existieren, ziehen möchte. Er spricht vielmehr von der Größe einer einzigen Entität in zwei verschiedenen Umständen oder Situationen – einmal in einer Situation, in welcher sie nicht existiert, das andere mal in einer Situation, in welcher sie existiert. Dieser Punkt ist auch von Alvin Plantinga herausgestellt worden: Anselm möchte von nur einem Gegenstand sprechen; und er sagt von diesem Ding, von dem vorübergehend angenommen wird, es existiere nicht, dass es größer wäre, wenn es existierte. Er möchte die Größe, die es in einer möglichen Welt hat, mit der Größe vergleichen, die es in einer anderen möglichen Welt hat; er möchte uns zu verstehen geben, dass dieser Gegenstand in den Welten, in denen er existiert, größer ist als in dieser, in der er nicht existiert. 7 Diesen Punkt haben wir übrigens schon in der Formulierung der zweiten Prämisse (Zeile 3) berücksichtigt: Für jedes Individuum x gilt: Wenn es möglich ist, dass x existiert, und x existiert nicht, dann kann x größer sein. Hier wird nur von der vergleichsweisen Größe einer Alvin Plantinga, „Gott und Notwendigkeit“, in: Analytische Religionsphilosophie, hg. v. Christoph Jäger, S. 102. 7 111 einzigen Entität in verschiednen Situationen – in verschiedenen Welten – gesprochen, nicht aber von dem Größenverhältnis zwischen unterschiedlichen Dingen. Damit ist also der Punkt, auf den Gaunilos Einwand sich gestützt hat beseitigt. Ist sein Einwand damit komplett hinfällig geworden? Um Anselms Argumentation auf Gaunilos Beispiel applizieren zu können, müsste gezeigt werden können, dass aus der Behauptung, die höchst vortreffliche Insel existiere nicht, ein Widerspruch entsteht. Anselm scheint hier eine Möglichkeit der Erwiderung zu haben. Er könnte zunächst einfach darauf hinweisen, dass eine höchst vortreffliche Insel nichts ist über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. So kann etwa auch ein höchst vortrefflicher Bäcker in vielerlei Hinsicht unvollkommen sein, so dass Größeres gedacht werden kann als ein höchst vortrefflicher Bäcker. Daher, könnte Anselm fortfahren, lässt sich in Bezug auf die Insel kein Widerspruch konstruieren – der Widerspruch nämlich, dass Größeres gedacht werden kann als das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann. Gaunilo könnte hier jedoch offenbar eine Antwort parat haben. Er könnte darauf hinweisen, dass eine höchst vortreffliche Insel eine Insel ist, die vortrefflicher nicht gedacht werden kann – eine Insel ist, über die hinaus in der Tat Vortrefflicheres gedacht werden kann, über die hinaus jedoch eine vortrefflichere Insel nicht gedacht werden kann. Ist das aber zugestanden, ergibt sich auch hier, unter der Annahme die höchst vortreffliche Insel existiere nicht, ein Widerspruch: Die höchst vortreffliche Insel kann vortrefflicher sein als sie ist. In seiner wirklichen Erwiderung auf Gaunilo beharrt Anselm darauf, dass zwischen seinem eigenen Beweis und dem Beweis Gaunilos ein erheblicher Unterschied besteht. Er schreibt dort: Es dürfte aber bereits offenkundig sein, dass das Nicht-Sein dessen, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, nicht gedacht werden kann. (Flasch, S. 97) Und er meint damit offenkundig, dass allein im Falle Gottes das Nicht-Sein undenkbar ist eben weil Gott das ist, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Diese Antwort ist jedoch im gegenwärtigen Kontext vollkommen unzureichend – sie trifft nämlich gar nicht Gaunilos Punkt. Gaunilo behauptet ja, dass man dann, wenn Anselms indirekter Beweis aus Kapitel 2 funktionieren würde, auch zeigen könnte, dass das Nicht-Sein einer höchst vortrefflichen Insel nicht gedacht werden kann. Anselm ist daher nicht berechtigt, in seiner Erwiderung von der Aussage Gebrauch zu machen, dass nur Gott etwas ist, dessen Nicht-Sein nicht gedacht werden kann. Denn damit würde er einfach als wahr voraussetzen, was in Frage steht. Eine bessere Erwiderung könnte dagegen folgende sein: Der Begriff einer Insel über die hinaus eine vortrefflichere Insel nicht gedacht werden kann, ist leer. Denn zu jeder Beschreibung einer Insel lässt sich eine weitere finden, die eine Insel von noch größerer Vortreff- 112 lichkeit beschreibt. Bei Gott dagegen als dem höchst vortrefflichen Wesen überhaupt, ist dies nicht möglich, weil so etwas wie Allwissenheit, Allmacht und Allgüte Maxima an Vortrefflichkeit sind. Aber über diesen Punkt müssen wir hier nicht entscheiden. Es würde uns zu einer komplizierten Diskussion über die Bedingungen maximaler Vortrefflichkeit führen. Anselm selbst hat jedoch, wie ich es sehe, niemals einen wirklich interessanten Einwand gegen Gaunilo vorgebracht. Nehmen wir nun an, Gaunilos Einwand wäre stichhaltig. Dann wissen wir zwar, dass mit Anselms Argument etwas nicht stimmen kann, wir wissen aber noch nicht, wo genau der Fehler liegt. Prinzipiell bieten sich uns folgende Möglichkeiten an: Wir können überprüfen ob die Prämissen wahr sind, oder wir können überprüfen ob sich aus den gegebenen Prämissen unter der Annahme, dass Gott nicht existiert, wirklich ein Widerspruch ergibt. Sehr viel ökonomischer und durchschlagender ist die letzte Option. Und es ist in der Tat so, dass sich der Widerspruch, den Anselm meinte ableiten zu können, nicht wirklich ergibt. Auf diesen Punkt haben – auf etwas verschiedene Weise – sowohl Alvin Plantinga, als auch Eric Gale hingewiesen. Um das zu sehen, müssen wir uns der Rede von möglichen Welten als einem Modell für die Bedeutung modalisierter Aussagen bedienen. Es ist möglich, dass Schmitz, der de facto existiert, nicht existiert. Das heißt paraphrasiert: Es gibt eine mögliche Welt, in der Schmitz nicht existiert. Es hätte sein können, dass Schmitz ein Sportler geworden wäre. Das heißt paraphrasiert: Es gibt eine mögliche Welt, in der Schmitz ein Sportler ist. Wenn wir dieses semantische Modell möglicher Welten applizieren, in dem wir von einem Individuum sagen können, dass es in mehr als einer Welt existiert, ergibt sich, dass der entscheidende Schritt in Anselms Argument – der Satz nämlich in Zeile 5 – nicht hinreichend spezifiziert ist. (5) Das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann, kann größer sein als es ist. Denn der Ausdruck „größer als es ist“ ist offenbar unvollständig, insofern wir eine Spezifikation der Welt bzw. der Welten brauchen. Unterstellen wir mit Anselm, dass Existenz eine Größe oder Vollkommenheit verleihende Eigenschaft ist, dann kann man sich die Notwendigkeit einer Weltspezifikation leicht verdeutlichen. Dass Supermann existiert, ist möglich. Er existiert aber nicht in der aktualen oder wirklichen Welt. Hier hat er nur fiktionalen Status. Es gibt aber eine mögliche Welt, in der Supermann existiert. Und seine Größe in dieser möglichen Welt übertrifft sein Größe in der aktualen Welt. Und genau aus den gleichen Gründen heraus können wir ohne Widerspruch auch von Gott sagen, dass er in einer möglichen Welt, in der er existiert, größer ist als in einer anderen Welt, in der er nicht existiert. Diese Art der Widerspruchsbeseitigung drängt sich auf, sobald wird die Prämisse, 113 dass es möglich ist, dass das, über das hinaus größeres nicht gedacht werden kann, existiert durch die Rede von möglichen Welten paraphrasieren. Sie lautet dann so: (1’) Es gibt eine mögliche Welt W und ein Individuum x, so dass gilt: x existiert in W und die Größe von x in W wird von keinem anderen Individuum in irgendeiner möglichen Welt übertroffen. So gelesen ist klar, dass x in W größer sein kann als in der aktualen Welt – genau dann nämlich, wenn x in der aktualen Welt nicht existiert. Das Problem mit Anselms Argument ist daher dieses: Anselm kann nicht zeigen, dass W die aktuale Welt ist und daher auch nicht, dass x in der aktualen Welt existiert. Der entscheidende Schritt seiner Reductio fällt also zusammen und damit auch der Anspruch, dass der Tor anerkennen muss, dass Gott existiert. b) Anselm, Descartes und Kants Kritik des ontologischen Arguments Das 3. Kapitel von Anselms Proslogion „Dass nicht gedacht werden kann, dass er nicht existiert“ beginnt mit folgender Passage: Das existiert schlechthin so wahrhaft, dass auch nicht gedacht werden kann, dass es nicht existiert. Denn es lässt sich denken, dass es etwas gibt, das als nichtexistierend nicht gedacht werden kann – was größer ist, als was als nichtexistierend gedacht werden kann. Wenn deshalb „das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann“ als nichtexistierend gedacht werden kann, so ist eben „das über dem Größeres nicht gedacht werden kann“, nicht das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann; was sich nicht vereinbaren lässt. So wirklich also existiert „etwas, über dem Größeres nicht gedacht werden kann“, dass es als nichtexistierend auch nicht gedacht werden kann. Und das bist Du, Herr, unser Gott. So wirklich also bist Du, Herr, mein Gott, dass Du als nichtexistierend auch nicht gedacht werden kannst. Es ist nicht ganz klar, ob Anselm hier rückblickend sein Kapitel 2 Argument kommentieren möchte, oder ob er ein weiteres, von dem ersten unabhängiges Argument vorzulegen gedenkt. Dass es sich hier um ein anderes Argument handelt ist einem Sinne klar, denn offenbar bedient sich Anselm hier anderer Prämissen als im Kapitel zwei. Unklar dagegen ist, ob dieses Argument wirklich etwas Neues bringt in dem Sinne, dass es von den Problemen des ersten Arguments nicht affiziert wird. Was neu an diesem Argument ist, ist offensichtlich, dass es von dem Begriff von etwas Gebrauch macht, das als nichtexistierend nicht gedacht werden kann. Aber es kommt auch noch ein anderer Punkt ins Spiel. Denn Anselms sagt in der zitierten Passage, dass das, was als nichtexistierend nicht gedacht werden kann, größer ist als etwas, das als nichtexistierend gedacht werden kann. Auf den ersten Blick zumindest 114 scheint das ein anderes Prinzip zu sein als das, auf das Anselm sich im Kapitel 2 Argument berufen hat. Im Kapitel 2 Argument, hatten wir gesehen, ging es Anselm nicht um einen Größenvergleich zwischen wirklich existierenden Dingen und möglichen, aber nicht wirklich existierenden Dingen, sondern um den Vergleich der Größe eines Dinges in unterschiedlichen Situationen. Hier dagegen wird offenbar ein Vergleich zwischen verschiedenen Objekten vorgenommen. Das Prinzip, auf das Anselm sich hier beruft scheint also folgendes zu sein: Für alle x und für alle y gilt: Wenn es nicht möglich ist, dass x nicht existiert, und wenn es möglich ist, dass y nicht existiert, dann ist x größer als y. Oder, anders formuliert: Für alle x und für alle y gilt: Wenn x in jeder möglichen Welt existiert, und wenn y nicht in jeder möglichen Welt existiert, dann ist x größer als y. Auf der Basis dieses Prinzip zusammen mit der schon bekannten Definition Gottes verläuft Anselms Argumentation tatsächlich anders als in Kapitel 2. (1) Etwas, das als nichtexistierend nicht gedacht werden kann, kann gedacht werden. [Prämisse] (2) Es kann gedacht werden, dass Gott nicht existiert. [Annahme für die reductio] (3) Was als nichtexistierend nicht gedacht werden kann, ist größer als was als nichtexistierend gedacht werden kann. [Prämisse] (4) Wenn Gott als nichtexistierend gedacht werden kann, dann kann Größeres gedacht werden als Gott. [Instanz von 3] (5) Es kann Größeres gedacht werden als Gott. [Widerspruch] (6) Es kann nicht gedacht werden, dass Gott nicht existiert. (7) Gott existiert. Ich möchte dieses Argument hier nicht näher auf seine Schlüssigkeit prüfen – wozu auch eine präzisere Formulierung vonnöten wäre – sondern mich mit einigen Hinweisen begnügen. Auch dieses Argument hat die Gestalt eines indirekten Beweises. Ein indirekter Beweis oder ein indirektes Argument zieht seine Beweiskraft intuitiv gesehen daraus, dass er ausschließlich von Aussagen ausgeht, die der Opponent des zu beweisenden Satzes teilt. Im Kapitel 2 Argument hatte Anselm sich zum Beispiel darauf berufen können, dass Gott, wie er sagt, im Verstande ist – auch im Verstande des Toren ist – da der Tor ja die Denkbarkeit der Existenz Gottes zugesteht. Das über dem hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, ist also im Verstande oder ist möglich. Bei dem jetzt vorliegenden Argument bedient sich Anselm der Prämisse, dass etwas, das als nichtexistierend nicht gedacht werden kann, gedacht werden kann. Aus dem Kontext der Argumentation ist es jedoch nicht klar, ob der Tor diese Prämisse 115 akzeptieren muss. Denn warum sollte es dem Toren verwehrt sein, folgenden Einwand zu machen: Alles, was existiert, kann auch nicht existieren. Daher ist es denkbar, dass Gott, selbst wenn er existiert, auch nicht existiert. Der Punkt ist hier der, dass Anselm offenbar nicht mehr an das Prinzip appellieren kann: Wenn der Tor versteht, was ich sage, dann ist, was ich sage, in seinem Verstand. Denn dann könnte ja auch der Tor daran appellieren und behaupten, dass, weil Anselm die Aussage, dass alles, was existiert, auch nicht existieren kann, versteht, eben dies auch wirklich denkbar sei. Der Argumentationskontext selbst lässt es also nicht zu, dass Anselm sich auf diese Prämisse stützen darf – selbst wenn sie wahr sein sollte. Ein weiteres Problem ergibt sich bei der zweiten Prämisse, die besagt, dass was als nichtexistierend nicht gedacht werden kann, größer sei, als das, was als nichtexistierend gedacht werden kann. Da uns dieses Prinzip, anders als beim ersten Argument, dazu einlädt unterschiedliche Individuen zu vergleichen, ergibt sich das Problem, das wir schon oben in unserer ersten Rekonstruktion von Anselms Argument gesehen haben. Denn offenbar impliziert die Aussage: etwas, das notwendig existiert, ist größer, als etwas, das nicht notwendig existiert, die Aussage: etwas, das existiert, ist größer, als etwas, das nicht existiert. Denn wie könnte notwendige Existenz eine Größe verleihende Eigenschaft sein, wenn nicht auch Existenz eine Größe verleihende Eigenschaft ist? Damit aber kommen wir wieder zu dem Prinzip: Was in Wirklichkeit existiert ist größer als was nur im Verstand ist. Und das bringt uns zu dem bereits als unplausibel zurückgewiesenen Prinzip: In den Vollkommenheit verleihenden Eigenschaften rangiert Existenz an erster Stelle, so dass, was nicht existiert auf jeden Fall geringer ist, als was existiert. Nach meiner Auffassung könnte Anselms zweite Prämisse nur unter der Bedingung akzeptiert werden, dass es nur genau ein Ding gibt, das als nichtexistierend nicht gedacht werden kann, und dass dieses Ding eben das ist, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Aber dann würde das Argument zirkulär und wertlos. Es gibt aber andere sehr berühmte und wirkungsmächtige Einwände gegen ontologische Argumente. Und diese wollen wir uns nun ansehen. Um ihnen einen Anhaltspunkt zu geben, betrachten wir zunächst das ontologische Argument von Descartes in seiner 5. Meditation. Im Endeffekt ist sein ontologisches Argument sehr einfach – sehr viel einfacher als Anselms Argumente. Die genaue Identifikation seines Arguments ist jedoch nicht so ganz einfach, insofern Descartes’ in seiner umfassenden Argumentation für die Existenz Gottes (sie umfasst die Abschnitte 7-16 der 5. Meditation ) mehrere Einwände berücksichtigt und bei der Beantwortung der Einwände einige Hilfsargumente konstruiert, die für seine Argumentation 116 insgesamt sehr wichtig sind, auch wenn sie vom zentralen ontologischen Argument verschieden sind. Anstatt die ganze Argumentation von Descartes zu rekonstruieren, möchte ich hier direkt mit der Türe ins Haus fallen und mich nur auf die Textstellen beziehen, in der sein Argument am deutlichsten hervortritt. Betrachten wir zunächst den Abschnitt 8. Dort heißt es: [...] bei allen anderen Dingen [bin ich gewohnt] das Dasein vom Wesen zu unterscheiden, so rede ich mir leicht ein, dass es auch vom Wesen Gottes getrennt werden könne und Gott sich so als nicht existent denken lässt. Achte ich indes sorgfältiger darauf, so wird deutlich, dass sich das Dasein vom Wesen Gottes ebenso wenig trennen lässt, wie vom Wesen des Dreiecks, dass die Größe seiner drei Winkel zwei rechte beträgt, oder von der Vorstellung des Berges die Vorstellung des Tales. Es widerspricht sich daher ebenso sehr, sich einen Gott, d.h. ein höchst vollkommenes Wesen zu denken, dem das Dasein fehlte, d. h. dem es an Vollkommenheit mangelte, als einen Berg zu denken ohne Tal. In dieser Passage wird die ganze Stoßrichtung des ontologischen Argument deutlich. Descartes will uns zeigen, dass, sobald wir uns die Konzeption oder die, wie er sagen würde, Idee Gottes nur aufmerksam vor Augen führen, sehen wir deutlich, dass Gott nicht nicht existieren kann. Das geht hervor aus dem Anfang des zweiten hier zitierten Satzes: „Achte ich indes sorgfältiger darauf, so wird deutlich [...]“. Das von Descartes hier anvisierte Argument ist nun in der Tat sehr einfach. Zunächst gibt er an, unter welcher Bedingung es sich denken lässt das Gott nicht existiert, und versucht dann zu zeigen, dass diese Bedingung unmöglich erfüllt sein kann. Die Bedingung ist nach Descartes Auffassung die: Dasein bzw. Existenz lässt sich vom Wesen bzw. der Essenz Gottes trennen. Anders gesagt: Existenz gehört nicht zum Wesen Gottes. Diese Bedingung kann aber nicht erfüllt sein, wenn es um Gott geht. Es sei nämlich, behauptet Descartes, ein Widerspruch, sich ein höchst vollkommenes Wesen zu denken, dem das Dasein fehlt. Dies kann aber offenbar nur dann ein Widerspruch sein, wenn Dasein oder Existenz zur Vollkommenheit irgendwie beiträgt – wenn also Existenz eine Vollkommenheit verleihende Eigenschaft ist. Dass das Descartes Auffassung ist, geht aus dem letzten Satz hervor, in dem implizite zum Ausdruck gebracht wird, dass „x fehlt es an Dasein“ impliziert „x fehlt es an Vollkommenheit“. Das in dieser Passage enthaltene Argument sieht also so aus: 117 (1) Gott ist das höchst vollkommene Wesen. [Prämisse] (2) Wenn Gott nicht existiert, dann gehört Existenz nicht zur Essenz Gottes. [Prämisse] (3) Alle Vollkommenheiten gehören zur Essenz eines höchst vollkommenen Wesens. [Prämisse] (4) Existenz ist eine Vollkommenheit. [Prämisse] (5) Existenz gehört zur Essenz eines höchst vollkommenen Wesens. [Aus 3 und 4] (6) Gott existiert. [Aus 1, 2 und 5] Betrachten wir noch die direkt folgende Passage (Abschnitte 9 und 10), in denen sich Descartes selbst einen Einwand macht: Aber gesetzt auch, dass ich Gott nur als existierend denken könnte, wie einen Berg nicht ohne Tal, so folgt doch sicher daraus, dass ich den Berg mit dem Tale denke, nicht, dass es überhaupt einen Berg in der Welt gibt, und ebenso wenig scheint daraus, dass ich Gott als existierend denke, zu folgen, dass Gott existiert, legt doch mein Denken den Dingen keine Notwendigkeit auf. Und ebenso wie ich mir ein geflügeltes Pferd bildlich vorstellen kann, wenngleich kein Pferd Flügel hat, so könnte ich etwa auch Gott das Dasein andichten, wenn gleich gar kein Gott existiert. Doch nein! Hier liegt der Trugschluss; denn daraus, dass ich den Berg nicht ohne Tal denken kann, folgt allerdings nicht, dass Berg und Tal irgendwo existieren, sondern nur, dass Berg und Tal, sie mögen nun existieren oder auch nicht existieren, voneinander nicht getrennt werden können. Dagegen folgt daraus, dass ich Gott nur als existierend denken kann, dass das Dasein von Gott untrennbar ist und demnach, dass er in Wahrheit existiert, - nicht als ob mein Denken dies bewirkte, oder als ob es irgendeiner Sache eine Notwendigkeit auferlegte, sondern im Gegenteil deshalb, weil die Notwendigkeit der Sache selbst, nämlich des Daseins Gottes, mich zu diesem Gedanken bestimmt. Genauer betrachtet macht sich Descartes hier zwei verschiedene Einwände. Der erste beruht auf dem Berg-Tal Beispiel, der zweite auf dem Beispiel mit dem geflügelten Pferd. Aus der Untrennbarkeit von Berg und Tal folgt nicht, wie Descartes selbst hervorhebt, dass überhaupt irgendein Berg und ein Tal existiert. Und das ist richtig. Denn aus „Kein Berg ohne Tal“ folgt lediglich, dass, wenn es einen Berg gibt, es dann auch ein Tal gibt. Und das ist verträglich mit „Berge existieren nicht.“ Entsprechend würde z. B. auch daraus, dass die Idee Gottes untrennbar mit der Idee der Allmacht verbunden ist, nicht folgen, dass Gott existiert, sondern nur, dass, wenn Gott existiert, dann auch ein allmächtiges Wesen existiert. Dass aber die Idee Gottes mit dem Konzept der Existenz untrennbar verbunden ist, lässt – so hebt Descartes 118 hervor – die Möglichkeit der Nicht-Existenz Gottes nicht mehr zu. Der zweite Einwand, dem Descartes begegnet, besagt, dass Gott das Dasein ja auch nur angedichtet sein könnte, oder dass es, anders gesagt, eine bloße Stipulation ist, dass Existenz zum Wesen Gottes gehört. Und aus bloßen Stipulationen sind metaphysisch irrelevant, insofern aus irgendwelchen begrifflichen Festlegungen nichts über die Welt folgen kann. Diesem Einwand begegnet Descartes, indem er die Behauptung, es handle sich hier um eine willkürliche Festlegung des Denkens, zurückweist. Es steht, betont er, mir nicht frei Gott ohne Dasein zu denken, denn dass ich Gott immer nur mit der Idee der Existenz zusammendenken kann, verdankt sich gar nicht meinem Denken, sondern der Notwendigkeit der Sache selbst. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen von Descartes, können wir das oben genannte Argument abspecken, und seinen Gedanken einfach so wiedergeben: (1) Gott ist das höchst vollkommene Wesen. [Prämisse] (2) Ein höchst vollkommenes Wesen hat alle Vollkommenheiten. [Prämisse] (3) Existenz ist eine Vollkommenheit. [Prämisse] (4) Gott existiert. [Aus 1, 2 und 3] Irgendwie, möchte man meinen, ist dieses Argument viel zu einfach um die Existenz Gottes beweisen zu können. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Der springende und verletzliche Punkt in diesem Argument scheint die dritte Prämisse zu sein – die Behauptung, dass Existenz eine Vollkommenheit oder eine Vollkommenheit verleihende Eigenschaft ist. Das ist auch der Punkt, den Kant in seiner Kritik des ontologischen Gottesbeweises, ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt hat. Kants Kritik des ontologischen Beweises findet sich in seiner Kritik der reinen Vernunft und zwar innerhalb der sogenannten transzendentalen Dialektik – demjenigen Teil, in dem er die rein rationale Seelenlehre (rationale Psychologie), die rein rationale Kosmologie und schließlich auch die rein rationale Theologie als eine Logik des Scheins entlarven wollte – als Anmaßungen der Vernunft, ohne Bezug auf die Erfahrung Erkenntnisse gewinnen zu können. Die für uns interessanten Stellen sind im vierten Abschnitt des dritten Hauptstücks der transzendentalen Dialektik enthalten. Und hier ist auf die Überschrift zu achten: Von der Unmöglichkeit eines ontologischen Beweises vom Dasein Gottes. Kants Anspruch ist also enorm. Er will nicht irgendein besonderes ontologisches Argument kritisieren, sondern zeigen, dass jedes ontologische Argument notwendigerweise fehlerhaft und ohne Beweiskraft ist. Dieser Anspruch mag selbst recht anmaßend klingen, konnte Kant doch selbst unmöglich alle möglichen ontologischen Argumente kennen. Aber sein Gedanke ist der, dass bei jedem ontologischen Argument versucht wird aus dem Begriff 119 Gottes auf seine Existenz zu schließen, und seine Zurückweisung des ontologischen Beweises beruht eben auf dem Versuch nachzuweisen, dass aus Begriffen niemals auf die Existenz von etwas geschlossen werden kann. Kants Einwände bündeln sich in diesem einen Gedanken, er bringt aber dennoch mehrere verschiedene vor. In Bezug auf das Argument von Descartes ist jedoch ein Einwand von besonderer Bedeutung – Kants berühmte Behauptung nämlich, dass Existenz kein reales Prädikat sei. Mit dieser Kritik zielt Kant direkt auf die Prämisse, dass Existenz eine Vollkommenheit ist. Er bestreitet diese Prämisse zwar nicht direkt, indem er etwa zu zeigen versuchte, dass Existenz nicht zu den Eigenschaften gehört, die man als Vollkommenheit verleihende Eigenschaften beschreiben könnte. Er bestreitet vielmehr die Implikation dieser Prämisse – dass nämlich Existenz überhaupt eine Eigenschaft ist. Kann er das zeigen, erübrigt sich natürlich jede weitere Frage danach, ob Existenz Vollkommenheit verleiht oder nicht. Sehen wir uns Kants Argumentation selbst an: Sein ist offenbar kein reales Prädikat, d. i. ein Begriff von irgend etwas, was zu dem Begriffe eines Dinges hinzukommen könne. Es ist bloß die Position eines Dinges, oder gewisser Bestimmungen an sich selbst. [...] Der Satz: Gott ist allmächtig, enthält zwei Begriffe, die ihre Objekte haben: Gott und Allmacht; das Wörtchen; ist, ist nicht noch ein Prädikat oben ein, sondern nur das, was das Prädikat beziehungsweise aufs Subjekt setzt. Nehme ich nun das Subjekt (Gott) mit allen seinen Prädikaten (worunter auch die Allmacht gehöret) zusammen, und sage: Gott ist, oder es ist ein Gott, so setze ich kein neues Prädikat zum Begriffe von Gott, sondern nur das Subjekt an sich selbst mit allen seinen Prädikaten, und zwar den Gegenstand in Beziehung auf meinen Begriff. Beide müssen genau einerlei enthalten, und es kann daher zu dem bloßen Begriffe, der bloß die Möglichkeit ausdrückt, darum, dass ich dessen Gegenstand als schlechthin gegeben (durch den Ausdruck: er ist) denke, nichts weiter hinzukommen. Und so enthält das Wirkliche nichts mehr als das bloß Mögliche. Hundert wirkliche Taler enthalten nicht das mindeste mehr, als hundert mögliche. Denn, da diese den Begriff, jene aber den Gegenstand und dessen Position an sich selbst bedeuten, so würde, im Fall dieser mehr enthielte als jener, mein Begriff nicht den ganzen Gegenstand ausdrücken, und auch nicht der angemessene Begriff von ihm sein. Aber in meinem Vermögenszustand ist mehr bei hundert wirklichen Talern, als bei dem bloßen Begriffe derselben [...]. Denn der Gegenstand ist bei der Wirklichkeit nicht bloß in meinem Begriffe analytisch enthalten, sondern kommt zu meinem Begriffe [...] synthetisch hinzu, ohne dass, durch dieses Sein außerhalb meinem Begriffe, diese gedachten hundert Taler selbst im mindesten vermehrt werden. Wenn sich also ein Ding, durch welche und wie viele Prädikate ich will (selbst in der durchgängigen Bestimmung), denke, so kommt dadurch, dass ich noch hinzusetze, dieses 120 Ding ist, nicht das mindeste zu dem Dinge hinzu. Denn sonst würde nicht eben dasselbe, sondern mehr existieren, als ich im Begriffe gedacht hatte, und ich könnte nicht sagen, dass gerade der Gegenstand meines Begriffes existiere. (KrV B 626 ff.) Dieser Text ist nicht gerade ein Musterbeispiel von Klarheit. Was Kant insgesamt sagen möchte, scheint jedoch hinreichend deutlich zu sein. Die zentrale These ist: Sein bzw. Existenz ist kein reales Prädikat. Was meint Kant damit überhaupt? Das lässt sich klären, wenn wir beachten, dass Kant nicht sagt, dass Existenz kein Prädikat ist, sondern dass Existenz kein reales Prädikat ist. Es kommt ihm offensichtlich auf die Qualifikation „real“ an. Ohne diese Qualifikation wäre Kants Behauptung offenbar falsch. Denn „Tiger existieren“ ist offenbar ein wohlgeformter und auch informativer Satz, bei dem „Tiger“ das Satzsubjekt und „existieren“ das Satzprädikat bilden. Im grammatischen Sinn von Prädikat ist also Existenz bzw. das Verb „existieren“ durchaus ein Prädikat. Kant kann nun aber auch nicht meinen, dass Existenz kein Prädikat ist, weil es uninformativ wäre, so etwas wie „Tiger existieren“ zu sagen. Denn das ist offensichtlich nicht uninformativ, denn dieser Satz sagt ja etwas über die Welt aus. Was Kant sagen will, ist daher offenbar dies: In einem Satz wie „Tiger existieren“ wird nichts über Tiger ausgesagt. Und in diesem Sinne handelt es sich nicht um ein reales Prädikat – es handelt sich, so können wir sein These übersetzen, nicht um ein beschreibendes Prädikat. Beachten Sie, dass diese Behauptung, wenn sie wahr ist, das ontologische Argument nur dann treffen kann, wenn gilt: (A) Wenn Existenz eine Eigenschaft ist, dann ist „existiert“ ein beschreibendes Prädikat. Denn offenbar würde nur unter dieser Voraussetzung aus Kants These, dass „existiert“ kein beschreibendes Prädikat ist, folgen (per modus tollens nämlich), dass Existenz keine Eigenschaft ist. (A) scheint jedoch vollkommen plausibel und akzeptabel zu sein. Eine Eigenschaft wie Röte ist ja ein Charakteristikum, das ein Ding haben oder nicht haben kann. Ein Ausdruck nun, der eine Eigenschaft bezeichnet – etwa der Ausdruck „rot“ – dient daher, wenn er als Prädikat in einem Satz Verwendung findet, der Charakterisierung von Dingen, und ist folglich ein beschreibendes Prädikat. Also ist (A) nur eine Instanz von: Wenn F eine Eigenschaft ist, dann ist ein F bezeichnender Ausdruck, wenn er grammatisch als Prädikat verwendet wird, ein beschreibendes Prädikat. Wenn (A) akzeptierbar ist, hängt Kants Einwand gegen das ontologische Argument also ganz von der Prämisse ab, dass „existiert“ kein beschreibendes Prädikat ist. Kant will uns nun offenbar darauf aufmerksam machen, dass der Ausdruck „existiert“, wenn wir so etwas sagen wie oder „Tiger existieren“ eine andere Funktion hat als beschreibende Prädikate. Wir sagten schon, dass mit Tiger existieren nichts 121 über Tiger, aber durchaus etwas über die Welt gesagt wird. Kants Gedanke ist offenbar der, dass die wahre Funktion von „existiert“ in „Tiger existieren“ die folgende ist: Es wird zum Ausdruck gebracht, dass das Konzept des Tigers auf etwas Anwendung hat, dass es etwas gibt, was unter das Konzept Tiger fällt, oder auch: dass Tigersein exemplifiziert/instanziiert ist. Das geht aus der Stelle hervor an der Kant sagt: „[Sage ich] Gott ist, oder es ist ein Gott, so setze ich kein neues Prädikat zum Begriffe von Gott, sondern nur das Subjekt an sich selbst mit allen seinen Prädikaten, und zwar den Gegenstand in Beziehung auf meinen Begriff.“ Das was Kant hier mit „den Gegenstand in Beziehung auf den Begriff setzen“ umschreibt, scheint mir nichts anders zu sagen als dass, wenn wir behaupten, Gott existiert, wir dann behaupten, dass der Begriff „Gott“ Anwendung hat oder dass der Begriff „Gott“ instanziiert ist. Und wenn Kant etwas umständlich und unklar sagt wir würden damit aber kein neues Prädikat zum Begriff von Gott hinzusetzen, dann meint er eben, dass wir mit „existiert“ keine weitere Beschreibung des Satzsubjekts geben. Und wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, scheint Kant hier auch recht zu haben. Denn Existenzaussagen können offenbar nicht als sinnvolle Antworten auf „Was ist x“-Fragen verstanden werden. Wenn mich jemand fragt „Was ist ein Tiger“ und ich sage „Tiger sind große fleischfressende Katzen“, ist das eine ganz passable Antwort, aber „Tiger existieren“ offenbar nicht. Und das zeigt uns, das wir „existiert“ nicht zur Charakterisierung von Dingen verwenden können. Der Unterschied, den Kant zum Ausdruck bringen wollte, spiegelt sich übrigens auch in der symbolischen Notationsweise der modernen formalen Logik wieder. So würden wir zum Beispiel für „Atlantis ist eine Insel“ Fa schreiben (lies: a ist F) wobei „a“ eine Individuenkonstante bzw. ein Kürzel für den singulären Terminus „Atlantis“ ist, und „F“ das Prädikat ist, das die Eigenschaft, eine Insel zu sein, bezeichnet. „Atlantis existiert“ würde dagegen so nicht notiert werden, sondern so: (x) (x = a), wobei x eine Variable ist und „a“ wiederum die Individuenkonstante ist, die für „Atlantis“ steht. Das ist freilich kein zusätzliches Argument. Denn wir hätten keine Schwierigkeiten, Existenzaussagen auch dann in der Standardnotation wiederzugeben, wenn „existiert“ ein reales Prädikat wäre. „Atlantis existiert“ würde dann einfach geschrieben werden als (x) (Fx (x = a)) wobei F dann die Eigenschaft der Existenz ausdrücken würde. Ist damit die Sache erledigt? Zunächst einmal ist darauf hinzuweisen, dass nicht alle Philosophen diese Sicht akzeptieren. Aber dem kann ich hier nicht im Detail nachgehen, weil es mit technisch anspruchsvollen Dingen zu tun hat, sondern mich mit einigen kleinen Hinweisen begnügen. Hat Kant wirklich gezeigt, dass „existiert“ eine ganz andere Funktion ausübt als beschreibende Prädikate? Das ist nur der Fall, wenn seine alternative Sicht der 122 Funktion von „existiert“ eine befriedigende Analyse darstellt. Kant würde „Tiger existieren“, wie wir gesehen haben, so interpretieren, dass er besagt, dass der Begriff „Tiger“ instanziiert ist. Es gibt einige Objekte, heißt das, welche Instanzen des Begriffs „Tiger“ sind. Aber was, könnte man nun fragen, kann das denn anderes heißen, als dass Instanzen des Begriffs Tiger existieren? Aber wie sollte nun dieser Gebrauch von „existiert“, der in der Analyse von „existiert“ auftaucht nun seinerseits analysiert werden? Es würde offenbar nicht weiterhelfen den Satz „Instanzen des Begriffs Tiger existieren“ zu analysieren als „Der Begriff „Instanzen des Begriffs Tiger“ ist instanziiert“, denn hier würde dasselbe Problem wieder auftauchen. Und das heißt aber, dass der Begriff der Existenz immer wieder in der Analyse von Existenzaussagen gebraucht und folglich von dieser Analyse präsupponiert wird. Dieser Einwand der Zirkularität ist einer der Einwände, die Collin McGinn in seinem Buch Logical Properties gegen die orthodoxes Sicht über Existenzsätze gemacht hat. Aber nehmen wir an, dies sei nur ein technisches Problem, und es könnte gelöst werden. Dann bleibt noch ein weiteres. Kant scheint nämlich nicht gezeigt zu haben, dass „existiert“ überhaupt kein beschreibendes Prädikat ist, sondern nur, dass „existiert“ nicht zur Charakterisierung von Objekten (wie Tiger, Menschen oder auch Gott) verwendet werden kann. Denn wenn wir „Tiger existieren“ analysieren als „Der Begriff „Tiger“ ist instanziiert“ dann analysieren wir ihn durch einen Satz der etwas über den Begriff „Tiger“ sagt und dann hätten wir die Sicht, die Gottlob Frege vertreten hat, dass Existenz nämlich eine Eigenschaft von Begriffen ist. Um nun sagen zu können, dass ontologische Beweise unmöglich sind, müsste man daher zeigen, dass sie nur unter der Voraussetzung funktionieren können, dass Existenz eine Eigenschaft von Objekten ist. Das ist aber etwas, was Kant offenbar gar nicht getan hat. (Vgl. hierzu den Artikel von Clement Dore „Ontological Arguments“ im Blackwell Companion to the Philosophy of Religion). Es gibt nun aber zwei sehr viel stärkere Einwände, die gegen den ontologischen Beweis in der Form, wie ihn Descartes vorgelegt hat, sprechen. Der eine Einwand durchzieht die ganze Argumentation, die John Mackie gegen ontologische Argumente vorgebracht hat. Mackies Punkt ist, dass es ein Dilemma gibt, das das ontologische Argument zu Fall bringt. Nehmen wir an, Existenz ist keine Eigenschaft, dann bricht das ontologische Argument zusammen, weil dann die Prämisse, dass Existenz eine Vollkommenheit ist, falsch ist. Nehmen wir aber an, Existenz sei eine Eigenschaft, dann ist das ontologische Argument unschlüssig. Denn seine Konklusion ist die Aussage „Gott existiert“ im Sinne von „Es gibt Gott“. Wenn jedoch „Existenz“ eine Eigenschaft ist, wie zum Beispiel „Allmacht“, dann, so Mackie, können wir ja immer die Frage stellen, ob es denn ein solches Wesen, zu dessen Beschreibung die Existenz 123 dazugehört, auch wirklich gibt. Denn wenn wir berechtigt sind, zu fragen, ob es ein als allmächtig charakterisiertes Wesen auch wirklich gibt, dann sind wir auch berechtigt, zu fragen, ob es ein als existierend charakterisiertes Wesen auch wirklich gibt. Das Dilemma besteht also darin, dass das Argument entweder eine falsche Prämisse enthält, oder unschlüssig ist. Wie wir die Sache auch drehen und wenden, es hat keine Beweiskraft. Der letztere Punkt ist vielleicht nicht unmittelbar einleuchtend. Denn wenn wir uns in Descartes hineinversetzen, dann würden wir einwenden wollen, dass es doch offenbar widersprüchlich sei zu behaupten, dass es Gott, zu dessen Wesen die Existenz gehört, möglicherweise nicht existiert. Aber wenn wir die Sache näher betrachten liegt darin in der Tat kein Widerspruch. Nehmen wir mit Descartes an, dass Gott als das höchst vollkommene Wesen charakterisiert ist, zu dessen Vollkommenheit verleihenden Eigenschaften unter anderem die Eigenschaft der Existenz gehört. Daraus folgt nicht, dass Gott existiert, sondern lediglich dies: dass kein nicht-existierendes Individuum Gott ist. Anders formuliert: Es folgt nicht, dass Gott existiert, sondern nur, dass wenn etwas Gott ist, es dann existiert. Ob aber etwas Gott ist – ob es ein Individuum gibt, auf das der Ausdruck „Gott“ zutrifft – ist darin nicht eingeschlossen. Vielleicht haben wir hier aber nur ein Problem, weil wir nicht berücksichtigt haben, dass Descartes nicht nur behauptet, Existenz sei eine Eigenschaft, sondern stärker behauptet, Existenz sei eine essentielle Eigenschaft Gottes. Aber auch das hilft nicht weiter. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass es eine essentielle Eigenschaft von Sokrates ist eine Person zu sein, dann sagen wir damit, dass es keine Umstände geben kann, in denen Sokrates existiert und keine Person ist. Anders gesagt, in jeder möglichen Welt, in der Sokrates existiert, ist Sokrates eine Person. Daher läuft die Behauptung, dass es eine essentielle Eigenschaft von Gott ist, zu existieren, auf die schlichte Tautologie heraus, dass Gott in jeder möglichen Welt existierend ist, in der er existiert. Und das wiederum ist vollkommen verträglich mit der Aussage, dass Gott nicht existiert oder dass es Gott nicht gibt. Selbst wenn daher Kants Einwand nicht stichhaltig wäre, würde das Descartes Argument nicht helfen, denn die Frage, ob es Gott gibt, ist weiterhin offen, auch wenn Existenz als ein Charakteristikum der Gottheit aufgefasst werden könnte. Den letzteren Einwand halte ich für den stärksten gegen Descartes Version des ontologischen Arguments sprechenden Einwand. Zu Kant möchte ich noch folgendes sagen. Er hat aufgezeigt, dass ontologische Argumente wie das von Descartes und eventuell das Kapitel 3 Argument von Anselm mit erheblichen Problemen konfrontiert ist. Was er meiner Ansicht nach aber nicht gezeigt hat, ist die Unmöglichkeit eines beweiskräftigen ontologischen Arguments. Die Argumente, die wir betrachtet haben, sind in der Tat wertlos. Aber wie können wir annehmen, dass jedes 124 ontologische Argument solche Defekte aufweist? Ein Punkt könnte der sein, dass ontologische Argumente Existenz als eine Vollkommenheit verleihende Eigenschaft betrachten müssen. Das scheint mir aber ein erhebliches Problem zu sein. Denn wir können so etwas wie Wissen, Gerechtigkeit usw. problemlos als Vollkommenheit verleihende Eigenschaften bezeichnen, weil Wissen und Gerechtigkeit Werte sind. Aber wie sollte man Existenz als einen Wert verstehen: Was ist wertvoll daran, zu existieren? Ist ein existierender Satan irgendwie vorzugswürdig vor einem bloß vorgestellten Satan? Das kann ich nicht sehen. Und wenn alle ontologische Argumente wirklich von dieser Auffassung abhängig sein sollten – was nicht ausgemacht ist – dann haben sie in der Tat ein Problem. . 125 IV. Die Übel in der Welt als ein Problem für den Theismus Dass die Welt voll von Übeln ist, wird von keinem, der bei gesundem Verstand ist, bestritten. Für den Theismus ist dieses Faktum eine besondere Herausforderung. Denn zu den prominentesten und profundesten Einwänden gegen die Rationalität des Glaubens gehören Argumente aus dem Faktum des Übels. Argumente dieser Art sind Argumente, die für den Atheismus als der einzig rationalen Position über den religiösen Glauben angeführt werden. Argumente für die Existenz Gottes sind nur unter der Bedingung von ausschlaggebender Relevanz, dass der religiöse Glaube, um rational akzeptierbar zu sein, eine Basis in natürlicher Theologie bedarf. Einige theistische Philosophen wie Plantinga, Alston und Wolterstorff haben diese Vorstellung jedoch fallengelassen und die Position verteidigt, dass die Akzeptierbarkeit des Glaubens an Gott nicht von natürlicher Theologie abhängt. Sie haben also bestritten, dass der Glaube einer positiven Apologie bedarf. Diese Verteidigung gilt dem Vorwurf, dass es keine Evidenz für die Existenz Gottes gibt. Atheistische Argumente aus dem Faktum der Übel in der Welt sind nun aber nicht etwa Argumente, die sagen, dass es keine Evidenz für die Existenz Gottes gibt, sondern Argumente, die sagen, dass es Evidenz für die Nicht-Existenz Gottes gibt. Selbst wenn es daher richtig wäre, dass der Glaube keiner positiven Apologie bedarf, wäre damit die Sache des Glaubens noch nicht hinreichend verteidigt. Deshalb glaubte etwa Plantinga, dass der Glaube angesichts von positiven Argumenten für den Atheismus durchaus negativer Apologie bedarf. Negative Apologie ist dann eine Verteidigung der Rationalität des Glaubens gegen Argumente für den Atheismus. Das Problem, mit dem sich der Theismus konfrontiert sieht, nimmt grundsätzlich zwei unterschiedliche Gestalten an. Es gibt auf der einen Seite das sogenannte logische oder Konsistenzproblem und auf der anderen Seite das evidentielle Problem. Das logische Problem ist das Problem der Vereinbarkeit der Existenz Gottes mit den Übeln in der Welt. Hier handelt es sich offenbar um das vordringlichste Problem. Denn wenn der Glaube an Gott logisch 126 unvereinbar ist mit der Tatsache, dass es Übel in der Welt gibt, dann ist der Glaube an Gott klarerweise aufzugeben. Denn, wie gesagt, dass es Übel in der Welt gibt, kann von niemandem mit gesundem Verstand, bestritten werden. Wenn aber die Vereinbarkeit gezeigt werden könnte, ist damit noch nicht alles getan, um eine negative Apologie des Glaubens zufriedenstellend zu gestalten. Denn logische Vereinbarkeit zeigt nur, dass es nicht unmöglich ist, dass Gott existiert, obwohl die Welt voller Übel ist. Aber das etwas nicht unmöglich ist, gibt uns natürlich noch lange nicht den geringsten Grund an etwas zu glauben. Die atheistische Herausforderung die bestehen bleibt ist, dass es angesichts der Übel in der Welt vollkommen unplausibel ist anzunehmen, dass Gott existiert. Mit herausragender Klarheit hat schon David Hume in seinen Dialogen über natürliche Religion diese zwei Aspekte des Problems des Übels herausgearbeitet. Im 10. Teil sagt Philo zu Cleanthes: Ich will zugeben, dass Leid und Elend im Menschen mit unendlicher Macht und Güte in der Gottheit [...] vereinbar ist. Aber was nützen dir all diese Zugeständnisse? Die bloße Möglichkeit, die in einer Vereinbarkeit liegt, reicht nicht aus. Du musst vielmehr diese reinen, ungetrübten und unumschränkten Eigenschaften aus den vorliegenden gemischten und wirren Erscheinungen – und zwar aus ihnen allein – beweisen. (Hume, Dialoge, 104) Die Vereinbarkeit von Leid und Elend mit der Existenz Gottes räumt Philo hier nur aus Zwecken der Argumentation ein. Und sein Punkt ist der, dass selbst dann, wenn das Problem der Vereinbarkeit ausgeräumt werden kann, das Problem bestehen bleibt, wie man auf Basis unserer Erfahrung der Welt plausibler Weise zu der Auffassung kommen kann, dass sie von einem allmächtigen, allwissenden und unumschränkt gütigen Gott erschaffen und gelenkt wird. Das vordringliche Problem ist jedoch, wie gesagt das der Vereinbarkeit. Von einigen Philosophen ist behauptet worden, dass diese Problem nicht gelöst werden kann, so dass Atheismus als die einzig konsistente Position übrig bleibt. So schreibt John Mackie: 127 An diesem Problem [des Übels] schein deutlich zu werden, dass dem traditionellen Theismus nicht nur jede vernünftige Grundlage fehlt, sondern dass er auch positiv widervernünftig ist, weil einige seiner zentralen Aussagen einander widersprechen. (Mackie, Wunder des Theismus, S. 238) Dieselbe Einschätzung finden wir auch bei H. J. McCloskey: Evil is a problem for the theist in that a contradiction is involved in the fact of evil, on the one hand, and the belief in the omnipotence and perfection of god. Worin das Problem liegt, hat schon Epikur deutlich gemacht. Entweder gibt es Übel in der Welt, weil Gott sie nicht verhindern kann. In diesem Fall ist er nicht allmächtig. Oder es gibt sie, weil er sie nicht verhindern will. In diesem Fall ist er nicht gütig. Oder es gibt sie, weil er nicht weiß, wie man Übel verhindern kann. Dann ist er nicht allwissend. Der Gedanke ist also schlicht der, dass die Aussagen: (1) Es gibt einen allmächtigen, allwissenden und unumschränkt gütigen Gott. und (2) Es gibt Übel in der Welt. logische miteinander unverträglich sind. Betrachten wir diese beiden Aussagen genau, dann sehen wir aber schnell, dass sie nicht unmittelbar oder aus formalen logischen Gründen allein miteinander unverträglich sind. Ihre Unverträglichkeit ergibt sich nur, was auch Mackie selbst hervorhebt, unter gewissen Zusatzannahmen. Zu diesen Zusatzannahmen gehört etwa: (a) Ein allwissendes Wesen weiß, wie man Übel verhindern kann; (b) Ein allmächtiges Wesen hat die Macht, Übel zu verhindern oder zu beseitigen; (c) Ein vollkommen gutes Wesen will Übel verhindern oder hat eine Pflicht Übel zu verhindern; (d) Es ist nicht notwendig, dass Übel existieren. Im folgenden möchte ich mich kurz mit zwei Verteidigungsstrategien beschäftigen. Bei beiden müssen wir im Auge behalten, dass es hier ausschließlich um die Frage der logischen Konsistenz, d.h. der Möglichkeit der Existenz Gottes angesichts der Übel in der Welt geht. 128 Beide Verteidigungsstrategien versuchen zu zeigen, dass es in einem gewissen Sinne unumgänglich ist, dass es Übel in der Welt gibt. Die eine Verteidigungsstrategie beruft sich dabei darauf, dass die Welt als ganze betrachtet gut ist und dass auch in einer guten Welt notwendig Übel vorkommen. Die zweite Verteidigung ist die sogenannte Willensfreiheitsverteidigung, die sich darauf beruft, dass moralische Gutheit nur auf der Basis von Willensfreiheit möglich ist, dass aber Geschöpfe mit einem freien Willen notwendig auch frei sind Böses zu tun, so dass Böses auch durch Gott nicht verhindert werden kann. Betrachten wir zunächst die erste Art einer Theodizee. In Humes Dialogen wird sie von Demea wie folgt vorgetragen: Diese Welt ist bloß ein kleiner Punkt im Vergleich zum Universum, dieses Leben bloß ein Augenblick im Vergleich zur Ewigkeit. Die gegenwärtigen Übel werden deshalb in anderen Regionen und in einem künftigen Zeitabschnitt des Daseins berichtigt. Und die Augen der Menschen, die dann für eine umfassendere Sicht der Dinge geöffnet sind, erblicken nun den Gesamtzusammenhang der allgemeinen Gesetzmäßigkeiten und verfolgen in Anbetung die Güte und Rechtschaffenheit der Gottheit durch all die verschlungenen Pfade. Demeas Theodizee versucht unseren Blick auf das große Ganze zu lenken. Er lädt uns ein zu bedenken, dass diese Welt – er meint damit offenbar unsere eigene Lebenswelt oder die Umgebung in der wir leben – nur ein Teil eines Ganzen (des Universums) ist. Und er lädt uns ein, zu bedenken, dass dieses Leben, wie wir es selbst erfahren, nur ein verschwindender Augenblick verglichen mit der Ewigkeit ist. Diese Erweiterung unseres Blicks soll dann dazu führen, dass wir lernen, die Übel, die wir wirklich erfahren, nicht als für sich bestehende Zustände anzusehen, sondern als in einen umfassenderen Zusammenhang eingeordnete Aspekte der gesamten Wirklichkeit. So betrachtet, sind dann die Übel nicht mehr etwas in sich selbst schlechtes und nichts absolut beklagenswertes. Denn sie werden, wie Demea sagt, in anderen Regionen und in einem künftigen Zeitabschnitt berichtigt. Damit meint er offenbar, dass es einen Ausgleich oder eine Kompensation für die wirklich erlebten Übel gibt. Obwohl Demea hier nicht explizit ist, ist es doch recht klar, was er damit meint. Ein Ausgleich in anderen Regionen des Universums besteht darin, dass dort keine Übel oder Übel 129 nicht in dem Ausmaß herrschen wie in unserer Menschenwelt. Ein Ausgleich in künftigen Zeitabschnitten ist entweder, wörtlich verstanden, ein Ausgleich in diesem Leben, oder, übertragen verstanden, ein Ausgleich in einem Leben der Person nach dem Tod. Betrachten wir die Dinge so im Zusammenhang des Großen Ganzen oder sind wir dereinst fähig die Dinge so zu betrachten, dann sehen wir ein, dass die Übel in der Welt ein notwendiger Bestandteil einer Gesamtwirklichkeit sind, die von guten und gerechten Gesetzen regiert ist. Was ist von dieser Theodizee zu halten? Demeas Theodizee ist nicht von Interesse, weil sie raffiniert und mit guten Argumenten vorgetragen wird, sondern weil wir an ihr ablesen können, wie eine Theodizee prinzipiell nicht funktionieren kann. Demeas Theodizee enthält zwei charakteristische Elemente: (1) Der Appell an das große Ganze; (2) Der Appell an die Beschränktheit der menschlichen Sicht. Betrachten wir einmal wie diese beiden Aspekte in Demeas Theodizee zusammenspielen. Der Appell an die Beschränktheit der menschlichen Sicht soll uns ermahnen, dass wir unsere Einschätzung der Übel in der Welt nicht für ausschlaggebend halten sollen. Dass wir etwa auf den Gedanken kommen, die Existenz eines allmächtigen, allwissenden und uneingeschränkt gütigen und gerechten Gottes sein mit der Existenz von Übeln in der Welt unvereinbar, liegt nur daran, dass wir aus unserer beschränkten Sicht heraus urteilen. Der Appell an das große Ganze übernimmt dann zwei Funktionen: Er soll zum einen die negative Behauptung stützten, dass unsere Interpretation von Vorkommnissen von Übeln als etwas in sich selbst Schlechtem, das besser nicht vorkommt, eine Interpretation nur von unserem beschränkten Standpunkt aus ist; er soll zum anderen die positive Behauptung stützen, dass eine Interpretation von Übeln, die von der Warte des großen Ganzen aus vorgenommen wird, zu einem ganz anderen Ergebnis führt – nämlich dem, dass die Welt entgegen dem Augenschein gut und gerecht organisiert ist. Nun könnte man gegen Demea ja einwenden, dass er doch ebenso wie alle anderen Menschen auch, nicht anders als eben aus der beschränkten Perspektive urteilen kann, und das daher die positive Behauptung, dass die Welt als ganze betrachtet gut und gerecht organisiert ist, 130 jeglicher Grundlage entbehrt. Hier wird Demea antworten, dass das hieße, unsere Perspektive zum Maßstabe des ganzen zu machen, und dass wir, würden wir das große Ganze angemessen verstehen, wir dann auch sehen würden, dass Übel auch in einer gut und gerecht organisierten Welt vorkommen müssen. Und hier – an dieser selbstimmunisierenden Behauptung – sehen wir nun, was an Demeas Theodizee faul ist. Das Problem ist einfach, dass Demea als erwiesen voraussetzt, was es aller erst zu erweisen gilt. Demea spricht als Gläubiger, der eben annimmt, dass es einen allmächtigen, allwissenden und uneingeschränkt gütigen Gott gibt. Und unter dieser Annahme muss die Existenz Gottes mit den Übeln in der Welt notwendig vereinbar sein. Denn wenn Gott existiert, dann kann es nichts geben, was mit seiner Existenz unvereinbar ist. Indem Demea also vom Standpunkt des Gläubigen spricht, setzt er die Vereinbarkeit Gottes mit den Übeln in der Welt voraus. Aber gerade das war ja das Problem, was in Frage steht. Anders gesagt, Demea hat in keiner Weise erklärt, wie diese Vereinbarkeit zustande kommt. Was wir hier lernen, ist also, dass keine Theodizee funktionieren kann, die heimlich voraussetzt, dass Gott existiert. Aus diesem Grund scheitert auch die Leibnizsche Theodizee, die von der Vorstellung Gebrauch macht, dass diese Welt die beste aller möglichen Welten ist. Diese Welt ist für Leibniz die beste aller möglichen, weil Gott, der Allmächtige, Allwissende und Allgütige notwendig diejenige Welt erschafft, die die beste unter allen möglichen Welten ist. Und daher sind eben Vorkommnisse von Übeln notwendig Bestandteile der besten aller möglichen Welten. Wir können Gott nicht anklagen, weil er es ja nicht hätte besser machen können. Diese Theodizee ist genau wie Demeas zum Scheitern verurteilt, weil sie eben voraussetzt, was in Frage steht: Die Existenz Gottes voraussetzen heißt die Vereinbarkeit der Existenz Gottes mit den Übeln in der Welt voraussetzen. Wer als Gläubiger spricht kann daher das Problem der Vereinbarkeit notwendig nicht lösen; er umgeht es immer nur. Daraus können wir nun eine wichtige Folgerung ziehen. Der Appell an die menschliche Beschränktheit kann keine tragende Rolle in der Diskussion des Vereinbarkeitsproblems spielen. 131 Denn das Problem der Vereinbarkeit ist überhaupt kein epistemologisches Problem, bei dem es darum geht, ob wir irgendwelche Einsichten in Gottes Vorsehung haben können, sondern das rein konzeptuelles Problem ob die göttlichen Attribute mit den Vorkommnissen von Übeln zusammen bestehen können. Eine Frage etwa, warum Gott zugelassen und nicht verhindert hat, dass die Tsunami Welle mehrere hunderttausend Menschen vernichtet, stellt sich erst dann, wenn Gott existiert. Und wenn das feststeht oder geglaubt wird, dann kann man so etwas anführen wie: Wir können es nicht wissen, wir haben keinen Einblick in Gottes Vorhersehung usw. Ein weiterer Punkt, den wir angesichts von Demeas Theodizee auch noch lernen können, ist der, dass das Vereinbarkeitsproblem nicht gelöst werden kann durch eine Wegerklärung oder Umdeutung von Übeln. Demea hat die typische Tendenz, die Übel in der Welt als etwas Unbedeutendes umzuinterpretieren. Aber es ist klar, dass das nicht nur vollkommen unplausibel und abwegig, wenn nicht sogar skandalös ist, sondern dem Vereinbarkeitsproblem auch nicht weiterhelfen kann. Denn dieses Problem haben wir ja gerade, weil es zum Beispiel nicht so leicht fällt einzusehen, wie es einen allgütigen Gott geben kann, der noch dazu allmächtig und allwissend ist, wenn es Übel in der Welt gibt. Würden wir Übel oder Leiden als etwas Unbedeutendes ansehen, dann würden wir damit unmittelbar aber auch den Begriff der Güte uminterpretieren. Es gehört offenbar zum Begriff eines maximal gütigen Wesens, dass es niemanden leiden lässt, dass es keine Leiden hervorbringt und Leiden verhindert, sofern ihm das möglich ist. Wäre Leiden nun etwa an sich Unbedeutsames, würden wir gar nicht mehr verstehen können, was es heißt gütig oder maximal gütig zu sein. Mit einer Uminterpretation von Leid und Übeln kann das Vereinbarkeitsproblem daher niemals gelöst, sondern nur umgangen werden – aber um den Preis, dass wir dann gar nicht mehr verstehen können, was es heißt, von einem gütigen Gott zu sprechen. Schauen wir uns nun zum Abschluss noch die Verteidigung Plantingas an. Diese Verteidigung hat nur ein Ziel, nämlich zu zeigen, dass es logische möglich ist, dass sowohl Gott als auch 132 Übel existieren. Sie richtet sich also bewusst nur gegen den Vorwurf der Inkonsistenz oder positiven Irrationalität des theistischen Glaubens. Wir hatten gesehen, dass der Vorwurf der Unvereinbarkeit besagt, dass die beiden Aussagen (1) Es gibt einen allmächtigen, allwissenden und unumschränkt gütigen Gott. und (2) Es gibt Übel in der Welt. logische miteinander unverträglich sind. Wie kann man nun im allgemeinen zeigen, dass zwei Aussagen A und B miteinander logisch verträglich sind? Plantinga deutet hier eine generelle Strategie an. Wir müssen eine weitere Aussage C finden, die möglicherweise wahr ist, die mit der Aussage A logisch verträglich ist, und zusammen mit A die Aussage B impliziert. Und genau das ist es, was Plantinga mit seiner Verteidigung anhand der Willensfreiheit leisten möchte. Seine Suche nach einer solchen weiteren Aussage, welche die angegebenen Bedingungen erfüllt, beginnt mit der Beschreibung einer möglichen Welt, der Skizze eines Szenarios über menschliche Freiheit im Verhältnis zu göttlicher Allmacht: A world containing creatures who are sometimes significantly free (and freely perform more good that evil actions) is more valuable, all else being equal, than a world containing no free creatures at all. Now God can create free creatures, but he cannot cause or determine them to do only what is right. For if he does so, then they are not significantly free after all; they do not do what is right freely. To create creatures capable of moral good, therefore, he must create creatures capable of moral evil; and he cannot leave these creatures free to perform evil and at the same time prevent them from doing so. God did in fact create significantly free creatures; but some of them went wrong in the exercise of their freedom: this is the source of moral evil. The fact, that these free creatures sometimes go wrong, however, counts neither against God’s omnipotence nor against his goodness; for he could have forestalled the occurrence of moral evil only by exicising the possibility of moral good. Die Aussage, nach der Plantinga gesucht hat, um zu zeigen, dass Gottes Existenz mit den Übeln in der Welt logisch vereinbar ist, können wir aus dieser Passage extrahieren. Sie lautet: 133 (3) Gott ist allmächtig aber es steht nicht in seiner Macht eine Welt zu erschaffen, die moralische Gutheit aber keine moralische Schlechtigkeit enthält. Der Anspruch Plantingas ist also, gezeigt zu haben, dass es möglich ist, dass Gott, wenn er eine Welt erschafft, dann eine Welt mit freien Kreaturen erschafft, die Schlechtes tun (also etwa Leid verursachen). Diese Aussage impliziert nun aber in Verbindung mit der Aussage, dass Gott existiert, die Aussage, dass Übel oder Schlechtes existiert. Und damit ist gezeigt, dass Gottes Existenz mit den Übeln in der Welt vereinbar ist. Betrachten wir kurz einige Einwände. Einige Autoren wie Anthony Flew und John Mackie haben entgegnet, dass es wohl möglich ist, dass es eine Welt gibt, in der freie Wesen immer das richtige tun. Wenn das richtig ist, dann ist es nicht wahr dass ein allmächtiges Wesen keine Welt erschaffen kann in der freie Akteure immer gut handeln. Und dann fällt die Verteidigung Plantingas in sich zusammen. Hier spielen nun zwei entscheidende Fragen eine Rolle. Einmal die Frage, was Allmacht impliziert. Zweitens die Frage, was Freiheit ist. Plantinga hat seine Behauptung, dass auch ein allmächtiges Wesen nicht bestimmen kann, ob freie Geschöpfe Gutes oder Schlechtes tun, durch den Hinweis darauf beantwortet, dass es zwar möglich ist, dass ein freies Geschöpf eine freie Handlung ausführt, dass es aber nicht für irgendjemanden anderen möglich sein kann, ein freies Geschöpf dazu zu bringen, eine freie Handlung auszuführen. Denn jemanden dazu bringen, eine Handlung auszuführen, heißt, dass diese Handlung nicht frei ausgeführt wurde. Also ist der Sachverhalt: Gott bestimmt, dass A die Handlung H frei ausführt, unmöglich realisierbar, und daher keine Einschränkung von Allmacht. Problem 1: Plantingas Theodizee beruht auf der sogenannten inkompatibilistischen Theorie der Freiheit, der zu Folgen Freiheit und Determiniertheit des Handelns nicht miteinander verträglich sind. Nach der kompatibilistischen Auffassung ist das aber falsch: Eine Person kann auch dann frei handeln, wenn sie nichts anderes hätte tun können. Ist die kompatibilistische Auffassung richtig, dann steht es aber in Gottes Macht zu bewirken, dass 134 Menschen frei Gutes tun und Schlechtes unterlassen. Die Willensfreiheitstheodizee verlangt also eine Verteidigung des Inkompatibilismus. Problem 2: Die Willensfreiheitstheodizee mag zwar die Vereinbarkeit der Existenz Gottes mit moralischen Übeln erweisen können; sie ist aber nicht in der Lage die Vereinbarkeit der Existenz Gottes mit der Existenz sogenannter natürlicher Übel zu zeigen (Krankheiten, Naturkatastrophen usw.). Hätte ein gütiger Gott nicht eine Welt schaffen können, in der solche natürlichen Übel nicht vorkommen (Also andere Randbedingungen oder andere Naturgesetze). Plantinga sieht darin allerdings kein echtes Problem: Es ist denkbar, dass die Gesetzmäßigkeiten der Natur Wirkungen des Handelns freier Wesen sind. Das ist zwar nicht plausibel, wenn es aber denkbar (logisch möglich) ist, dann ist das Problem der natürlichen Übel kein eigenständiges Problem mehr, sondern reduziert auf das Problem der moralischen Übel und die Willensfreiheitstheodizee tritt wieder auf den Plan. 135