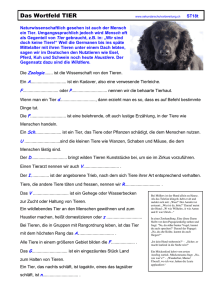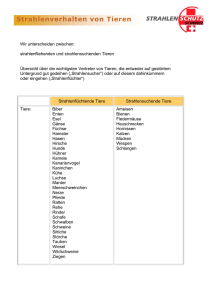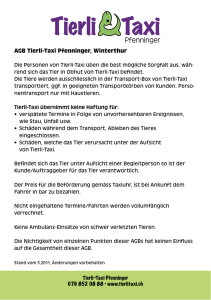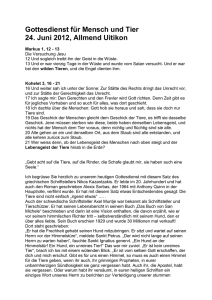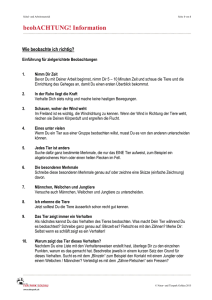Der Gott des Alten Testaments
Werbung

Gerlitz, Peter, (1926-): Mensch und Natur in den Weltreligionen: Grundlagen einer Religionsökologie. Darmstadt, Wiss. Buchges., 1998. <72:> „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!” Menschen und Tiere unter der gleichen Verheißung Jahwes Der Gott des Alten Testaments: Schöpfer über der Schöpfung „Ich fragte die Erde, und sie sprach: Ich bin nicht Gott. Und dasselbe bekannte alles, was auf Erden ist. Ich fragte das Meer und die Abgründe und die kriechenden Tiere unter den lebendigen Seelen, und sie antworteten: Wir sind nicht dein Gott, frage über uns hinaus (quaere super nos)! Ich fragte die behenden Winde, und die ganze Luft mit ihren Bewohnern antwortete: Anaximenes irrt sich, wir sind nicht Gott./1/ Ich fragte den Himmel, die Sonne, den Mond und die Sterne, und sie sprachen: Auch wir sind nicht Gott, den du suchst. Und ich sagte all denen, welche die Pforte meines Daseins (Fleisches) umstehen: Ihr habt mir von meinem Gott gesagt, was ihr nicht seid; sagt mir doch etwas von ihm. Und sie riefen mit lauter Stimme: Er hat uns geschaffen." Dieses schöne Wort, das aus den >Bekenntnissen< des Kirchenvaters Augustinus (354-430) stammt (Augustinus >Confessiones< X, 6,9), ist ein eindrucksvolles Beispiel für die biblisch-christliche Schöpfungslehre. Es macht unmißverständlich klar, daß der gläubige Mensch Gott nicht in den Objekten der Schöpfung, in den Kreaturen, zu suchen habe, sondern „über die Schöpfung hinaus" fragen müsse. Dem alttestamentlichen wie dem neutestamentlichen Frommen, Juden und Christen, ist es verwehrt, den Schöpfer in der Schöpfung selbst zu suchen: Alle Tiere und „alles, was Odem hat", alle Pflanzen und alles, was die Schönheit der Schöpfung veranschaulicht, die Elemente und die Gestirne, die einmal Träger des göttlichen Geistes waren und im Alten Vorderen Orient sogar als Gottheiten verehrt wurden – in der Bibel werden sie ihrer Göttlichkeit entkleidet, sind sie keine Götter mehr und haben ihre einstige numinose Bedeutung verloren. Sie sind jetzt nur mehr Hülsen, Objekte, Gegenstände der Forschung, aus denen die Gottheit ausgezogen ist. Sie haben allenfalls noch einen Hinweischarakter, tragen die vestigia Dei, die Spuren <73:> Gottes, an sich und sind Zeichen seiner Allmacht. Und nur darum sind sie in der Lage, Gott als ihren Schöpfer zu loben, und nur insofern sind sie „beseelt". Zwar ist es die göttliche Liebe, die ihre Schönheit hervorbrachte, die die Sonne und die Gestirne schuf, wie Dante am Ende seines >Paradiso< bekennt – aber alle Schönheit der Geschöpfe wird zum blassen Abbild des wahren und einzigen Urbildes Gott. Ihn spiegeln die Geschöpfe wider, ihn verehren und loben sie; denn er ist ihr Erschaffer, der sie einst aus dem Nichts ins Sein rief und ihnen seinen Odem verlieh. Ohne ihn wären sie im Nichts geblieben; nur mit und durch Gott sind sie. Das Wesen der Geschöpfe ist darum – auf den Schöpfer bezogen – passiv, weil sie nur dessen Urbild reflektieren und nur zum Stammeln des Lobes fähig sind. Das haben sie mit den Menschen gemeinsam. Die Bibel und die aus ihr hervorgegangenen Religionen haben die Tiere und Pflanzen, die Elemente und Gestirne entgöttert, „entseelt" und sie zu Objekten des einen und einzigen Gottes gemacht. Dieser These wollen wir jetzt nachgehen. Gottes Bund mit den Tieren Nachdem die Sintflut vorüber ist und Noah samt seiner Familie und den Tieren die Arche verlassen hat, wird Gott durch ein Brandopfer versöhnt. Die Versöhnung geschieht durch einen Bund (befit), den Gott mit den Menschen schließt. Jahwe-Gott leitet diesen Bund mit einem Schwur ein: „Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht" (Gen 8,21 b-22). Doch dieser Noah-Bund erfährt eine Erweiterung: auch die Tiere werden mit einbezogen. Wie die Menschen erhalten sie darin ihren Platz: Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm: Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, daß hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und <74:> allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, daß ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, daß hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, daß ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah: Das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. (Gen 9, 8-17; vgl. Janowski/Neumann-Gorsolke u. a. 1993, S. 331) Feierlich verpflichtet sich Jahwe hier, Menschen und Tiere nicht wieder zu verderben, wie es während der Sintflut geschehen war. „Die ursprüngliche Lebensgemeinschaft ist wieder das Ziel" (Schreiner 1993, S. 233). Sie soll darin bestehen, daß Menschen und Tiere und damit die Natur in ihrer Geschöpflichkeit Gott gegenüberstehen. Gott redet sie zwar nicht an; denn die Tiere und alle lebenden Wesen außer dem Menschen tragen keine Verantwortung, sie sind auch nicht mitschuldig geworden an der Katastrophe der Sintflut, aber sie müssen sie zusammen mit den Menschen – erleiden. Sie sind mitgefangen in die Schuld der Menschen; schicksalhaft sind sie darin verstrickt und können sich von selbst nicht befreien. Darum stiftet Gott seinen Bund auch für die Tiere. Bezeichnenderweise besteht dieser Tier-Schutz-Bund in einem Naturereignis, das uns vertraut ist und das wir immer wieder bestaunen: dem Regenbogen (Gen 9,13 f.). Dieses Zeichen des Gottesbundes umspannt die sichtbare Erde wie eine Schwurhand und hält gleichzeitig die Wassermassen davon ab, auf die Erde herabzuregnen und eine neuerliche Überschwemmung hervorzurufen. Gott hält dabei die Wassermassen jenseits des Himmelsgewölbes zurück, indem er die Schleusen verschließt und sie fortan nur dann öffnen will, wenn Menschen und Tiere Wasser brauchen und die Pflanzen wachsen sollen. Der Regenbogen aber wird zur Brücke zwischen Himmel und Erde und damit zum Symbol der Versöhnung zwischen Jahwe und den Menschen einerseits und den Menschen und der Natur andererseits. Das Symbol des Regenbogens leitet den Frieden in der Schöpfung ein. Gen 9 ist nicht die einzige Stelle, an der von einem „Bund Gottes mit den Tieren" die Rede ist. Auch beim Propheten Hosea findet sich eine solche auf die paradiesische Endzeit hinweisende Verheißung: Wenn endlich die Untreue Israels ein Ende haben wird, die <75:> fremden Götter ausgelöscht sind und Jahwe wieder mit seinem Volk in ehelicher Treue vereint sein wird, dann wird dieser Bund die gesamte Schöpfung umfassen: „Und ich will zur selben Zeit für siez einen Bund schließen mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm des Erdbodens und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen" (Hos 2,20). Dieser Text ist insofern interessant, weil er die Tiere zu Bundespartnern Gottes macht und damit den Noah-Bund erweitert: Die Tiere werden gleichsam als Mitunterzeichner dieses Gottesvertrags ernst genommen. Diese Unterzeichnung wird schließlich den Frieden einleiten; zunächst in der Natur und dann zwischen den Menschen. Die Waffen, mit denen bisher Menschen gegen Menschen und Menschen gegen Tiere vorgingen, werden von Gott „vertilgt", zerbrochen werden. Der Friede in der Natur wird den Schöpfungsfrieden einleiten. Tiere verkörpern numinose Mächte In dem Jahr, als der König Usija starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Serafim standen über ihm; ein jeder hatte sechs Flügel: mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße, und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum andern und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll! Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Serafim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, daß deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei! (Jes 6,1-7; nach: Janowski/NeumannGorsolke u. a. 1993, S. 326). Dieser Text, der von der Berufung des Propheten Jesaja erzählt, enthält eine Vision und eine Audition, eine numinose Erscheinung und eine numinose Offenbarung, die beide von geheimnisvollen, mythischen Wesen ausgehen. Es sind Seraphim, geflügelte Fabelwesen, Schlangen oder Drachen gleich, die – ähnlich wie die Cherubim, welche den Zugang zum Paradies bewachen – Gottes Gegenwart repräsentieren und darum die Prototypen des Fascinosum und des Tremendum sind, wie Rudolf Otto sagt (Otto 1963, S. 5-7, 42-52 u. ö.). Sie verbergen die unnahbare Gottheit und verbergen zugleich <76:> sich selbst, indem sie sich mit den Flügeln bedecken. Der Prophet kann die Nähe Gottes, die ihm im Traum geoffenbart wird, nur ahnen, ansichtig wird er ihrer nicht. Aber er vernimmt die Stimmen, welche unwirklich und zugleich unheimlich über ihm ertönen: „Heilig, heilig, heilig ist Jahwe Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll!" In diesem Augenblick überträgt sich die Macht der unsichtbaren Gottheit auf die mythischen Wesen, so daß die Türangeln in den Tempelschwellen erzittern und der gesamte Tempel in Rauch gehüllt wird. Kein Mensch kann eine solche Erfahrung ertragen. Darum ruft auch Jesaj a erzitternd und erschauernd: „Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen." Erst nachdem einer der Seraphim mit einer glühenden Kohle den Mund des angehenden Propheten entsühnt und ihn damit von seiner Schuld befreit hat, ist das Tabu von ihm genommen, und er kann berufen werden. Tiere bzw. tierähnliche, theriomorphe Wesen übernehmen hier auf Grund ihrer numinosen Macht die Funktionen Gottes: sie erscheinen als himmlische Mächte und sprechen Worte, die zu sagen nur Gott zustehen. Tierähnliche Wesen wirken als die Medien Jahwes, die die Botschaft der transzendenten Gottheit an die Sterblichen übermitteln. Vielleicht sind die Seraphim in alter Zeit selber einmal Gottheiten gewesen, als man im vorstaatlichen Israel noch besondere Tiere als Träger der göttlichen Mächte anbetete. Der Jesajatext bestätigt uns aber solche Vermutungen nicht; er ist eindeutig monotheistisch und läßt für die Tierverehrung keinen Raum. Das ist im Exodus-Buch anders. Hier wird vom Tanz um das Goldene Kalb erzählt, einer theriomorphen Gottheit, in welcher die Israeliten die Verkörperung der numinosen Macht erblickten: Als das Volk aber sah, daß sich Moses Herabkunft vom Berge verzögerte, rottete sich das Volk gegen Aaron zusammen, und sie sagten zu ihm: Auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen mögen; denn was diesen da, Mose, den Mann, der uns aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat, angeht, so wissen wir nicht, was ihm geschehen ist. Da sagte Aaron zu ihnen: Reißt die goldenen Ringe ab, die eure Frauen, Söhne und Töchter an den Ohren tragen, und bringt sie zu mir. So rissen sich alle Leute die goldenen Ringe ab, die sie an den Ohren trugen, und brachten sie zu Aaron. Der nahm sie aus ihrer Hand entgegen und verschloß es (nämlich das Gold) in einem „Beutel" und machte daraus ein gegossenes Kalb. Da sagten sie: Dies sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Lande Ägypten heraufgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er vor ihm einen Altar auf, und Aaron rief aus und sagte: Ein Fest für Jahwe ist morgen! So opferten sie denn am nächsten Morgen früh <77:> Brandopfer und brachten Gemeinschaftsopfer dar; und das Volk setzte sich hin, um zu essen und zu trinken, und dann standen sie auf, um sich zu belustigen. (Ex 32,1-6) Die Erzählung hat noch eine Vorgeschichte: Während sich Mose auf dem Sinai aufhält, um die Vorschriften und Gesetze zur Einrichtung der Stiftshütte usw. zu empfangen – nach Ex 24,18 beträgt die Dauer seiner Abwesenheit die mythische Zahl von vierzig Tagen und Nächten –, überkommt das Volk Israel eine Frustration, in der der Glaube an den Einen Gott Jahwe in Frage gestellt wird. Der Erzähler, die sogenannte „Priesterschrift", berichtet den Vorfall so, als sei das Volk nach einer gewissen Zeit der Glaubenstreue von dem Einen Gott Jahwe abgefallen und habe Zuflucht bei einem der Götter Ägyptens, einer Stiergottheit gefunden. Er läßt die Leser glauben, diese Stiergottheit sei gewissermaßen plötzlich in der Erinnerung des Volkes aufgetaucht und als Helfer in der Not begrüßt worden. In Wirklichkeit dürfte der Stier als Verkörperung der numinosen Gottesmacht seit dem Aufbruch aus Ägypten und trotz der Verkündigung des Einen Gottes Jahwe durch Mose immer eine potentielle Glaubensmöglichkeit auf der Wüstenwanderung gewesen sein. Das Volk greift hier gleichsam auf den „Glauben der Ahnen" zurück und erwartet von ihm eher Hilfe als von jener unsichtbaren Gottheit, die nur ein Deus absconditus, ein verborgener Gott, ist und sich außer gewissen Zeichen am Himmel und einer wunderbaren Führung durch das Meer nirgends offenbart, während das Goldene Kalb allen sichtbar vor Augen ist. Aaron ist dafür der Gewährsmann; er teilt nicht mehr die Meinung des Mose, sondern die des Volkes, das nach sichtbaren und potenten Göttern ruft. Er ist es, der das Tier in die Erinnerung seines Volkes zurückholt, und es zeigt sich dabei, daß der Stierkult offenbar rasch wieder seine Anhänger findet. Das Numen des Tieres „lebte" nur im Verborgenen und im Schatten des übermächtigen Jahwe. Aber es war da, war vorhanden und brauchte nur belebt zu werden. Und das geschieht hier: Die Erzählung vom Goldenen Kalb ist ein Beispiel dafür, daß das heilige Tier während der Wüstenwanderung stets zugegen war und gleichsam nur darauf wartete, vom Volk herbeigerufen zu werden. Tiere sind Segensträger Numinose Mächte können immer beides sein: Sie können Segen über Mensch und Natur bringen, und sie können Fluch verbreiten; <78:> sie sind ambivalent. Im ersten Falle werden sie zu Boten Gottes, im zweiten Falle zu Überträgern dämonischer Mächte. Bei Hirten und Ackerbauern – und das Volk Israel hat im Laufe seiner Geschichte beide Gesellschaftsstrukturen durchgemacht – gilt das säugende Muttertier und sein Junges als die „Manifestation des Segens" (Janowski/Neumann-Gorsolke u. a. 1993, S. 15). Überall im Vorderen Orient kannte man dieses Bild und verstand es als Ausdruck göttlicher Geborgenheit und Liebe. Das berühmte Grabrelief aus Giza und das Relief auf dem Sarg der Kauit (vgl. Janowski/ Neumann-Gorsolke u. a. 1993, S. 15, 17) sprechen dazu eine beredte Sprache. Emma Brunner-Traut faßt das innige Verhältnis zwischen Kuh und Kalb im Alten Ägypten zusammen in den Worten: „Zu Kuh und Kalb hatte der Ägypter ein besonders enges Verhältnis, das Kälbchen wurde nahezu verzärtelt. Die kuhmütterliche Sorge um ihr Junges findet ebenso sprachlichen Ausdruck in folgenden Worten, die einem Bild unterlegt sind, unter dem geschrieben steht: „Er sehnt sich danach wie die Kuh, die ihr Kälbchen ruft, wenn es fern von ihr ist." Kuh und Kalb galten als „das von der Natur geschenkte Symbol für das Mutter-Kind-Verhältnis" (Brunner-Traut 1987, S. 36). Dieses enge Verhältnis von Muttertier und Jungtier ist uns auch aus dem Alten Testament bekannt. So heißt es z. B. in den Ritualtexten Ex 22,28 b und 29: „Deinen ersten Sohn sollst du mir geben (spricht Gott). So sollst du auch tun mit deinem Stier und deinem Kleinvieh: Sieben Tage laß es bei seiner Mutter sein, am achten Tag sollst du es mir geben." Oder Lev 22,27: „Wenn ein Rind oder Schaf oder eine Ziege geboren ist, so soll das Junge sieben Tage bei seiner Mutter sein; aber am achten Tage und danach darf man es Jahwe opfern, so ist es wohlgefällig." Ausdrücklich und scharf wendet sich der Bauer und Prophet Amos gegen diejenigen seiner Landsleute, die das Kalb bereits schlachten, während es noch an den Vorderfuß der Mutter angebunden ist. Und er fordert eine allmähliche Entwöhnung von Kalb und Kuh, bis das Jungtier ohne Muttermilch leben und dann auch – nämlich als selbständiges Tier – geschlachtet werden kann (Amos 6, 1-7). Bernd Janowski spricht in diesem Zusammenhang von einer „numinosen Scheu vor dem Geheimnis des Lebens" (in: Janowski/ Neumann-Gorsolke u. a. 1993, S. 17), doch darf man in diesen Text nicht zuviel Mitleidsempfinden mit den Tieren hineinlesen; vielmehr läßt sich Amos hier wohl von seinem bäuerlichen Instinkt leiten, und darin ist dann auch sein Zorn gegenüber den verschwenderischen Reichen begründet. Verantwortung für die Tiere und ihre Nutzbarmachung, das dürften seine Grundmotive sein. <79:> Von dieser Verantwortung sind auch Dtn 22,6 u. 7 geprägt, wo es heißt: „Wenn du unterwegs ein Vogelnest findest auf einem Baum oder auf der Erde mit Jungen oder mit Eiern, und die Mutter sitzt auf den Jungen oder auf den Eiern, so sollst du nicht die Mutter mit den Jungen ausnehmen, sondern du darfst (nur) die Jungen ausnehmen, aber die Mutter sollst du fliegen lassen, auf daß dir's wohl gehe und du lange lebest." Aus dem letzten Text spricht fast ein ökologisches Verhalten, wenn der Wanderer um Schonung der Art ersucht wird und daran die Verheißung geknüpft wird „auf daß ... du lange lebest". Leben zerstören – auch wenn es noch so unbedeutend ist – ist immer mit Schuld verbunden, während Leben erhalten in jedem Falle zum Segen gereicht. Hier hat sogar die Erhaltung eines scheinbar bedeutungslosen Vogellebens das Wohlergehen und das lange Leben des Menschen zur Folge. Damit ist ein beachtenswerter ökologischer Zusammenhang von Mensch und Tier gegeben: Was dem Tier schadet, das schadet auch dem Menschen; was dem Tier zugute kommt, das kommt auch dem Menschen zugute. Aber Tiere vermitteln nur den Segen des Schöpfers; sie selber sind nicht Subjekt des Segnens. Das wird in den zahlreichen Arbeiten über die Bedeutung der Tiere in der Bibel häufig vergessen. Subjekt seines Segnens ist und bleibt Gott selbst. Gott bedient sich nur der Menschen und der Tiere sowie der gesamten Natur, diesen Reichtum des göttlichen Segens als Lebenskraft zu empfangen und weiterzugeben. Eine eindrucksvolle Stelle ist Psalm 104, wo es in den Versen 27 bis 30 heißt: Es warten alle (Lebewesen) auf dich, daß du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du machst neu die Gestalt der Erde. In diesen Versen wird die Kontinuität des Jahwesegens angesprochen: Gott erneuert diesen Segen über Mensch und Tier immer wieder, und damit erneuert er auch die Erde, d. h., er gibt ihr die Chance zur Erneuerung. „Im Anfang" aber, als Gott Himmel und Erde schuf, nahm auch der Segen einmal seinen Ausgang: „Und Gott segnete sie [nämlich die Tiere des Wassers und der Luft] und sprach: `Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden' (Gen 1,22). <80:> Der Segen geschieht durch das göttliche Wort. Das göttliche Wort besitzt Segenskraft, indem es Wirkungen auf der Erde hervorbringt. Eine dieser Wirkungen — sozusagen die Grundbedingung von Sein und Werden — ist die Fruchtbarkeit. Indem Jahwe mit seinem Segen Fruchtbarkeit auf Erden bewirkt, setzt er einen Prozeß in Gang, der nicht aufhört und kein Ende hat, solange die Erde besteht (Gen 8,22; vgl. Steck 1981, S. 65). Der Segen wirkt auf Grund seiner vielfältigen Manifestationen in der Menschen- und Tierwelt und in der gesamten Natur interdependent, d. h., er „bindet" die Geschöpfe aneinander und macht sie voneinander abhängig. Tiere sind Überträger von Flüchen Numinose Mächte manifestieren sich auch in der Gestalt von Dämonen. Sie verkörpern das Unheil unter den Menschen und bilden — gegenüber dem Bereich des Segens — eine Gegenwelt, die sich sowohl gegen die Menschen als auch gegen Gott richtet. Dämonen leben in unwegsamen Gegenden wie der Wüste und im kahlen Gebirge. Sie tragen Tiergestalt oder bestehen aus einer Mischgestalt aus Mensch und Tier. Die ägyptische Mythologie ist reich an solchen Dämonen (vgl. Gerlitz 1992, S.160ff.), aber die mesopotamische Mythologie ist noch reicher. Dort stellte man sich z. B. die Krankheitsdämonin Lamaschtu mit Löwenkopf oder Vogelkopf, Eselsohren, Hunde- und Eselszähnen, gefiedertem Unterleib und Adlerkrallen vor (Abb. in: Janowski/Neumann-Gorsolke u. a. 1993, S. 279). Solche theriomorphen Unheilsgestalten sollten Angst einflößen, die Gefahren symbolisieren und die Allgegenwärtigkeit der Krankheit beschwören, vor der kein Mensch sicher sein kann. Die Ugarit-Texte und Amulette berichten von theriomorphen weiblichen Dämonen, welche Wölfen oder Hunden ähnlich sahen und mit einem Skorpionschwanz ausgestattet waren (Loretz 1990, S. 65 u. 90). Ihnen fallen besonders Neugeborene zum Opfer. Das Alte Testament bedient sich dieser mesopotamischen bzw. kanaanäischen Dämonologie und versucht, sie zu integrieren, so daß z. B. die im Kontext der Umwelt als Manifestationen des Bösen selbständig auftretenden Dämonen auf einmal zu dämonischen Wesen werden, die im Auftrag Jahwes handeln und nicht mehr selbständig sind; so z. B. Schlangen, Hunde, Löwen, der unheimliche Maschhit, der „Verderber" (Ex 12,23) und vor allem Azazel, der Bock, der die Sünden in die Wüste hinausträgt (Lev 16,10 u. 21 f., vgl. Janowski/Koch u. a. 1993 S. 281) Auch therio<81:> morphe Wesen werden im Alten Israel als Dämonen gefürchtet. Dazu gehören die Scheirim, die „Haarigen" (Lev 17,7). Diese Tierdämonen treten in Gruppen auf und hausen in der Wüste und auf menschenleeren Trümmerstätten (Janowski/Koch u.a. 1993, S. 281), dort warten sie auf ihren unheimlichen Einsatz. Jes 13,21 f. gibt uns einen Einblick in das dämonische Treiben: Wüstentiere werden sich da lagern, und ihre Häuser werden voll Eulen sein. Strauße werden da wohnen, und Feldgeister werden da hüpfen, und wilde Hunde werden in ihren Palästen heulen und Schakale in den Schlössern der Lust. Ihre Zeit wird bald kommen, und ihre Tage lassen nicht auf sich warten. Die tiergestaltigen Dämonen repräsentieren eine bedrohende, den Menschen überlegene Macht. Zwar sind sie integriert in den Heilsplan Jahwes und können deshalb von sich aus nichts tun. Aber zugleich stellen sie die dunkle Seite Jahwes dar, die unheimliche Seite des Deus absconditus, des verborgenen Gottes. Dämonen tragen und übertragen den Fluch auf die Menschen, und der Fluch hat — im Gegensatz zum Segen — die Unfruchtbarkeit zur Folge. Wer verflucht ist, dessen Acker trägt nicht mehr, dessen Tiere werfen nicht mehr, dessen Kinder sterben. Die Dämonen sind die Träger und Überträger von Krankheit, Leid und Tod. Und Tiere oder tiergestaltige Wesen dienen dabei als Medien. Tiere als Vorbilder der Menschen Häufig werden in der Bibel Tiere den Menschen als nachahmenswerte Beispiele vor Augen geführt. Denn es heißt, sie „kennen" die Naturgesetze instinktiv und richten sich nach ihnen. Besonders an den Vögeln und ihrem Verhalten lassen sich solche Kenntnisse ablesen. Wenn sie Zugvögel sind, so halten sie Jahr für Jahr die Zeiten ihres Wegzugs und ihrer Rückkehr ein. Instinktiv fühlen sie, daß sie im Frühjahr wieder heimkehren müssen, auch wenn sie dabei um die halbe Welt zu fliegen haben. Sie haben einen Instinkt, der den Menschen — und das heißt im Alten Testament dem Volk Israel — verlorengegangen ist. Das Volk Israel — klagen Jeremia (Jer 8,6) und Jesaja (Jes 1,3) — besitzt diesen Instinkt nicht mehr: „Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit, Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten <82:> die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen; aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen!" (Jer 8,7). Und Jes 1,3: „Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn; aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht." Dem Instinkt der Vögel sollte eigentlich der Glaube der Menschen entsprechen, in ihm sehen die Propheten Gleichnisse für Zuversicht und Gottvertrauen. Die so selbstverständliche Rückkehr der Haustiere zu ihrem Herrn und zu ihrem Stall sollte den Menschen zu denken geben und sie zur Umkehr bewegen. Aber sie können die Zeichen in der Tierwelt nicht deuten. Dabei brauchten sie nur ihren Verstand zu benutzen, um zu erkennen, daß die Vögel und die Haustiere genau das Richtige tun, nämlich immer wieder an den Ursprung ihres Lebens und Daseins zurückzukehren.; Aber sie benutzen offenbar ihren Verstand nicht, werden sich dieses Naturgleichnisses nicht bewußt, geschweige denn eines Glaubens, der aus Zuversicht und Vertrauen besteht. Nicht einmal ihrer Herkunft sind sich die Menschen bewußt, während doch Tiere und Pflanzen unübersehbar und unüberhörbar davon Zeugnis ablegen, daß Gott sie geschaffen hat und daß aus dieser Schöpfung alle Bereiche des Lebens hervorgegangen sind. Mit anderen Worten: Die Tiere sind noch von der alten Gottesordnung umschlossen. Sie verleiht ihnen Geborgenheit. Tiere leben nach dem Gesetz, nach dem sie von Gott berufen wurden; sie leben in Harmonie mit ihrem Schöpfer. „Der Mensch hingegen hat das Gesetz seiner Berufung, das ein religiöses ist, in sich zum Schweigen gebracht. Er lebt deswegen nicht mehr mit seinem Schöpfer, ja ist ihm bereits so fern gerückt, daß er nicht einmal um diese Tatsache weiß" (Henry 1993, S. 57). „Frage doch das Vieh, das wird dich's lehren", antwortet Hiob seinem besserwisserischem Freunde Zophar von Naama, „und die Vögel unter dem Himmel, die werden dir's sagen, oder die Sträucher der Erde, die werden dich's lehren, und die Fische im Meer werden dir's erzählen! Wer erkennte nicht an dem allen, daß des Herrn Hand das gemacht hat, daß in seiner Hand ist die Seele von allem, was lebt, und der Lebensodem aller Menschen?" (Hiob 12,711). Der Mensch braucht die Tiere geradezu zu seiner Gotteserkenntnis. Das schöne Bild von den Seelen in der Hand Gottes müßte doch den uneinsichtigen, überheblichen Freund von der Macht des Schöpfers überzeugen; denn er könnte daran ermessen, daß Gott alle Fäden in der Hand hat und niemand ohne sein Zutun eigene Wege gehen kann. Wenn jemand die Natur beseelen kann, dann ist es Gott <83:> allein. Allen Wesen wurde ihr Lebensodem von ihm eingehaucht. Die Geschöpfe sind nur etwas wert im Zusammenhang mit dem Schöpfer. Ohne ihn sind sie Nichtse. Wenn man im Alten Testament überhaupt von einer „Beseelung der Natur" sprechen kann, dann nur so, daß Gott sie vornimmt, sie aber auch jederzeit widerrufen und aufheben kann. Aber die Menschen sind blind gegenüber der Allmacht des Schöpfers, der allein beseelen und entseelen kann; sie sehen nur sich selbst in diesem Prozeß und beklagen, daß sie dabei zu kurz kommen und womöglich nicht gerecht behandelt werden. Dabei ist es doch so einfach, das Walten Gottes in der Natur wahrzunehmen: Tiere und Pflanzen legen dauernd davon Zeugnis ab. So wird das Tier im Alten Israel zur Glaubensorientierung für den Menschen, „dieses orientierungsloseste Wesen der Schöpfung, das starrsinnig nur sich selbst folgt, nichts mehr ahnend von der ihm eingesenkten Setzung Gottes" (Henry 1993, S. 57). Tiere sind aber nicht nur „Glaubenszeugen", sie sind auch Vorbilder im Alltag, ethische und moralische Vorbilder des Menschen, wie wir z. B. in den Sprüchen Salomos hören: Gehe hin zur Ameise, du Faulenzer, sieh' an ihr Verhalten und werde weise! Sie, die keinen Vorsteher hat, keinen Aufseher oder Herrscher, bereitet im Sommer ihre Speise, sammelt in der Erntezeit ihre Nahrung. Wie lange, Faulenzer, willst du liegen, wann willst du aufstehen von deinem Schlafe? Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Arme kreuzen im Bett — so kommt wie ein Wegelagerer deine Armut — und dein Mangel wie ein Schildbewehrter. (Spr 6,6-11; nach: Das Alte Testament Deutsch) Man könnte diese Lebensregel zusammenfassen in den Worten: Fleiß macht wohlhabend, Faulheit macht arm. Die Ameise bietet das beste Beispiel für Fleiß und Emsigkeit. Sie hat keinen Aufseher oder Herrscher (oder doch? – nämlich die Königin!), sondern ihre Weisheit gibt ihr ein, daß sie Vorräte für den Winter anlegen muß, ihre Weisheit sagt ihr, daß man zur Erntezeit die Nahrung sammelt, ihre Weisheit gibt ihr den Rat, fleißig zu sein, um auch während der kargen Zeiten nicht hungern zu müssen. Der Mensch aber scheint sich nicht um derartige Regeln zu kümmern, noch besitzt er die Weisheit der fleißigen Ameise, und so verschläft er am liebsten die Heraus<84:> forderungen, die an ihn gestellt werden und verpaßt damit alle Chancen seines Lebens. Hier kann ein Blick in die Natur und in das Leben der Ameisen geradezu eine Umkehr im Verhalten der Menschen bewirken. Die talmudische Literatur nennt eine ganze Reihe von moralischen Eigenschaften, welche die Menschen von den Tieren lernen könnten: Von der Ameise die Rechtschaffenheit; denn sie stiehlt die Vorräte anderer Ameisen nicht. Von der Katze die Sittsamkeit; denn sie vergräbt ihre Exkremente. Vom Grashüpfer die Heiterkeit; denn er singt, obgleich er weiß, daß er dazu bestimmt ist zu sterben. Vom Storch die Frömmigkeit, weil er über die Reinheit seiner Familie wacht und zu seinen Artgenossen freundlich ist. Von der Taube die Keuschheit. Vom Raben eheliche Treue usw. (Perek Shirah<).4 Sie alle, ob Haustiere oder wilde Tiere, tragen zum Lobe Gottes bei. Menschen und Tiere teilen das gleiche Schicksal Die Bibel berichtet ausdrücklich, daß die Tiere den gleichen Ursprung haben wie die Menschen, nämlich einst von Gott aus Erde geformt und – wie die Menschen – von Gott mit seinem Odem „beseelt" worden zu sein. Aber – ganz im Unterschied zu den Natur-und Stammesreligionen und den Religionen Indiens – die Bibel sieht (wie später auch der Koran) in den Tieren keine Geschwister der Menschen, die mit den Menschen wegen ihrer gemeinsamen Herkunft auf gleicher Stufe stehen, – sondern nur Gehilfen, Diener, Sklaven: „Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und Gott der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, daß er sähe, wie er sie nennte; denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen; aber für den Menschen (selbst) ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre" (Gen 2,18-20). Es ist der Mensch, der die Tiere benennt und sie sich damit aneignet; denn wer die Macht hat, Namen zu verleihen, der hat auch Macht über die Träger dieser Namen und kann sie sich dienstbar machen. Der Mensch – so geht klar aus diesem Genesistext hervor – verfährt hier gleichsam an Gottes Statt: Er benennt die Tiere, und sie dienen ihm. Andererseits erleiden die Tiere auch das gleiche <85:> Schicksal wie die Menschen: Die Sage von der Sintflut (Gen 6 und 7) – wie im Neuen Testament das berühmte Kapitel 8 im Römerbrief (Verse 18-24) des Apostel Paulus – sind Belegstellen dafür, daß die Tiere für die Sünden der Menschen büßen und mit ihnen das Verderben teilen müssen, obgleich sie keine Schuld tragen. „Als aber der Herr sah, daß der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar, da reute es ihn, daß er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel; denn es reut mich, daß ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn" (Gen 6,5-8). Die schuldlosen Tiere haben Teil an der Schuld der Menschen; denn sie leben mit ihm zusammen im selben Bund (Gen 9,16). Dieser Gedanke ist nur vom gemeinsamen Ursprung her zu verstehen: Die Schöpfung aus Erde und das Aufeinander-Angewiesensein läßt Menschen und Tiere zu einer Solidargemeinschaft werden, die im Leben wie im Tode unauflösbar ist. Jahwe-Gott, der beide geschaffen hat, hat auch das Recht, beide zu vernichten; denn er ist der Herr über Leben und Tod. Und dennoch läßt er Gnade vor Recht ergehen: In der rettenden Arche überlebt nicht nur die Spezies Mensch, es überleben auch die Tiere: „Da sprach Jahwe-Gott zu Noah: Gehe du mit deinem ganzen Hause in die Arche, denn dich habe ich vor mir gerecht befunden in diesem Geschlecht. Von allen reinen Tieren nimm dir je sieben, Männchen und Weibchen; von den unreinen Tieren ein Paar, Männchen und Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels je sieben, Männchen und Weibchen, damit auf der ganzen Erde Nachwuchs am Leben bleibe. Denn noch sieben Tage, dann will ich regnen lassen auf die Erde vierzig Tage und vierzig Nächte und alle Wesen, die ich gemacht habe, vom Erdboden vertilgen. Da tat Noah ganz wie ihm Jahwe geboten hatte" (Gen 7,1-5). Kohelet, der „Prediger Salomo", reflektiert diesen Sachverhalt noch einmal in seinem berühmten Kapitel von der Vergänglichkeit allen Daseins (Koh 3). Wieder ist es die Matrix Erde, die als tertium comparationis für Gut und Böse gilt. Daß alles aus Staub gemacht ist, alles aus Staub besteht und alles zum Staube zurückkehren wird, ist Grund und Ursache für die Vergänglichkeit dessen, was ist. „Ich sprach in meinem Herzen: Es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und sie sehen, daß sie selber sind wie das Vieh. Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh: wie dies stirbt, so stirbt <86:> auch er, und sie haben alle einen Odem, und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh; denn alles ist eitel. Es fährt alles an einen Ort. Es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Wer weiß, ob der Odem der Menschen aufwärts fahre und der Odem des Viehes hinab unter die Erde fahre? (Koh 3,18-21). „Einerlei Geschick erfahren sie [...] Der Mensch hat keinerlei Vorzug vor dem Vieh; denn alles ist eitel." Hier ist nichts mehr von der optimistischen Weltsicht der Bibel zu erkennen; sie scheint abgelöst von einem tiefen Pessimismus, der das Vergehen der Welt vor Augen hat: Menschen und Tiere stammen aus dem gleichen Stoff und kehren wieder zum gleichen Stoff zurück; Menschen und Tieren ist von Gott der gleiche Atem eingehaucht worden, der Atem, der das Leben ist. Aber eines Tages werden Menschen und Tiere diesen Atem wieder aushauchen und damit ihr Leben beenden. Das ist die pessimistische Erkenntnis des Kohelet, der niemand widersprechen kann. Doch im Gegensatz zur Sintflutsage wird hier das Ende der Menschen- und Tierwelt nicht auf menschliche Schuld zurückgeführt. Zwar heißt es auch hier: „Weiter sah ich unter der Sonne: An der Stätte des Rechts war Gottlosigkeit, und an der Stätte der Gerechtigkeit war Frevel. Da sprach ich in meinem Herzen: Gott wird richten den Gerechten und den Gottlosen; denn alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit. Ich sprach in meinem Herzen: Der Menschen wegen ist das so" (Koh 3,26 u. 17). Aber von Strafe und Bestrafung ist im folgenden keine Rede, vielmehr heißt es: „Weil Gott sie prüfen will, damit sie sehen, daß sie selber sind wie das Vieh" (Koh 18). Es ist also eine Glaubensprüfung, die Gott an den Menschen vornimmt. Sie sollen ihren Hochmut und ihre Herrschaftsgeltiste über die Natur und Kreatur ablegen und die Wirklichkeit sehen, so wie sie ist. Und Wirklichkeit und vor aller Augen sichtbar ist: Alle Wesen (hakol hajäh) sind aus Erde (oder noch krasser: aus Staub, ciphdr) „gemacht", und alle Wesen werden eines Tages an denselben Ort (mäköm ähad) zurückkehren. Wer das einsieht, der muß seinen Hochmut, Mensch zu sein und als Mensch Gott auf Erden sein zu wollen, aufgeben und ganz demütig werden, „denn alles ist eitel" (ki hakol habäl). Aus seinem Geschick also soll der Mensch auf seinen gegenwärtigen und seinen zukünftigen Zustand schließen, aus seinem Geschick soll der Mensch Konsequenzen ziehen und zur Einsicht kommen und schließlich sein Vertrauen auf Gott allein setzen. Das ist die Botschaft des Predigers. Sie appelliert an die Verantwortung des Menschen, die nur er haben kann, und die darin besteht, daß nur er <87:> sich seiner Geschöpflichkeit mit allen Konsequenzen bewußt werden kann. Diese Konsequenzen beinhalten auch die Tatsache, daß Menschen und Tiere aufeinander angewiesen sind, weil sie den gleichen Lebensodem haben und weil sie das gleiche Ziel erwartet: die Rückkehr – oder sollen wir sagen: die Heimkehr? – zur Erde, die aller Geschöpfe Matrix ist. Zeichen der Endzeit: Der Friede unter den Tieren – außerbiblische Parallelen Die pessimistisch-depressive Solidarität von Menschen und Tieren, wie sie der Prediger Salomo vor Augen hat, ist aber nicht typisch für das Weltbild des Alten Testaments. Typisch ist vielmehr, daß es für beide, Menschen und Tiere, ein gemeinsames eschatologisches Ziel gibt, welches Kennzeichen des Weltfriedens ist. Es ist eine optimistische Eschatologie, die das Alte Testament vertritt: Dem gemeinsamen Anfang entspricht auch ein gemeinsames Ziel. In utopischen Bildern wird dieses Ziel umschrieben: Zuerst wird der Ort genannt, das Umfeld, das Ambiente, auf dessen Hintergrund das Friedensreich entstehen soll: Wenn der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird, dann wird die Wüste zum fruchtbaren Lande und das fruchtbare Land wie Wald geachtet werden. Und das Recht wird in der Wüste wohnen und Gerechtigkeit im fruchtbaren Lande. Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein, daß mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe. (Jes 32,15 —18) Das eschatologische Friedensreich gehört zu den großen Hoffnungen des Alten Orients und des Alten Griechenlands. Es drückt die Sehnsucht nach einer heilen Welt aus, die am Anfang war, und einem Goldenen Zeitalter, das am Ende sein wird. Im Mythus von Dilmun, einer sumerischen Stadt, heißt es schon: In Dilmun stoßen die Raben ihre Schreie nicht aus, die wilde Henne stößt nicht den Schrei der wilden Henne aus, der Löwe tötet nicht, der Wolf reißt nicht das Lamm, unbekannt ist der das Zicklein verschlingende wilde Hund, <88:> unbekannt ist das Korn verschlingende Wildschwein ... Die Taube läßt nicht den Kopf hängen. Der Augenkranke sagt nicht: „Ich bin augenkrank", der Kopfkranke sagt nicht: „Ich bin kopfkrank", Die alte Frau (aus Dilmun) sagt nicht: „Ich bin eine alte Frau", der alte Mann (aus Dilmun) sagt nicht: „Ich bin ein alter Mann" (nach: Bibby 1973, S. 88f.). Das Goldene Zeitalter umfaßt Menschen und Tiere und bedeutet eine wahre Wende in den Beziehungen der Kreaturen zueinander: Sowohl Tiere wie Menschen werden sich an einem höchsten Wert, einem summum bonurn, orientieren, das sowohl die „bösen Instinkte" der Tiere als auch die Krankheit verursachenden Dämonen zunichte machen wird. Der Mythus verkündet: Ein solches Goldenes Zeitalter hat es vor Urzeiten schon einmal gegeben, damals, als die Natur sich noch in Harmonie vollzog, als es das Böse in der Welt noch nicht gab und die Gefahren, die den Menschen (heute) von seiten bestimmter Tiere drohen, unbekannt waren: „Einmal, vor langer Zeit, gab es keine Schlange, keinen Skorpion, gab es keine Hyäne, gab es keinen Löwen, gab es keinen wilden Hund, gab es keinen Wolf, gab es keine Furcht, kein Entsetzen. Der Mensch hatte keinen Nebenbuhler" (Kramer 1959, S. 177). Nach diesem Text sieht es so aus, als habe es in der Urzeit nur `gute', dem Menschen freundlich gesonnene Tiere gegeben; die 'bösen' Tiere waren noch nicht geschaffen, bzw. sie hatten das `Böse' in sich noch nicht entwickelt. Den gleichen Gedanken finden wir auch im Alten Ägypten, wo man hoffte, der göttliche Pharao werde die Verhältnisse der Urzeit wiederherstellen. Dann werde eine neue Weltordnung entstehen, und diese wird so aussehen, wie sie am Anfang war; denn damals „wurde das Recht geschaffen, die Wahrheit kam aus dem Himmel zu ihrer Zeit und gesellte sich zu denen, die auf Erden lebten, das Land war im Überfluß, die Leiber waren voll, nicht gab es ein Hungerjahr in den [...] Ländern, nicht fielen Mauern ein, nicht stach ein Dorn [...] es gab kein Unrecht im Lande, kein Krokodil raubte, es gab keinen Schlangenbiß zur Zeit der urzeitlichen Götter" (Sethe 1929, S. 63; Kirchhoff 1987, S. 32). Das Glück der Urzeit werde am Ende der Zeiten wiederkehren. Das war die Hoffnung der ägyptischen Frommen (vgl. Groß 1967, S. 65). Auch in der Zauberwelt Kirkes hat der Friede zwischen Mensch und Tier seinen Platz, wie uns Homer schildert: <89:> Und um sie waren Bergwölfe und Löwen, welche sie (Kirke) selbst verzaubert hatte, nachdem sie ihnen böse Kräuter gegeben hatte. Doch sie drangen nicht auf die Männer ein, sondern standen auf und umwedelten sie mit den langen Schwänzen. Und wie wenn um den Herrn die Hunde wedeln, wenn er vom Mahl kommt, denn immer bringt er Labsale des Herzens: so umwedelten diese die starkkralligen Wölfe und Löwen; sie aber fürchteten sich, als sie die schrecklichen Untiere sahen. (>Odysee< XXXX, 212 ff.) Offenbar herrschte unter den Frommen die Überzeugung, daß der Mensch während des Goldenen Zeitalters nur von Feldfrüchten gelebt und keine tierische Nahrung zu sich genommen habe (Hesiod >Erga<, 117 ff.); erst der Krieg und mit ihm eine Veränderung der menschlichen Triebe habe den Fleischgenuß gebracht (vgl. Landmann 1961, S. 83). Empedokles zieht aus dem Mythus vom Tierfrieden die ersten Konsequenzen (Empedokles >Fragment< 128,130, in: Diels 1934): Er plädiert für die Abschaffung des blutigen Opfers und möchte dafür Weihegaben aus Teig und Honig geopfert wissen, sogenannte Substitutionsopfer, die nur noch der Form nach Tiergestalt besitzen. Daß Empedokles auch – ebenso wie die Pythagoräer – zur Abstinenz von Fleisch und Fleischspeisen aufrief, hängt mit seinem Glauben an die Seelenwanderung zusammen: Das Tier könnte ja Träger eines früheren Menschenlebens sein. Wenn man aber die Fleischabstinenz einhält, dann leitet man damit unwillkürlich die Rückkehr zur Urzeit ein, in der kein Mensch tierische Produkte gegessen habe (Landmann 1961, S. 85). Schließlich tragen auch die nichtbiblischen Bilder vom Tierfrieden messianische Züge. In Vergils 4. Ekloge ist von einer goldenen Zeit die Rede, die das eiserne Geschlecht ablösen und die Herrschaft des Gottes Saturn erneuern wird. Da werden die Löwen zahm werden und die Schlangen zugrunde gehen; da brauchen selbst die Stiere nicht mehr unter dem Joch zu gehen. Als ein „Zwischenglied zwischen Jesaja und Vergil" (Landmann 1961, S. 87) kann endlich das 3. Buch der rätselhaften Sibyllinen angesehen werden, in dem zu Beginn des christlichen Zeitalters ein alexandrinischer Jude die Heilsvoraussage des Propheten Jesaja aufnimmt und sie als seine messianische Weissagung ausgibt. So wird es einmal sein: die allnährende Erde wird für den Menschen hervorbringen eine Fülle herrlicher Frucht des Weizens und Wein und Öl und danach werden die Himmel senden lieblichen Honigtau und die Frucht des Nußbaums und fette Schafe und Ochsen und die Frucht der Lämmer und Ziegen hervorbringen, und sie wird die süßen Quellen der lieblichen Milch überströmen lassen. Und die Städte werden mit Schätzen gesegnet sein und die Äcker frucht<90:> bar, und wird kein Schwert und Krieg auf Erden sein, und die schwerz seufzende Erde wird nicht mehr erschüttert werden und wird kein Krieg und keine Dürre, nicht Hungersnot und Hagelschlag mehr auf Erden sein, der dem Frieden Unheil bringt; sondern ein großer Friede wird über der ganzen Erde walten ... Frohlocke, o Jungfrau, und freue dich; denn eine ewige Wonne hat dir beschieden, der da Himmel und Erde geschaffen hat. Er wird ja bei dir wohnen und dir ein ewiges Licht sein. Dann werden Wölfe mit Lämmern auf den Bergen, auf den Höhen weiden und die Pardel mit den Böcken grasen und Bären mit den Kälbern die Weide teilen, und der fleischgierige Löwe wird Streu in der Krippe fressen wie ein Ochse, und kleine Knaben werden ihn am Leitseil führen (nach: Clemens 1984, S. 159ff.). Wie eine Folie legt sich hier - in biblischen wie in außerbiblischen Texten - die künftige Welt über die dem Verderben anheimgegebene gegenwärtige Welt: An die Stelle der unfruchtbaren, schwer zu bearbeitenden Erde oder der abweisenden und von Dämonen heimgesuchten Wüste tritt - wie in der Urzeit - ein Garten Eden. Und wie in der Urzeit, bzw. biblisch gesprochen: am Anfang der Schöpfung, so wird auch am Ende der Zeiten wieder Recht und Gerechtigkeit auf Erden herrschen, und die Menschen werden untereinander und miteinander im Frieden leben. Sorgenfrei und sicher werden ihre Wohnungen sein. Ruhe (eigentlich: „vertrauensvolle Sicherheit bis in Ewigkeit", bätah ad oläm), wird unter den Menschen herrschen; denn die Waffen werden schweigen, und das Kriegsgeschrei wird verstummen (vgl. Jes 32,15-18). Mit den Menschen werden alle anderen Geschöpfe an diesem Friedensreich teilhaben, vor allem die Tiere; denn der alttestamentliche Gott ist auch ein „Gott der Tiere". Er hat mit ihnen seinen Bund geschlossen, wie wir Gen 9,16 hörten. Wie die Menschen so rufen auch die Tiere zu Gott (vgl. Landmann 1961, S. 91, 94). Für sie entwirft Jesaja im 9. vorchristlichen Jahrhundert, lange vor den Sibyllinischen Büchern, ein utopisches, überirdisches Bild: „Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Bökken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, so daß ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird am Loch der Otter spielen, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand in die Höhle der Natter stecken" (Jes 11,6-8). Die Gemeinsamkeit zwischen Menschen und Tieren, wie sie einst im Paradies bestand, kehrt wieder. Der gemeinsame Sündenfall, wie <91:> er Gen 3 berichtet wird, ist für immer aufgehoben. Die Endzeit versöhnt nicht nur die Menschenfeinde miteinander, sie macht auch die wilden Tiere und die Haustiere zu Freunden; und was die Menschen betrifft, so gehen sie mit den Tieren um wie mit ihresgleichen. Es gibt keine Gefahren mehr; selbst die gefährlichsten Tiere werden zahm und zu treuen Gefährten der Menschen.' Das feindliche Widereinander ist einem freundschaftlichen Miteinander gewichen. Die Einheit der Natur ist wiederhergestellt. Schließlich wird Jahwe:Gott eine via sacra, eine Wallfahrtsstraße, durch die Wüste bahnen, auf der die Reinen, die Erlösten in Zion, einziehen werden. „Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen; sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen" (Jes 35,9 u. 10). Die Tiere tun den Menschen deshalb nichts mehr zuleide, weil es entweder keine gefährlichen Tiere mehr gibt oder weil sie verjagt worden sind oder weil sie am Ende der Tage ihre Wildheit verloren haben und sich ihr „Charakter" verändert hat, weil aus reißenden zahme Tiere geworden sind (vgl. Landmann 1961, S. 81). Gerade der letzte Gedanke ist für die Weissagungen des Propheten Jesaja von besonderer Bedeutung: Die Tiere ändern ihren Charakter, ihre Gesinnung! Das ist ausschließlich Jahwes Werk, der den schalöm, den Frieden für alle Kreaturen, bringt, und der alle Kreaturen sich innerlich auf diese neue Ordnung vorbereiten heißt. Gerade diese Einschätzung der eschatologischen Tierwelt ist das Besondere an der biblischen Friedensutopie. Das unterscheidet sie von ihren außerbiblischen Parallelen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für den schalöm unter Menschen und Tieren besteht darin, daß sich die Tiere auch untereinander nicht mehr verfolgen und sich darum voreinander nicht mehr zu fürchten brauchen. Das betrifft sowohl die wilden Tiere untereinander als auch ihr Verhältnis zu den zahmen, den domestizierten Tieren. Im messianischen Zeitalter hört die Feindschaft zwischen den Tieren und mithin auch die Feindschaft zwischen Menschen und Tieren auf. Der Sündenfall, der auch die Tiere betraf und „Feindschaft setzte" zwischen Tieren und Menschen und eine lange Zeit des Gegensatzes zur Folge hatte, hat damit seine unheilvolle Wirksamkeit verloren. Die Folge ist, daß der Mensch keine Tiere mehr zu töten braucht, <92:> um sich von ihnen zu ernähren, sondern fortan nur mehr von Pflanzenkost leben kann (vgl. Landmann 1961, S. 81, 93). Damit kehren Menschen und Tiere in ihren paradiesischen Biokosmos zurück und leben wieder miteinander in Harmonie und Eintracht. Jahwe ist ein Gott der Menschen und der Tiere: Sein Gottesfriede bewirkt Frieden unter den Menschen, unter den Tieren und zwischen den Menschen und Gott. Damit erfüllt sich das Symbol des Völkerfriedens, wie Martin Buber gemeint hat (vgl. Landmann 1961, S. 97). Und darin besteht die Verheißung, die wir allen diesen utopischen Texten entnehmen können: Man wird Gott wieder inmitten der Natur wahrnehmen; denn wahrer Friede ist dort, wo man Gott wahrnimmt. Das Eschaton wird eine neue Schöpfung bringen, die verbunden ist mit einer völligen Neuordnung in der Natur und einem völligen Gesinnungswandel bei den Menschen. Die dunkle Zeit, die zwischen dem Sündenfall und den Weltkatastrophen liegt, ist damit zu Ende, von Jahwe-Gott aufgehoben und für ungültig erklärt. Er hat sie gleichsam ungeschehen gemacht. Damit ist die Vergangenheit „beseitigt", und die Zukunft ist zur Gegenwart geworden. Auch am Ende der Zeiten wird es ein Paradies geben; ja, das Paradies ist die Endzeit. Die Urverwandtschaft zwischen Mensch und Tier Dieser Gedanke, der uns überall in den Natur- und Stammesreligionen begegnet, scheint auch einen Sitz im Leben der biblischen Überlieferungen zu haben: Es gibt eine seinsmäßige Verwandtschaft zwischen Mensch und Tier, die auf den Anfang der Schöpfung zurückgeht. Gen 2, der zweite Schöpfungsbericht, erzählt nämlich, wie Mensch und Tier aus Ackererde entstehen und von Gott eine näfäsch hajjäh, eine lebendige Seele, erhalten. Gott bedient sich also bei der Erschaffung des Menschen und der Tiere nicht nur der gleichen Materie, die er als Matrix, als Urstoff, verwendet, sondern er haucht auch beiden seinen Odem ein. „Das Lebensprinzip des Tieres ist kein anderes als dasjenige des Menschen, es ist näfäsch hajjäh, lebendes Wesen wie jener" (Henry 1993, S.28f.). Daß den Tieren ebenfalls der Gottesatem eingehaucht wird, wird zwar in Gen 2,7 nicht ausdrücklich berichtet, aber es scheint hier vorausgesetzt zu werden. Leben, so will der Text sagen, hat einen einzigen Ursprung, gleich welches Wesen es beseelt. Dieser Ursprung ist Jahwe-Gott, vielmehr die Tatsache, daß Jahwe-Gott die prima causa ist und daß <93:> von ihm und nur von ihm Leben ausgehen kann. Treffend schreibt Marie Louise Henry: „Hinter der einfachen Feststellung, daß Mensch und Tier als lebende Wesen von der Hand Gottes geschaffen wurden, verbirgt sich ein ganz naives Bewußtsein untergründiger Zusammengehörigkeit und einheitlicher Herkunft aller beseelten Kreaturen. So verbinden Ursprung, Lebensprinzip und Wesen Mensch und Tier zu unauflöslicher Gemeinschaft, und ihnen gegenüber steht Gott als der ganz andere Unbegreifliche, Nichtkreatürliche, Unbenennbare, der den Kreaturen das Wunder des Lebens zuteilte. Die Welterfahrung und das Lebensgefühl, welche sich in dieser Darstellung ausprägten, sind noch ausschließlich religiös bestimmt" (Henry 1993, S. 29). Ähnlich wie in den Natur- und Stammesreligionen (vgl. Gerlitz 1992, S. 107 ff., 177 ff.) liegt auch Gen 2 die Anschauung einer Urverwandtschaft zwischen Mensch und Tier zugrunde; aber diese Urverwandtschaft ist seinsmäßig, ontologisch begründet und setzt nicht – wie Abram Menes annahm – einen Idealzustand, nämlich ein „tierähnliches Leben des Urmenschen", voraus (vgl. Menes 1925, S. 33 ff., 44). Marie Louise Henry warnt zu Recht davor, soziologische Perspektiven an die Erzählung Gen 2 heranzutragen, weil sie dem antiken Wirklichkeitsverständnis nicht entsprechen. Eine Nähe zur „kommunistischen Urgesellschaft" zu postulieren ist ebenso falsch, wie einen Idealzustand innerhalb der Natur anzunehmen, der eines Tages, d. h. am Ende der Zeiten wiederkommen werde. Das ist schon deshalb nicht der Fall, weil Mensch und Tier niemals Teil des Schöpfergottes werden können, sondern von ihm qualitativ unterschieden bleiben und als Unterschiedene ihm gegenüberstehen. Ja, diese Unterscheidung bezieht sich auch auf das Verhältnis von Mensch und Tier: Gerade in Gen 2 wird deutlich, daß das Tier eben nicht zu einem gleichberechtigten Partner für den Menschen werden konnte, sondern daß der Mensch die Gehilfin und Partnerin nur innerhalb der Species Mensch finden konnte (vgl. Henry 1993, S. 30f.). Tiere, die nicht sprechen, nicht urteilen und nicht entscheiden können, die – um es vorwegzunehmen – auch nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden können, sind eben keine gleichberechtigten Partner des Menschen, auch wenn sie Mitgeschöpfe sind und sie mit dem Menschen jene Urverwandtschaft verbindet. Diese Urverwandtschaft bleibt auch über den Sündenfall, Gen 3, hinaus bestehen, ja, sie zeigt sich durch die Schuldverflechtung zwischen Mensch und Schlange jetzt sogar von einer neuen dunklen Seite. Hier aber hört die Gemeinschaft auf, das Vertrauen zwischen Mensch und Tier, das Verstehen ist zu Ende. Der Mensch <94:> „weiß sich vom Tier getrennt, aber diese Trennung wird empfunden als etwas Widersinniges, ursprünglicher Ordnung Fremdes. Sie wird darum gedeutet als das bittere Ergebnis gemeinsamen Falles aus der Einheit mit Gott, als eine Mensch und Tier auferlegte Strafe des erzürnten Gottes, verhängt in dem schaurigen Fluch, der ewige Feindschaft zwischen dem Samen der Frau und der Schlange setzte" (Henry 1993, S. 33). Der Mensch sondert sich damit aus der Gemeinschaft aller anderen Lebewesen ab. Der Sündenfall wird zur „Geburtsstunde der menschlichen Freiheit", wie Friedrich Schiller meinte. Der Mensch – die Krone der Schöpfung Gen 2, der zweite Schöpfungsbericht, ist älter als der Schöpfungsbericht in Gen 1, welcher der sogenannten `Priesterschrift' zugeschrieben wird und vermutlich in Babylonien während der Gefangenschaft des Volkes Israel geschrieben worden ist. Das kann man daran erkennen, daß in Gen 1 der Mensch aus der übrigen Schöpfung herausgehoben und zur `Krone der Schöpfung' gemacht wird. Nachdem dort Pflanzen und Tiere durch Gottes Wort ins Leben gerufen sind, sind die Voraussetzungen für den Menschen geschaffen. Nun kann er auf den Plan treten und die Herrschaft über die Erde antreten: Und Gott-Elohim sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alle Tiere des Feldes, über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan (kibschu) und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und GottElohim sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. (Gen 1,2629) In diesem Text wird die Herrschaftsstellung des Menschen deutlich ausgesprochen. Dei' Mensch ist die Krone der Schöpfung; er ist zur Herrschaft über Tiere und Pflanzen berufen. Gott selber hat ihn dazu auserwählt. Er wird hier ausdrücklich vom Tier unterschieden, hat mit ihm keine Gemeinschaft. Das Tier ist und bleibt nur „lebendes Wesen", näfäsch hajjäh: aber der Mensch ist mehr; er allein ist säläm. und demut, Bild und Abbild Elohims. Wenn der Mensch mehr <95:> ist als das Tier, dann ist es seine Aufgabe, das Tier zu beherrschen und Herr auf Erden zu sein. Der Mensch ist also nicht mehr – wie noch Gen 2 – seinsmäßig mit den Tieren verbunden, zwischen ihm und den Tieren gibt es hier keine Urverwandtschaft mehr, sondern er allein steht vor Gott, wird von Gott angesprochen, von Gott gesegnet und von Gott zur Verantwortung gerufen. Nur er wird fortan der Gesprächspartner des Schöpfers sein. Mit den Tieren redet Gott nicht; das ist jetzt ausschließlich Sache des Menschen, des ädnm. Hier liegt der Grund für das menschliche Selbstbewußtsein und zugleich für die menschliche Hybris. Daß die seinsmäßige Verwandtschaft zwischen Mensch und Tier zerbrochen ist, die Urverwandtschaft sich aufgelöst hat, wird nirgends deutlicher als an jenem harten und unerbittlichen Wort, das im Hebräischen für „untertan machen" steht, nämlich kabasch, „unter die Füße treten", und radah, „niedertreten", Worte, die in der Kriegssprache gebräuchlich waren oder die man einem Großkönig zukommen ließ, wenn er seine Feinde besiegt hatte. „Der Mensch, der Niedertreter, der Schrecken aller Kreaturen", ist Tieren und Pflanzen überlegen (Henry 1993, S. 35). Der göttliche Auftrag, sich die Erde untertan zu machen und über die Tiere zu herrschen, bedeutet die Loslösung des Menschen von den übrigen Geschöpfen, die Verselbständigung und die Trennung von all dem, was einmal seinsmäßige Einheit, Urverwandtschaft bedeutete. Gen 9,2 drückt diese Vormachtstellung des Menschen unmißverständlich so aus: „Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter dem Himmel, über allem, was auf dem Erdboden wimmelt und über allen Fischen im Meer; in eure Hände seien sie gegeben". Die Herrscherstellung des Menschen über die Mitgeschöpfe verdeutlichte bereits der B. Psalm: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel! [...] Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, daß du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan: Schafe und Rinder allzumal, <96:> dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. (Ps 8,2,5-9) Geschöpfe und Mitgeschöpfe unter dem gleichen Gesetz „Die im Alten Testament so reichlich vorhandenen Tiermotive dürfen keineswegs nur als verzierendes Beiwerk gelten." Diese Feststellung Marie Louise Henrys (Henry 1993, S. 21) wird, wie wir gesehen haben, durch eine Fülle von alttestamentlichen Belegen bestätigt: Der biblische Mensch lebt mit den Tieren in einer Symbiose. Zwischen ihm und den Tieren besteht eine schicksalhafte Beziehung. Er hat ihnen Namen gegeben (Gen 2) und durch diese Benennung eine Lebensgemeinschaft hergestellt – ein Vorgang, der sich bis zum heutigen Tage wiederholt, wenn Bauern ihren Haustieren Namen geben, sie fortan mit diesen Namen rufen und auf diese Weise in ihre Haus- und Lebensgemeinschaft einbeziehen. Diese Symbiose von Mensch und Tier geht so weit, daß sich der alttestamentliche Mensch zusammen mit den Tieren unter den Schutz des göttlichen Gesetzes stellt. Ausdrücklich werden die Haustiere etwa in das Sabbatgebot einbezogen: „Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am siebenten Tage sollst du feiern, auf daß dein Rind und dein Esel ruhe und deiner Sklavin Sohn und der Fremdling sich erquicken" (Ex 23,12). Die Sabbatruhe am siebten Tage wird hier also ausdrücklich auf die Haustiere und die Dienstleute bezogen; d. h., der Mensch soll die Sabbatruhe einhalten, damit sich auch seine Tiere ausruhen können. Man hat den Eindruck, als sei hier das Gebot geradezu um der Haustiere willen eingesetzt worden. Tiere sollen eine „menschliche" Behandlung erfahren. Erst wenn die Tiere gefüttert sind, sollen sich ihre Besitzer zu Tisch setzen, sagt ein talmudischer Text (>Berakhot< 40a; als Grund wird angegeben, daß das Tier zuerst erwähnt wird; vgl. >Encyclopaedia Judaica<, III, S. 6). Nur derjenige soll zum Kauf von Tieren berechtigt sein, der auch das nötige Futter für sie bereitstellen kann, rät der Talmud ausdrücklich. Und niemals soll ein Arbeitstier überanstrengt werden. Das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit von Mensch und Tier entstand und entsteht dadurch, daß der Bauer auf seine Haustiere, ihre Mitarbeit und ihren Nutzen angewiesen ist. So gilt es in Israel als eine Selbstverständlichkeit, daß man dem Ochsen, der das Getreide drischt, keinen Maulkorb anlegt, sondern ihn <97:> sich sättigen läßt (Dtn 25,4). Was aber die freilebenden Wildtiere anbelangt, so sollen sie im Sabbatjahr wie die Armen an den Erträgen des Feldes Anteil haben dürfen. Jedes Tier soll vor Ausbeutung und Hunger bewahrt werden. Erich Spier gibt eine schöne jiddische Geschichte wieder, die aus dem >Kuh-Buch< stammt und von Rabbi Jochanan Kuhsohn handelt, der einst Heide war und von einem Juden eine Kuh kaufte. Am Sabbat weigerte sich die Kuh zu arbeiten, und sie ließ sich von niemandem dazu zwingen. Der frühere Besitzer erklärte dem Heiden, warum sie sich so verhielte: sie war es gewohnt, die Sabbatruhe zu genießen und wollte das auch unter ihrem neuen Besitzer so halten. „Als der Heide das hörte", heißt es, „erschrak er und ließ es sich durch den Sinn gehen" und sagte zu sich: „Wenn dieses Geschöpf, das kein Sprech- und Wissensvermögen hat, seinen Schöpfer kennt, muß dann nicht auch ich, den Gott in seinem Eben-bilde geschaffen hat, meinen Schöpfer anerkennen?" Da ging er hin, wurde Proselyt, lernte eifrig die Thora und bekam den Namen „Rabbi Jochanan Kuhsohn" (vgl. Spier 1989). Eine bis ins Detail funktionierende kultische und zivilrechtliche Gesetzgebung bestimmt die Gemeinschaft von Menschen und Tieren im Alten Israel. Dabei gilt das Tier in bestimmter Hinsicht genauso als „Rechtsperson" wie der Mensch. Wird jemand durch ein Haustier zu Tode getrampelt, dann wird dem Tier der Prozeß gemacht. Das Urteil lautet dabei auf Todesstrafe durch Steinigung (Ex 21,28 ff.). War dem Besitzer des Tieres dessen wildes Verhalten vorher bekannt und hat er keine Anstalten getroffen, das Tier zu verwahren, dann wird das Tier gesteinigt und sein Besitzer zum Tode verurteilt, dem er sich aber durch ein Lösegeld entziehen kann. Das Tier trägt also seine Schuld wie der Mensch. Deutlich läßt sich das noch an der Verurteilung der Schlange durch Jahwe-Gott Gen 3 erkennen: „Weil du das getan hast (nämlich die Frau zu verführen), seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen; der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Verse stechen" (Gen 3,14 u. 15). Obwohl die Schlange nicht zur Verantwortung gezogen werden kann wie die Menschen, so ergeht über sie doch Gottes Urteilsspruch (vgl. Amira 1891, S. 545 ff.). Natürlich sind auch rechtliche Grenzen zwischen Menschen und Tieren gezogen. Das wird besonders deutlich an der physischen Unterscheidung zwischen den Arten: Eine „physische Grenzüberschrei<98:> tung", wie z. B. die Sodomie, gilt als Sakrileg und wird mit dem Tode bestraft: „Wenn jemand bei einem Tier liegt, der soll des Todes sterben, und auch das Tier soll man töten" (vgl. Lev 20,15; Lev 1,18 u. 23). Offenbar galt diese Strafgesetzgebung der Abwehr heidnischer Bräuche und Gewohnheiten, wie sie im kanaanäischen Umfeld geübt wurden. Die klare Scheidung von Mensch und Tier kommt in diesem Gesetz ebenso zur Geltung wie die Scheidung der Species im Tierreich und in der Pflanzenwelt (Lev 19,19 u. Dt 22,9). Zu den Verordnungen und Gesetzen gehört allerdings auch das Tieropfer, das dem neuzeitlichen Verständnis von Tierschutz und Arterhaltung so gänzlich zu widersprechen scheint. Es ist uns in den ältesten Quellen überliefert: „Alle Erstgeburt ist mein", spricht Gott, „alle männliche Erstgeburt von deinem Vieh, es sei Stier oder Schaf. Alle Erstgeburt unter deinen Söhnen sollst du (auf diese Weise) auslösen" (Ex 34,19 f.). Die Vorstellung des blutigen Opfers beruht also auf der Hingabe menschlichen Lebens: Der Opfernde bringt im Opfer einen Teil seiner selbst dar und erhält sich auf diese Weise das Gotteserbarmen. Wie wir an der Erzählung von der Opferung Isaaks (Gen 22) noch erkennen können, haben in alter Zeit in Israel auch menschliche Erstlingsopfer stattgefunden. Später wurden sie durch Tieropfer ersetzt, doch so, daß ein gleichwertiges Opfer dargebracht werden mußte, ein Erstling der Rinder, der Ziegen, der Schafe. Dieses Äquivalent mußte schmerzlich sein für den, der es darzubringen hatte; denn es bedeutete ja, einen Teil seiner selbst zu opfern. Marie Louise Henry wundert sich zu Recht darüber, daß nirgends „das unendliche Leid", das durch die Opferpraxis über die Tierwelt gebracht wurde, erwähnt wird noch irgendwelche Reflexionen darüber angestellt werden. Und sie schreibt: „Das Schweigen der Quellen zu dem bedrückenden Problem tierischen Leides um des Menschen willen mutet fast so an wie ein Erweis dessen, daß Tier und Mensch auch an diesem Punkt als unaufhebbare Einheit vor dem Angesicht der Gottheit empfunden wurden" (Henry 1993, S. 43). Mensch und Tier sind, weil sie schicksalhaft aneinandergebunden sind, geradezu austauschbar. An der altisraelitischen Opferpraxis wird das besonders deutlich: Der Erstling der Herde (der Haustiere) ist gleichwertig dem Erstgeborenen der Menschen. Immer wieder wird die Urverwandtschaft zwischen Menschen und Tieren erkennbar. <99:> Tiere im Schutze der Gottheit Gott ist „Herr der Tiere", so wie er „Herr der Menschen" ist. Sein Erbarmen gilt den Tieren ebenso wie den Menschen. Das kommt in besonders schöner Weise im Jonabuch zum Ausdruck. Jona hält hier der Stadt Ninive und ihren hundertzwanzigtausend Bewohnern eine Bußpredigt, die ihre Wirkung zeigt: Der König läßt ein Fasten ausrufen, dem sich auch das Vieh unterwerfen muß: „Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen" (Jona 3,7). Gott läßt daraufhin Gnade vor Recht ergehen und läßt die Stadt am Leben: mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere?" (Jona 4,11). Hier werden Menschen und Tiere in einem Atemzuge genannt, beide stehen sie unter dem Schutz der Gottheit: „Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen; und was sich regt auf dem Felde, ist mein", heißt es Ps 50,10 und 11. Wie die Menschen so erhalten auch die Tiere ihre Nahrung aus der Hand des Schöpfers. Der Lobpreis Jahwes im 104. Psalm ist dafür ein eindrucksvolles Beispiel: Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich; du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich; du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes. 1...] Du lässest Wasser in den Tälern quellen, daß sie zwischen den Bergen dahinfließen, daß alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen. Du feuchtest die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, daß du Brot aus der Erde hervorbringst, <100:> daß der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Die Bäume des Herrn stehen voll Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel, und die Reiher wohnen in den Wipfeln. Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Klippdachs. Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen; die Sonne weiß ihren Niedergang. Du machst Finsternis, daß es Nacht wird; da regen sich alle wilden Tiere, die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise suchen von Gott. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist, da wimmelt's ohne Zahl, große und kleine Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin; da sind große Fische, die du gemacht hast, damit zu spielen. – Es warten alle auf dich, daß du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du machst neu die Gestalt der Erde. (Ps 104,1-3 u. 10-30) In einem Hymnus auf Amon-Re, der sich im Museum von Kairo befindet, haben wir zu diesem Psalm eine wunderbare ägyptische Parallele vor uns: Preis dir, Amon-Re, Herr von Karnak, du Erster in Theben! Der Herr der Ordnung, der Vater der Götter; der die Menschen machte und die Tiere schuf; der Herr dessen, was ist; <101:> der den Fruchtbaum schafft, der das Kraut macht und das Vieh ernährt ...; Atum, der die Menschen schuf, der ihre Arten unterschied und machte, daß sie leben können, der die Hautfarben unterschied, eine von der anderen [...] Der Allereinzige, der machte, was existierte [...], der macht, wovon die Fische im Strom leben und die Vögel unter dem Himmel, der dem Wesen im Ei Luft gibt und das Junge der Schlangen ernährt, der macht, wovon die Mücken leben und die Würmer und die Flöhe ebenso, der macht, was die Mäuse in ihren Löchern brauchen, und ernährt das, was fliegt, in jedem Baum [...] Jubel für dich, weil du dich mit uns abmühst, Verehrung dir, weil du uns geschaffen hast! Heil dir wegen alles Viehs, Jubel dir wegen aller fremden Länder, bis zur Höhe des Himmels und bis zur Weite der Erde und bis zur Tiefe des Meeres!"/6/ „Es mag wenige Stellen in der Weltliteratur geben", schreibt Marie Louise Henry, „wo die Liebe zur Natur und der Glaube, daß sie auch in ihren kleinsten Erscheinungsformen göttlichen Erbarmens wert sei, einen so innigen und warmen Ausdruck gefunden hat" (Henry 1993, S. 45, Anm. 39). Beide Texte sind einander ähnlich, und es ist sehr wahrscheinlich, daß der ägyptische Text, der in der 18. Dynastie vor der Regierungszeit Echnatons (vor 1365 v. Chr.) entstanden ist, einmal als Vorlage für den 104. Psalm gedient hat. Das Gotteslob kommt in beiden Texten aus dem Bewußtsein, daß die Gottheit für alle Tiere auf Erden, im Wasser und in der Luft sorgt. Gott hat sie ins Leben gerufen, indem er ihnen seinen göttlichen Atem einhauchte, und nur durch diesen leben sie. Mit jeder Einhauchung geschieht Neues auf Erden, eine neue Schöpfung. Doch wehe, wenn diese Beatmung durch den Gottesodem ausbleibt! Dann bricht alles Leben zusammen: „Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie/nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub" (Ps 104,29). In Gen 2 wurde eine solche Beseelung durch den Odem Gottes nur vom Menschen berichtet. Im 104. Psalm erfolgt die Ergänzung: Menschen und Tiere sind unter den gleichen Bedingungen ins Leben gerufen worden, und sie werden auch unter den gleichen Bedingungen wieder aus dem Leben abberufen, wenn ihre Zeit erfüllt ist. Es <102:> ist, als ob Gott sie mit seinem Odem wieder zurückholt, sie gleichsam wieder einatmet und ihnen in der Ewigkeit eine letzte Bleibe gewährt. Das ist der Augenblick des Erschreckens von Menschen und Tieren. Alle Wesen sind von Gott beseelt. Der ganze Psalm ist erfüllt von dem Gedanken, daß alle Lebewesen um das Geheimnis von Geschöpf und Schöpfer wissen oder es ahnen. Sie ahnen, daß ihr Leben eine Gnade ist und daß ihr Tod mit der Abwesenheit Gottes zu tun hat. Auch das Tier hat auf Grund seiner Seele ein ewiges Verhältnis zu Gott. Gibt es aber auch ein Weiterleben nach dem Tode für die Tiere? Eine Fortexistenz in der Ewigkeit? Schon die Apokryphen (4. Esra 7,66 und >Slawischer Henoch< 58,5) diskutieren diese Frage ernsthaft und kommen zu der Erkenntnis, daß Tiere nach ihrem irdischen Dasein sogar in eine glücklichere Ewigkeit als die Menschen eintreten werden; sie würden jedoch weder belohnt noch bestraft werden. Der Talmud hingegen lehnt ein jenseitiges Gottesreich für die Tiere ab (>Sifre Deut.<, in: >Universal Jewish Encyclopedia< Bd. I, 330), wenngleich er ihnen Intelligenz (Tanhuma Vayakhel< 4, in: >Universal Jewish Encyclopedia< Bd. I, 330) und die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse (guten und bösen Taten) zu unterscheiden (>Berakhot< 61 a und >Sforno< zu Dt 22,26), zugesteht.' Saadia Gaon wiederum spricht im Zusammenhang mit der Tierschlachtung davon, daß die Schlachttiere größere Qualen erleiden als Wesen, welche eines natürlichen Todes sterben; darum verdienten sie eine größere Belohnung im Jenseits: Gott werde diesen Tieren ein entsprechendes Maß an Ausgleich zuteil werden lassen (>Emunoth Vedeoth< Kap. 3, in: >Universal Jewish Encyclopedia< Bd. I, S. 330); denn – so Gaon (>Teshuboth Hegeonim<; vgl. >Universal Jewish Encyclopedia< Bd. I, S. 330) – „wir sind der Ansicht, daß alle lebendigen Geschöpfe, deren Schlachtung und Tötung Gott gestattet hat, eine Belohnung zu erwarten haben". In der Mystik der Kabbala schließlich und bei den Chassidim kommt der Gedanke an eine Metamorphose, eine Seelenwanderung, auf. Sie ist möglicherweise der Grund für einen Vegetarismus, zu dem sich manche jüdischen Sekten bekennen (>Hulin< 84 a), und zur Verurteilung der Jagd, die als ein Sichausliefern an die niederen Triebe gedeutet wird (>Sanhedrin< 56 a). Von dem spanischen Mystiker Isaak Luria (1534-1572) wissen wir, daß er aus Ehrfurcht vor dem Leben der Geschöpfe kein lebendes Wesen, nicht einmal ein Insekt, tötete (>Universal Jewish Encyclopedia< Bd. I, S. 326). <103:> Läßt sich auf Grund dieser Beispiele von einem „Tierschutz" im Alten Israel und im Judentum sprechen? Daß Grausamkeit gegenüber Tieren, za'ar ba'alei hayyim, „Schmerz der lebenden Wesen", im Alten Testament verabscheut wird und statt dessen das Erbarmen gegenüber der Kreatur von Gott gefordert wird, steht außer Frage. Aber von einem eigentlichen Tierschutz ist man noch weit entfernt. Das scheint sich in der rabbinischen Literatur zu ändern. Dort wird z. B. in aller Deutlichkeit darüber diskutiert, ob nicht bestimmte Diätvorschriften die Tiertötung eingrenzen könnten. Dazu empfehlen die Rabbinen etwa die Einschränkung des Fleischgenusses auch von solchen Tieren, deren Schlachtung vom Gesetz her erlaubt ist. Die Rabbinen wenden sich damit ausdrücklich gegen das mutwillige Töten von Tieren und gegen die Schmerzen, die den Tieren damit bereitet werden.' Deutlicher noch äußern sie sich über die Tierquälerei von Arbeitstieren und Nutztieren, besonders am Sabbat, an dem Tiere wie Menschen zu behandeln seien und das Beladen und Abladen von Lasten sowie das Sporengeben bei Reitpferden strikt verboten ist. Von Rabbi Juda Hanasi wird sogar berichtet, daß er von Gott bestraft worden sei, weil er Tieren gegenüber keine Gnade zeigte, und die Strafe erst von ihm genommen wurde, als er seine Haltung änderte. Im übrigen begrenzten die zahlreichen Reinheitsgebote und Speisevorschriften die Tötung von Tieren bzw. erschwerten sie erheblich, so daß zahlreiche Arten, deren Genuß per Dekret verboten war, bessere Überlebenschancen hatten als z. B. genießbare Arten (>Hulin< 63 b; vgl. >Encyclopaedia Judaica< Bd. III, S. 7, 18.). Doch dürfen wir bei aller Hochschätzung des Tieres und seiner Seele im Alten Israel und im Judentum eines nicht vergessen: Die „Seele" eines jeden Tieres, von dem im Alten Testament und im Talmud gesprochen wird, ist – wie die Seele des Menschen – in jedem Falle eine „geliehene" Seele; d. h., mit der Beseelung durch Gott ist das Tier nicht etwa eine selbständige Wesenheit geworden, die neben oder unter Jahwe-Gott steht. Vielmehr ist und bleibt diese Seele nur darum am Leben, weil sie von Gott abhängig ist und ihm für immer gehört. Eine Selbständigkeit der Beseelung im Sinne der Stammesreligionen, in denen das Numen eines Tieres oder einer Pflanze verehrt wird oder dieses bestimmte Tier oder diese bestimmte Pflanze Götter sind, kennt das Alte Testament nicht, und wenn, dann nur aus der Zeit, in der es die Tier- und Pflanzenverehrung aus Ägypten oder Mesopotamien übernahm und umdeutete. Tiere und Pflanzen erfuhren auf diese Weise das gleiche Schicksal wie die Himmelskörper, <104:> die einmal babylonische Götter waren, aber im ersten Schöpfungsbericht (Gen 1) zu Geschöpfen umgestaltet wurden, die, Lampen gleich, die Erde erleuchten und dazu da sind, den Schöpfer aller Dinge zu loben und zu bekennen: „Er selbst hat uns geschaffen." „Das Wild des Feldes preist mich", läßt Jesaja Jahwe-Gott sagen (Jes 43,20). „Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel [...], die sollen loben den Namen des Herrn", ruft der Psalmist (Ps 148,10ff.). „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn", mit dieser Aufforderung schließt der Psalter ab (Ps 150,6). Die Natur mit ihren Wesen hat kein Eigenleben, sondern dient dem Schöpfer und ist dazu da, den Schöpfer anzubeten und ihn zu preisen oder ihn um Erbarmen zu bitten: die jungen Raben flehen Gott um Hilfe an (Hiob 38,41), die Hunger leidenden Tiere bitten Gott um Nahrung, und Gott tröstet die Tierwelt: „Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde; denn die Auen in der Steppe sollen grünen und die Bäume ihre Früchte bringen" (Joel 2,22). Gott loben und Gott um Erbarmen bitten, das ist es, wozu die Wesen, die der Schöpfer beseelt hat, auf Erden sind. Es sind Eigenschaften, die sich die Geschöpfe nicht selbst gegeben haben, sondern Gaben Gottes sind. Was aber alle Geschöpfe miteinander gemeinsam haben, das ist der Odem Gottes. Er verbindet alles, was lebt, miteinander und macht sie alle untereinander gleich. Kennzeichen ihrer Geschöpflichkeit ist der Odem Gottes als Zeichen des Lebens, Kennzeichen ihrer Geschöpflichkeit ist aber auch die Matrix Erde, der sie alle entnommen sind, als Zeichen ihrer Vergänglichkeit. Das eine ist ein Geschenk, das andere wirkt sich als Verhängnis aus. Beides kommt von Jahwe-Gott. Aber keines von beiden deutet darauf hin, daß darum eine verwandtschaftliche Verbindung zwischen Schöpfer und Geschöpf besteht. Auch wenn der Mensch als „Bild Gottes" bezeichnet wird, das dem Urbild nachgestaltet worden ist, so ist doch mit keinem Wort davon die Rede, daß Bild und Urbild „Verwandte" sind oder daß es eine Teilhabe des Bildes am Urbild gibt. Die Distanz zwischen Geschöpf und Schöpfer. ist, wie Augustin sagt, nur durch das Lob des einen und das Erbarmen des anderen zu überbrücken. Der Odem Gottes ist dabei das Medium, das beide miteinander verbindet; aber die Erde, der alle Geschöpfe entstammen und zu der sie wieder werden, trennt zugleich beide unerbittlich. So liegt eine Tragik über der Schöpfung und ihren Geschöpfen, eine Tragik, die die Bibel nicht auflöst. Nur der Glaube des Geschöpfes Mensch wird zuweilen zur Brücke, die vom Diesseits hinüber ins Jenseits führt. <105:> Das ist der Vorzug, den der Mensch vor allen anderen Geschöpfen genießt. Für Tiere und für Pflanzen gilt, daß sie diesen Glauben „nur" unbewußt, „nur" instinktiv ausüben können. Für sie tritt an die Stelle des Glaubens das Lob des Schöpfers, das dieser mit seinem Erbarmen beantwortet. Konkretisierung: Ein fast unerreichbares Ideal Sechs Jahre sollst du dein Land besäen und seine Früchte einsammeln. Aber im siebenten Jahr sollst du es ruhen und liegen lassen, daß die Armen unter deinem Volk davon essen; und was übrigbleibt, mag das Wild auf dem Felde fressen. Ebenso sollst du es halten mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen. Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun; aber am siebenten Tage sollst du feiern, auf daß dein Rind und Esel ruhen und deiner Sklavin Sohn und der Fremdling sich erquicken. Alles, was ich euch gesagt habe, das haltet. Aber die Namen anderer Götter sollt ihr nicht anrufen, und aus eurem Munde sollen sie nicht gehört werden. (Ex 23,10-13) Dieser Text, der im 3. Buch Mose, Lev 25,1-23, noch einmal, und zwar sehr viel ausführlicher auftaucht, bezieht sich nicht nur auf das Gebot der wöchentlichen Sabbatruhe für Mensch und Tier, sondern auf ein ganzes Jahr, das Sabbatjahr, schabbat ha'erez, das Gott für jedes siebente Jahr verordnet hat. Dieses Sabbatjahr sollen die Israeliten Jahwe als Opfer darbringen, indem sie die Erde, den Akkerboden, ausruhen lassen. Sie sollen handeln wie Gott nach der Vollendung seiner Schöpfung handelte, aber das ein ganzes Jahr lang, nämlich das siebente Jahr. In diesem Jahr durfte weder gesät noch geerntet werden, vielmehr sollte die Erde brachliegen, „sich selbst überlassen" werden. Der Talmud gibt später genaue Anweisungen, wie das zu geschehen hat und fragt: „Von wann an darf man die Fruchtbäume im Siebentjahr nicht mehr abhauen?" Und er gibt das Ergebnis rabbinischer Diskussion bekannt: „Die Schule Schammajs sagt, keinen Baum, sobald er Frucht hervorbringt. Die Schule Hillels sagt: [...] Weinstöcke, sobald sie kernig sind, Oliven, sobald sie blühen" (>Berakhot< VI,1). „Sich selbst überlassen", das heißt zunächst: Alle sieben Jahre soll der ursprüngliche Zustand des Ackers und des gesamten Kulturlandes wiederhergestellt werden und eine restitutio in integrum erfolgen. Mit dem ursprünglichen Zustand war zu allererst die Wiederherstellung der ursprünglichen Besitzverhältnisse verbunden: Der <106:> Acker, die Erde ist heiliges Land und gehört Gott. Die erez Jisrael, das Land Israel, ist auch heute Jahwes Land und Besitz. Mit ihm dürfen die Menschen nicht wie mit Privateigentum verfahren. Es ist grundsätzlich unverkäuflich und unantastbar, weil sich in ihm und auf ihm Jahwe offenbart. Das sogenannte „Brachjahr" gehört zu den ältesten Gesetzen des Alten Testaments. Es steht im „Bundesbuch" und im „Heiligkeitsgesetz" und besitzt eine außerordentlich große Bedeutung für das Selbstverständnis Israels. Ursprünglich wurden sogar die Ackeranteile neu verlost, um zu dokumentieren, daß die Besitzrechte allein Gott zustehen und er das Land seinem Volk jeweils alle sieben Jahre leihweise überläßt, um es sich dann wieder anzueignen. Eine solche „Wiederherstellung des Ursprungs" bedeutete aber zugleich auch einen neuen Anfang: Nach der Verlosung der Ackeranteile durften einst Bauern und Hirten wieder mit der Nutzung des ihnen zugesprochenen Landes neu beginnen. In jedem siebenten Jahr wurde damit die Unmittelbarkeit der Beziehung zu Jahwe wiederhergestellt bzw. rituell bekräftigt. Der eigentliche Eigentümer des Landes, Gott, wurde erneut eingesetzt, und die Menschen liehen von ihm das Land auf Zeit. Man kann sich denken, wie sich eine solche radikale Regelung der Eigentumsrechte, die sich periodisch alle sieben Jahre wiederholte, auf die moderne „Befreiungstheologie", wie sie von den christlichen Kirchen z. B. in Lateinamerika vertreten wird, auswirkt: Die Großgrundbesitzer werden aufgefordert, ihr Eigentumsverständnis radikal zu verändern und sich bewußtzumachen, daß ihr riesiger Landbesitz im Grunde nicht ihnen, sondern Gott gehört. Sie sind nur Lehnsherren Gottes, und als solche sind sie verpflichtet, ihr Eigentum mit den Armen zu teilen. Das Sabbatjahr wird hier also symbolisch zu einem Jahr des Teilens mit den Armen verstanden. „Sich selbst überlassen", das heißt aber außerdem: Dem Land wird nach sechs Jahren der Bearbeitung und der Nutzung, ja der „Ausnutzung", die ursprüngliche, nicht durch Menschenhand gestörte Ruhe zugebilligt. In diese Ruhe ist auch die Tierwelt des Feldes und des Waldes eingeschlossen: Die Tiere durften in jedem Brachjahr Nutznießer der wildwachsenden Früchte sowie der übriggebliebenen Nahrung sein. Aber das Sabbatjahr war nicht unproblematisch. Der Leviticustext macht zwar deutlich (Lev 25,20-23), daß Gott sein Volk im sechsten Jahr durch eine gute Ernte reich segnen werde, so daß es genug zu essen haben und auch genug Saatgetreide für das achte <107:> Jahr übrigbehalten werde; doch wissen wir aus dem 1. Makkabäerbuch (1. Makk 6,49-53) und aus späteren rabbinischen Zeugnissen, daß es oft Hungersnöte während des Sabbatjahres in Israel gegeben hat und man darum Nahrungsmittel einführen mußte. Viele Juden Israels sehen auch heute in der erez Jisrael das Land, in dem und auf dem sich Gott offenbart und das darum Heiliges Land ist. In den Grenzen des Davidischen Königreichs ist es für jeden Nichtjuden tabu. Alle Auseinandersetzungen mit den Palästinensern haben dort ihren Ursprung, wo sich Israel in den Grenzen seines Heiligen Landes bedroht fühlt. Würde es diese Grenzen aufgeben oder zurücknehmen, dann würde es gleichsam die Eigentumsrechte Gottes antasten und seine Allmacht in Frage stellen. Das ist eine der religiösen Begründungen für das unerbittliche Festhalten an den Grenzen des heutigen Staates Israel und an seiner Siedlungspolitik. Zugleich ist das Sabbatjahr für den jungen Staat Israel immer auch eine praktisch-ökologische Herausforderung gewesen. Es wird im wahrsten Sinne des Wortes als „Brachjahr" verstanden, in dem die Erde und die Natur eine Ruhezeit erhalten sollen. Besonders von der jüdischen Orthodoxie wird dieses Brachjahr als eine Art „ökologischer Auftrag" propagiert: Die erez Jisrael bedarf alle sieben Jahre eines besonderen Ruhejahrs, damit sie sich erholen und Kraft sammeln kann für die Zukunft, damit sie wieder neues Leben spenden kann. Dazu sind viele Opfer erforderlich, darunter der Verzicht auf rücksichtslose Ausbeutung und Überdüngung. Der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur ist im Lande Israel überall mit Händen zu greifen. Allerdings bleibt die Ausrufung eines Sabbatjahrs mit lautem Hornblasen, wie es im Heiligkeitsgesetz des Leviticus vorgeschrieben ist, ein utopisches Ziel: Wie sollte es sich auch angesichts dieser kleinen bebaubaren Fläche des Staates Israel und der großen Bevölkerungsdichte verwirklichen lassen! Aber der Ruf: „Im siebenten Jahre sollst du das Land sich selbst überlassen und es unbestellt lassen, und die Armen deines Volkes sollen sich davon ernähren, und was diese übriglassen, sollen die Tiere des Feldes fressen" (Ex 23, 1011), ist darüber nicht verstummt. Und ähnlich wie im Islam, so gibt es auch in der jüdischen Religion die Möglichkeit, statt dessen eine Ersatzhandlung zu leisten oder ein Ersatzopfer zu bringen: Der fromme Jude soll sich alle sieben Jahre in besonderer Weise der Armen und Hilfsbedürftigen annehmen und sich um die Tiere kümmern. Dadurch wird das Sabbatjahr zu einem Jahr des Naturschutzes und des Friedens zwischen Mensch und Natur.