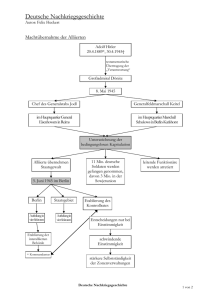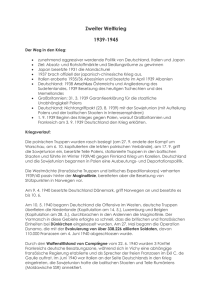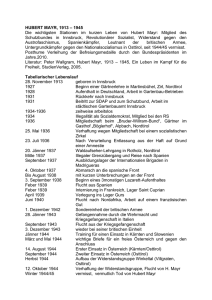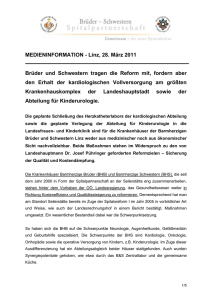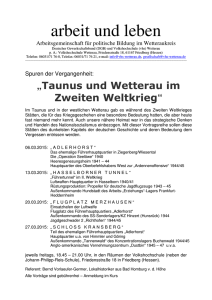Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in katholischen Einrichtunge
Werbung
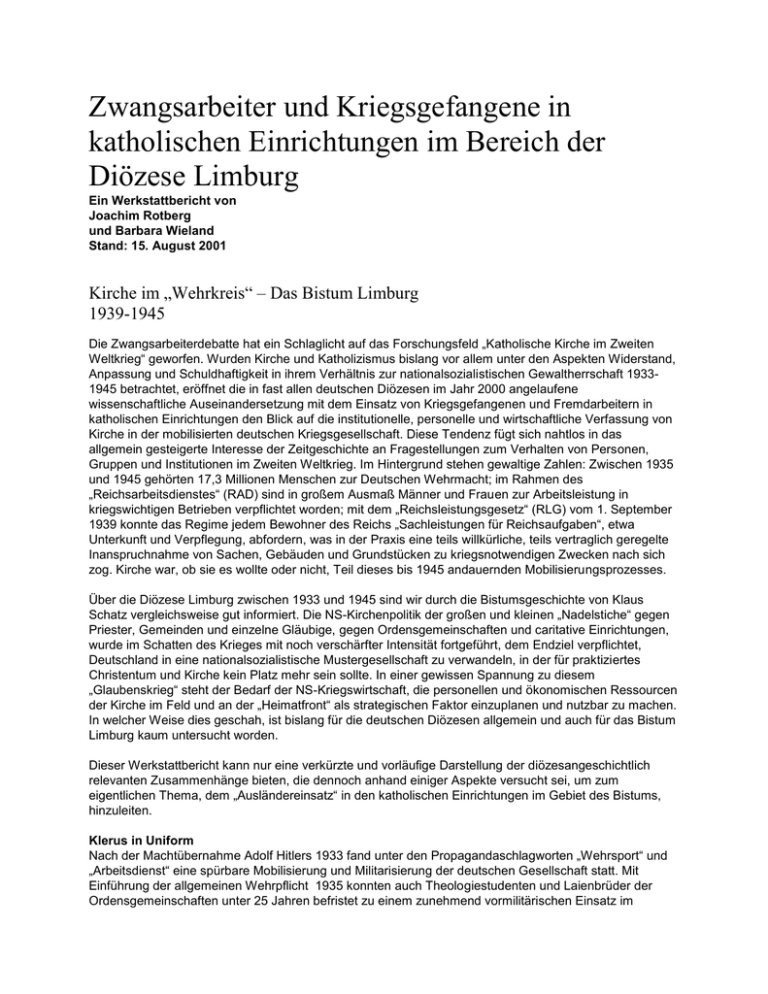
Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in katholischen Einrichtungen im Bereich der Diözese Limburg Ein Werkstattbericht von Joachim Rotberg und Barbara Wieland Stand: 15. August 2001 Kirche im „Wehrkreis“ – Das Bistum Limburg 1939-1945 Die Zwangsarbeiterdebatte hat ein Schlaglicht auf das Forschungsfeld „Katholische Kirche im Zweiten Weltkrieg“ geworfen. Wurden Kirche und Katholizismus bislang vor allem unter den Aspekten Widerstand, Anpassung und Schuldhaftigkeit in ihrem Verhältnis zur nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 19331945 betrachtet, eröffnet die in fast allen deutschen Diözesen im Jahr 2000 angelaufene wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Einsatz von Kriegsgefangenen und Fremdarbeitern in katholischen Einrichtungen den Blick auf die institutionelle, personelle und wirtschaftliche Verfassung von Kirche in der mobilisierten deutschen Kriegsgesellschaft. Diese Tendenz fügt sich nahtlos in das allgemein gesteigerte Interesse der Zeitgeschichte an Fragestellungen zum Verhalten von Personen, Gruppen und Institutionen im Zweiten Weltkrieg. Im Hintergrund stehen gewaltige Zahlen: Zwischen 1935 und 1945 gehörten 17,3 Millionen Menschen zur Deutschen Wehrmacht; im Rahmen des „Reichsarbeitsdienstes“ (RAD) sind in großem Ausmaß Männer und Frauen zur Arbeitsleistung in kriegswichtigen Betrieben verpflichtet worden; mit dem „Reichsleistungsgesetz“ (RLG) vom 1. September 1939 konnte das Regime jedem Bewohner des Reichs „Sachleistungen für Reichsaufgaben“, etwa Unterkunft und Verpflegung, abfordern, was in der Praxis eine teils willkürliche, teils vertraglich geregelte Inanspruchnahme von Sachen, Gebäuden und Grundstücken zu kriegsnotwendigen Zwecken nach sich zog. Kirche war, ob sie es wollte oder nicht, Teil dieses bis 1945 andauernden Mobilisierungsprozesses. Über die Diözese Limburg zwischen 1933 und 1945 sind wir durch die Bistumsgeschichte von Klaus Schatz vergleichsweise gut informiert. Die NS-Kirchenpolitik der großen und kleinen „Nadelstiche“ gegen Priester, Gemeinden und einzelne Gläubige, gegen Ordensgemeinschaften und caritative Einrichtungen, wurde im Schatten des Krieges mit noch verschärfter Intensität fortgeführt, dem Endziel verpflichtet, Deutschland in eine nationalsozialistische Mustergesellschaft zu verwandeln, in der für praktiziertes Christentum und Kirche kein Platz mehr sein sollte. In einer gewissen Spannung zu diesem „Glaubenskrieg“ steht der Bedarf der NS-Kriegswirtschaft, die personellen und ökonomischen Ressourcen der Kirche im Feld und an der „Heimatfront“ als strategischen Faktor einzuplanen und nutzbar zu machen. In welcher Weise dies geschah, ist bislang für die deutschen Diözesen allgemein und auch für das Bistum Limburg kaum untersucht worden. Dieser Werkstattbericht kann nur eine verkürzte und vorläufige Darstellung der diözesangeschichtlich relevanten Zusammenhänge bieten, die dennoch anhand einiger Aspekte versucht sei, um zum eigentlichen Thema, dem „Ausländereinsatz“ in den katholischen Einrichtungen im Gebiet des Bistums, hinzuleiten. Klerus in Uniform Nach der Machtübernahme Adolf Hitlers 1933 fand unter den Propagandaschlagworten „Wehrsport“ und „Arbeitsdienst“ eine spürbare Mobilisierung und Militarisierung der deutschen Gesellschaft statt. Mit Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 1935 konnten auch Theologiestudenten und Laienbrüder der Ordensgemeinschaften unter 25 Jahren befristet zu einem zunehmend vormilitärischen Einsatz im Rahmen des RAD oder der „Deutschen Arbeitsfront“ (DAF) verpflichtet werden. Die jüngeren Geistlichen mußten im Fall der Mobilmachung mit der Einberufung zur Heeresseelsorge oder zum Sanitätsdienst rechnen, denn dies war in einem geheimen Zusatzprotokoll zum Reichskonkordat so geregelt. Vom Kriegsdienst blieben nach diesem bis heute umstrittenen Protokoll nur die Bischöfe und die in der Diözesanverwaltung, als Gemeindepfarrer, als Seminarprofessoren oder Hausrektoren (Seminar- und Konviktsregenten) tätigen Geistlichen verschont. Alle übrigen geweihten Kleriker - auch Ordensleute waren für den Sanitätsdienst oder die Wehrmachtsseelsorge vorgesehen, Theologiestudenten unter der Diakonatsweihe „zum Dienst mit der Waffe, wenn sie nicht im Sanitätsdienst verwendet werden können“. Das Deutsche Reich war seit 1937 in 13 sog. „Wehrkreise“ oder auch „Reichsverteidigungsbezirke“ eingeteilt mit den für Ersatz und Versorgung des Heeres zuständigen Dienststellen. In den Wehrkreisen waren für die Soldatenseelsorge besonders beauftragte Wehrkreispfarrer als Reichsbeamte eingesetzt, die dem Katholischen Feldbischof in Berlin-Charlottenburg, Rarkowski, unterstanden. Das Bistum Limburg gehörte gebietsmäßig zu den Wehrkreisen IX (Kassel) und XII (Wiesbaden). Bereits am 8. Oktober 1938, im Zuge der Sudetenkrise, wurde Generalvikar Göbel mit vertraulichem Schreiben („Geheime Kommandosache!“) des Katholischen Wehrkreispfarrers in Wiesbaden eine Liste mit 15 Namen von jüngeren Geistlichen aus der Diözese Limburg übersandt, die im Mobilisierungsfall für die Wehrmachtsseelsorge „in der Heimat“ vorgesehen waren. Etwa 1.700 bis 1.800 Priester aus dem ganzen Deutschen Reich waren zwischen 1939 und 1945 als Militärseelsorger tätig, meist im Offiziersrang, davon etwa 550 als Kriegs- und Marinepfarrer bei den kämpfenden Truppen. Zum regulären Heeresdienst waren bezogen auf alle deutschen Diözesen 3.819 Weltgeistliche, 4.292 Ordensgeistliche, 4.016 Laienbrüder und 858 Ordensnovizen eingezogen (Stand: 1. Mai 1943). Zudem standen 4.368 Theologiestudenten im Feld, vor allem als Sanitäter. Für Limburg läßt sich anhand von kriegswirtschaftlichen „Kräftebilanzen“ des Bischöflichen Ordinariates für die Wehrkreise IX und XII wenigstens ansatzweise die Zahl der Priester und Brüder im Kriegsdienst erheben (Stand: 31.5.1942). Demnach waren im Wehrkreis IX, zu dem auch Frankfurt am Main gehörte, 26 von 163 Welt- und Ordensgeistlichen im Kriegsdienst. Für den Wehrkreis XII, in dessen Einzugsbereich die großen Ordensgemeinschaften des Bistums ihren Sitz hatten, verfügen wir über genauere Angaben: Von 318 im aktiven Dienst befindlichen Welt- und Ordenspriestern waren 103 eingezogen, darunter 32 Weltgeistliche, 49 Pallottinerpatres aus Limburg, zehn Zisterzienser aus Marienstatt, acht Oblatenpriester aus Niederlahnstein, drei Arnsteiner Patres und ein Franziskanerpater aus Marienthal. Von den Laienbrüdern waren noch 66 für die Orden tätig, 141 Brüder waren eingezogen [Abb. 1, siehe nächste Seite]. Allein aus dem Mutterhaus der Limburger Pallottinerprovinz waren von 127 Brüdern 62 im Heeresdienst und weitere 22 in Haft oder zum Arbeitsdienst im Raum Limburg verpflichtet (Stand 1.1.1944). Nach der Katastrophe von Stalingrad und der Wende im Westen wurden noch die letzten Reserven mobilisiert, so daß 1944 noch einmal 135 Limburger Priester Gestellungsbefehle erhielten. Für die Pfarreien bedeutete die Abwesenheit der Kapläne und jungen Pfarrer weitere Einschränkungen, vor allem in der Kinder- und Jugendseelsorge. 5.953 Seelsorgstellen waren Anfang 1944 in Deutschland unbesetzt. Die Kriegsverluste sind bislang nur vorsichtig zu beziffern. Während des Krieges listeten die Titelseiten der Bischöflichen Amtsblätter in regelrechten Ehrentafeln die gefallenen Priester und Ordensleute auf [Abb. 2]. Am Ende blieben zehn Geistliche der Diözese Limburg im Feld, vier gelten bis heute als vermißt. Als erster starb am 2. September 1940 der aus dem Bistum stammende 28jährige Kriegsmarinepfarrer Friedrich Wagner den „Seemannstod“, wie der Nekrolog festhält. Kumulierte und zuverlässige Zahlen zu den Kriegsverlusten der Orden im Bistum liegen bislang nicht vor. Der Limburger Bischof Antonius Hilfrich hat in den Hirtenworten der Kriegszeit seine Diözesanen immer wieder auf ihre religiösen Pflichten daheim und im Feld hingewiesen. Im Fastenhirtenbrief vom 15. Januar 1940 sagte der Bischof: „Die bevorstehende ernste heilige Fastenzeit fällt in die noch viel ernstere Zeit eines schweren Krieges um die Freiheit und Zukunft unseres Volkes. Eine große Zeit fordert und weckt zugleich hochherzige Gesinnung und eifert an zu opfervoller Hingabe. Eine Zeit der Entscheidung über Glück und Existenz unseres Volkes! Eine Zeit weltgeschichtlicher Wende!“ Derartiges Pathos war fraglos auch der von Kirche und Katholizismus immer wieder geforderte Erweis patriotischer Zuverlässigkeit, der nichts mit radikaler NS-Propaganda gemein hatte; allerdings führten solche Kanzelworte der deutschen Kriegsführung nolens volens auch Kräfte zu, was die kontrovers diskutierte Fragestellung nach dem Anteil von Kirche und kirchlichen Lehrmeinungen an der Rechtfertigung der erfolgten Kriegshandlungen aufwirft. „Priester unter Hitlers Terror“ Nicht nur die Kriegsereignisse haben die personellen Kräfte der Katholischen Kirche nachhaltig geschwächt. Der nationalsozialistische Unterdrückungsapparat forcierte in der Kriegszeit seine Maßnahmen gegen unliebsame Geistliche. Aus den Reihen des Bistums Limburg kamen drei Pallottinerbrüder und ein Sankt Georgener Theologiestudent durch Haftumstände und willkürliche Gerichtsurteile zu Tode. Pfarrer Jakob Bentz von Frankfurt-Oberrad, Pfarrer Dr. Adolf Müller, Hausgeistlicher in BerlinDahlem und Priester der Diözese Limburg, und der Superior des Klosters Arnstein, P. Alphons Spix SSCC, starben im „Priester-KZ“ Dachau. Seit Ende 1940 wurden dort fast alle internierten Geistlichen aus anderen Konzentrationslagern zusammengezogen, in der Mehrzahl Polen. In KZ-Haft befanden sich außerdem fünf Weltpriester und dreizehn Ordensleute aus der Diözese. In internen Beratungen der Ordinariate wurden Kriegsdienst und Haftmaßnahmen als zwei Seiten derselben Medaille angesehen. In einer vertraulichen Statistik aus dem zweiten Kriegsjahr mit der Überschrift „Verluste im Mitgliederstande des Klerus in Groß-Deutschland“, die im Diözesanarchiv Limburg aufbewahrt wird, stehen Priestersoldaten und KZ-Häftlinge in einer Reihe. Die Rubriken lauten: „In Strafgefängnissen und Untersuchungshaft“, „Im Konzentrationslager“, „Priester im Dienste der Wehrmacht“ und „Theologiestudenten im Dienste der Wehrmacht“. Die Mobilisierung von Priestern und Ordensleuten für den Kriegsdienst, das war in den Stabsstellen der Bischöfe klar, war eine zweischneidige Angelegenheit. Sie diente unzweifelhaft dem voranschreitenden Kampf des NS-Regimes gegen Kirche und Katholizismus. Dennoch wurde die Kriegsteilnahme auch als ein Akt selbstverständlicher patriotischer Solidarität der Geistlichen mit ihren Altersgenossen, die als Soldaten im Felde ihr Leben einsetzen mußten, empfunden. Genau diese „nationale“ Haltung zweifelten aber die NS-Machthaber bei den katholischen Heeresgeistlichen in zunehmendem Maße an. Unerwünschte Nebeneffekte traten etwa dann auf, wenn sich wehrmachtsangehörige Pfarrer, wie im nationalsozialistischen Mustergau „Wartheland“ geschehen, trotz rigoroser Strafandrohung mit Polen solidarisierten und mit ihnen die hl. Messe feierten. Solche oder ähnliche Vorfälle führten zum Verbot jeder seelsorglichen Tätigkeit von Priestersoldaten durch das Oberkommando der Wehrmacht (OKW), was den Klerus an der Front letztlich spaltete, denn gegenüber den ordentlichen Wehrmachtsgeistlichen waren die „einfachen“ Wehrpflichtigen jetzt Priester 2. Klasse. Um die Situation nachhaltig in den Griff zu bekommen, wurden als erstes die politisch ohnehin „verdächtigen“ Jesuiten als „wehrunwürdig“ mit dem Vermerk „n.z.v.“ (nicht zur Verwendung) diffamiert, dann die Priester, Priesteramtskandidaten und Ordensleute, die Reserveoffiziere waren, entlassen. Reichsleiter Martin Bormann plante 1943 sogar, alle Geistlichen aus der Wehrmacht auszuschließen. Es wäre sicher lohnend, den Aspekt „Kriegsdienst“ als Teil des Themenkomplexes „Priester unter Hitlers Terror“ für die Diözese Limburg anhand der „Militaria“-Bestände und Personalakten im Diözesanarchiv in schärferes Licht zu setzen. Die Klöster und Ordenshäuser in der Diözese - und dies ist für den vorliegenden Werkstattbericht relevant - waren durch die kriegsbedingten personellen Einbußen, das 1940 ergangene Verbot, neue Laienbrüder und -schwestern in die Konvente aufzunehmen und eine intensivierte antikirchliche Propaganda an ihrem eigentlichen Auftrag (Erziehung, Unterricht, Seelsorge, Exerzitien, Krankenpflege, Landwirtschaft, Selbstheiligung, klausuriertes Leben usw.) zunehmend gehindert, in ihrer ökonomischen Leistungsfähigkeit gravierend geschwächt und somit als kirchliche oder klösterliche Einrichtung existentiell gefährdet, sofern sie nicht durch „staatspolizeiliche“ und regierungsamtliche Willkürakte bereits gänzlich ihrem Wirkungskreis entzogen waren. „Klostersturm“ Für die Nationalsozialisten waren Orden und Klöster seltsam autarke Sonderwelten, die sich einer wirksamen Gleichschaltung durch den „braunen“ Macht- und Propagandaapparat entzogen. Früher als in anderen Diözesen, kam es im Bistum Limburg zu einem sogenannten „Klostersturm“. Dabei handelte es sich um die 1941 erfolgte entschädigungslose Enteignung von etwa 130 Klöstern und kirchlichen Einrichtungen im ganzen Reichsgebiet, deren Hintergründe und Auswirkungen bis 1945 allerdings nur in Einzelfällen bekannt sind. Ein großangelegtes Vorspiel dazu war das geradezu raubzugartige Vorgehen staatlicher Stellen im Gau Hessen-Nassau im Frühjahr 1939. Dem berüchtigten Gauleiter Sprenger wird bis heute die Äußerung zugeschrieben, er wolle Hitler zu dessen 50. Geburtstag einen „klosterfreien“ Gau darbieten. Bereits zum Jahreswechsel 1938/39 wurde die im bischöflichen Besitz befindliche Pflegeanstalt St. Vinzenzstift für geistig Behinderte in Aulhausen in ein Erholungsheim der „Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt“ (NSV) umgewandelt, die dort tätigen Dernbacher Schwestern vertrieben und die Zöglinge - mit ungewissem Schicksal - in staatliche Anstalten verlegt. Im Krieg fungierte das Haus als Reservelazarett. Am 21. März 1939 wurde die Marienschule der Dernbacher Schwestern in Limburg, ein Lyzeum für höhere Töchter, durch die Stadt geschlossen und am 15. April eine staatliche Oberschule in den Gebäuden eröffnet. In einer konzertierten Aktion von Gestapo und Regierungspräsidium in Wiesbaden, das die notwendigen Verwaltungsakte besorgte, wurde Bischof Hilfrich am 25. März 1939 die Verfügung über die im Diözesanvermögen befindliche Peter-Joseph-Stiftung und den Diözesanknabenseminarfonds entzogen. Die auf den Limburger Bischof Blum zurückgehende Peter-Joseph-Stiftung war Eigentümerin der Franziskanerklöster Kelkheim und Hadamar (Studienheim), zu einem Teil auch des Franziskanerklosters Bornhofen. Betroffen waren von dieser Maßnahme gegen die Stiftung auch der Schwesternkonvent vom „Guten Hirten“ in Marxheim, die Dernbacher Schwestern in Tiefenthal sowie die Diözesanjugendheime in Kirchähr und Königshofen, die für Zwecke der Hitler-Jugend beschlagnahmt wurden. An die Stelle der Peter-Joseph-Stiftung trat auf Anordnung des Regierungspräsidenten die „Nassauische Volkspflegestiftung e.V.“ zur „Förderung und Erziehung deutscher Volksgenossen im Regierungsbezirk Wiesbaden“. Diese zog die Verfügung über die genannten Häuser an sich. Die zum Diözesanknabenseminarfonds gehörigen Knaben-Konvikte des Bischofs in Montabaur und Hadamar ereilte das gleiche Schicksal. Die Regenten und Subregenten kamen in Haft und erhielten nach Freilassung die Auflage, sich im Umkreis von 50 Kilometern von ihren früheren Wirkungsstätten fernzuhalten. Am 5. April 1939 wurde dann auch noch die Diözesanjugenderziehungsanstalt in Marienhausen aus „staatspolizeilichen Gründen“ geschlossen, in die besagte NS-Stiftung überführt und zunächst zum Kinderlandverschickungs-Lager, im Krieg schließlich zum Lazarett und NS-Landdienstlehrhof umfunktioniert. Als Begründung für die widerrechtlichen Aneignungen mußten angebliche „sittliche Verfehlungen“ der Geistlichen in den fraglichen Häusern herhalten, was auch in den Tageszeitungen breiten Widerhall fand. Das von langer Hand geplante Vorgehen bedeutete einen geradezu flächenmäßigen Schlag gegen caritativ und schulisch wichtige Einrichtungen des Bistums. Besorgt äußerte sich Bischof Hilfrich am 31. Mai 1939 in einer Eingabe an den Verbindungsmann des Episkopates zu den Regierungsstellen in Berlin, Weihbischof Wienken: „Sind die Eingriffe bei uns vielleicht nur ein Anfang, ein Versuch, dem andere Maßnahmen auch in anderen Diözesen folgen werden?“ Trotz dieser Ereignisse ließ Bischof Hilfrich für den Vorabend von Hitlers 50. Geburtstag ein halbstündiges Geläut, Beflaggung aller Kirchen und Dienstwohnungen mit Hakenkreuz- und Schwarz-Weiß-Roter-Fahne sowie ein „feierliches Votivamt zu Ehren des heiligen Michael, des Patrones unseres deutschen Volkes“, über das Amtsblatt anordnen. Der „Klostersturm“ zwei Jahre später betraf auf dem Gebiet der Diözese Limburg vor allem die Benediktinerinnen-Abtei Eibingen bei Rüdesheim. Der dortige Konvent hatte am 26. Mai 1941 noch bei der Wehrkreisverwaltung erreicht, daß die Abtei mit sofortiger Wirkung für „Lazerettzwecke“ in Beschlag genommen wird. Zu einem Vertragsabschluß mit dem Reservelazarett nach § 27 RLG kam es jedoch nicht mehr. Am 2. Juli 1941 wurde das Kloster mit damals 114 Schwestern von der Gestapo geräumt und das gesamte Vermögen der „Vereinigung der Benediktinerinnen zu St. Hildegard e.V.“, des Rechtsträgers der Abtei, aufgrund von § 1 der „Reichstagsbrandverordnung“ vom 28. Februar 1933 als „volks- und staatsfeindliches Vermögen“ enteignet. Der Konvent ging in seiner überwiegenden Zahl nach Dernbach. Nur neun Schwestern blieben zurück, die im schließlich doch noch eröffneten Lazarett dienstverpflichtet wurden. Als die Enteignung im Februar 1942 vom Regierungspräsidenten für Rechtens erklärt wurde, protestierte Bischof Hilfrich in einem Hirtenbrief sehr offen, aber erfolglos gegen die Vertreibung der Schwestern. Nach Kriegsende wurde von der Stadt Rüdesheim ein Altenheim im Kloster eingerichtet. Erst 1948 erhielten die Schwestern ihren Besitz zurück. Ähnliche Maßnahmen gegen andere, noch bestehende bedeutende Konvente in der Diözese, etwa gegen die Kapuziner in Frankfurt, die Franziskaner in Marienthal oder die Zisterzienser in Marienstatt, erfolgten 1941/42 offenbar nicht. Die staatlichen Räumungsabsichten im Falle der Jesuiten-Kommunität in Frankfurt-Sankt Georgen wurden zurückgezogen, da die Einquartierung eines Lazaretts bevorstand. Von der Übernahme der kirchlichen Kindergärten durch die NSV im August 1941 waren jedoch die Dernbacher Schwestern in besonderer Weise betroffen, da hauptsächlich sie in diesen Einrichtungen auf Pfarrebene arbeiteten. Der NS-Staat hatte seit Kriegsbeginn in zunehmender Weise polykratische Herrschaftsstrukturen ausgebildet, institutionelle und persönliche Rivalitäten schwächten den Anspruch des totalitären Staates, allerdings verloren im Windschatten des zunächst erfolgreichen „Blitzkrieges“ letzte rechtsstaatliche Formen immer mehr an Bedeutung, und ungezügelte Willkürakte der Exekutivorgane griffen zunehmend Raum. Über Erfolg oder Mißerfolg der Enteignungsabsichten entschieden nicht selten das Kräfteverhältnis zwischen den alten Eliten in Bürokratie und Militär und den neuen Staats- und Parteidienststellen, der Grad intensionaler Verwurzelung der „braunen“ Bewegung in traditionell verhafteten Lebensräumen und, wie meist in der Geschichte, okkasionale Gegebenheiten. Die Erforschung dieser Zusammenhänge und der Auswirkungen des „Klostersturms“ steckt in unserem Bistum noch in den Anfängen. Dienstleistungen für die „Heimatfront“ Wie schon im Ersten Weltkrieg stellte die Kirche Räume und Personal für Lazarette und Notunterkünfte zur Verfügung, allerdings unter sehr viel größerem Druck als 1914/18. Der Raumbedarf während des Krieges stieg enorm an. Hinzu kamen die Begehrlichkeiten von Parteidienststellen, den Umbau der Gesellschaft nicht ins Stocken geraten zu lassen und brauchbare kirchliche Gebäude für NSKaderschmieden in Besitz zu bekommen. Zunächst aber wurden kirchliche Unterkünfte für Soldaten, Arbeitsdienstpflichtige usw. für den Mobilisierungsfall regelrecht auf „standby“ geschaltet. Nach dem oben erwähnten Geheimschreiben des Wehrkreispfarrers in Wiesbaden war bereits 1938 das Behindertenheim St. Vinzenzstift in Aulhausen als Reservelazarett und die Jugendanstalt Marienhausen der Salesianerpatres als Teillazarett vorgesehen. Auch das Missionshaus der Pallottiner in Limburg wurde im Herbst 1938 inspiziert und vermessen, um im Kriegsfall das städtische Vinzenzkrankenhaus, das Lazarett werden sollte, dorthin verlegen zu können. Eine Inbeschlagnahme dieser großen Häuser mit Ausnahme der Kirchengebäude hätte jederzeit nach dem „Gesetz über Leistungen für Wehrzwecke“ vom 13. Juli 1938, dem Vorläufer des RLG, erfolgen können. Sie lag in der Luft. Mit Kriegsausbruch wurden über-all in der Diözese kirchliche Einrichtungen und Klöster zur Unterbringung von Soldaten und Zivilisten genutzt. Wieviele der 613 durch den Realschematismus von 1936 festgestellten damals bestehenden Häuser und Einrichtungen (Pfarrheime, Klöster, Krankenhäuser, Seminare, Heime, Kindergärten etc.) in Beschlag kamen, läßt sich bislang nur ansatzweise beziffern. In einer im Nachlaß von Kardinal Bertram befindlichen „Statistik zum Kriegseinsatz der katholischen Kirche in Deutschland“ vom 12. August 1943 werden für das Reichsgebiet 675 Lazarette, 427 Umsiedlerlager, 217 Lager für die Kinderlandverschickung, 90 Lager für Rüstungsarbeiter und 1.902 weitere kirchliche und klösterliche Einrichtungen vermerkt, über deren Verwendung keine Angaben vorlagen. Wie war die Lage in der Diözese Limburg? In den bischöflichen Akten befindet sich eine 1944 erstellte Liste mit der Überschrift „Bereitstellung der Ordensgenossenschaften von Häusern für den Kriegseinsatz“. Auf ihr sind 17 Einrichtungen und deren gegenwärtige Nutzung aufgezählt: Elf Lazarette, sechs Hilfskrankenhäuser, fünf „Kriegsaltersheime“, zwei Kinderheime und eine sonstige Nutzung. Bei letzterer handelt es sich um die bereits 1936 von den Nationalsozialisten aufgelöste St. Josefsanstalt für geistig Behinderte im Besitz der Barmherzigen Brüder, die eigentlich an eine NS-Lehrerbildungsanstalt vermietet war, im Krieg allerdings als Wäscherei für das Lazarett Montabaur und als Unterkunft für das Offlag Hadamar diente. In der Bischofsstadt selbst waren die zwischenzeitlich enteignete Marienschule der Dernbacher Schwestern, das Pallottinerinnenkloster Marienborn und das Bischöfliche Priesterseminar Lazarett. Das Missionshaus der Pallottiner diente als Hilfskrankenhaus des Vinzenzhospitals, das wie geplant ebenfalls Lazarett geworden war. Die Liste zählt schließlich noch weitere vier fremdgenutzte Einrichtungen der Barmherzigen Brüder auf (alle Lazarett), das Zisterzienserkloster Marienstatt (Kinderheim und Altersheim), das Franziskanerkloster Marienthal (Altersheim), das Kloster Arnstein (Kinderheim und Altersheim), die Philosophisch-Theologische Hochschule Frankfurt-Sankt Georgen (Lazarett und Hilfskrankenhaus), das Antoniushaus in Hochheim (Hilfskrankenhaus), das Kinderheim der Dernbacher Schwestern in Wiesbaden (Hilfskrankenhaus), des weiteren deren Niederlassung in Kamp (Hilfskrankenhaus), die Gemeindestation der Schönstattschwestern in Wallmerod (Altersheim), das Johannesstift der Hiltruper Missionsschwestern (Hilfskrankenhaus), das Kloster Johannisberg im Rheingau (Altersheim) und das Ursulineninternat in Geisenheim (Lazarett). In dieser Liste wegen bereits erfolgter Ausbombung im März 1944 nicht aufgeführt, aber ebenfalls herangezogen wurden auch das Mutterhaus der Ursulinen in Frankfurt (Altersheim) und das Frankfurter Marienkrankenhaus der Dernbacher Schwestern (Luftschutzlazarett). Die genannte Liste bildet wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges. Für Frankfurt etwa verfügen wir durch erhaltene Hausstandsbücher über Hinweise, daß die größeren Häuser der noch bestehenden katholischen Vereine (Monikaheim, Heim für Kaufleute und Studenten, Karlshaus) als Sammelunterkünfte genutzt wurden. Selbst Pfarreien mußten ihre größeren Räumlichkeiten für „Sachleistungen“ zur Verfügung stellen, etwa St. Josef in Frankfurt-Bornheim, wo im Pfarrsaal italienische Saisonarbeiter und eine Pionierabteilung der Wehrmacht einquartiert wurden. In fast allen genannten Fällen blieb der kirchliche Träger formal Hausherr. In den kirchlichen Krankenhäusern und Anstalten, die noch Zivilfunktion hatten oder nur vorübergehend als Lazarett genutzt wurden, zielten die staatlichen Stellen auf Ausschaltung des konfessionellen Charakters dieser Häuser. In einem Nachtrag zum Runderlaß über die „Betätigung der Glaubensgemeinschaften in den öffentlichen Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten“ vom 9. April 1941 schränkte Reichsinnenminister Frick am 8. Juli 1941 die Freiheit der Seelsorge in den kirchlichen Krankenhäusern drastisch ein. Die Patienten mußten, wenn sie noch konnten, beim diensthabenden Stationsleiter selbst um den Besuch des Pfarrers bitten, der nicht einmal mehr im Krankenzimmer stattfinden durfte. Die Krankenhausseelsorger durften ihrerseits keinerlei Informationen, etwa die Konfessionszugehörigkeit, aus der Patientenkartei erhalten. Mit der Okkupation von kirchlichen Einrichtungen wurde meist auch das dort vorhandene Potential an arbeitsfähigen Personen dienstverpflichtet. So waren nach Hochrechnungen in „Groß-Deutschland“ rund 70% von etwa 120.000 Ordensschwestern und -novizinnen für Lazarette, Zivil- und Hilfskrankenhäuser, Altenheime oder andere Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge tätig [Abb. 3, siehe nächste Seite]. Durch wehrstatistische Erfassungen in den Jahren 1940 bis 1944 versuchte das OKW im Zusammenspiel mit den Arbeitsbehörden und dem Reichsministerium für die kirchlichen Angelegenheiten (RMfdkA) vor allem gegen Ende des Krieges auch die letzten abkömmlichen und dienstfähigen Geistlichen, Ordensleute und kirchlichen Angestellten für die Front oder den Einsatz in der Heimat zu mobilisieren. Am 10. Dezember 1943 antwortete der greise Generalvikar Göbel in der ihm eigenen Gelassenheit auf ein entsprechendes Ansinnen der Behörden: „An den Herrn Minister für die kirchlichen Angelegenheiten, durch eine Mitteilung des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz wurden wir über die Forderung des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz unterrichtet, Dienstkräfte der kirchlichen Stellen für Zwecke des Rüstungseinsatzes zur Verfügung zu stellen. Wir bedauern mitteilen zu müssen, daß aus unserer Diözese keine Kräfte abgeben werden können, nachdem der Personalbestand der Diözese, der Kirchengemeinden und kirchlichen Angestellten durch Einberufungen zum Heeresdienst und Dienstverpflichtungen bei gleichzeitigem Wegfall des Nachwuchses und fast vollständigen Unmöglichkeit der Heranziehung freiwilliger Hilfskräfte schon seit längerer Zeit auf ein Minimum herabgedrückt worden ist. Zur Begründung verweisen wir auf folgende Ausführungen: 1. Die Diözesanverwaltung beschäftigte zu Beginn des Krieges in ihren verschiedenen Abteilungen 15 Angestellte, heute nur noch 7, darunter einen bereits pensionierten Beamten und eine Aushilfe. 2. Gesamtverbände. a. Der Gesamtverband kath. Pfarrgemeinden Frankfurt beschäftigt z.Zt. auf seinem Verwaltungsbüro 25 Personen (2 sind bei der Wehrmacht). Nachdem durch den feindlichen Luftangriff auf Frankfurt am 4. Oktober ds. Js. das Verwaltungsgebäude mit seiner gesamten Einrichtung, den Akten, der Steuerkartei usw. vernichtet wurde, werden die Kräfte zum Neuaufbau (Erfassung von 30.000 Steuerpflichtigen, Einrichtung der Kartei, Veranlagung usw.) dringend benötigt. Der Caritasverband Frankfurt hat 4 Angestellte in der letzten Zeit durch Erkrankung u.a. verloren, so daß er wegen Einstellung neuer Kräfte in Verhandlung steht. b. Der Gesamtverband Wiesbaden hat in seiner Verwaltung 3 Vollbeschäftigte, eine Halbtagskraft und eine nebenamtliche im Außendienst, die alle benötigt werden. 3. Pfarrgemeinden. In 10 Pfarreien sind 12 Küster bzw. Organisten hauptamtlich tätig. Diese kommen wegen ihres Alters oder ihres Gesundheitszustandes für Rüstungsarbeiten nicht in Frage. Die Gemeindehelferinnen sind alle über 48 Stunden beschäftigt, und zwar nur in wenigen großen Kirchengemeinden. 4. Weibliche Ordensgenossenschaften. a. Die Genossenschaft der Armen Dienstmägde Jesu Christi in Dernbach und die der Pallottinerinnen in Limburg ist in Lazaretten, Krankenhäusern, Altersheimen, Gemeindekrankenpflegestationen in unserer Diözese tätig. Bei der Unmöglichkeit, neue Mitglieder aufzunehmen, bei dem Mangel an Hilfskräften sind bekanntlich die Schwestern in den genannten Einrichtungen überstark in Anspruch genommen. (...) Die Haus- und Ordensleitungen versichern uns, daß keine Kräfte für den Rüstungseinsatz abgegeben werden können, wenn die Arbeit nicht gefährdet werden soll. 5. Die Angehörigen der männlichen Ordensgenossenschaften sind, soweit sie nicht bereits zum Heeresdienst u.a. herangezogen sind, in der Seelsorge oder in den Ordenseinrichtungen beschäftigt und nach der Erklärung der zuständigen Stellen nicht abkömmlich. gez. Göbel.“ Die Personaldecke der kirchlichen und klösterlichen Einrichtungen wurde immer dünner, je länger der Krieg dauerte. Parallel dazu schwebte gerade über den Orden das Damoklesschwert der Schließung oder Exklaustration aus „staatspolizeilichen“ Gründen. Dieses Schicksal konnte vor allem dann abgewendet werden, wenn die verblieben Schwestern, die Patres und Fratres einen kriegswichtigen Beitrag durch Krankenpflege, Verwaltungstätigkeit oder Lebensmittelproduktion erbrachten. Dagegen wurden noch im Herbst 1944 weniger kriegsrelevante Anstalten und Ordenshäuser aus fadenscheinigen Gründen von der Gestapo geschlossen, etwa das Augustinuslehrlingsheim der Salesianer in Wiesbaden. Die Beschäftigung von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen in kirchlichen und klösterlichen Einrichtungen im Bereich der Diözese Limburg ist in dieser Topographie von kirchenfeindlichen Maßnahmen, machtstaatlich erzwungenen Arbeits- und Sachleistungen und der geradezu „wilden Hektik“ (Herbert) in der vollständig mobilisierten deutschen Kriegsgesellschaft einzuordnen und nur aus diesem Zusammenhang heraus zu verstehen. Mit der Darstellung von Unterdrückungsmaßnahmen gegen Kirche in unserem Bistum sollen andere, „objektiv“ sicher schlimmere Formen der Nachstellung und Verfolgung im „Dritten Reich“, vor allem das unbeschreibliche Leid der Juden und der verschleppten Zwangsarbeiter, nicht ausgeblendet werden. Das entdeckte Forschungsfeld „Kirche im Krieg“ eröffnet ja gerade neue Perspektiven für die menschlich eindringlichen Reizthemen „Katholizismus und Antisemitismus“, „Rettung von ‘Nichtariern’ durch kirchliche Institutionen und Persönlichkeiten“, „braune Pfarrer“ oder „Katholizismus, Euthanasie und Eugenik“. Nähere Ausführungen hierzu verbieten sich aus Gründen zumeist fehlender Forschungsergebnisse für die Diözese ebenso, wie aus der thematischen Anlage dieses Werkstattberichtes, dessen Zweck darin liegt, eine Facette dieses Krieges, Katholische Kirche und Zwangsarbeit, für das Bistum Limburg in einer vorläufigen Form darzustellen. (JR) Annäherung an den Begriff „Zwangsarbeiter“ „Im August 1944 waren im Gebiet des ‚Großdeutschen Reiches‘ 7.615.970 ausländische Arbeitskräfte als beschäftigt gemeldet; davon 1,9 Millionen Kriegsgefangene und 5,7 Millionen zivile Arbeitskräfte; darunter 250.000 Belgier, 1,3 Millionen Franzosen, 590.000 Italiener, 1,7 Millionen Polen, 2,8 Millionen Sowjets. Mehr als die Hälfte der polnischen und sowjetischen Zivilarbeiter waren Frauen, ihr Durchschnittsalter lag bei etwa 20 Jahren“. So beginnt Ulrich Herbert seine umfangreiche Studie zum Thema „Fremdarbeiter“. Wer verbirgt sich nun hinter den „ausländischen Arbeitskräften“? Sind es Zwangsarbeiter, Fremdarbeiter, Zivilarbeiter, Sklavenarbeiter oder KZ-Häftlinge? Und um wen handelt es sich bei „Wanderarbeitern“ „Saisonarbeitern“ und „Absiedlern“? Der Begriff „Zwangsarbeiter“ taucht in den Erlassen und Bestimmungen der NS-Zeit nicht auf, man sprach von „Fremdarbeitern“ und „Zivilarbeitern“. Der moderne Begriff „Zwangsarbeiter“ wird von Historikern verwendet, um einen Sachverhalt zu umschreiben, der 1930 in einer Definition der „Internationalen Arbeitsorganisation“ so umschrieben wird: „Jede Art von Arbeit oder Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung irgendeiner Strafe verlangt wird und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat“. Unstrittig wurden in den Jahren 1939 bis 1945 Menschen in ihrer Heimat aufgegriffen und unter Zwang in das Deutsche Reich deportiert. Zwangsweise Arbeit war in den letzten Jahren des „Tausendjährigen Reichs“ eine Realität, die in keiner Stadt und in keinem Dorf übersehbar war. Selbst in den kleinsten Ortschaften sah man Baracken als Sammelunterkünfte und kannte die ausländischen Landarbeiter und Kriegsgefangenen, die auf den Höfen und Gütern lebten und zusammen mit den ansässigen Bäuerinnen und älteren Kindern Felder und Stall bestellten. Dennoch ist der Begriff „Zwangsarbeiter“, der sich auch in weiten Teilen der wissenschaftlichen Literatur durchgesetzt hat, nicht unproblematisch und sollte zumindest nicht unbedacht verwandt werden. Zu den sogenannten „Westarbeitern“ gehörten Männer und Frauen aus Belgien, den Baltenländern (Estland, Lettland, Litauen), Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien, Jugoslawien, den Niederlanden, Norwegen, der Tschechoslowakei, der Schweiz und aus Ungarn. Die differenzierte Sicht des Arbeitseinsatzes von ausländischen Zivilisten im Deutschen Reich soll hier exemplarisch am Beispiel der Italiener verdeutlicht werden. Drei Phasen sind klar voneinander zu unterscheiden: 1. Die Vorkriegszeit und die Monate der „Nicht-Kriegsführung“ bis Juni 1940; 2. Die Zeit des italienischen Kriegseintritts bis zum 8. September 1943; 3. Die Zeit der Besetzung bis Kriegsende. In der 1. Phase versuchte die Regierung in Rom, dem deutschen Wunsch nach Arbeitskräften für die Landwirtschaft nachzukommen, nicht zuletzt, um die hohe Arbeitslosenquote Italiens zu senken. Die Italiener kamen als „Wanderarbeiter“ oder „Saisonarbeiter“ und für die Zeit von April bis November ins Reich. In der 2. Phase ab Sommer 1940 war die Lage angespannter. Deutschland wollte nun Kräfte für die Industrie in Italien abziehen. Die benötigten Facharbeiter wurden zwangsweise nach Deutschland geschickt. Italien erhielt im Gegenzug dringend benötigte Rohstofflieferungen und militärische Unterstützungsleistungen. In der 3. Phase wurde das System lediglich weiterentwickelt und „verbessert“. Die „Freiwilligkeit“ der Arbeitsaufnahme in Deutschland war insoweit gegeben, als kein physischer Zwang bei der Rekrutierung ausgeübt wurde. Die Skala reichte aber tatsächlich von der Migrationsbewegung über ökonomische Triebfedern (Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung, niedrige Löhne) bis hin zu offenen Zwangsmaßnahmen, z.B. dem Verbot der Rückkehr nach Italien, trotz abgelaufener Arbeitsverträge. Ohne ein unzulässiges Urteil zu fällen, ist die Feststellung erlaubt, daß nicht alle italienischen Zivilarbeiter gleichermaßen gezwungen nach Deutschland kamen. Eine zweite zu nennende Großgruppe sind die polnischen Zivilarbeiter. Alle Rekrutierungen für den Einsatz im Deutschen Reich beruhten von Kriegsbeginn bis zum 25. Oktober 1939 auf Zwang. Es fanden regelrechte Menschenjagden und Razzien statt, Männer und Frauen wurden namentlich und unter Androhung der Todesstrafe zu Abtransporten zusammengestellt. Als die zivile Besatzungsverwaltung am 26. Oktober 1939 eingeführt wurde, versuchten es die Behörden in den in das Reich inkorporierten Gebieten mit persönlichen Anschreiben des Inhaltes, daß sich die Adressaten für den Arbeitseinsatz in Deutschland bereitzuhalten hätten. Als sich diese Methode als weithin erfolglos herausstellte, weil sich an den brieflich mitgeteilten Sammelstellen nur wenige Menschen einfanden, wurden dort ebenfalls Razzien, vor allem vor Kirchen, in Parks und auf Straßen durchgeführt. Im Generalgouvernement setzte sich zunächst die Überzeugung durch, daß Freiwilligkeit zu höheren Anwerbungszahlen führen kann. Als aber die Kunde aus Deutschland kam, daß die Arbeitsbedingungen mehr als schlecht waren, meldete sich fast niemand mehr. Deswegen wurde auch im Generalgouvernement jede erdenkliche Form von Zwangsmaßnahme eingeführt. Wer dem Ausreisebefehl nicht nachkam, dessen Hab und Gut wurde beschlagnahmt und es drohte Gefängnis- und KZ-Haft. Bei den ins Reich verschickten Polen kann man also zwei Gruppen unterscheiden: diejenigen, die brutal zur Arbeit nach Deutschland gezwungen wurden und jene, die formal freiwillig gingen. Sogenannt „freiwillig“ reisten Menschen, die sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befanden. Andere folgten ihren erzwungenermaßen nach Deutschland gereisten Angehörigen. Die Zahl der „Freiwilligen“ an der Gesamtzahl der polnischen Zivilarbeiter betrug etwa 5%, die Zahl der Zwangsdeportierten 95%. In der Hierarchie ganz unten standen die „Ostarbeiter“. Ab März 1942 war der Bedarf an Arbeitskräften im Deutschen Reich so groß, daß der „Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz“, Sauckel, durch Einsatzstäbe der Wehrmacht innerhalb von zweieinhalb Jahren 2,5 Millionen Zivilisten aus der Sowjetunion als „Zwangsarbeiter“ ins Reich deportieren ließ – das waren 20.000 Menschen in jeder Woche. Von irgendeiner „Freiwilligkeit“ konnte hier nicht gesprochen werden. Die nationalsozialistische Terminologie „Absiedler“ bezieht sich auf Angehörige von besetzten Gebieten, die auf längere Sicht dem Deutschen Reich eingegliedert werden sollten: Untersteiermark und Oberkrain in Slowenien, Elsaß und Lothringen in Frankreich sowie Luxemburg. Die Gebiete sollten „germanisiert“ werden, die Einwohner zwangsweise die deutsche Sprache als Muttersprache (wieder) annehmen. Arbeitskräfte aus diesen Gebieten waren Opfer der Entnationalisierungspolitik. Sie, die als Ausländer oder Bewohner bestimmter Grenzgebiete in den einzudeutschenden Gegenden wohnten, wurden außer Landes gebracht. Statt der Bezeichnung „Aussiedler“ oder „Evakuierte“, die für die nach Frankreich, Serbien, Kroatien oder dem Generalgouvernement Verbannten galten, bezeichneten die Deutschen die aus den aufgeführten fünf Ländern ins Reich deportierten Personen als „Absiedler“. Eine große Gruppe bildeten Slowenen von der Save, die zunächst nach Kroatien verbracht werden sollten, wegen der unruhigen politischen Lage auf Anordnung von Himmler jedoch in das Gebiet des Deutschen Reichs verschleppt wurden. Zwei dieser Frauen wohnten und arbeiteten zwischen 1942 und 1945 im St. Josephshaus der Dernbacher Schwestern in Kamp. Ausschließlich französisch-sprechende junge Frauen aus Lothringen wohnten im Kloster der Franziskanerinnen in Frankfurt und arbeiteten in Frankfurter Betrieben. Tone Ferenc konstatiert: „Die Arbeit der Absiedler war richtige Zwangsarbeit: Sie mußten arbeiten, was man sie arbeiten hieß“. Der Begriff „Sklavenarbeiter“, der sich im angelsächsischen publizistischen Bereich durchgesetzt hat, ist auch bei den gegen ihren Willen in Deutschland beschäftigten Ausländern in katholischen Einrichtungen nicht brauchbar. Der Einsatz von KZ-Häftlingen ist für die Einrichtungen des Bistums Limburg weder zu belegen noch auch nur entfernt zu vermuten. (BW) Rahmenbedingungen des „Arbeitseinsatzes“ Häufig wird die Frage gestellt, wie die katholischen Einrichtungen an die Fremdarbeiter gelangten und ob sie gar eigenständig im Ausland Werbung betrieben haben. Darauf läßt sich folgende Antwort geben: Die „Anwerbung“ und Vermittlung ausländischer Arbeitskräfte war ausschließlich dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz oder den von ihm beauftragten Stellen und Personen gestattet (§ 67 ABABG; § 24 Ausl. VO). In einer Reihe von Ländern wurden deshalb Anwerbestellen eingerichtet: Finnland, Norwegen, Dänemark, Niederlande, Belgien, Frankreich, Elsaß und Lothringen, Luxemburg, Italien, Jugoslawien, Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Protektorat, Spanien, Generalgouvernement, besetzte Ostgebiete (Vgl. RABl. 1941, I 523). Die Verteilung der mehr oder weniger freiwillig geworbenen Personen erfolgte nach Planungsgrundsätzen, die sich an „staatspolizeilichen“ Gesichtspunkten und Dringlichkeitsregeln orientierten: Zunächst waren die kriegswichtigen Arbeitsplätze zu besetzen. Eine eigenmächtige Anwerbung, z.B. durch kirchliche Einrichtungen, war strafbar. Die Gesetzgebung zur Einstellung und Entlassung, zur Unterbringung und Verpflegung sowie Besteuerung der verschiedensten aus dem Ausland eingereisten Menschen war hoch kompliziert, ständig gab es neue Erlasse auf Reichs-, Gau- oder Stadtebene – kurz gesagt: ein verwirrendes Dickicht. Einige wichtige Bestimmungen sollen deshalb herausgegriffen werden (vgl. Hertel): Die ausländischen Arbeitskräfte hatten grundsätzlich die gleichen Arbeitsbedingungen wie Deutsche, d.h. die gleichen Rechte und Pflichten wie „deutsche Gefolgschaftsangehörige“. Das galt z.B. in bezug auf die Ernährung, die Entlohnung, die Beiträge und Leistungen aus der Krankenversicherung, Invalidenversicherung, Arbeitslosenversicherung etc. Ausländer durften nicht schlechter, aber auch keinesfalls besser gestellt werden als Deutsche. Die Unterkunft für ausländische Arbeiter mußte in gesundheitlicher und polizeilicher Hinsicht einwandfrei sein. Als zweckmäßig wurde die Gemeinschaftsunterkunft angesehen, stand sie nicht zur Verfügung, so hatte sich der Betriebsführer nach einem nicht zu teuren Quartier umzusehen. Angehörige verschiedenen Volkstums waren getrennt unterzubringen. In Betrieben mit Kriegsgefangenen war der zeitgleiche Einsatz von Zivilarbeitern der gleichen Sprache verboten, auch durften französische weibliche Arbeitskräfte in Betrieben nicht zusammen mit französischen Kriegsgefangenen arbeiten. Damit die Ausländer flexibler eingesetzt werden konnten, war die DAF aufgefordert, in allen Gauen Deutschkurse durchzuführen. Die Betreuung in gewerblicher Beschäftigung stehenden Ausländern geschah durch die DAF, landwirtschaftliche Kräfte wurden durch die Dienststellen des Reichsnährstandes versorgt. Eine Sonderstellung unter den ausländischen Arbeitskräften nahmen Polen, Juden, Ukrainer und Ostarbeiter ein. Sie waren den deutschen Arbeitnehmern nicht gleichgestellt, für sie galten Sondervorschriften. 1. Zu den Polen zählen alle Personen, die im früheren polnischen Staatsgebiet polizeilich gemeldet waren. Zu dieser Gruppe zählten auch die dort ansässigen Ukrainer, Goralen, Slonsaken und andere Volksstämme. Die Distrikte Galizien und Bialystok waren ausdrücklich eingeschlossen. Polnischen Arbeitskräften, so hieß es 1941 in einer Anordnung des Reichsarbeitsministeriums, „ist eine besondere Stellung im Arbeitsleben des deutschen Volkes zugewiesen; sie haben nicht unbeschränkt an dem sozialen Fortschritt des neuen Deutschland teil“ (RABl. 1941, I 448). Konkret bedeutete dies für polnische Beschäftigte folgendes: a. - Arbeitsrechtliche Stellung: Es bestand nur Anspruch auf Vergütung für tatsächlich geleistete Arbeit. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall entfiel. Der Feiertagszuschlag zum Lohn durfte nicht gewährt werden, ebensowenig Familien- und Kinderzulagen, Geburts- und Heiratsbeihilfen, Sterbegelder, Weihnachtszuwendungen, Jubiläumsgaben, Trennungs- und Unterkunftsgelder und vieles mehr. Die Höhe des Arbeitsentgelts der Polen durfte nur die niedrigste betriebsübliche Vergütung der jeweiligen Alters- und Tätigkeitsgruppe betragen. Polnische Beschäftigte durften nicht an Arbeitsplätzen eingesetzt werden, „die sie berechtigten, deutschen Gefolgschaftern Weisungen zu erteilen“. Der Sozialversicherungsschutz der polnischen Arbeitskräfte richtete sich nach den allgemeinen Vorschriften. - - b. - - - Polizeiliche Sondervorschriften: Polen erhielten einen Sonderausweis, d.h. eine Arbeitskarte mit polizeilich abgestempeltem Lichtbild, Fingerabdrücken und der eigenen Unterschrift. Polen hatten nach den Polenerlassen vom 8.3.1940 ein Kennzeichen [Abb. 4] zu tragen: „Auf der rechten Brustseite jedes Kleidungsstückes (Rock, Bluse, Weste, Hemd, Mantel) ist ein Stoffabzeichen, bestehend aus einem auf der Spitze stehenden Quadrat mit 5 cm langen Seiten bei ½ cm breiter violetter Umrandung auf gelbem Grunde, ein 2½ cm hohes violettes P zeigend, zu tragen. Das Abzeichen muß stets sichtbar und fest angenäht sein“ (RGBl. 1940, 555). Polen durften während für sie geltender nächtlicher Sperrzeiten ihre Unterkunft nicht verlassen und mußten sich wöchentlich einmal persönlich bei der Ortspolizeibehörde melden. Die Benutzung von Verkehrsmitteln war nur aufgrund einer Bescheinigung durch die Ortspolizeibehörde gestattet, das galt auch für Fahrräder. Fotoapparate durften Polen nicht besitzen. Der Besuch deutscher Veranstaltungen kultureller, kirchlicher und geselliger Art war untersagt, ebenso der Besuch von Gaststätten. Gottesdienste zusammen mit Deutschen, selbst wenn den - Polen eigene Bänke vorbehalten waren, durften nicht stattfinden, es mußten eigene Gottesdienste eingerichtet werden. Auf die sogenannte „Rassenschande“ stand die Todesstrafe. 2. „Ostarbeiter sind diejenigen Arbeitskräfte nichtdeutscher Volkszugehörigkeit, die im Reichskommissariat Ukraine, im Generalkommissariat Weißruthenien oder in Gebieten, die östlich an diese Gebiete und an die früheren Freistaaten Lettland und Estland angrenzen, erfaßt und nach der Besetzung durch die deutsche Wehrmacht in das Deutsche Reich einschließlich des Protektorates Böhmen und Mähren gebracht und hier eingesetzt werden“. Diese Definition und alle weiteren hier zitierten Bestimmungen waren dem „Merkblatt Nr. 1 für Betriebsführer über den Einsatz von Ostarbeitern“, herausgegeben vom Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, Sauckel, zu entnehmen. Hier hieß es weiter „Die Masse der Ostarbeiter kommt arbeitswillig ins Reich. Sie empfindet die Vernichtung des Bolschewismus in ihrer Heimat als Erlösung. Die Ostarbeiter müssen daher korrekt und gerecht behandelt werden“. Dies durfte nicht zu weit führen: „Ebenso verderblich wie eine willkürliche und ungerechte Behandlung der Ostarbeiter für den Arbeitseinsatz in Deutschland wäre eine der Würde unseres Volkes und der Schwere der Kriegszeit widersprechende Annäherung oder gar Anbiederung“. Für Ostarbeiter galten folgende Einzelvorschriften: a. - Arbeitsrechtliche Stellung: „Die im Reich eingesetzten Ostarbeiter stehen in einem Beschäftigungsverhältnis eigener Art. Die deutschen arbeitsrechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen finden auf sie nur insoweit Anwendung, als dies besonders bestimmt wird“. Wie bei Polen wurde Lohn nur für tatsächlich geleistete Arbeit ohne jeden Zuschlag ausgezahlt. Die Höhe richtete sich nach einer Lohntabelle, das auszuzahlende Entgelt lag bei weniger als 1/3 im Vergleich zu deutschen Arbeitskräften. Der Lohnanteil für Unterkunft und Verpflegung wurde direkt einbehalten. Die Betriebsführer, die Ostarbeiter beschäftigten, mußten eine Ostarbeiterabgabe entrichten, die ebenfalls in der Tabelle festgelegt war. Ostarbeiter unterlagen nicht der Reichsversicherung und zahlten demzufolge keine Sozialversicherungsbeiträge. Im Krankheitsfall wurde „Krankenversorgungsschutz“ eingeräumt, d.h. es sollte ein „ausreichender Schutz“ auch für Ostarbeiter gelten. Wenn notwendig, durften „Kur und Verpflegung“ in einem Krankenhaus gewährt werden. Selbstverständlich durften Ostarbeiter nicht in gemeinsam mit anderen Patienten benutzten Räumen behandelt und versorgt werden. Sie mußten separiert werden. Über die Notwendigkeit aller Leistungen „entscheidet der Träger der Krankenversorgung nach pflichtgemäßem Ermessen“. Die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit stand an erster Stelle. Ostarbeiter mußten sowohl getrennt von Deutschen wie auch von Kriegsgefangenen am besten in geschlossenen Kolonnen Einsatz finden. Familien jedoch, die in der Landwirtschaft arbeiten wollten, sollten nicht auseinander gerissen werden. - - - b. - - - Betreuung: In allen Ostarbeiterlagern galt die „Lagerordnung für Ostarbeiter“, sie war peinlich genau einzuhalten. Die Unterkünfte mußten „Hinsichtlich Ordnung, Sauberkeit und Hygiene (Heizungs-, Wasch-, Abortanlagen) einwandfrei und nach Möglichkeit mit allem Notwendigen (Schränke, Betten, Stühle usw.) ausgestattet sein“. Diese Möglichkeit wurde offenbar häufig nicht gesehen, das „Notwendige“ war z.B. eingeschüttetes Stroh. Das Merkblatt für Betriebsführer sagte weiter, „die Lagerinsassen sind anzuhalten, zur wohnlichen Ausgestaltung der Räume selbst beizutragen“. Die Umzäunung der Lager durfte nicht mit Stacheldraht versehen sein. In landwirtschaftlichen Betrieben war es gestattet, weibliche Arbeitskräfte bei den Betriebsführern auch einzeln unterzubringen – männliche in kleinen Landwirtschaften nur, wenn fest verschließbare und gut zu überwachende Unterkünfte vorhanden waren und wenn sich eine deutsche männliche Arbeitskraft auf dem Grundstück befand. Die Ernährung der Ostarbeiter erfolgte nach vom Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft festgelegten Verpflegungssätzen. Das hieß für den „Normalarbeiter“ pro Woche: 2600g Brot, 250g Fleisch, 130g Fett, 7000g Kartoffeln, 150g Nährmittel, 110g Zucker, 14g Tee-Ersatz und Gemüse nach Aufkommen. Nur die Qualität der Nahrungsmittel war bestimmt: „Die Fleischportion ist möglichst - c. - - - - - in Pferde- und Freibankfleisch zum vollen Anrechnungssatz zu verabreichen. Die Fettportion soll nach Möglichkeit aus Margarine bestehen (...). Als Gemüse können neben Kohlrüben auch andere Gemüsesorten zugeteilt werden, wenn die Versorgungslage für die Zivilbevölkerung dies gestattet (...). Die am Ende eines Markttages übriggebliebenen Gemüseabfälle sind, wenn ihrem Verderb nicht anders begegnet werden kann, unverzüglich den Lagerverwaltungen zuzuweisen“. Sonderzulagen für werdende und stillende Mütter kamen nicht in Betracht. Vor der Einreise bereits sollte sichergestellt sein, daß nur „gesundheitlich geeignete und von ansteckenden oder übertragbaren Krankheiten freie Arbeitskräfte zugeführt werden“. Entlausung der Menschen und Entwesung ihres Hab und Gut war offenbar an der Tagesordnung. Polizeiliche Sondervorschriften: Ostarbeiter waren wie Polen kennzeichnungspflichtig. Ihr Kennzeichen bestand aus einem hochstehenden Rechteck von 7 cm Breite und 7,7 cm Höhe und zeigte bei 1cm breiter blau-weißer Umrandung auf blauem Grund in weißer Schrift das Kennwort „Ost“. Ostarbeiter mit einwandfreier Führung und Leistung konnten von der Verpflichtung, das Zeichen auf der rechten Brustseite zu tragen, befreit werden, sie trugen es auf dem linken Ärmel. Ostarbeitern war es nicht gestattet, ihre Freizeit außerhalb des Lagers zuzubringen. Sie wurden angeregt, „sich aus eigener Kraft eine artgemäße Freizeit zu gestalten (Musik, Volkstanz, Basteln, Sport usw.)“. „Bewährten Arbeitskräften“ durfte als Belohnung Ausgang in geschlossenen Gruppen unter deutscher Aufsicht gewährt werden, selbstverständlich ohne dabei mit Deutschen in Kontakt zu kommen. „Jeder Deutsche hat mit dafür zu sorgen, daß eine Blutmischung mit den Ostarbeiterinnen vermieden wird“. Wurden Ostarbeiterinnen dennoch schwanger, so wurde ab 1943 häufig „freiwillig“ eine Abtreibung ermöglicht. Es darf aber berechtigt vermutet werden, daß sowohl Zwangsabtreibungen wie Zwangssterilisationen angeordnet wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Krankenhäuser in katholischer Trägerschaft im Bistum Limburg diese Eingriffe nicht durchgeführt. Es war auch gestattet, die Neugeborenen ihren Müttern zu entziehen – bei Westarbeiterinnen mit, bei Polinnen und Ostarbeiterinnen ohne deren Zustimmung – um sie je nach „rassischem Wert“ unterzubringen und zu pflegen. Am Volksempfänger durften deutsche amtliche Nachrichtensendungen in russischer, ukrainischer und weißruthenischer Sprache gehört werden. Auch drei in Deutschland im Auftrag der Nationalsozialisten produzierte Lagerzeitungen konnten abonniert werden. Eine seelsorgerische Betreuung durch ausländische oder deutsche Geistliche war verboten. Ostarbeiter (Priester und Laien) innerhalb des Lagers aber durften religiöse Betätigung ausüben oder leiten. Kirchenbesuch außerhalb des Lagers war auch „unter deutscher Führung nicht möglich“. Die Unterkünfte standen ständig unter Bewachung durch Wachmannschaften. Tatsächlich war Unterbringung und Verpflegung vor allem der Polen und der Ostarbeiter derart menschenunwürdig, daß unzählige von ihnen an Hunger und Krankheiten zu Tode gekommen sind. Einzeldarstellungen legen von erniedrigenden und entwürdigenden Behandlungen beredtes Zeugnis ab. Solche Zustände haben nach allen bisherigen Erkenntnissen in den Wohnunterkünften, die von katholischen Trägern im Bistum Limburg zur Verfügung gestellt wurden, nicht geherrscht. Wie sich die Lebensumstände der Polen und Ostarbeiter aber auch der Westarbeiter konkret dargestellt haben, läßt sich ebensowenig zeigen, da hier zum Teil die nötigen Quellen fehlen, in einigen Einrichtungen aber auch noch nicht erhoben worden sind. Die Problematik der Erkrankung von Ostarbeitern zeigen schon allein die o.g. rechtlichen Vorgaben. Als aber ab 1944 keine Möglichkeit mehr bestand, Kranke in Richtung Osten rückzuführen, wurde am 6. September 1944 vom Reichsministerium des Inneren ein Runderlaß herausgegeben, der Sammelstellen für unheilbar geisteskranke Ostarbeiter und Polen festlegte. Für Kurhessen, Nassau und das Land Hessen waren die Kranken in die „Heil- und Pflegeanstalt Hadamar“ abzutransportieren. Insgesamt sind 100 psychisch kranke Ausländer, zumeist Polen und Ostarbeiter, in Hadamar gestorben. Ebenfalls 1944 begann u.a. das Arbeitsamt Rhein-Main in Frankfurt damit, an Tuberkulose erkrankte Fremdarbeiter nach Hadamar zu überweisen. Etwa 500 angeblich an Tuberkulose erkrankte Ausländer – auch hier überwiegend Polen und Ostarbeiter – wurden in Hadamar durch Einspritzungen getötet, selbst ganze Familien samt ihrer Kinder. Im Rahmen der von der Diözese Limburg durchgeführten Zwangsarbeitersuche ist bislang ein Fall bekannt geworden, in dem einer Erkrankung zufolge, die nach der Einschätzung des Arbeitgebers wohl zu Arbeitsunfähigkeit geführt haben muß, eine Einweisung nach Hadamar erfolgte: Eine Großfamilie mit drei Söhnen kam am 22. Juni 1944 zur Zwangsarbeit in das Missionshaus der Pallottiner. In den Räumen befand sich das Hilfskrankenhaus des Vinzenz-Hospitals. In der Hauschronik von Br. Wendling SAC heißt es wörtlich: „Der eine der drei Gebrüder wurde nach einigen Wochen krank, kam dann nach einiger Zeit nach Hadamar und wurde dort nach vier Wochen beseitigt und verbrannt, ohne daß seine Mutter oder einer seiner Brüder ihn in Hadamar noch einmal sprechen durfte“. (BW) Feind oder Nächster? Die „Arbeitsvölker“ in der Wahrnehmung der Katholischen Kirche Wenn über die Beschäftigung von Zwangsarbeitern in kirchlichen Einrichtungen gesprochen wird, muß die Wahrnehmung von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen durch Kirchenvolk, Klerus, Episkopat und Kurie in den Blick geraten. Wie bei der immer wieder belebten Debatte um die Katholische Kirche, Papst Pius XII. und den Nationalsozialismus tauchen anklagende Fragen auf: Warum unterblieb auch angesichts des im Alltag für jedermann in Deutschland sichtbaren, meist menschenunwürdigen Zwangsarbeitereinsatzes ein grundsätzlicher kirchenamtlicher Protest gegen den Unrechtsstaat? Warum haben die Kurie und die deutschen Oberhirten nicht wenigstens in ihrem unmittelbaren Einflußbereich, auf dem Gebiet der Seelsorge, Stellung bezogen, etwa gegen die zeitweise staatlicherseits angeordnete Trennung von deutschen und „fremdvölkischen“ Katholiken im Gottesdienst durch eigens separierte Kirchenbänke? Wenn sogar Zwangsarbeiter in kirchlichen Einrichtungen beschäftigt waren, liegt da nicht sogar der Verdacht nahe, daß die Kirche den „Reichseinsatz“ stillschweigend gebilligt hat? Andererseits, war vom christlichen Standpunkt in dieser Hinsicht nicht alles offen ausgesprochen, was damals im Hirtenbrief der deutschen Bischöfe über die Zehn Gebote ab dem 12. September 1943 von den Kanzeln verkündet wurde? Dort hieß es: „Tötung ist in sich schlecht, auch wenn sie angeblich im Interesse des Gemeinwohls verübt würde: An schuld- und wehrlosen Geistesschwachen und -kranken, an unheilbar Siechen und tödlich Verletzten, an erblich Belasteten und lebensuntüchtigen Neugeborenen, an unschuldigen Geiseln und entwaffneten Kriegs- oder Strafgefangenen, an Menschen fremder Rassen und Abstammung. (...) ‘Du sollst Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. (...).‘ (Matth. 22,37-40). Beseelt von dieser Liebe, treten wir auch ein für die, die sich am wenigsten selber helfen können: (...); für die schuldlosen Menschen, die nicht unseres Volkes und Blutes sind, für die Ausgesiedelten, für die Gefangenen oder fremdstämmigen Arbeiter, für deren Recht auf menschenwürdige Behandlung und auf sittliche wie religiöse Betreuung.“ Moralisierende Bewertungen verbieten sich, denn bisher stand das Thema „Zwangsarbeiter und Kirche“ am Rande der kirchen- wie der zeithistorischen Forschungen zum „Dritten Reich“. Unser Wissen um die Zusammenhänge ist begrenzt. Regionale und lokale Feldstudien zur Wahrnehmung der „Fremdarbeiter“ durch Katholiken stehen noch aus. Wir können aber immerhin feststellen: Bischöfe, Priester und Laien haben sich religiös-seelsorglich für die polnischen Zwangsarbeiter zumeist im Rahmen der staatlichen Verordnungen und Erlasse eingesetzt (Sakramentenspendung), der Umgang im Alltag, etwa am Arbeitsplatz, war in vielen Fällen unter Mißachtung der Vorschriften und der rassepolitischen Grundregeln des Nationalsozialismus von Konzilianz und heimlicher Zuwendung geprägt, was von Lebensmittelgeschenken bis zur Überlassung von Fahrrädern und Sonntagskleidern für den Besuch der hl. Messe reichen konnte. Französische Kriegsgefangene und Zivilarbeiter wurden im Rahmen der „Action catholique en Allemagne“ durch etwa 10.000 zum Teil inkognito in die Lager eingeschleuste französische Priester und Laien seelsorglich betreut, unterstützt von deutschen Geistlichen. 46mal verfügte das NS-Regime wegen Seelsorge an Fremdarbeitern und Kriegsgefangenen gegen katholische Geistliche KZ-Haft, 137mal Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren. Die mittlerweile in vierter Auflage erschienene Dokumentation „Priester unter Hitlers Terror“ nennt für die Diözese Limburg 26 Fälle von Welt- und Ordensgeistlichen, die wegen „Polenseelsorge“ oder Kontaktes mit Kriegsgefangenen belangt wurden. In Fall des Arnsteiner Superiors P. Alphons Spix (1894 - 1942) führte die KZ-Einweisung zum Tode. Weniges ist bisher aus sicherer Quelle über Priester und Ordensleute bekannt, die selbst Zwangsarbeiter waren, wie die 1944 nach Bietigheim, Sontheim und Neckarsulm verschleppten Benediktinerinnen aus Warschau. Für die Kriegsgefangenen und den Arbeitseinsatz der Polen und „Ostarbeiter“ im Reich gab es zur Ausübung von Seelsorge genaue, aber viel zu viele behördliche Instruktionen, die durch die Amtsstuben der Bischöflichen Ordinariate liefen und bei den Geistlichen in den Pfarreien und Klöstern für gefährliche Verwirrung sorgten. Wo lag der Unterschied in der Behandlung von Kriegsgefangenen und Zivilarbeitern? Welche Gebetstexte durften gesprochen werden? Konnten Polen am Gemeindegottesdienst teilnehmen? Durften „Ostarbeiter“ kirchlich beerdigt werden? Welche Pastoration erhielten griechisch-katholische Ukrainer? Drei Aktenbände im Diözesanarchiv in Limburg über die Seelsorge an Kriegsgefangenen, Polen und Ukrainern legen beredtes Zeugnis über Mißverständnisse und Gefahren beim religiös motivierten Kontakt mit Zwangsarbeitern ab. Kriegsgefangene Zu Beginn des Krieges 1939/40 konnten die in den sogenannten Stammlagern internierten polnischen Kriegsgefangenen durch die örtlichen Standortpfarrer der Wehrmacht, die in den kleineren Arbeitskommandos eingesetzten durch die für die Dörfer und Gemeinden zuständigen „Zivilgeistlichen“ seelsorglich betreut werden, sofern die Gefangenen selbst den Wunsch dazu hatten. Wenn der Ortsgeistliche nicht selbst Gottesdienst halten konnte, mußte er sich an den zuständigen Wehrkreispfarrer in Kassel oder Wiesbaden wenden. Predigttexte mußten vorzensiert werden. Beichthören durften nur die Wehrmachtsgeistlichen [Abb. 5], ansonsten war die Generalabsolution zu erteilen. Ein Besuch des deutschen Gemeindegottesdienstes war aus militärischen Gründen untersagt. Diese Vorschriften nach Maßgabe des Oberkommandos der Wehrmacht entsprachen noch den Regelungen der Haager Landkriegsordnung und der Genfer Konvention über die freie Religionsausübung von Kriegsgefangenen. Im Reichssicherheitshauptamt (RSHA) wurde die Anwesenheit der polnischen Kriegsgefangenen von Anfang an, vor allem aber nach ihrer begonnenen Überführung in den Zivilarbeiterstatus im Frühjahr 1940, als Verstoß gegen die rassepolitischen Prinzipien des Nationalsozialismus gesehen. Menschlich gute Behandlung der Polen und zwischenmenschliche Solidarität aufgrund gemeinsamer religiöser Bindung konnten geeignet sein, die „Heimatfront“ und den NS-Staat zu destabilisieren. Gerade die „Polenseelsorge“ wurde in zunehmender Weise aus rassischen und konfessionellen Vorbehalten als Sicherheitsrisiko eingeschätzt. In Verbindung mit den berüchtigten „Polenerlassen“ legte das RSHA fest, daß auch für die „Zivil-Polen“ der Besuch deutscher Gottesdienste und anderer kirchlicher Veranstaltungen verboten sei und das Verhalten deutscher Seelsorger genau beobachtet und kontrolliert werden müsse. Mit diesen Vorgaben zeigte das RSHA im Zusammenspiel mit OKW und RMfdkA schon vor der Ankunft weiterer Kriegsgefangener, etwa der Franzosen, ihr offenkundiges Mißtrauen gegenüber dem deutschen Klerus und ihre bis 1945 in Einzelheiten immer wieder verschärfte ausländerpolitische Grundlinie, die Religionspraxis der Kriegsgefangenen und Fremdarbeiter von der deutschen Bevölkerung rigide und unter Strafandrohung zu trennen. Nach dem Frankreichfeldzug wurde die Seelsorge für die kriegsgefangenen Franzosen wie zuvor bei den Polen zunächst der deutschen Militärgeistlichkeit anvertraut. Der Besuch von Sondergottesdiensten in den Ortschaften war ausschließlich den Angehörigen der örtlichen Arbeitskommandos erlaubt, in den „Stammlagern“ (Stalags) und „Offizierslagern“ (Offlags) mußte die hl. Messe an einem geeigneten Ort auf dem Lagergelände gehalten werden. Von großer Tragweite war das schließlich im Mai 1941 vom OKW angeordnete Verbot jeder Pastoration von Kriegsgefangenen (Westgefangene und Polen) durch deutsche Geistliche, auch Wehrmachtsgeistliche, mit der Ausnahme von Beerdigungen, Versehgängen und Krankenkommunionen. Jedes religiöse Schrifttum durfte nur nach vorheriger Genehmigung durch das OKW an die Gefangenen verteilt werden. Erlaubnis zur Meßfeier und Sakramentenspendung hatten jetzt nur noch die selbst kriegsgefangenen Geistlichen, die bei der Truppe nicht gekämpft hatten. Bei den Franzosen waren dies die „Aumôniers militaires“, Priester, die vor ihrer Gefangennahme als Feldgeistliche amtierten. Den übrigen internierten Geistlichen („prêtres prisonniers“) war jede seelsorgliche Handlung an ihren Kameraden dadurch erschwert, daß sie von der Lagerarbeit oder den Kommandos nicht freigestellt wurden und über keinerlei liturgische Gerätschaften verfügten. Von 3.000 französischen Priestern in Gefangenschaft waren nur 1.000 als „Aumôniers militaires“ anerkannt. Zur Verbesserung der religiösen Lage war es Ziel der „Action catholique“, eine religiöse Betreuung der Lager „von außen“ sicherzustellen, worin die französische Kirche auch vom Vatikan unterstützt wurde. Fast jede Diözese in Frankreich übernahm eine „Patenschaft“ für ein Stalag. So konnten zum Beispiel liturgische Geräte für die Lagerseelsorge nach Deutschland geschickt werden. Die „Aumônerie générale“ in Paris hatte derweil ein dichtes Korrespondentennetz mit deutschen Priestern aufgebaut. Kriegsgefangene französische Priester und Ordensleute im Stalag XII A bei Limburg etwa standen über den Freiendiezer Gefängnisseelsorger Kneip in geheimen Kontakten zum Limburger Klerus und zu deutschen Ordensbrüdern. In der Freiendiezer Anstalt waren sehr viele straffällig gewordene Gefangene aus dem unmittelbar benachbarten Stalag, denen Kneip Gebetbücher brachte, Krankenkommunion oder auch Sterbesakramente erteilte. Von einem ehemaligen Häfling wird „Abbé Kneip“ als „prêtre humain et francophile“ bezeichnet. Kneip stand unter anderem in brieflichem Kontakt mit dem im Stalag kriegsgefangenen Trappistenmönch André Bouché, der nach Rückkehr in das heimatliche Kloster in Nordfrankreich im März 1941 Grüße des Dankes an den Bischof von Limburg, den Abt des Zisterzienserklosters Marienstatt, Pfarrer Pistor von Dietz und Pfarrer Ehl von Offheim auszurichten bat. Ab 1942 kamen junge Franzosen zu Hundertausenden zum Zwangsarbeitsdienst nach Deutschland. Sie wurden zunächst durch französische kriegsgefangene Priester mit Zivilarbeiterstatus religiös versorgt. 1943 schließlich landete die französische Kirche noch einen spektakulären Coup, indem sie 26 als Handwerker getarnte „Geheimpriester“ nach Deutschland schickte, um die französischen Zivilarbeiter in verschiedenen Industrieregionen seelsorglich zu betreuen und im politischen Untergrund zu wirken. Die Religionsausübung der Zivilarbeiter aus den westlichen „Feindstaaten“ unterlag zwar formal keinerlei Einschränkungen. Sie konnten mit den deutschen Gemeindemitgliedern zum Gottesdienst gehen, in der Praxis jedoch wirkte die Sprachbarriere nicht selten hemmend, zumal deutsche Priester mit guten Sprachkenntnissen im Französischen oder Englischen bei den Sicherheitsbehörden unter besonderer Beobachtung standen. Kontakte zu Geistlichen ihrer Muttersprache waren den Zivilarbeitern indes streng verboten. Ende 1943 begann der deutsche Sicherheitsapparat mit der gezielten Zerschlagung der „Action catholique“, die zwischenzeitlich in 400 deutschen Städten ein Netzwerk von über 1.000 religiösen „Zellen“ aufgebaut hatte. Ihre Mitglieder wurden enttarnt, verhaftet, abgeschoben oder in Konzentrationslager eingeliefert. „Polenseelsorge“ 1942/43 kam es zu einer grundlegenden Verschärfung der seelsorglichen Bestimmungen für die im Reichsgebiet anwesenden Polen, die das größte Kontingent unter den Zwangsarbeitern bildeten. 1,2 Millionen Fremdarbeiter „polnischen Volkstums“, die Hälfte in der Landwirtschaft beschäftigt, waren davon betroffen. Schon seit 1941 war ihnen nur noch der Besuch von Sondergottesdiensten an Sonn- und Feiertagen erlaubt, ab 1942 nur noch jeden ersten Sonntag im Monat und an den Feiertagen. Der Erlaß Himmlers vom 10. September 1943 bildete einen Kulminationspunkt. Gerade dieser letzte Erlaß spiegelte noch einmal die ganze Verachtung des Nationalsozialismus für die „rassisch minderwertigen“ und zugleich „katholischen“ Zwangsarbeiter wider. Als Verbotsliste zeigte er, was im Alltag offenbar zwischen katholischen Deutschen und Polen in erheblicher Häufigkeit geschah. Der Erlaß wandte sich letztlich gegen die in bestimmten Nischen der NS-Gesellschaft noch immer mächtige Kirche und ihre praktizierenden Gläubigen. Einige Bestimmungen seien im einzelnen wiedergegeben (Amtsblatt des Bistums Limburg vom 1.12.1943, Nr. 149, S.59f): 1. Zivile Arbeitskräfte polnischen Volkstums aus dem Generalgouvernement, den eingegliederten Ostgebieten und dem Bezirk Bialystok durften nur an für sie eingerichteten, einmal monatlich am ersten Sonntag in der Zeit von 10-12 Uhr stattfindenden Sondergottesdiensten teilnehmen. Die Sondergottesdienste konnten in Kirchen sowie in geeigneten profanen Räumen veranstaltet werden. In einem Teil des Bistums Limburg war durch Erlaß des Gauleiters Sprenger in seiner Doppelfunktion als „Reichsverteidigungskommissar für den Wehrkreis XII“ unter dem 22. Juni 1940 bereits geregelt, 2. 3. 4. 5. 6. 7. daß deutsche Kirchen für Sondergottesdienste überhaupt nicht genutzt werden durften [Abb. 6]. Zur Feier der hl. Messe extra für die Polen mußten die Geistlichen bei ihrem Ordinarius sogenannte Bioder Trinationsfakultäten einholen, je nachdem, wieviele Gottesdienste sonntags insgesamt angesetzt waren. Bei den Sondergottesdiensten war grundsätzlich der Gebrauch der polnischen Sprache, auch das Absingen von Liedern, verboten. In den Jahren zuvor konnte noch das polnische Gebetbuch „Droga do nieba“ („Wege zum Himmel“) mit den darin enthaltenen Liedern genutzt werden. Die Abnahme der Beichte in polnischer Sprache war ebenfalls nicht gestattet. Es stand jedoch nichts im Wege, von der allgemeinen Lossprechung Gebrauch zu machen. Zur Vorbereitung der Kriegsgefangenen und Zivilarbeiter auf diese 1940 auch päpstlich approbierte „Generalabsolution“ und die Kommunion durften die polnischen Texte aus den vom Erzbischöflichen Ordinariat in Breslau herausgegebenen `Vollmachten für die Kriegsseelsorge` benutzt werden. Verboten waren die ebenfalls in Breslau herausgegebenen Predigtvorlagen in polnischer Sprache. An Gottesdiensten für die deutsche Bevölkerung durften polnische Zivilarbeiter keinesfalls teilnehmen; andererseits war es der deutschen Bevölkerung verboten, an den Sondergottesdiensten für die Polen teilzunehmen. Ein Rechtsanspruch auf die Veranstaltung von Sondergottesdiensten bestand natürlich nicht. Vielmehr konnten die unteren Verwaltungsbehörden „aus allgemeinen oder Arbeitseinsatzgründen“ den Ausfall der Sondergottesdienste für kürzere oder längere Zeit anordnen. Kinder von polnischen Zivilarbeitern konnten von deutschen Geistlichen getauft, polnischen Zivilarbeitern die Sterbesakramente erteilt und bei ihrer Beerdigung mitgewirkt werden. Jedoch galt auch hier das Verbot der polnischen Sprache und die strikte Trennung von „deutschen Volksgenossen“, die keinesfalls an einer Taufe, Beerdigung oder einem Versehgang teilnehmen durften. Es war nach dem Erlaß darauf hinzuwirken, daß polnische Zivilarbeiter nicht zwischen den Grabstätten deutscher „Volksgenossen“, sondern an besonderen Stellen der Friedhöfe beigesetzt wurden. Anträgen auf Erteilung von Religionsunterricht oder Unterricht zur Vorbereitung auf die Beichte bzw. Kommunion für Kinder polnischer Zivilarbeiter war grundsätzlich nicht stattzugeben. Eine „Heranziehung deutscher Jugendlicher als Meßdiener bei den Sondergottesdiensten der Polen sowie sonstigen kirchlichen Handlungen an Polen“ war verboten. Den aus dem Generalgouvernement und dem Bezirk Bialystok stammenden polnischen Zivilarbeitern war die Eheschließung im Reichsgebiet verboten, den Polen aus den „eingegliederten Ostgebieten“ (Warthegau, Westpreußen usw.) konnte als „Schutzangehörigen des Reiches“ die Heirat gestattet werden, allerdings bei Männern erst ab dem 25., bei Frauen ab dem 22. Lebensjahr. Die Praxis der „Polenseelsorge“ im Bistum Limburg erhellt die Akte „Seelsorge – Ausländer: Polen“ (Laufzeit 1906-1944) im Diözesanarchiv. Unter dem 27. Oktober 1940 wurden die Pfarrer vom Generalvikar um Bericht des örtlichen Status quo in dieser Frage gebeten. Bei gründlicher Durchsicht der Korrespondenzen und der vom Ordinariat handschriftlich angefertigten Statistik (zusammen 156 Blatt) ließen sich Zahlen erheben, wieviele Polen in den einzelnen Ortschaften und Pfarreien anwesend waren bzw. wahrgenommen wurden. Auskünfte über seelsorgliche Intentionen der Pfarrer, diesbezügliche Zusammenstöße der Geistlichen mit der Gestapo, äußere Umstände der Sakramentenspendung (Räume, Gebete, Musik, Lieder) oder die Kirchlichkeit der verschleppten Polen selbst harren der Auswertung. Von Pfarrer Hans Becker, Wehrheim, wurde zum Beispiel am 4. November 1940 mitgeteilt, daß sich 42 landwirtschaftliche polnische Zivilarbeiter am Ort aufhalten: „Ich habe mir vom Bürgermeister die Liste der polnischen Arbeiter geben lassen und allen deren Arbeitgebern mitgeteilt, daß der Gottesdienst ist. (...) Für 6. Oktober setzte ich Kommunionfeier mit Generalabsolution an. Von den 42 nahmen 37 daran teil. Ich ließ meine (dem Wehrmachtspfarrer eingeschickte) Predigt durch einen Dolmetscher übersetzen und diesen ein Reuegebet auf polnisch vorbeten. Dieser Dolmetscher ließt jedes mal das Sonntagsevangelium auf polnisch vor und stimmt die polnischen Lieder aus dem zugelassenen Gebetbüchlein Droga do nieba an.“ Nicht überall gingen die Polen offenbar gern zur Kirche. Aus Neuenhain/Ts., wo neun Ukrainer und zwei Polen eingesetzt waren, teilte Pfarrer Josef Schmidt mit: „Einen eigenen Gottesdienst zu halten für die paar Leute würde sich nicht lohnen, zumal die männlichen Polen, wie es scheint, keinerlei religiöse ‘Bedürfnisse‘ haben. 1 Pole erklärte auf die Aufforderung seiner Kostgeber, am Sonntagsgottesdienst teilzunehmen: Kirche nix, Kino!“ Die Initiativen der Gemeindepfarrer, die Polen zu erreichen, gestalteten sich ganz unterschiedlich. Oftmals gelang nur die „Mindestversorgung“ mit einem Gebetbuch. In anderen Fällen waren die Geistlichen hartnäckiger, wie etwa Pfarrer Groll von Biedenkopf, der die polnischen Zivilarbeiter seiner weit verstreuten Diaspora-Pfarrei auf dem Postweg zum Weihnachtsgottesdienst einlud [Abb. 7]. Aus Frankfurt am Main wiederum ist durch einen SD-Bericht vom 1. Oktober 1942 bekannt, daß Ukrainer, Weißruthenen, Tschechen und auch die Polen teilweise in Nationaltracht an der Fronleichnamsprozession teilgenommen haben. „Ostarbeiter“ und Ukrainer Die „Ostarbeiter“ standen in der Hierarchie der Fremdarbeiter ganz unten. Entsprechend den „Ostarbeitererlassen“ wurde von staatlicher Seite versucht, kirchliche Kontakte völlig zu unterbinden. Jede seelsorgliche Betreuung von „Ostarbeitern“ durch katholische Geistliche war strengstens verboten. Selbst eine Trauerfeier durfte durch Geistliche nicht vorgenommen werden, denn diese war in der kalten Sprache der Nationalsozialisten nicht mehr als eine „gesundheitspolizeiliche Maßnahme“, die vom zuständigen Arbeitsamt durchgeführt wurde, zuletzt vorzugsweise als Einäscherung. Zynisch wurde den einschlägigen Erlassen noch angefügt, die „Beerdigungsfeier“ könnte von einem „geeigneten Ostarbeiter“ als „Laienpriester“ geleitet werden. Im Krankenhaus der Armen Dienstmägde Jesu Christi in Dernbach waren alle in der Lohnkartei als „Ostarbeiter“ oder „Ostarbeiterin“ geführten Personen entweder römischkatholisch oder gehörten der unierten russisch-katholischen Kirche an. Ob und wie sie seelsorglich betreut wurden, läßt sich zum gegenwärtigen Stand der Nachforschungen nicht sagen. In geringer Weise besser gestellt gegenüber „Volkspolen“ und „Ostarbeitern“ waren die mit Rom unierten griechisch-katholischen Ukrainer, die aus den Gebieten Galizien und der sogenannten Karpatho-Ukraine stammten, die vor 1918 zu Österreich-Ungarn, dann zu Polen, Tschechoslowakei und Rumänien gehörten. Infolge des Hitler-Stalin-Paktes kam Galizien nach Besetzung am 17. September 1939 zur Sowjetunion. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es bereits eine griechisch-katholische Gemeinde in GroßBerlin, die 8.000 Gläubige zählte und ihre Gottesdienste in katholischen Gotteshäusern hielt. Die im Zuge der Grenzverschiebungen in großer Zahl nach Deutschland zuströmenden ukrainischen Fremdarbeiter stellten die kleine Gemeinde vor neue Herausforderungen. Um die Seelsorge für diese Volksgruppe im Reich zu koordinieren und ihr gegenüber den staatlichen Stellen ein Sprachrohr zu geben, setzte der Hl. Stuhl 1940 einen Apostolischen Visitator mit Sitz in Berlin ein: Prälat Msgr. Dr. Petro Werhun (18901957), der bereits seit 1927 als Ukrainer-Pfarrer in der Reichshauptstadt wirkte. Werhun, von Papst Johannes Paul II. in diesem Jahr 2001 als Opfer von Nationalsozialismus und Stalinismus zur Ehre der Altäre erhoben, verfügte als Ordinarius der unierten Ukrainer über eigene Jurisdiktionsvollmacht mit Zuständigkeit für das Altreich, den Reichsgau Danzig-Westpommern, das Wartheland und das Sudetenland. Von Berlin aus beauftragte er geeignete Priester mit der Seelsorge vor Ort, deren Zuständigkeit sich auch auf ruthenische Volkszugehörige erstreckte, die dem byzantinisch-slawischen Ritus angehörten. Ukrainer-Seelsorger für die Diözesen Limburg, Mainz und Fulda wurde Jaroslaus Polanskyj, ein junger, erst im Juli 1939 geweihter Absolvent des St. Andreas-Kollegs in München, der eigentlich für die Diaspora-Seelsorge unter den RussischKatholischen in Kanada vorgesehen war. Polanskyj wohnte im Heppelstift in Limburg, Bischof Hilfrich übernahm von 1941 bis 1944 einen Großteil der Finanzierung dieser Seelsorgstelle. Die in Deutschland anwesenden katholischen Ukrainer unterlagen als Zivilarbeiter aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Berliner Visitatur keinen Beschränkungen bei der Teilnahme am kirchlichen Leben der deutschen Pfarreien. Nach Mitteilung des RMfdkA vom 3. Mai 1943 galt: „Soweit die Ukrainer nicht die Bezeichnung ‘Ost‘ tragen, ist gegen ihre Teilnahme an den Gottesdiensten für deutsche Katholiken nichts einzuwenden.“ Auch bestand staatlicherseits kein Verbot, in der ukrainischen Sprache Beichte zu hören. Nur ein kleiner Teil der „Ostarbeiter“ war tatsächlich griechisch-katholisch und somit von dieser Religionspraxis ausgeschlossen. Dennoch gab es Hürden: Ein Gottesdienst im byzantinisch-slawischen Ritus mußte zwei Wochen vorher bei der Gestapo angemeldet werden. Teilnehmen durften nur ukrainische Zivilarbeiter, die bereits vor dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion emigriert waren und weder das „P“ noch das „Ost“-Abzeichen trugen. Die Predigt durfte nur in deutscher Sprache gehalten werden, was eine zusätzliche Barriere bildete. Die Gottesdienste im eigenen Ritus waren entsprechend schlecht besucht. Ein Besuch der Polen-Gottesdienste war auch nicht erlaubt, ebenso die Pastoration der kriegsgefangenen Ukrainer. In der Praxis waren die komplizierten Bestimmungen für die Ukrainerseelsorge kaum zu durchschauen, weder für die deutschen Behörden vor Ort noch für die Pfarrgeistlichen. Oftmals wurden griechischkatholische Ukrainer einfach für Polen gehalten. In Niederhöchstadt wurde zu Ostern 1943 von der Ortspolizeibehörde ein Gottesdienstverbot für alle Litauer und Ukrainer ausgesprochen. Pfarrvikar Frink wandte sich nach erfolglosen Verbaleingaben beim Bürgermeister und bei der Ortspolizei am 7. Mai 1943 an das Ordinariat in Limburg: „Die Zivilarbeiter, die keinerlei Abzeichen tragen, hatten bis dahin unseren Gottesdienst besucht. Ein Kirchenvorsteher, bei dem eine solche Arbeiterin eingestellt ist, sagte mir, daß sie nun dem polnischen Gottesdienst beiwohnen müßten. Ich bitte um geflissentliche Mitteilung, ob eine neue Bestimmung den Besuch der Zivilarbeiter regelt und an welchen Gottesdiensten sie ohne Schwierigkeiten teilnehmen dürfen.“ Limburg wandte sich an die Visitatur in Berlin, wo das Problem bereits aus anderen Orten bekannt war. Prälat Werhun schrieb am 1. Juli 1943 an die Gestapo in Frankfurt am Main und verwies auf die oben zitierte Entscheidung des RMfdkA, wonach Ukrainer ohne Ostarbeiter-Abzeichen an den deutschen Gottesdiensten teilnehmen durften. Darauf wurden in Niederhöchstadt die Arbeitsunterlagen aller ukrainischen Zivilarbeiter geprüft und ein einziger als griechisch-katholisch festgestellt, der kein „Ostarbeiter“ war. Dieser bekam dann die Erlaubnis, zum Gottesdienst zu gehen. Das Beispiel zeigt, mit welchen Schwierigkeiten die Pfarrer bei der Ausländerseelsorge zu kämpfen hatten. Es wird auch deutlich, daß die NS-Behörden bei der Behandlung der Ukrainer zwischen „Gewinnung für Deutschland“ und kompromißloser rassistischer Diffamierung schwankten. Zusammenfassend ist zu sagen: Zur spezifisch katholischen Wahrnehmung von „Zwangsarbeitern“ wissen wir wenig, denn bislang ist erst damit begonnen worden, die zentrale Aktenüberlieferung der Bischöfe und die Lageberichte der Sicherheitsorgane (SD, Gestapo) auszuwerten, womit die Analyse der Zwangsarbeiterproblematik durch die verfaßte Kirche im Mittelpunkt des Interesses steht. Über die „mentale“ Wirklichkeit bei der Wahrnehmung von Zwangsarbeitern im Kirchenvolk, über den „Alltag“ in der Seelsorge, Hilfestellungen aus christlicher Nächstenliebe, aber auch über sicherlich vorgekommene regimekonforme Verhaltensweisen von Katholiken ist der Kenntnisstand noch verhältnismäßig gering. Haben die Katholiken den „Arbeitseinsatz“ als Ausbeutung empfunden oder naiv als Teil der traditionellen Wanderbewegungen von ausländischen Arbeitskräften gesehen? Änderte sich konfessionell-solidarisches Denken von Katholiken etwa über Polen und Russen, als es nach Kriegsende zu Plünderungen und Zwangseinquartierungen in deutsche Wohnungen kam? Wie haben sich katholische Bauern, Unternehmer, Industrielle verhalten, die Zwangsarbeiter beschäftigten? Im Fall des Herz-JesuKrankenhauses der Armen Dienstmägde in Dernbach wissen wir zum Beispiel, daß eine junge russische Frau aus gesundheitlichen Gründen von der Firma Osmose in Staudt zur Arbeit als „Büglerin“ bei den Schwestern weitervermittelt wurde, was ihr möglicherweise das Leben gerettet hat. Ein Fall wie dieser zeigt: Viele praktizierende Katholiken entzogen sich dem „Sog des Totalitären“ (Koerner) und versuchten unter den Bedingungen von Krieg, Bespitzelung und Staatsterror nach den Geboten der Kirche zu leben, wo sie es konnten. Das NS-System war an seinem Absolutsheitsanspruch gemessen lückenhaft, das wird am „Reichseinsatz“ der Fremdarbeiter und den erfolgten kirchlichen Reaktionen deutlich. Hans-Michael Körner bilanziert: „Das Verhalten von Kirchenvolk und Klerus entzog sich so partiell dem totalitären Anspruch, noch dazu in einer Richtung, die durch Verbote rassenideologischer Provenienz besetzt war. Aus der Sicht des Systems, näherhin der SS-Führung, handelt es sich somit um einen doppelten Angriff, dem von daher große Gefährlichkeit zugeordnet und besondere Wachsamkeit zuteil wurde.“ (JR) Ziel und Methode der Untersuchung Das Ziel der Untersuchung bestand zunächst ausschließlich darin, die in Einrichtungen der katholischen Kirche beschäftigten Zwangsarbeiter möglichst vollständig und zeitnah zu erfassen, um eine Entschädigung im Sinne des Beschlusses der Deutschen Bischofskonferenz zu ermöglichen. Dieser Arbeitsschritt ist aufgrund der Quellenlage bis heute noch nicht abgeschlossen. Ein erster Beginn der Nachforschungen bestand in einem Schreiben des Generalvikars Dr. Günther Geis vom 25. Juli 2000, das an alle Pfarrer, leitenden Priester und Pfarrbeauftragte gerichtet war. Darin hieß es: „Es geht bei der Frage der Zwangsarbeit nicht allein um die gerechte Entschädigung der Opfer, sondern auch um die Auseinandersetzung mit unserer eigenen Geschichte. Zu Eingeständnis von Schuld gehört eine intensive Auseinandersetzung, sonst bleibt es ein formaler Akt. Geschichte läßt sich nicht mit Pauschalzahlungen an den Entschädigungsfonds allein bewältigen. Um die Auseinandersetzung mit unserer eigenen Geschichte als katholische Kirche im NS-Staat möchte ich Sie in den Pfarreien, katholischen Einrichtungen und Ordensniederlassungen, auch im Namen unseres Bischofs, ausdrücklich ermutigen. Prüfen Sie bitte in Ihren eigenen Archiven und durch Befragung von Zeitzeugen, ob während der NS-Zeit bei Ihnen Zwangsarbeiter beschäftigt waren. Versuchen Sie zu erfahren, ob und welche Kontakte es zu Zwangsarbeitern gab, die in Ihrer Umgebung eingesetzt waren“. Weitere Schreiben an die Ordensgemeinschaften, die Ruhestandsgeistlichen und die Caritasverbände in Limburg, Frankfurt und Wiesbaden folgten. Die Erhebung mit einem vollständigen Rücklauf erbrachte aber leider nur einen Teilerfolg. Die Pfarreien berichteten übereinstimmend, weder ausländische Zivilarbeiter noch Kriegsgefangene beschäftigt zu haben. Bei den Ordenseinrichtungen waren einige direkt bereit, umfassend Auskunft zu erteilen, bei anderen bedurfte es größerer Überzeugungsarbeit, um den Sinn und die Bedeutung des Unternehmens zu vermitteln. Inzwischen gibt es eine Zusammenarbeit mit allen Ordensgemeinschaften, die zwischen 1939 bis 1945 Niederlassungen in der Diözese Limburg unterhielten. Oft waren mehrmalige Nachfragen und persönliche Vorsprache in den Einrichtungen unabdingbar. Die auf das Rundschreiben hin zugesandten Ergebnisse überzeugten nicht immer. Einige Namen von Fremdarbeitern sind nur durch Nachrecherche in Konfrontation mit anders gewonnenen Erkenntnissen (nichtkirchliche Quellen, Zeitzeugenauskünfte) herausgefunden worden. Parallel zur Briefaktion liefen die Nachforschungen der Arbeitsgruppe an. An erster Stelle stand die Durchsicht der in Frage kommenden Bestände des Diözesanarchivs, dann folgten u.a. Besuche der Stadtarchive Montabaur, Frankfurt und Wiesbaden, des Hessischen Hauptstaatsarchivs in Wiesbaden, Korrespondenzen mit dem Landeshauptarchiv in Koblenz und dem Bundesarchiv, Außenstelle Militärarchiv, in Freiburg. Bislang konnten noch nicht alle sinnvollerweise einzubeziehenden Archive aufgesucht werden, in denen aufgrund der Archivpläne Hinweise zu vermuten sind. Eine gesonderte Würdigung verdient das Archiv des Internationalen Suchdienstes (ISD) in Arolsen. Dieses Archiv verwahrt u.a. Material, das von den Alliierten in den Jahren 1945/46 zunächst zu Dokumentationszwecken mitgenommen, dann aber nach Deutschland rückgeführt wurde. Es handelt sich dabei z.B. um personenbezogene Unterlagen, die zur Erstellung der UNRRA-Berichte verwendet wurden. Diese archivalischen Quellen sind derzeit nur nutzbar, wenn der Name der zu suchenden Person bereits bekannt und lediglich eine Bestätigung der Zwangsarbeit erforderlich ist. Der Werkstattbericht zeigt den Arbeitsstand in Bezug auf den Einsatz und die Unterbringung von ausländischen Arbeitskräften auf. Zu einigen weiteren Einrichtungen gibt es erste Spuren, die aber noch so ungesichert sind, daß sich eine Darstellung derzeit verbietet. Die bereits gewonnenen Erkenntnisse zum Thema Seelsorge an Kriegsgefangenen und Zivil- bzw. Zwangsarbeitern können in diesem Rahmen noch nicht umfassend dargestellt werden. Eine zukünftige Gesamtdarstellung mit dem Arbeitstitel „Das Bistum Limburg im Krieg. Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene unter den Aspekten kirchlicher Beschäftigung, Unterbringung und Seelsorge 1939-1945“ soll sowohl die zahlreichen offenen Fragen und Lücken des Werkstattberichtes schließen als auch den Aspekt der Seelsorge eingehend beleuchten. (BW) Ausgewertete Quellenbestände Die Quellenlage für das Forschungsvorhaben ist als schwierig zu bezeichnen, da fast keine gemeinsamen Leitquellen existieren, die in mehreren Einrichtungen vergleichbar aufzufinden sind. Chroniken, die als Leitquellen zu vermuten sind, wurden häufig in der NS-Zeit nicht geführt und in manchen Fällen erst in der Nachkriegszeit (oft mit großem Zeitabstand) nachgetragen. Die Fragen nach Zivil- oder Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen standen dabei gewiß nicht an erster Stelle. Auch Personalkarteien bzw. Lohnunterlagen gab es offenbar in vielen Einrichtungen nicht, mindestens sind sie nur sporadisch vorhanden. Die Meldeunterlagen zur Pflichtversicherung von Zwangsarbeitern bei den Allgemeinen Ortskrankenkassen sind für das Gebiet des Bistums Limburg ausnahmslos zum Internationalen Suchdienst nach Arolsen abgegeben worden. Als vollständig verloren gelten sämtliche Akten des „Gauarbeitsamtes Rhein-Main“ und der zugehörigen Arbeitsämter Frankfurt, Limburg, Niederlahnstein, Wiesbaden und Wetzlar. Der Verlust der Akten erklärt sich durch Kriegseinwirkung und Vernichtung in der frühen Nachkriegszeit, wie etwa in Frankfurt am Main geschehen. Die Aufstellungen mit Lagern und detaillierten Listen von Zwangsarbeitern, die von der UNRRA 1946 von den Bürgermeistern aller Städte und Gemeinden verlangt worden sind, konnten für das Bistum Limburg nebst den dazugehörigen Korrespondenzen bisher nur im Stadtarchiv Montabaur aufgefunden werden. Da auf keinen einheitlichen Aktenbestand zurückgegriffen werden kann, ist bei jedem Stadt-, Pfarr- oder Ordensarchiv zunächst zu klären, welches Material eventuell in Frage kommen könnte und in welcher Weise es archiviert wurde. Zuweilen sind die entsprechenden Papiere gar nicht verzeichnet und wurden auf dem Weg des Zufalls bzw. der langwierigen (und oft staubigen) Suche aufgetan. Viele der durchgesehenen Bestände liefern leider keine verwertbaren Hinweise. Informationen zu den Lebens- und Arbeitsverhältnissen der Zwangsarbeiter in kirchlichen Einrichtungen sind nur sporadisch vorhanden, Selbstzeugnisse fehlen. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sich die Recherchearbeit zwar arbeitsintensiv gestaltet, dennoch einen respektablen Erfolg zeigt. Bislang sind die folgenden Quellen für den vorliegenden Werkstattbericht und die zukünftige Gesamtdarstellung erhoben worden: I. - Quellen in kirchlichen Einrichtungen Diözesanarchiv Limburg (DAL) u.a. Korrespondenz des Bischofs von Limburg mit staatlichen und übergeordneten kirchlichen Stellen. Korrespondenzen der Pfarreien mit dem Bischöflichen Ordinariat betr. Binations- und Trinationsfakultäten, Genehmigungen zur Abhaltung von Ausländergottesdiensten, Zuständigkeitsfragen. Korrespondenzen im Vorfeld der Veröffentlichungen im Amtsblatt des Bistums Limburg. Anordnungen zur Seelsorge an katholischen Zwangsarbeitern. Berichte von Priestern über die Seelsorge an Gefangenen und Zivilarbeitern. Erhebung über die Polenseelsorge von 1940. Akten zur Ausländerseelsorge (Allgemein, Polen, Ukrainer). Meldelisten im Zusammenhang mit staatlichen Erhebungen zur „Volkswirtschaftlichen Kräftebilanz“ (1940-1945). Personalnachweis auf Anforderung des Reichskirchenministers 1941 und 1943. Kriegswirtschaftliche Kräftebilanzen. Pfarrakten für die Zeit von 1939 bis 1945 und für die direkte Nachkriegszeit. Personalakten der Priester, die wegen des Umgangs mit Ausländern in Konflikt mit dem NS-Staat kamen. Priesterkartei. Akten zu den Ordensgemeinschaften. Akten zu den Trägerschaften von Stiftungen (u.a. Peter-Joseph-Stiftung). Akten des Diözesan-Caritasverbandes. Nachkriegsakten zu Wiedergutmachungsfragen, DP-Lagern. Berichte zur Verfolgungspolitik 1933 - 1945 im Bistum Limburg (Pfarreien und Ordenseinrichtungen). Gedruckte Darstellungen über Pfarreien und Einrichtungen (Festschriften etc.). Sammlung von Zeitungsausschnitten (Nachlaß Pfarrer Hans Becker). 2. Pfarreien, Orden, Stiftungen 1. - - II. 1. 2. 3. - Nach den Rundschreiben des Generalvikars wurden Ordenseinrichtungen und Pfarreien aufgesucht, bei denen konkrete Hinweise auf Zwangsarbeiter vorlagen oder eine Beschäftigung vermutet werden konnte. Hier wurde zurückgegriffen auf: Chroniken von Ordensgemeinschaften und von Pfarreien. Pfarrakten. Lohnzahlungsunterlagen [Abb. 8]. Polizeimeldeunterlagen. Taufbücher, Geburtsbücher. Matrikel über Todesfälle in Krankenhäusern. Sammlung von Fotografien. In Manuskriptdruck für den internen Gebrauch vervielfältigte Erinnerungen an die Kriegszeit von einzelnen Ordensangehörigen. Tagebücher. Zeitzeugenbefragung. Quellen in staatlichen Archiven Bundesarchiv – Militärarchiv Freiburg Bestand Stalag XII (Diez). Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Gestapokartei Frankfurt (deckt mit den Gestapo-Nebenstellen den größten Teil des Bistums ab). Spruchkammerakten. Berichte des Sicherheitsdienstes (SD) für den Regierungsbezirk Wiesbaden. Berichte des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS (Außenstelle Limburg) betr. Überwachung von Firmen. Listen der in der Provinz Hessen-Nassau befindlichen Ordensniederlassungen. Stadt- und Gemeindearchive UNRRA-Berichte. Ostarbeiterkartei. Hausstandsbücher. Akten über Kriegsgefangene. Gestapo-Kartei. (BW) Darstellung der Ergebnisse nach Orten (Stand: 15. August 2001) Hinweis: Bei der Auswertung von Lohnunterlagen, Chroniken usw. fällt auf, daß die Schreibweise der Namen und Herkunftsorte der Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen aufgrund von sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten und Unkenntnis der kyrillischen Schrift, häufig vom Arbeitgeber nur nach dem Hören aufgenommen wurden. Zahlreiche Vornamen vor allem von Arbeitern aus Osteuropa wurden einfach eingedeutscht, z.B. Jadwiga zu Hedwig. In der vorliegenden Darstellung wurde streng nach dem Quellenprinzip verfahren, d.h. die in den Dokumenten vorgefundenen Schreibweisen wurden beibehalten. Es sei noch darauf verwiesen, daß wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nur Vornamen und gekürzte Nachnamen der Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen nennen. Balduinstein: Obstgut Schwalbenstein (Missionsschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu/Hiltrup) Die Missionsschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu (Hiltrup) erwarben 1930 das Obstgut „Schwalbenstein“ von der „Gesellschaft für landwirtschaftliche Frauenbildung“. Die Anlage der staatlich anerkannten Gärtnerinnenschule umfaßte eine Obstplantage, sechs Gewächshäuser für ganzjährige Pfirsichtreiberei, einen Spaliergarten, Gemüsefreiland, ein Gurken- und ein Weinhaus und das großzügige Parkgelände. Die Zahl der Schülerinnen lag zwischen 20 und 30, unter ihnen auch Schwestern verschiedener Ordensgemeinschaften. 1933 wurde zusätzlich eine Haushaltungsschule mit etwa 20 Schülerinnen gegründet. 1939 mußten auf staatliche Verfügung beide Schulen geschlossen werden. Das Anwesen wollte der RAD übernehmen, die Wohnverhältnisse schienen aber dann doch zu beengt. Stattdessen wies der Caritasverband Hamburg von Oktober 1940 bis November 1941 den Schwestern 10 Kinder zur Erholung zu. Den Nazis entzogen, diente Haus Schwalbenstein der Volkswohlfahrt: Im September 1942 trafen 30 Senioren aus einem Düsseldorfer Altersheim ein. In der Chronik des Obstgutes findet sich für das Jahr 1939 der Eintrag: „Um der Abgabepflicht an Gemüse genügen zu können, wurden uns nach langen Verhandlungen 2 Gefangene zugewiesen, die zum Stallag [sic] auf der Schaumburg gehörten. Außerdem konnten wir noch 2 ausländische Arbeiter einstellen, die Kost und Logie im Haus hatten“. Über diese heißt es weiter: „1940 wurde mit dem Bau des Erdhauses begonnen (...). Die Genehmigung bekamen wir nur unter der Versicherung, daß das Haus nur mit eigenen Kräften erstellt würde. Die beiden ausländischen Arbeiter freuten sich sehr, mit dieser Aufgabe betraut zu werden und holten sich nach Feierabend oft Erkundigungen und Ratschläge beim Bauunternehmer Lenau in Balduinstein ein“. Zu den beiden Zivilarbeitern fehlen bedauerlicher Weise bislang jegliche Angaben. Gegen Ende des Krieges „kamen die vielen Flüchtlinge, Polen, Ukrainer usw. Zum Schluß hatten wir den ganzen freien Hühnerstall voll Ukrainer. Stroh, Matratzen und Decken dienten als Lager. Den Flüchtlingsfrauen bereiteten wir Notunterkunft auf dem Hausboden (...). Und dann kamen die Amerikaner. Sie ließen kein Haus undurchsucht, nur unser Haus haben sie nicht betreten, das hatten wir wohl den Franzosen zu verdanken, die als Gefangene bei uns waren“. Auch die Namen dieser Männer kennen wir noch nicht. (BW) Q.: PAMSC, Chronik Obstgut Schwalbenstein 1929-1999, o.pag. Lit.: RAAB. Dernbach: Generalmutterhaus Kloster Maria-Hilf, St. Marienanstalt, Herz-Jesu-Krankenhaus, St. Josephshaus (Arme Dienstmägde Jesu Christi) Die selige Maria Katharina Kasper gründete 1842 einen „Verein für junge Frauen“, für den sie eine Lebensregel schrieb, die zur Grundlage der späteren Konstitutionen wurde. Mit Billigung des zunächst der Bewegung gegenüber abwartenden Bischofs baute die Gründerin 1847 ein kleines Haus, in das sie mit ihren ersten Gefährtinnen einzog. Die Regel für diese Lebensgemeinschaft genehmigte Bischof Blum 1850 und nahm am offiziellen Gründungstag der Gemeinschaft, dem 15. August 1851, die einfachen Gelübde der ersten Dernbacher Schwestern ab. Die Zahl der Schwestern stieg bis 1938 auf 4.556 Mitglieder. 1939 unterhielten die Dernbacher Schwestern 115 Niederlassungen in der Diözese Limburg, davon 87 mit einem Kindergarten und 61 mit einer angegliederten Nähschule. Keines dieser Häuser blieb von den Kriegseinwirkungen und Maßnahmen der Nationalsozialisten völlig verschont. Die überwiegende Zahl der kleineren Schwesternstationen mußten zwischen Ende 1939 und etwa Januar 1940 sogenannte Rückwanderer aus dem Saargebiet oder Soldaten zur Einquartierung aufnehmen. Die Räume, meistens Kindergärten, Nähschulen und Verbandszimmer, wurden auf dem Weg der Beschlagnahmung den Schwestern genommen. Nachdem der Regierungspräsident in Wiesbaden zum 1. August 1941 die Schließung aller konfessionellen Kindergärten verfügte, wenn sie nicht in NSV-Kindergärten umgewandelt wurden, und im gleichen Monat den Schwestern die Konzessionen zur Unterhaltung der Nähschulen entzogen wurden, beschränkte sich die Arbeit in den kleinen Stationen mit wenigen Schwestern fast ausschließlich auf die ambulante Krankenpflege. In einzelnen Fällen erhielten die ADJC die Genehmigung, gelegentlich Näh- oder Zuschneidehilfen zu geben. Eine Reihe größerer Häuser wurde durch staatliche Inanspruchnahme anderen Bestimmungen zugeführt (Die Einrichtungen, in denen Fremdarbeiter oder Kriegsgefangene gearbeitet haben siehe unten): Aulhausen, St. Vinzenzstift, Beschlagnahmung durch die Gestapo vom 31. Dezember 1938 bis 25. - März 1946. Camberg, Lieber’sches Hospital, Belegung durch Flüchtlinge und Militärbehörden. Dehrn, St. Hubertushaus, Haus 1943 mit Bombengeschädigten belegt. Geisenheim, Krankenhaus Maria Hilf, Teilbeschlagnahmung im Sommer 1944 für ein Lazarett aus Homburg/Saar. Hachenburg, Helenenstift, wiederholte Beschlagnahmungen, u.a. vom 31. Mai 1942 bis 12. Juni 1945 für Infektionskranke. Höhr-Grenzhausen, Marienkrankenhaus, 1939 Teilbeschlagnahmung und Einrichtung eines Pferdelazarettes, März 1944 Einquartierung von Bombengeschädigten aus Frankfurt. Kiedrich, St. Valentinushaus, Beschlagnahmung als Reservelazarett am 1. September 1939, Verlegung der Patienten zur Heil- und Pflegeanstalt Eichberg. Königstein, St. Josephskrankenhaus, 8. Oktober 1943 fast vollständige Beschlagnahmung für die Städtische Kinderklinik Frankfurt. Limburg, Marienschule, Aufhebung der Schule Ostern 1939. Rüdesheim, St. Josefskrankenhaus, ab Kriegsbeginn wiederholt für Monate als Lazarett beschlagnahmt. Tiefenthal, Exerzitienhaus und Kloster St. Elisabeth, Beschlagnahmung durch die Gestapo am 27. Juli 1939. Wiesbaden, Kinderheim St. Michael, 1. September 1939 Belegung eines Teils des Hauses durch das städtische Krankenhaus, 1940 bis 1942 durch Militär, März 1944 Hilfskrankenhaus für Franzosen, Italiener und Russen. In Dernbach lagen neben dem Kloster Maria Hilf die St. Marienanstalt, das St. Josephshaus und das Herz-Jesu-Krankenhaus. Im Kloster Maria-Hilf, dem Generalmutterhaus und Hauptnoviziat der ADJC, befand sich auch der Kindergarten St. Agnes, der 1939 auf staatliche Anweisung hin geschlossen werden mußte. Die St. Marienanstalt beherbergte ein Waisenhaus mit Pflegeplätzen für etwa 60 Mädchen, Unterrichtsräume und die Haushaltungsschule. Das St. Josephshaus diente als Heim für kranke und alte Schwestern der Genossenschaft, es hatte etwa 90 Betten. Das Herz-Jesu Krankenhaus schließlich nahm in sechs Stationen bis zu 140 Kranke auf. Angegliedert war eine Krankenpflegeschule. Die ADJC konnten während der NS-Zeit diese Einrichtungen weiter betreiben, sie blieben auch Anstellungsträger für sämtliches Personal. Während des Zweiten Weltkriegs lebten und arbeiteten 20 Polen bzw. Ostarbeiter und ein Franzose in den Einrichtungen der Dernbacher Schwestern. Sie waren im Kloster Maria Hilf, im St. Josephshaus und im Herz-Jesu-Krankenhaus untergebracht. Der Pole Martin K. (*1910 in Przcima) ist im April 1940 als erster Zivilarbeiter in Dernbach eingesetzt worden, er arbeitete hier bis zum November 1944, Johann L. von Februar bis November 1941, Jan und Pavel B. kamen lt. Lohnkarten wenigstens von April bis Dezember 1942 nach Dernbach. Mehr ist von ihnen nicht bekannt. Im Dezember 1942 übernahm die Arbeit in der Landwirtschaft der Jugendliche Wasil L. (*1927), gebürtig in Stomnikowa/Ukraine, der bis April 1944 anwesend war. In den Jahren 1943 bis 1945 gehörte zu den Landarbeiterinnen auch noch Maria R. (*1906) aus Beroschki. Ein ganzer russisch-katholischer Familienverband aus Oszowo/Ukraine scheint am 27. März bzw. 2. April 1943 als Ostarbeiter nach Dernbach gekommen zu sein, um bis Kriegsende als Landarbeiter im Westerwald zu bleiben. Der verwitwete Philipp L. (*1879); der ledige Ilja L. (*1928); Mojschej (gen. Iwan) L. (*1908) mit seiner Ehefrau Hanna L. (*1917) und einem gemeinsamen Kind (*1944 wohl in Dernbach) sowie das Ehepaar Michael L. (*1924) und Stefanie L. (*1918), die ebenfalls ein gemeinsames Kind haben (* vor 1944). Den Eltern mit Kind stand eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 5,- RM zu, für die Kinderpflege wurden gleichzeitig monatlich 6,- RM von den Schwestern einbehalten. Als Hausgehilfinnen werden Anna B. (*1903) aus Proentsakoma und Maria D. (*1918) aus Hinka in der Lohnkartei benannt. Bei Antonia H. (*1904) aus Bukowska im Generalgouvernement Polen, die einige Monate im Jahr 1944 geführt wurde, und Stanislawa T. (*1923) aus Budzischewize/Polen, die von 1943 bis 1945 entlohnt wurde, ist die ausgeübte Tätigkeit nicht benannt. Letztgenannte scheint auch zeitweilig im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Montabaur ausgeholfen zu haben. Marija A. (*1920) aus Newel war nach Aussagen einer Zeitzeugin zunächst bei der Firma Osmose in Staudt dienstverpflichtet. Weil sie dort erkrankte und die Arbeit zu schwer für sie war, fragte die Firma im Mutterhaus um eine andere Beschäftigungsmöglichkeit für die junge Frau an. Marija A., verheiratet und Mutter eines Kindes, wechselte zu den Schwestern und arbeitete bis März 1945 als Büglerin. Gemeinsam nach Dernbach kamen im Dezember 1944 bis Kriegsende auch Nickolei T. (*1878) und Wawara T. (*1887) mit Anna T. (*1907), es könnte sich hier um ein Ehepaar mit Tochter gehandelt haben. Ihre Herkunft bleibt unklar. Jacques N. (*1923) aus Paris bildet eine Ausnahme, er war kein Pole oder Ostarbeiter und als einziger ab September 1944 als Krankenpfleger eingesetzt. Da im Provinzarchiv sämtliche Lohnunterlagen des Jahres 1943 fehlen, ist es möglich, daß dieser Liste nach Erfassung anderer Quellen noch weitere Namen hinzugefügt werden müssen. In der Chronik des Mutterhauses wurde am 28. März 1945 eingetragen: „Heute hat Robert, unser französischer Kriegsgefangener, der beinahe 5 Jahre lang treu und fleißig auf der Ökonomie geschafft hat, uns verlassen, um in seine Heimat zu gehen“. Er kehrte zwei Tage später noch einmal über Wirges kommend zurück, da er keine Reisemöglichkeit fand. Weitere Angaben zu „Robert“ fehlen leider. Am 9. April 1945 berichtete die Chronistin: „Heute sind unsere russischen Arbeiter und Arbeiterinnen abgezogen und zwar zunächst nach Montabaur. Es verlautet, sie kämen zunächst nach Belgien, um später zur See nach Odessa befördert zu werden“. (BW) Q.: PAADJC, Dernbach, Verzeichnis der Niederlassungen 1939-1945, Lohnunterlagen. Lit.: SCHATZ 138-142; STAUDT. Elz: St. Josephshaus (Arme Dienstmägde Jesu Christi) Am 5. Mai 1893 kamen die ersten Armen Dienstmägde Jesu Christi nach Elz, sie eröffneten eine Kinderbewahrschule und widmeten sich der Krankenpflege. Im Juli 1893 fanden die ersten Hospitalkranken im St. Josephshaus Aufnahme. Im Ersten Weltkrieg wurde die Einrichtung in ein Lazarett mit 50 Betten umgewandelt. Nach der entbehrungsreichen Kriegszeit wandten sich die Schwestern wieder der Pflege von Kranken aus Elz zu und „nach einem Besuch im St. Josephshaus äußerte sich der bekannte Limburger Arzt Dr. Tenbaum, daß auch die Geistesschwachen so gut aufgehoben seien“. Von 1922 bis 1933 nahmen die Schwestern auch Wöchnerinnen auf. Nach Verhandlungen mit dem Kreiswohlfahrtsamt in Limburg wurde das St. Josephshaus zum Alten- und Siechenheim deklariert und 1934 um das „Schutzengel-Haus“ erweitert. In den Jahren des Dritten Reichs fanden „wehrunwürdige“ Jesuiten und Geistliche, die mit dem Nationalsozialismus in Konflikt geraten waren, ein Refugium im St. Josephshaus. In der Hauschronik des Jahres 1941 heißt es: „Am 13.5. besichtigten Herr Kreisarzt Dr. Jürges und der Leiter der Allg. Ortskrankenkasse Limburg unsere Krankenräume und trafen eine Vereinbarung, daß die erkrankten polnischen Landarbeiter der Krankenkassen Limburg, Diez, Montabaur, Marienberg und Weilburg zur Pflege und Behandlung hier untergebracht würden; 5 Betten für männliche und 5 Betten für weibliche Erkrankte müssen reserviert werden. An Stelle des ins Heer eingerückten Knechtes wurde uns für unsere Landwirtschaft vom Arbeitsamt ein französischer Gefangener zur Arbeit zugewiesen“. Wer dieser Mann war, wie lange er bei den Schwestern arbeitete – alle diese Fragen sind noch nicht zu beantworten. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs suchten viele Menschen Schutz im Josephshaus: Anwohner aus Elz, durch die Fliegerangriffe obdachlos gewordene Frankfurter Bürger und Evakuierte aus Köln, Essen und Duisburg. (BW) Q.: PAADJC, Dernbach: Verzeichnis der Niederlassungen 1939-1945. Lit.: W EIMER. Frankfurt am Main-Innenstadt: Karlshaus des Katholischen Gesellenhausvereins e.V. (Franziskanerinnen von Erlenbad) Das „Karlshaus“ des Katholischen Gesellenhausvereins e.V. in Frankfurt stand seit 1919 unter der Leitung der Franziskanerinnen von Erlenbad. Diese Gemeinschaft wurde als Schwesternkongregation im 19. Jahrhundert in Schwarzach (Erzdiözese Freiburg) gegründet. Von 1859 bis zum beginnenden Kulturkampf in Baden widmeten sich die Franziskanerinnen der schulischen Bildung und der Unterbringung von Waisenkindern. 1872 verboten ihnen die kirchenfeindlichen Schulgesetze jegliche Lehrtätigkeit in Deutschland. Ein Teil der Schwestern wanderte in die USA aus und gründete die Genossenschaft der Franziskanerinnen in Milwaukee aufs Neue. Erst nach dem Ersten Weltkrieg konnte in Erlenbad wieder ein Noviziat auf deutschem Boden eröffnet werden. In den 1920er und 1930er Jahren wuchs die Gründung beständig. 1936 nannten die Schwestern 15 Häuser ihr eigen. Bislang lassen sich nur für die Liegenschaft des Katholischen Gesellenhausvereins e.V. einige Hinweise auf Zivilarbeiter feststellen. Gesichert scheint, daß das Karlshaus für deren Unterbringung genutzt wurde, unklar ist jedoch in welchem Umfang. Da die entsprechenden Hausstandsbücher im Krieg vernichtet wurden, konnte aufgrund von Umzugsmeldungen nur ein kleinerer Teil der in der Seilerstraße 20 gemeldeten Personen ermittelt werden. Die namentlich bekannten 19 ausländischen Jungen und Männer stammten aus Italien, Frankreich, der Slowakei, Rußland und den Niederlanden. Als Berufe wurden Dreher, Metzger, Mechaniker, Schweißer, Anstreicher, Fräser, Elektriker, Fabrikarbeiter, Schneider und Konditor angegeben, sie gehörten der römisch-katholischen bzw. der russisch-orthodoxen Kirche an. Es fällt auf, daß 13 von ihnen im September bzw. Oktober 1940 über Paris nach Frankfurt am Main gelangten: Die Italiener Amelo M. (*1923), Ottilio L. (*1908), Giuseppe P. (*1922), Indrigo S. (*1914), Conradio R. (*1917); die Slowaken Josef P. (*1899), Josef S. (*1925), Paul S. (*1899), M. (*1890), K. (*1924) und Josef R. (1896) sowie die Russen Viktor B. (*1894) und Wladimir B. (*1895). Ob diese Arbeitskräfte auch im Haus beschäftigt wurden, konnte noch nicht nachgewiesen werden. Einer der in der Seilerstraße 20 untergebrachten französischen Zivilarbeiter, „Roger“ (* 1912 in Angers), wurde laut Gestapo-Kartei am 15. Juni 1944 für vier Wochen wegen Verdachts auf Arbeitsvertragsbruch in Polizeihaft genommen. (BW) Q.: IfSGF, HB Nr. 23, 36, 83, 101, 103, 105, Gestapo-Kartei. Lit.: STREITENBERGER. Frankfurt am Main-Innenstadt: Heim für Kaufleute und Studenten (Kongregation der Töchter der göttlichen Liebe) Das 1929 von dem geistlichen Studienrat Augustin Manns (1871-1947) aus größtenteils von ihm selbst gesammelten Mitteln gegründete, heute nicht mehr bestehende Heim für Kaufleute und Studenten in der Hochstraße 28-30 war ein lange gehegtes und vielbeachtetes Projekt des Katholischen Kaufmännischen Vereins in Frankfurt. Professor Manns verfolgte vor allem das Ziel, Auszubildende und Studierende aus ländlichen Regionen vor den „moralischen Gefahren“ (Manns) der Großstadt zu bewahren. Aber auch für junge Erwachsene aus anderen Ländern Europas und aus Übersee sollte das Kaufmannsheim preisgünstigen Wohnraum bereithalten. Besonderes Augenmerk lag dabei auf sogenannten auslandsdeutschen Jugendlichen, etwa Lothringern und Sudetendeutschen, die sich in Frankfurt kaufmännisch ausbilden ließen oder die Universität besuchten. Das Haus mit modernster und komfortabler Inneneinrichtung, Kapelle, öffentlichem Restaurations- und Klubraum, Bibliothek, Freizeitzimmer, einem 2.000 qm großen Garten und einer beheizbaren Dachterrasse bot Unterkunft und Verpflegung für bis zu 70 Lehrlinge und Studierende männlichen und weiblichen Geschlechts. Das Haus wurde von 17 Schwestern aus der Kongregation der Töchter der göttlichen Liebe mit Hauptsitz in Wien geführt, die auch als Eigentümerin eingeschrieben war (1936). Trotz massiver finanzieller Schwierigkeiten in der NS-Zeit konnte die Einrichtung bestehen bleiben, sie war jedoch nach einem Bombenabwurf am 29. Januar 1944 nur noch eingeschränkt nutzbar. Im Dezember 1944 meldeten die Schwestern noch nach Limburg, sie hätten eine Notkapelle im Haus eingerichtet. Nach erneutem Bombardement mußte das Wohnheim offenbar gänzlich geschlossen werden. Professor Manns und die Schwestern wurden bis Kriegsende in die Kellerräume des Opernhauses evakuiert. Das Hausstandsbuch für die Hochstraße 28-30 ist durch Kriegseinwirkung verloren, doch können anhand der im Stadtarchiv Frankfurt angelegten Datenbank zur Erfassung von Zwangsarbeitern durch polizeiliche Ummeldungsvermerke aus anderen Hausstandsbüchern für den Zeitraum des Zweiten Weltkrieges noch 31 Ausländer als dort wohnhaft nachgewiesen werden. Schon vor dem Krieg fanden sehr viele junge Erwachsene aus der ganzen Welt Unterkunft im Kaufmannsheim, auch aus Amerika und Fernost. Im Zeitraum 1940-44 waren vor allem Staatsangehörige besetzter oder verbündeter Staaten im „Kaufmannsheim“ registriert: Belgier, Niederländer, Franzosen, Italiener, Jugoslawen, Rumänen, Bulgaren, ein Weißrusse und eine Ukrainerin. Nicht alle Berufsbezeichnungen deuten allerdings auf einen reinen Ausbildungsaufenthalt dieser Personen in Deutschland hin. Zwar sind zwei Bankangestellte aus Slowenien, eine Studentin aus Rumänien, zwei kaufmännische Angestellte aus Belgien und dem Protektorat, ein junger Lehrer aus Lothringen und auch ein Medizinstudent aus Bulgarien gemeldet, die Angaben Friseur, Konditor, Gärtner, Schneider oder Küchenhilfe bei den anderen Namen sind ein starkes Indiz für eine Tätigkeit der betreffenden Personen als Fremdarbeiter. Möglicherweise mußte das Kaufmannsheim Räumlichkeiten in beträchtlichem Umfang für die Unterbringung von ausländischen Zivilarbeitern zur Verfügung stellen. Darauf deutet auch ein Bericht des Diözesancaritasdirektors Lamay an das Bischöfliche Ordinariat in Limburg vom Oktober 1942 hin, in dem vor dem Hintergrund seelsorglicher Bemühungen von Professor Manns um französische Zivilarbeiter in Frankfurter Betrieben auch mitgeteilt wird, das Kaufmanns- und Studentenheim sei Treffpunkt für „französische Arbeiter“. Unter den Einträgen in den Hausstandsbüchern fallen zwei Personen auf: Lida. D. aus Warmanuk in der Ukraine und Nikolaj A. aus Marienpol in Weißrußland. Lida D. kam im April 1944 aus dem Ort Wawaruk nach Frankfurt und war bis November 1944 im Kaufmannsheim als „Küchenhilfe“ gemeldet, bevor sie zur Brauerei Thomas in der Hochstraße 54 umgemeldet wurde. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist sie als Zwangsarbeiterin nach Deutschland deportiert worden. Ob Lida D. im Küchenbetrieb des Kaufmannsheimes geholfen hat, läßt sich nur vermuten. Das gilt auch für die beiden belgischen Küchenhilfen, die 1944 in Hausstandsbüchern vermerkt sind. Personalaufstellungen des Kaufmannsheimes aus dieser Zeit, die näheren Aufschluß geben könnten, aber auch andere Quellen, eine Hauschronik etwa, sind nach Auskunft des Provinzialates in Wien nicht erhalten. Möglicherweise wurde auch der weißrussische „Hilfsarbeiter“, der ab März 1941 im Kaufmannsheim gemeldet war, am Wohnort selbst beschäftigt. Ebenfalls nur spekulieren können wir bisher, ob der „Gärtner“ Pieter T. aus den Niederlanden, von Juli 1941 bis April 1942 in der Hochstraße 28-30 gemeldet, auch für die Grünpflege im großen Garten des Kaufmannsheimes tätig war. Im November 1944 brechen schließlich auch die Eintragungen in den verschiedenen Hausstandsbüchern ab. (JR) QQ.: IfSGF, HB Nr. 39, 60, 61, 63, 567, 207, 266; DAL, PA Manns, 224 A/1, 233 BA/1. Frankfurt am Main-Innenstadt: Kloster der Franziskanerinnen von Aachen Mitten im Kulturkampf, im Jahr 1875, einigten sich Franziska Schervier, die Gründerin der Armen Schwestern vom hl. Franziskus (Aachen) und der Frankfurter Stadtpfarrer Münzenberger darauf, eine Niederlassung der Franziskanerinnen in der Lange Straße in Frankfurt zu gründen. In den ersten Jahren pflegten die Schwestern Kranke in den Wohnungen, 1881 eröffneten sie ein Altersheim und 1883 ein Mädchenheim, das weibliche Dienstboten vor den „Gefahren der Großstadt“ fern halten sollte. 1928 kam das Schwesternhaus in der Pfarrei Heilig Geist in Frankfurt-Riederwald hinzu. Das Mädchen- und das Altersheim, eine der größten Einrichtungen in katholischer Trägerschaft in Frankfurt, hatte 1936 zusammen 260 Plätze, 38 Schwestern lebten und arbeiteten im Kloster. Das Gebäude wurde vom Gesamtverband Frankfurt zur Verfügung gestellt, die Adresse lautete nun bis Kriegsende „HansHandwerk-Straße 12“. Nachdem der Niederlassung 1930 eine Leichtkrankenabteilung angegliedert wurde, verfügten die Behörden im November 1941 für die Dauer des Krieges die Umwandlung des Hauses in ein allgemeines Krankenhaus mit dem Namen „Franziska-Klinik“. Die Provinzoberin, Sr. M. Luciosa Benz, teilte im Februar 2001 mit, daß im Provinzhaus Lange Straße noch viele alte Schwestern leben, die die Kriegsjahre vor Ort erlebten, „auch diese ‚Augenzeugen‘ haben keine Erinnerung an Zwangsarbeiter in diesem Haus“. Ob Zwangsarbeiterinnen im Kloster angestellt waren, bleibt bislang unklar. Sicher ist jedoch, daß das Gebäude zur Unterbringung einer nicht geringen Zahl von ausländischen Mädchen und Frauen diente, die in Wirtschaftsbetrieben arbeiten mußten. Da für die Hans-Handwerk-Straße durch Kriegseinwirkung keine Hausstandsbücher mehr existieren, sind nur einige wenige Personen namentlich bekannt, da sie zeitweilig in andern Sammelunterkünften gemeldet waren: die Französinnen Denise P. (*1918) und Lucette Y. (*1920), die Italienerinnen Magdalene L. (*1921, beschäftigt bei der Naxos Union), Anna Z. (*1922) und Lucie Di T. (*1929, sie wohnte zunächst bei den Dernbacher Schwestern in der Eichwaldstraße), der Bulgare Petko P. (*1915, beschäftigt bei Teves) und der Slowake Maley K. (*1901, wohl beschäftigt bei der Firma Voigt & Häffner AG). Eine Mutter mit zwei Kleinkindern lebte ebenfalls im Kloster: die ledige italienische Arbeiterin Antonia Del B. (*1922) mit Fred Hans Del B. (*1942) und Ellen-Ruth Yvonne Del B. (*1943). Ob die Frau im Kloster tätig war, konnte noch nicht geklärt werden. Einen interessanten Einblick in die Verhältnisse im Heim der Franziskanerinnen erlauben die Schreiben des Pfarrers i.R. Wilhelm Nicolay, der sich wegen der „Pastoration französisch sprechender Mädchen“ am 28. April 1941 an das Bischöfliche Ordinariat in Limburg wandte: „Dem Hochwürdigsten Bischöflichen Ordinariat teile ich mit, daß seit längerer Zeit über 50 Mädchen sich in dem Heim Hans Handwerkstr. 12 befinden, die teils der Sprache und der Nation nach Italiener sind, teils der Sprache nach dem französischen Sprachgebiet angehören; sie sind als Arbeitskräfte in großen Betrieben tätig. Die italienischen Mädchen werden, wie ich von privater Seite höre, von einem eigenen Geistlichen seelsorgerisch betreut, der sich aber um die anderen nicht kümmert, alle Mädchen sprechen französisch, der italienische Geistliche kann es nicht. Einige Mädchen, deren Eltern nach dem nichtbesetzten Frankreich ihren Wohnsitz verlegten, durften in Frankfurt nicht mehr arbeiten, sie sollen nach dem jetzigen Wohnsitz ihrer Eltern abgereist sein, die anderen Mädchen sind als Lothringerinnen jetzt deutsch, sprechen aber nur französisch, einige seien staatenlos. Schon vor längerer Zeit begab ich mich auf das Polizeirevier in der Cranachstraße, das mich an die Geheime Staatspolizei verwies. Die könnte mir allein Auskunft erteilen. Ich war auch da, sagte, daß das Arbeitsamt die fremdsprachigen Mädchen da eingewiesen habe, zeigte auch meinen Paß, der Herr aber war nicht orientiert, gab mir als Verhaltensmaßregel eine äußerste Zurückhaltung, er werde sich erkundigen (...). Ich bin bereit, die Mädchen seelsorglich in der Langestraße in der Kapelle, im Saale seelsorglich zu betreuen“. Auf seine Anfrage bei der Gestapo erhielt Nicolay keine Antwort. Er wandte sich noch einmal am 9. November 1941 an die Bistumsleitung: „Betreffs der seelsorglichen Betreuung der fremdsprachigen Arbeiterinnen in der Hans- Handwerkstraße 12 besprach ich mich mit der Provinz- und Hausoberin, wies in der Unterredung auf die Methodes eines Hl. Franz von Sales, Vincenz v. Paul (...) u.a. hin, die Großes durch große Frauen auf diesem Gebiete leisteten. Leider beherrscht keine der Schwestern das Französische, so daß meine Tätigkeit alleine den Arbeiterinnen einige Klänge in der Muttersprache im dortigen Haus bieten konnte. Ich halte in der Regel alle 14 Tage einen Vortrag beim Frühstück in französischer Sprache. Andere Möglichkeit wurde mir nicht geboten, ich höre die Arbeiterinnen Beicht, wenn sie sich im Beichtstuhl einfinden (...). Ich kaufte den Arbeiterinnen das bei Herder erschienene billige kleine Gebetbuch für Kriegsgefangene, verschaffte für sie französische Literatur weltlicher und religiöser Art in großem Umfang, machte Besichtigungen auf der Saalburg und in der Karmeliterkirche mit ihnen und bat öfter, eine Dame für die Arbeiterinnen als Vertreterin ihrer Mutter anzuwerben. Das gelang nach längerer Zeit, Frau Dr. Klein aus Coblenz nimmt sich als sprachgewandte Dame in selbstloser, mütterlicher Weise der Arbeiterinnen jetzt an, hält mit ihnen gemeinsam im Oktober Rosenkranzandacht, an der 8 Arbeiterinnen teilnahmen. Gesänge in fremder Sprache erfüllen das Haus, religiöse und weltliche Lieder erklingen in fremdem Idiom, die Ansprache des italienischen Geistlichen, der häufig zu den Arbeiterinnen kommt, gibt sicher fast allen Worte des Trostes und der Erbauung“. (BW) QQ.: IfSGF, HB Nr. 63, 220, 586, 823, 1994; DAL, 224 A/1. Lit.: GATZ (1) 374-399; NICOLAY. Frankfurt am Main-Bornheim: Pfarrei St. Joseph Die Pfarrei St. Joseph und die Dernbacher Schwestern gehörten viele Jahrzehnte lang in der Wahrnehmung des Frankfurter Stadtteils Bornheim untrennbar zusammen. 1871 bat Pfarrer Dr. Rody die Armen Dienstmägde Jesu Christi, die Armen- und Krankenpflege zu übernehmen. Das erste kleine Kloster, das heutige Marienheim, entstand 1875 in der Eichwaldstraße 40, 1879 öffnete die Suppenküche für bedürftige Kinder in der ehemaligen Notkapelle. Der von 1884 bis 1905 amtierende Pfarrer Koenigstein hatte als ehemaliger Privatsekretär des Zentrumsführers Windthorst beste Beziehungen zu hochgestellten katholischen Persönlichkeiten in ganz Deutschland, von denen er Unterstützung für seine caritativen Bestrebungen erhielt: er erwarb die Liegenschaften Berger Straße 133 und Heidestraße 62 zur Errichtung mehrerer, dem sozialen Zwecke dienender Gebäude. Die Fertigstellung des ersten Neubaus, des St. Anna-Hauses, in der Heidestraße begingen Schwestern und Pfarrei im Jahr 1902. Nur ein Jahr später, im Juni 1903, begann in den Räumlichkeiten ein Kinderheim für bis zu 40 Halb- und Vollwaisen und gefährdete Mädchen ein Ersatz für das Familienleben zu sein. Ein Vierteljahr darauf, im September 1903, konnte das Josephsheim, der „Sammelpunkt für unsere Vereine und eine Heimstätte für die gefährdete Jugend“, der Öffentlichkeit übergeben werden. Unter einem Dach befanden sich nun in der Berger Straße 133 ein Arbeiter-Wohnhaus mit 2- und 3-Zimmerwohnungen, im Erdgeschoß ein Laden und die Restauration „Josephsheim“, daran anschließend der Festsaal mit Bühne, ein Übungssaal für den Kirchenchor, die Borromäusbibliothek, Vereinsräume und das Notburga-Mädchenheim. Die Anstalten erregten weit über Frankfurt hinaus Aufsehen, da diese Einrichtungen Vorbildcharakter für die Linderung der kirchlichen und sozialen Not hatten. Da die Räumlichkeiten im alten Schwesternhaus nicht ausreichten, baute der Orden 1914 ein größeres Haus in Verlängerung des Josephsheims, das St. Josephs-Schwesternhaus in der Eichwaldstraße 39, in dem auch die Erweiterung des Mädchenheims „St. Martha-Mädchenheim“ sowie eine Damenpension Platz fanden. In der Eichwaldstraße 40 wurde ein Witwenheim für ältere alleinstehende Frauen des Arbeiterstandes eingerichtet. Die Dernbacher Schwestern übernahmen die Leitung sämtlicher caritativer Einrichtungen. In den Jahren des Ersten Weltkriegs standen die Räume des Schwesternhauses und des Josephsheims zur Versorgung von Verwundeten offen. Die Situation in den Jahren 1939 bis 1945 gestaltete sich anders. Der Saal des Josephsheims war im März 1941 gegen entsprechende Vergütung zur Einquartierung italienischer Arbeiter beschlagnahmt worden. Es handelte sich um 135 italienische Männer, die den Saal mit Bühne und umlaufenden Emporen in Besitz nahmen. 125 von ihnen reisten direkt aus Italien am 24. Juni 1941 an. Zahlenmäßig größere Kontingente kamen aus der östlichen Emilia Romagna und der nördlichen Toskana. Zu der Gruppe um Ravenna gehörten 54 Männer, sie wohnten vor ihrer Abreise in Ariana, Alfonsine (6), Bagnacavallo (2), Brisighella (4), Castel Bolognese, Chorino, Conselice (2), Fusgnano, Lugo (3), Ravenna (14), Russi (18) und Solarolo. Aus der Gegend um Massa stammten 31 Männer, die zuvor in Carara (2), Casola (7), Fosdinuova (4), Lucca (2) und Massa (16) gemeldet waren. Ein Beleg dafür, wer diese Arbeitskräfte ins Land holte und beschäftigte, steht noch aus. Am 1. April, 7. Mai und 5./6. Dezember 1942 siedelten insgesamt 69 Männer in das Lager an der Philipp-Reis-Straße über. Es handelte sich um ein Großlager für Italiener auf dem Festhallengelände, die errichteten Backsteinbaracken wurden im Krieg schwer beschädigt. Diese Unterkunft wurde vom Bauamt und dem Luftschutz der Stadt Frankfurt belegt, der wohl dann auch die Italiener beschäftigte. Am 5./6. Dezember 1942 kehrten 27 Arbeiter und ein Jahr später nochmals 21 Arbeiter nach Italien zurück. Zwei Männer sind bis zu ihrer Heimfahrt nach Italien am 6. Dezember 1944 in der Berger Str. 133 gemeldet, vier Personen sind lt. den Hausstandsbüchern bis nach Kriegsende in Bornheim verblieben. Welcher Arbeit sie nachgingen ist unklar, auch ob sie direkt in einer der Einrichtungen in St. Joseph eingesetzt waren. Anfang 1942 nahm lt. Pfarrchronik eine Pionierabteilung der Wehrmacht Quartier im Pfarrsaal. Wie sich das zeitgleich zur Einweisung der Italiener realisieren ließ, bedarf noch der Klärung. (BW) QQ.: IfSGF, HB Nr. 883; PfA St. Josef Frankfurt-Bornheim, Chronik, Bd. 8, 315, 322. Lit.: Mut zum Weitergehen, 83-101; BECKERT 192. Frankfurt am Main-Bornheim: St. Josephs-Schwesternhaus (Arme Dienstmägde Jesu Christi) Im St. Josephs-Schwesternhaus, das während des Krieges im Besitz der ADJC blieb, fanden 16 ausländische Mädchen und Frauen eine Unterkunft: Die Französinnen Henriette B. (*1921), Johanna H. (*1923 in Lothringen) und Emilia Z. (*1923, Arbeiterin), die Holländerinnen Henrike K. (*1917, Hausgehilfin), Maria K. (*1921, Buchhalterin) und Henrike L. (*1917, Arbeiterin), die Italienerinnen Helene C. (*1924, ohne Beruf), Dina C. (*1922, zuvor Arbeiterin, in der Eichwaldstraße als Hausgehilfin bezeichnet), Lidia Del B. (*1920, Näherin), deren Schwester offenkundig im Haus der Franziskanerinnen, Hans-Handwerk-Straße 12, untergebracht war, Lucie T. (*1929, Näherin, später auch bei den Franziskanerinnen) und Cäsile E. (*1924 in Lothringen, Näherin). Auch osteuropäische Frauen befanden sich unter den Ausländerinnen: Die Jugoslawin Käthe K. (*1920), die Polinnen Helene K. (*1905, ohne Berufsangabe) und Anna M. (*1916, Schneiderin), aus „Ungarn-Slowakei“ stammten Alzbeta C. (*1923, Hausgehilfin) und Irma S. (*1924, Hausgehilfin). Da alle Akten des Hauses vernichtet wurden, ist es den Dernbacher Schwestern nicht mehr möglich festzustellen, ob einige der Frauen im Haus beschäftigt waren. Es muß deshalb weiter versucht werden, über andere archivalische Quellen diese offenen Fragen zu beantworten. In der Schwesternhaus-Kapelle hielt Pfarrer Höhler ab August 1940 Gottesdienste für französische Kriegsgefangene, die in der Bergerstraße 96 (Wirtschaft Bantze) wohnten. Die Teilnahme von Zivilisten war untersagt. Ein Jahr später kamen zwei Chorfrauen und eine Laienschwester aus dem beschlagnahmten Benediktinerinnenkloster Eibingen im Rheingau zu den ADJC. Am 20. Dezember 1943 verzeichneten die Schwestern die ersten Kriegsschäden, der Dachstuhl des Mädchenheims brannte nieder. Völlig zerstört wurden das Schwesternhaus, das Witwenheim sowie der Mittelbau des Josephsheims am 11. Februar 1944, Schwester Claudica ADJC kam bei dem Bombenangriff ums Leben. Das St. Anna-Haus in der Heidestraße sank am 22. März 1945 ebenfalls in Schutt und Asche. (BW) QQ.: PAADJC, Dernbach, Verzeichnis der Niederlassungen 1939-1945; IfSGF, HB Nr. 23, 586, 928; PfA St. Josef Frankfurt-Bornheim, Chronik, Bd. 8, 308, 317, 329, 330f. Lit.: Mut zum Weitergehen. Frankfurt am Main-Gallus: Pfarrei St. Gallus Die Pfarrei St. Gallus hatte schwere Kriegsschäden zu verzeichnen. Der 12. September 1944 blieb den Pfarrangehörigen in schrecklicher Erinnerung. Waren bereits vorher 80% der Häuser des Bezirks geschädigt bzw. zerstört, so traf es nun die kirchlichen Bauten: das Kirchenschiff sprengten Luftminen auseinander, Schwesternhaus, Pfarrhaus, Jugendheim und Küsterhaus fingen Feuer. Im Schwesternhaus starben acht Menschen, unter ihnen die Oberin. Dennoch fand auf dem Gelände der Pfarrei im sog. „Lager Mainzer Landstraße 299“ am 3. November 1944 eine bunte Schar Aufnahme. Eugen D. (*1905) aus Aux Andelys in Frankreich, und die hochschwangere Veronika D. (*1925) aus Briese in Litauen, beide ledig, nahmen Quartier – man darf sagen, in höchster Not. Nur drei Wochen später wurde hier ihr gemeinsamer Sohn Johann geboren. Das Paar wohnte zuvor im Lager der Firma Voigt & Häffner im Tanzsaal des Gasthauses „Zum Mainbörnchen“ im Burglehen 7. Zusammen mit ihnen traf von dort Martha D. (*1911) aus Grzyb in Polen und Anna D. (*1924) aus Wilna in Litauen mit ihrer sieben Wochen alten unehelichen Tochter Anna D. ein. Ob weiterhin die Verpflichtung bestand bei Voigt & Häffner zu arbeiten oder ob andere Tätigkeiten, z.B. in der Pfarrei übernommen wurden und wer diesen Menschen überhaupt diese Bleibe anwies, ist noch eine offene Frage. Auch ist bis jetzt nicht recht vorstellbar, wie die Unterkunft ausgesehen haben mag, da wenige Monate zuvor alle Gebäude fast restlos zerstört wurden und nur der Turm der Kirche aus den Trümmern aufragte. (BW) Q.: IfSGF, HB Nr. 18, 113, 2134. Lit.: FIRTEL; BECKERT 195. Frankfurt am Main-Gallus: Monikaheim (Schwestern vom Heiligen Geist) Das Monikaheim in der Kostheimer Straße 11-15 wurde 1914 errichtet. Bereits seit 1910 führten die Schwestern vom Heiligen Geist aus Koblenz diese schon seit 1909 bestehende Einrichtung des Fürsorgevereins e.V., die Anlaufstelle und Unterbringungsort für gefährdete Mädchen, deren Säuglinge und Kinder bot. In der Zeit des Nationalsozialismus versuchte der Verein seine Arbeit fortzuführen. Das Haus hatte damals Platz für mehr als 170 Zöglinge. Fragen wie Zwangssterilisation von Heimbewohnerinnen und erzwungene Abtreibungen bereiteten den Schwestern große Sorgen, wie aus den Protokollen der Vorstandssitzungen zu entnehmen ist. Den Schwestern gelang es auch, sechs von zehn Frauen, die nach Hadamar deportiert worden waren, wieder ins Monikaheim zurückzuholen. Neben finanziellen Schwierigkeiten lagen in den Kriegsjahren weitere Sorgen darin, möglichst genug Wohnraum und Essen zur Verfügung stellen zu können: 1939 für Evakuierte aus dem Saarland, danach für Schwestern aus dem Ordenshaus in Koblenz, Flüchtlinge und Obdachlose. Im März 1944 wurden die im Haus anwesenden Kinder nach Oberursel in das Johannesstift gebracht. Im September 1944 beschädigte der Bombenhagel das Monikaheim schwer. Da bislang weder Lohnunterlagen auffindbar waren, noch die Hausstandsbücher der Kostheimer Straße vorhanden sind, konnten nur die Namen von zwei ausländischen Frauen ermittelt werden, die wenigstens im Monikaheim gelebt haben, dort eventuell aber auch beschäftigt waren: die belgische Küchenhilfe Jeanna De B. (*1925), die bis im Juli 1944 blieb, und die Niederländerin Margarete De J. (*1918). Näheres zu diesen beiden Personen muß noch geklärt werden. (BW) Q.: IfSGF, HB Nr. 18, 113, 2134. Lit.: Einhundert Jahre Sozialdienst. Frankfurt am Main-Griesheim: Kloster Maria vom Siege (Arme Dienstmägde Jesu Christi) Das Kloster „Maria vom Siege“ der Dernbacher Schwestern zog 1899 in das St. Josephshaus (Vereinsund Schwesternhaus) in Frankfurt-Griesheim um. Die Schwestern eröffneten ein Altersheim, das im Jahr 1936 für 14 alte und pflegebedürftige Menschen Raum bot. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden durch das Fürsorgeamt Insassen des Altersheimes in Köppern nach hier verlegt, die von den ADJC versorgt wurden. Am 11. Februar 1944 und am 22. März 1944 zerstörten Bomben das Schwesternhaus fast völlig. Ab dem 15. Juli 1944 bis in den November 1944 kamen aus dem Lager Schwanheim Russen in ihrer Freizeit zu Aufräumungsarbeiten. Sie erhielten ihren Lohn in Form von Naturalien: eine Beköstigung und Kleidung aus dem Altenheimbestand. Wer diese hilfsbereiten Menschen waren, bleibt noch unbekannt – eventuell kamen sie aus dem Zivilarbeiterlager in der Martinskirchstraße 70, das von 194345 bestand oder aus einem großen Ostarbeiterlager in Schwanheim, dessen Lage heute nicht mehr genau feststellbar ist. (BW) Q.: PAADJC, Dernbach, Verzeichnis der Niederlassungen 1939-1945. Lit.: BECKERT 200f. Frankfurt am Main-Höchst: Städtisches Krankenhaus (Arme Dienstmägde Jesu Christi) Die Situation im Krankenhaus Frankfurt-Höchst unterscheidet sich von den anderen Einrichtungen der Dernbacher Schwestern. Trägerin des Krankenhauses war die Stadt Frankfurt, die Schwestern arbeiteten seit 1887 in Gestellungsvertrag im Bereich der Krankenpflege. Da die Armen Dienstmägde Jesu Christi aber die Verwaltungshoheit und die Personalhoheit auf den einzelnen Stationen des Krankenhauses inne hatten, unterstanden ihnen faktisch auch die ausländischen Arbeitskräfte. Somit waren diese zwar von der Stadt Frankfurt angestellt, nahmen als Vorgesetzte aber hauptsächlich die Schwestern wahr. Dem Krankenhaus, das in 14 Stationen 400 Betten zur Verfügung stellte, war eine Krankenpflegeschule angegliedert, die ebenfalls von den Schwestern betrieben wurde. Nach den Hausstandsbüchern waren auf der Liegenschaft Gotenstraße 6 in den Kriegsjahren insgesamt 28 ausländische Personen gemeldet, die alle im Krankenhaus arbeiteten. Da bislang keine Lohnunterlagen aufzufinden sind, kann der jeweilige Status nicht immer geklärt werden. Aus Belgien kamen Blanka D. (*1905), Alida M. (*1920, Hausgehilfin) und die bei Arbeitsbeginn noch minderjährige Julia M. (*1924). Die drei Franzosen waren alle als medizinisches Personal ausgebildet: André B. (*1922) und Michel S. (*1922) als Medizinstudenten und Assistenzärzte und Alexie L. (*1912) als Krankenpfleger. Theodor-Johann K. (*1922, Krankenträger), die minderjährige Lÿntje N. (*1926) und S. (*1920) stammten aus Holland. Drei Norwegerinnen, die als „DRKSchwesternhelferinnen“ bezeichnet wurden, waren für eine kurze Zeit in Höchst: Grete G. (*1918), Lillie H. (*1915) und Maria Giselheid S. (*1920). Die Polin Antonia M. (*1904) machte gleichsam eine ‚Dernbacher Karriere‘. Sie arbeitete außer in Höchst auch noch im Marienkrankenhaus in Frankfurt und in Dernbach bei den Schwestern. Ihre Tochter Viktoria (*1923) kommt einige Zeit später nach, beide Frauen arbeiteten als Hausgehilfinnen. Bei den Russinnen wurde häufig keine Berufsbezeichnung angegeben, vereinzelt sprach man von „Hausgehilfinnen“. Es handelte sich um Nila H. (*1923), Miliza K. (*1925), Tamara P. (*1924), Praskowya P. (*1921), Lisa Sch. (*1907), Nina B., Erna N., Vera K. (*1923), Nina K. (*1924), die ledige Anna K. (*1919), die in Frankfurt-Höchst 1944 einen Sohn, Jura K., zur Welt brachte und Alexander von L. (*1909), der als Krankenträger arbeitete. Eine Frau, Inni P. de la R. wurde als staatenlos bezeichnet. (BW) QQ.: PAADJC, Dernbach, Verzeichnis der Niederlassungen 1939-1945; IfSGF, HB Nr. 266, 2478-2480, Vorortakten Höchst 175, Bll. 22, 24, 25 (Nachkriegsmeldungen). Lit.: SCHÄFER 172, 261. Frankfurt am Main-Nordend: Marienkrankenhaus (Arme Dienstmägde Jesu Christi) Das Marienkrankenhaus in Frankfurt, Brahmsstraße 3, befand sich im Besitz des Bischöflichen Stuhles in Limburg. Die Dernbacher Schwestern übernahmen ab 1892 die Krankenpflege und die Krankenpflegeschule. Während des Zweiten Weltkriegs mußte das Haus 200 der 350 Betten für das Luftschutzlazarett bereithalten. Ab Juli 1941 wurden sechs in Eibingen ausgewiesene Benediktinerinnen im Marienkrankenhaus aufgenommen. Nach der Zerstörung des Hauses bei einem Bombenangriff am 22. März 1944 setzte die Stadt Frankfurt französische Kriegsgefangene zur Instandsetzung ein, manche von ihnen bis zum Jahresende 1944. Ihre Namen sind nicht bekannt. Ermittelt werden konnte ein Teil der ausländischen Zivilarbeiter, jedoch nicht alle, da die Hausstandsbücher für die Liegenschaft Brahmsstraße 3 nicht mehr vorhanden sind und nur über den Rückschluß aus Umzugsmeldungen eine Liste erstellt werden konnte. Auf ihr stehen die Belgierin Helene M. (*1922, Hausgehilfin), die Franzosen Charles A. (*1921) und Rose P. (*1911), die bei Arbeitsbeginn erst 17jährige Italienerin Andrea T. (*1925, Hausgehilfin), die Niederländer Richardus C. (*1921, Student) und Egbert Sch. (*1919, Student), die beiden bereits aus dem Höchster Krankenhaus bekannten Polinnen Antonia und Viktoria M., ferner die Sklovakinnen Juliana S. (*1924, Hausgehilfin) und Paulina T. (*1926, Hausgehilfin) – auch sie war bei Arbeitsbeginn erst 16 Jahre alt. Die Lohnunterlagen für alle diese Arbeitskräfte fehlen. (BW) Q.: PAADJC, Dernbach, Verzeichnis der Niederlassungen 1939-1945; IfSGF, HB Nr. 112, 208, 266. Frankfurt am Main-Nordend: Ursulinen-Kloster St. Ursula Als sehr bedeutender und weltweiter Frauenorden für Erziehung und Unterricht verfügte die „Gesellschaft der hl. Ursula“ seit 1889 auch über eine selbständige Kongregation mit drei Niederlassungen im Bereich der Diözese Limburg. Das infolge Kriegseinwirkung heute nicht mehr bestehende Kloster St. Ursula am Unterweg in Frankfurt am Main war Mutterhaus für die Filialen St. Anna in Königstein, St. Josef in Geisenheim und die noch 1934 bzw. 1938 erfolgten Missionsgründungen in Rezende und São Lourenço (Brasilien). Die drei Internatsschulen für höhere Töchter in Frankfurt, im Rheingau und im Taunus mußten 1940 geschlossen werden. Die Schülerinnenzahlen waren durch staatliche Eingriffe in die Schulwahlfreiheit von Beamtenkindern rapide gesunken, in Frankfurt allein von 1.000 auf 500. Die Schwestern konnten nach langen Verhandlungen in den Niederlassungen Geisenheim und Frankfurt bleiben, wurden aber gezwungen, die Räumlichkeiten für caritative und militärische Zwecke zur Verfügung zu stellen. Die hauswirtschaftliche Verantwortung hatten die Ursulinen aber weiter zu tragen. Die Filiale in Königstein mit der St. Anna-Schule mußte für eine NS-Lehrerinnenbildungsanstalt geräumt werden, die Schwestern kamen in einer Privatvilla unter, wo sie ein kleines Altersheim einrichteten. Über die Spur einer Fremdarbeiterin verfügen wir im Fall der Niederlassung in Frankfurt am Main. Das Kloster am Unterweg 6-16 mit der 1894 erbauten Marienschule wurde nach dem Ende des Schulbetriebes 1940 auf Druck der Stadt in ein Altersheim mit 68 Betten umgewandelt, das Eigentum der Ordensgenossenschaft blieb und in dem die Schwestern, soweit sie „dienstfähig“ waren, für Pflege und Hauswirtschaft zu sorgen hatten. Das Haus diente bis zur Ausbombung im März 1944 zudem als „Unterkunft für Berufstätige und in der Berufsausbildung stehende“, wie die kriegswirtschaftliche „Kräftebilanz“ des Mutterhauses für 1943 angibt. Im Hausstandsbuch für das Kloster ist eine französische „Einsatzarbeiterin“ namens Alberta H. (*1894) aus Orléans erwähnt, von der lediglich folgende Daten bekannt sind: Geboren in Marseille, römischkatholisch, verwitwet, polizeilich angemeldet im Unterweg 6-16 am 1. September 1943. Eine Abmeldung ist nicht nachgewiesen. Ob Alberta H. im Ursulinenkloster gearbeitet hat oder anderswo eingesetzt war, ist bisher nicht zu klären, jedoch können wir davon ausgehen, daß es sich um eine französische Zivilarbeiterin handelt, die bei den Ursulinen zumindest Unterkunft und Verpflegung erhielt. Schwestern und Altenheim wurden nach Zerstörung der Klosteranlage in der Nacht vom 22. auf den 23. März 1944 in die Zisterzienserabtei Marienstatt evakuiert. (JR) QQ.: DAL, 101 Q/1, 563 F/13; IfSGF, HB Nr. 208. Lit.: GOLDMANN; FS Einhundert Jahre Ursulinen; SCHATZ 207f, 280. Frankfurt am Main-Oberrad: Philosophisch-theologische Hochschule Sankt Georgen der Jesuiten Die philosophisch-theologische Hochschule der Jesuiten, Sankt Georgen, wurde mit Beginn des Krieges offiziell geschlossen, durfte aber zu Weihnachten 1939 wieder geöffnet werden. In der Zeit vom Sommersemester 1940 bis zum Wintersemester 1943/44 waren nur zwischen 25 und 35 Studenten (Alumnen, Externe und Scholastiker) eingeschrieben, die wenigen verbliebenen siedelten ab dem Sommersemester 1944 in das Zisterzienserkloster Marienstatt im Westerwald über. Bereits am 3. September 1939 widmete die Stadt Frankfurt den Neubau in ein Städtisches Hilfskrankenhaus um, die Zimmer der Alumnen wurden geräumt. Der Vizerektor berichtete am 14. September 1939: „Der ganze Neubau also, vorläufig abgesehen vom 5. Stock, ist beschlagnahmt. Untergeschoß und 1. und 2. Obergeschoß sind Krankenzimmer mit Zubehör; im 3. Obergeschoß sind die Wohnräume der Schwestern und des Personals. Das 4. Obergeschoß wird für eventuelle Fälle beansprucht. Außerdem ist fast unser gesamtes Bettenmaterial, soweit es nicht von Patres, Fratres und Brüdern gebraucht wird, in Anspruch genommen. Die Kapelle im Neubau ist uns geblieben. Dagegen sind die Speisesäle und der große Hörsaal belegt“. Die erste Einweisung von Lungenkranken stand im Dezember 1940 an. P. Schütt SJ benachrichtigte das Bischöfliche Ordinariat in Limburg am 1. Januar 1941 darüber, daß „unser Haus als Hilfskrankenhaus mit 38 Kranken belegt ist. In den nächsten Tagen und Wochen wird die Zahl der nach hier kommenden Kranken bis auf 300 steigen“. Da weiterer Platzbedarf bestand, mußte im Oktober 1941 zusätzlich das Althaus als Lazarett für verwundete und erkrankte Soldaten abgegeben werden. Nur das Lindenhaus blieb den Jesuiten erhalten. In der Nacht vom 4./5. Oktober 1943 zerstörte ein Großangriff Pförtnerhaus, Lindenhaus, Neubau und Baracke. Das Krankenhaus konnte in solchen Räumen nicht mehr bestehen bleiben. Als im März 1944 die Aufbauarbeiten beendet schienen, vernichtete ein erneuter Angriff alle Mühe – Sankt Georgen war endgültig ein Trümmer- und Trichterfeld geworden. Die Jesuiten, die den Ort nicht verließen, hausten im Kohlenkeller unter dem Neubau, bis sie sich die am wenigsten zerstörten Gebäudeteile herrichten konnten. Folgende Ausländer, die nicht im Zusammenhang mit dem Lehr- und Studienbetrieb standen und auch nicht den Theologen oder anderen Wissenschaftlern zuzurechnen sind, lebten in diesen bewegten Jahren zwischen 1940 und 1945 in der Offenbacher Landstraße 224: der Belgier Marcel-Jean Florent B. (*1920), dessen Tätigkeit mit „Krankenwärter“ angegeben wurde, von November 1942 bis Oktober 1943; der Belgier Petrus C. (1922-1943), der ab Februar 1943 gemeldet war und im Juni 1943 in einem Frankfurter Krankenhaus verstarb; der Jugoslawe Georg Rößler (*1919), Landarbeiter und früherer Tischler, von November 1940 bis März 1941; der Pole Stanislaus T. (*1918), Krankenträger, im September/Oktober 1943 und der Pole Antonin W. (*1921), ab Januar 1941. (BW) QQ.: IfSGF, HB Nr. 1179; DAL, 54 A/1. Lit.: LÖSER 101-132, 243. Geisenheim: Pfarrei Heilig Kreuz Die Stadt Geisenheim war als Standort einiger bedeutender industrieller Anlagen von kriegswirtschaftlicher Bedeutung. In Baracken bei der „Maschinenfabrik Johannisberg“ war von Dezember 1944 bis Kriegsende 1945 ein Außenkommando des Konzentrationslagers Natzweiler/Elsaß untergebracht, das für die Friedrich Krupp Eisenwerke arbeiten mußte. Der CCP spricht von ca. 200 polnischen und ungarischen Juden, STRUCK gibt die Zahl von zuletzt 1.000 polnischen und russischen Fremdarbeitern an. Auf dem Meldebogen der „Kräftebilanz“ vom 31.5.1942 vermerkte Pfarrer Wilhelm Hesse für die Pfarrei Geisenheim einschließlich des Ursulinenklosters St. Joseph neben drei Geistlichen, einem kirchlichen Angestellten und 42 Schwestern die Zahl von 28 beschäftigten Kriegsgefangenen bzw. zum Stichtag 31.5.1941 sogar 30. Es ist bis jetzt nicht zu erhellen, für wen diese Kriegsgefangenen gearbeitet haben. Annehmbar ist ein Zusammenhang mit dem im Kloster eingerichteten Lazarett. Die 1894 gegründete St. Ursula-Schule für höhere Töchter wurde zwar zu Ostern 1940 aufgehoben und als Unterkunft für Rückgeführte aus dem Saarland und Ausgebombte genutzt, die Schwesterngemeinschaft konnte aber bleiben; ein Teil von ihnen war allerdings zur Pflege im Reservelazarett (160 Betten), das Anfang 1942 im Internat eingerichtet wurde, verpflichtet. Weder das Stadtarchiv Geisenheim noch die Pfarrakten im DAL, das Pfarrarchiv oder die Pfarrchronik vor Ort konnten bis jetzt weiteren Aufschluß über Namen, Herkunft oder den genauen Einsatzort der Kriegsgefangenen geben. Hier sind weitere Recherchen notwendig. (JR) Q.: DAL, 116 A/1, 563 F/13 Lit.: CCP 173; STRUCK 278f, 302; SCHATZ 281. Geisenheim: Franziskaner-Kloster Marienthal Von den Niederlassungen der Thüringischen Franziskanerprovinz auf dem Gebiet der Diözese Limburg wurden 1939 das Kloster Kelkheim und das Studienheim Hadamar von der Gestapo aufgehoben. Diese Häuser gehörten der an caritativen Einrichtungen reichen bischöflichen Peter-Joseph-Stiftung, die im März 1939 „aus staatspolizeilichen Gründen“ in die auf NS-Linie getrimmte „Nassauische Volkspflegestiftung e.V.“ umgewandelt und der bischöflichen Einflußnahme vollends entzogen wurde. Das Kloster Bornhofen bei Kamp/Rhein, zum Teil ebenfalls im Besitz der besagten Stiftung, wurde teilenteignet und der Verwaltung eines Gestapo-Kommissars unterstellt, die Brüder unter Bewachung genommen und die Bibliothek von der SS beschlagnahmt. Das Exerzitienhaus St. Josef in Hofheim blieb zunächst in den Händen der Minoriten, mußte aber 1940 an die NS-Volkswohlfahrt zur Unterbringung von Baltendeutschen verpachtet werden und wurde gegen Kriegsende zur Nutzung als Luftwaffenseuchenlazarett doch noch beschlagnahmt. Zahlreiche Ordensangehörige aus den genannten Niederlassungen gerieten in diffamierende Pressekampagnen und kamen wegen angeblicher Sittlichkeitsvergehen oder staatsfeindlicher Predigten zum Teil in längere Haft, darunter der Rektor des Hauses in Hadamar, P. Justus Michel, der für vier Jahre in die Konzentrationslager Oranienburg und Dachau verbracht wurde. Möglicherweise hat die bei den Rheingauern beliebte Wallfahrt das 1873 von den Franziskanern besiedelte Kloster Marienthal vor einschneidenden Maßnahmen der braunen Machthaber bewahrt. Die Kloster- und Wallfahrtskirche gehörte der Fürst von Metternich‘schen Verwaltung, die Baulast lag beim Konvent (Stand: 1936). Der an manchen Sonn- und Feiertagen vierstellige Pilgerzustrom war den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge und veranlasste 1939 sogar Reichskirchenminister Kerrl zu einer Beschwerde bei Bischof Hilfrich über den angeblich politischen Charakter der Marienthaler Wallfahrt. Am 31. August 1943 wurden alle Wallfahrten durch den Landrat des Rheingaukreises aus luftpolizeilichen Gründen verboten. Guardian P. Florentinus Wöbkenberg erreichte allerdings auf dem Verhandlungsweg einen Kompromiß, der eine Begrenzung auf 200 gleichzeitig anwesende Pilger in Marienthal vorsah. Bei diesem „Warnschuss“ blieb es. Es gab keine Hausdurchsuchungen, keine Eingriffe in das Klosterleben, keine Verhaftungen, Prozesse oder sonstige Schikanen. Ab 1943 wurden allerdings in zunehmendem Maße Einquartierungen notwendig, und einige Räume im Kloster mußten für Evakuierte, ein kleineres Altenheim und ausgebombte Ursulinen-Schwestern aus Geisenheim und Frankfurt genutzt werden. Von elf Einberufungen unter den Brüdern abgesehen, blieb der Personalstand des Hauses weitgehend unverändert. An der Ostfront fielen die beiden Klosterköche Br. Winfried Armbrecht und Br. Ignatius Schmutz. Durch die staatspolizeilichen Maßnahmen gegen die Peter-Joseph-Stiftung war allerdings auch Marienthal betroffen, das etwa 4,5 ha Ackerland und Wiesen der Stiftung in Pacht bewirtschaftete, ein gutes Drittel der Liegenschaften des Klosters. Die „Nassauische Volkspflegestiftung“ verkaufte die Grundstücke zwei Jahre später weiter an vier Marienthaler Privatpersonen. Nach dem Krieg und der Wiederherstellung der Stiftung kam es zu einem Vergleich mit den Käufern. 1941 blieben dem Kloster zur Bewirtschaftung nur die etwa 7,6 ha Äcker und Wiesen im Eigentum des Fürsten Metternich, wovon jedoch 3,2 ha wieder weiterverpachtet waren. Die Bewirtschaftung der Klosterökonomie in der Kriegszeit oblag dem Hausknecht Peter Engels. Durch die Klosterchronik können zudem zwei ausländische Arbeiter nachgewiesen werden. Unter dem 15. Januar 1943 ist eingetragen: „(...) Peter Paul G., ein Litauer, ein großer Mann, seiner Figur nach; er ist auch Schriftsteller und Dichter und ist aus Litauen, er ist in Deutschland zugelassen als Hel-fer in der Landwirtschaft und soll hier dem Knecht Peter Engels helfen; Herr G. ist vom Arbeitsamt Rüdesheim a. Rh. uns zugewie-sen worden.“ G. ist vom Interna-tionalen Suchdienst in Bad Arolsen fernmündlich als Zwangsarbeiter bestätigt worden, wenngleich bisher nicht geklärt werden konnte, ob aufgrund der diffizilen landwirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse der Konvent als formeller Arbeitgeber anzusehen ist. Allerdings deutet die Formulierung in der Chronik darauf hin, daß das Kloster als solches vom Arbeitsamt bedacht wurde. Eine Klärung könnte durch Personalakten des Klosters erfolgen, allerdings ist eine Recherche vor Ort bisher noch nicht durchgeführt worden. Ähnlich unklar liegt der Fall des zweiten Arbeiters. Eintrag in der Klosterchronik vom 16. Juli 1943: „Heute erhielten wir als Gehilfe für den Knecht Engels Peter einen tüchtigen jungen Franzosen namens Daniel B., einen soliden Bauernsohn, der sehr anstellig und fleißig ist.“ In der Personalaufstellung der Chronik zu Weihnachten 1943 heißt es weiter: „Unsere Ökonomie, die immer, seit Jahrhunderten zum Kloster Marienthal gehört (...) besorgt der Knecht Peter Engels und ein junger Franzose: Daniel B., aus Frankreich nach Deutschland verwiesen.“ Die Formulierung „verwiesen“ deutet auf einen unfreiwilligen Aufenthalt des Franzosen in Deutschland hin. Möglicherweise wurde er im Zuge der Abkommen mit der VichyRegierung als Zivilarbeiter nach Deutschland gebracht. Er erscheint noch ein letztes mal in einem Eintrag der Chronik vom 31. Januar 1945: „Die Daniels aus der Oster- und Weihermühle und unser Hilfsknecht und Daniel B. trugen den Sarg [des verstorbenen P. Osmund].“ (JR) QQ.: DAL, 561 8/A, 455 A/4-5, 563 F/14; Kloster Marienthal, Chronik (Auszüge). Lit.: HASELBECK 35-45; PFEIFER 144-160; SCHATZ 281f; STRUCK 338f; W INTERHALDER 156-164. Hochheim: Elisabeth-Krankenhaus (Arme Dienstmägde Jesu Christi) Die Niederlassung der Armen Dienstmägde Jesu Christi in Hochheim bestand von 1857 bis 1965. Im Elisabeth-Krankenhaus, einer Einrichtung, die 1936 für die Krankenpflege und das Altersheim insgesamt 67 Betten zur Verfügung stellen konnte, arbeiteten 15 Schwestern. 1943 hielt die Chronik fest: „Für den Garten und Stallarbeiten wurden uns 2 Ukrainer zugewiesen vom Arbeitsamt und für die Baracke (Isolierstation) eine Russin“. Zu diesen drei Personen und der erwähnten Baracke gibt es bislang keine näheren Erkenntnisse. Nach Befragung einer Zeitzeugin durch den Pfarrer von St. Peter und Paul Hochheim, Pfarrer Ch. Wurbs, konnte herausgefunden werden, daß es sich bei den genannten Personen neben der altkatholischen Polin „Kascha“, die in der Krankenhausküche arbeitete, um Johann R. und dessen Sohn Wilhelm R. (*1921 in Stankowa/Ukraine) gehandelt haben soll. (BW) Q.: PAADJC, Dernbach, Verzeichnis der Niederlassungen 1939-1945. Kamp: Josephshaus (Arme Dienstmägde Jesu Christi) 1898 zogen die ersten Dienstmägde Jesu Christi nach Kamp. Sie übten im Josephshaus ambulante Krankenpflege aus, sorgten sich um die Kindergartenkinder und richteten ein Heim für Alte und Kurfremde mit 14 Betten (Stand 1936) ein. Am 18. August 1941 wurde das Gebäude beschlagnahmt zur Unterbringung von infektionskranken Kindern und wenigen Erwachsenen. Den Schwestern, die die Pflege übernahmen, standen als Arbeitskräfte zwischen 1940 und 1945 insgesamt acht osteuropäische Zivilarbeiterinnen zur Verfügung, deren Lohnkarten sich im Provinzarchiv befinden. In der Chronik heißt es: „Am 9.3.1940 schickte uns Herr Bürgermeister eine Polin zu, Hedwig Sch.. Das arme Kind weinte fast Tag und Nacht vor Heimweh, aß fast nichts, sodaß wir fürchteten für ihr Leben. Aber sie kam nicht fort, zuerst mußte sie Geld zur Heimreise zum Arbeits-amt Niederlahnstein schicken. Seit Juni ist sie nun froher und arbeitet leichte Hausarbeiten“. Die junge Polin (*1929) aus Skawaze blieb von März bis Juni 1940 in Kamp. Im Januar 1942 traf die Familie G. aus Gozd-Lipinski in der Ukraine ein: Zofia G. (*1897) und deren Töchter Nadziejda (*1926) und Maria (*1933), der Mann bzw. Vater Andreas G. war in Ransbach in Arbeit und wohnte auch dort. Sie verließen die Schwestern bereits Ende März 1942. Im April 1942 kamen als Arbeitskräfte zwei Slowakinnen aus Lipiany, Bezirk Sabinov: Anna S. (*1921), die im Dezember 1942 Kamp bereits wieder verließ, und Maria S. (*1923), die bis in den Juli 1943 blieb. Noch im Dezember 1942 traf die Winzerin Maria V. (*1889) aus Pyanska bei Gurkfeld/Untersteiermark an der Save bei den Schwestern ein. Ihre Staatsangehörigkeit wurde mit „slowenische Absiedlerin“, „Herkunftsland Kroatien“ und „Schutzangehörige des Reichs“ angegeben. Auch die letzte Arbeitskraft, die in das Josephshaus kam, war „Slowenische Absiedlerin“, Marija Z. (*1900), gebürtig in Hundsdorf-Videm, Bezirk Raren an der Save, sie verließ zusammen mit Maria V. Kamp im März 1945. Alle Frauen waren als landwirtschaftliche Arbeiterinnen beschäftigt. Nach Ende des Krieges war für zwei Monate die Polin Josefa S. (*1921) als landwirtschaftliche Arbeiterin bei den Schwestern. Sie wohnte in St. Goarshausen bei ihrem bisherigen Arbeitgeber. Sie wollte noch einmal nach Polen reisen, um dann – wieder in Deutschland – in der Krankenpflege bei den Schwestern tätig zu werden, ihr Ziel bestand jedoch in der Auswanderung zu Verwandten nach Amerika. (BW) Q.: PAADJC, Dernbach, Verzeichnis der Niederlassungen 1939-1945, Lohnunterlagen. Limburg: Heppelstift (Arme Dienstmägde Jesu Christi) Josef Heppel (1849-1936), einstiger Besitzer der Blechwarenfabrik „Heppels Fabrik“ und seine Frau Sophia (1862-1944), übergaben 1912 einen Teil ihres Wohngebäudes in der Diezer Straße 65 den ADJC zur Errichtung eines Hauses für junge Mädchen und Dienstmädchen. Während des Ersten Weltkriegs standen die Räumlichkeiten für ein Lazarett namens „Heppelstift“ zur Verfügung, die Schwestern pflegten die Verwundeten und Kranken (1917: 278). Hinzu kam die Sorge um die alleinstehenden Mädchen (1918: 23), den Mittags- und Abendtisch für diesen Personenkreis und kurzfristige Übernachtungen. 1915 erweiterte das Ehepaar Heppel den Bau und stiftete zudem die Sophienkapelle. Das gesamte Objekt wurde 1915 in die „Heppelsche Stiftung“ eingebracht. Ab 1919 konnten auch Pensionärinnen aufgenommen werden, teils „junge Fräuleins“, teils ältere Damen. Seit 1939 lebten außerdem Flüchtlinge aus dem Saargebiet im Heppelstift, das Gebäude blieb aber im Besitz der Schwestern. 1940 arbeiteten sechs kriegsgefangene Franzosen mit einem Wachmann in Heppels Park, um dürre Bäume auszumachen und Holz zu spalten. Im Herbst desselben Jahres gruben sie den Garten um. Im August 1942 kam ein ukrainischer Geistlicher, Jaroslaw Polanskyj, ins Haus, der die ukrainischen Zivilarbeiter in den Diözesen Fulda, Limburg und Mainz seelsorglich betreute. Das Gebäude wurde durch Luftangriffe am 16. September und 23. Dezember 1944 unbewohnbar. Nachdem die Amerikaner am 26. März 1945 Limburg eingenommen hatten, versuchten die Schwestern ihre Unterkunft wieder notdürftig herzurichten. Sie wiesen die 30 Russen, die sich in Küche, Kapelle und Sakristei eine vorläufige Wohnung gesucht hatten, erfolgreich aus dem Haus. Vier Polen, die ebenfalls dort Unterschlupf gefunden hatten, blieben und halfen bei der Instandsetzung. Namen und Herkunft sämtlicher im Heppelstift tätigen Personen sind bei den ADJC leider nicht nachweisbar. (BW) QQ.: PAADJC, Dernbach, Verzeichnis der Niederlassungen 1939-1945; DAL, 224 E/1. Lit.: CRONE [2]. Limburg: Kloster Bethlehem (Arme Dienstmägde Jesu Christi) Die erste Niederlassung der Dernbacher Schwestern in der Bischofsstadt lag auf historischem Boden. Auf diesem Grund wurde bereits 1339 eine klosterähnliche Gemeinschaft der Beginen gegründet. 1478 wurde das Haus, das inzwischen von Frauen bewohnt war, die sich dem Dritten Orden der Franziskaner angeschlossen hatten, erstmals „Bethlehem“ genannt. 1817 fiel es der Säkularisation zum Opfer und wurde erst 1882 wieder von den Dernbacher Schwestern besiedelt. Neben der ambulanten Krankenpflege nahmen die Schwestern zunächst zehn alte und kranke Menschen in ihr Kloster auf. 1928/29 riß man Teile des Gebäudes ab und ersetzte sie durch einen Neubau. 1933 versorgten die ADJC 36 alte Menschen im Haus und 428 Personen ambulant. 1941 bis 1945 kochten die Schwestern für französische und russische Kriegsgefangene, die von der Stadt Limburg beschäftigt wurden. Als Entgelt stellte die Stadt dem Haus einen Gefangenen zur Verfügung. Seine Identität war bislang nicht zu klären. (BW) Q.: PAADJC, Dernbach, Verzeichnis der Niederlassungen 1939-1945, Lohnunterlagen. Lit.: CRONE [1]. Limburg: Missionshaus der Pallottiner Nach Anfangsjahren im Walderdorffer Hof entstand in den Jahren 1896/98 das Missionshaus der Pallottiner an der Wiesbadener Straße 1. Es beherbergte die Provinzleitung, die theologische Hochschule, Werkstätten, die Druckerei, eine Landwirtschaft und eine Gärtnerei [Abb. 9]. 1925 wurde der Seminarbau und 1927 die Kirche St. Marien errichtet. Zum Missionshaus der Pallottiner gehörten vor dem Ausbruch des Krieges (Stand 1. Januar 1939) 44 Patres, 110 Theologen, 147 Brüder und 35 Novizenbrüder. Sie wohnten alle in der Wiesbadener Straße 1. Von ihnen wurden bis 1945 56 in Haft genommen, davon 8 in Konzentrationslagern. An der Front fielen 14 Patres, 53 Theologen, 50 Brüder und eine große Zahl von Postulanten und Schülern. Rektor P. Bange berichtete in seinen Erinnerungen an die Kriegszeit vom Beginn der Beschlagnahmung: „Es war am Samstag vor Kriegsbeginn, abends vielleicht 19.08 Uhr, als ich in Vertretung des abwesenden P. Rektors Wenzel ans Telefon gerufen wurde. Der Kreisarzt, Medizinialrat Dr. Lapp machte mir da amtlich bekannt, daß unser Haus binnen 24 Stunden die Räume des Seminarbaus – er nannte sie alle der Nummer nach – freizumachen habe und sie als Hilfskrankenhaus einrichten müsse. Das Vinzenzhospital sei Lazarett geworden, wir müssten sämtliche Zivilkranke aufnehmen. Ganz unvorbereitet traf uns die Beschlagnahme nicht. Schon ein Jahr vorher, als wegen der Besetzung des Sudetengebietes ein Krieg drohte, hatte man das Haus besichtigt und das Seminar als Hilfskrankenhaus vorgesehen. Da damals bereits mit einem Krieg zu rechnen war, hatten P. Jung und ich einen genauen Plan für die Verlegung ausgearbeitet (...) sodaß wir nicht 24 Stunden brauchten, um die gewünschte Räumung zu vollenden“. Die Unterbringung des Vinzenz-Hospitals mit zunächst 150 Betten war vertraglich mit der Stadtverwaltung geregelt. Die Pallottiner übernahmen für das Hilfskrankenhaus die gesamte Leitung, Verwaltung und Verantwortung auf eigene Kosten. Die Pflege stand unter der Oberleitung von Schwester M. Praxedes, der Oberin der Pallottinerinnen, die ärztliche Behandlung übernahm Chefarzt Dr. Bremer. Die Leitung des Vinzenzhospitals lag nach wie vor in den Händen des Verwaltungsrates, an dessen Spitze Stadtpfarrer Geistlicher Rat Heinrich Fendel als Vorsitzender stand. Dem Verwaltungsrat gehörten weitere neun Mitglieder und der Ehrenvorsitzende, Bischof Antonius Hilfrich, an. Zu Beginn des Jahres 1941 nahm die Arbeit überhand – vor allem weil inzwischen viele Brüder im Feld standen –, und die Pallottiner sahen sich nach eigenen Angaben gezwungen, Kriegsgefangene einzustellen, nicht zuletzt, um die fast 58 Hektar Land des Klosters zu bewirtschaften. Zunächst mußten sie in der Frühe im Stalag in Freiendiez geholt und am Abend zurückgebracht werden. Anfang Februar 1941 verhandelte Rektor P. Bange mit der Lagerleitung mit dem Erfolg, daß in den Noviziatsräumen das Gefangenenlager „1176“ mit eigenem Wachkommando eingerichtet wurde. 50 französische Kriegsgefangene, von denen die Hälfte bei den Pallottinern arbeiteten, lebten nun im Kloster. Im Juni wurden alle Fenster mit Eisenstäben versehen und trotzdem flohen im März 1942 zwei der Gefangenen. Arbeit fanden die Franzosen u.a. in der Bäckerei und der Druckerei. Am 24. Juli 1941 hielt die Gestapo Einzug im Missionshaus, sie versiegelte Büros und Werkstätten. Br. Alfred Rochat wurde für zwei Tage festgenommen, da er im Beisein der Kommissare einen französischen Gefangenen in dessen Muttersprache anredete und brieflich aufgetragene Grüße an zwei weitere Franzosen, „Jean“ und „Olivier“, weitergab. Im Dezember 1941 gab Br. Alois Hamm, ein Krankenwärter im Hilfskrankenhaus, einem Jungen mehrere Heiligenbildchen – dies galt als religiöse Betreuung und Hamm wurde von der Gestapo für drei Wochen ins Limburger Gefängnis gebracht. Von Frühling bis Weihnachten 1942 kehrten die beiden italienischen Zivilarbeiter „Rafaelo“ und „Johann“ zur Arbeit in das Limburger Haus zurück. Zwischen August und dem Jahresende 1942 wurden verschiedene Maßnahmen zur Erhöhung der Bettenzahl vorgenommen: Hinter dem Papierlager der Druckerei errichtete man je eine Baracke für ausländische Kranke und zur Erweiterung der Isolierstation, ferner wurden alle Patreszimmer auf dem Gang des Provinzialates und der Brüdersaal mit Kranken belegt. Im Dezember 1942 sah die Gestapo weitere Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten der Pallottiner gegenüber den französischen Kriegsgefangenen. Auslöser war offenbar Br. August Hindel. Er besaß einen wertvollen Photoapparat, den er dazu nutzte, gegen Bezahlung Aufnahmen der Franzosen in der Wiesbadener Straße herzustellen. Dieser Nebenverdienst kam durch Neider im Stalag Freiendiez ans Licht, die sich schlechter behandelt fühlten. Br. Hindel wurde verhaftet und mußte seinen Apparat „freiwillig“ abliefern. Bei der sich anschließenden Kontrolle des Kriegsgefangenenlagers fiel der Gestapo das Tagebuch eines französischen Theologiestudenten in die Hände. Der Vorwurf der Gesprächskontakte zu den Gefangenen erhob sich erneut: Br. Hugo Stöckler und Br. Michael Preisinger wurden deswegen zu Gefängnisstrafen verurteilt, P. Josef Lucas und Br. Josef Wendling kamen mit Verhören davon. Acht der französischen Kriegsgefangenen wurden ins Stalag zurückbeordert und durch drei neue Männer ersetzt. Im Februar 1943 wurden auf Betreiben der Gestapo alle französischen Kriegsgefangenen bei den Pallottinern entfernt und durch 20 russische Kriegsgefangene ersetzt. Diese sahen elend und verhungert aus und waren zur Arbeit kaum fähig. Provinzial Heinrich Schulte beschreibt die Situation im Haus am 27. Februar 1942 in einem „Familienbrief“ an die verstreuten Pallottiner: „Schwer wird es nur im Lauf der Zeit, mit all den vielen fremden Arbeitskräften das Krankenhaus und die Betriebe richtig in Gang zu halten. Die Bewohnerschaft bietet ein nie dagewesenes buntes Bild. In allen Betrieben, bis in den Garten und die Ökonomie hinein, arbeiten Angehörige jeden Standes, Grades, Geschlechtes und sogar verschiedener Nation, wenn man die russischen Kriegsgefangenen und angestellten Zivilarbeiter noch hinzuzählt: ein rechtes Kriegsbild. Es ist anormal, aber nicht zu ändern“. Das Bild erhielt noch eine weitere Facette, als in ein Zimmer des Ökonomieschlafsaales im Juli 1943 ein Ostarbeiter-Ehepaar einzog. Im November 1943 fand der erste Betriebs-Appell durch die Deutsche-Arbeits-Front für die Gefolgschaft des Hilfskrankenhauses – auch für die Ordensschwestern und Brüder – statt, der Redner verlangte Haß gegen alle Menschen, die nicht Deutsche seien. Im April 1944 wurden alle Pallottiner, die nicht im Krankenhaus arbeiteten des Missionshauses verwiesen. Der Vizeprovinzial Josef Friedrich gab am 29. April 1944 bekannt, daß für die im Haus verbleibenden Brüder in Sachen der Disziplin der Vizerektor P. Andreas Stock (Pfarrer von St. Marien) und für die Arbeitsangelegenheiten der Geschäftsführer des Hilfskrankenhauses P. Bernhard Kolberg zuständig wäre. P. Kolberg legte am 1. Mai die neuen Bestimmungen betreffs der Dienstverpflichtung für die 20 noch im Haus beschäftigten Brüder dar. In der Zeit zwischen Frühsommer 1944 und dem Kriegsende wechselte der Bestand an Arbeitskräften häufig. Mitte Mai 1944 stellten die Pallottiner für den Schweinestall einen lettischen Arbeiter mit Frau und zwei Kindern ein, die gemeinsam auf der Kegelbahn über dem Refektorium wohnten. Keine zwei Wochen später wurde der Schlafsaal der Ökonomie mit Ostarbeitern belegt. Einen knappen Monat später erfolgte ein Anruf vom Arbeitsamt, die russischen Kriegsgefangenen würden alle weggeholt und durch andere Arbeitskräfte ersetzt. Die Russen hatten sich wohl sehr gut im Missionshaus eingelebt, sie feierten ihren Abschied bis spät in die Nacht mit Gesang und Schnaps, den sie heimlich aus Bierhefe im Schweinestall gebrannt hatten. Das Wachkommando „1176“ wurde damit aufgelöst. Statt der Russen wies das Arbeitsamt am 21. Juni 1944 eine polnische Großfamilie aus der Gegend von Posen zu. Die vier Männer, vier Frauen und zwei Kinder fanden im Noviziat Unterkunft. Einen Tag später reiste eine weitere Familie zur Arbeit in der Landwirtschaft an: Eine Mutter mit sechs z.T. bereits verheirateten Kindern, drei Söhnen und drei Töchtern, außerdem einem Schwiegersohn. Der eine der Brüder erkrankte nach einigen Wochen, und kam nach Angaben der Hauschronik von Br. Wendling „nach einiger Zeit nach Hadamar und wurde dort nach vier Wochen beseitigt und verbrannt, ohne daß seine Mutter oder einer seiner Brüder ihn in Hadamar noch einmal sprechen durfte“. Vom Stalag wurden für landwirtschaftliche Arbeiten außerdem 23 kriegsgefangene Italiener zugewiesen. Im September nahm in der Ökonomie eine Sanitätskompanie Quartier und zwei Wochen später, am 9. Oktober 1944 wurde die Aula mit 60 französischen Kriegsgefangenen belegt, ein größerer Teil von ihnen war von Beruf Dachdecker. Die Facharbeiter kamen am 29. Januar 1945 von Limburg fort auf ein anderes Kommando, die verbliebenen gingen am 17. April 1945 zurück nach Frankreich. Einige Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene kehrten noch einmal in die Wiesbadener Straße zurück, nachdem der Krieg mit dem Einmarsch der Amerikaner am 26. März in Limburg beendet war. Ehemalige Kriegsgefangene aus Rußland logierten sich im Noviziat bei den Polen ein, unter ihnen auch „TraktorIwan“, der zwischenzeitlich in ein Lager bei Trier gebracht worden war und Safron und Simon, deren Arbeitsplätze sich in Schweinestall und Garten befunden hatten. Einer der früheren französischen Kriegsgefangenen, der Schmied Louis, wurde mit einem Oberschenkelschuß ins Krankenhaus eingeliefert, noch im Gips liegend, reiste er am 8. Mai mit einem der zahlreichen Transporte gen Heimat. Auch die bis zuletzt in Haus und Landwirtschaft tätigen Ausländer zogen im April und Mai 1945 davon: Die „dienstverpflichteten“ Franzosen „Alex“ und „Herr und Frau Kunz“, der polnische Arbeiter „Kasimir“ vom Kesselhaus und weitere nicht näher bezeichnete Polen und Ostarbeiter. Die letzten Polen gaben am 14. Juni 1945 das Noviziat, „abgesehen von Wanzen und übrigem Ungeziefer“ frei und nahmen einen Zwischenaufenthalt in einem Lager bei Niederlahnstein. Die ehedem kriegsgefangenen Russen wurden alle gesammelt und im Stalag untergebracht. Für die nach Mitte April 1945 noch in Arbeit stehenden ausländischen Arbeiter, Polen und drei Italiener, legten die Amerikaner Arbeitszeiten fest: von 8-12 und von 13-17 Uhr. Bis zum Spätsommer 1945 verließen die letzten Ausländer das Missionshaus: drei „italienische Arbeiter“, drei „weibliche Angestellte“, die in der Gärtnerei gearbeitet hatten und der Lettländer mit seiner Familie, die in einem Lager in Wiesbaden aufgenommen wurden. Ausländer, die sich nun frei bewegen durften, plünderten nach Kriegsende alles, dessen sie habhaft werden konnten: Bahnwaggons mit Heeresgut (Stoffe, Schuhe, Lebensmittel etc.). Die Ostarbeiter und Polen, die bei den Pallottinern in Garten und Landwirtschaft beschäftigt waren, streikten zeitweilig. Fleißig waren sie jedoch beim Räubern der Beute, die die Gestapo für den persönlichen Gebrauch in den versiegelten Räumen des Missionshauses untergebracht hatte. Es wurde im Haus derart turbulent, daß die amerikanische Polizei zum Schutz geholt wurde. Bruder Wendling berichtete Anfang Mai 1945 noch eine weitere Begebenheit: „Die Russen waren besonders scharf auf Taschenuhren, sie frugen die Leute wie spät es sei und wenn diese dann die Uhr hervor holten, so nahmen sie ihnen diese gewaltsam weg. Als der alte Herr Generalvikar Göbel, bei einem Spaziergang auf dem Schafsberg, auch auf diese Wiese gefragt wurde, wie spät es sei, wehrte er lächelnd mit der Hand ab und sagte: nein, nein, lassen sie das, das kennen wir schon, und zog keine Uhr heraus. Ordnung und Sicherheit bestand keine mehr.“ Eine einzige Zwangsarbeiterin ist uns mit vollem Namen bekannt geworden. Es handelt sich um die Ärztin Walentina R., die von Chefarzt Dr. Bremer eingestellt wurde. Nach Kriegsende mußte Bremer als Mitglied der NSDAP das Spruchkammerverfahren zur Entnazifizierung durchlaufen. Sein Anwalt hielt im Juni 1946 folgendes Plädoyer: „Mandant hat die russische Ärztin R. als vollwertige Assistentin behandelt, die auch bei vielen Operationen Deutscher assistierte und leichte Operationen allein ausführte. Ohne Rücksicht auf die ihm persönlich erwachsenden Schwierigkeiten durch die im gleichen Haus wohnende Gestapo setzte er sich mit Erfolg für die Ärztin ein, als diese am 14.5.1944 verhaftet wurde, wenn er auch die nach 4 Monaten erfolgte 2. Verhaftung nicht mehr rückgängig machen konnte“. Dr. Bremer wurde am Ende des Verfahrens in Gruppe V eingestuft, d.h. entlastet. Nach Aussage einer weiteren damaligen Assistenzärztin, Dr. Gisela Lang, hat R. seit 1943 trotz ausdrücklichen Verbotes fast täglich bei Operationen teilgenommen, auch weil Dr. Bremer ihr die Gelegenheit zur Weiterbildung geben wollte. Am 17. Oktober 1944 wurde Walentina R. zum zweiten Mal von der Gestapo verhaftet und nach einem Zwischenaufenthalt in Frankfurt in das Arbeitserziehungslager Hirzenhain gebracht. Der Grund der Verhaftung liegt noch im Dunkeln. Sie konnte mit Hilfe einer deutschen Freundin, Katharina Kremer aus Niederbrechen, am 25. März 1945 fliehen und kehrte am 6. April 1945 in das Hilfskrankenhaus zurück. Dr. Bremer stellte sie unverzüglich wieder ein. 87 Mitgefangene von R. wurden am 26. März 1945, vier Tage bevor die amerikanischen Truppen Hirzenhain erreichten, von der SS ermordet. Wohl auf Veranlassung von Walentina R. prüften amerikanische Offiziere den sanitären und hygienischen Zustand der Baracken, die mit kranken Ausländern belegt waren. Die Besatzer verfügten daraufhin eine Räumung der Baracken und eine Unterbringung im Hauptgebäude, selbst wenn dort deutsche Patienten weichen müßten. Auch die Qualität und die Menge des Essens sollte erhöht werden. Rektor P. Bange konnte diese Maßnahmen nicht akzeptieren. Er war der Meinung, daß diese Anordnung nur auf die Beschwerde eines einzelnen beinamputierten Polen zurückging und alle anderen „viel lieber in den Baracken blieben. Denn im Hause mußten sie Ordnung und Sauberkeit annehmen“. Wegen der Gefahr, mit den Ausländern auch Läuse und Wanzen ins Haus zu bekommen, stand Bange mit dem Vorsitzenden des Kuratoriums für das Vinzenzspital, Stadtpfarrer Fendel, und Dr. Tenkhoff, dem Chefarzt des Spitals, in Kontakt. Diese wandten trotz entsprechender Eingaben die Maßnahme nicht ab, die Verlegung erfolgte am 15. Mai 1945. Die russische Ärztin blieb dem Krankenhaus bis zum 9. Juni 1945 erhalten. Sie reiste dann, ausgestattet mit Zeugnissen von Dr. Bremer, mit unbekanntem Ziel ab. Ein erster Schritt zurück zur Normalität war die Wiedererrichtung des Missionshauses am 4. April 1945. P. Wilhelm Bange übernahm als Rektor die Geschäfte, P. Bernhard Kolberg fungierte als Prokurator. Das Hilfskrankenhaus befand sich nun im Missionshaus. Von dort verlegte man im Juni und Juli 1945 noch nicht genesene Ausländer in das Limburger Schloß, erhielt dafür aber Kranke, die von Balduinstein hierher gebracht worden waren. Die Baracke mit der Isolierstation vor allem für Scharlach- und Diphteriekranke blieb noch bis Juni 1946, die im Haus befindliche Isolierstation bis im September 1946 bestehen. Zu den bei den Pallottinern beschäftigten Männern und Frauen gibt es bislang keine weiteren Angaben, nicht zu den Zahlen und auch nicht zu den Namen und der Aufenthaltsdauer. Lohnunterlagen, polizeiliche Meldeunterlagen etc. sind im Provinzarchiv nicht vorhanden oder noch nicht gefunden worden. (BW) QQ.: HHStAW, Abt. 520 WA 7885 (191); DAL, 561 8/A; PASAC, Limburg, Provinzialatsakten, Dokumentationen von Br. Josef Wendling SAC, P. Wilhelm Bange SAC, P. Wilhelm Schützeichel SAC, Familienbriefe des P. Provinzials, NL Br. Alfred Rochat SAC [sämtliche Bestände unverzeichnet]. Lit.: DIAMANT 295; FENDEL; SCHATZ, 286f; SCHÜTZEICHEL; SKOLASTER 85-93, 209-211. Limburg: Mutterhaus Kloster Marienborn (Pallottinerinnen) Noch bevor die Pallottiner mit der Mission in Kamerun begannen, stand fest, daß ein Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Errichtung von Schulen gelegt werden mußte. Durch Vermittlung von P. Kugelmann SAC im Generalat in Rom nahm die eigens dafür zu gründende Kongregation der deutschen Missionspallottinerinnen im Frühjahr 1895 ihren Anfang in Limburg. Der Bischof von Limburg, unter dessen Jurisdiktion die Schwestern stehen sollten, und die preußische Regierung hatten im Oktober 1894 dazu ihr Einverständnis erklärt. Bischof Dominikus Willi genehmigte 1901 die Konstitutionen. Nachdem die Pallottinerinnen ihre erste Bleibe in einer Mietwohnung in der Diezer Straße 86 gefunden hatten und zeitweilig auch im Walderdorffer Hof der Pallottiner wohnten, konnte im Jahr 1900 unter großen finanziellen Schwierigkeiten das bis heute bestehende Mutterhaus der Kongregation „Kloster Marienborn“ in der Weilburger Straße 5 errichtet werden [Abb. 10]. 1925 bis 1927 wurde daran das Exerzitienhaus angebaut, um dort Exerzitienkurse für die Ordensschwestern sowie für Frauen und Mädchen durchzuführen. Die Schwestern in den USA halfen bei der Finanzierung mittels eines zinspflichtigen Darlehens. Da Zinszahlungen ins Ausland als „Devisenvergehen“ betrachtet wurden, wiederholten sich nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten Haussuchungen der Gestapo, die Gründe für die Auflösung des Hauses suchte. Aus den Lohnunterlagen läßt sich entnehmen, daß die Pallottinerinnen ab Sommer 1940, wenigstens zeitweilig, Kriegsgefangene in ihrem Mutterhaus in der Weilburger Straße 5, beschäftigten. Die drei französischen Gefangenen Albert E., Unteroffizier Arthur T. und Unter-Feldwebel Jean J. waren seit dem 17. bzw. 22. Juni 1940 dort in Arbeit, ohne Unterbrechung auf jeden Fall seit Januar 1942. Es herrschte dennoch ein Übermaß an Arbeit. In der Chronik des Klosters Marienborn heißt es am 9. September 1940: „Wir brauchen notwendig eine männliche Arbeitskraft für Garten und Feld, da unsere bisherige Landhilfe (Albert) schon seit Ende August 1939 im Heeresdienst steht. Am Festtage kam nun vom hiesigen Arbeitsamt die Nachricht, daß es uns einen 17-jährigen polnischen Zivilgefangenen zugewiesen habe. Bald stellte Wladislaus, genannt Wladek, sich auch ein. Er freut sich, daß er bei Schwestern arbeiten kann“. Der Katholik Wladislaus M., geboren 1923 in Wola Milkowska, Kreis Jureck/Polen, blieb bis zum 30. April 1945 als Landhelfer im Klostergarten bei den Schwestern. Über die Beschäftigung von weiteren französischen Kriegsgefangenen berichtet die Chronistin am 23. Oktober 1940: „Im letzten strengen Winter sind uns mehr als 30 Obstbäume erfroren, die der junge Pole nicht ausgraben kann. Wir baten deshalb um französische Kriegsgefangene, die heute zu dritt kamen und sämtliche erfrorene Obst- und Zierbäume im Exerzitienhausgarten ausroden werden“; dann wieder am 30. Januar 1941: „Wir haben jetzt auch wieder zwei französische Kriegsgefangene zur Hilfe in Feld und Garten bekommen“. Einige Schwestern, unterstützt von P. Knoche SAC, unterbreiteten der Generaloberin M. Aquina Klär SAC 1941 den Vorschlag, das Haus dem Militär als Lazarett anzubieten, um es so vor Enteignung zu schützen. Sie gab ihre Zustimmung und der Limburger Domvikar Will fuhr nach Wiesbaden, um dort mit der Sanitätsbehörde des XII. Wehrkreiskommandos direkt zu verhandeln. In der Chronik des Hauses heißt es: Am 8. August 1941 „(...) erhielten wir die Nachricht, daß unser Haus (Mutterhaus und Exerzitienhaus) von der Wehrmacht beschlagnahmt und als Lazarett vorgesehen sei. Am 15. bereits soll es eröffnet werden, vorerst mit 100 Betten. Also begann am folgenden Tag ein großes Räumen und Ausziehen (...) Mehrere französische Kriegsgefangene kamen, um uns beim Transport der schweren Möbel zu helfen“. Die Namen der Gefangenen, die in den Jahren 1941/42 im Kloster für die Pallottinerinnen gearbeitet haben, sind bislang nicht alle bekannt geworden. In den nächsten Tagen und Wochen blieb die Situation kritisch. Die Gestapo hatte immer noch die Absicht, Marienborn zu besetzen, die arbeitsfähigen Schwestern in Arbeitslager zu bringen und die Gemeinschaft aufzulösen. Oberstabsarzt Nikol kam den Schwestern zur Hilfe. Er verpflichtete 14 Krankenschwestern und 10 Hilfsschwestern zum Kriegshilfsdienst in der Verwundetenpflege. Damit wurden sie Angehörige der Wehrmacht und waren berechtigt, eine gestempelte Armbinde mit rotem Kreuz zu tragen. Auch alle anderen Schwestern fanden Arbeit im Haus und waren so vor dem Zugriff des Arbeitsamtes sicher. Die Situation im Lazarett gestaltete sich besonders schwierig, da in räumlicher Enge und ungeeigneten Räumen schwerkranke Menschen gepflegt werden mußten. Während der zahlreichen Luftalarme und Bombenangriffe galt es, alle Kranken aus den oberen Geschossen in die Kellerräume und nach der Entwarnung wieder hinauf zu tragen. Von Anfang Juni 1942 bis zum 24. Juli 1943 kam zur Unterstützung der im Stalag Diez untergebrachte – wohl französische – Kriegsgefangene Georges M. täglich in die Weilburger Straße 5. Zu seiner Person wie auch zur Art seiner Beschäftigung kann noch nichts berichtet werden. Im Oktober 1943 ändert sich die Lage der Kriegsgefangenen. „Die bisher in deutschen Betrieben beschäftigten französischen Kriegsgefangenen nennt man jetzt ‚beurlaubte Kriegsgefangene‘. Als solche dürfen sie Zivilkleider tragen und eine Zivilwohnung beziehen. Sie empfangen Lohn und haben Freiheit wie jeder deutsche Angestellte. Unsere drei Franzosen Artur, Albert und Johann bleiben weiterhin bei uns; z.T. wohnen sie im Zimmer über der Remise, während der polnische Landarbeiter Wladek in seinem Zimmer über der Waschküche bleibt.“ Alle drei Franzosen sind den Schwestern schon seit 1940 bekannt: Artur T., katholisch, aus Le Havre, geboren 1902 in CondéFolie/Frankreich, seit 1933 verheiratet und Albert E., katholisch, aus Paris, geboren 1900 in Genf/Schweiz, seit 1939 verheiratet. Diese beiden waren als Kriegsgefangene aus Staffel zugeteilt und wohnten ab 1943 auf dem Klostergelände. Jean Ch., katholisch, aus Ronchin (Nord), geboren 1905 in Fretin (Nord), seit 1933 verheiratet, kam aus Diez und wurde 1943 in der Westerwaldstraße untergebracht. Bei allen wurde als Beruf „Erwerbsgärtner“ angegeben. Als die Kriegshandlungen am Niederrhein zunahmen und ganze Ordenseinrichtungen evakuiert wurden, kamen am 14. Oktober 1944 mit den Schwestern auch deren Zivilarbeiter mit nach Limburg: „Unsere Schwestern brachten aus dem Teil-Lazarett Christinenstift (Gereonsweiler bei Aachen) einen (...) Ukrainer – Constantin – und ein polnisches [sic] Dienstmädchen – Nadja mit Namen – mit, die wir, falls das Arbeitsamt dazu die Erlaubnis gibt, in unserem Lazarett beschäftigen werden“. Die Genehmigung wurde offenkundig erwirkt. Nadja K., 1925 in Gorlowka/Ukraine geboren, stand bis zum Jahresende 1944 auf der Lohnliste der Pallottinerinnen. Der ebenfalls aus der Ukraine stammende Konstantin G. (*1923) aus Stalino hingegen blieb bis März 1945. Er konnte aber nicht wie erhofft, im Lazarett beschäftigt werden, sondern übernahm Tätigkeiten als Landhelfer. Mit dem Kriegsende, nach Einzug der Amerikaner in Limburg, endete der Arbeitseinsatz der Zivilarbeiter im Kloster Marienborn am 27. März 1945: „Alle ausländischen Arbeiter, also auch unsere drei Franzosen Albert, Artur und Jean sowie der Ukrainer Konstantin und der Pole Wladek mußten sich bei der amerikanischen Behörde melden und wurden freigegeben. Morgen wollen unsere französischen Gartenund Küchenhilfen den Rückweg in ihre Heimat antreten“. (BW) Q.: PASACSr, Limburg, Chronik des Klosters Marienborn, Bd. 4, 56, 58, 65, 73, 145, 216, 275, Lohnunterlagen des Klosters Marienborn. Lit.: Ein jeder bedenke 40f; HORSMANN; LAU; SCHATZ 208; SKOLASTER 75-84; Unser gemeinsamer Weg 184-186. Limburg: Bischöfliches Priesterseminar Das Seminar für den sog. praktischen Kurs wurde 1829 unter Bischof Brand in den Räumen des säkularisierten Franziskanerklosters gegründet. Der bis heute in der Weilburger Straße 8 auf der anderen Lahnseite gegenüber dem Dom befindliche geräumige Neubau, 1929-1931 nach Plänen der Architekten Böhm und Rummel errichtet, trug der seinerzeit kontinuierlich steigenden Zahl der Priesteramtskandidaten Rechnung. Der Gebäudekomplex stand im Eigentum des Bistums-Dotationsfonds [s. Abb. 10, S. 64]. Limburg wurde früh in das Geschehen des Zweiten Weltkrieges einbezogen. Durch die Lage an der neuen Autobahn Köln-Frankfurt war die Bischofsstadt wehrstrategisch bedeutend. Während der ganzen Kriegszeit diente das Priesterseminar neben anderen größeren Einrichtungen der Stadt als Heeresunterkunft und „Teillazarett“. Schon vor Beginn der Kriegshandlungen wurden am 25. August 1939 für gut einen Monat 80 Wehrmachtsangehörige einquartiert. Regens Wilhelm Pappert notierte damals für seine Handakte: „Am 25.-26.8.1939 nachts kamen mit Ausnahme der Offiziere in zivil die Mannschaften eines zusammenzustellenden Feldlazaretts. Auch etwa 20 Fahrzeuge wurden angefahren. Am Sonntag, dem 27.8. erfolgte die Einkleidung. Am gleichen Tage war nachmittags in unserem Speisesaal die Vereidigung auf den Führer.“ - Bis zum Frankreichfeldzug im Sommer 1941 wurden weitere 180 Soldaten, teils Wachpersonal für das Inland, teils Angehörige der Flak-Kampfgruppe Lahntal, im Priesterseminar untergebracht. Sicher aus Vorsicht gegenüber möglichen Enteignungsabsichten von Staats- und Parteistellen erschien es Bischof Hilfrich ratsam, von sich aus im Mai 1941 dem Rüstungsinspekteur im Wehrkreis XII die dauerhafte Einmietung des Heeres anzubieten. Mit Wirkung vom 20. Juli 1941 kam es zu einer vertraglichen Übereinkunft zwischen dem Bischöflichen Ordinariat und dem Wehrkreiskommando XII nach § 27 des Reichsleistungsgesetzes. Das Priesterseminar wurde als „Teillazarett“ mit 120 Betten eingerichtet. Das Gebäude konnte somit in kirchlicher Trägerschaft bleiben und - mit räumlichen Einschränkungen - für seinen eigentlichen Zweck weiter genutzt werden. Zwischen 1940 und 1944 wurden allerdings nur zwölf Alumnen in Limburg zu Priestern geweiht, denn die meisten Kandidaten waren zum Kriegsdienst eingezogen. Auch die Dernbacher Schwestern, die seit 1895 im Gestellungsvertrag für die Haushaltsführung des Seminars zuständig waren, konnten im Haus bleiben. Die Personalnachweisungen aus der „Kräftebilanz“ 1943 zeigen, daß zu dieser Zeit 13 Arme Dienstmägde in Hauswirtschaft und Krankenpflege tätig waren. Für den Einsatz des Pflegepersonals trug die Wehrmacht die Verantwortung. Ein Oberarzt, ein Assistenzarzt, zwölf Rot-Kreuz-Schwestern und neun Ordensschwestern sorgten für die Verwundeten. Für die Bewirtschaftung des Hauses (Nahrungsmittel, Heizung, Beleuchtung, Strom, Wasser, Wäsche und Bauunterhaltung) hatte nach dem Vertrag der „Anstaltsträger“, das Priesterseminar, zu sorgen; für jedes belegte Bett zahlte die Wehrmacht RM 2,50 pro Tag. In den Aufzeichnungen von Regens Pappert, der auch als Lazarettpfarrer fungierte, findet sich folgender Vermerk: „Ab 20. Juli 1941 wurde das Haus (...) als Teillazarett des Reserve-Lazarettes Limburg in Gebrauch genommen, wobei der II. Stock des sog. Schwesternflügels seinem Zweck (nebst der Kapelle und Bibliothek) erhalten blieb. Es wurden 120 Betten, später nach Einbeziehung des Raumes der Handbibliothek 140 Betten aufgestellt für leichte und mittlere Fälle.“ Von April bis Juli 1941 waren außerdem noch fünf Räume als Büro und Depot für das nahe Limburg gelegene Stalag XII A (Diez) in Benutzung. Von dort waren im Priesterseminar auch zwei kriegsgefangene Franzosen zu Hilfsarbeiten eingesetzt: der Volksschullehrer Guy G. aus Tilly sur Meuse im Département Meuse (*1915) und Edmond B., von Beruf Handelsdirektor in einer Seidenfabrik in Lyon (*1910). Die beiden Franzosen pflegten die Parkanlage des Priesterseminars und bestellten den Feld- und Gemüsegarten für den Küchenbetrieb. Für den Garten trug als gelernter Fachgärtner der vermutlich aus Frankfurt-Sankt Georgen gekommene Jesuitenbruder Julius Kox die Verantwortung, der, schon weit über 60 Jahre alt, im Priesterseminar als Aushilfe von der Wehrmacht dienstverpflichtet war. Offenbar im Zuge der zwischen Sauckel und der Vichy-Regierung ausgehandelten „transformation“ wurden die beiden Gefangenen im Sommer 1943 in den Zivilarbeiterstatus überführt. Dieses für die deutsche Seite günstige Abkommen beinhaltete den „freiwilligen“ Transfer ziviler französischer Arbeitskräfte in das Reich. Als Gegenleistung wurden französische Kriegsgefangene „beurlaubt“, die allerdings nicht nach Frankreich zurückkehren konnten, sondern in ein „reguläres“ Arbeitsverhältnis kamen. Die beiden Arbeiter wurden jetzt zwar für ihre Tätigkeit entlohnt, konnten sogar Erspartes bis zu einem bestimmten Betrag über ein Sammelkonto der Auslandsabteilung der Deutschen Bank in Berlin in die Heimat überweisen und durften am Arbeitsplatz wohnen. Allerdings entbehrten sie jetzt auch den letzten Schutz der Genfer Konvention und galten gegebenenfalls im Herkunftsland als Kollaborateure. Zwischen der Hausleitung und den Franzosen bestand offenbar ein gutes Verhältnis. Nach der Erinnerung einer Schwester kamen die beiden Männer Ende der 80er Jahre noch einmal zu Besuch. Dabei soll einer geäußert haben: Wenn er morgens vom Stalag ins Seminar gekommen sei und das große Kreuz in der Eingangshalle erblickt habe, dann wäre es ihm sofort besser gegangen. Er habe sich auch noch genau erinnern können, welche Bäume er gepflanzt hatte. Ob die beiden noch leben, konnte bis dato nicht festgestellt werden. Nach Kriegsende übernahmen die Amerikaner das Seminar und richteten ihrerseits ein Lazarett ein. Der Bischof erreichte, daß die Dernbacher Schwestern im Haus bleiben konnten und ihre Klausur nicht besetzt wurde. Sie halfen dann bei der Pflege amerikanischer Soldaten und der aus dem Stalag Diez entlassenen kranken russischen Kriegsgefangenen. Am 12. November 1945 wurde das Haus wieder seinem ursprünglichen Zweck übergeben. (JR) Q.: DAL, Bestand Priesterseminar „Korrespondenz“ [ohne Signatur], 55 A/1, 55 JB/1, 101 Q/1. Lit.: STILLE 195-197; CRONE [3]; ZENETTI. Lorch: Pfarrei St. Martin Im Februar 1940 wurde in dem Rheingau-Städtchen Lorch ein Arbeitskommando von 30-35 kriegsgefangenen Polen eingesetzt, die sonntags regelmäßig zur hl. Messe gingen. Diesen Sondergottesdienst hielt der Lorcher Pfarrer Johannes Hans. Nach Verlegung der Polen wurde im Zuge des Frankreichfeldzuges im alten Lorcher Sägewerk ein bewachtes Lager mit französischen Kriegsgefangenen untergebracht, das dem Stalag XII A bei Diez unterstand. Durch Zeitzeugenberichte kann in diesem Zusammenhang der Einsatz von zumindest drei Arbeitern auf den Pfarrweingütern von St. Martin als gesichert gelten. Es handelt sich um drei französische Kriegsgefangene, darunter ein Algerier. Namentlich identifiziert ist ein Louis R. aus der Nähe von Narbonnes, damals ca. 35 Jahre alt. Dieser war in seinem Heimatland selbst Winzer und Gutsbesitzer. Sein Aufenthalt im Lager Lorch ist für 1940 bis zum Kriegsende anzunehmen. R. arbeitete vorwiegend für die Pfarrei, aber auch für andere Weingüter am Ort und eine ansässige Gärtnerei. R. behielt nach der Heimkehr den Kontakt mit Lorcher Familien, die ihn in Frankreich auch besuchten. Er ist zwischenzeitlich verstorben, allerdings lebt seine Frau noch, zu der die Arbeitsgruppe Kontakt aufgenommen hat. Nach der Erinnerung von Pfarrer i.R. Ferdinand Eckert, 1939-1944 Kaplan in Lorch, hat einer der Franzosen regelmäßig im Pfarrhaus am Tisch von Pfarrer Johannes Hans mitgegessen. Dieses Verhalten des Pfarrers war nicht ohne persönliches Risiko und konnte leicht als Verbrüderung mit dem „Feind“ ausgelegt werden. Schon mit Verfügung vom 12. Mai 1941 hatte das OKW die „gottesdienstlichen Handlungen“ für Kriegsgefangene durch deutsche Geistliche verboten. Wie der stellv. Wehrkreispfarrer in Wiesbaden auf eine Anfrage von Pfarrer Hans am 9. Juli 1941 mitteilte, könne die hl. Messe „grundsätzlich nur durch in Gefangenschaft geratene Geistliche der Feindmächte“ gefeiert werden. In einem Merkblatt „Verhalten gegenüber Kriegsgefangenen“, das im Pfarrarchiv Lorch aufbewahrt wird, heißt es: „Kriegsgefangene gehören nicht zur Haus- oder Hofgemeinschaft (...). Sie haben als Soldaten ihres Landes gegen Deutschland gekämpft, sind daher unsere Feinde. Wer sie besser behandelt als deutsche Arbeitskräfte, wird zum Verräter an der Volksgemeinschaft. (...) Jedes Entgegenkommen gegenüber Kriegsgefangenen erleichtert dem Feind die Spionage und Sabotage und richtet sich damit gegen unser Volk.“ Ob es sich bei den betreffenden Personen um Zivilarbeiter oder ausschließlich Kriegsgefangene handelt, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Die Bestände des Pfarrarchivs wurden ohne Ergebnis gesichtet. Unklar ist allerdings der Verbleib der Pfarrchronik von St. Martin, die möglicherweise weiteren Aufschluß geben kann. Der fragliche Louis R. war ausländerpolizeilich nicht gemeldet, was auf einen dauerhaften Status als Kriegsgefangener hindeutet. Allerdings ist die alte Meldekartei der Stadt Lorch nicht vollständig erhalten. (JR) QQ.: PfA St. Martin Lorch, Korrespondenzen; DAL, 224 H/1. Lit.: STRUPPMANN 167; CCP 185. Montabaur: Mutterhaus und Krankenhaus der Barmherzigen Brüder von Montabaur Die Genossenschaft der Barmherzigen Brüder verfügte 1936 im Bereich der Diözese Limburg über Niederlassungen in Bad Ems, Hadamar, Limburg, Frankfurt-Allerheiligen, Frankfurt-Höchst und Wiesbaden-Maria-Hilf. Es handelte sich vor allem um Alten- und Pflegeheime, Sanatorien, Häuser mit ambulanter Krankenpflege und Küsterdienststellen. Die Heil- und Pflegeanstalt St. Joseph in Hadamar wurde bereits 1936 aufgelöst und später durch das am Ort eingerichtete Offlag für kriegsgefangene polnische Offiziere genutzt. Das Sanatorium in Bad Ems fungierte in der Kriegszeit als Teillazarett. Hinweise auf einen Einsatz von Fremdarbeitern oder Kriegsgefangenen in den dortigen Einrichtungen sind bisher nicht festgestellt worden. Ein Zwangsarbeiter-Einsatz größerer Ordnung ist für die Einrichtungen der Kongregation in Montabaur [Abb. 11] selbst nachweisbar. Dort bestand im unmittelbaren Einflußbereich des Mutterhauses mit Werkstätten und Landwirtschaft ein eindrucksvolles Netzwerk caritativer Einrichtungen: 1. 2. 3. 4. Das von den Brüdern in Pflege und Verwaltung geführte Krankenhaus im ehemaligen Konviktsgebäude mit der 1910 gegründeten staatlich anerkannten Krankenpflegeschule. An das Krankenhaus angeschlossen waren Getreide-, Kartoffel-, Gemüse- und Obstanbauflächen, ein Garten, Vieh- und Schweinestallungen, Metzgerei und Bäckerei, eine Wäscherei, eine Schuh- und Textilmanufaktur, eine Schmiede und eine Zimmermannswerkstatt; das „Caritashaus“, eine 1903 bis 1978 in Regie der Brüder geführte Anstalt für geistig Behinderte mit Bildungswerkstätten und Landwirtschaft; das in der Nähe des Stadtfriedhofs befindliche Vinzenzhaus als Heim für geistig Behinderte und Epileptiker; schließlich unterhielten die Brüder zur Bewirtschaftung der Einrichtungen noch die Getreide-Mühle Wirzenborn an der Gelbachstraße und den 1931 vom Grafen Walderdorff zu Molsberg erworbenen „Rossberger Hof“ auf einer dem Gelbachtal gegenüberliegenden Höhe mit Getreide-, Kartoffel-, Gemüse- und Obstanbauflächen sowie Schweine- und Hühnerzucht. Auf die Beschäftigung eines „Fremdarbeiters“ im Brüder-Krankenhaus ist bereits 1995 in einem Beitrag von Günter Henkel über Zwangsarbeiter in Montabaur hingewiesen geworden. Erst im Zuge der öffentlichen Diskussion im vergangenen Jahr konnten weitere Erkenntnisse gewonnen werden. Zum Verständnis des „Ausländereinsatzes“ bei den Barmherzigen Brüdern ist eine kurze historische Annäherung erforderlich, die das Mutterhaus der Kongregation unter den Bedingungen der nationalsozialistischen Herrschaft zeigt. 1934 begannen die neuen Machthaber mit offenen und verdeckten Maßnahmen gegen die BrüderGemeinschaft vorzugehen. Für die Krankenhäuser und Sanatorien erteilte die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte Belegungssperren für Versicherungspatienten, die Steuerbegünstigung für die Niederlassungen wurde aufgehoben und längerfristige Darlehen wurden kurzfristig gekündigt. Seit 1935 unterlag das Mutterhaus der ständigen Beobachtung durch die Gestapo. Es kam zu politisch zielgerichteten Verhaftungen und Strafprozessen wegen angeblicher und erwiesener Devisen- und Sittlichkeitsdelikte. Etwa 60 Brüder waren zeitweise oder länger in Haft. Der Generalobere des Ordens, Br. Hyazinth Vey, wurde wegen angeblicher „Devisenschieberei“ des „Volksverrats“ angeklagt und von einem Berliner Sondergericht zu vier Jahren Gefängnis und RM 50.000,- Geldstrafe verurteilt. Er starb 1937 in der Strafanstalt in Brandenburg. Im Juni 1936 wurden auf Anordnung der Bezirksregierung in Wiesbaden alle behinderten Zöglinge im Caritas- und Vinzenzhaus in die Anstalt Weilmünster verbracht. Nachdem die staatlichen Instanzen mit ihren Bestrebungen gescheitert waren, die beiden genannten Häuser durch finanziellen Druck an sich zu ziehen, gelang es den Brüdern die Anstaltsgebäude im Juli 1937 zur Kasernennutzung an die Wehrmacht zu vermieten (bis 1945). Im September 1937 wurde die Krankenpflegschule für die Novizen auf Anordnung der Gestapo geschlossen. In der Folgezeit war auch das Brüder-Krankenhaus selbst von Schließung bedroht, nicht zuletzt, da die Pflege weiblicher Patienten bisher nicht vorgesehen war und sich die Gemeinschaft auch weigerte, die mittlerweile vorgeschriebene NSV-Pflegedienstschule für Krankenschwestern einzurichten. Es gelang aber, mit Hilfe der Franziskanerinnen von Erlenbad/Baden auch die Pflege weiblicher Patienten sicherzustellen, so daß das Hospital, das jetzt offiziell nur noch „Krankenhaus Montabaur“ hieß, in der Trägerschaft der „Charitas-Vereinigung G.m.b.H.“, der juristischen Person der Kongregation, verbleiben konnte. Trotz des weitgehend katholischen Umfeldes in Montabaur wurde die Lage für die Genossenschaft ernster. Aus Wut über 61 Nein-Stimmen bei der Volksabstimmung über den „Anschluß“ Österreichs am 10. April 1938 befestigten die örtlichen Stadtväter am Rathaus-balkon eine Puppe, die einen aufgehängten Bruder darstellte, mit folgender Aufschrift: „Ich bin einer von den 61 lumpigen Verrätern“ [Abb. 12]. Bei Kriegsausbruch wurde das Krankenhaus zunächst zwei Monate Lazarett, dann, Anfang 1941, ganz geschlossen. Die Patienten wurden nach Dernbach verlegt. Auf Vermittlung der Wehrmacht konnte das Hospital wieder geöffnet werden und diente dann bis Kriegsende als Lazarett. Lediglich 15 Betten blieben für Zivilkranke, 140 Betten mußten für Verwundete bereitgehalten werden, wie das Mutterhaus am 11. August 1941 an das Bischöfliche Ordinariat berichtete. Noch im selben Monat kamen die ersten 128 Verwundeten. 1942 wurde auch das Vinzenzhaus als Lazarett mit 170 Betten in Betrieb genommen. Die Brüder behielten wie im Krankenhaus die Pflege und die Ökonomie. Folgt man der Chronik des Mutterhauses, waren die genannten Lazarette durchweg mit 400 bis 420 verwundeten Soldaten belegt. Allein in 1943 wurden insgesamt 2.226 Soldaten behandelt, eine Kraftanstrengung, die mit wenig Personal kaum zu bewerkstelligen war. Die jungen Brüder waren fast alle zum Arbeitsdienst oder zur Wehrmacht eingezogen, dort vor allem im Sanitätsdienst. Selbst der Generalobere der Gemeinschaft, Br. Vitus Dahlbüdding, wurde eingezogen und leitete als Sanitätshauptfeldwebel Lazarette in Montabaur und Limburg. In einem Bericht des Generalates vom Dezember 1946 werden 110 Brüder der deutschen Provinz gezählt, die zur Wehrmacht eingezogen waren, davon sind zwölf gefallen, zwei in Gefangenschaft gestorben und fünf als vermißt gemeldet. Um den Pflegebetrieb in den Lazaretten und die Bewirtschaftung und Ernährung des gesamten Gebäudekomplexes sicherstellen zu können, mußten auch Kriegsgefangene und Fremdarbeiter in großer Zahl beschäftigt werden. In der Stadt Montabaur selbst waren sehr viele solcher Arbeitskräfte eingesetzt, zum Beispiel in den Ortlinghauswerken, einem 1944 von Remscheid verlegten Rüstungsbetrieb. Es bestand ein Zivilarbeiterlager mit 500 Personen und das Kriegsgefangenenlager „962“, ein Arbeitskommando des Stalag XII A bei Diez, das wiederum ausschließlich für land- und forstwirtschaftliche Arbeiten und für Meliorationsarbeiten zum Einsatz kam. Das Brüder-Krankenhaus lieferte Eisenbetten und Wolldecken für die Unterkünfte dieses Lagers, in dem zwischen 1940 und 1945 insgesamt sechs Polen, drei Belgier und 90 Franzosen untergebracht waren, die auf Betriebe und Güter der Umgegend verteilt wurden. 1944/45 betrug die Stärke des Kommandos allerdings nur noch 40 ausländische Kriegsgefangene. Die polnischen Kriegsgefangenen und weitere sieben bis elf Franzosen waren in den Eigenbetrieben der Brüdergenossenschaft tätig. Am 24. Januar 1940 beantragte der Hausobere Br. Gotthard Tilke beim Bürgermeister die Überlassung von sechs polnischen Kriegsgefangenen für die hauseigene Landwirtschaft, da vier Brüder und drei Angestellte zur Wehrmacht einberufen waren. Laut Antrag von Br. Gotthardt waren insgesamt 350 Morgen Land mit 50 Rindern und vier Pferden zu bewirtschaften. Nach befürwortender Stellungnahme des Ortsbauernführers wurden die Polen unter Zusendung der „Richtlinien für den Einsatz von Kriegsgefangenen im Unterwesterwaldkreis“ den Betrieben der Brüder zugeteilt, worauf Br. Gotthardt am 9. Februar an den Bürgermeister schrieb: „Hiermit danken wir für die freundliche Überlassung der 6 polnischen Kriegsgefangenen, die uns heute für unsere Landwirtschaft zugeführt wurden. Gleichzeitig bestätigen wir den Empfang des Merkblattes bezügl. Verhalten gegenüber den Kriegsgefangenen, und werden wir nach den gegebenen Anweisungen strengstens verfahren.“ Durch die im Stadtarchiv erhaltenen Arbeitspläne des Lagers Montabaur sind insgesamt 19 Kriegsgefangene nachgewiesen, für die das Brüderhaus die vorgeschriebene Abgabe von RM 2,40 pro Tag und Person an die Gemeinde entrichtete. Es handelt sich ausschließlich um Polen und Franzosen, im Zivilberuf zum Teil qualifizierte Facharbeiter (Lokführer, Mechaniker, Textilarbeiter, Kraftfahrer, Schuhmacher, Friseur, Kaufmann, Sekretär etc.). Zumindest acht Personen waren in den landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt, über die Tätigkeitsfelder der übrigen Gefangenen sind keine Angaben verfügbar. Es ist jedoch davon auszugehen, daß vor allem für die Werkstätten, Stallungen und Felder Arbeitskräfte fehlten. Die nach dem Krieg im Zuge der Ausländersuchaktion der Vereinten Nationen von der Stadt Montabaur erstellten Listen der vor Ort eingesetzten Fremdarbeiter geben Aufschluß über den Grad der Beschäftigung von Zivilarbeitern im Krankenhaus/Lazarett bzw. in den angeschlossenen Eigenbetrieben der Barmherzigen Brüder. Zudem sind polizeiliche Anmeldungen von „ausländischen Arbeitskräften“ durch das Krankenhaus aus den ersten beiden Monaten des Jahres 1945 erhalten, die von Br. Ludwig Loos, dem Generalökonom, unterschrieben sind [Abb. 13, vorherige Seite]. Demnach waren zwischen 1940 und Kriegsende 1945 zumindest 58 ausländische Arbeitskräfte - ohne die Kriegsgefangenen - tätig. Im einzelnen ergibt sich folgendes Bild: 50 ausländische Männer und acht Frauen waren im Krankenhaus und auf dem Hofgut Rossberg eingesetzt. In den Listen werden sie teils als „Ostarbeiter“, teils als „Russen“ oder „Polen“ aufgeführt. Nach Nationalitäten gegliedert waren es insgesamt: 22 Polen, 20 Russen (darunter zwei „Ostarbeiter“), fünf Ukrainer, drei Slowaken, drei Niederländer und ein Jugoslawe. Von vier Personen, darunter ein Kind, wissen wir nur den Geburtsort, nicht die Staatsangehörigkeit. Die Frauen waren entweder Polinnen oder Russinnen. In der Landwirtschaft waren ausschließlich Polen, Ukrainer und Ostarbeiter tätig. Nicht bei allen Personen können wir davon ausgehen, daß es sich um „echte“ Zwangsarbeiter handelt. Möglicherweise waren die Slowaken, Niederländer und der Jugoslawe freiwillig in Deutschland. Dagegen können wir bei den Personen auf den „Russen-Listen“ davon ausgehen, daß es sich um Zwangsverpflichtete aus den Sowjetgebieten handelt, die im Regelfall alle „Ostarbeiter“ waren, auch wenn sie in den Akten als „Russen“ bezeichnet werden. Ob die im BrüderKrankenhaus eingesetzten „Ostarbeiter“ das stigmatisierende Abzeichen „Ost“ auf der Arbeitskleidung getragen haben und die Polen das „P“, ist bislang unklar. Bei dem „Kind“ handelt es sich um Wiethold L. (*1935), einen in Moskau geborenen zehnjährigen Jungen, der zusammen mit seiner Mutter Eugenie L. (*1918), gebürtig aus Minsk, am 20. Februar 1945 mit anderen Arbeitskräften des Krankenhauses bei der Polizeiverwaltung Montabaur angemeldet wurde. Die Deportation ganzer russischer Familien war kein Einzelfall, denn viele Zwangsarbeiter versuchten durch Flucht zu ihren Angehörigen zurückzugelangen, was bei zu großer Fluktuation die Produktivität vieler Betriebe schwächte. Von den Arbeitern waren manche nur wenige Monate bei den Brüdern, manche mehrere Jahre, wie etwa Wladyslaw C. (*1913) aus Kolinia-Wulka in Polen, der am längsten, offenbar vom 8. März 1940 bis zum 31. März 1945, für das Krankenhaus und das Hofgut der Barmherzigen Brüder gearbeitet hat. Die Angaben in den Ausländerlisten über den Beschäftigungsort sind in einigen Fällen widersprüchlich. Eine Polin wird in einer Liste unter „Hof Rossberg“ geführt, in der anderen unter „Krankenhaus“. Möglicherweise sind die Arbeiter je nach Bedarf auf dem Gut oder zur Unterstützung der Hauswirtschaft und Werkstätten des Krankenhauses und des Brüderhauses eingesetzt worden. Hierzu wird in der Chronik des Mutterhauses eine interessante Episode mitgeteilt: „Am 20.12.1943 explodierte ein feindliches Flugzeug an der Hollerstraße - Spießweiher. Sieben Leichen wurden, zum Teil verkohlt, geborgen (Engländer). Sie wurden von deutschen Stellen würdelos behandelt. Es durfte kein Deutscher bei der Beerdigung helfen. Bei uns arbeitende Ausländer (Polen) besorgten unter Leitung unseres Gärtnerbruders die Beerdigung auf unserem Brüderfriedhof. Ein schmachvolles Zeugnis für unsere damalige städtische Leitung.“ Über Verpflegung, Entlohnung und Behandlung der Fremdarbeiter bei den Brüdern können bislang keine zuverlässigen Aussagen getroffen werden. Die Personalakten des Brüder-Krankenhauses aus der Zeit vor 1962 sind 1988 bei Errichtung des neuen Krankenhauses vernichtet worden. Allerdings bestätigte Br. Ludwig zusammen mit 38 weiteren Arbeitgebern aus Montabaur im August 1946 gegenüber der Stadtverwaltung, daß alle „bis Frühjahr 1945 beschäftigten ausländischen Arbeitskräfte (...) bis zum Tage ihres Wegganges (...) ordnungsmässig entlohnt“ wurden. Der Mindestlohn betrug für ausländische Arbeiter mit dem „Ost“-Abzeichen nach der „Verordnung über Einsatzbedingungen der Ostarbeiter“ vom 30. Juni 1942 RM 48,- im Monat, was dem Bruttolohn eines vergleichbaren deutschen Arbeitnehmers nur in der Fiktion der euphemistischen Zahlen- und Sprachwelt der NS-Bürokratie entsprach, denn zugleich sollte der Arbeitgeber RM 45,- einbehalten können, wenn der „Ostarbeiter“ freie Kost und Logis erhielt. Der „Ausländereinsatz“ in den Einrichtungen der Brüdergenossenschaft erreichte mit 45 gleichzeitig beschäftigten Fremdarbeitern im ersten Quartal 1945 seine größte Intensität, als sich die nationalsozialistische Kriegsordnung bereits in Auflösung befand. Das heraufziehende Ende der NSHerrschaft und des „Reichseinsatzes“ trieb in Montabaur noch eine seltsame Blüte, als die Ortspolizeibehörde am 1. März 1945 der Gestapo die Flucht zweier „russischer SS-Zöglinge“ meldete. (JR) QQ.: DAL, 101 Q/1, 107 C/2, 561 8/A; StAMt, Abt. 5 Nr. 37, Abt. 4 Nr. 1235; GAFMM, Personalakten. Lit.: HILPISCH; BUXBAUM; SCHATZ 273f; HENKEL; CCP 531. Oberlahnstein: Städtisches Krankenhaus (Arme Dienstmägde Jesu Christi) Auch im Städtischen Krankenhaus Oberlahnstein war die Pflege der Kranken den Dernbacher Schwestern (seit 1858) anvertraut. Am 26. August 1939 wurde das Haus von der Wehrmacht als Reservelazarett „Hilfskrankenhaus Heilquelle“ beschlagnahmt, die Schwestern blieben zur Versorgung der Verletzten und Kranken. Wenige Wochen später, im Oktober 1939 zogen zudem alte und pflegebedürftige Menschen ein. Am 20. März 1943 wurde eine Baracke für 30 kranke Kriegsgefangene aufgeschlagen. Ein Zivilarbeitereinsatz kann bislang nicht nachgewiesen werden. Beim Bombenangriff am 11. November 1944 jedoch war Pfarrer Delabre, ein französischer Kriegsgefangener, sofort zu Hilfeleistungen zur Stelle. Um herauszufinden, wo er lebte und arbeitete, bedarf es weiterer Recherchen. (BW) Q.: PAADJC, Dernbach, Verzeichnis der Niederlassungen 1939-1945. Obertiefenbach-Beselich: Schwesternhaus Maria Hilf (Pallottinerinnen) Im Schwesternhaus „Maria Hilf“ der Pallottinerinnen in Obertiefenbach-Beselich wurden während des Krieges sowohl Verwundete versorgt und aufgenommen als auch Flüchtlinge und Soldaten beherbergt und neben dem Schwesternhaus eine Feldküche eingerichtet. In der Chronik heißt es 1941/42: „Unser Koks schmolz rasch zusammen (...) Den ganzen Sommer und Herbst (1941) durch hatten wir auch den Kriegsgefangenen Badegelegenheit gegeben und dadurch ziemlich viel Koks verbraucht“. Der Antrag auf eine zusätzliche Kokslieferung wurde damit begründet, daß 14-tägig den Gefangenen aus Obertiefenbach und den umliegenden Ortschaften das Baden ermöglicht wurde. Auch am 11. Januar 1943 wurde Koks angeliefert: „Der Stützpunktleiter, Herr Jung, schickt den Schwestern 6 Russen, die an 2 Vormittagen den gelieferten Koks einschaufeln“. Wer diese Russen waren, welchen Status sie hatten und ob sie den Schwestern zu anderen Tätigkeiten auch zur Verfügung standen, ist noch nicht bekannt. (BW) Q.: PASACSr, Limburg, Chronik des Schwesternhauses „Maria Hilf“. Streithausen/Ww.: Zisterzienser-Abtei Marienstatt Die gedruckten Kriegserinnerungen des damaligen Klosterzellerars P. Albert Kloth gaben einen ersten Hinweis auf den Einsatz von Zivilarbeitern auf dem Klostergelände. Durch die „Personalkartei der Klosterverwaltung“ und das Tagebuch von Abt Idesbald Eicheler im Archiv der Abtei konnten die Angaben bei Kloth verifiziert werden. Zu den historischen Hintergründen: Die Geschichte des 1888 von Mönchen aus Mehrerau bei Bregenz in Österreich wiederbesiedelten Zisterzienserklosters Marienstatt in der Zeit des „Dritten Reiches“ ist bislang kaum erforscht. 1936 mußte Abt Eberhard Hoffman wegen „Devisenvergehens“ vor der Gestapo ins Ausland fliehen und als Abt resignieren. Er hatte einem Konventualen, der in Rom studierte, Semestergeld zugesandt. Zu Ostern 1939 wurde die Oblatenschule der Abtei vom Regierungspräsidenten in Wiesbaden aufgelöst. An ihr waren 14 Patres und eine zivile Lehrperson für 80 Schüler auf fünf Klassen tätig. Gegen Abt Idesbald Eicheler wurde 1942 vor einem Schöffengericht in Limburg ein Strafverfahren wegen angeblicher Unterschlagung einer Bronzeglocke angestrengt, das allerdings in zweiter Instanz eingestellt wurde. Im Zuge dieser Ermittlungen „fand“ die Gestapo im Zimmer der Klosterverwaltung eine Tuschezeichnung, die einen Mönch darstellte, der mit erhobener Axt gegen einen Drachen kämpft. Auf der Brust des Drachen prangte ein eingezeichnetes Hakenkreuz. Die Zeichnung war von den Geheimpolizisten wohl selbst mit dem NS-Symbol präpariert worden, um etwas gegen die Abtei in der Hand zu haben. Am Ende mußte der Abt ein Sicherungsgeld von RM 3.000,- zahlen. Sehr viel härtere Maßnahmen wurden im folgenden Jahr gegen den Konventualen und ehemaligen Regens der Oblatenschule, P. Raymund Lohausen (1897-1948), ergriffen. Erkrankt war Lohausen als Aushilfspriester in Siegburg in der Seelsorge tätig. Wegen Kanzelmißbrauchs und angeblich staatsfeindlicher Äußerungen in der Jugendseelsorge kam er in Gestapo-Haft und wurde ohne Gerichtsverfahren in das KZ Dachau verbracht, wo er seine Gesundheit vollends einbüßte und bis zur Befreiung durch die Amerikaner interniert blieb. Obwohl die NS-Machthaber das Kloster, das juristisch in der Trägerschaft der Vermögensverwaltungsgesellschaft Abtei Marienstatt m.b.H. stand, derart im Visier hatten, ist weder eine willkürliche Aufhebung der Abtei durch die Geheime Staatspolizei noch eine kriegsnotwendige Beschlagnahme nach dem „Reichsleistungsgesetz“ erfolgt. Das hatte mehrere Gründe: 1. Die Abtei war nicht vermögend und durch die Westerwald-Lage, zudem noch im abseits gelegenen Nistertal, strategisch zunächst unbedeutend. 2. Der Ortsbürgermeister von Streithausen, Josef Beckschäfer, zusammen mit dem Volksschullehrer einziges NSDAP-Mitglied in dieser rein katholischen Gemeinde, zu der das Kloster bis heute gehört, setzte sich für die Abtei ein. Auch die Anwesenheit des Landrates des Oberwesterwaldkreises bei der Wallfahrt 1942 deutet auf relativ entspannte Beziehungen der Abtei zu den lokalen politischen Instanzen hin. Im Verfolgungsbericht vom 29. November 1945 an das Ordinariat in Limburg schreibt der Pfarrkurat von Marienstatt, P. Placidus Hülster OCist, über die politische Grundstimmung während des „Dritten Reiches“: „Die N.S.D.A.P. hat in der Pfarrfamilie Marienstatt nichts verdorben. Sie war und blieb von allen Katholiken schon allein aus konfessionellen Gründen verhasst.“ 3. Seit März 1941 war es in Marienstatt laufend zu kriegsbedingten Einlagerungen öffentlicher Institute (Museen, Bibliotheken) und zu personellen Einquartierungen gekommen. Schon zum Jahreswechsel 1939/40 lag eine aus Bayern stammende Pioniereinheit der Wehrmacht im Klostertal. Unter dem 23. Juni 1944 notierte Abt Idesbald in seinem Tagebuch, daß sich gegen 500 Personen in der Abtei aufhalten, ca. 350 Kinder einer evakuierten und in der ehemaligen Oblatenschule eingemieteten Heimanstalt der Hiltruper-Missionsschwestern in Dormagen, 44 „alte Leutchen“ des UrsulinenAltenheimes in Frankfurt mit 15 Schwestern sowie die ausgebombten Alumnen mit einigen Professoren der Hochschule Frankfurt-Sankt Georgen. Als die Kampfhandlungen am Niederrhein langsam näher rückten, wurde das Kloster durch die Kriegslazarettabteilung I/680 der Wehrmacht aus Rheinbach am 7. März 1945 doch noch beschlagnahmt und für 2.000 Verwundete vorgesehen. Vor Bombenabwürfen im Zuge deutscher Rückzugsgefechte schützte die Abtei jetzt das auf den Dächern des Klosters weithin sichtbare rote Kreuz auf weißem Grund. Am 26. März 1945 kamen schließlich die Amerikaner nach Marienstatt. Kriegsgefangene und Fremdarbeiter gehörten in der Kriegszeit zum Alltag in der agrarisch geprägten Umgegend des Klosters. Vor allem der spätere Prior P. Placidus Hülster versuchte als Kurat der Pfarrei Marienstatt seelsorgliche Kontakte mit den kriegsgefangenen und zivilen „Landarbeitern“ in den umliegenden Dörfern und Ortschaften herzustellen, auch mit Polen, was ihm eine Verwarnung durch die Gestapo einbrachte. Laut Pfarrchronik bestanden 1940 in Oberhattert, Kroppach und Kundert Kriegsgefangenen-Arbeitskommandos, in Kroppach und Geisenhausen waren insgesamt vier polnische Zivilarbeiter untergebracht. Für den gesamten Oberwesterwaldkreis sind vom Französischen Nationalen Suchdienstbüro zudem Zivilarbeiterlager in Luckenbach (nahe Marienstatt) mit 115 und (Bad) Marienberg mit 69 Insassen nachgewiesen. Abt Idesbald schrieb am 13. August 1943 an Generalvikar Göbel: „In hiesiger Gegend sind französische Zivilarbeiter, darunter Ordensleute, Ordens- und Weltpriesterkandidaten seit einigen Wochen eingesetzt. Wäre dankbar erfahren zu können, wie weit diese an den Gottesdiensten für deutsche Katholiken teilnehmen dürfen, ob es nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen erlaubt ist, diesen Zivilarbeitern die heilige Kommunion und das Bußakrament zu spenden in der Pfarrkirche. Wissen Sie vielleicht, ob jeder ausserkirchliche Verkehr mit französischen Zivilarbeitern wie bei den Kriegsgefangenen verboten ist?“ Nicht nur in seelsorglicher Hinsicht kam das Kloster mit Fremdarbeitern in Kontakt. Kriegsbedingte Einberufungen schwächten den Personalstand der Abtei beträchtlich. Insgesamt wurden 30 Konventualen, darunter fast alle Laienbrüder, zum Heeresdienst eingezogen. Fünf Brüder und zwei Patres blieben im Feld. Die Abtei konnte den Ausfall an Arbeitskräften in der Klosterökonomie kaum kompensieren. Abt Idesbald notierte am 13. Dezember 1942 in sein Tagebuch: „Heute läuft die Aufforderung ein, daß Bruder Peter Rapp, der bereits zu Beginn des Krieges, am 26. August 1939, eingezogen worden war und dann am 7.10.1940 bis heute beurlaubt wurde, am 15.12. wieder in Mainz sich stellen muß. Das bedeutet für uns ein neues großes Opfer: Er war Koch und half bei den Buchungen mit, vorher versah er anstelle der Küche den Küsterdienst in der Basilika. Überall stellte er seinen Mann. Auch im Stall wird die Arbeit immer schwieriger, da am 9. Dezember unser Stallknecht und Botengänger Josef einrücken mußte. Nun müssen Otto Stockinger, Bruder Arnulf und 2 polnische Arbeiter alles allein bewältigen.“ Die Abtei beschäftigte zwischen 1941 und 1945 insgesamt vier landwirtschaftliche Arbeitskräfte aus Polen bzw. dem „Generalgouvernement“: Iwan M. aus Lublinca-Nowa (* 1902) von Dezember 1940 bis April 1945, Josef W. aus Pabianice (*1911) von Dezember 1940 bis Februar 1941, Kasimir Z. aus Rava-Rus`ka (*1914) von Februar 1941 bis Februar 1944 und Michail H. aus Iaschow-Stargi bei Lemberg (*1926) von Februar 1944 bis April 1945. Von letzterem wissen wir die Konfessionszugehörigkeit: griechischkatholisch. Nach den Arbeitskarten in der Personalregistratur der Klosterverwaltung war H. im April 1942 als landwirtschaftlicher Arbeiter in Linter bei Limburg registriert worden, die drei anderen Personen waren schon 1940/41 in Deutschland. Alle vier kamen als Zwangsarbeiter nach Deutschland. Sie waren entweder im Rahmen des sog. „Poleneinsatzes“ ab Januar 1940 aus dem besetzten Polen nach Deutschland deportiert oder als Kriegsgefangene in den Status von „Zivilarbeitern“ überführt worden. Nach der Einverleibung Galiziens und der Angliederung des „Distrikts Lemberg“ an das Generalgouvernement im Zuge des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion im Sommer 1941 kam womöglich der Ukrainer Michail H. - noch nicht sechzehnjährig - nach Deutschland. Das vom neuen „Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz“, Sauckel, am 20. April 1942 verkündete Programm sah ausdrücklich auch die Rekrutierung von arbeitsfähigen jungen Sowjetmännern und -frauen ab dem 15. Lebensjahr vor. Nach den Arbeitsdokumenten waren die Fremdarbeiter als Helfer für die Landwirtschaft eingestellt. Von einer größeren Agrarbewirtschaftung in Marienstatt kann für die Kriegszeit allerdings nicht mehr ausgegangen werden. Die NS-Behörden hatten den Zisterziensern 1938 das über 300 Morgen große Pachtland des Eichhartshofes, einer entfernten alten Grangie der Abtei, entzogen; ein schwerer Schlag für die als mustergültig anerkannte Landwirtschaft des Klosters. Allerdings verfügten die Brüder noch über einige kleinere Felder in der Nähe der Abtei, und neben dem Konventsgarten gab es noch einen weiteren Garten mit Obst- und Gemüseanbau. Nach den Eintragungen von Abt Idesbald halfen die beiden Arbeiter, die im Dezember 1942 da waren, in den Stallungen. Aus den erhaltenen Personalunterlagen der Beschäftigten geht hervor, daß sie die für landwirtschaftliche Zivilarbeiter übliche Entlohnung von RM 70,im Monat erhalten haben, bei der Krankenkasse angemeldet waren und vom „Betriebsführer“, also vom Klosterzellerar, monatlich „Verwaltungsbeiträge“ in Höhe von 0,30 RM an die Kreisbauernschaft in Limburg abgeführt wurden. Als Wohnort von Iwan M. wird auf der Beitragskarte „Streithausen“ angegeben, so daß von einer dauerhaften Unterbringung und Verpflegung des Arbeiters durch die Abtei ausgegangen werden kann [Abb. 14, siehe nächste Seite]. Ob zu den Arbeitern auch seelsorgliche Kontakte bestanden haben und ob es sich überhaupt um praktizierende Katholiken handelte, ist nicht belegt. Noch nicht geklärt ist auch, auf wessen Initiative die Zuteilung der Arbeitskräfte nach Marienstatt erfolgte. Die Arbeitskarte von Iwan M. wurde vom Arbeitsamt in Limburg gestempelt, das auch für den damaligen Oberwesterwaldkreis zuständig war. Die dortigen Akten haben das Kriegsende allerdings nicht überdauert. Spuren führen auch zur Verwaltungsstelle der Kreisbauernschaft des pseudokorporativen „Reichsnährstandes“ in Limburg, die für die „Betreuung“ von landwirtschaftlichen Zivilarbeitern verantwortlich zeichnete. Die von dort ausgestellte „Verwaltungsbeitragskarte“ mußte der „Betriebsführer“ bei Anstellung eines „ausländischen oder fremdvölkischen Arbeiters“ über den Ortsbauernführer bei der Kreisbauernschaft beantragen. Von Iwan M. und Michail H. sind diese Karten in der Personalkartei der Klosterverwaltung erhalten. Auf der Personalkarteikarte des Polen Kasimir Z. ist ein „Arbeitslager“ erwähnt, in das der Betreffende am 10. Januar 1942 für drei Monate „abtransportiert“ worden war. Vermutlich handelt es sich um das Lager Luckenbach mit einem Steinbruch und der Eisengrube „Bindweide“ in der Nähe, wo die Internierten möglicherweise arbeiten mußten. Der Grund der Lagereinweisung ist nicht bekannt, wirft aber die Frage nach der Disziplinierung der „Fremdarbeiter“ auf, da die NS-Behörden gerade der Arbeitsleistung der Polen besondere Aufmerksamkeit widmeten. Bei „Arbeitsbummelei“ etwa drohte die Einweisung in ein spezielles „Arbeitserziehungslager“. Für deutsche Bauern, Landarbeiter und Frauen, die sich zu nachsichtig zeigten oder gar engeren Kontakt mit den polnischen Arbeitern pflegten, drohten ebenfalls drakonische Strafmaßnahmen, da gerade in der Landwirtschaft vom SD immer wieder „Verbrüderungen“ von Gesindekräften und Polen festgestellt wurden. Nach den Erinnerungen von P. Albert Kloth wurden auch die beiden 1945 in Marienstatt noch anwesenden Zivilarbeiter „menschlich“ behandelt, obwohl der Gutsverwalter zur regelmäßigen Prügelstrafe angewiesen worden sei. Nach dem Krieg hat sich die Spur der Zivilarbeiter aus Marienstatt verloren, auf den Personalkarten wurde im Mai 1945 „Abmeldung infolge Kriegsereignisse“ vermerkt. Kontakte gab es offenbar keine mehr. Allerdings ist ein zwangsverpflichteter Niederländer namens Martin T., der 1944 im Auftrag eines Kölner Architekten zusammen mit einem Landsmann namens „Jan“ Behelfsheime für das Kloster errichtet hatte, nach der Befreiung als Schreiner in den Dienst der Abtei getreten. (JR) QQ.: DAL, 101 Q/1, 224 A/1, 561 7/B; AAM, Personalkartei der Klosterverwaltung, Tagebuch Abt Idesbald Eicheler; PfA St. Mariä Himmelfahrt Marienstatt, Pfarrchronik 1939-1941. Lit.: 50 Jahre Marienstatt 21f, 33f; Cist. Chron. 54 (1947) 254-259; W ELLSTEIN 378-382; KLOTH; GEIBIG; HAMMER 138-143; SCHATZ 280, 286f; VON HEHL 833; CCP 531. Wiesbaden-Innenstadt: St. Augustinusheim der Salesianer Don Boscos Die 1874 von Papst Pius IX. approbierte Priester- und Laienbrüderkongregation der Gesellschaft des hl. Franz von Sales („Salesianer Don Boscos“), die sich der Erziehung und Ausbildung gefährdeter Jugendlicher widmet, hatte 1924 die Leitung der im Eigentum des Bischöflichen Stuhles befindlichen sogenannten Knaben-Rettungsanstalt im ehemaligen Zisterzienserinnenkloster Marienhausen bei Assmannshausen übernommen und sich damit auch in der Diözese Limburg niedergelassen. Allerdings war die Einrichtung, die zuvor der Caritas-Pionier Prälat Matthäus Müller über 40 Jahre geführt hatte, seit dem Brand von 1915 nur teilweise wiederaufgebaut, so daß die Unterbringung der vier Jugendgruppen im Haus, Vorschulpflichtige, Schulpflichtige, Schulentlassene und Lehrlinge, nur mit großen Einschränkungen möglich war. Der Wiederaufbau von Kirche und Kloster konnte erst 1931 abgeschlossen werden. Zur Entlastung der heute unter Verwaltung des St. Vinzenstiftes/Aulhausen stehenden Anstalt, aber auch aus grundsätzlichen seelsorglichen Erwägungen wurde 1927 vom Sozialen Jugendschutz e.V. in München für die Salesianer eine größere Villa in der Mainzer Straße 14 in Wiesbaden erworben, in der jetzt die Lehrlinge ihre Wohnunterkunft fanden, die ihre Arbeitsstellen in der Stadt hatten. 1936 waren in diesem Heim, das heute nicht mehr besteht, zwei Patres, zwei Kleriker und vier Brüder tätig. Zur Deckung des steigenden Raumbedarfs für die in der Stadt Wiesbaden im großen Stil beschäftigten Kriegsgefangenen und Fremdarbeiter wurden auch im Augustinusheim polnische Zivilarbeiter einquartiert. Die Einrichtung war 1944 das letzte im Gau Hessen-Nassau noch bestehende katholische Lehrlingsheim. Die Hausleitung stand unter ständiger Beobachtung von HJ-angehörigen Lehrjungen, die auch vor Drohungen nicht zurückschreckten. Nach einer dennoch überraschenden Gestapo-Aktion am 22. November 1944, die mit Verhaftung der beiden einzigen Hausgeistlichen P. Heck und Direktor P. Dr. Oeffling endete, wurde das Heim geschlossen und als Jugendwohnheim der HJ ausgewiesen. Im Februar 1945 wurde dann noch die ausgebombte Wiesbadener Gestapo-Zentrale in dem Gebäude untergebracht. In diesem Zusammenhang ist die am 12. März 1945 auf dem Gelände des Wohnheimes erfolgte Hinrichtung von vier Sowjetbürgern, denen Arbeitsverweigerung vorgeworfen wurde, zu sehen. Hinweise auf eine Beschäftigung von Zwangsarbeitern im Lehrlingsheim liegen nicht vor. Die Durchsicht der über 2.500 Namen umfassenden „Ostarbeiterkartei“ im Stadtarchiv Wiesbaden erbrachte allerdings Näheres über einen polnischen Zivilarbeiter namens Zenon J. (*1906), von Beruf Schuhmacher, der seit Januar 1941 in verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben der alten Residenzstadt eingesetzt war und im Augustinusheim wohnte. Seine Frau Eva schrieb am 15. April 1941 aus dem Heimatort Kalisch an den damaligen Direktor des Augustinusheimes, P. Rund: „Hochgeschätzter Herr Pfarrer! Am 13. ds. Mts. d.h. am ersten Osterfest war ich bei der Beichte und habe meinen Pfarrer gebeten, ob ich nicht für meinen Ehemann Zenon J. beichten könnte. Der Pfarrer hat meine Bitte erfüllt, hat aber dabei mir anbefohlen, Sie Herr Pfarrer zu bitten, dass Sie gütigst meinem Manne die Sünden erlassen und das heilige Abendmahl austeilen würden, was ich meinerseits ergebenst (und) auch herzlich bitte. Meine Bitte und meine Tat erklärt sich damit, dass mein Mann sich nicht in der deutschen Sprache verständigen kann. Sende den verbindlichsten Dank für das schöne Ostergeschenk in Form der 10 RM, welche Sie so gütig mir gesandt. Die herzlichsten Grüsse für Sie tiefgeehrter Herr Pfarrer sendet Ihnen die verbindliche Eva J. nebst ihrer kleinen Tochter.“ P. Rund wandte sich an den Wiesbadener Stadtpfarrer Wolf. Dieser bemühte sich beim Bischöflichen Ordinariat um eine Beichtfakultät für einen des Polnischen mächtigen Ruhestandsgeistlichen: „Der Brief [von Frau J.] wirft ein Licht auf die religiöse Not dieser Leute, die nicht deutsch beichten können und doch gern ihre Ostern halten möchten. Es handelt sich nicht um Gefangene, sondern um freie Zivilarbeiter. Herr Pater Rund kennt ihrer ungefähr zwölf, die gern in der Kapelle des St. Augustinusheimes die hl. Sakramente empfangen würden, wenn sie einen polnisch sprechenden Priester hätten.“ Erst im August 1943 erhielt Wolf einen Bescheid aus Limburg unter Hinweis auf die einschlägigen Erlasse des Reichskirchenministers zur Polenseelsorge, nach denen lediglich die Generalabsolution in polnischer Sprache gemäß den „Vollmachten für die Kriegsseelorge“ zugelassen war. Der Fall zeigt die aus den Akten immer wieder sichtbare Hilfsbereitschaft vieler Geistlicher, die allerdings mit dem unübersichtlichen staatlichen „Regelwerk“ für die seelsorgliche Behandlung der Kriegsgefangenen und Fremdarbeiter ihre liebe Mühe hatten. (JR) QQ.: DAL, 561 7/B; StAWi, WI/2. Lit.: BEMBENEK 245f, 341-356; MÜLLER-W ERTH 198f; FS Einhundert Jahre Marienhausen; SCHATZ 220f. Wiesbaden-Innenstadt: St. Josephs-Hospital (Arme Dienstmägde Jesu Christi) Im St. Josephs-Hospital, einer ordenseigenen Einrichtung am Langenbeckplatz in Wiesbaden, übernahmen Dernbacher Schwestern 1892 die Krankenpflege. Die Klinik war in den 1930er Jahren spezialisiert auf Chirurgie und Gynäkologie, 26 Schwestern (Stand 1936) und Laienschwestern als Hilfskräfte versorgten die bis zu 110 Kranken. Wie der Ostarbeiterkartei der Stadt Wiesbaden zu entnehmen ist, stand seit dem 13. Dezember 1943 Anna K. (*1923) aus Posulwek, Kreis Sierards/Polen“ als „Arbeiterin“ in Diensten des Josephs-Hospitals. Näheres ist zu ihr nicht bekannt [Abb. 15]. (BW) QQ.: PAADJC, Dernbach, Verzeichnis der Niederlassungen 1939-1945, Lohnunterlagen; StAWi, WI/2. Quellen- und Literaturverzeichnis Quellen aus kirchlichen Archiven Diözesanarchiv, Limburg/Lahn (= DAL) 36 B/2 Militärdienstpflicht der Geistlichen (1920-1944) 54 A/1 Sankt Georgen: Allgemeines (1927-1944) 55 A/1 Priesterseminar: Allgemeines (1830-1944) 55 JB/1 Lazarett im Seminar (1941-1945) 101 Q/1 Kräftebilanz, verschiedene Klöster (1943) 107 C/2 Barmherzige Brüder: Hausgeistlicher und Gottesdienst in Montabaur (1877-1941) 114 A/2 Benediktinerinnen, Eibingen: Allgemeines (1905-1941) 116 A/1 Ursulinen: Allgemeines (1901-1944) 219 G/7 Kriegsgefangenenseelsorge (1939-1944) 224 A/1 Seelsorge-Ausländer: Allgemeines (1941-1944) 224 E/1 Seelsorge-Ausländer: Ukrainer (1941-1943) 224 H/1 Seelsorge-Ausländer: Polen (1906-1944) 233 BA/1 Heim für Kaufleute und Studenten, Frankfurt (1928-1944) 455 A/4 Peter-Joseph-Stiftung: Entziehung der Verwaltung (1938-1941) 455 A/5 Peter-Joseph-Stiftung: Klage wegen Entziehung der Verwaltung mit Rechtsgutachten (19391940) 561 7/A Verfolgungspolitik - Bistum Limburg (1933-1944) 561 7/B Verfolgungspolitik - Bistum Limburg (1945) 561 8/A Verfolgungspolitik - Klöster (1935-1944) 563 F/13 Krieg: Kräftebilanz, Allgemeines (1940-1944) 563 F/14 Krieg: Kräftebilanz, Allgemeines (1941) Bestand Priesterseminar: „Korrespondenz“ [ohne Signatur] Personalakte Friedrich Kneip Personalakte Augustin Manns Nachlaß Pfarrer Hans Becker Archiv der Abtei Marienstatt, Marienstatt (=AAM) Personalkartei der Klosterverwaltung Tagebuch Abt Idesbald Eicheler Generalatsarchiv der Barmherzigen Brüder von Montabaur, Montabaur (=GAFMM) Personalakten Provinzarchiv der Missionsschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu/Hiltrup, Münster (=PAMSC) Chronik Obstgut Schwalbenstein 1929-1999 Provinzarchiv der Armen Dienstmägde Jesu Christi, Dernbach (=PAADJC) Verzeichnis der Niederlassungen 1939-1945, Lohnunterlagen Provinzarchiv der Pallottiner, Limburg (=PASAC) Provinzialatsakten [unverzeichnet] Die Limburger Pallottiner-Provinz während der Zeit des II. Weltkrieges 1. September 1939 – 8. Mai 1945. Gesammelte Angaben von Br. Josef Wendling SAC, Limburg/Lahn, Limburg a. d. Lahn 1957 P. Wilhelm Schützeichel SAC, Dokumentation der seitens des Nationalsozialismus gegen die Norddeutsche Pallottiner-Provinz, Limburg an der Lahn, durchgeführten Maßnahmen Josef Wendling SAC (Hg.), Gesammelte Familienbriefe des Provinzialates der Limburger-PallottinerProvinz während des zweiten Weltkrieges [gebundene Sammlung o.J.]. P. Bange PSM, Zur Geschichte des Mutterhauses in den Kriegsjahren 1939-1945. Nachlaß Br. Alfred Rochat SAC [unverzeichnet]. Provinzarchiv der Pallottinerinnen, Limburg (=PASACSr) Chronik des Klosters Marienborn, Bd. 4; Lohnunterlagen des Klosters Marienborn; Chronik des Schwesternhauses Maria Hilf Pfarrarchiv St. Maria Himmelfahrt, Marienstatt Pfarrchronik 1939-1941 Pfarrarchiv St. Martin, Lorch Korrespondenzen Pfarrarchiv St. Josef-Bornheim, Frankfurt am Main Pfarrchronik, Bd. 8 Quellen aus staatlichen Archiven Hessisches Hauptstaatsarchiv, Wiesbaden Abt. 483 Nr. 7019 Berichte des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS, Außenstelle Limburg, betr. Überwachung von Firmen [1937-1941] Abt. 520 Spruchkammerakten Institut für Stadtgeschichte (Stadtarchiv), Frankfurt am Main (=IfSGF) Hausstandsbücher Magistratsakte 3.837 Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen und polnischen Arbeitskräften (1939-1945) Gestapo-Kartei Vorortakten Höchst 175 Stadtarchiv, Montabaur (=StAMt) Abt. 4, Nr. 1235 Kriegsgefangenenlager Abt. 5, Nr. 37 Ausländische Kriegsgefangene Abt. 10, Nr.1235 Zweiter Weltkrieg Luftschutz: Kriegsgefangenenlager (1939-1943) Abt. 10, Nr.1236 Zweiter Weltkrieg Luftschutz: Kriegsgefangenenlager (1943-1945) Stadtarchiv, Wiesbaden (= StAWi) WI/2 Selekt „Ostarbeiterkartei“ Schriftliche Mitteilungen P. Gottfried Krebs OFM, Marienthal, 4.8.2000. Sr. Philippa Rath OSB, Eibingen, 4.8.2000. Br. Probus Bakker FMM, Provinzarchiv der Barmherzigen Brüder, Montabaur, 10.8. und 19.10.2000. Sr. Magdalene Klein SAC, 12.8.2000, 6.3.2001. Pfarrer Christoph Wurbs, Hochheim, 17.8.2000. Abt Dr. Thomas Denter OCist, Marienstatt, 21.8.2000. P. Provinzial Helmut Schlegel OFM, Fulda, 24.8.2000. Bundesarchiv, Berlin, 6.9.2000. Rheinland-Pfälzisches Landeshauptarchiv, Koblenz, 26.9.2000. Sr. Lucinda Grams ADJC, Dernbach, 30.9.2000, 15.6.2001. Katholisches Pfarramt Herz-Jesu, Diez, 19.10.2000. P. Prof. Dr. Werner Löser SJ, Frankfurt/Main, 2.1.2001. Provinzoberin Sr. M. Luciosa Benz (Franziskanerinnen von Aachen), 13.2.2001. Bundesarchiv - Militärarchiv -, Freiburg/Brsg., 16.2.2001. Provinzialat der Kongregation der Töchter der Göttlichen Liebe, Wien, 20.2.2001. P. Provinzial Meinolf von Spee SDB, Köln, 20.2.2001. P. Martin Pfeifer OFM, Fulda, 13.3.2001. Pfarrer Michael Metzler, Frankfurt, 23.3.2001. Amt für Paß- und Meldewesen der Stadt Geisenheim, 22.5. und 19.6.2001. Bezirksdekan Otto-Peter Franzmann, Geisenheim, o.D. Karl Josef Kettel, Frankfurt am Main, 21.6.2001. Mündliche Mitteilungen Abt Dr. Thomas Denter OCist, Marienstatt, 11.8.2000. Frau Ute Hollinghaus, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Frankfurt/Main, 26.10.2000. Pfarrer i.R. Ferdinand Eckert, Bad Soden, 11.11.2000. Lutz Becht, Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, 8.12.2000. Dr. Konrad Schneider, Institut für Stadtgeschichte Frankurt am Main, 18.1.2001. Pfarrer i.R. Albert Zell, Assmansshausen, 1.2. und 11.6.2001. Sr. Christine Bohr SAC, London, 26.2.2001. Sr. Simona Kastenholz ADJC, Limburg/Lahn, 8.6.2001 Sr. Simone Weber ADJC, Limburg/Lahn, 8.6.2001. Frau Käthe Augstein, Lorch/Rh., 11.6.2001. Stadtverwaltung Lorch/Rh., 20.6.2001. Amtliche Hilfsmittel AMTSBLATT des Bistums Limburg 1938ff. DIDIER, Friedrich (Bearb.), Handbuch für die Dienststellen des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz und die interessierten Reichsstellen im Großdeutschen Reich und in den besetzten Gebieten, Bd. 1, Berlin 1944. HANDBUCH des Bistums Limburg, hg. vom Bischöflichen Ordinariat Limburg, Limburg/Lahn 1956. HERTEL, Philipp, Arbeitseinsatz ausländischer Zivilarbeiter, Stuttgart 1942. KROSE, Hermann, Kirchliches Handbuch für das katholische Deutschland, hg. von der Zentralstelle für kirchliche Statistik Deutschlands, Köln 1943. NECROLOGIUM der seit Gründung des Bistums Limburg verstorbenen Diözesangeistlichen für das tägliche Memento in der hl. Messe, Limburg/Lahn o.J. REICHSGESETZBLATT 1938ff. REICHSMINISTERIALBLATT des Inneren 1941. SCHEMATISMUS der Diözese Limburg, bearbeitet durch den Bischöflichen Sekretär, hg. vom Bischöflichen Ordinariat, Limburg/Lahn 1936. VOLLMACHTEN für die Kriegsseelsorge, hg. vom Erzbischöflichen Ordinariat in Breslau, Breslau o. J. [1940]. Ausgewählte Spezialliteratur zum Thema Zwangsarbeit AUGUST, Jochen u.a., Herrenmensch und Arbeitsvölker. Ausländische Arbeiter und Deutsche 1939-1945 (Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik 3), Berlin 1986. BARWIG, Klaus/SAATHOFF, Günter/W EYDE, Nicole (Hg.), Entschädigung für NS-Zwangsarbeit. Rechtliche, historische und politische Aspekte, Baden-Baden 1998. EIKEL, Markus, Französische Katholiken im Dritten Reich. Die religiöse Betreuung der französischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter 1940-1945, Freiburg/Brsg. 1999. HELBACH, Ulrich, Quellen in Registraturen und Archiven der Katholischen Kirche zur Erforschung der Zwangsarbeit in Deutschland 1939 bis 1945, in: Klaus Barwig/Dieter R. Bauer/Karl-Joseph Hummel (Hg.), Zwangsarbeit in der Kirche. Entschädigung, Versöhnung und historische Aufarbeitung (Hohenheimer Protokolle 56), Stuttgart 2001 (im Druck). HERBERT, Ulrich, Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-Einsatzes“ in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, Bonn 31999 (11985). DERS., Europa und der „Reichseinsatz“. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge in Deutschland 1938-1945, Essen 1991. KÖRNER, Hans Michael, Das staatliche Regelwerk für die Zwangsarbeiter, in: Peter Pfister (Hg.), Katholische Kirche und Zwangsarbeit. Stand und Perspektiven der Forschung (Schriften des Archivs des Erzbistums München und Freising 1), Regensburg 2001, 19-23. PFAHLMANN, Hans, Fremdarbeiter und Kriegsgefangene in der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945 (Beiträge zur Wehrforschung 16/17), Darmstadt 1968. PFISTER, Peter (Hg.), Katholische Kirche und Zwangsarbeit. Stand und Perspektiven der Forschung (Schriften des Archivs des Erzbistums München und Freising 1), Regensburg 2001. SCHÄFER, Annette, Zwangsarbeiter und NS-Rassenpolitik: Russische und polnische Zwangsarbeiter in Württemberg 1939-1945. Eine Untersuchung zur Rolle der NS-Rassenpolitik und ihrer Umsetzung in der Praxis (Veröffentlichungen der Kommission für Geschichte und Landeskunde in BadenWürttemberg B. 143), Stuttgart, Berlin, Köln 2000. SEEBER, Eva, Zwangsarbeiter in der faschistischen Kriegswirtschaft. Die Deportation und Ausbeutung polnischer Bürger unter besonderer Berücksichtigung der Lage der Arbeiter aus dem sogenannten Generalgouvernement (1939-1945), Berlin 1964. SPOERER, Mark, Zwangsarbeit im Dritten Reich, Verantwortung und Entschädigung, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 51 (2000), 508-527. DERS., Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa 1939-1945, Stuttgart 2001. W EINMANN, Martin (Hg.), Das nationalsozialistische Lagersystem (CCP), Frankfurt/Main 31998. Sonstige Darstellungen APOLD, Hans, Feldbischof Franz Justus Rarkowski im Spiegel seiner Hirtenbriefe. Zur Problematik der katholischen Militärseelsorge im Dritten Reich, in: Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde des Ermlands 100 (1978), 86-128. BECHT, Lutz, Ausländische Arbeitskräfte und Arbeitseinsatz in Frankfurt am Main 1938-1945, in: Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst 65 (1999), 422-472. BECKERT, Sven, Bis zu diesem Punkt und nicht weiter. Arbeitsalltag während des Zweiten Weltkrieges in einer Industrieregion Offenbach-Frankfurt, Frankfurt/Main 1990. BEMBENECK, Lothar, Widerstand und Verfolgung in Wiesbaden 1933-1945: Eine Dokumentation, hg. vom Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden, Gießen 1990. BOBERACH, Heinz (Bearb.), Berichte des SD und der Gestapo über Kirchen und Kirchenvolk in Deutschland 1934-1944 (VKZG A. 12), Mainz 1971. BUXBAUM, E.M., Peter Lötschert genannt Bruder Ignatius, Kehl 1995. CAJANI, Luigi, Die italienischen Militär-Internierten im nationalsozialistischen Deutschland, in: Ulrich Herbert (Hg.), Europa und der „Reichseinsatz“. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und KZHäftlinge in Deutschland 1938-1945, Essen 1991, 295-316. CHROUST, Peter u.a. (Hg.), „Soll nach Hadamar überführt werden.“ Den Opfern der Euthanasiemorde 1939 bis 1945. Gedenkausstellung in Hadamar. Katalog, Frankfurt/Main 1989. CRONE, Marie-Luise, Die Niederlassungen in Limburg (Das Kloster Bethlehem 1883-1992), in: Norbert Zabel (Hg.), Die Orden im Bezirk Limburg seit der Gründung des Bistums Limburg, Selters/Taunus 1992, 55-59. [1] DIES., Die Niederlassungen in Limburg (Das Heppelstift 1912-1952), in: Norbert Zabel (Hg.), Die Orden im Bezirk Limburg seit der Gründung des Bistums Limburg, Selters/Taunus 1992, 68-71. [2] DIES., Die Niederlassungen in Limburg (Das Bischöfliche Priesterseminar 1895-), in: Norbert Zabel (Hg.), Die Orden im Bezirk Limburg seit der Gründung des Bistums Limburg, Selters/Taunus 1992, 64-66. [3] DIES., Ein Wohltäter im Kriegsgefangenenlager Stalag XII A bei Limburg: Johann Klein (1895-1977), in: Nassauische Annalen 109 (1998), 333-348. [4] DENZLER, Georg/FABRICIUS, Volker, Christen und Nationalsozialisten. Darstellung und Dokumente, Frankfurt/Main 1993. DIAMANT, Adolf, Gestapo Frankfurt am Main. Zur Geschichte einer verbrecherischen Organisation 19331945, Frankfurt am Main 1988. Ein jeder bedenke ... (FS 100 Jahre Pallottinerinnen in Limburg), Limburg a. d. Lahn 1995. Einhundert Jahre Marienhausen. Von der „Oaschdald“ zum Zentrum der Jugendhilfe, o.O. o.J. Einhundert Jahre Sozialdienst katholischer Frauen in Frankfurt. Hilfe von Mensch zu Mensch, Frankfurt a. M. 2001. EINHUNDERT Jahre Ursulinen Frankfurt M./Königstein Ts. FS hg. vom Ursulinenkloster St. Angela Königstein im Taunus, Frankfurt am Main 1980. FENDEL, Heinrich (Hg.), Festschrift aus Anlaß des 100jährigen Jubiläums des St. Vinzenz-Hospitals in Limburg an der Lahn, Limburg a. d. Lahn 1950. FERENC, Tone, „Absiedler“. Slowenen zwischen „Eindeutschung“ und Ausländereinsatz, in: Ulrich Herbert (Hg.), Europa und der „Reichseinsatz“. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge in Deutschland 1938-1945, 200-209. FIRTEL, Hilde, Pfarrer Albert Perabo. Ein Wandel in der Liebe, Frankfurt am Main 1965. Die Erlenbader Franziskanerinnen. Festschrift zur Hundertjahrfeier 1976, Erlenbad 1976. FÜHRKÖTTER, Adelgundis, Die Benediktinerinnenabtei St. Hildegard zu Eibingen. Das erste Frauenkloster der Beuroner Kongregation auf deutschem Boden und seine Bedeutung für die Hildegardforschung, in: AmrhKG 32 (1980), 135-146. Fünfzig Jahre Marienstatt. Festgabe zum Tage der Wiederbesiedlung 1888-1938, hg. von den Cisterciensern in Mehrerau, Bregenz o.J. [1938]. GATZ, Erwin, Kirche und Krankenpflege im 19. Jahrhundert, München 1971. [1] DERS. (Hg.), Der Diözesanklerus (Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts 4), Freiburg/Brsg. 1995. [2] Zum GEDÄCHTNIS an das 100jährige Jubiläum der Genossenschaft der Barmherzigen Brüder von Montabaur 1856-1956, hg, vom Generalvorstand des Barmherzigen Brüder, Limburg/Lahn o.J. [1956]. GEIBIG, Johannes, Die fünf Äbte des Centenariums 1888-1988, in: Einhundertjahre Wiederbesiedlung der Abtei Marienstatt (1888-1988), hg. von den Mönchen der Abtei Marienstatt (Marienstatter Aufsätze 6), Marienstatt 1988, 113-141. GOLDMANN, Maria Andrea, In St. Ursulas Gefolge. Vom Werden, Wachsen und Wirken des UrsulinenKlosters in Frankfurt a. M. und seiner Filialen, Frankfurt/Main 1935. HAMMER, Gabriel, Die Pfarrei Marienstatt in Geschichte und Gegenwart, in: 750 Jahre Abteikirche Marienstatt. Festschrift zur Kirchweihe 1977 (Marientatter Aufsätze 5), Marienstatt 1977, 115-150. HASELBECK, Gallus, Wie Kelkheim zu einem Kloster kam und Pfarrei wurde. Zum Goldenen Jubiläum der Franziskaner in Kelkheim, Fulda o.J. [1959]. HENKEL, Günter, Ein Brief aus Bjelorußland. - „Wir wohnten in einem Lager der Stadt Montabaur“, in: Montabaur: Von Schulen, Straßen, Bahnhöfen, hg. vom Stadtarchiv Montabaur (Schriftenreihe zur Stadtgeschichte von Montabaur 3), Montabaur o.J. [1995], 79-95. HILDEBRAND, Klaus, Das Dritte Reich (Oldenbourg Grundriss der Geschichte 17), München 41991. HILPISCH, Georg, Die Genossenschaft der Barmherzigen Brüder von Montabaur. Eine kurze Geschichte ihrer Entstehung und Entwicklung bis zur Gegenwart, Wiesbaden 1926. HOCKERTS, Hans Günter, Ausblick: Kirche im Krieg. Aspekte eines Forschungsfeldes, in: Peter Pfister (Hg.), Katholische Kirche und Zwangsarbeit. Stand und Perspektiven der Forschung (Schriften des Archivs des Erzbistums München und Freising 1), Regensburg 2001, 47-55. HORSMANN, H., 60 Jahre Pallottinerinnen in Limburg, in: Jahrbuch des Bistums Limburg 1955, 45-48. HÜRTEN, Heinz, Deutsche Katholiken 1918-1945, Paderborn u.a. 1992. KEMPNER, Benedicta Maria, Nonnen unter dem Hakenkreuz. Leiden - Heldentum - Tod,Würzburg 1979. KLOTH, Albert, Meine Erinnerungen an die Kriegszeit in Marienstatt 1939-1945, in: Einhundertjahre Wiederbesiedlung der Abtei Marienstatt (1888-1988), hg. von den Mönchen der Abtei Marienstatt (Marienstatter Aufsätze 6), Marienstatt 1988, 168-185. KNAUFT, Wolfgang, Ein Ukrainer in Berlin. Petro Werhun wird vom Papst während dessen Ukraine-Reise selig gesprochen, in: Der Sonntag Nr. 25 vom 24.6.2001. KOERNER, Hans Michael, Der Sog des Totalitären. Katholische Kirche und polnische Zwangsarbeiter 1939-1945, in: Rheinischer Merkur Nr. 30 vom 28. Juli 2000. DERS., Katholische Kirche und polnische Zwangsarbeiter 1939-1945, in: Historisches Jahrbuch 112 (1992), 128-142. LAU, Ephrem E., Die Pallottinerinnen (1895-), in: Norbert Zabel (hg.), Die Orden im Bezirk Limburg seit der Gründung des Bistums Limburg, Selters/Taunus 1992, 193-197. LEUGERS, Antonia, Gegen eine Mauer bischöflichen Schweigens. Der Ausschuß für Ordensangelegenheiten und seine Widerstandskonzeption 1941 bis 1945, Frankfurt/Main 1996. LÖSER, Werner, Sankt Georgen 1926 bis 1951, Frankfurt am Main 2001. LUCZAK, Czeslaw, Polnische Arbeiter im nationalsozialistischen Deutschland während des zweiten Weltkrieges. Entwicklungen und Aufgaben der polnischen Forschung, in: Ulrich Herbert (Hg.), Europa und der „Reichseinsatz“. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge in Deutschland 1938-1945, Essen 1991, 90-105. MANTELLI, Bruno, Von der Wanderarbeit zur Deportation. Die italienischen Arbeiter in Deutschland 19381945, in: Ulrich Herbert (Hg.), Europa und der „Reichseinsatz“. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge in Deutschland 1938-1945, 51-89. MÜLLER-W ERTH, Herbert, Geschichte und Kommunalpolitik der Stadt Wiesbaden unter besonderer Berücksichtigung der letzten 150 Jahre, Wiesbaden 1963. Mut zum Weitergehen. 125 Jahre Gemeinde St. Josef Frankfurt am Main – Bornheim, Frankfurt am Main 1994. NICOLAY, Wilhelm, 80 Jahre caritatives Wirken der Frankfurter Franziskanerinnen, Frankfurt a. M. 1956. PFEIFER, Martin, Thuringia 1933 bis 1945. Überlebensstrategien einer deutschen Franziskanerprovinz im Dritten Reich, in: Einhundert Jahre Wiedererrichtung der Thuringia, hg. vom Provinzialat der Thüringischen Franziskanerprovinz, Fulda 1994, 122-148. Priester in Uniform. Seelsorger, Ordensleute und Theologen als Soldaten im Zweiten Weltkrieg, hg. vom Katholischen Militärbischofsamt und Hans-Jürgen Brandt (Quellen und Studien zur Geschichte der Militärseelsorge 10), Augsburg 1994. RAAB, Hermann-Josef, Die Niederlassung in Balduinstein (1930 - ), in: Norbert Zabel (Hg.), Die Orden im Bezirk Limburg seit der Gründung des Bistums Limburg, Selters/Taunus 1992, 275-278. REPGEN, Konrad, Die deutschen Bischöfe und der Zweite Weltkrieg, in: Historisches Jahrbuch 115 (1995), 411-451. SCHÄFER, Rudolf, Chronik von Höchst am Main, Frankfurt 1986. SCHATZ, Klaus, Geschichte des Bistums Limburg (QAmrhKG 48), Mainz 1983. SCHÜTZEICHEL, Wilhelm, Die Niederlassungen in Limburg (1892 - ). Die Pallottiner (1892 - ), in: Norbert Zabel (Hg.), Die Orden im Bezirk Limburg seit der Gründung des Bistums Limburg, Selters/Taunus 1992, 188-193. SKOLASTER, Hermann, P.S.M. in Limburg a. d. Lahn, Limburg a. d. Lahn 1935. STAUDT, Alois, Die Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC, Dernbacher Schwestern), in: Norbert Zabel (Hg.), Die Orden im Bezirk Limburg seit der Gründung des Bistums Limburg, Selters/Taunus 1992, 28-32. STILLE, Eugen, Limburg an der Lahn und seine Geschichte. Ein Überblick, Kassel 1971. STREITENBERGER, Lothar, Kongregation der Franziskanerinnen von Erlenbad, in: Norbert Zabel (Hg.), Die Orden im Bezirk Limburg seit der Gründung des Bistums Limburg, Selters/Taunus 1992, 215-217. STRUCK, Wolf-Heino, Geschichte der Stadt Geisenheim, Frankfurt/Main 1972. STRUPPMANN, Robert, Chronik der Stadt Lorch im Rheingau, Lorch 1981. Unser gemeinsamer Weg. 150 Jahre Bistum Limburg, Frankfurt/Main 1977. Unter S. Ursulas heiligem Banner. Vom Wachsen und Wirken des Ursulinenklosters in Frankfurt a.M. und seiner Filialen, o.A., Düsseldorf o.J. VOLK, Ludwig (Bearb.), Akten deutscher Bischöfe zur Lage der Kirche 1933-1945, Bd. V: 1940-1942, Bd. VI: 1943-1945 (VKZG A. 34, 38), Mainz 1983, 1985. VON HEHL, Ulrich/KÖSTERS, Christoph (Bearb.), Priester unter Hitlers Terror. Eine biographische und statistische Erhebung (VKZG A. 37), Paderborn u.a. 41998. W EIMER, Erhard, Die Niederlassung in Elz (1893-1987), in: Norbert Zabel (Hg.), Die Orden im Bezirk Limburg seit der Gründung des Bistums Limburg, Selters/Taunus 1992, 92-96. W ELLSTEIN, Gilbert, Die Cisterzienserabtei Marienstatt im Westerwald, Limburg/Lahn 1955. W INTERHALDER, Christoph, Einhundert Jahre Franziskaner in Marienthal/Rheingau. Gebundene Zusammenstellung von Jubiläums-Beiträgen aus: Thuringia Franziscana 1977-1979, Exemplar vorhanden in: Bischöfliches Ordinariat Limburg/Lahn, Präsenzbibliothek des Kirchenbucharchivs. ZABEL, Norbert (Hg.), Die Orden im Bezirk Limburg seit der Gründung des Bistums Limburg, Selters/Taunus 1992. ZENETTI, Lothar, Unser Priesterseminar, in: Jahrbuch des Bistums Limburg 1953, 15-18. Abkürzungen Bl. Blatt BO Bischöfliches Ordinariat CCP Catalog of Camps and Prisons Cist. Chron. Cistercienser-Chronik DAF Deutsche Arbeitsfront DAL Diözesanarchiv Limburg DP Displaced Persons DRK Deutsches Rotes Kreuz FMM Barmherzige Brüder von Montabaur (Fratres Misericordiae de Montabaur) FS Festschrift GAFMM Generalats-Archiv der Barmherzigen Brüder von Montabaur HB Hausstandsbuch HHStAW Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden ISD Internationaler Suchdienst IfSGF Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main KLV Kinderlandverschickung KZ Konzentrationslager Lit. Literatur MSC Missionsschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu/Hiltrup NL Nachlaß NS Nationalsozialismus NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSV Nationalsozialistische Volkswohlfahrt o.pag ohne Paginierung OCist Zisterzienser (Ordo Cisterciensis) Offlag Offizierslager OFM Ordo Fratrum Minorum (Franziskaner) OKW Oberkommando der Wehrmacht OSB Benediktiner/innen (Ordo Sancti Benedicti) PA Personalakte PAADJC Provinzarchiv der Armen Dienstmägde Jesu Christi PAMSC Provinzarchiv der Missionsschwestern vom Hlst. Herzen Jesu von Hiltrup PASAC Provinzarchiv der Pallottiner PASACSr Provinzarchiv der Pallottinerinnen PfA Pfarrarchiv PSM Pallottiner/innen (Pia Societas Missionum) Q. Quelle RABl. Reichsarbeitsblatt RAD Reichsarbeitsdienst RGBl. Reichsgesetzblatt RLG Reichsleistungsgesetz RM Reichsmark RMfdkA Reichsministerium für die kirchlichen Angelegenheiten RSHA Reichssicherheitshauptamt SAC Pallottiner/innen (Societas Apostolatus Catholici) SD Sicherheitsdienst SDB Salesianer Don Boscos SSCC Arnsteiner Patres (Congregatio Sacrorum Cordium Jesu et Mariae) Stalag Stammlager StAMt Stadtarchiv Montabaur StAWi Stadtarchiv Wiesbaden UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration VO Verordnung


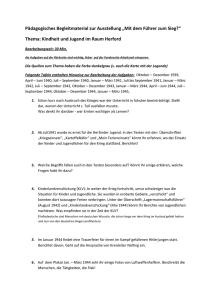
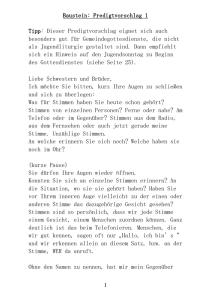
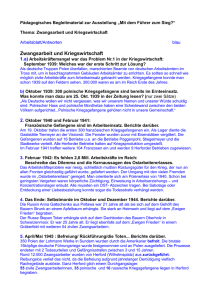
![Hygiene 07_2015 vortrag für homepage [Kompatibilitätsmodus]](http://s1.studylibde.com/store/data/001314430_1-1944b1df5af794fde2e45508c516504c-300x300.png)