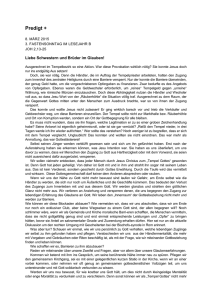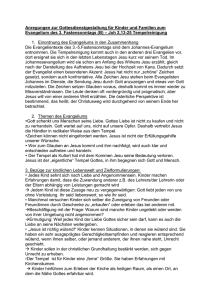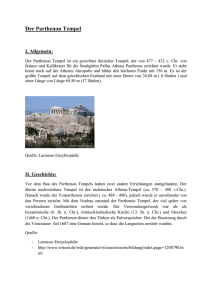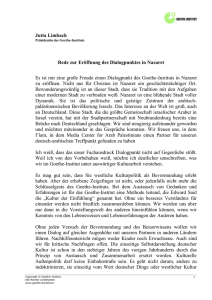Predigt Lukas 2,41-53 „Der Neugierige“ (Reihe: „Jesusgesichter“ I)
Werbung
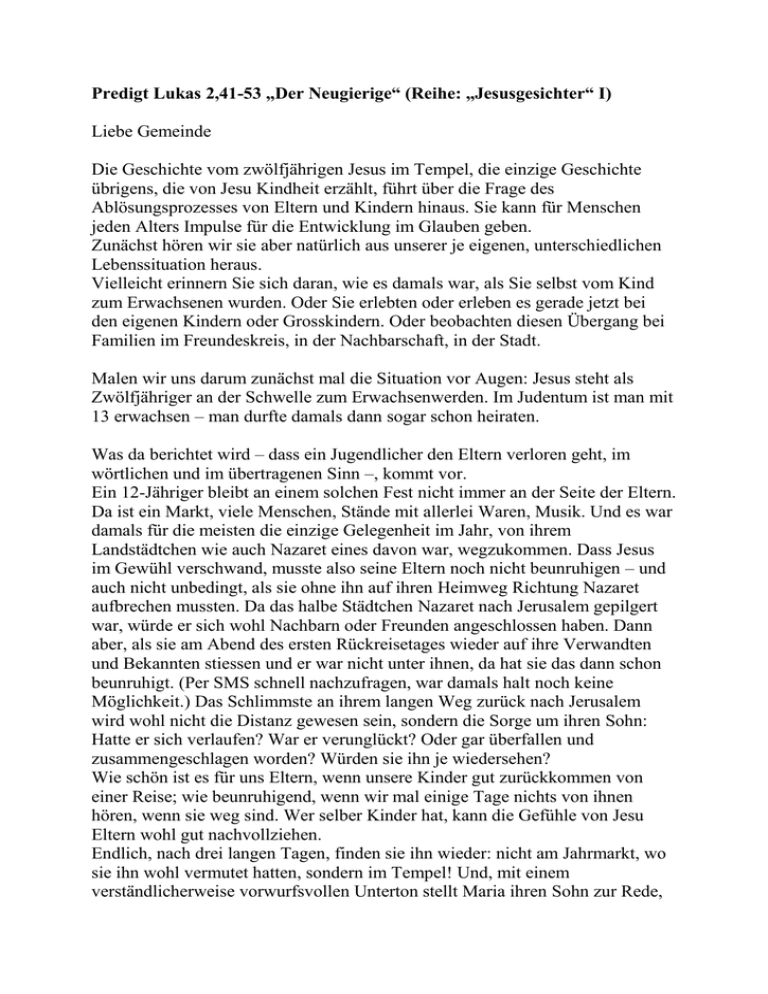
Predigt Lukas 2,41-53 „Der Neugierige“ (Reihe: „Jesusgesichter“ I) Liebe Gemeinde Die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel, die einzige Geschichte übrigens, die von Jesu Kindheit erzählt, führt über die Frage des Ablösungsprozesses von Eltern und Kindern hinaus. Sie kann für Menschen jeden Alters Impulse für die Entwicklung im Glauben geben. Zunächst hören wir sie aber natürlich aus unserer je eigenen, unterschiedlichen Lebenssituation heraus. Vielleicht erinnern Sie sich daran, wie es damals war, als Sie selbst vom Kind zum Erwachsenen wurden. Oder Sie erlebten oder erleben es gerade jetzt bei den eigenen Kindern oder Grosskindern. Oder beobachten diesen Übergang bei Familien im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, in der Stadt. Malen wir uns darum zunächst mal die Situation vor Augen: Jesus steht als Zwölfjähriger an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Im Judentum ist man mit 13 erwachsen – man durfte damals dann sogar schon heiraten. Was da berichtet wird – dass ein Jugendlicher den Eltern verloren geht, im wörtlichen und im übertragenen Sinn –, kommt vor. Ein 12-Jähriger bleibt an einem solchen Fest nicht immer an der Seite der Eltern. Da ist ein Markt, viele Menschen, Stände mit allerlei Waren, Musik. Und es war damals für die meisten die einzige Gelegenheit im Jahr, von ihrem Landstädtchen wie auch Nazaret eines davon war, wegzukommen. Dass Jesus im Gewühl verschwand, musste also seine Eltern noch nicht beunruhigen – und auch nicht unbedingt, als sie ohne ihn auf ihren Heimweg Richtung Nazaret aufbrechen mussten. Da das halbe Städtchen Nazaret nach Jerusalem gepilgert war, würde er sich wohl Nachbarn oder Freunden angeschlossen haben. Dann aber, als sie am Abend des ersten Rückreisetages wieder auf ihre Verwandten und Bekannten stiessen und er war nicht unter ihnen, da hat sie das dann schon beunruhigt. (Per SMS schnell nachzufragen, war damals halt noch keine Möglichkeit.) Das Schlimmste an ihrem langen Weg zurück nach Jerusalem wird wohl nicht die Distanz gewesen sein, sondern die Sorge um ihren Sohn: Hatte er sich verlaufen? War er verunglückt? Oder gar überfallen und zusammengeschlagen worden? Würden sie ihn je wiedersehen? Wie schön ist es für uns Eltern, wenn unsere Kinder gut zurückkommen von einer Reise; wie beunruhigend, wenn wir mal einige Tage nichts von ihnen hören, wenn sie weg sind. Wer selber Kinder hat, kann die Gefühle von Jesu Eltern wohl gut nachvollziehen. Endlich, nach drei langen Tagen, finden sie ihn wieder: nicht am Jahrmarkt, wo sie ihn wohl vermutet hatten, sondern im Tempel! Und, mit einem verständlicherweise vorwurfsvollen Unterton stellt Maria ihren Sohn zur Rede, macht ihm den Schmerz und die Angst, den sie als Eltern durchlitten haben, bewusst. Jesus auf der anderen Seite versucht – wie es scheint, vergeblich – seinen Eltern deutlich zu machen, dass er seinen eigenen Weg gehen musste. Hand aufs Herz, liebe Eltern: Im Prinzip wünschen wir unseren Kindern, wenn sie erwachsen werden, dass sie ihre eigenen Wege suchen und finden. Und doch: Tun wir uns nicht manchmal schwer damit, sie wirklich loszulassen, besonders wenn sie auf ihrem Weg weit von uns weggehen, sei es, geografisch gesehen, sei es, dass sie sich von dem entfernen, was uns selbst wertvoll und wichtig ist? Und ganz ähnlich wie bei Jesus mag es dann von Seiten unserer Jugendlichen tönen: „Ihr versteht mich halt nicht.“ Der Weg, den Jesus gehen musste, führte ihn also in den Tempel: Da konnte er die Fragen stellen, die ihn im Zusammenhang mit Gott und der Welt beschäftigten, konnte diskutieren mit den Lehrern – sozusagen ein konzentriertes Stück Konfirmandenunterricht, was sich da abspielte. Nicht dass alle Jugendlichen in seinem Alter den gleichen „Zug“ in den Tempel hätten wie Jesus. Aber dass die meisten ebenfalls von grundsätzlichen Fragen bewegt werden – Fragen über ihr Leben, ihre Zukunft, über Gott und das Gute und Böse auf der Welt, das beobachte ich schon so, etwa bei meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden – auch wenn sie solche Fragen nicht immer zuvorderst auf der Zunge haben. Betrachten wir die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel aber nun noch einmal – und diesmal mit etwas Abstand: Welche Impulse gibt sie uns – auch solchen, die nicht Jugendliche oder Eltern sind – für die Entwicklung unseres Glaubens? Da spielt schon mal der Anlass der Reise nach Jerusalem eine Rolle: das Passafest. Es ist das höchste Fest, zu welchem Jesus mit seiner Familie aus Nazaret und Menschen aus dem ganzen Land nach Jerusalem pilgern. Das Passafest erinnert daran, dass die Israeliten, bevor sie aus Ägypten auf ihren langen Weg durch die Wüste aufgebrochen sind, ungesäuertes, also im Grunde genommen „unfertiges“ Brot gegessen haben. Das heisst doch: All das, was unfertig ist in unserem Leben, all das, was vielleicht noch unausgegoren ist, was nicht einfach rund und schön und geordnet ist, muss uns nicht daran hindern, zu feiern. Ein solches Fest gibt die Kraft, aufzubrechen – im Vertrauen, dass Gott mit uns ist: auf dem Weg ins Erwachsenenleben hinein, bei jedem neuen Auszug, bei jedem Exodus, zu dem uns die Umstände des Lebens manchmal zwingen oder den wir aus freien Stücken unter die Füsse nehmen. Und jedes Jahr wird dieses Passafest gefeiert, es ist eine inzwischen Jahrtausende alte Tradition. Das gibt Sicherheit, und es verbindet mit den anderen Mitfeiernden. Das ist „Religio“, Religion, im lateinischen Wortsinn: Rückbindung. Das jährliche Feiern eines Festes gibt Halt im Jahreslauf und im Leben überhaupt, denken wir etwa an das Weihnachtsfest bei uns mit all seinen Bräuchen. Beim Passafest ist es auf eine heilsame Weise paradox: Gerade das wichtigste Fest der jüdischen Tradition will immer neu den Mut geben, aufzubrechen ins Leben hinaus, in der Zuversicht, dabei auch Gott immer wieder auf neue Weise erfahren zu können. Die Erinnerung an die Geschichte vom Auszug des Volkes Israel, von seiner Befreiung aus der Sklaverei will Menschen, will auch uns immer neu auf den Weg in die Freiheit führen und das Vertrauen schenken, dass Gott mit uns unterwegs ist. Gerade die Rückbindung an die Vergangenheit kann also eine gute Zukunft eröffnen. Und Jesus hat in der Tat, ohne die Tradition über Bord zu werfen, einen neuen, einen eigenständigen Aufbruch gewagt, einen Aufbruch im Glauben. Wie ein solcher Aufbruch vor sich gehen kann, das zeigt unsere Geschichte sehr schön. Jesus hört im Tempel zu. Einfach zuhören zunächst, die Ohren offen halten, die Gedanken an sich herankommen lassen. Und dann spüren: Das löst Fragen aus bei mir. Da werde ich neugierig, will weiterbohren, will mehr wissen. Fragen stellen und nicht locker lassen. Uninspirierend ist dagegen das Zusammensein mit einem Menschen, der keine Fragen hat, nur Antworten, der altklug bloss seine Sicht der Welt darstellt und von allem zu wissen vorgibt: „So ist es.“ Die Begegnung zwischen Jesus und den Lehrern im Tempel jedoch ist ein lebendiger Austausch. Sie beschränkt sich nicht darauf, dass er als Knabe bloss fragt und die Erwachsenen auf alles eine Antwort aus dem Ärmel schütteln könnten. Nein, das Gespräch geht offenbar hin und her. Jesus bringt seinen Verstand ein, wirft selber auch seine Antworten in die Runde. Und er muss nicht der einzige Jugendliche bleiben, auf dessen Fragen und Antworten zu hören auch für Erwachsene sich lohnt! Jesus tut, was Theologie tut: Er befragt das religiös Selbstverständliche. Er geht gedanklich über den blossen Vollzug der Religion und ihrer Bräuche hinaus. Er befragt den Brauch, das, „was immer schon so war“. Theologie ist das kritische Nachdenken über das Religiöse. Und wie diese Geschichte zeigt, soll sie nicht einfach Fachleuten überlassen werden, liebe Theologen-Kolleginnen und -Kollegen, wenn ich Sie so ansprechen darf. Für uns alle, die wir einen mündigen Erwachsenenglauben leben wollen, gehört es also dazu, dass wir unsere Religion nicht nur ausüben, sondern auch fragend, suchend, diskutierend uns damit auseinander setzen. Was dabei entsteht, ist wie eine Helix, eine dreidimensionale Spirale, einer Wendeltreppe ähnlich: Fragen treiben Antworten hervor, Antworten wecken wieder neue Fragen. Es ist nicht so, dass die Einen die Fragen haben und die Anderen die Antworten. Vielmehr haben beide beides. Darum ist es ganz natürlich, dass viele Fragen erst nach und nach aufkommen, im Lauf des Lebens, und nicht schon von Anfang an da sind. Auch bei Glaubensfragen ist das so. Im Lauf der drei Tage – drei ist übrigens die Zahl für das Spirituelle, das Göttliche – kommt es zu einer für die Eltern nicht schmerzlosen Ablösung: Jesus wird sich bewusst: Sein Weg führt immer stärker weg von den eigenen Eltern, sein göttlicher Vater wird immer wichtiger für ihn. Vielleicht können wir unsere Kinder aber doch besser loslassen, wenn wir darauf trauen, dass sie Gotteskinder sind und bleiben, und wir Erwachsene ebenfalls – und zwar so, wie es uns aus dieser Geschichte entgegenkommt: Als erwachsen werdendes Gotteskind ist Jesus gerade nicht unmündig und still. Ein Gotteskind stellt erwachsene Fragen an die Religion; liebt die religiöse Tradition und das kritische Nachdenken darüber; will nicht nur Stimmungen und Gefühle erleben, sondern möchte auch verstehen, was ihm Gott, der Grund seines Lebens, bedeutet. Und dann? Die Geschichte berichtet zum Schluss, Jesus sei wieder mit seiner Familie nach Nazaret zurückgekehrt – „gehorsam“, wie es heisst. Ich war als Jugendlicher ein bisschen enttäuscht von diesem Schluss: Ist von diesem neugierigen, spannenden, diskutierenden Jesus nichts mehr da? Kehrt er einfach wieder schön brav in den Schoss der heiligen Familie zurück? Wenn ich heute darüber nachdenke, habe ich den Eindruck: So einfach ist es nicht. Er kehrt als ein anderer zurück, er weiss nun von mehr. Äusserlich gesehen ändert sich nicht viel. Bis er etwa 30 ist, lebt er in den ärmlichen Verhältnissen seiner Heimatstadt Nazaret. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für uns: Dass wir uns, unser Leben lang, ohne dass wir die Türen zuschlagen müssten zu den Menschen um uns, ruhig und unspektakulär entwickeln, gute eigene Wege im Leben und im Glauben einschlagen. Und dabei wie es von Jesus heisst „zunehmen an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.“ Amen.