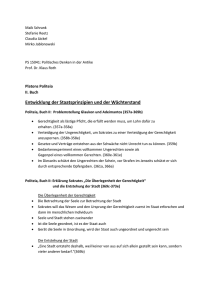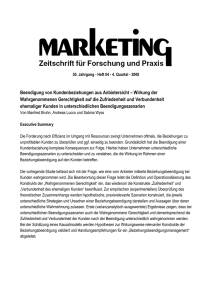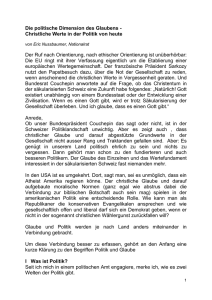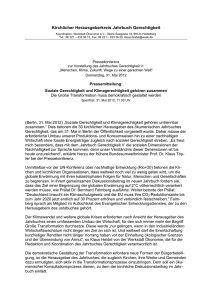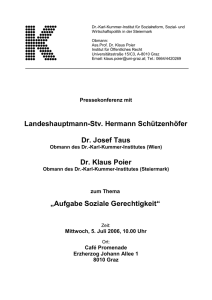christliche Werte in der österreichischen Verfassung
Werbung
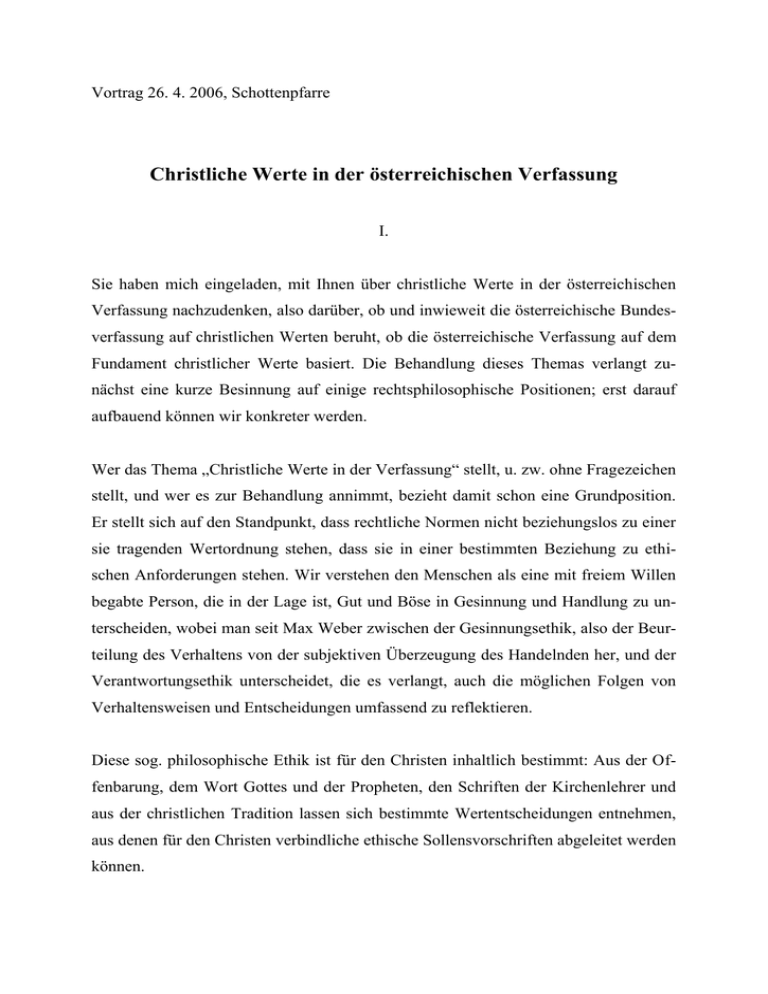
Vortrag 26. 4. 2006, Schottenpfarre Christliche Werte in der österreichischen Verfassung I. Sie haben mich eingeladen, mit Ihnen über christliche Werte in der österreichischen Verfassung nachzudenken, also darüber, ob und inwieweit die österreichische Bundesverfassung auf christlichen Werten beruht, ob die österreichische Verfassung auf dem Fundament christlicher Werte basiert. Die Behandlung dieses Themas verlangt zunächst eine kurze Besinnung auf einige rechtsphilosophische Positionen; erst darauf aufbauend können wir konkreter werden. Wer das Thema „Christliche Werte in der Verfassung“ stellt, u. zw. ohne Fragezeichen stellt, und wer es zur Behandlung annimmt, bezieht damit schon eine Grundposition. Er stellt sich auf den Standpunkt, dass rechtliche Normen nicht beziehungslos zu einer sie tragenden Wertordnung stehen, dass sie in einer bestimmten Beziehung zu ethischen Anforderungen stehen. Wir verstehen den Menschen als eine mit freiem Willen begabte Person, die in der Lage ist, Gut und Böse in Gesinnung und Handlung zu unterscheiden, wobei man seit Max Weber zwischen der Gesinnungsethik, also der Beurteilung des Verhaltens von der subjektiven Überzeugung des Handelnden her, und der Verantwortungsethik unterscheidet, die es verlangt, auch die möglichen Folgen von Verhaltensweisen und Entscheidungen umfassend zu reflektieren. Diese sog. philosophische Ethik ist für den Christen inhaltlich bestimmt: Aus der Offenbarung, dem Wort Gottes und der Propheten, den Schriften der Kirchenlehrer und aus der christlichen Tradition lassen sich bestimmte Wertentscheidungen entnehmen, aus denen für den Christen verbindliche ethische Sollensvorschriften abgeleitet werden können. 2 Es ist nun eine Grundfrage rechtstheoretischer Reflexionen, mit der sich die Rechtsphilosophie seit jeher befasst hat, wie sich derartige Handlungsmaximen zu den Normen des Rechts verhalten. Hier wurden und werden bekanntlich die unterschiedlichsten Auffassungen vertreten: Auf der einen Seite stehen die in den Frühformen der Rechtsentwicklung vertretenen Auffassungen der nicht weiter differenzierten Einheit von Recht, Sitte und Moral. Recht beruht auf eingelebten und eingeübten gesellschaftlichen Verhaltensregeln, deren Zielsetzung bzw. Geltungsbedingungen nicht weiter in Frage gestellt und keiner ausdrücklichen Rechtfertigung unterzogen werden. Diese Einheitsvorstellung von Recht und Moral bleibt auch in der geschichtlichen Entwicklung bis in die Neuzeit herrschend; erst seit der Aufklärung wird der Trennungsaspekt betont. Für den Heiligen Thomas etwa ist das Recht ein Teil der vorgegebenen sittlichen Ordnung, die auf die Verwirklichung des Guten ausgerichtet ist. Es wird aber immer mehr dem Recht auch die Aufgabe zugeschrieben, jenen sittlichen Forderungen Geltung zu verschaffen, die für das gesellschaftlich-politische Zusammenleben der Menschen im Zeichen des Gemeinwohls unabdingbar sind. Zwar ist es primär Aufgabe des Menschen aus sich selbst heraus, d. h. aus der Entscheidung seines Gewissens die sittlichen Forderungen zu erfüllen; verfehlt er aber diese Aufgabe, so soll er zur Erfüllung seiner gesellschaftlichen Verpflichtungen durch rechtlichen Zwang angehalten werden. In diesem Sinn hat auch der Heilige Thomas dem Recht eine sittenbildende Kraft beigemessen. Dem steht die Auffassung von der völligen Trennung von Recht und Moral gegenüber, wie sie vor allem in 19. und 20. Jahrhundert entwickelt worden ist. Diese Trennungsthese wurde vor allem im Rahmen der verschiedenen Richtungen des Rechtspositivismus vertreten, eine Extremposition hat hier die Wiener Schule der Rechtstheorie um Hans Kelsen eingenommen. Das Recht sei in seinem Geltungsanspruch völlig unabhängig von moralischen Forderungen und bedürfe auch keinerlei moralischen Rechtfertigung. 3 Verbunden ist diese Auffassung zumeist mit dem Standpunkt eines Wertrelativismus, wonach es überhaupt keine allgemein verbindlichen moralischen Grundsätze gebe. Recht durch Moral rechtfertigen zu wollen oder in den Dienst der Verwirklichung moralischer Grundsätze zu stellen, stelle eine unzulässige ideologische Anmaßung dar, für die in der Rechtswissenschaft kein Platz sei. Das mir heute gestellte Thema lässt sich sinnvoll nur behandeln, wenn man beide Extrempositionen ablehnt. Die Einheitsthese führte - wenn man sie in aller Konsequenz zu Ende denkt - zu einer unzulässigen Verquickung moralischer und rechtlicher Ansprüche und vor allem: Moralisches Handeln ist ein Handeln aus Freiheit - und so etwas kann vom Recht nicht erzwungen werden. Zwang zum moralisch Guten wäre ein Widerspruch in sich. Die Einsicht in die Individualität des Menschen und in seinen freien Willen verträgt sich nicht mit einem rechtlichen Zwang zum Guten. Recht kann und darf die Freiheit der Entscheidung nicht erzwingen, hat sie aber zu ermöglichen. Es vermag Bedrohungen der Freiheit zwangsweise abzuwehren und reale Bedingungen der Freiheitsentfaltung zu schaffen und zu garantieren und vor allem: Es vermag negative Auswirkungen der Freiheitsausübung durch einen auf andere Menschen in Schranken zu halten. Aber auch der Trennungsthese ist zu widersprechen und gerade im Gefolge der schrecklichen politischen Erlebnisse des vergangenen Jahrhunderts wurde ihr auch immer wieder widersprochen. Recht als verpflichtende Sollensordnung zu akzeptieren, gleichgültig wozu sie verpflichtet, ist uns nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus und des Stalinismus unerträglich geworden. Aber nicht nur politisch, auch rechtstheoretisch lässt sich gegen die Trennungsthese argumentieren: Die Verbindlichkeit des Rechts lässt sich allein aus der Tatsache seiner Setzung als positives Recht nicht begründen. Es bliebe dabei nämlich unbeantwortet, warum man durch rechtliche Normen überhaupt verpflichtet werden kann, warum man ihnen gehorchen soll. 4 Die Erfahrung zeigt, dass die Befolgung rechtlicher Normen ein Mindestmaß an Akzeptanz bedarf und die Akzeptanz ist ohne sittliche Untermauerung von Rechtsvorschriften nicht zu erreichen. Recht bedarf eben der sittlichen Untermauerung, um überhaupt seine Funktion als Friedensordnung erfüllen zu können. II. Was sind nun diese Kernelemente der sittlichen Fundierung des Rechts ? Wenn man sich diese Frage stellt, kommt man nicht darum herum, sich zunächst mit dem Postulat der Gerechtigkeit zu befassen. Zu Beginn meines Studiums habe ich im Jahr 1958 in einer Einführungsvorlesung von Karl Wolff, dem zivilrechtlichen Zentrum der Wiener Schule des Rechtspositivismus, den Satz gehört: „Recht hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun“. Er meinte damit nicht nur, dass die Anforderungen der Gerechtigkeit andere seien, als die Anforderungen des positiven Rechts, sondern er vertrat damit die vorhin erwähnte Trennungsthese in schärfster Ausprägung. Mich hat dieses Erlebnis erschüttert. Ich muss dazu sagen, dass ich in den letzten Jahren meiner Gymnasialzeit von meinem Vater angeleitet auch ein bisschen Aristoteles gelesen habe, zwar entgegen seinem Willen nicht in einer griechischen, sondern in einer doppelsprachigen Ausgabe, aber immerhin. Und von daher wusste ich, dass Aristoteles den Satz geprägt hat, Recht sei, was der Gerechtigkeit entspreche. Und in der Vorlesung aus Römischem Recht lernte ich den Satz des bedeutenden römischen Juristen Celsus kennen, der Recht als „ars boni et aequi“ bezeichnete, also die Kunst, dem Guten und Angemessenen Geltung zu verschaffen. Ich habe mir damals gesagt, dass ich einfach nicht glaube, dass Rechts- und Staatsphilosophen durch Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch einer völlig unsinnigen Vorstellung nachgegangen sein sollen, wenn sie sich um Recht und Gerechtigkeit bemüht haben, wenn Isaias vom Gottesknecht erwartet hat, dass er Recht und Gerechtigkeit 5 bringen wird, wenn der Psalmist im Psalm 85 die Gerechtigkeit als Voraussetzung für eine Friedensordnung mit den Worten umschrieben hat: „Gerechtigkeit und Friede küssen sich“ und wenn Denker wie ein Thomas von Aquin oder ein Immanuel Kant sich um die Relation der Begriffe von Recht und Gerechtigkeit bemüht haben. Und ich beschloss damals - ohne jede nähere Reflexion und genauere Kenntnis - mich der These zu verschreiben, dass das positive Recht der Gerechtigkeit entsprechen soll, und zu versuchen, das in meiner juristischen Arbeit umzusetzen - dass das einmal als Forscher, Lehrer und Verfassungsrichter zu tun sein wird, wusste ich damals freilich noch nicht. In den Jahrzehnten meiner Beschäftigung mit diesen Fragen hat sich dieser Standpunkt erhärtet, er hat mich aber auch zunehmend mit zwei zentralen Fragen beschäftigt, ja geradezu gequält: Was ist dieses Sollen ? Ist es eine rechtliche Kategorie oder ist es seinerseits nur eine ethische Anforderung an den, der Recht schafft, Gesetze erlässt oder Recht anwendet, sei es als Richter, Verwaltungsorgan oder Privatperson, der mit anderen einen Vertrag schließt ? Bestimmte Grundsätze der Gerechtigkeit sind wohl Bestandteil unserer Rechtsordnung geworden. So hat der OGH einmal formuliert, sie seien so allgemein anerkannt, „daß es zu ihrer Anwendung keiner besonderen Gesetzesbestimmung bedarf; sie durchbrechen selbst die geschriebene Norm“ (SZ 47, 104). Und die zweite Frage ist natürlich die Frage nach dem Inhalt der Gerechtigkeit. Objektiv kann man sich dem sicher nur annähern - und das nur auf hohem Abstraktionsniveau. Aber aus christlicher Sicht lässt sich die Frage in den Kernelementen beantworten, auch wenn wir natürlich alle wissen , dass wir bei der Beantwortung einer konkreten Frage, ob das oder das gerecht ist, unterschiedlicher Auffassung sein können. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, ob die christlichen Werte, die wir aus der Offenbarung und der christlichen Tradition beschreiben können, eine Entsprechung im positiven Recht finden. 6 III. Ein Teilbereich dieser Frage ist unser heutiges Thema. Die Frage ist, ob der österreichischen Verfassungsordnung in diesem Sinn christliche Werte zugrunde liegen. Die Frage ist für mich mit einem klaren Ja zu beantworten. In einer Verfassungsordnung, - die die Freiheit und Würde der Person garantiert und den Gleichheitsgrundsatz gewährleistet, - die auf den verfassungsmäßigen Prinzipien von Demokratie, Gewaltenteilung und Rechtsstaat, - auf der grundsätzlichen Trennung von Staat und Gesellschaft, - auf dem Prinzip der rechtlichen Gebundenheit des Staates - und der Garantie einer grundsätzlich marktwirtschaftlichen Ordnung aufbaut, es aber ermöglicht, diese im Interesse des Gemeinwohls zu lenken, können alle jene Inhalte, die man mit der christlichen Auffassung von Gerechtigkeit in Verbindung bringt, nachgewiesen werden. Lassen Sie mich zu den einzelnen eben genannten Aspekten in der notwendigen Kürze etwas sagen. 1. Die Garantie der Würde und Freiheit der Person Tragendes Prinzip jener verfassungsrechtlichen Bestimmungen, die das Verhältnis der Gemeinschaft zum Einzelnen betreffen, ist das Prinzip der Würde des Menschen, das insbesondere in den Freiheitsrechten und im Gleichheitsgrundsatz Ausdruck findet. Bevor wir uns diesen beiden konkreten Aspekten zuwenden, möchte ich aber die Menschenwürde und die Notwendigkeit ihrer Sicherung in ihrer Grundsätzlichkeit ins Auge zu fassen. Seine letzte Rechtfertigung findet der Grundgedanke der Menschenwürde in der „Imago Dei-Lehre“: Gott hat den Menschen - wie wir in der Genesis lesen - nach 7 seinem Bild, als sein Abbild, geschaffen; und der Hl. Paulus hat den Grundsatz der Gottesebenbildlichkeit des Menschen in den Zusammenhang der Mittlerfunktion Christi gestellt, wenn er vom Glanz Christi spricht, der das Bild Gottes ist, und schreibt, die Menschen seien dazu bestimmt, Christus gleich zu sein, dem Erstgeborenen unter den Geschwistern. Diese Lehre findet ihren vollendeten Ausdruck in der Weihnachtsoratio der ältesten Gebetssammlung der Westkirche, dem „Sacramentarium Leonianum“, die mit den Worten beginnt, die später Eingang in das Opferungsgebet der Heiligen Messe nach dem tridentinischen Ritus gefunden hat: „Gott, der du den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert hast“. Von diesem Grundverständnis des Menschen als einer mit Würde ausgestatteten und dementsprechend zu respektierenden Person geht schon § 16 des ABGB aus 1811 aus, der zur Zeit seiner Entstehung so etwas wie Grundrechtscharakter hatte und als „Zentralnorm unserer Rechtsordnung“ bezeichnet worden ist: „Jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte“. In Österreich wird häufig übersehen, dass das Anliegen des Schutzes der Menschenwürde auch verfassungsrechtlich grundgelegt ist, und zwar zunächst schon dadurch, dass die Präambel der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte, die Verfassungsrang aufweist, auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948 verweist, die mit den Worten beginnt: „Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet, (verkündet die Generalversammlung die vorliegende Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ...). Das ist positives Verfassungsrecht, wird aber in der Literatur unglaublicherweise verdrängt: Im Standardlehrbuch von Walter und Mayer findet sich der Begriff Menschenwürde nicht einmal im Sachregister und im Handkommentar von Mayer ist die Präambel zur MKR nicht einmal abgedruckt. 8 Aber ich möchte auf noch etwas hinweisen: Der Verfassungsgerichtshof hat in einer Entscheidung aus 1993 unter ausdrücklichem Hinweis auf die ausführliche Ableitung zum Rechtsgrundsatz der Personen- und Menschenwürde bei Franz Bydlinskis „Fundamentalen Rechtsgrundsätzen“ den Rechtsgrundsatz der Menschenwürde als „allgemeinen Wertungsgrundsatz unserer Rechtsordnung“ bezeichnet, der es insbesondere ausschließt, dass ein Mensch jemals als bloßes Mittel für welche Zwecke immer betrachtet und behandelt werden darf. Manche versuchen, diese zentrale Aussage als obiter dictum abzutun. Das ist es aber nicht. Es ist eine ganz bewusst gewählte Formulierung. Und ihr kommt meiner Ansicht nach im Rahmen der heute herrschenden Grundrechtsdogmatik besondere Bedeutung zu, in der wir bestimmte staatliche Schutzpflichten zur Sicherung der Grundrechte anerkennen. An dieser Kernaussage darf der Staat nicht vorbeigehen, wenn es etwa um Fragen der Privatheit von Menschen, oder - um ein anderes aktuelles Beispiel zu nennen - um Fragen der Medizinethik geht. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass der Grundsatz der Menschenwürde vor allem im Gleichheitsgrundsatz und in den Freiheitsrechten zum Ausdruck kommt. Diesen beiden verfassungsrechtlichen Regeln möchte ich mich nunmehr zuwenden: 2. Die Gleichheit als „Kern der Gerechtigkeit“ Aristoteles hat in seiner Nikomachischen Ethik den Gerechten als einen Freund der Gleichheit bezeichnet und formuliert, dass die Gleichheit der Kern der Gerechtigkeit sei. 9 Der Grund für diese Verknüpfung liegt im Folgenden: Wenn Rechte und Pflichten, Güter und Lasten auf gerechte Weise verteilt werden sollen, bedarf es dazu eines Maßstabes, der allgemeine Geltung besitzt. Aristoteles fand ihn im Prinzip der Proportionalität. Dieses Prinzip anzuwenden bedeutet, die Menschen in allen gleichgelagerten Fällen auch gleich zu behandeln, also willkürliche Ungleichbehandlung zu unterlassen. Das schließt ein Diskriminierungsverbot in sich und verbietet unsachliche Differenzierungen. Der Zusammenhang von Gleichheitsgebot und materialer Gerechtigkeit, auf dem vor allem der große deutsche Staatsrechtslehrer Leibholz hingewiesen hat, wird schon rein sprachlich deutlich, wenn von der Notwendigkeit der sachlichen Rechtfertigung die Rede ist. Zweifellos: in der Demokratie hat der Gesetzgeber zu entscheiden, was er wie regelt. Und es gibt für ihn einen relativ großen rechtspolitischen Gestaltungsspielraum. Aber eine sachlich nicht zu rechtfertigende Norm darf er nicht erlassen; das verbietet ihm die Verfassung und der Verfassungsgerichtshof hat darüber zu wachen, dass dieser Rahmen nicht verletzt wird. Martin Schlag hat darauf hingewiesen, dass es die distributive Gerechtigkeit ist, die den Kern der verfassungsgerichtlichen Judikatur zur sachlichen Rechtfertigung ausmacht. In der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes spielt die Ausgestaltung und Anwendung des Gleichheitsgrundsatzes eine ganz große Rolle - nicht nur in seinem ohnehin einleuchtenden Kerngehalt, sondern darüber hinaus: Aus ihm ist der Vertrauensgrundsatz entwickelt worden, das Verbot, rückwirkend Belastungen einzuführen und die Anforderung, dass sich rechtliche Regelungen stets sachlich rechtfertigen lassen müssen. Und der Verfassungsgerichtshof hat den Gleichheitsgrundsatz sogar einmal (15.373/1998) als wesentlichen Bestandteil der Grundrechtsordnung und des demokratischen Prinzips bezeichnet, der eben deshalb einen veränderungsfesten Kern hat, was bedeutet, dass dem Verfassungsgesetzgeber zwar ein gewisser Spielraum zur Konkretisierung des Gleichheitsgrundsatzes, aber keine Ermächtigung zu seiner Beseitigung zukommt. Der Grundsatz der Gleichheit ist al- 10 so nicht nur vor der Beliebigkeit gesetzgeberischer Akte, sondern in seinem Kern auch vor der Beliebigkeit des Verfassungsgesetzgebers geschützt. 3. Die Freiheitsgewährungen und die Schranken für die Ausübung der Freiheit Der Grundrechtskatalog der österreichischen Verfassung garantiert vielfältige Ausprägungen der umfassenden grundlegenden Freiheit auf persönlichem, kulturellem, wirtschaftlichem und politischem Gebiet: Der Schutz des Lebens, der Privatsphäre und der Familie, der Schutz vor menschenunwürdiger Behandlung, die Garantie der persönlichen Freiheit, der Schutz der Grundrechte der Religion, der Schutz der Grundrechte des Eigentums und die übrigen Grundrechte des Wirtschaftslebens, die Grundrechte der Vereinigungs-, Koalitions- und Versammlungsfreiheit, der Schutz der Meinungsäußerungsfreiheit und viele andere Freiheitsverbürgungen sind hier zu nennen. Auch in ihnen kommt eine ethische Grundhaltung unserer Verfassungsordnung zum Tragen, die Anerkennung der Willensentscheidung zum Gebrauch der Freiheit. Da aber der Gebrauch der Freiheit immer auch mit Gefährdungen der Freiheit anderer, aber auch mit Gefährdungen des Gemeinwohls einhergehen kann, erlaubt die Verfassung dem Gesetzgeber, der Ausübung der Freiheit Schranken zu setzen, allerdings nur soweit, wie sie in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse bestimmter Ziele, wie der nationalen Sicherheit und territorialen Unversehrtheit, der öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral, des Schutzes des guten Rufes und der Rechte anderer notwendig sind. Die moderne Grundrechtsdogmatik hat erkannt, dass die Verfassung damit unverhältnismäßige Eingriffe in die Freiheitspositionen verbietet, aber auch, dass den Freiheitsgewährleistungen gewisse Schutzpflichten immanent sind; der Gesetzgeber und die zur Vollziehung der Gesetze Berufenen haben die Verpflichtung, den 11 Gebrauch der Freiheit zu ermöglichen, etwa Meinungspluralität zu sichern, die ungestörte Religionsausübung zu garantieren und Versammlungen zu schützen, Rechtsvorschriften zu erlassen und zu vollziehen, die unsere Privatheit schützen, Manipulationen an Menschen ausschließen - um nur einige Beispiele zu nennen. Und sie haben bei der Beschränkung der Freiheit auf Grundrechtspositionen anderer und auf Gemeinwohlerfordernisse Rücksicht zu nehmen: So ist im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren der Grundrechtsgebrauch zu ermöglichen - denken sie an den Schutz einer rechtmäßigen Versammlung vor gewaltsamer Störung und andererseits kann - um wieder ein Beispiel zu nennen - die Kunstfreiheit eingeschränkt werden, etwa, um grundlegende religiöse Gefühle von Menschen zu schützen - denken Sie an das Verbot des Filmes „Das Liebeskonzil“ oder an die Einschränkung des Tierschutzes durch die Erlaubnis zum rituellen Schächten. Freilich, die Eingriffe müssen verhältnismäßig bleiben und dürfen die Grundrechtsverbürgungen nicht übermäßig einschränken. Das stellt den Gesetzgeber und noch mehr den diesen kontrollierenden Verfassungsgerichtshof oft vor schwere Wertungsentscheidungen. Hier geht es also darum, die rechtsethischen Elemente der Verfassung in die konkrete Rechtswirklichkeit zu übertragen. Und das sind sehr häufig selbst wieder Entscheidungen, die man nur aus seinem Gewissen heraus treffen kann. IV. Einen rechtsethischen Gehalt im christlichen Sinn glaube ich aber auch in einigen Prinzipien unserer Verfassung ausmachen zu können. Dabei möchte ich auf zwei Aspekte im Speziellen hinweisen, auf die Regeln über die Demokratie und auf das Prinzip der grundsätzlichen Trennung von Staat und Gesellschaft. Denn ein so konstituierter Staat anerkennt die Verantwortungsethik der auf den verschiedenen Ebenen - im Staat und in der Gesellschaft - handelnden Personen. Und in diesem Sinn liegt dem 12 Entwurf des Staates ein bestimmtes Menschenbild zugrunde, das eines ethisch verantwortlichen Ich darf wieder auf die einzelnen genannten Aspekte kurz eingehen: 1. Das Prinzip der Demokratie Wenn in Art 1 B-VG in programmatischer Weise festgelegt ist, dass Österreich eine demokratische Republik ist, dann kommt darin auch ein ganz bestimmtes Menschenbild zum Ausdruck. Die Verfassung sieht ihn im aristotelischthomasischen Sinn als ein seiner Natur nach politisches Wesen, das gefordert ist, an der Willensbildung des Staates mitzuwirken. Diese Anerkennung des Menschen als einer aktiv gestaltenden Person geht von einem ganz bestimmten Menschenbild aus, das an den Menschen Anforderungen einer Verantwortungsethik stellt, wie wir sie zu Beginn dieses Referats kurz in den Blick genommen haben. Es war Pius XII., der in seiner berühmt gewordenen Weihnachtsbotschaft im Jahr 1944 so eindringlich betont hat, welche hohe sittliche Anforderungen die demokratische Ordnung an den Einzelnen stellt. Es hängt - sagte er damals - vom moralischen Charakter und dem Verantwortungsgefühl der Bürger ab, ob die Demokratie gelingen kann. Und er betonte insbes. die Notwendigkeit, sich nicht nur der eigenen Rechte und Pflichten bewusst zu sein, sondern dies mit der Achtung vor der Freiheit und Würde des anderen zu verbinden. Und für diejenigen, die im Auftrag des Volks zu regieren haben, nennt er überdies drei Voraussetzungen für ihr Tun: Sie müssen erkennen, worauf ihre Autorität beruht Sie müssen den sittlichen und geistigen Anforderungen an Träger öffentlicher Gewalt entsprechen und 13 sie müssen ihre Bindung an das Recht erkennen und anerkennen. Hier kommt uns die klassische Formulierung in den Sinn, mit der Macchiavelli dem jungen Fürsten von Florenz, Lorenzo, erklärt hat: Ihr müsst Euch nämlich dessen bewusst sein, dass es zweierlei Arten von Auseinandersetzung gibt - die mit Hilfe des Rechts und die mit Hilfe der Gewalt. Jene eignet dem Menschen, diese dem Tier. Wie aktuell das alles ist. Was ich zeigen wollte, ist, dass die Entscheidung einer Verfassung für die Demokratie bestimmte ethische Anforderungen an die Menschen stellt, ein bestimmtes Menschenbild voraussetzt. 2. Das Prinzip der rechtlichen Gebundenheit des Staates und der Trennung von Staat und Gesellschaft „Der Mensch darf von Rechts wegen alles, was ihm nicht ausdrücklich verboten ist; das Organ, letztlich der Staat, kann nur das, was ihm rechtlich ausdrücklich ermöglicht, was in seine Kompetenz gestellt ist“. Dieser klassische Satz Adolf Merkls zeigt den prinzipiellen Unterschied in der Rechtsstellung des Einzelnen und in der Rechtsstellung des Staates in einem demokratisch-liberalen Rechtsstaat und macht deutlich, dass in einem derartigen Staat die Staatsgewalt eine rechtlich verliehene, geordnete und kontrollierte Gewalt ist. Im Rechtsstaat sei es der Sinn aller Staatsgewalt, so formulierte René Marcic, „daß Menschen nicht dem subjektiven Willen von Menschen, sondern dem objektiven Sinn von Normen unterworfen sind“. Die österreichische Bundesverfassung entspricht dem geschilderten Typ des Rechtsstaates. Nur insoweit dem Staat und den für ihn handelnden Organen explizit die Kompetenz zur Besorgung von Aufgaben zugewiesen ist, dürfen sie tätig werden. Bei der Gestaltung derartiger rechtlicher Regeln ist die erwähnte Verantwortungsethik in der Demokratie gefordert. Aber - und das ist die Kehrseite des 14 von mir zitierten Satzes von Adolf Merkl - überall dort, wo etwas nicht in die ausdrückliche Kompetenz des Staates gestellt ist, ist der Einzelne in seiner ethischen Verantwortung selbst gefordert: gefordert, in Freiheit und Verantwortung die Spielräume der Rechtsgestaltung zu nutzen. Darin kommt das Prinzip einer grundsätzlichen Trennung von Staat und Gesellschaft zum Ausdruck - Gesellschaft verstanden als Beziehungsgefüge der Einzelnen und der von ihnen gebildeten Gruppen zueinander. Dabei ist der Ausdruck „Trennung“ freilich nicht so zu verstehen, als ob es keine Verbindung zwischen den beiden Ordnungssystemen des Staates und der Gesellschaft gäbe, sondern so, dass - und hier fasse ich einen insb. von Herbert Schambeck näher entfalteten Gedanken zusammen - die beiden grundsätzlich verschiedene, aber aufeinander bezogene Ordnungsbereiche sind, die einander aber kraft konstitutioneller Grundentscheidung unaufhebbar gegenüberstehen. Die Gesellschaft ist eine rechtlich organisierte und kontrollierte, im Übrigen aber freie Koordinationsordnung der Bürger und wird gewährleistet insbesondere durch die Existenz von Grund- und Freiheitsrechten und die verfassungsrechtliche Anerkennung des Prinzips der Privatautonomie. Der Ordnungsbereich des Staates ist dagegen rechtlich durch das Verfassungsrecht eingerichtet und determiniert, aus dem insbesondere folgt, dass jede Rechtssetzungs- und Zwangsgewalt auf einer rechtlich umgrenzten staatlichen Ermächtigung zu beruhen hat. Während für den Bereich des Staates das dominierende Strukturprinzip das der Demokratie ist, ist es im Bereich der Gesellschaft von Verfassungs wegen das Prinzip der Freiheit. Und dass beide Prinzipien in der christlichen Wertordnung ihren Platz finden, habe ich versucht aufzuzeigen. 15 V. Was ich bisher zu den christlichen Wurzeln der österreichischen Verfassung gesagt habe, bezog sich aufs Grundsätzliche: Einerseits auf die den Menschen unmittelbar betreffenden Bezüge der Garantie der Würde der Person, der Gleichheit und der Gewährung von Freiheit, andererseits auf Strukturelemente der Verfassungskonzeption, die den Menschen als ethisch verantwortliches Wesen voraussetzen, sei es, dass ihn die Freiheit zur Gestaltung im nicht-staatlichen, gesellschaftlichen Bereich überlassen ist, sei es, dass ihm die Rolle des Mitgestalters im demokratischen Gemeinwesen zuerkannt ist. Ich muss der Vollständigkeit halber aber auch noch darauf hinweisen, dass die Verfassungsordnung darüber hinaus eine Reihe von ganz konkreten Aussagen enthält, die das sittliche Sollen ansprechen und - in der Begrifflichkeit der katholischen Soziallehre dem Prinzip der Solidarität zuzuordnen sind. Es sind das insbesondere einige der so genannten Staatszielbestimmungen, wie das Bekenntnis zum umfassenden Umweltschutz oder zur Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Mann und Frau und zur Gewährleistung der Gleichbehandlung von behinderten und nicht behinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens. Aber auch die Grundrechte der Minderheiten und das BVG gegen alle Formen rassischer Diskriminierung möchte ich in diesem Zusammenhang nennen. All diese Verfassungsbestimmungen haben eine christlich-ethische Dimension. Sie enthalten eine Entscheidung zugunsten bestimmter Werte und postulieren ein sittliches Handeln. Diese Postulate sind nach zutreffender Ansicht aber nicht bloß sanktionslose Bekenntnisse, sondern haben einen juristisch-normativen Gehalt. Das ist für die Grundrechte der Minderheiten völlig klar, das hat der Verfassungsgerichtshof aber auch in der Entfaltung des Bundesverfassungsgesetzes gegen alle Formen rassischer, religiöser, ethnischer oder nationaler Diskriminierungen klargestellt, das er überdies zu einer umfassenden Gleichheitsverbürgung für Fremde und ein gegen Fremde wirkendes Willkürverbot entwickelt hat. Er hat aber etwa auch im Zusammenhang mit dem 16 Bekenntnis zum umfassenden Umweltschutz schon mehrfach ausgesprochen, dass es hier um normative Festlegungen geht und das trifft auch für die anderen genannten Gewährleistungen zu. Darf ich ein Beispiel nennen: Es kann in bestimmten Konstellationen unzulässig sein, Aufwendungen von nicht behinderten Menschen und behinderten Menschen steuerlich gleich zu behandeln. Der Verfassungsgerichtshof hat einmal etwa einen Steuerbescheid aufgehoben, der den Einbau eines rollstuhlgeeigneten Aufzuges in ein zweistöckiges Einfamilienhaus einer Familie, in der eines der Familienmitglieder auf einen Rollstuhl angewiesen war, in gleicher Weise behandelt hat, wie andere Umbauarbeiten oder Verbesserungen; diese werden ja bekanntlich nach dem Grundsatz, dass eine bloße Vermögensumschichtung steuerlich unbeachtlich bleiben soll, nicht als steuermindernd gewertet. Bei Investitionen, die der tatsächlichen Gleichstellung von behinderten und nicht behinderten Menschen dienen, ist so etwas eben nicht mehr zulässig. Es stört nicht, dass als Vehikel zur Durchsetzung derartiger Bestimmungen letztlich meistens der Gleichheitsgrundsatz herangezogen wird; der Sache nach geht es um die Realisierung bestimmter ethischer Elemente in der Verfassung. VI. Ich habe damit meinen tour d’ horizon abgeschlossen, in dem ich Ihnen zu zeigen versucht habe, dass die ethische Sollensordnung und die rechtliche Sollensordnung nicht beziehungslos nebeneinander stehen, dass die österreichische Verfassungsordnung von einem Menschenbild ausgeht, das den ethisch verantwortlichen Menschen zur Voraussetzung hat und dass viele grundlegende Bestimmungen der österreichischen Bundesverfassung ihr Fundament in zentralen christlichen Werten, insb. in der Menschenwürde, finden, die sich auf die Lehre von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen gründet. 17 Aber auf eine Frage habe ich noch keine Antwort gegeben: Ich habe eingangs gefragt, welcher Natur dieses Sollen ist, das von uns verlangt, das positive Recht der Gerechtigkeit entsprechend zu gestalten und zu realisieren ? Ist dieses Sollen eine rechtliche Kategorie oder seinerseits nur eine ethische Anforderung an den Rechtserzeuger und Rechtsanwender ? Ich meine, dass sich die Antwort auf diese Frage aus den Ergebnissen, die ich zu präsentieren versucht habe, von selbst ergibt: In einer Rechtsordnung wie der österreichischen, die die Freiheit und Würde der Person garantiert, die Gleichheit als grundlegendes Prinzip festschreibt und die auf den Verfassungsprinzipien von Demokratie, Gewaltenteilung und Rechtsstaat aufbaut, auf der grundsätzlichen Trennung von Staat und Gesellschaft und dem Prinzip der rechtlichen Gebundenheit des Staates sind diese Gehalte rechtsethischer Natur Bestandteil des positiven Rechts. Die genannten Verfassungsgrundsätze liegen in unserer Rechtsordnung als teils geschriebene, teils ungeschriebene Leitlinie dem gesamten Rechtsbestand zugrunde; sie können aus der positiven Rechtsordnung heraus abgeleitet und entwickelt werden. Sie haben damit verfassungsrechtliche Qualität und ihnen widersprechende Normen wären als verfassungswidrig aus dem Rechtsbestand auszuscheiden.