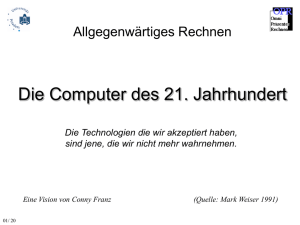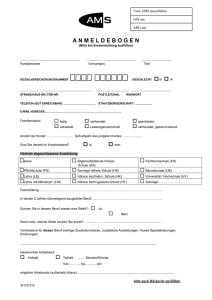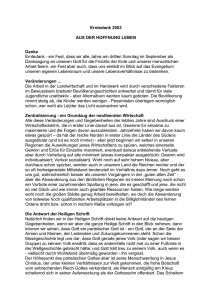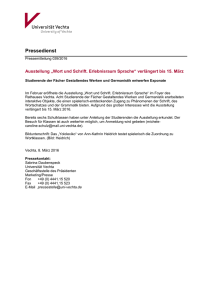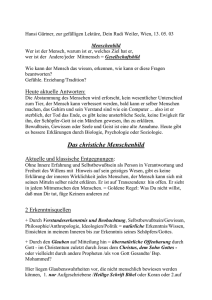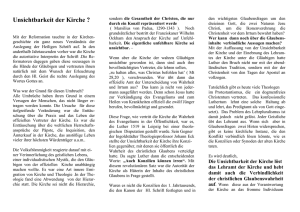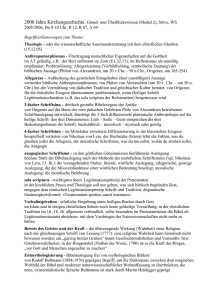„Schrift im Zentrum des frühbeginnenden Fremdsprachenunterrichts
Werbung

Die Schrift als Weg und Ziel beim frühen Fremdsprachenlernen.“ am Beispiel von Englisch / Französisch / Deutsch Dr. Jürgen Mertens Pädagogische Hochschule Freiburg VORTRAG FOLIE 1 - 11 Folie 2 Überblick Folie 3 / Vortragsteil Primat des Mündlichen Wirft man einen Blick auf die in den Rahmenrichtlinien und Lehrplänen zum frühen Fremdsprachenlernen formulierten Richtzielkataloge, so fällt auf, dass die in pädagogisch-interkulturell orientierten Ansätzen („Begegnung mit Sprachen“, „Lerne die Sprache des Nachbarn“ „integrative Fremdsprachenarbeit“) gewonnenen Erkenntnisse an Bedeutung verloren haben und das bildungspolitische Pendel in Richtung der „Priorität der sprachlichen Zielsetzung“ (Sauer 2000: 5) ausschlägt. Dabei ist das fremdsprachliche Lernen in der Grundschule weitgehend auf den Erwerb mündlich-kommunikativer Sprachkompetenz ausgerichtet. Begründet wird diese Schwerpunktsetzung zum einen mit Erfahrungen aus dem Fremdsprachenunterricht der Sekundarstufe I, wo der Erwerb der Schriftsprache (d.h. Lesen und (Recht-)Schreiben) allein auf Nachsprechen bzw. Abschreiben sowie Auswendiglernen beruht und die Schüler aufgrund eines engen Zusammenhangs von Orthographieerwerb und Leistungsfeststellung an der Fremdsprache scheitern (vgl. Gompf / Karbe 1995); weitere Vorbehalte, denken wir an die Interferenzgefahr und das Lernalter der Kinder, sind linguistischer oder päda1 gogisch-psychologischer Natur. Dem Schriftlichen wird überwiegend eine Randposition zugewiesen.1 Diese Position ist genauso wenig die meine, wie die, die einer Polarisierung von einerseits interkulturell-pädagogischen und andererseits sprachlichen Zielen das Wort redet. Es gilt zu berücksichtigen, dass es die Aufgabe der Grundschule ist, „die nötigen Freiräume für ein Lernen zu schaffen, bei dem [...] eine Öffnung auf die Welt möglich wird.“2 Diese Öffnung ist aber nicht möglich in Konzeptionen, die der Verfremdsprachlichung des Hier und Jetzt des Grundschulkindes das Wort reden und die eigentliche Zielperspektive, die transkulturelle Handlungskompetenz außer acht lassen, die Befähigung zum Vollzug sprachlicher Akte, der geprägt ist von Offenheit, Toleranz und Kommunikationsbereitschaft, durch einen Lerner, der – um es mit Peter Doyé zu sagen – „bereit ist, aktiv zu werden, d.h. in eine Kommunikation mit Personen und Gegenständen dieser Kulturen einzutreten (Doyé 1995: 164).“ Bei einem Vortrag an der Pädagogischen Hochschule Weingarten umschrieb Klieme vor einiger Zeit das literacy – Konzept, das der PISA-Studie zugrunde liegt: Ziel von literacy müsse sein, Menschen dazu zu befähigen, ihr eigenes Wissen und ihre eigenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln, um am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können. Wir können es auch mit Jürgen Baumert sagen, dem wissenschaftlichen Leiter von Pisa-Deutschland: „Wer nicht lesen kann, ist praktisch vom Zugang zur Kultur ausgeschlossen.“3 Mit Bezug auf die europäische Einigung ist diese Formulierung in den Plural zu setzen. Wir sind aufgefordert, Schrift als Medium und Lernziel aus seiner Randposition zu entfernen und sie in das Zentrum des Frühbeginns zu stellen. Ontogenetische Position. Trotz immer wieder vorgetragener Begründungen für die Berücksichtigung von Schrift beim Fremdsprachenfrühbeginn, auf die hier nicht eingegangen werden soll, bleibt der Status quo erhalten: es wird der Vorrang des Mündlichen hervor2 gehoben (Rück: „L’oral garde la primauté“), es gilt die Annahme, dass ein extensives Sprachbad dem Kontakt mit der Schriftsprache vorangehen müsse (Bleyhl 2001) und bildungspolitisch wird – so etwa in BW – derselbe Weg eingeschlagen: „Oberstes Ziel des Grundschulfremdsprachenunterrichts [ist] die rezeptive und produktive Sprachkompetenz im Mündlichen“ (Ministerium 2001:14). „So wie ontogenetisch das Gesprochene dem Geschriebenen vorausgehe, habe auch die Reihenfolge in den Lehrkonzepten zu sein“, fasst Röber-Siekmeyer (2002b) – aus der Perspektive der Mehrsprachigkeitsdidaktik - ihre Kritik an dieser hierarchischen Sicht auf gesprochene und geschriebene Sprache zusammen. Ein kurzer Blick auf die neueren Frühbeginnkonzeptionen genügt um festzustellen, dass sich kaum etwas tut: entweder wird die Schrift ausgespart oder aber – wie in BW – die Einführung der Schrift beim frühen Fremdsprachen lernen erfolgt erst nach Abschluss des muttersprachlichen Lese- und Schreiblehrgangs. Recht unbekümmert und im Vertrauen auf die Wirkungen eines Sprachbades wird hier der Erwerb von Lesekompetenz anvisiert. Dabei beschränkt man sich auf vermutete Kompetenzen der Kinder („[...] Schülerinnen und Schüler erkennen [...] hinlänglich bekannte Wörter [...] in ihrem Schriftbild wieder“; a.a.O.: 28) und man belässt es bei spärlichen methodischen Hinweisen („Zuordnung und Gruppieren“, „Abschreiben“; a.a.O.: 28) und vertraut auf den „Prozess der Selbstorganisation im Kopf des Lerners“ (Bleyhl 1999: 47). Es ist zu bezweifeln, ob eine rein mündliche Vorgehensweise die erhofften Prozesse „des Segmentierens und Strukturierens des zielsprachlichen Sprachangebots“ – wie es Bleyhl meint (a.a.O.: 26) – initiieren kann. Diese Sichtweise verkennt, dass die Schrift Strukturen des Gesprochenen in didaktisch nutzbarer Weise speichert und dass dieses Strukturwissen erst mit dem Schrifterwerb ent3 steht (vgl. Maas 1992, Röber-Siekmeyer 2002) und überschätzt die Möglichkeiten des Spracherwerbs durch auf Immersion bauende Vermittlungskonzepte. Kritik am Sprachbad Immersive Spracherwerbskontexte gelten gegenwärtig als eine äußerst effektive Möglichkeit, das institutionalisierte Fremdsprachenlernen zu verbessern (vgl. Wode u.a. 1999; Zydatiß 2000). Dabei ist jedoch keine Garantie gegeben, dass dieses Sprachbad – beim natürlichen oder institutionellen Zweit- / Fremdspracherwerb – zu phonetisch / phonologisch einwandfreien Sprachkenntnissen führt. So hat Trubetzkoy schon vor mehr als 60 Jahren darauf hingewiesen, dass eine muttersprachliche Sozialisation die Wahrnehmungsleistungen von fremdsprachlichen Lauten beeinträchtigt bzw. unmöglich macht. Die Analyse des Gesprochenen erfolge – so Trubetzkoy – bei fremdsprachlichen Sprechern auf der Grundlage ihrer muttersprachlichen Wahrnehmungsmuster: „Die Laute der fremden Sprachen erhalten eine unrichtige phonologische Interpretation [...], weil man sie durch das „phonologische Sieb“ der eigenen Muttersprache durchläßt“ (Trubetzkoy 1939: 47). Betrachten wir die Muster, wie muttersprachliche und fremdsprachliche Sprecher lautliche Differenzen wahrnehmen, so zeigt eine Untersuchung von Bohn / Flege aus dem Jahr 1990 für unseren Zusammenhang interessante Ergebnisse: zum einen können die Wahrnehmungsmuster in einer Erstsprache durch Erfahrungen mit einer Zweitsprache umgebaut werden (vgl. Bohn 1998: 4), so dass sie sich den Wahrnehmungsmustern von Muttersprachlern angleichen; zum anderen ist dieser Erfahrungseffekt jedoch stark davon abhängig, wie lange die Möglichkeit zu sprachlicher Hörerfahrung bestanden hat. Unterhalb einer Schwelle von 6 Monaten Aufenthaltsdauer im „Sprachbad“ waren kaum Wahrnehmungsveränderungen feststellbar gewesen (a.a.O.: 6). Insofern müssen wir die Hoffnung auf die alleinige Wirkung des Immersionsansatzes in einem institutionalisierten Erwerbskontext in Zweifel ziehen. Allergrößte Bedenken sind angebracht, wenn - wie in Baden-Württemberg – der dort erprobte Ansatz 4 Fremdsprachen lernen in der Grundschule (FliG) als „’Eintauchen in das Sprachbad der zu lernenden Sprache’ bezeichnet wird (Ministerium 2001: 19) und diese „Immersion“ (Werlen 2001: 42) gerade einmal 18 Minuten pro Schultag ausmacht. Wenn nun das grundschulische Fremdsprachenangebot um die Lernbereiche Lesen und Schreiben ergänzt wird, so halte ich es für bedenklich und es erscheint mir geradezu unpädagogisch, wenn die Verantwortung für den präzisen Erwerb der Sprache den Kindern allein überlassen bleibt. Dürfen wir den Lernprozess als „vom Lerner individuell zu leisten, d.h. durch Lehren nicht direkt steuerbar“ (Bleyhl 2001: 24) auffassen und die Lehrkräfte zu Präsentatoren optimalen Inputs reduzieren? Soll der Erwerb der Schriftsprache weiterhin auf unsystematischem Auswendiglernen und dem Abschreiben von Wörtern basieren? Ich meine nein. Schrift - Objektivierung, Visualisierung, Präzisierung gesprochener Sprache Vorstellungen eines dyadischen Verhältnisses von Schrift- und Sprechsprache prägen derzeit die Zugangswege zur (fremdsprachlichen) Schrift, beeinflussen den Erwerb der entsprechenden Anwendungsmöglichkeiten (Lesen, Schreiben) und steuern somit die Teilhabe an den Chancen und Aufgaben, die sich in modernen Gesellschaften – je nach schriftsprachlicher Kompetenz - bieten und stellen (vgl. Vermès 1998). Vermès weist nicht nur darauf hin, in welchem Ausmaß die Entwicklung und Vereinheitlichung der Schriftsprachen seit dem Mittelalter zu einer überregionalen Hochsprache geführt hat, wie Schrift als Mittel der Distanzierung zu Vorteilen gegenüber anderen verhelfen und zu persönlichem (Bildungs-)Kapital und gesellschaftlichem Ansehen beitragen konnte. Sie macht auch darauf aufmerksam, dass Schriftsprache als „Dekontextualisierung des Sprechens“ (Vermès 1998: 7) angesehen werden kann. Darunter ist ein Prozess zu verstehen, bei dem die flüchtige, eindimensionale, subjektive, individuelle Sprechsprache fixiert, um die Dimension des Visuellen erweitert, objektiviert 5 und der Sprachgemeinschaft zugänglich gemacht wird: „Dafür, daß Sprache virtueller Raum, formales Objekt [...] wird, sind Visualisierung, Zweidimensionalität, Manipulation (wörtlich verstanden) wahrscheinlich entscheidende Bedingungen“ (Vermès 1998: 9). Schrift - so betrachtet - ist die Voraussetzung für kompetenten Fremdspracherwerb, denn spiegelt nicht – wie oft angenommen – die Lautverhältnisse des Gesprochenen wieder im Sinne einer Phonem-Graphem-Korrespondenz (vgl. z.B. Ministerium 2001: 28). Schrift ist vielmehr als Visualisierung von Strukturen des Gesprochenen aufzufassen. Diese Strukturen meinen nicht nur das Lautsystem einer Sprache, sondern „Lautung in Relation zur Prosodik“ (Fuchs; RöberSiekmeyer 2001: 20): das Französische, als Alphabetschrift, verbildlicht mittels der Buchstaben als seinen kleinsten Bestandteilen, wie einzelne Laute bezogen auf die jeweiligen Positionen innerhalb der Silbe zu artikulieren sind. Wir können unter Zuhilfenahme der Schrift neue phonologische Kategorien veranschaulichen und bewusst machen sowie die beschriebenen Defizite eines rein mündlich-kommunikativen Fremdsprachenlernens überwinden. Schrift bildet die Voraussetzung dafür, dass das lautliche Kontinuum der gesprochenen Sprache aufgespalten werden kann, dass „Wörter als grammatische Segmente der Schrift sichtbar“ gemacht werden (Röber-Siekmeyer 2002b), wodurch Sprache letztendlich durch die kognitive Aneignung über das Medium Schrift lernbar wird. Wenn nun Schrift in das Zentrum des frühbeginnenden Fremdsprachenunterrichts gestellt werden soll, so geht es nicht in erster Linie darum, die primär damit verbundenen Ziele Lesen und (Recht-)Schreiben zu bedienen: Schrift wird nicht „in seiner kommunikativen Funktion gesehen, also als Abbildung der mündlichen Rede, [sondern als] ein eigenes System, das mündliche Sprache nach einer festen Regelhaftigkeit fixiert.“ Schrift ist, so gesehen, das Instrumentarium für die „Fixierung eines Texte[s] in einer symbolischen Form so, daß er erlesen werden kann (sic!)“ (Maas 2000: 44). Die Schrift beinhaltet an den Leser gerichtete „Instruktionen für die Inter6 pretation eines Textes“ (Maas 2000: 65), die im frühbeginnenden Fremdsprachunterricht zu nutzen sind. Und dieses Wissen sollten wir unseren Schülerinnen und Schülern nicht vorenthalten. ARBEITSPHASE 1 (Handout S. 2 und 3) Erkennen von Strukturen der Schrift Folie: Strukturen erkennen Nonsens-Wörter international Folie: Nonsens-Wörter im Deutschen Die Silbe als Grundlage schriftbezogener Sprachanalyse Silbenaufbau Die Struktur der Silbe ergibt sich aus dem obligatorischen, im Französischen vokalischen Silbenkern und der fakultativen konsonantischen Silbenschale. Diese wiederum teilt sich auf in den Silbenkopf und die Silbenkoda. Kern und Koda zusammen bilden den Reim einer Silbe. Das Französische wird den silbenzählenden Sprachen zugeordnet, deren Charakteristikum es ist, dass alle Silben in jeweils gleichen zeitlichen Abständen aufeinander folgen. Die Isochronie bezieht sich im Gegensatz zu den akzentzählenden Sprachen Englisch und Deutsch nicht auf die Betonungen im Versfuss sondern auf die Silbe. Infolge dieser gleichmäßigen Verteilung verfügt das Französische auch über keine Reduktionssilben und –vokale, wie im Englischen (<summer> /?s/.m%/) oder Deutschen (<Sommer> /?sO.m%/). Die französischen Silben haben sowohl in unbetonter wie betonter Stellung die gleiche Struktur, wobei ein einfacher Silbenaufbau (CV) vorherrscht (vgl. Kaltenbacher 1998: 21f, Meisenburg; Selig 1998: 123ff). Charakteristisch ist auch die jambische Betonungsstruktur unbetont – betont, deren korrekte Realisierung Sprechern von Sprachen mit trochäischem Akzentmuster (Deutsch, Englisch) vielfach Schwierigkeiten bereitet. 7 Le petit train – als Mittel der Anschauung Um Lerner der Grundschule an das französische Schriftsystem heranzuführen, orientierten wir uns zum einen an den o.g. phonologischen Erkenntnissen, zum anderen griffen wir auf eine Idee von Röber-Siekmeyer (vgl. 1998b) zurück, die in der Darstellungsform eines Hauses (Akzentsilbe) und einer Garage (Reduktionssilbe) die Betonungsverhältnisse im Deutschen den Kindern veranschaulichen und erläutern konnte. Aufgrund der im Französischen anderen Situation wird hier das Bild eines Zuges vorgeschlagen: die einzelnen Wagons repräsentieren die Silben, wobei die maximale Dreigliedrigkeit der Silbe durch drei Abteile dargestellt wird. Bei unserer Arbeit mit den Kindern wurde die im Französischen vorherrschende Endbetonung mit Erklärungen wie „Gepäckwagen“ oder „1. Klasse - Wagen“ umschrieben, um die besondere Hervorhebung der letzten Silbe, der Ultima, zu kennzeichnen. Um den Kindern das Erhören lautlicher Merkmale zu erleichtern, konfrontierte ich sie mit Reimen, die im Rahmen eines Seminars erstellt worden waren, zum Beispiel 1)Crapaud ce mot est beau, 2) Bizarre ! Le fromage est dans la cage. Le garage est sur la plage. Et la neige ? Elle est beige. Et le manège part pour la Norvège. 3) Un éléphant est dans les champs il marche lentement il prend son temps tout en chantant! und 4) Ni un kangourou, ni un loup-garou, n‘est aussi doux, qu‘un bisou dans le cou. Wie bin ich vorgegangen ? Zuerst wurde den Kindern ein Reim vorgesprochen. Sie erkannten, dass sich hier irgend etwas reimte. Die Reimwörter wurden bestimmt, auf einem Blatt unterstrichen oder eingekreist. Danach wurde durch Klatschen und Ergehen die Anzahl der Silben bestimmt. Es fiel den Schülerinnen und Schüler leicht, mit diesem Instrument den vokalischen Kern der Silbe der Reimwörter (cra)paud, mot, beau herauszufiltern: /o/. Den Kindern wurde daraufhin erklärt, dass die Buchstaben in einem Zug verreisen würden. Die Kinder beschrieben die Darstellung: es handelt sich um einen Zug; der hat unterschiedlich viele Waggons; in jedem Waggon sind 3 Abteile. Ihnen wurde ge8 sagt, manche fanden es auch selbst heraus, dass der Teil des Wortes, den sie am besten hören konnten, immer im mittleren Abteil säße. Sobald der Silbenkern isoliert war, konnten sie erkennen, dass im 1. Abteil immer ein anderer Laut untergebracht war: /b/, /m/ sowie /p/. Daraufhin wurden gemeinsam die Buchstaben in das Zug-Modell übertragen. Bei einem anderen Reim sieht das dann so aus. Dabei entdeckten die Kinder, dass der Laut /o/ im mittleren Abteil durch mehr als einen Buchstaben repräsentiert werden kann: <eau>, <aud> und <ot> ergaben jeweils /o/ („Da - hem - * da is‘ dies jetzt, nur das (er zeigt auf „[crap]aud“) wenn man‘s ausspricht, ist es nur [o]“, Heiko, 4. Klasse). Die Kinder sind bei einer solchen Vorgehensweise, die die silbenbezogene Darstellung in den Mittelpunkt stellt, allesamt in der Lage, die symbolische Funktion der Alphabetschrift zu erkennen: „Wenn <s-c-h> [im Deutschen; J.M.] [S] gibt, dann kann auch <ch> [S] geben.“ (Valerie, 1. Kl., 6 Jahre). <ou> ist immer [u]. [...] <che> steht immer für [S]“ (Raphaela, 4. Kl., 9 Jahre; <mouche>). „Da ist so was wie ein [&&E] drin, aber es ist kein <ä> drin. Also das <n> hört man eigentlich auch nicht. Weil man hört das alles in einem Laut [...] Und auch ein <in>. Das ist eigentlich immer ein <in> .. hier ein <in> .. hier ein <in> .. hier ein <in> .. hier ein <in> und hier ein <in> [...] Das macht ein [&&E]“ (Steffen, 3. Kl., 9 Jahre; <sapin>). „Man hört da gar keine Buchstaben von denen. [...] Da ist <in> immer [&E] geworden. [...] Aus dem <in> oder aus dem <ain> [...] Da mussten wir das in Wagen reinschreiben“ (Christian, 3. Kl., 8 Jahre; <sapin>, <pain>). „Da sind mehr Buchstaben drin und ich höre nur einen Laut“ (Markus, 3. Kl., 8 Jahre; <sapin>, <pain>). Dieser als «Le petit train» bezeichnete Ansatz eines systematischen schriftbezogenen Zugangs zum Französischen trägt dazu bei, dass die Kinder den Blick für die ideogrammatischen Elemente des Französischen schulen: „Ich habe den Selbstlaut ins zweite Zimmer gesetzt, der (sic!) Buchstabe, der davor stand, habe ich ins erste Zimmer gemacht. Und dann kommt nichts, weil man nichts mehr 9 hört“ (S., 3. Klasse, 8 Jahre). Sie lernen die Linearität von Graphemsequenzen zu durchbrechen, indem sie das auch im Französischen geltende silbische Prinzip der Orthographie zu nutzen lernen, demzufolge Silben so geschrieben werden, dass sie visuell, vor allem durch konsonantische Anfangsränder, wahrnehmbar werden (vgl. Raible 1991: 35). Diese innere Strukturierung wird Kindern, wenn sie an sie herangeführt werden, bewusst: „Man sieht es halt besser, wie wenn man bloß drüber liest“ (Raphaela, 4. Klasse, 9 Jahre). Ein drittes Beispiel soll zeigen, dass und wie Kindern lautliche Strukturen des Französischen, hier die Opposition ‚stimmhaft / stimmlos’, verdeutlicht werden kann. Den meisten Kindern war es anfänglich nicht bewußt, dass die Frikative in Reimwörtern wie <beige> und <neige> im Gegensatz zu <mouche> und <douche> unterschiedlich klingen. Auf die Frage, was sie nach dem „lauten“ Bestandteil hörten, wurde meist [S] genannt. Dies ist nicht verwunderlich, war ihnen doch die phonologische Opposition aus ihrer Muttersprache nicht bekannt. Nachdem die Wörter den Kindern noch einmal vorgesprochen worden waren und sie sie ihrem Schriftbild zugeordnet hatten, sollten die Kinder anhand von Minimalpaaren (<beige< <neige>; <mâche> <mage> ) herausfinden, ob diese in Bezug auf den Zischlaut gleich oder verschieden klangen. Es wurde den Schülern bewußt, dass es zwei verschiedene Arten von „sch“ gab: „Bei dem einen Wort wird es kurz gesprochen und beim anderen wird es länger gesprochen“ (Raphaela, 4. Klasse, 9 Jahre). Beim erneuten Vorsprechen wurden die Wortkärtchen so geordnet, dass die Kinder einen eindeutigen Bezug der Stimmhaftigkeit zu <ge> herstellen konnten: „Der lange (Buchstabe; J.M.) ist immer <ge>.“ Die Schrift leistet somit über die Einbeziehung des Visuellen einen Beitrag zur Präzisierung der Lautwahrnehmung wie auch zur Erweiterung des Phoneminventars, das bei der Produktion von gesprochener Sprache eingesetzt wird. Will die Schule ihre Aufgabe ernst nehmen, den Kindern die nötigen Freiräume für ein Lernen zu schaffen, so dass ihnen eine Öffnung auf die Welt ermöglicht wird (vgl. Drews; Schneider; Wallrabenstein 2000: 23ff), so muss sie auch die 10 Sicherheiten schaffen, die manche Kinder für ihren individuellen Lernprozess benötigen. Welchen Beitrag der kognitive Zugang zum Französischen über die Schrift dazu leisten kann, sei am folgenden Beispiel einer Drittklässlerin gezeigt. Dieses Mädchen hatte erhebliche Schwierigkeiten bei den ihr gestellten Aufgaben (wieder ging es um den Reim: Le matin Alain mange du pain sous le sapin. Fin.). Mehrmals mussten Umwege über das Deutsche gemacht werden (z.B. konnten die französischen Reimwörter erst erkannt werden, nachdem dies mit deutschen Wörtern geübt worden war). Sie war auch nicht dazu in der Lage, ihre Beobachtungen verbal auszudrücken; meist waren ihre Reaktionen gestisch (Kopfschütteln, Nicken) oder mimisch (Verziehen des Gesichts). Da ich sehr viel Hilfestellung geben musste, war ich, trotz des korrekten Erlesens neuer Wörter (<pin>, <jardin>) auf der Basis der erworbenen kognitiven Regel, am Ende der ersten Sitzung skeptisch, ob der Lernerfolg von nachhaltiger Dauer sein würde. Nach einem Abstand von zwei Wochen, während dessen auf diese Arbeit kein Bezug genommen worden war, sollte das Mädchen den genannten Reim nochmals vorlesen. Wie erstaunt war ich, als sie zum einen alle Reimwörter fließend, phonetisch sowie intonatorisch absolut korrekt, vorlesen konnte („[ma.t&E] – [a.l&E] – [p&E] – [sa.p&E] – [f&E]“); zum anderen, dass sie die restlichen Wörter des Reims völlig außer acht ließ. Es sollte sich zeigen, dass sie eine Struktur kognitiv erworben hatte, es ihr hingegen nicht möglich war, den kompletten Reim vorzulesen, obwohl sie diesen mehrmals zuvor gehört hatte. Auf die Aufforderung hin, den gesamten Reim vorzulesen, verstummte sie und blickte hilflos auf das vor ihr liegende Blatt. Dass der kognitive Zugang zu einem Teilbereich der Schrift ihr Strukturwissen vermittelt hatte, wurde deutlich, als sie, sozusagen im Reißverschlussverfahren, mit mir zusammen den Reim vorlesen konnte. Wie wir sehen konnten, ermöglicht diese kognitive Arbeit mit den Kindern durch systematisches Einbeziehen von Schrift · 1) das mündlich dargebotene Klangkontinuum zu segmentieren; 11 2) Lautstrukturen der Zielsprache im Kontrast zur Muttersprache zu entdecken; 3) Strukturwissen über die Fremdsprache aufzubauen; 4) Lesekompetenz zu erwerben. Die Schülerinnen sind weder demotiviert noch überfordert, wenn ihnen ein kognitiver Zugang zur fremden Sprache ermöglicht wird. Im Gegenteil, sie erkennen die Hilfestellung, die ihnen durch die Schrift gewährt wird, wie die Zitate zeigen. Schluss Beispiele wie das letztgenannte dürfen berechtigte Zweifel an Positionen aufkommen lassen, die den Zugang zur Schriftsprache auf einen „Prozess der Selbstorganisation im Kopf des Lerners“ (Bleyhl 2000: 85) reduzieren wollen. Wenn wir Grundschulkindern, die von ihnen benötigte Unterstützung bei ihren sprachlichen Lernprozessen vorenthalten, ihnen aktive Unterstützung beim Voranschreiten zur nächsten Entwicklungsstufe („zone of proximal development“; Vygotsky 1974) versagen, birgt das die Gefahr, vor allem schwächere und benachteiligte Kinder im Zustand der „Sprachunsicherheit“ (Bourdieu 1982 ) zu be- oder aber sie in diesen zu entlassen. Der von uns vorgeschlagene Weg einer kognitiven Analyse der Schrift als Unterstützung des Fremdsprachenerwerbs ist eine Form von Exteriorisierung von Problemen, wodurch „das, was sie (die Kinder; J.M.) bewegt, in eine linear geordnete, auf jeden Fall für sie selbst verstehbare Form“ (Raible 1999: 36) gebracht wird. Selbst wenn es einzelnen Kindern – wie oben zu sehen – nicht möglich ist, diese Exteriorisierung verbal zu leisten, so ist die positive Wirkung des kooperativen Vorgehens, durch Lernhilfen begleitetes aktives Lehren, nicht zu leugnen. Anhand des vorgeschlagenen Modells kann Grundschülerinnen und Grundschülern die interne Strukturierung der Schriftsprache verdeutlicht werden, um damit den Zugang zur Lautung und Prosodik. des Französischen zu erleichtern und eine fremdsprachliche Lesekompetenz anbahnen zu können. 12 Wie die Pisa-Studie ür den muttersprachlichen Unterricht nachweisen konnte, bestehen statistisch hochsignifikante Korrelationen zwischen Dekodierfähigkeit und Lesekompetenz. Kinder scheitern nur dann an der Schrift, wenn ihnen ein strukturierender Einblick in deren regelhaftes System vorenthalten wurde. Dass es dann kaum mehr zu den Spracherfahrungen „des möglichst vielen Lesens“ – wie teilweise geglaubt wird (Bleyhl 2001: 24) - kommen kann, zeigen die Biographien von sogenannten Versagern im Mutter- wie auch Fremdsprachenunterricht. Der frühbeginnende Fremdsprachenunterricht muss dazu nicht auch noch seinen unrühmlichen Beitrag leisten. Das Potenzial der analytischen Betrachtung der Schrift konnte hier nur skizziert werden, doch zeigt sich deutlich, dass die Kinder sprachliches Strukturwissen durch die graphischen Symbole entdecken können, dass sie aufgrund der Schrift zu weit mehr zu leisten imstande sind, als wenn sie nur aus einem – oftmals kläglichen – Klangbad ihre Erkenntnisse gewinnen dürfen. 1 Siehe Michailow-Drews (2002: 33) u.a.. U. Drews; G. Schneider; W. Wallrabenstein, Einführung ..., S. 27f. 3 Zitiert nach Kerstan 2001:45. 2 13