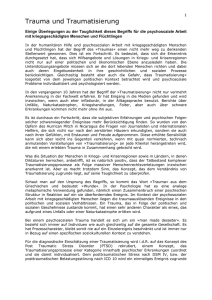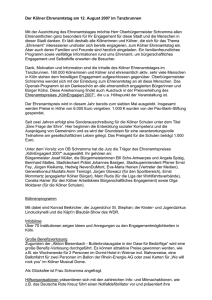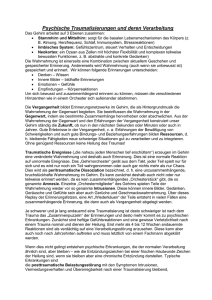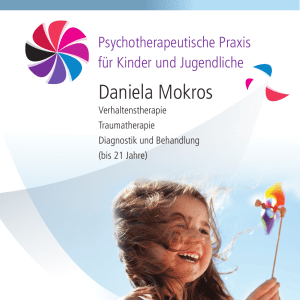Inhaltsverzeichnis - Universität des Saarlandes
Werbung
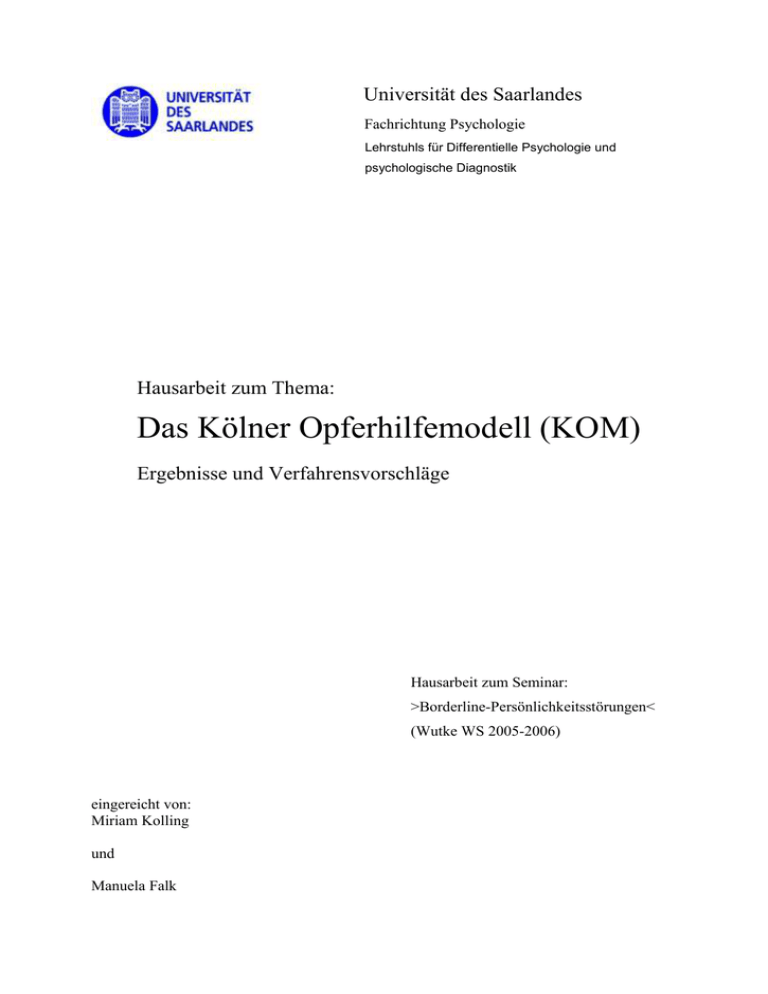
Universität des Saarlandes Fachrichtung Psychologie Lehrstuhls für Differentielle Psychologie und psychologische Diagnostik Hausarbeit zum Thema: Das Kölner Opferhilfemodell (KOM) Ergebnisse und Verfahrensvorschläge Hausarbeit zum Seminar: >Borderline-Persönlichkeitsstörungen< (Wutke WS 2005-2006) eingereicht von: Miriam Kolling und Manuela Falk Inhaltsverzeichnis Einleitung 3 1. Die Restitution des Opfers als staatliche Aufgabe 4 1.1 Forschungsthema des KOM-Projekts 1.2 Tendenzen zur Ausgrenzung und Beschuldigung von Opfern – psychotraumatische Abwehrmechanismen 1.3 Der Auftrag an die Sozial- und Gesundheitsverwaltung: Helfen und weitere Schäden vermeiden 6 8 10 2. Psychische Traumatisierung: die Wirklichkeit vieler Betroffener 11 2.1 Versuch einer Prävalenz-Schätzung 2.2 Missstände in der Situation von Gewaltopfern 2.3 Das Trauma und seine Folgen 2.4 Weitere langfristige Auswirkungen 2.5 Traumadiagnostik - 5 Skalen zur Messung relevanter Faktoren - 11 12 13 19 23 3. Das Verlaufsmodell psychischer Traumatisierung 24 4. Forschung im Kölner Opferhilfemodell (KOM) 28 4.1Der KOM-Fragebogen und Interviews 4.2 Ergebnisse der Kölner Forschung 4.2.1Die untersuchten Gewaltopfer/Stichprobe 4.2.2 Beschreibung objektiver Situationsfaktoren 4.2.3 Dissoziatives Erleben in der traumatischen Situation 4.2.4 Symptomverbreitung und –ausprägung 4.2.5 Einflussgrößen späterer Symptombildung und Beschwerden und deren Vorhersage 4.3 Ein Analysemodell zur Integration relevanter Komponenten psychischer Traumatisierung 4.3.1 Erläuterung der einzelnen Faktoren in dem Modell 4.3.2 Lebensgeschichte 4.3.3 Unmittelbare Vorgeschichte 4.3.4 Traumatische Situation 4.3.5 Belastungen 4.3.6 Schützende Faktoren 4.3.7 Langfristige Auswirkungen 28 29 29 29 29 30 31 34 34 34 35 35 36 36 36 5. Die Strategie der Opferbetreuung im Kölner Opferhilfe Modell 37 Schlusswort 38 Literaturverzeichnis 39 2 Einleitung Opfer von Verbrechen und Gewalt befinden sich immer in einer Ausnahmesituation. Sie benötigen Beistand und Hilfe, insbesondere durch ihr persönliches Umfeld. Polizei und Opferhilfeorganisation haben die Aufgabe ergänzende Hilfe zu leisten. Laut Hans-Detlef Nöllenburg, Kriminaldirektor und Vertreter der Geschäftsführung des Deutschen Forums für Kriminalpräventention, ist Opferschutz eine gesellschaftliche Aufgabe, denn Opferschutz muss von der Gesellschaft wahrgenommen werden. (www.kriminalpraevention.de/ pressearchiv/pressemitteilungen/PM20020321_DFK.pdf) Die Kriminalität erst gar nicht entstehen zu lassen wird gesellschaftlich immer das vorrangige Ziel sein, aber eine absoluter Schutz der Bürger vor Gewalttaten ist von staatlicher Seite leider nicht zu verwirklichen. Der Staat trägt aber eine Führsorgepflicht gegenüber seinen Bürgern, Opfer von Gewalttaten Hilfe zu Leisten. Diese wurde durch die Schaffung zahlreicher Vorschriften (z.B. Opferanspruchssicherungsgesetzt, Opferschutzgesetz, Opferentschädigungsgesetz, etc.) auch Rechnung getragen. Dennoch ist es wichtig, dass die bereits bestehende Angebot an Hilfestellungen für Gewaltopfer weiter ausgebaut, überprüft und verbessert werden. Eine Studie in Köln untersuchte den gesamten behördlichen Prozess, den ein Opfer zu durchlaufen hat - vom ersten Kontakt, über Gerichtsverfahren bis hin zu Rentenanträgen. In der vorliegenden Hausarbeit wird diese Studie, das Kölner Opferhilfe Modell (KOM), näher beschrieben. Zunächst wird die staatliche Aufgabe, die Restitutionspflicht gegenüber dem Opfer erläutert, bevor die Wirklichkeit vieler Betroffener, die psychische Traumatisierung, dargestellt wird. Dem anschließen wird sich das Verlaufsmodell psychischer Traumatisierung, die Ergebnisse und die Verfahrensvorschläge des Kölner Opferhilfe Modells. Die Problematik der Opfer und die Wichtigkeit, dass diese optimale Hilfestellung erfahren, wird im Schlusswort noch einmal betont. 3 1. Die Restitution des Opfers als staatliche Aufgabe Eine der wichtigsten Aufgaben des Staates ist es, seine Bürgerinnen und Bürger vor Kriminalität und Verbrechen zu schützen. In das moderne europäische Staatsrecht gehen rechtsphilosophische Überlegungen aus dem Rousseauschen Vertragsdenken ein, indem der Bürger auf eine gewaltsame Verfolgung des Täters verzichtet und stattdessen dem Staat das „Gewaltmonopol“ überträgt. Dass heißt, die Funktion der Strafverfolgung liegt immer beim Staat, auch wenn es sich bei dem Bürger um den Geschädigten handelt. Im Gegenzug bedeutet dies aber auch, dass die Pflicht beim Staat liegt soweit es geht seine Bürger vor Gewalttaten und Verbrechen zu schützen (primäre Prävention von Gewaltdelikten). Da dies prinzipiell nicht lückenlos gewährleistet werden kann, fällt dem Staat die Aufgabe zu einer Person den Opferstatus anzuerkennen, falls sie durch ein Gewaltdelikt geschädigt wurde. Es müssen alle Maßnahmen ergriffen, gefördert und verantwortlich überwacht werden, die geeignet sind , den schuldlos betroffenen Bürger für das erlittene Unrecht zu entschädigen. Diese staatliche Verpflichtung gegenüber dem Bürger als Opfer eines Gewaltverbrechens wird auch als Restitutionspflicht des Staates bezeichnet. Um dieser Restitutionspflicht nachzukommen, werden an der staatlichen Reaktion auf Verbrechen verschiedene Institutionen beteiligt: Polizei, Staatsanwaltschaft und Strafgerichte. „Sie haben die Aufgabe, vor Straftaten zu schützen, sie festzustellen, aufzuklären, zu verfolgen und die Rechtsfolgen entsprechend zu vollstrecken. Hierfür stellt der Staat feste Verfahrensordnungen zur Verfügung, die mittelbar dem Schutz des Bürgers vor ungerechtfertigter Strafverfolgung garantieren.“ (Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.7). Die staatlichen Reaktionen sind durch ihre mittelbaren Schutzfunktionen zwangsläufig täterorientiert. Die Ziele eines Ermittlungs- und Strafverfahrens sind die rechtliche Bewertung eines Sachverhaltes und die Verurteilung eines Täters. In der Vergangenheit standen vielfach ausschließlich der Täter und die Tat im Mittelpunkt des polizeilichen und justiziellen Interesses. Die Rolle des Opfers reduzierte sich auf die eines „personenspezifischen Beweismittels“ Nicht selten führt das vom Opfer als kühl und nüchtern wahrgenommene Strafverfahren zu einer erneuten, schmerzhaften Erinnerung an das Erlebte. Dies kann zu einer Verfestigung des traumatischen Ereignisses und einer empfindlichen Störung der seelischen Gesundung führen. Besonders Opfer von Gewaltdelikten bedürfen häufig eines sehr behutsamen Vorgehens und besonderen Schutz. (vgl. Gewalt gegen Frauen und sexueller Missbrauch von Kindern, 3. Bericht zum Handlungskonzept der Landesregierung (NRW), 4 S.128) . Dass der Staat eine Restitutionsverpflichtung gegenüber dem Opfer hat, wird in der Öffentlichkeit meistens weder vom Opfer noch von der allgemeinen Bevölkerung als selbstverständlich angesehen. Dieser Mangel an Problembewusstsein und zutreffender Problemdefinition kann man häufig auch an der prekären Lage der Opfer erkennen. Diesem sind in den staatlichen Institutionen unterschiedliche Rollen zugewiesen. Die Polizei benötigt die Aussage des Opfers in erster Linie zur Spurensicherung und Tatbestandsermittlung und für die Justiz ist das Opfer in erster Linie Zeuge. Beide Institutionen handeln zwar auch im Interesse des Opfers dahingehend, dass sie bemüht sind die Tat aufzuklären und die Strafverfolgung des Täters übernehmen, das Recht des Opfers auf Wiederherstellung seiner leiblichen und seelischen Unversehrtheit gehört hingegen nicht oder zumindest nicht primär zur Aufgabendefinition und zum traditionellen Selbstverständnis von Polizei und Justiz. Nicht selten können unterschiedliche Interessen von Seiten der Opfer und von Seiten staatlicher Organe zu Konflikten führen, die sich auch zum Nachteil des Geschädigten auswirken können. Zum Beispiel wenn Ermittlungsinteressen ohne Rücksicht auf die persönliche Verfassung des Opfers wahrgenommen werden oder wenn die Zeugenaussage des Opfers bei diesem zu einer erneuten Opfererfahrung führt. Das am 1. Dezember 1998 in Kraft getretene „Gesetz zum Schutz von Zeugen bei Vernehmung im Strafverfahren und zur Verbesserung des Opferschutzes“, kurz Zeugenschutzgesetz soll dem etwas entgegen wirken. Es hat den Einsatz der Videotechnik im Ermittlungs- und Strafverfahren erstmals gesetzlich verankert. Das Gesetz ist auf die Situation besonders sensibler, verletzlicher – insbesondere kindlicher – Zeugen zugeschnitten. Es regelt unter anderem die Aufzeichnung von Zeugenvernehmungen auf Bild- und Tonträgern sowie die zeitgleiche Übertragung von Fragen an den Zeugen und deren Aussage in Bild und Ton zwischen den Vernehmungs- und Sitzungszimmer in der Hauptverhandlung. Ziel ist es sensiblen und verletzlichen Zeugen quälende Mehrfachvernehmungen im Ermittlungs- und Strafverfahren und die direkte Konfrontation mit dem Täter in der Hauptverhandlung zu ersparen. (vgl. Gewalt gegen Frauen und sexueller Missbrauch von Kindern, 3. Bericht zum Handlungskonzept der Landesregierung (NRW), S.130) Im Fall eines Konfliktes sollte das Recht des Opfers auf Erholung und bestmöglichste Restitution vor den übrigen bürgerlichen und staatlichen Interessenspositionen an erster Stelle stehen. Vom Grundsatz her wird das kaum bestritten und Neuregelungen zum Schutz des Opfers z.B. die Anerkennung des Opferstatus im Rahmen des Opferentschädigungsgesetzes (OPG) wurden schon durchgesetzt, dennoch muss weiterhin noch einiges getan werden, damit die persönliche Interessenvertretung des Opfers mit der gleichen Selbstverständlichkeit und einem gleichen 5 Aufgabenbewusstsein wahrgenommen wird wie die täterorientierte Strafverfolgung. Immer noch fühlen sich viele Opfer allein gelassen und in ihrem eigenen Interesse ungenügend anerkannt. „So gehört es von Anfang an zum Projektplan des Kölner Opferhilfe Modells, die psychische Situation von Verbrechensopfern zu erforschen und auf der Basis der Forschungsergebnisse Prinzipien und Verfahrensvorschläge auch für den angemessenen Umgang staatlicher Institutionen mit dem Opfer zu erarbeiten, in dessen ideellem Mittelpunkt die Restitutionspflicht des Staates gegenüber dem physisch und psychisch verletzten Bürger steht.“ (Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.7). Den Opfern geht es dabei in erster Linie nicht um materielle Entschädigung, sondern vielmehr um eine unzweideutige Anerkennung der Opferwerdung und des ihnen zugefügten Unrechts mit einhergehendem Recht auf Restitution und Rehabilitation (=Wiederherstellung der persönlichen Würde). 1.1 Forschungsthema des KOM-Projekts Im KOM-Projekt werden die psychische und soziale Situation der Gewaltopfer und die Wirklichkeit der staatlichen und außerstaatlichen Institutionen, mit denen das Opfer nach und infolge seiner Gewalterfahrung in Berührung kommt, in Verbindung gebracht. Dies stellt insofern eine Besonderheit dar, da dies nur selten vorkommt. Man will vor allem den Fragen nachgehen, welchen Verlauf und welche Langzeitfolgen die Opfererfahrung unter ungünstigen Bedingungen hat und welchen Verlauf sie unter günstigen Bedingungen nimmt. Auch von Interesse ist, welchen Verlauf dementsprechend der „natürliche Heilungsprozess“ erlittener psychosozialer Verletzungen nimmt. Dabei zeigt sich, dass vor allem von Vorteil ist, wenn alle Maßnahmen auf den natürlichen Heilungs- und Erholungsprozess abgestimmt sind, diesen unterstützen, jedoch keinesfalls behindern sollten. Gleichzeitig ist es wichtig, dass man pathologische Entwicklungen als Tatfolge beim Opfer rechtzeitig erkennt, so dass man gleich gegensteuernd eingreifen kann. Man ist also bemüht diese pathologischen Entwicklungen direkt zu unterbrechen und gegebenenfalls gezielte therapeutische Maßnahmen einzuleiten, so dass weiteres Leiden so gut wie möglich vom Opfer fern gehalten wird. Psychische Traumata, die einen ungünstigen Heilungsverlauf nehmen, können nämlich zu erheblichen psychischen, sozialen und somatischen Langzeitfolgen und Folgelasten führen. In diesem Punkt wird also der Restitutionspflicht des Staates gegenüber den geschädigten Bürgern nachgekommen. 6 Als Grundlage des weiteren Vorgehens wurde im KOM-Projekt zunächst eine größere Opferbefragung im Raum Köln durchgeführt. Und zwar an Betroffenen, deren Opferstatus vom Versorgungsamt Köln bestätigt war. Hierfür wurden die Kriterien der psychotraumatischen Belastungsstörungen mit verschiedenen international anerkannten übersetzten und adaptierten Skalen erfasst. Um einen vertieften und individualisierten Einblick in die psychosoziale Lage der Opfer zu bekommen, werden zusätzlich ausführliche Interviews erhoben. Zu einer weiteren Verbesserung der Opferversorgung wurden diese nach Beschwerden und Änderungsvorschlägen im Umgang mit Institutionen und Behörden befragt. Folgende Probleme stellten sich heraus: - Von Seiten ihrer Umwelt erfahren Opfer häufig keine angemessene Behandlung und Unterstützung (v.a. betrifft dies Institutionen im medizinischen Bereich und Institutionen wie Polizei, Versicherungen, Gerichte, etc.) Auch ein Problem ist die mangelnde Anerkennung des Opferstatus und daraus entstehender Folgebelastungen. Man kann feststellen, dass Gewaltopfer nicht selten retraumatisierende Erfahrungen machen. - Das Wissen um traumatische Erfahrungen und deren Wirkung auf die Opfer und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung damit sind sehr gering. Viele Opfer fühlen sich unangemessen behandelt; fühlen nicht selten das Misstrauen und den Unglauben anderer und haben häufig ein Empfinden als seien sie selber schuldig. - 2/3 der traumatisierten Personen gelingt zwar im Laufe der Zeit eine eigenständige Verarbeitung der Traumafolgen, dennoch verbleibt ein erheblicher Anteil von betroffenen Personen, bei denen es nicht zu Spontanremissionen kommt und die erhebliche körperliche und psychische Schädigungen davontragen. - Unangemessener persönlicher Umgang mit den Gewaltopfern. Bei Gewaltdelikten liegt der Ursprung der Traumatisierung in anderen Menschen, die das Opfer bewusst schädigen. Im Gegensatz zum Beispiel zu Naturkatastrophen. Daher ist jeder, der mit Gewaltopfern zu tun hat, in der Folgezeit gefordert, sich korrektiv zu verhalten und daran mitzuwirken, dass die Gewaltsituation im Laufe der Verarbeitung als eine Ausnahme normalen mitmenschlichen Umgangs begriffen werden kann. Das heißt, Interaktionen mit Opfern von Gewalt müssen verständnisvoll, unterstützend und akzeptierend ablaufen, transparent sein und dem Opfer eine größtmögliche Handlungskontrolle ermöglichen. - Opfer sind zu wenig über Hilfsangebote informiert. - Aber auch Stellen, mit denen man als Opfer zu tun hat (Polizei, Medizin, etc.) besitzen zu wenige Informationen zur Hilfestellung. 7 - Weiter besteht auch noch ein Mangel an Fachwissen. Spezielles psychotraumatologisches Wissen über typische Erlebnisweisen und Traumafolgen haben weder Betroffene noch Helfer und spezifische Angebote, zum Beispiel psychologische Beratung oder Traumatherapien, gibt es kaum. - Fehlende Koordination von Hilfseinrichtungen - Unsicherer Umgang mit der Diagnose „Posttraumatische Belastungsstörungen“, die bei sozialrechtlichen Anerkennungs- und Gerichtsverfahren eine zunehmende Rolle spielt. - Prozessuale Abläufe in Ermittlungs- und Anerkennungsverfahren sind in der Regel denkbar schlecht auf den Verarbeitungsverlauf und aufeinander abgestimmt (zu lang, zu bürokratisch, zu belastende Wiederholungen von Vorfallsschilderungen, etc.). „Jedes Opfer, das versucht, zu seinem Recht zu kommen bzw. Entschädigungen oder andere Leistungen zu erhalten, läuft Gefahr, in eine Situation zu geraten, die ihm ein Überwinden des Opferstatus und die Verarbeitung seiner Erfahrung erschwert oder unmöglich macht.“ (Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.10). Es zeigte sich, dass Traumafolgen sich verschlimmern können, wenn es zu Demütigungen, Ablehnung und Misstrauen von institutioneller Seite kommt. „Im Erhebungsteil des KOM-Projekts musste somit eine erhebliche Diskrepanz zwischen rechtsstaatlich wünschenswerter Führung und Behandlung der Verbrechensopfer und ihrer psychischen und sozialen Wirklichkeit festgestellt werden, die es durch wirksame Maßnahmen schrittweise zu mildern gilt. (Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.10). 1.2 Tendenzen zur Ausgrenzung und Beschuldigung von Opfern – psychotraumatische Abwehrmechanismen In moralischer Weise fehlende Hilfsbereitschaft, gar „böser Wille“ der Beteiligten, Inkompetenz von Behörden oder Desinformation der Öffentlichkeit für die Diskrepanz zwischen rechtsstaatlichem Anspruch und sozialer Wirklichkeit verantwortlich zu machen, wäre zu einfach. Verantwortlich dafür ist vielmehr eine psychologisch tief in uns allen verwurzelte Tendenz, die uns dazu veranlasst uns nicht mit dem oft Grauen erregenden Schicksal von Gewaltopfern näher zu befassen. Das Schicksal von Gewaltopfern erschüttert unser eigenes persönliches Sicherheitsgefühl und stößt die Überlegungen an, ob das eigentlich 8 auch mir zustoßen könnte und wenn ja, wie ich mich in so einem Fall verhalten würde. Gegen diese Bedrohung des eigenen Sicherheitsgefühls setzten nun viele Personen Abwehrmechanismen ein, welche die aufkommende Angst und persönliche Bedrohung mildern oder überflüssig machen sollen. Die bedrohliche Realität, mit der uns das Schicksal der Betroffenen konfrontiert, will wieder vergessen werden, damit man weiterhin ein ruhiges und sicheres Leben führen kann. Es handelt sich also offensichtlich um ein berechtigtes Anliegen, das allerdings mit Mitteln verwirklicht wird, die auf Kosten der Opfer gehen und ihre Lage verschlimmern können. Schauen wir uns im Einzelnen einmal ein Beispiel für einen typischen Abwehrmechanismus an: Die wichtigste, zentrale Bedrohung des persönlichen Sicherheitsgefühls ist der Gedanke, es könne auch mir passieren. Schaut man in die Statistik von Gewaltdelikten, dann ist dieser Gedanke durchaus realistisch, da die Mehrheit der Erwachsenen Bürger in den europäischen Staaten mindestens einmal im Leben Opfer einer kriminellen Handlung wird (van Dijk 1990). Die Angst scheint also berechtigt zu sein. Doch um diese Angst nicht spüren zu müssen, schiebt man die realistische Überlegung „es kann jedem passieren“ zur Seite und sucht die Ursache der Tat in irgendeiner Besonderheit der Tatsituation oder des Opfers, die so auf uns nicht zutrifft, z.B. gefährliches Wohnviertel, ungünstige Tageszeit, leichtsinniges Verhalten des Opfers, etc. Es kann mich also eben doch nicht treffen! Diese subjektive Überzeugung geht über eine realistisch angemessene Einschätzung oft weit hinaus und nimmt eine irrationale subjektive Gewissheit an. An wissenschaftlichen Theorien, welche die Ursachen für Gewaltverbrechen überwiegend in den Persönlichkeitseigenschaften der Opfer suchten, zeigt sich wie stark solche Überzeugungen um sich greifen können. Dem Opfer die Schuld für das was ihm angetan wurde zuzuschreiben, ist die radikalste Variante dieses Abwehrmechanismus. Von Seiten der kirchlichen Organe wird diesem Denken nicht immer genügend entgegengewirkt: Das Opfer muss (mit)schuldig sein, da der gerechte Gott niemals zulassen würde, dass ein unschuldiger Mensch so hart und ungerecht getroffen würde. Für Theologen und Seelsorger liegen hier wichtige Aufgaben der Aufklärung. (vgl. Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.11). Häufig werden Opfer von Seiten der Justiz auch nicht genug mit einbezogen und so nicht als rationaler Partner betrachtet. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass das Opfer die blinde Rache verfolge statt einer staatlich kontrollierten Rechtssprechung. So wird letzten Endes das Opfer ausgegrenzt und entmündigt und diesmal im Namen der vom Rechtsstaat geforderten unparteilichen Rechtssprechung. Andererseits wird bei angestrebten Verschärfungen des Strafrechts das angebliche Interesse des Opfers an härterer Bestrafung des Täters betont. 9 International repräsentative Opferbefragungen führen jedoch übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass Opfer häufiger als der Bevölkerungsdurchschnitt milde und pädagogisch sinnvolle Strafen fordern. (van Dijk 1990). Den Opfern ist es häufig wichtig, dass der Täter einen Lernprozess durchmacht, der ihm das Unrecht seines Verhaltens vor Augen führt und ihm ermöglicht, sich in Zukunft anders zu verhalten. Für einen günstigen Umgang mit dem Opfer stehen noch weitere Hindernisse im Weg: Parteinahme und Identifikation mit dem Täter, Überidentifikation mit dem Opfer, etc. Da diesen Mechanismen zumeist unbewusste Motivation zugrunde liegt, ist eine bewusste Kontrolle eine wichtige Voraussetzung dafür, dass der Umgang mit der Opferproblematik langfristig rational gestaltet werden kann und die vorhandenen und zum Teil institutionalisierten Tendenzen zur Ausgrenzung und Beschuldigung von Opfern erfolgreich abgebaut werden können (vgl. Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.11). 1.3 Der Auftrag an die Sozial- und Gesundheitsverwaltung: Helfen und weitere Schäden vermeiden Wir als Bürger eines Rechtsstaates stehen in der Pflicht Menschen die zum Opfer von Gewalt wurden zu helfen oder zumindest dafür zu sorgen, dass weiterer Schaden von ihnen fern gehalten wird. Eine erste wichtige Anforderung ist, dass das Opfer Information und Führung benötigt durch eine Instanz, die von ihrem staatlichen Auftrag her primär sein persönliches Interesse im Auge hat, das mit dem Ziel einer optimalen Restitution zusammenfällt. Es werden also Einrichtungen benötigt, die den Betroffenen auf dem Weg vom Opfer zum (Über-)Lebenden des Traumas behilflich sind. Dieses Ziel sollte in enger Zusammenarbeit mit den übrigen Institutionen der Kriminalitätsbekämpfung verwirklicht werden. Es bedarf jedoch einer eigenständigen staatlich-institutionellen Repräsentation und Ermächtigung, denn die primäre Aufgabe für Polizei und Justiz besteht in Beweissicherung, Strafverfolgung, Rechtssprechung und Strafvollzug (vgl. Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.12). Außerdem erwies sich in wissenschaftlichen Studien (u.a. im KOM-Projekt), dass eine gewisse Professionalisierung im Bereich der Opferhilfe unerlässlich ist, denn nicht jede gut gemeinte Hilfe wirkt sich auch positiv für die Restituierung der Opfer aus. Eine staatliche 10 Interessenvertretung der Opfer, die sicherstellt, dass Hilfsangebote effektiv auf die Interessen des Opfers abgestimmt werden, wäre hilfreich. Die Beteiligten im Kölner Opferhilfe Modell bemühen sich seit dem Herbst 1995 darum, Missstände in der Situation von Gewaltopfern aufzudecken, systematisch zu erforschen, Verbesserungsvorschläge zu entwickeln und umzusetzen. Den Kern des Projekts bildet dabei die Zusammenarbeit zwischen der Universität Köln (Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie), dem Institut für Psychotraumatologie Köln, dem Ministerium für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie Nordrhein-Westfalen, dem Versorgungsamt Köln und dem Kölner Polizeipräsidium. Ferner bestehen Kontakte zu medizinischen Einrichtungen, zur Justiz und zu anderen Einrichtungen der Opferhilfe (vgl. Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.12). Im Nachfolgenden soll ein Einblick gegeben werden, in die Arbeit des KOM-Projekts und damit in Missstände und Verbesserungsmöglichkeiten der Opferhilfe. 2. Psychische Traumatisierung: die Wirklichkeit vieler Betroffener 2.1 Versuch einer Prävalenz-Schätzung (Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.14) „Diese eher vorsichtig geschätzten Zahlen und die Berücksichtigung der Tatsache, dass bei den betroffenen Personen eine erhebliche und andauernde symptomatische Belastung besteht, die oft auch eine starke Verminderung der Arbeits- und Kontaktfähigkeit und/oder des allgemeinen Gesundheitszustandes bedeutet, lassen einen deutlichen Handlungsbedarf allein im Bereich der Traumatisierung durch Gewalttaten erkennen. Dies gilt umso mehr, wenn man 11 berücksichtigt, dass sich die Folgen durch frühzeitige Unterstützung des natürlichen Verarbeitungsprozesses erheblich reduzieren lassen.“ (Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.14). 2.2 Missstände in der Situation von Gewaltopfern Im Nachfolgenden soll noch einmal kurz auf die Missstände in der Situation von Gewaltopfern eingegangen werden und die bereits im Kapitel 1 erwähnten ungünstigen Umstände für Bürger nach Opferwerdung noch einmal ins Gedächtnis gerufen und ergänzt werden. Unter vielerlei Aspekten ist die gegenwärtige Situation für Opfer von Gewalttaten nicht optimal. So kommt es immer wieder zu Erlebnissen, die aus psychotraumatologischer Sicht den Betroffenen nicht nur nicht helfen, sondern im Gegenteil eine beginnende Erholung verhindern und/oder zu einer Stagnation und Verschlechterung der psychischen Verfassung der Opfer beitragen. Langfristig kann sich dieser Umstand nicht nur auf die Psyche auswirken, sondern auch auf sozialen Beziehungen, Partnerschaft und Familie, das Arbeitsleben und auf den körperlichen Gesundheitszustand. Negative Erfahrungen von Seiten der Opfer werden an vielen Stellen gemacht: - misstrauische Polizisten, die dem Opfer nicht glauben - überforderte Sanitäter - Angehörige, die nicht in der Lage sind, ihre eigene Betroffenheit und Verunsicherung zu verarbeiten und dem Opfer Vorwürfe machen - Verschiedene Situationen vor Gericht - Antragsstellungen z.B. auf OEG-Entschädigung oder Begutachtungen Opfer kommen dadurch leicht in eine Spirale aus negativen Umwelterfahrungen, sozialer Isolation und Rückzug, aus Resignation und Frustration bei gleichzeitigem Leiden an psychotraumatischen Folgeerscheinungen, wenn sie nicht über ein sehr gutes soziales Netzwerk -Familie, Freunde- verfügen, welches verständnisvolle andauernde und nicht bevormundende Unterstützung gewährt. Betroffene wünschen häufig mehr Rat und Unterstützung, denn es existieren nur wenig spezifische Beratungsstellen oder Therapieangebote für Gewaltopfer (Ausgenommen Frauenberatungsstellen). Neben den zuvor erwähnten Abwehrmechanismen spielen auch verschiedene Empfindungen eine Rolle, warum häufig Opfern nicht auf die effektivste Weise geholfen wird. Wie schon bei den 12 Abwehrmechanismen erwähnt, steckt auch hier keine böse Absicht dahinter. Nicht selten empfindet man Schuldgefühle, weil man nicht in der Lage war das Opfer zu schützen. Solche Schuldgefühle können sich in Aggressivität gegen das Opfer verkehren, weil man mit der eigenen vermeintlichen Unzugänglichkeit nicht fertig wird. Ein anderes Problem, dass häufig auftritt ist die Desillusionierung, die eintritt durch die Konfrontation mit einem Opfer. „Desillusionierung bedeutet, dass man sich mit der Möglichkeit, selbst Opfer zu werden, mit der eigenen Verletzlichkeit, ja sogar mit der Möglichkeit des Todes konfrontiert sieht.“ (Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.15). Dies ist unangenehm, und wird quasi automatisch abgewehrt. Ein weiterer Mechanismus der oft in Kraft tritt, ist das Leugnen von der Schwere der Erfahrung und vor allem von der Ernsthaftigkeit und Hartnäckigkeit der Folgeerscheinungen. Oft dauert es eine Zeit lang, bis sich ein Opfern bewusst wird, dass das Unglück tatsächlich geschehen ist. Reaktionen, die in traumatischen Situationen und in den ersten Minuten oder sogar Stunden danach häufig vorkommen sind: - „Das kann nicht wahr sein!“ - „So etwas liest man nur in der Zeitung.“ - „Es ist gar nicht passiert.“ - „Ich bin das gar nicht.“ etc. Auch Angehörige, Helfer oder Sacharbeiter verspüren nicht selten ähnliche Impulse. „In der Verarbeitung eines Traumas spielt die Neuorganisation solcher Illusionen und grundlegende Annahmen über die eigene Person und die Umwelt eine zentrale Rolle.“ (Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.15). Im positiven Fall kann das Trauma als eine Ausnahmesituation bei einer gelungenen Differenzierung begriffen werden, ohne dabei die erschütternde Wirkung zu leugnen. Dieser Differenzierungsprozess muss auch die Umwelt des Opfers nachvollziehen um eine effektive Hilfestellung zu gewährleisten. Also keine leichte Aufgabe, die sowohl das Opfer als auch das soziale Umfeld bewältigen muss. 2.3 Das Trauma und seine Folgen Ein traumatisches Ereignis wird im Rahmen der diagnostischen Kriterien der Posttraumatischen Belastungsstörung im Diagnostischen Statistischen Manual psychischer 13 Störungen der American Psychatric Association (DSM-III-R) definiert als „außerhalb der üblichen menschlichen Erfahrung ... und für fast jeden stark belastend“. Beispiele dafür sind: - ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der körperlichen Integrität - ernsthafte Bedrohung nahe stehender Personen - plötzliche Zerstörung des eigenen Zuhauses bzw. der Gemeinde - Zeuge von Verletzung oder Tod anderer zu sein Typische traumatische Ereignisse: - Unfälle - Betroffensein von Naturkatastrophen - Diagnosemitteilungen bei tödlichen Krankheiten - Verlust nahe stehender Personen - Sexuelle Übergriffe - Vergewaltigungen - Folter - Gewalttätigkeiten - Wohnungseinbrüche in Abwesenheit (vgl. Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.15). Das Kriterium „außerhalb der üblichen menschlichen Erfahrung“ wurde in der nächsten Auflage (DSM IV) wieder fallen gelassen. Ein Grund dafür mag sein, dass die oben skizzierten Ereignisse zu häufig vorkommen, um sie außerhalb üblicher menschlicher Erfahrung zu klassifizieren. ... Im DSM IV wurde stattdessen als Kriterium eine Reaktion von intensiver Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen der betroffenen Personen hinzugenommen.“ (Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.15). Traumatische Situationen lassen sich zudem auch danach unterscheiden, ob es sich bei ihnen um singuläre Ereignisse handelt oder ob sie nur ein Teil einer Kette weiterer, oft ähnlicher, Erfahrungen sind, ob sie antizipierbar waren oder überraschend, inwieweit noch Handlungsspielraum währenddessen bestand, etc. Meist hinterlassen traumatische Erfahrung Spuren bei den Betroffenen. Am häufigsten und Übereinstimmend beschrieben werden Syndrome - auf der Ebene des Erlebens, - auf der Ebene des Verhaltens 14 - und auf der Ebene der physiologischen Ebene (vgl. unten Kriterien B-D) In der von dem KOM-Projekt verwendeten Terminologie wird das Symptombild als Basales Psychotraumatisches Belastungssyndrom benannt. Das Basale Psychotraumatisches Belastungssyndrom umfasst folgende Kriterien nach dem DSM IV: A. Die Person wurde mit einem traumatischen Ereignis konfrontiert, bei dem die beiden folgenden Kriterien vorhanden waren: 1) die Person erlebte, beobachtete oder war mit einem oder mehreren Ereignissen konfrontiert, die tatsächlichen oder drohenden Tod oder ernsthafter Verletzung oder eine Gefahr der körperlichen Unversehrtheit der eigenen Person oder anderen Personen beinhalten. 2) Die Reaktion der Person umfasst intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen. Beachte: Bei Kindern kann sich dies auch durch aufgelöstes oder agiertes Verhalten äußern. B. Das traumatische Ereignis wird beharrlich auf mindestens eine der folgenden Weisen wiedererlebt: 1) Wiederkehrende und eindringliche belastende Erinnerungen an das Ereignis, die Bilder, die Gedanken oder Wahrnehmungen umfassen können. Beachte: Bei kleinen Kindern können Spiele auftreten, in denen wiederholt Themen oder Aspekte des Traumas ausgedrückt werden können. 2) Wiederkehrende, belastende Träume von dem Ereignis. Beachte: Bei Kindern können stark beängstigende Träume ohne wieder erkennbaren Inhalt auftreten. 3) Handeln oder Fühlen, als ob das traumatische Ereignis wiederkehrt (beinhaltet das Gefühl, das Ereignis wiederzuerleben, Illusion, Halluzination und dissoziative Flashback-Episoden, einschließlich solcher, die beim Aufwachen oder bei Intoxikationen auftreten). Beachte: Bei kleinen Kindern kann eine traumaspezifische Neuinszenierung auftreten. 4) Intensive psychische Belastung bei der Konfrontation mit internalen oder externalen Hinweisreizen, die einen Aspekt des traumatischen Ereignisses symbolisieren oder an Aspekte desselben erinnern. 15 5) Körperliche Reaktionen bei der Konfrontation mit internalen oder externalen Hinweisreizen, die einen Aspekt des traumatischen Ereignisses symbolisieren oder an Aspekte desselben erinnern. C. Anhaltende Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma verbunden sind, oder eine Abflachung der allgemeinen Realität (vor dem Trauma nicht vorhanden). Mindestens drei der folgenden Symptome liegen vor: 1) Bewusstes Vermeiden von Gedanken, Gefühlen oder Gesprächen, die mit dem Trauma in Verbindung stehen. 2) Bewusstes Vermeiden von Aktivitäten, Orten oder Menschen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen. 3) Unfähigkeit, einen wichtigen Aspekt des Traumas zu erinnern. 4) Deutlich vermindertes Interesse oder verminderte Teilnahme an wichtigen Aktivitäten. 5) Gefühl der Losgelöstheit oder Entfremdung von anderen. 6) Eingeschränkte Bandbreite des Affekts (z.B. Unfähigkeit, zärtliche Gefühle zu empfinden). 7) Gefühle einer eingeschränkten Zukunft (z.B. erwartet nicht, Karriere, Kinder oder normal langes Leben zu haben). D. Anhaltende Symptome erhöhten Arousals (vor dem Trauma nicht vorhanden). Mindestens zwei d folgenden Symptome liegen vor: 1) Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen 2) Reizbarkeit oder Wutausbrüche 3) Konzentrationsschwierigkeiten 4) Übermäßige Wachsamkeit (Hypervigilanz) 5) Übertriebene Schreckreaktion E. Das Störungsbild (Symptome unter Kriterium B, C und D) dauert länger als 1 Monat F. Das Störungsbild verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. Bestimme, ob: Akut: Wenn die Symptome weniger als 3 Monate andauern. Chronisch: Wenn die Symptome mehr als 3 Monate andauern. 16 Bestimme, ob: Mit verzögertem Beginn: Wenn der Beginn der Symptome mindestens 6 Monate nach dem Belastungsfaktor liegt. (Tabelle 2-1 Diagnostische Kriterien der Posttraumatischen Belastungsstörung nach DSM-IV) Das Störungsbild lässt sich frühestens einen Monat nach dem traumatischen Ereignis diagnostizieren. (vgl. Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.16f). In den ersten vier Wochen nach einer traumatischen Erfahrung können natürlich die selben Symptome auftreten. Das geschieht auch bei einem größeren Anteil traumatisierter Personen. Im DSM-IV wurde dafür die Akute Belastungsstörung neu aufgenommen. Die akute Belastungsstörung umfasst die folgenden Kriterien: A. Die Person wurde mit einem traumatischen Ereignis konfrontiert, bei dem die beiden folgenden Kriterien vorhanden waren: 1) die Person erlebte, beobachtete oder war mit einem oder mehreren Ereignissen konfrontiert, die tatsächlichen oder drohenden Tod oder ernsthafter Verletzung oder eine Gefahr der körperlichen Unversehrtheit der eigenen Person oder anderen Personen beinhalten. 2) Die Reaktion der Person umfasst intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen. Beachte: Bei Kindern kann sich dies auch durch aufgelöstes oder agiertes Verhalten äußern. B. Entweder während oder nach dem extrem belastenden Ereignis zeigt die Person mindestens drei der folgenden dissoziativen Symptome: 1) Subjektives Gefühl von emotionaler Taubheit, von Losgelöstsein oder Fehlen emotionaler Reaktionsfähigkeit. 2) Beeinträchtigung der bewussten Wahrnehmung der Umwelt (z.B. „wie betäubt sein“). 3) Derealisationserleben 4) Depersonalisationserleben 5) Dissoziative Amnesie (z.B. Unfähigkeit, sich an einem wichtigen Aspekt des Traumas zu erinnern). C. Das traumatische Ereignis wird ständig auf mindestens eine der folgenden Arten wiedererlebt: wiederkehrende Bilder, Gedanken, Träume, Illusionen, Flashback- 17 Episoden oder das Gefühl, das Trauma wiederzuerleben oder starkes Leiden bei Reizen, die an das Trauma erinnern. D. Deutliche Verminderung von Reizen, die an das Trauma erinnern (z.B. Gedanken, Gefühle, Gespräche, Aktivitäten, Orte oder Personen). E. Deutliche Symptome von Angst oder erhöhtem Arousal (z.B. Schlafstörungen, Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Hypervigilanz, übertriebene Schreckreaktionen, motorische Unruhe). F. Das Störungsbild verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen oder beeinträchtigt die Fähigkeit der Person, notwendige Aufgaben zu bewältigen, z.B. notwendige Unterstützung zu erhalten oder zwischenmenschliche Ressourcen zu erschließen, indem Familienmitglieder über das Trauma berichtet wird. G. Die Störung dauert mindestens 2 Tage und höchstens 4 Wochen und tritt innerhalb von 4 Wochen nach dem traumatischen Ereignis auf. H. Das Störungsbild geht nicht auf die direkte körperliche Wirkung einer Substanz (Z.B. Drogen, Medikamente) oder eines medizinischen Krankheitsfaktors zurück, wird nicht besser durch eine kurze psychotische Störung erklärt und beschränkt sich nicht auf die Verschlechterung einer bereits vorher bestehenden Achse I- oder Achse IIStörung. (Tabelle 2-2 Diagnostische Kriterien der Posttraumatischen Belastungsstörung nach DSM-IV) Aufgrund vorliegender Untersuchungen (Kleber (unveröffentlicht), Koopman et. al. 1995) lässt sich vermuten, dass mindestens 50% von traumatisierten Personen eine akute Belastungsstörung zeitweise entwickeln. Daher lässt sich annehmen, dass ein großer Teil einer traumatisierten Population in der ersten Zeit an Folgesyndromen leiden, dass es aber bei einem Teil dieser Personen zu Spontanremissionen kommt. Diejenigen, bei denen später die Diagnose PTBS gestellt wird, stammen zu einem großen Teil aus der Gruppe der Personen mit frühen akuten Belastungsreaktionen. Die akute Belastungsreaktion kann somit bis zu einem gewissen Grade als Prädiktor langfristiger Schädigungen angesehen werden. Um die Diagnose psychotraumatische Belastungsstörungen zu erhalten, müssen nicht unbedingt alle Elemente der Bereiche intrusives Wiedererleben, Vermeidungsverhalten und Hyperarrousal vorliegen. Es gibt nicht selten Verläufe, in denen z.B. das Vermeidungsverhalten überwiegt, während intrusives Wiedererleben zumindest zeitweise 18 nicht auftritt. (vgl. Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.17f). 2.4 Weitere langfristige Auswirkungen „ Das PTSD aus dem DSM IV scheint eher die Kriterien festzuhalten, die sich aus der psychobiologischen Antwort des Organismus und seinen spontanen Versuchen ergeben, das Trauma zu verarbeiten. Unter besonderen Bedingungen werden weitere Symptome hinzukommen oder einzelne Kriterien des mehr physiologisch definierten Syndroms können durch psychologische oder psychosomatische Folgen ersetzt werden.“ (Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.18). Daher wird das PTSD von den Mitarbeitern des KOMProjekts auch als das allgemeine psychotraumatische Belastungssyndrom bezeichnet und von komplexeren oder auch speziellen Belastungssyndromen unterschieden. Als Folge einer Opferwerdung müssen also nicht unbedingt die Symptome des basalen psychotraumatischen Belastungssyndroms auftreten, sondern je nach näheren Umständen können auch andere Veränderungen auftreten bzw. hinzukommen. Das komplexe psychotraumatische Belastungssyndrom beschreibt die Folgen andauernder externer Traumatisierung. Teilweise lassen sich die Symptome aus diesen Syndrom auch bei Gewaltopfern beobachten. Die nachfolgende Aufzählung der möglichen Symptome sind dem Reader des Kölner Opferhilfe Modells entnommen (S.18f): Der Patient war über einen längeren Zeitraum (Monate bis Jahre) totalitärer Herrschaft unterworfen, wie z.B. Geiseln, Kriegsgefangene, Überlebende von Konzentrationslagern oder Aussteiger aus religiösen Sekten, aber auch Menschen, die in sexuellen oder familiären Beziehungen totale Unterdrückung erlebten, beispielsweise von Familienangehörigen geschlagen, als Kinder psychisch misshandelt oder sexuell missbraucht wurden oder von organisierten Banden sexuell ausgebeutet wurden. 1. Störung der Affektregulation, darunter - anhaltende Dysphorie - chronische Suizidgedanken - Selbstverstümmelung - aufbrausende oder extrem unterdrückte Wut (eventuell alternierend) - zwanghafte oder extrem gehemmte Sexualität (eventuell alternierend) 19 2. Bewusstseinsveränderungen, darunter - Amnesie oder Hyperamnesie, was die traumatischen Ereignisse - zeitweilig dissoziative Phasen - Depersonalisation/Derealisation - Wiederholungen des traumatischen Geschehens, entweder als intrusive Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung oder als ständig grüblerische Beschäftigung 3. Gestörte Selbstwahrnehmung - Ohnmachtsgefühle, Lähmung jeglicher Initiative - Scham- und Schuldgefühle, Selbstbezichtigung - Gefühl der Beschmutzung und Stigmatisierung - Gefühl, sich von anderen grundlegend zu unterscheiden (der Patient ist etwa überzeugt, etwas ganz besonderes zu sein, fühlt sich mutterseelenallein, glaubt, niemand könne ihn verstehen oder nimmer eine nichtmenschliche Identität an) 4. Gestörte Wahrnehmung des Täters, darunter - Ständiges Nachdenken über die Beziehung zum Täter (auch Rachegedanken) - unrealistische Einschätzung des Täters, der für allmächtig gehalten wird (Vorsicht: Das Opfer schätzt die Machtverhältnisse eventuell realistischer ein als ein Arzt) - Idealisierung oder paradoxe Dankbarkeit - Gefühl einer besonderen oder natürlichen Beziehung - Übernahme des Überzeugungssystems oder der Rationalisierung des Täters 5. Beziehungsprobleme, darunter - Isolation und Rückzug - gestörte Intimbeziehung - wiederholte Suche nach einem Retter (eventuell alternierend mit Isolation und Rückzug) - anhaltendes Misstrauen - wiederholt erfahrene Unfähigkeit zum Selbstschutz 6. Veränderung des Wertesystems, darunter - Verlust fester Glaubensinhalte - Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung 20 Einen differenzierten Vorschlag für ein Victimisierungssyndrom hat Ochberg vorgelegt: A) Die Erfahrung einer oder mehrerer Episoden von psychischer Gewalt oder psychologischem Missbrauch oder Nötigung zu sexueller Aktivität entweder als Opfer oder als Zeuge B) Die Entwicklung von x (Anzahl noch nicht festgelegt) der folgenden Symptome, welche vor der Victimisierungserfahrung nicht vorhanden waren. 1. Ein Gefühl, den täglichen Aufgaben und Verpflichtungen nicht mehr gewachsen zu sein, welches über das Erlebnis von Ohnmacht in der speziellen traumatischen Situation hinausgeht (z.B. allgemeine Passivität, mangelnde Selbstbehauptung oder fehlendes Vertrauen in die eigene Urteilsfähigkeit). 2. Die Überzeugung, das man durch Victimisierungserfahrung dauerhaft geschädigt ist (z.B. wenn ein missbrauchtes Kind oder ein Opfer von Vergewaltigung der Überzeugung sind, dass sie für andere nie mehr attraktiv sein können). 3. Gefühle von Isolation, Unfähigkeit, anderen zu vertrauen oder mit Ihnen Intimität herzustellen. 4. Übermäßige Unterdrückung oder exzessiver Ausdruck von Ärger. 5. Nicht angemessene Bagatellisierung von zugefügten psychischen oder physischen Verletzungen. 6. Amnesie des traumatischen Erlebnisses. 7. Die Überzeugung des Opfers, an dem Vorfall eher die Schuld zu tragen als der Täter. 8. Eine Neigung, sich der traumatischen Situation erneut auszusetzen. 9. Übernahme des verzerrten Weltbildes des Täters in der Einschätzung von sozial angemessenem Verhalten. (z.B. die Annahme, dass es in Ordnung ist, wenn Eltern sexuelle Beziehungen zu ihren Kindern unterhalten oder, dass es in Ordnung ist, wenn ein Ehemann seine Frau schlägt, damit sie gehorcht.) 10. Idealisierung des Täters. C) Dauer des Syndroms von mindestens einem Monat. (Ochberg, 1993 in dtsch. Übersetzung in Fischer & Riedesser 1998) Zusätzlich führt er noch folgende Victimisierungssymptome auf : (Übersetzung Düchting, 1997) - Scham: Tiefe Verlegenheit, oft charakterisiert als Demütigung oder Schande, Kränkung 21 - Selbstbeschuldigung: Übertriebene Gefühle von Verantwortung für das traumatische Ereignis, mit Schuld und Reue, trotz deutlicher Unschuld - Unterwerfung: Sich abgewertet fühlen, entmenschlicht, mit vermindertem Einfluss, kraftlos als ein direktes Resultat des Traumas - Krankhafter Hass: Besessene Rachegefühle, Fantasien, den Täter zu schlagen oder zu erniedrigen, mit oder ohne Ausbruch von Zorn oder Wut - Paradoxe Dankbarkeit: Positive Gefühle gegenüber dem Täter, vom Mitleid bis zu Liebe, einschließlich Zuneigung, aber nicht notwendigerweise Identifikation. Die Gefühle werden Üblicherweise ironisch erlebt, gründen sich aber auf die Dankbarkeit über das Geschenk des Lebens von jemandem, der seinen Willen zum Töten demonstriert hat. (Ebenso bekannt als pathologische Übertragung oder „Stockholm Syndrom“) - ´defilement`: sich schmutzig oder eklig fühlen, oder sich vor etwas ekeln - Sexuelle Hemmung - Resignation : Zustand von gebrochenem Willen oder Verzweiflung - Sinken des sozio-ökonomischen Status, auch Änderungen im Lebensstil Wie schon oben erwähnt, findet man diese Symptome mehr oder weniger häufig auch in Aussagen von Gewaltopfern wieder, die auch im Rahmen des KOM-Projekts untersucht wurden. Es treffen allerdings nur selten viele oder gar alle Beeinträchtigungen zu. Dies hängt auch mit der Art der Gewalttat zusammen, die das Opfer zu bewältigen hat. Einige sind besonders bei Vergewaltigungen oder Kindesmissbrauch anzutreffen, andere bei sehr schweren anderen Traumatisierungen. Wichtig ist es aber, und das soll in diesem Zusammenhang noch einmal betont werden, dass man sich die ganze Bandbreite möglicher Traumafolgen vor Augen hält und bei der dargebotenen Hilfestellung berücksichtigt. Zu achten ist auch auf Schwierigkeiten in der Affektregulation, auf Depressionen und auf suizidale Neigungen. Und auf kognitiver Ebene sollte man spezielle auf Änderungen im Selbst- und Weltbild der Betroffenen reagieren. 22 2.5 Traumadiagnostik - 5 Skalen zur Messung relevanter Faktoren „Das Erleben traumatischer Situationen wird besonders deutlich an dissoziativen Erlebnisweisen, die sehr häufig – vorübergehend- während des Traumas auftreten. Das Ausmaß peritraumatischer Dissoziationen ist der wohl am besten bestätigte Prädiktor langfristiger Belastungsstörungen.“ (Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.20). Im folgenden werden fünf der zahlreichen Fragebögen und Tests kurz vorgestellt, die sich zur Feststellung psychotraumatischer Belastungsreaktionen eignen und die alle auch im KOMProjekt eingesetzt wurden: - Peritraumatic Dissoziative Experiences Questionaire (PDEQ) (Marmar, Charles R./ Weiss, Daniel S./ Metzler, Thomas 1996) : o Es wird retrospektiv nach dissoziativen Erlebnissen während des traumatischen Ereignisses gefragt (z.B. Ich hatte Momente in denen ich nicht mehr wusste was vor sich ging. Ich fühlte mich so, als ob ich nicht Teil von dem war, was passierte. etc.) o Es kann jeweils auf einer Skala von 1-5 angekreuzt werden, ob die Aussage gar nicht (1) bis ganz genau (5) zutrifft. o - Dieser Fragebogen wurde auch im KOM-Projekt eingesetzt. Posttraumatic Symptom Scale mit 10 Items (PTSS-10) (Raphael, R ; Lundin,T ; Weisaeth, L ; 1989) : o Messung psychotraumatischer Folgeerscheinungen o Es wird nach aktuellen Psychotraumatischen Belastungssymptomen gefragt, die in den letzten 7 Tagen vor Beantwortung der Skala aufgetreten sind. o Ankreuzen auf einer Skala von 0-6, ob das Symptom nie (0) bis immer (6) aufgetreten ist o Die Skala ist als kurzes, leicht auszufüllendes und auszuwertendes Instrument gut geeignet, eine erste Verdachtsdiagnose zu stellen. - Impact of Event Scale (IES-r) (Weiss, Daniel S.; Marmar, Charles R. 1997): o Dieser Test enthält drei Subskalen, die die drei wesentlichen diagnostischen Kriterien B-D der PTSD-Definition im DSM-IV abdecken: 23 Wiedererleben der Situation Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma verbunden sind, oder eine Abflachung der allgemeinen Reagibilität o Erhöhtes Erregungsniveau Auch hier geht es um akute Symptome, es ist gefragt, wie häufig die genannten Erlebnisphänomene in den letzten 7 Tagen aufgetreten sind (Skala von 1-4, überhaupt nicht bis oft). - Gießener Beschwerde Bogen nach Brähler (1983): o - Mit diesem Verfahren werden psychosomatische Symptome erfasst. Das Kölner Trauma Inventar (KTI , Fischer Schedlich 1995b): o Das KTI ermöglicht die Diagnostik weiterer traumatischer Erfahrungen in der Lebensgeschichte. 3. Das Verlaufsmodell psychischer Traumatisierung Im Folgenden wird kurz auf das Verlaufsmodell psychischer Traumatisierung von Fischer und Riedesser (1998, Fischer 1995) eingegangen, welches den Prozess der Traumatisierung in drei Phasen unterteilt: 1. Die traumatische Situation. 2. Die traumatische Reaktion als unmittelbare Antwort auf die Situationserfahrung. 3. Den traumatischen Prozess, d.h. den Versuch, mit der unbewältigten traumatischen Erfahrung zu leben. „Eine traumapsychologische Untersuchung nach dem traumatologischen Verlaufsmodell versucht, den inneren Zusammenhang zwischen Elementen der traumatischen Situation, der individuellen Reaktion darauf und dem persönlichkeitstypischen traumatischen Prozess zu untersuchen, wie er sich in der Lebensgeschichte der Betroffenen entwickelt. Eine Definition von „Trauma“ muss dem systematischen Zusammenhang zwischen subjektiven und objektiven Faktoren gerecht werden, indem sie beide Gesichtspunkte systematisch aufeinander bezieht. Um diesem „ökologisch“ oder bisweilen auch als „transaktional“ bezeichneten Aspekt der traumatischen Erfahrung gerecht zu werden, definiert Fischer et al. (1995a) das Trauma als „ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen 24 Situationsfaktoren und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt.“ “ (Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.21). Durch das Trauma wird unser Selbst- und Weltverständnis dahingehend erschüttert, als dass wir einige, allerdings lebenswichtige Illusionen verlieren. Wir glaubten zuvor an die Unverletzlichkeit unseres Selbst und dass Ereignisse, die uns betreffen, auch von uns kontrolliert, beherrscht oder zumindest verstanden werden können. Unter dem Begriff „individuelle Bewältigungsmöglichkeit“ ist die subjektive Fähigkeit der Traumaverarbeitung zu verstehen. Diese spielt bei der Verarbeitung eine ebenso wichtige Rolle wie objektive Situationsfaktoren. Es handelt sich bei einem Trauma also um ein relationales Phänomen. Für Menschen, die eine traumatische Situation erlebt haben, bedeutet dies eine vital bedrohliche Herausforderung von außen, die sowohl kognitiv als auch handelnd nicht adäquat beantworten kann. Genau dies ist aber in einer solchen Lage eigentlich dringend erforderlich. Dieser Gegensatz von Möglichem und Erforderlichem führt zu extremer physiologischer Erregung, zu Dissoziationserlebnissen während der traumatischen Situation und zu (Teil)Amnesien danach. Das Trauma verlangt nach einer Verarbeitung, die aufgrund extremer Überforderung nicht zeitgleich mit dem Erlebten erfolgen konnte, sondern die nachträglich geschehen muss. Von Horowitz wird angenommen, dass die traumatische Erfahrung in einer Art „working memory“ gespeichert wird und von dort aus solange immer wieder (portionsweise) ins Bewusstsein drängt, bis eine Integration in das Selbst- und Weltverständnis des Individuums gelungen ist. Bis also eine realistische Einschätzung und eine Rekonstruktion der traumatischen Erfahrung inklusive der zugehörigen Affekte möglich geworden ist. Eine realistische Einschätzung heißt, dass die subjektiven und objektiven Komponenten der traumatischen Erfahrung und deren Differenz berücksichtigt werden können. Der Motor dieses Prozesses ist eine „Completion Tendency“, eine inhärente Tendenz, die unterbrochene Sequenz von Wahrnehmung und Handeln zu Ende zuführen. Gelingt diese Verarbeitung nicht, kommt es nach Fischer und Riedesser zu einer „Einkapselung“ der gemachten Erfahrung. Psychosomatische Erkrankungen, Charakterveränderungen, aber auch Alkoholoder Drogenmissbrauch, bzw. allgemeine Veränderungen und Störungen der Arbeits- und Liebesfähigkeit können Folgeerscheinungen davon sein. Die Forschungen des KOM-Projekts haben gezeigt, dass es unmittelbar nach der eigentlichen traumatischen Situation weichenstellend für den weiteren Verarbeitungsverlauf sein kann, 25 inwieweit es beteiligten Dritten gelingt, Betroffene zu beruhigen, zu vermitteln, dass es jetzt vorbei ist, ein wenigstens minimales Sicherheitsempfinden wiederherzustellen und die Wahrnehmung Betroffener ernst zu nehmen (vgl. Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.22). „Wichtig hierbei ist, dass ein Trauma per definitionem eine Situation ist, die den gegenwärtig vorhandenen Wissensbestand und den Handlungsspielraum beim Betroffenen übersteigt bzw. die zu den vorhandenen Schemata inkompatibel ist.“ (Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.22). Es handelt sich also nicht um ein Trauma, wenn diese Inkongruenz nicht vorliegt. Insofern sind Reaktionen wie Dissoziationen während traumatischen Situationen oder Verleugnungen nicht nur ganz normal, sondern sogar adaptiv. Sie stellen sog. Schutzreaktionen des durch die Situation überforderten und existenziell bedrohten Individuums dar. Laut Fischer und Riedesser gibt es einen natürlichen Verarbeitungsverlauf eines Traumas. „Die prinzipielle Unabgeschlossenheit des Traumas bedingt eine Verarbeitung im Nachhinein, einen Verarbeitungsverlauf mit einer unterschiedlichen zeitlichen Ausdehnung, bei dem eine Integration der traumatischen Erfahrung in die Selbst- und Weltschemata des Individuums bzw. ein entsprechender Prozess von Assimilation und Akkomodation von Schema und Erfahrung schließlich gelingen kann, der manchmal aber auch nicht zum Abschluss kommt.“ (Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.22). Falls es nicht ganz zum Abschluss kommen kann, werden mehr oder weniger gelungene Kompromisse in Form von kompensatorischen Bemühungen oder Desillusionierungsschemata oder chronifizierter Symptomatik gebildet. Während der traumatischen Reaktion versucht das Individuum sich der traumatischen Erfahrung zu stellen und beginnt sie zu verarbeiten. Wichtig scheint dabei zu sein, dass die gemachten Erfahrungen mit allen negativen Aspekten eine gewisse Zeit im Bewusstsein gehalten werden und so eine Durcharbeitung ermöglicht wird. Nach einer gelungenen Verarbeitung kann das Erlebnis als etwas Vergangenes, aber Reales akzeptiert werden. Durch eine Differenzierung wird die traumatisierende Situation als Ausnahme betrachtet und die vor dem Ereignis bestehende Selbst- und Weltordnung kann wieder größtenteils hergestellt werden. Das soll nicht heißen, dass das Erleben eines Traumas das Leben nicht mehr oder weniger tief greifend verändert. Man kann eine solche Erfahrung nicht einfach löschen. Wenn es nach einer angemessenen Verarbeitungszeit immer noch nicht gelungen ist, die gemachte Erfahrung zu integrieren, dann wird von einem traumatischen Prozess gesprochen. 26 Mit einer graphischen Übersicht über Komponenten psychischer Traumatisierung soll dieser Abschnitt abgeschlossen werden. Zur Erklärung: Im rechten Teil (grauer Untergrund) geht die Grafik in ein Diagramm über, das nach rechts durch die Zeitachse und nach oben durch Symptomstärke definiert ist. Die dicken Pfeile in diesem Bereich symbolisieren idealtypische Verläufe, in denen anfänglich gleich hohe Symptome – die durchaus als adaptive Schutzmechanismen fungieren – entweder chronifizieren oder in einem Erholungsprozess übergehen. Zu ergänzen wären hier Verläufe, bei denen auch anfänglich keine auffälligen Reaktionen festgestellt werden können, und die auch keine späteren Symptome zeigen. Ob in solchen Fällen ein (objektiv) weniger traumatisierender Einfluss anzunehmen ist oder eine besondere Wiederstandskraft der betroffenen Person, kann hier nicht beantwortet werden. Der dünne Pfeil, der sich von links nach rechts durch die gesamte Graphik zieht, soll die individuelle Bedeutungszuschreibung symbolisieren, die sich aus der Lebensgeschichte und Situationsfaktoren entwickelt, postexpositorische Einflüsse und eigendynamische Effekte entstandener Symptome aufnimmt und schließlich das individuell konstellierte Belastungssyndrom determiniert. (Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.24) 27 4. Forschung im Kölner Opferhilfemodell (KOM) 4.1 Der KOM-Fragebogen und Interviews Im KOM-Projekt war man an der Erforschung von Verarbeitungsformen und psychotraumatischer Folgeerscheinungen bei betroffenen Personen interessiert. Zu diesem Zweck wurde ein Fragebogen (KOM-Fragebogen) entwickelt. Hierfür bediente man sich Teilen anderer Fragebögen, wie z.B. dem Kölner Trauma Inventar KTI von Fischer/Schedlich und entwickelte offene Fragen. Fünf Skalen zur Messung relevanter Faktoren wurden hinzugefügt, von denen vier aus dem Englischen übersetzt sind (siehe Kap.2.5). Zusätzlich zu diesen Skalen wurden die Betroffenen befragt, ob sie bereits frühere Gewalterfahrungen im Laufe ihrer Lebensgeschichte gemacht hatten. Somit sollte eine zusätzliche Belastung aufgrund weiterer, früherer oder späterer Gewalttraumatisierungen erfasst werden. Im Folgenden sind zwei der offenen Fragen aufgeführt: Hat sich in Ihren sozialen Kontakten seit dem Vorfall etwas geändert? Wie ging es Ihnen unmittelbar nach dem Ereignis? Neben dem Bearbeiten der Fragebögen wurde den Betroffenen die Möglichkeit gegeben über ihre Erfahrungen in einem ausführlich klinischen, teilstrukturierten Interview zu sprechen, was dazu beitragen sollte, dass hier Fragen geklärt werden, die sich allein durch das Beantworten von Fragebögen nicht klären lassen. Um beispielsweise herauszufinden, welches die ausschlaggebenden Faktoren für eine Entwicklung und Chronifizierung von PTBSSymptomen sind, wurden sie aufgefordert detaillierte Angaben zu den lebensgeschichtlichen Erfahrungen, vorhergehenden Traumata, zu Einzelheiten der traumatischen Situation und deren Verarbeitung zu machen. Um die Interviewstudien auswerten zu können, wurden sie auf Tonband aufgezeichnet Diese Möglichkeit der Interviewbefragung wurde zum Untersuchungszeitpunkt von 25 Personen wahrgenommen. Die Hauptaufgabe der Interviews ist es detailliert Umstände und Verlauf des Einzelfalls zu untersuchen, wobei der Versuch unternommen wird, systematisch die Einflussgrößen und deren individuell gesetzmäßiges Zusammenwirken aufzuzeigen um dann Vergleiche solcher Verlaufsscripte durchzuführen. 28 4.2 Ergebnisse der Kölner Forschung 4.2.1 Die untersuchten Gewaltopfer/Stichprobe Die zwei Stichproben der Kölner Forschungsuntersuchung setzen sich aus 107 Personen zusammen, von denen 59 Männer sind und 48 Frauen. Hiervon handelt es sich bei 68 Fällen um Gewaltereignisse, die mehr als ein Jahr zurückliegen. Die Personen waren zum Zeitpunkt der Tat zwischen 6 bis 88 Jahre alt. Das Durchschnittsalter beträgt 32,6 Jahre. Die meisten der Befragten (55%) machten die Angabe 2 bis 3mal Opfer einer Gewalttat gewesen zu sein, einer von ihnen sogar bis zu 10mal. In der Untersuchung ergab sich ein Spektrum sehr unterschiedlich geschilderter Situationen, weshalb es notwendig erschien die Schwere der traumatisierenden Einflüsse einzuschätzen. Da sich die Einteilung jedoch als nicht ganz einfach erwies, wurden die gesamten Fallschilderungen zusammen mit Angaben über Alter, Geschlecht und erlittene Verletzungen sechs Personen vorgelegt, die ein Rating bezüglich des Schweregrades der traumatischen Situation vornehmen sollten (von 0 bis 6 → ’gering’ bis extrem). Der Schweregrad der objektiven Situationseinflüsse weist eine signifikante Korrelation mit späteren Symptomen auf (0,35***, Rangkorrelation), determiniert diese aber nicht alleine! 52,3% der betroffenen Personen bezeichnen das Ereignis als lebensbedrohlich. Bei 29,9% der Täter handelte es sich um einen Bekannten. 4.2.2 Beschreibung objektiver Situationsfaktoren 4.2.3 Dissoziatives Erleben in der traumatischen Situation Bei einem Großteil der Betroffenen kam es während der traumatischen Situation zu dissoziativen Erfahrungen. Dies ließ sich neben der retrospektiven Ermittlung dieser Erfahrungen mit Hilfe der PDEQ-Skala, auch in zahlreichen Interviews und Beantwortungen der Fragebögen erkennen. Dass ein hohes Maß an dissoziativem Erleben vorlag, zeigt sich darin, dass 72% der 107 Befragten angaben, eine oder mehrere der 10 auf der PDEQ-Skala beschriebenen Dissoziationsformen in der extremsten Ausprägung erlebt zu haben. Bei 53% sind es zwei und mehr, bei 36% drei und mehr. 29 4.2.4 Symptomverbreitung und –ausprägung Ferner fand bei der Untersuchung die IES-R (revidierte Impact of Event Scale) von Weiss und Marmar (1997) Verwendung. Sie enthält neben den Subskalen Intrusion (überflutetes Wiedererinnern, mit oder ohne auslösende Momente) und Avoidance (Vermeidungs- und Verleugnungsverhalten) eine Subskala zum erhöhten Erregungsniveau (Hyperarrousal), womit die klassischen Symptome einer PTBS wie sie im DSM IV enthalten sind, messbar sind. Es zeigt sich, dass diese Symptome bei einem relativ hohen Prozentsatz der Opfer vergleichsweise in hoher Ausprägung auftreten. Um den Anteil der Personen mit PTBS zu bestimmen, wurde die PTSS-10 verwendet. Aus der Berechnung der Summenwerte der PTSS lassen sich folgende drei Gruppen klassifizieren: ,,kein PTBS’’= 55,3% ,,Verdacht auf PTBS’’= 26,2% PTBS= 18,4% Betrachtet man die Extremantworten, zeigt sich, dass über 1/3 der Stichprobe (38,3%) innerhalb der letzten Woche vor Bearbeiten des Fragebogens mit den entsprechenden Leiden ,,immer’’ zu tun hatte. Zu diesen Beschwerden zählen in 20,6% der Fälle ’Schreckhaftigkeit’, zu 22,4% ’Angst vor Erinnerungsauslösern’ und bei 11,2% Schlafprobleme. Da nach Traumatisierungen häufig psychosomatische Beschwerden vermehrt im Vergleich zur Normalbevölkerung auftreten, untersuchte man diesen Aspekt mit dem GBB. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Traumatisierung durch eine Gewalttat nicht in spezifischen psychosomatischen Beschwerden zeigt, der Patient aber dennoch durch diese insgesamt beeinträchtigt wird. In der Studie hat sich ebenso gezeigt, dass ein größerer Zeitabstand zum Vorfall nicht gleich eine Verbesserung der einmal aufgetretenen Symptombildung bedingt, denn man erhielt keine signifikanten negativen Korrelationen mit den Symptomskalen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die Schwere der erfahrenen Gewalt eine Rolle spielt bei der Ausbildung der Symptome. 30 4.2.5 Einflussgrößen späterer Symptombildung und Beschwerden und deren Vorhersage Man stellte sich ferner die Frage, ob gewisse Einflussgrößen existieren, die für die Entstehung lang anhaltender psychotraumatischer Symptome verantwortlich sind. Dabei stieß man in den bisherigen Analysen auf folgende Faktoren, die es nun in weiteren Untersuchungen als näher zu betrachten gilt: 1. Antezendente Einflussgrößen: - Vorliegen und Anzahl von Mehrfachtraumatisierungen 2. Objektiv situative Einflussgrößen - Schwere der traumatischen Situation - Deliktart/ Schwere des Delikts - Lebensbedrohlichkeit der Situation - die Dauer der traumatischen Situation - die Schwere der Verletzungen - Bekanntschaft zum Täter 3. Subjektiv situative Einflussgrößen - Erhöhtes Maß an Dissoziationen 4. zusätzliche Belastungen, Retraumatisierungen - tendenziell retraumatisierende Erfahrungen mit öffentlichen Funktionsträgern - kein Verständnis im sozialen Umfeld - Arbeitslosigkeit als zusätzlicher Risikofaktor 5. protektive Faktoren (negative Korrelation) - höhere Schulbildung Sie weisen allesamt eine signifikant positive Korrelation zu den späteren Symptomen auf. Die Autoren machen jedoch auch hier auf die starke Streuung der Werte und der damit verbundenen Schwierigkeit einer zufrieden stellenden Diagnose aufmerksam. Aus diesem Grund sei es im Einzelfall ratsam, das genaue Zusammenspiel aller oben genannten Faktoren zu betrachten um eine genaue Aussage darüber treffen zu können wie die Symptome sich ausbilden können. Nicht bei jeder traumatisierten Person besteht ein deutliches Risiko für einen ungünstigen Verarbeitungsverlauf, einige kommen auch ohne professionelle Betreuung zurecht. Ziel sollte es deshalb sein, in einem frühen Stadium diejenigen zu identifizieren, bei denen eine deutliche Gefahr einer späteren Chronifizierung der Symptome als Folge des Traumas besteht. Um dies zu diagnostizieren, können nicht die Kriterien der posttraumatischen Belastungsstörung wie 31 sie dem DSM-IV oder ICD 10 zu entnehmen sind oder mit Skalen wie z.B. der Impact of Event Scale gemessen werden , herangezogen werden, da die dort genannten Kriterien als ganz ,,normale’’ Reaktionen nach einem Trauma auftreten können und nicht automatisch eine spätere Chronifizierung bedeuten. Aus diesen Überlegungen heraus, entwickelten die Forscher im KOM-Projekt eine so genannte ’Traumaformel’, deren Bestandteile die oben genannten objektiven Situationsfaktoren sind. Mit ihrer Hilfe soll es möglich werden eine Prognose ungünstiger Verarbeitungsabläufe bei Traumapatienten zu erstellen. Als eine erste mögliche Ausarbeitung dieser entwickelten Formel wurde eine Art Checkliste erstellt, mit der die Anzahl der Risikofaktoren beim Patienten erhoben werden kann. Die Aufmerksamkeit der Berater soll hiermit im Gespräch mit Traumapatienten auf die entscheidenden Aspekte gelenkt werden. Berater können in diesem Fall auch aus Behörden oder medizinischen Diensten stammen, deren Aufgabe darin bestünde, die Patienten bei auftretenden Auffälligkeiten in der Checkliste an psychologische Beratungsstellen zu verweisen. Unabhängig davon, wie hoch der ermittelte Risikowert ausfällt, soll aber in folgenden Fällen immer eine Empfehlung an eine Beratungsstelle gegeben werden: im Falle einer Vergewaltigung bei anderen schweren Delikten, wie z.B. Geiselnahmen wenn der bearbeitende Beamte trotz eines unterschwelligen Wertes ein ,,ungutes’’ Gefühl hat, besonders wenn zudem mehrere Fragen aufgrund mangelnder Informationen nicht beantwortet werden konnten An folgendem Fallbeispiel lässt sich die Verwendung der Checkliste verdeutlichen: Ein Mann- zum Tatzeitpunkt 45 Jahre alt- wird abends auf seinem Nachhauseweg von vier unbekannten Jugendlichen angegriffen und mit einem Baseballschläger niedergeschlagen. Die Dauer der traumatischen Situation ist kurz. Dabei dissoziiert er heftig; fünf der zehn Dissoziationsformen der Skala PDEQ treffen für ihn in der stärksten Ausprägung zu. Es werden von ihm später keine weiteren negativen Erfahrungen nach dem Ereignis mit der sozialen Umwelt angegeben. Es liegt bei ihm kein zusätzlicher Risikofaktor in Form von Arbeitslosigkeit vor. Seine Schulbildung ist gering. Vor Gericht kam es zu negativen Erfahrungen, man glaubte ihm nicht. Der Vorfall ist aufgrund des Gebrauchs eines Baseballschlägers als schwere Körperverletzung und lebensbedrohlich anzusehen. Die Schwere der objektiven Situationsfaktoren wird mit 0,6 eingestuft. Er hatte bereits mehrere weitere Gewalterfahrungen im Laufe seiner Lebensgeschichte erleben müssen. Nimmt man 32 diese Informationen als Grundlage zum Ausfüllen der Checkliste, so lassen sich in der rechten Spalte mit Hilfe der Kriterien in der mittleren Spalte folgende Werte abtragen: (Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.33) Wenn die am Ende ermittelte Summe einen Wert größer als 6,4 übersteigt, kann man nach bisherigen Erkenntnissen davon ausgehen, dass sich einer hohen Wahrscheinlichkeit nach spätere posttraumatische Belastungssyndrome entwickeln. 33 4.3 Ein Analysemodell Traumatisierung zur Integration relevanter Komponenten psychischer In den vorangegangenen Kapiteln wurde über die vielfältigen möglichen Folgeerscheinungen einer Traumatisierung psychotraumatischen berichtet, die zusätzlich zum oder statt des basalen Belastungssyndroms auftreten können. Im vorhergehenden Abschnitt wurden Risikofaktoren für die Entwicklung von langfristigen Symptomen aufgeführt. Um wichtige Komponenten psychischer Traumatisierung zu integrieren, wurde ein Modell entwickelt, das sich in abgewandelter Form am Verlaufsmodell psychischer Traumatisierung (siehe Kapitel Miri?), orientiert. Bedeutsam ist dieses Modell, das im Folgenden vorgestellt werden soll, auch für diagnostische Zwecke und Begutachtungen. (Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM), S.37) 4.3.1 Erläuterung der einzelnen Faktoren in dem Modell 4.3.2 Lebensgeschichte Wie bereits weiter oben erwähnt wurde, können sich früher erlebte Traumatisierungen negativ auf die Verarbeitung eines erneut erlebten Traumas auswirken. Vor allem dann, wenn sie häufiger, schwerer und evtl. ähnlich waren. Allerdings kann es auch positive Effekte geben, 34 so z.B., wenn die frühere Erfahrung konstruktiv verarbeitet wurde oder es Personen gab, die versuchten das Opfer zu schützen. Weiter wurde in der KOM-Untersuchung herausgearbeitet, dass der Faktor Schulbildung ebenfalls einen positiven Einfluss haben kann, was laut der Untersucher dadurch zu erklären ist, dass man bei höherer Schulbildung auf eine nötige Differenzierungsfähigkeit schließen kann, die wiederum zur Verarbeitung des Traumas benötigt wird. 4.3.3 Unmittelbare Vorgeschichte Unter diesen Punkt fällt unter anderem die Tagesverfassung (z.B. eine labile Verfassung oder Übermüdung), die einen nicht unerheblichen Einfluss darauf haben kann, ob dissoziative Erlebnisweisen auftreten. Ein weiterer Aspekt, der hier zu berücksichtigen ist liegt darin, zu klären, ob das traumatische Geschehen überraschend auftrat oder vorhersehbar war (Antizipation), wie dies zum Beispiel bei einer Naturkatastrophe der Fall ist. 4.3.4 Traumatische Situation Auf der objektiven Seite sind einige Aspekte zu nennen, die bereits weiter oben erwähnt wurden wie zum Beispiel die ,,Schwere’’ Art des traumatisierenden Einflusses, war die Situation lebensbedrohlich und wie lange dauerte sie an, waren die Verletzungen schwer, ist der Täter bekannt? Unter dem Punkt ,Art des Traumas’ wird hier verstanden, ob ein Sexualdelikt, Beziehungsdrama oder körperliche Verletzungen usw. vorliegt. In der Grafik wird im nächsten Punkt wiederum darauf eingegangen, dass es einen positiven Einfluss hat, wenn in der traumatischen Situation eine Person versucht zu helfen. Die in der Grafik kursiv gedruckten Komponenten werden von beiden Seiten beeinflusst, zum einen vom objektiven Pol und zum anderen vom subjektiven Pol. Auf der subjektiven Seite wird vor allem dissoziatives Erleben genannt, insbesondere Derealisation (das Gefühl, es sei nicht wirklich, was geschieht), und Depersonalisation (das Gefühl es sei nicht der eigene Körper betroffen). 35 4.3.5 Belastungen Zu der schwersten zusätzlichen Belastung, die auftreten kann, zählt die Retraumatisierung. Ihr vorausgehen können negative Erfahrungen mit offiziellen Stellen oder dem privaten Umkreis, die sich in Misstrauen oder Bagatellisierung der erlebten traumatischen Situation seitens dieser zeigen. Solche Geschehnisse wirken einer Verarbeitung und Integration traumatischer Erlebnisse entgegen. Ebenfalls kontraproduktiv auswirken kann sich anderweitiger Stress, wie z.B. eine gleichzeitige Bewältigung einer Trennung vom Partner. 4.3.6 Schützende Faktoren Ebenso gibt es Faktoren, die die Verarbeitung von Traumafolgen begünstigen. In der Grafik werden hier genannt: eine räumliche und zeitliche Erholung für das Opfer, ein sorgsames und beruhigendes soziales Umfeld, materielle Entschädigung seitens des Täters, die vollständige Rekonstruktion des Tatverlaufs und Gerechtigkeit seitens der Justiz. 4.3.7 Langfristige Auswirkungen Wie im Modell zu erkennen, herrscht auch hier eine bipolare Aufteilung mit zum einen dem Folgesyndrom von Krankheitswert und zum anderen einer Integration des Traumas in die Lebensgeschichte. Auf die verschiedenen Arten von Folgesyndromen gehe ich hier nicht näher ein, da sie in Abschnitt 2.4 bereits beschrieben wurden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der in der Grafik mit ,Rückkopplung, Eigendynamik’ bezeichnete Kreis. Darunter versteht man den Vorgang, dass Folgeerscheinungen in spiralförmigen Bewegungen jeweils wieder auf die weiteren Folgeerscheinungen mit einwirken. So kommt es z.B. vor, dass eine traumatisierte Person aus Angst bestimmte Situationen meidet, die unerträgliche Erinnerungen hervorrufen. Dies wiederum kann zu Isolation und sozialem Rückzug führen, was dann die Verarbeitung des Traumas erschwert. Das hier vorgestellte Modell soll den Zusammenhang und das Zusammenwirken der einzelnen Komponenten verdeutlichen und somit eine Beschreibung und Analyse traumatischer Reaktionen möglich machen. 36 5. Die Strategie der Opferbetreuung im Kölner Opferhilfe Modell Um einen positiven Heilungsprozess bei Personen, die einem Gewaltverbrechen zum Opfer fielen zu gewährleisten, sollte er ausreichend über die vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten informiert werden. Am Vorteilhaftesten für den Patienten wäre eine einzelne Ansprechperson, die ihm im ,,Institutionendschungel’’ den Weg weist und ihm Ratschläge im Bezug auf die komplexen psychischen Prozesse gibt. Die Forschungsergebnisse im KOM-Projekt liefern auf die Frage, welche Kernkompetenz solch eine Beratungsinstanz haben sollte, folgende zwei Antworten: Eine genaue Kenntnis der Verwaltungsabläufe und des Gestaltungsspielraums, der dem Opfer überlassen bleibt Eine genaue Kenntnis des psychotraumatischen Verlaufsprozesses und seiner Deviationen Dieses Kompetenzprofil wird im KOM-Projekt durch die Kooperation zwischen dem Versorgungsamt, dem Institut für Psychotraumatologie und der Psychologischen Beratungsstelle für Kriminalitätsopfer verwirklicht. Neben einer psychotraumatologisch fundierten Beratungskompetenz wird von den Mitarbeitern gefordert, dass sie Kenntnisse und Kompetenzen im Umgang mit dem regionalen Netzwerk der lokalen Hilfseinrichtungen und Initiativen zur Opferbetreuung haben. Neuere Ergebnisse der Traumaforschung zeigen, dass bei Opfern von Gewalttaten die bewusste Erinnerung an das Erlebnis oft längere Zeit oder auch dauerhaft unzugänglich bleibt, da sie andernfalls in einen Überflutungszustand (Intrusion) gelangen könnten, der einer Retraumatisierung gleichkommen kann. Man kann sagen, dass Erinnerungslücken und Vermeidung dazu beitragen können, das seelische Gleichgewicht des Betroffenen zu halten. Daher sollte man daraus auch Konsequenzen ziehen im Bezug auf den gerichtlichen Umgang mit Gewaltopfern. Gedächtnislücken und Inkohärenz der Erinnerung sind traditionell Kriterien für mangelnde Glaubhaftigkeit, hier sprechen sie jedoch für den Realwert der Zeugenaussage. Man sollte deshalb das Opfer in der Vernehmungspraxis nicht zu vorzeitigen und erlebnisfremden Aussagen drängen, sondern vielmehr dafür sorgen, dass das Opfer das traumatische Erlebnis erfolgreich durcharbeitet. Vorraussetzung dafür ist, wie bereits weiter oben erwähnt, dass alle Beteiligten über psychotraumatologische Grundlagenkenntnisse verfügen und der Betroffene außerdem ausreichend über den Ablauf der Befragung in einem Prozess aufgeklärt wird. 37 Schlusswort Urplötzlich und ohne Vorwarnung werden Personen durch ein lebensbedrohliches Ereignis aus ihrem alltäglichen Lebensrhythmus gerissen. Körperliche und/ oder sexuelle Gewalt oder andere schwerwiegende Ereignisse erschüttern das Selbst- und Weltbild. In Deutschland werden, so ….statistik" jährlich allein etwa 40000 Menschen Opfer von unterschiedlichen Gewalttaten, wie z.B. schwere und gefährliche Körperverletzung, Raubüberfälle und Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung" (NRW-Justiz, 2/2000, S.6). Solche gravierenden von außen kommenden Eingriffe in das Leben bleiben meist nicht ohne schwere Folgen für den Betroffenen und dessen Angehörige. Viele Menschen, die durch eine Gewalttat zum Opfer wurden, können eine seelische Verletzung ohne Langzeitfolgen mit Hilfe des Umfelds und der Selbstheilung überwinden. Einem Großteil der Betroffenen gelingt dies allerdings nicht. Im Verlauf dieser Hausarbeit sollte dargestellt werden, wie wichtig es ist, den betroffenen Personen eine schnelle und effektive Hilfe zukommen zu lassen, die sich nicht nur auf psychotherapeutische Intervention reduziert, sondern dem Opfer von Anfang an umfangreiche Hilfen zur Selbsthilfe im Umgang mit dem Trauma an die Hand gibt. Wird dem Betroffenen schnellstmöglich und wirksam geholfen, besteht die Möglichkeit, dass sich Langzeitfolgen erst gar nicht bilden und die psychische Verletzung ausheilen kann. Das Kölner-Opferhilfemodell wurde als Initiative des Sozialministeriums und des Instituts für Klinische Psychologie und Psychotherapie der Universität Köln gegründet um die Hilfen für Gewaltopfer zu verbessern. Das Konzept wird auf alle anderen Städte und Gemeinden übertragen um Betroffene direkt vor Ort über Einrichtungen im Bereich der Opferhilfe beraten zu können. 38 Literaturverzeichnis Neue Wege in der Hilfe für Gewaltopfer, Reader über Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM) Gewalt gegen Frauen und sexueller Missbrauch von Kindern, 3. Bericht zum Handlungskonzept der Landesregierung (NRW) www.kriminalpraevention.de/ pressearchiv/pressemitteilungen/PM20020321_DFK.pdf 39