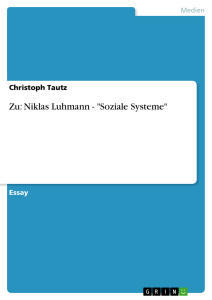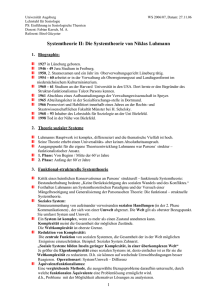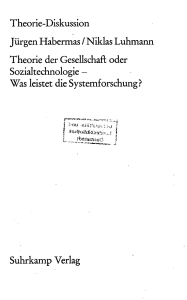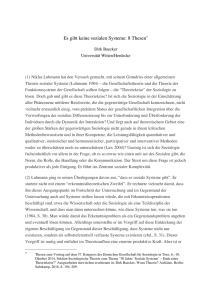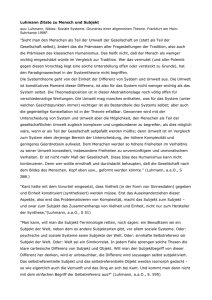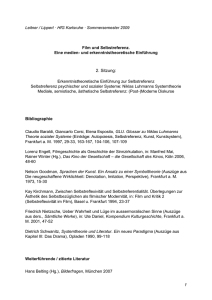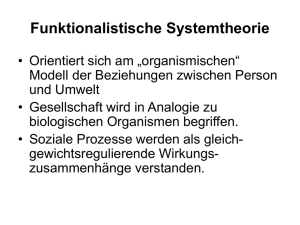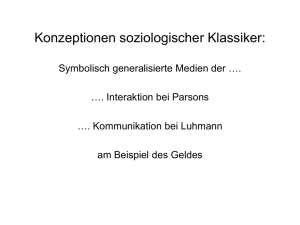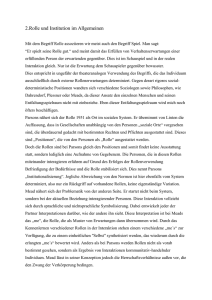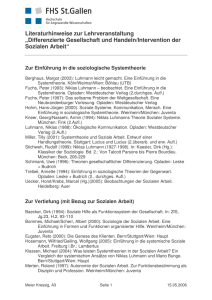eine kleine Geschichte der Systemtheorie aus der Perspektive des
Werbung

... eine kleine Geschichte der Systemtheorie
aus der Perspektive des Themas Komplexität
Als eines der Grundprobleme von Komplexität gilt, komplexe Ganzheiten über das
Verhältnis
seiner
Einzelteile
beschreiben
zu
müssen.
In
der
klassischen
Humanwissenschaft, die im Schema von Subjekt-Objekt-Beziehungen verhaftet ist, zeigt
sich dieses Problem vor allem im Bereich sozialer Phänomene - etwa wenn in
Subjekttheorien Gesellschaften über die darin agierenden Menschen erklärt werden
müssen: Ist der Wille des Menschen in der Gesamtdynamik der Gesellschaft noch zu
erkennen?
Handlungstheorien sind aktuell die dominanten Subjekttheorien im Bereich sozialer
Phänomene. Sie verbinden Subjekt- und Objektschema aus Perspektive des Subjektes:
Das Objektschema sozialen Geschehens bleibt die Kausalität als Erklärungsschema der
Dynamik der Natur: was immer geschieht, ist Wirkung einer Ursache. Darauf setzt das
'Kantsche' Subjektschema auf: Das Subjekt kann das Geschehen der Welt kraft seiner
Vernunft ordnen – also z.B. über kausale Gesetze erklären. Das Subjekt ist 'frei', das
Geschehen in verschiedene Ordnungskontexte zu stellen und damit selbst kausale
Ereignisketten zu initiieren (Ich will etwas und arbeite darauf hin, dass das geschieht.
Dann kann ich sagen: Ich habe es bewirkt). Wir haben somit faktisch zwei dynamische
Entwicklungslinien
vor
uns:
eine lineare,
die
der
Abfolge
kausalen
Geschehens
entsprichet und begleitend eine zirkuläre, in der das Subjekt das Geschehen auf sich
bezieht, auf Kontexte rückbezieht ('re-flektiert') und damit die Linearität neu ausrichtet,
neu initiiert etc.. Diese Linien entsprechen der hermeneutischen Unterscheidung von
erklären und verstehen.
Dieses Kantsche Subjektschema, in der jedes Subjekt für sich aufgrund seiner Vernunft
Gesetze formulieren kann, die für jeden gelten, weil ja die Vernunft bei allen gleich ist,
stößt aber im sozialen Bereich auf die Grenzen der untrennbaren Verwobenheit von
Intentionen, Handlungen etc. verschiedener Subjekte.
Dementsprechend beziehen sich Handlungstheorien auch auf die Hegelsche Vorstellung
von Intersubjektivität, die die vernünftigen Subjekte eingebunden in die historische-
kulturelle Sphäre 'geistiger' Kontexte beschreibt, auf die sich Vernunft notwendigerweise
bezieht (in allen 'Zivilisationsaspekten von Sprache über Sitte, Kunst, Recht etc.)
Gruppendynamik-Modelle sind dabei letztlich handlungstheoretische Konzepte, die diese
Intersubjektivitätsvorstellung in einem konkreten Modell zu verwirklichen suchen – in der
Gruppe, in der noch jeder Beteiligte mit jedem 'face to face' kommunizieren kann.
Größere soziale Einheiten sind derart allerdings nicht mehr erschöpfend erfassbar. Hier
bauen Modelle wie das von Habemas auf der Hegelschen Vorstellung in 'negativer' Form
auf (d.h. etwas ist intersubjektiv solange gültig, bis irgendjemand mit Gründen
widerspricht – dann muss man sich rational einigen).
Daneben hat sich aber eine Position herausgebildet, die dieses Problem grundsätzlich
anders lösen will: Systemtheorien.
So wie die Geisteswissenschaften (u.a. Dilthey mit seiner Hermeneutik um 1900)
kritisieren, dass der Mensch in seiner Reflexivität letztlich nicht nur kausal (also in
Ursache-Wirkungsmustern) beschreibbar ist, beginnen wenig später auch Vertreter
anderer Wissenschaftsbereiche (Malinowski oder Radcliffe-Brown) von der anderen - der
'objektiven' Seite - des Beobachtungsspektrums her ihre Kritik an der Kausalität als
dominantem wissenschaftlichen 'Beschreibungsmodus': Auch die Welt ist demnach nicht
kausal beschreibbar - wenn man sie nämlich soweit wie möglich in ihrer Komplexität
erfassen will. Dementsprechend kommt dieser Ansatz zunächst aus Bereichen, die sich
mit komplexen, dynamischen Phänomenen beschäftigen: Biologie, Thermodynamik,
Kulturanthropologie, später Soziologie.
Vor
allem
das
zirkuläre
Denken
der
Kybernetik
und
anderer
Stömungen
des
Konstruktivismus hat dabei das Denken der Systemtheorie beeinflusst. Diese thematisiert
eine
Metaebene
zum
Subjekt-
und
Objektschema:
Die
Welt
wird
nicht
mehr
gegenständlich gedacht – also bestehend aus Subjekten, die etwas bewirken können und
Objekten, an
denen
Zusammenhänge
etwas bewirkt
angesprochen,
bei
wird.
Stattdessen
denen
werden
gegenseitige
Beziehungen
und
Wechselwirkungen
die
Unterscheidung in Subjekt und Objekt, sinnlos erscheinen lassen. Dieses komplexe
Beziehungsnetz lässt aber auch keine objektive Beschreibung der Welt mehr zu: Je
nachdem, welche Zusammenhänge thematisiert werden, erscheint die Welt immer
anders, die Welt ist immer die Welt eines Beobachters – seine Konstruktion – und nicht
unabhängig von diesem vorstellbar.
Wieso kommt es zu diesen komplex-zirkulären Überlegungen?
Was passiert bei kausalen Beschreibungsmustern? Es wird ein Phänomen möglichst
isoliert betrachtet, um feststellen zu können, welche Ursache welche Wirkung hervorruft.
U
W
Beschreibt man Phänomene mit mehr als einem ursächlichen Einflussfaktor, kann man
sich eine Zeitlang noch mit Ausmittelungen, Interdependenzberechnungen etc. behelfen.
W
U
O
U
Was aber bei komplexen Phänomenen, bei denen die Objekte wechselseitig Ursache und
Wirkung sind (simples Beispiel: die wechselseitige Abhängigkeit der Populationen von
Jägern und Beutetieren in einem Gebiet)?
Derartig
komplexe
Phänomene
lassen
sich
durch
einzelne
Ursachen-
Wirkungsbeziehungen - durch das Wirken der einzelnen Teile - nicht mehr sinnvoll
beschreiben: die Dynamik biologischer Lebensräume, die Entwicklung von Kulturen etc. andererseits ist die Kultur aber auch nicht selbst Subjekt - sie agiert nicht als Einheit mit
eigenem Willen.
Die Systemtheorie behauptet nun, dass diese komplexen Phänomene - in ihrer
Terminologie 'Systeme' - prinzipiell nicht mehr zufriedenstellend als Verhältnis eines
Ganzen zu seinen Teilen beschrieben werden können und wählt einen grundlegend
anderen Weg: Ein System wird nicht bestimmt durch seine Teile, sondern durch die Form
der Beziehung im System: durch seine Struktur.
Das hat grundlegende Konsequenzen:
Wenn ich auf Relationen anstelle von Teilen schaue, denke ich nicht an Gegenstände,
an Objekte und Subjekte: In dieser nicht-gegenständlichen Perspektive geht es somit
nicht um das Handeln (und Erleiden) Einzelner, um ihren Willen, ihre Intentionen und
Werthaltungen – sondern um Strukturveränderungen: Wenn ich nicht auf den
Einzelnen achte, bleibt mir auch sein 'Innenleben', seine Seele und Persönlichkeit
verborgen – eine klare Gegenposition zu Subjekttheorien.
Wenn ich nicht auf Gegenstände achte – also auf 'rundum' definierte Einheiten –
benötige ich jeweils neue, 'punktuelle' Unterscheidungen, um mich zu orientieren: Ich
denke nicht in Einheit, sondern in Differenz (digital nicht analog), achte auf
Unterscheidungen, nicht Gemeinsamkeiten.
Wenn ich nicht Gegenstände beschreibe, beschreibe ich zunächst nicht die Welt – die
Wirklichkeit – sondern bin eine Metaebene weiter: Ich beschreibe von vornherein ein
Konstrukt von Wirklichkeit. Wir sprechen im Rahmen der Systemtheorie zunehmend
in Begrifflichkeiten wie Brauchbarkeit und Fruchtbarkeit anstelle von Wahrheit – eine
Referenz an kybernetische und konstruktivistische Fundierungen der Systemtheorie. 1
Wenn ich nicht auf Gegenstände, sondern auf Relationen achte, beschreibe ich nicht
mehr, wie sich etwa bei einer Einwirkung diese Gegenstände entsprechend kausaler
Gesetze verändern, sondern ich beschreibe, wie sich dadurch die Struktur verändert,
wie weitgehend das System dadurch betroffen ist
Bildlich gesprochen gleicht das kausale Denken einem Pfeilschuss: Ich visiere ein
punktuelles Ziel an und versuche dabei alle Störfaktoren auszublenden. Das systemische
Denken hingegen gleicht einem Steinwurf ins Wasser: Ich beobachte, welche Kreise die
Einwirkung verursacht und wie weit die Wasserfläche dadurch bewegt wird.
Der Unterschied zwischen diesen Perspektiven zeigt sich immer wieder auch aktuell in
der Diskussion komplexer Phänomene (Gentechnik, Atomkraft etc.) - das Problem
besteht meist darin, dass die Ansätze 'Ich will etwas Bestimmtes erreichen' und 'Welche
Auswirkungen hat das auf das Gesamtsystem?' kaum eine gemeinsame, aufeinander
Bezug nehmende Diskussion zulassen.
Sehen wir uns noch einmal das Modell eines Systems an:
„Entweder betrachte ich mich als den Bürger eines unabhängigen Universums, dessen
Regelmäßigkeiten, Gesetze und Gewohnheiten ich im Lauf der Zeit entdecke, oder ich betrachte mich
als Teilnehmer einer Verschwörung, deren Gewohnheiten, Gesetze und Regelmäßigkeiten wir nun
erfinden. Immer wenn ich mit denjenigen spreche, die sich dafür entschieden haben, entweder
Entdecker oder Erfinder zu sein, bin ich immer von neuem von der Tatsache beeindruckt, daß keiner
von ihnen erkennt, jemals eine derartige Entscheidung getroffen zu haben. Wenn sie überdies
herausgefordert werden, ihre Position zu rechtfertigen, bedienen sie sich eines Begriffssystems, das
nachweislich auf einer Entscheidung über eine prinzipiell unentscheidbare Frage basiert.“ (Foerster,
Heinz von: KybernEthik 1993, S. 75)).
1
Wenn dieses System nicht durch seine Teile, sondern durch die Struktur bestimmt ist,
zeigt sich sofort das grundlegende Problem dieses Ansatzes: Beziehungen sind weit
weniger stabil als Dinge selbst: Wie sichere ich die Stabilität eines Systems? Wie gehe ich
mit der Beschreibung der Veränderung und Dynamik um, ohne den Zusammenhalt des
Systems zu gefährden?
Das war das Hauptanliegen von Talcott Parsons, dem Begründer der ersten komplexen
Fassung der Systemtheorie in den Sozialwissenschaften. Er hat daher die stabilisierenden
Faktoren betont, die Struktur: Wenn ein Phänomen sinnvoll als System beschreibbar ist,
ist
davon
auszugehen,
dass
die
Dynamiken
innerhalb
des
Systems
die
Gesamtausrichtung überwiegend unterstützen: Diese Entsprechung nannte Parsons
Funktion. Die Funktion als systemkompatible Struktureinwirkung ist der dynamische
Faktor des Modells, es gilt: die Funktion folgt der Struktur. (Beispiel: Sozialisation als
Entwicklung des Menschen zu überwiegend gesellschaftsstabilisierendem 'funktionalen'
Verhalten – Sozialisation meint daher nicht seine Charakter-/Persönlichkeitsbildung,
sondern lediglich die Entwicklung seiner Beziehungsmuster/sozialen Verhaltensweisen)
Das Problem dieses Konstruktes zeigt sich, wenn man nicht nur ein System, sondern die
Interaktion zweier Systeme betrachtet: Parsons spricht von 'offenen Systemen', d.h.,
Systeme unterscheiden sich durch die unterschiedliche Struktur, sie haben keine
faktische Grenze gegenüber einem anderen System und interagieren dementsprechend
frei: Ein Input wird im System verarbeitet und ein Output wird erzeugt. Da Parsons aber
Veränderungen über den Begriff der Funktion an die Struktur bindet, hat er wenig
Möglichkeit, zu beschreiben, was mit dem Input im System geschieht (weil ja Funktionen
nicht die Strukturen beeinflussen, sondern umgekehrt). Beschrieben wird somit lediglich:
Output folgt auf Input – wird somit offensichtlich von Input verursacht. Damit sind wir
wieder in der selben komplexitätsreduzierenden Kausalität, die mit dem Systembegriff
vermieden werden sollte.
An diesem Punkt der mangelnden Beschreibbarkeit von Dynamik und Interaktion setzt
auch die Kritik und Weiterentwicklung der Systemtheorie von Niklas Luhmann an.
Luhmann dreht die Prioritäten Parsons um: structure follows function.
Er stärkt den dynamischen Aspekt der Beschreibung eines Systems, indem er annimmt,
dass die Elemente eines Systems temporär, vergänglich sind. Die Elemente sind dabei
nicht gleich den Teilen eines Systems (den Gegenständen/Objekten/Subjekten), sondern
sind die Beziehungen/Relationen zwischen ihnen. Bei den drei Systemarten, die Luhmann
unterscheidet, sind das:
o
Leben bei biologischen Systemen
o
Bewusstsein bei psychischen Systemen
o
Kommunikation bei sozialen Systemen
Dass Lebens-, Bewusstseins- und Kommunikationsformen vergänglich sind, ist wohl
nachvollziehbar – wichtig ist nun, dass ein System bei Luhmann nicht wie bei Parsons
dann bestehen bleibt, wenn es Strukturen stabil hält, sondern wenn es gelingt, die
vergänglichen Elemente immer wieder durch neue zu ersetzen, wenn das System
anschlussfähig bleibt (eine Idee weiterentwickelt, bevor sie vergessen ist,...)
Diese neuen Elemente werden von den alten Elementen gebildet – das System ist
autopoietisch – indem sich ein System immer auf sich selbst bezieht – das System ist
selbstreferentiell - und neue Information nutzt, um entsprechend seiner Selbstreferenz
neue Elemente zu produzieren.
Z.B.:
Der
ÖGB
(die
österreichische
Dachorganisation
des
sozialen
Systems
Gewerkschaften) sagt (kommuniziert): "Wir streiken immer, wenn die soziale Situation der
Arbeitnehmer massiv verschlechtert wird. Unsere neuen Informationen besagen, dass das
mit der Pensionsreform geschieht, also streiken wir am 6.5.03" (neue Kommunikation wird
aus alter Kommunikation unter Referenz auf diese eigene alte Kommunikation aufgrund
neuer Information gebildet).
Luhmann beschreibt also Systeme prozessorientiert.
Wie kann man sich nun diesen autopoietischen, selbstreferentiellen Prozess vorstellen?
Ein System 'bildet sich selbst', indem eine grundlegende Unterscheidung getroffen wird,
die zwischen 'drinnen' und 'draußen' – zwischen System und Umwelt unterscheiden lässt
und damit als 'Leitdifferenz' dient. Diese Unterscheidung ist also geeignet, Identität und
Differenz festzustellen – das System schließt sich damit von seiner Umwelt ab: Luhmann
Systeme sind geschlossene, nicht offene wie die von Parsons.
Das heißt,
anhand der Leitdifferenz definiert das System sowohl seine Umwelt wie auch sich
selbst
–
was in der
grundlegenden
Unterscheidbar nicht fassbar ist, ist
nicht
systemrelevant (der ÖGB vertritt auch Spitzenbeamte mit Höchstgehältern – er ist nicht
für Arme, sondern für Arbeitnehmer da – arm / reich, links / rechts, progressiv /
konservativ ist letztlich irrelevant, der ÖGB ist vielleicht eines davon 'eher', wenn es den
Interessen seiner Mitglieder dient und daher aufgrund immer wieder getroffener
Entscheidungen
dem
autopoietisch
und
selbstreferentiell
entstandenen
'Selbstbild'
entspricht).
die Umwelt kann nicht direkt auf ein System einwirken. Was immer in der Umwelt
geschieht,
wird
vom
System
lediglich
als
Information
wahrgenommen
und
selbstreferentiell zur autopoietischen Bildung neuer Elemente genutzt, die Grundlage
einer eigenen Entscheidung ist man hätte ja auch nicht oder anders streiken können).
Wie läuft dieser Prozess im Detail ab?
Ein System definiert sich und seine Umwelt anhand einer Leitdifferenz, die ihm
ermöglicht zu sagen 'wer zum Club gehört' und wer nicht – es schließt sich damit ab.
Das System
beobachtet
sich
und
seine Umwelt:
die Leitdifferenz
stellt
die
Umweltgrenze fest, (zumindest) eine zweite Unterscheidung stellt eine Differenz in
System oder Umwelt fest (=Information: die Pensionen werden anders geregelt).
Diese Information wird 'ins System getragen' (Selbstreferenz) und dort verarbeitet
(neue Elemente erzeugt – Autopoiesis) – bei Luhmann heisst das re-entry'.
Z.B: Leitdifferenz ÖGB: organisierte Arbeitnehmer - Information: andere Pensionsregelung
– re-entry der Information ins System: Pension ist ein wesentlicher Bestandteil des
Lebenseinkommes der Arbeitnehmer - Selbstreferenz: die Situation unserer Mitglieder wird
verschlechtert, in solchen Fällen reagieren wir immer – Autopoiesis: Wir rufen zum Streik
auf (neues Element) und bestätigen uns damit auch selbst wieder als Interessensvertreter
der Arbeitnehmer.
Der Unterschied zum Konzept von Parsons liegt auf der Hand:
Bei Parsons wird das System statisch über die Stuktur definiert und die Stabilisierung
dieser Struktur als funktionaler, dynamischer Aspekt beschrieben
Luhmann beginnt mit der Dynamik: Funktional ist für das geschlossene System die
Informationsverarbeitung: das Feststellen eines identitätsstiftenden Unterschieds, auf
den
ein
zweiter
Unterschied
Handlungsfähigkeit
(Autopoiesis
(selbstreferentiell)
neuer
Elemente)
bezogen
wird
gewonnen
wird.
und
Aus
daraus
den
so
gewachsenen selbstreferentiellen und immer wieder neu zu bestätigenden (oder zu
ändernden)
Informationsbeständen
'sedimentiert'
Struktur
–
als
resistenter
Informationsbestand.
Das setzt allerdings voraus, dass das System 'Wahlmöglichkeit' hat, wie es neue
Information verarbeitet: 'Kontingenz' (wir streiken so oder anders oder gar nicht).
Ansonsten wäre eben die kausale Notwendigkeit eines bestimmten Outputs aus einem
bestimmten Input gegeben. Diesen Umgang mit Handlungsalternativen bezeichnet
Luhmann als Sinn. Aus den jeweils getroffenen Entscheidungen ergeben sich in der Zeit
beständige identitätsstiftende Muster – 'Strukturen'.
" Psychische und soziale Systeme sind im Wege der Co-evolution entstanden. Die jeweils
eine Systemart ist notwendige Umwelt der jeweils anderen. Die Begründung dieser
Notwendigkeit liegt in der diese Systemarten ermöglichenden Evolution. Personen
können nicht ohne soziale Systeme entstehen und bestehen, und das gleiche gilt
umgekehrt. Die Co-evolution hat zu einer gemeinsamen Errungenschaft geführt, die
sowohl von psychischen als auch von sozialen Systemen benutzt wird. Beide Systemarten
sind auf sie angewiesen, und für beide ist sie bindend als unerläßliche, unabweisbare
Form ihrer Komplexität und ihrer Selbstreferenz. Wir nennen diese evolutionäre
Errungenschaft 'Sinn'. (...)
Sinn ist (die Frage, was Sinn leistet, stellen wir im Moment zurück), läßt sich am besten
in der Form einer phänomenologischen Beschreibung vorführen. Eine Definition zu
versuchen, würde dem Tatbestand nicht gerecht werden, da bereits die Frage danach
voraussetzt, daß der Fragende weiß, worum es sich handelt.
Das Phänomen Sinn erscheint in der Form eines Überschusses von Verweisungen auf
weitere Möglichkeiten des Erlebens und Handelns. Etwas steht im Blickpunkt, im Zentrum
der Intention, und anderes wird marginal angedeutet als Horizont für ein Und-so-weiter
des Erlebens und Handelns. Alles, was intendiert wird, hält in dieser Form die Welt im
ganzen sich offen, garantiert also immer auch die Aktualität der Welt in der Form der
Zugänglichkeit. Die Verweisung selbst aktualisiert sich als Standpunkt der Wirklichkeit,
aber sie bezieht nicht nur Wirkliches (bzw. präsumtiv Wirkliches) ein, sondern auch
Mögliches
(konditional
Wirkliches)
und
Negatives
(Unwirkliches,
Unmögliches)."
(Luhmann, Niklas: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie.- Frankfurt am
Main: Suhrkamp 19966, S 92f)