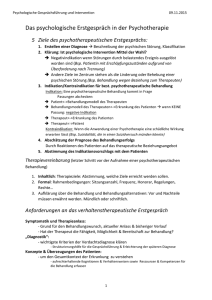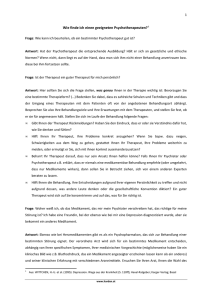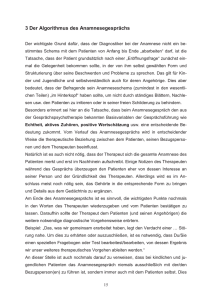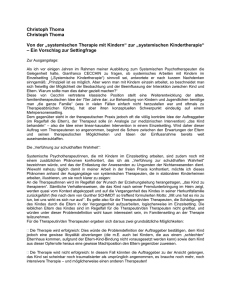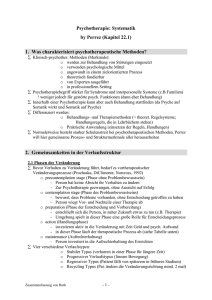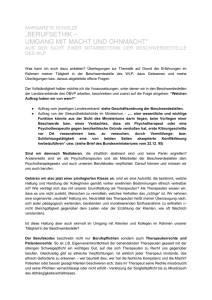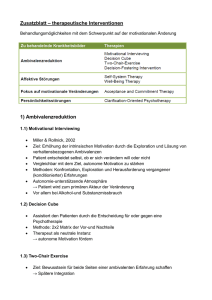2003-03-03_deWaal - la:sf Lehranstalt für systemische
Werbung

Systemische Notizen 04/04 Therapiepraxis HELMUT DE WAAL „RATSCHLÄGE“ FÜR DEN ZWEIFELNDEN THERAPEUTEN Ausgang Jeder Therapeut wird den Zweifel als verlässlichen und immer wiederkehrenden Gast kennen lernen. Je länger er bei dieser Arbeit ist, umso öfter. Das mag lästig, oft quälend sein, vor allem wenn man langsam älter wird, weil man ja Angst hat, vielleicht doch aufs falsche Pferd gesetzt zu haben und es nicht mehr wechseln zu können, und doch ist es unvermeidlich und nützlich. Denn das, was im Zweifel angesprochen wird, ist meist etwas, das wir bisher ausgelassen oder vermieden haben. Der Zweifel veranlasst uns hier nachhaltig zur Auseinandersetzung, zwingt uns, wollen wir ihm gerecht werden, zu neuen Erkenntnissen, die wir ursprünglich lieber vermieden hätten, etwa über unsere Bedeutsamkeit oder über unser Vermögen in der Therapie. Das ist nicht nur ein therapeutischer, sondern unvermeidlich auch ein menschlicher Erkenntnisgewinn, der sich meist auf Terrains erstreckt, die wir gar nicht beabsichtigt haben. Das haben wir dann mit unseren Klienten gemein, die ihre Krisen bewältigen. Oft sind diese Erkenntnisse banal, peinlich, unangenehm, manchmal eine Einladung zur Resignation. Das ist dann häufig eine große Erleichterung, weil es uns hilft das „Unveränderliche“ wahr- und anzunehmen. Gerade darin besteht oft die Überraschung und der Lohn des Zweifels. So ist der Zweifel unvermeidlich und auch nützlich - das ist aber nicht im Sinn von gewinnbringend gemeint, sondern als Erkenntniszuwachs, allerdings nur dann, wenn er überwunden werden kann - oder vielleicht besser - bestanden. Denn der Zweifel wird ja nicht in dem Sinn überwunden, dass er verschwindet, sondern sein Thema besteht weiter und erhält eine neue, oft unbequeme Antwort. Warum muss denn also etwas, von dem ich gerade behaupte, dass es - obschon unangenehm - im Grunde nützlich ist, dann überwunden werden? Kann man sich mit der Ungewissheit nicht grundsätzlich anfreunden? Ein ständiger, nicht nur wiederkehrender Gast, das wäre doch das klare und konsequente Ergebnis unserer Überzeugung, „dass es keine Wahrheit gibt“. Der Zweifel wäre dann so etwas wie eine Methode, „dubito, ergo psychotherapeuticus sum“ (der Therapeut als Skeptiker gegenüber jeder Gewissheit). Weil wir damit im Alltag nicht leben könnten, weder als Therapeuten oder als Klienten, noch jenseits dieses Kontexts, weil wir uns jeweils im Moment entscheiden müssen, für dieses oder jenes entschließen und diesen Entschluss auch verantworten. Der Zweifel, so behaupte ich jetzt einmal, wird nicht durch Gewissheiten überwunden und auch nicht durch Methode, sondern durch Glauben. Was ist Glauben? Heinz von Foerster hat einmal gesagt, entscheiden kann man sich nur dort, wo etwas prinzipiell Unentscheidbares vorliegt. Er hat damit gemeint, wenn es ein Prinzip gibt, nach dem entschieden werden kann, eine Formel, ein Verfahren etc., dann entscheiden wir ja nicht mehr, sondern wir verfahren nur mehr nach diesem Prinzip. Dasselbe gilt für Zweifel und Glauben. Solange ich nach etwas Unbezweifelbarem suchen kann, brauche ich nicht zu glauben. Erst wenn ich dort angelangt bin, wo es keine Sicherheit mehr gibt, muss ich etwas riskieren. Das gilt für den Therapeuten wie für den Klienten, Glaube ist nicht Sicherheit sondern Wagnis. Ist jetzt die Antwort auf den Zweifel nur blind, sozusagen Zufall, gipfelt der Glaube nur im blinden Mut zur Entscheidung, die uns vor der Verzweiflung bewahrt oder kann ich für dieses Tasten Richtpunkte angeben? Dem soll hier im Einzelnen nachgegangen werden. Seite 1 von 9 Systemische Notizen 04/04 Therapiepraxis Worin besteht nun der Zweifel des Therapeuten? Meist im Einzelnen. Der Zweifel des Therapeuten ist meist kein grundsätzlicher, er tritt im Alltagsgewand lästiger Fragen auf, dann reden wir nicht von dem, sondern von den Zweifeln. Der Therapeut kann alle möglichen Zweifel haben: Verstehe ich meinen Klienten, versteht er mich, mag ich ihn, mag er mich? Mögen/verstehen wir uns im passenden Ausmaß? Kann ich ihm wirklich helfen, wird er mein Honorar zahlen? Zweifel können symmetrische (verstehen, mögen) oder komplementäre (helfen/zahlen) Struktur haben. Helfe ich zuviel (Gefahr für seine Autonomie) oder zuwenig (Gefahr, dass der Klient wegbleibt) etc., etc. Da steckt der Therapeut dann schon in einem Dilemma: Nehme ich meine Zweifel nicht ernst, schade ich ev. dem Klienten, nehme ich sie ernst, schade ich mir selbst, kann nicht mehr arbeiten. Wesentlich lässt sich alles auf folgende Zweifel reduzieren: a) Glaubt der Klient an das, was ich tue. b) Glaube ich selbst an das, was ich tue. Was ist hier die richtige Reihenfolge? Hängen diese Fragen zusammen? Ist es leichter, wenn sie zusammenhängen oder wenn nicht? Es ist leichter, wenn sie nicht zusammenhängen und sie brauchen nicht zusammenhängen. Für den Klienten ist nicht wichtig, ob der Therapeut glaubt, sondern, dass er selbst glaubt, dass der Therapeut glaubt, dass er - der Klient - meint, der Therapeut weiß, was er tut. Für den Therapeuten ist es ebenfalls nicht wichtig, dass der Klient glaubt, sondern, dass er sich so benimmt als glaube er. Das hängt von der Definition dieses Benehmens ab - üblicherweise eine Erfolgsdefinition, also Änderung etc. In dem Sinn können wir sagen: Der Glaube selbst ist Privatsache, Kommunikation ist wichtig. Der Klient soll sich „erfolgreich“ im Sinn des vereinbarten Arrangements benehmen, also sich ändern. Tut er es nicht, kann er entweder dazu veranlasst werden, oder wir müssen „metakommunzieren", z.B. eine neue Definition von Erfolg finden oder die Beendigung der therapeutischen Beziehung diskutieren. So könnten wir salopp formulieren, der Zweifel des Klienten ist sein Bier, gehört entweder zu Bedingungen außerhalb der Therapie, wirkt mit, ob sich der Klient überhaupt auf die Unternehmung einlässt, oder er wird vom Therapeuten benützt, wenn wir paradox intervenieren, oder er kann in der Therapie metareflexiv erörtert werden. Der Zweifel des Klienten ist letztlich nicht die Sache des Therapeuten, er gehört in die Verantwortung des Klienten - und vice versa, der Klient kann eine durchaus erfolgreiche Therapie erleben, ohne dass der Therapeut nur einen Augenblick an sein Tun glaubt. Der Klient wird sein Verhalten nur danach richten, ob er glaubt, dass das, was der Therapeut tut, in irgendeiner Form hilfreich ist. So bleibt jeder mit seinem Zweifel allein, auf sich selbst zurück verwiesen. Das macht den Zweifel des Therapeuten weniger bedeutsam, denn der Zweifel an sich kann damit keinen Schaden anrichten, das könnte höchstens ineffektive oder gar verantwortungslose Therapie. Trotzdem kann es quälend sein, jeden Tag zu „schwindeln“, oder zumindest zu glauben, man täte es. Das kann dazu führen, dass der Therapeut verzweifelt, aufgibt etc. Deswegen macht es Sinn, sich damit auseinander zu setzen. Seite 2 von 9 Systemische Notizen 04/04 Therapiepraxis Der Glaube ist die Antwort auf den Zweifel Der Therapeut kann dem Zweifel (nur) seinen Glauben entgegensetzen. Was ist also der Glaube des Therapeuten? Zum Ersten ist er eine Antwort auf den Zweifel, auf sonst nichts, keine Antwort auf Nichtwissen, mangelnde Routine oder nicht in Anspruch genommene Supervision, darauf gibt’s andere Antworten: Lesen, Üben, Supervidieren lassen etc. Glaube ist nur die Antwort auf den Zweifel, in dem Sinn wird Glaube heute so oft überschätzt, deswegen erleben wir ja so viel Enttäuschung mit dem Glauben. Heimlich hoffen wir immer noch, dass der Glaube eine Antwort auf unsere Geldprobleme, unsere Desinformation, unser Gefühl, dass uns niemand mag usw., ist. Welcher Art kann denn der Glaube des systemischen Therapeuten sein, der ja eher gelernt hat, nicht zu glauben? Zumindest könnten wir das bei oberflächlichem Hinschauen meinen, „es gibt keine Wahrheit usw.“ Pascals „Gottesbeweis“ wäre hier von der Struktur her ein gutes Beispiel für systemische Glaubensmöglichkeit. (Vielleicht war es auch nicht Pascal, sondern wer anders, das tut dem Gedankengang als solchen ja keinen Abbruch. Gedanken sind ja als solche nicht kontextabhängig, sie müssen in sich plausibel sein und werden das nicht mehr, wenn sie von jemand Berühmten und nicht weniger, wenn sie von einem Unbekannten gedacht werden.) Dieser „Gottesbeweis“ ist eine Beweisführung, die ganz systemisch ist, weil sie sich von einem ersehnten und verantwortungsvollen Ergebnis herleitet. Sie ist zielorientiert und kybernetisch, weil sie einen erwünschten Output zum möglichen Orientierungspunkt gegenwärtigen Forschens und Handelns macht. Dieser „Gottesbeweis“ und seine „Anwendung“ auf die Zweifel des Therapeuten hat folgende Grundstruktur: a. Kann man beweisen, dass es Gott gibt/ kann man sagen, dass meine konkrete therapeutische Arbeit an sich entscheidend nützlich ist? Nein b. Kann man das Gegenteil beweisen? Nein c. Wäre es nützlich an Gott/Therapie zu glauben? Ja......( v.a. weil man sich dann nicht dauernd mit dieser Frage herumschlagen muss und seine Aufmerksamkeit dem Klienten und seinen Anliegen zuwenden kann.) d. Was kann für Glauben (das ist ein spontaner Vorgang) - egal ob „kirchlich“ oder „therapeutisch“ hilfreich sein, welche förderlichen Bedingungen können geschaffen werden? e. Kirchbesuch etc., die Rituale der Kirche einerseits/ die Rituale der Therapie anderseits. „Benimm dich als ein Glaubender, das macht den Glauben möglich - benimm dich wie ein Therapeut und überlass die Beurteilung den Anderen“, was das im einzelnen heißt, sollen im Folgenden die „Ratschläge“ skizzieren. Dieses Modell schlägt also vor, Glauben entlang seiner Erwünschtheit durch fördernde Bedingungen eine Chance zu geben. Das erinnert an einen alten jüdischen Witz: Ein frommer Jude betet Tag für Tag in der Synagoge um einen Lottogewinn, nichts passiert. Im zwanzigsten Jahr endlich eine ärgerliche Stimme von oben „Moische, gib mir a Chance, kauf dir a Los“. Wir können nur „Lose kaufen“, als Bedingung der Möglichkeit des Spontanen. Kaufen wir sie nicht, kann es nicht eintreten. „So tun als ob“ wäre die Bedingung der Möglichkeit des Glaubens. Glaube bezieht sich also nicht auf die Gewissheit („ich bin sicher“), sondern riskiert die Möglichkeit. Glaube bezieht sich nicht auf das Ereignis, sondern auf die Bedingungen der Möglichkeit. Ich kann nicht glauben wollen (spontaner Vorgang), aber ich kann beherzt Bedingungen schaffen, die die Wahrscheinlichkeit des Glaubens erhöhen. Insgesamt: Nicht ich bin gewiss, dass der Klient gesünder wird, sondern ich halte die Möglichkeit seiner Gesundung für eine riskierbare und nützliche Annahme. Seite 3 von 9 Systemische Notizen 04/04 Therapiepraxis Daraus können folgende Ratschläge formuliert werden: Sie sind verstanden als eine Ermutigung im Sinne der Erweiterung der Wahlmöglichkeiten, also, „kann, muss nicht sein, aber wenn verwirklicht, wird es leichter“. Es sind Richtpunkte für die Fahrt ins Ungewisse, die wir mit dem Klienten gemeinsam unternehmen. Orientierung und Aufrichtung soll hier ermöglicht werden. Folgende Bedingungen scheinen mir hiflreich zu sein: Die Haltung des Therapeuten, generell Der Therapeut kann nicht immer erwarten, dass er von seiner Tätigkeit überzeugt ist, und er kann auf diese Überzeugung tatsächlich nicht warten, im eigenen Interesse und im Interesse des Klienten. Er erlebt das gleiche Dilemma wie der Priester, der die Messe zelebriert - auch der kann nicht auf seinen Glauben warten, weil sonst inzwischen die Leute heimgehen. Er kann die „Haltung“ des Therapeuten einnehmen, wie ein Mönch, der seine Rituale verrichtet, etwa seine Stundengebete spricht. Diese Rituale mögen verschieden sein, sie hängen ab von der „Therapieschule“, der man anhängt, von der Ausbildung, vom eigenen Stil, im Wesentlichen alles Haltungsvorschläge. Wichtig ist, dass sie mit einer gewissen Demut getan werden, unabhängig von der momentanen Überzeugtheit. Wie und wann die Überzeugtheit kommt ist egal. Wichtig ist, dass sie hin und wieder vorbeischaut, sonst verhungern wir. Jan Willem van de Weeterings schildert in seinem Buch „Lehrjahre in einem Zenkloster“, wie er das erste Mal beim täglichen Gemüseschneiden das Erlebnis spiritueller Unmittelbarkeit erfährt, das Ziel seines Aufenthaltes in Japan. Als er das begeistert dem Abt des Klosters mitteilt, meint der nur: „Fein, das kommt und geht, aber das Gemüse für heute Mittag sollte jedenfalls geschnitten werden“. Das kennen wir ja als Therapeuten auch: „Mein Gott, war ich heute gut, was ist mir wieder für eine tolle Intervention gelungen........“ - derartige Sensation ist wahrscheinlich gar nicht wichtig für seine Arbeit, aber von Zeit zu Zeit notwendig für den Therapeuten, damit er nicht anerkennungsmäßig verhungert (s.u.). Aber im Grunde können wir uns darauf verlassen, dass wir die Erfahrung der Überzeugtheit verlässlich von Zeit zu Zeit machen. Wir können hier mit Goethe sagen: „wer immer strebend sich bemüht.........“, oder aber statistische Zufallshäufigkeiten für gelegentlichen Erfolg verlässlich annehmen. Solche „Erfolge“ sollten genossen werden, aber im Grund sind sie weder wichtig noch entscheidend, sie tun uns gut. Hier wird die Demut des Therapeuten als zentrale Haltung gefragt sein. Der Therapeut sollte also demütig die Haltung des Therapeuten seiner Schule einnehmen, unabhängig ob er im Moment daran glaubt oder nicht. Das Interesse des Therapeuten, seine Neugier Etwas dem Zweifel Verwandtes ist das Wundern. Beides geschieht, wenn wir für die Phänomene, die uns begegnen, keine Worte (mehr/Zweifel) haben (oder noch keine/Wundern). Ob wir etwas zweifelhaft oder wunderbar erleben, hängt vom Kontext ab. Kommt uns Sicherheit abhanden, bedroht uns gar, dann zweifeln wir, lässt uns das Phänomen Positives erhoffen, wundern wir uns. Lang können wir beides meist nicht aushalten, deswegen drängt das, wofür wir keine Worte haben, der Sprache entgegen (Glasersfeld). Neugier ist hier die Hebamme. Neugier hat keinen Zweck, keine Absicht, auch keine professionelle. Man kann nicht neugierig sein, damit man eine bessere Therapie macht. Man ist neugierig oder nicht. In dem Sinn: Der Therapeut kann und darf neugierig sein auf die Geschichten seiner Klienten, sonst ist er nicht verwickelt genug. Das muss er aber sein, sonst bemüht er sich nicht, gemeinsam mit dem Klienten spannende und alternative „Geschichten“ zu entwickeln. Neutralität, hier Konstruktneutralität, muss angesichts dieses Engagements immer wieder errungen werden, sonst bräuchten wir sie nicht thematisieren - wäre ja keine Kunst, wer nicht interessiert ist, kann leicht neutral sein. Ich trete hier für eine alltägliche Neugierde ein, nicht nur für eine professionelle. Wenn der Seite 4 von 9 Systemische Notizen 04/04 Therapiepraxis Therapeut nicht neugierig ist, dann kann er nicht neugierig sein. Er kann versuchen, so zu tun als ob, das reicht oft bei einiger Übung für den Klienten, für den Therapeuten auf Dauer nicht. Aber manchmal verführt die Haltung der Neugierde zu tatsächlichem Interesse. Ich trete hier für eine Kultur des gemeinsamen Tratsches ein. Wenn Therapeuten und Klienten nicht auch die Lust an der Neuigkeit, unabhängig ihrer Bedeutung, entwickeln, werden sie sich in korrekt formulierten „Fünfjahresplänen“ bloßer Zielarbeit unvermeidlich erschöpfen. Die Neugier des Klienten und des Therapeuten muss nicht immer in Andacht und weihevoller Stille reifen. Wenn der Tratsch, zumindest meistens, der Kompost ist, aus dem sich das Neue entwickelt, dann wird es, das ist bei Lebensvorgängen unvermeidlich, manchmal auch etwas schmutzig zugehen. Neugierde ist nie rein und antiseptisch, weder in dem, worauf sie sich bezieht - man braucht hier nur an die Kinder denken - noch in den Beweggründen, die sie antreibt. Hier hat die Psychotherapie viel mit dem Doktorspielen der Kinder gemeinsam. Und auch das Neue, das dann hervorgebracht wird, ist zuerst immer etwas unpassend und peinlich. Das Neue ist ja meist deswegen unentdeckt geblieben, weil es nicht nur unbekannt, sondern zudem unpassend war. Therapeuten sollten hier nicht verschämt sein, wenn sie ihre Klienten hilfreich begleiten wollen. Also, ohne ein bisserl Neigung zur unanständigen und aufmüpfigen Fantasie sollte man eher nicht Psychotherapeut werden. Der Therapeut darf und soll neugierig sein, aus der Gier aufs Neue, nicht weil er helfen will. Die Liebe des Therapeuten Es ist in Ordnung und sowieso unvermeidlich, wenn der Therapeut seine Klienten mag. Zuerst stehen sich, vor allen Regeln der Kunst, Therapeut und Klient, als Menschen gegenüber, als Mitmenschen mit Zuneigung und Vorsicht, gelegentlich auch als Mann und Frau, mit mehr oder weniger anziehender Tendenz, kalauerhaft könnten wir postulieren, das ist völlig o.k., solange sich die anziehende Tendenz nicht in eine „ausziehende“ verwandelt. Auch hier gilt: Wer nicht an Menschen und ihren Existenzmöglichkeiten interessiert ist, sollte Therapie sein lassen, das ist, als wäre ein Gärtner dem Geruch der Rosen gegenüber gleichgültig, oder dem Geschmack der Äpfel. Für Neutralität gilt dasselbe wie oben. Soziale Neutralität ist nur vor dem Hintergrund von möglicher und wahrscheinlicher Parteilichkeit und Interesse überhaupt eine sinnvolle Formulierung und Forderung. Ich trete hier für die Liebe und Zuneigung zu den Menschen ein, nicht nur für die Liebe zu ihren Geschichten - sie treten mir ja nicht nur in ihren Geschichten gegenüber, sondern sie überbringen diese sozusagen persönlich, in leiblicher Gestalt. Natürlich muss Therapie, wenn sie eine solche sein soll, innerhalb des regulierten Regelrahmens bleiben. Aber nur wenn wir überhaupt menschliche Begegnung als solche für möglich halten, das heißt, Menschen so ernst nehmen, dass wir sie im Gesamtem wahrnehmen, werden diese Regeln relevant, sonst hätten wir keinen Anlass zu regulieren. Der Therapeut darf und soll seine Klienten mögen, wenn er sie mag. Die Abneigung des Therapeuten Wenn sich Menschen gegenüber sind, lassen sich Emotionen nicht vermeiden. Wir haben das lange etwas zurückgestellt. Diese Emotionen folgen grundlegenden Tendenzen, Zuneigung und Abneigung sind solche. Das sind genuin spontane Phänomene, die sich nicht direkt beeinflussen lassen und wir sollten ihnen gelassen, neutral und neugierig gegenüberstehen, solange sie nicht die Grenzen der Therapie sprengen, die gesetzlichen wie die vereinbarten, möglicherweise auch die des üblichen Umgangs miteinander. Wir reden von den Seite 5 von 9 Systemische Notizen 04/04 Therapiepraxis anziehenden Tendenzen schon nicht gern, von den abstoßenden noch weniger. Wenn sich der Klient aber so benimmt, dass ihn alle Welt nicht mag, wie soll der Therapeut ihn mögen? Vor aller Regulierung wird der Therapeut Zuneigung und Abneigung körperlich registrieren, ob er will oder nicht. Seine stammesgeschichtlich alten Anteile werden schneller sein als jeder Vorsatz und jedes Neutralitätsgebot (Zwischenhirn vor Neokortex oder so). Missachtet er das, wird er leiden, zumindest an Verspannungen. Auch hier: „Neutralität“ ist nur vor dem Hintergrund ihrer Nichtexistenz, der Schwierigkeit ihrer Herstellung, eine sinnvolle Forderung. Warum sollte der Therapeut nicht Abneigung gegen den Klienten verspüren, solange er das systemisch tut, das heißt: Wenn er die Antipathie nicht für eine wahre, gewisse und absolute Nachricht über den Klienten hält sondern bloß für eine konkrete Information über die momentane eigene Befindlichkeit, ist das eine wichtige Information (die der Beobachter registriert) und ein wesentliches Element therapeutischer Begegnung. Wir können ja unserer spontanen körpernahen Reaktion unsere Reflexion und Einschätzung hinzufügen. Ja Reflexion und Einschätzung haben eigentlich nur einen erkenntnishaften Sinn im Zusammenhang mit einem spontanen widerständigen Eindruck. Davon abgesehen ist eine gewisse Antipathie gegen den Klienten der Therapie sowieso an sich nicht abträglich. Im Gegenteil, sie kann dem Fortschritt der Therapie dienen, weil der Therapeut sich bemühen wird, diesen Menschen bald nicht mehr sehen zu müssen. Ich trete hier dafür ein, „dass einem der Klient auf den Wecker fallen darf“. Das ist ja nichts Neues, nur gehen wir meistens verschämt damit um. Ich kann mich - zumindest spontan - an keinen Fall in der systemischen Literatur erinnern, der aus der Abneigung des Therapeuten gegen seinen Klienten heraus entwickelt wurde, aber die Milton Erikson Fans können bestimmt ein derartiges Beispiel nennen. Die Wurstigkeit als Form der Bescheidenheit des Therapeuten Sie ist eine wesentliche Voraussetzung der Neugierde - wer nur eine und nur eine bestimmte Lösung im Sinn hat, kann nicht neugierig sein. „Wurstigkeit“ ist nicht nur eine deftigere Formulierung der vornehmeren und blasseren Neutralität (Lösungsneutralität), sie ist zumindest ihr emotionales Unterfutter, aber vielleicht auch ihr emotionaler Ursprung. Der Therapeut sollte den Sorgen seiner Klienten auch ein kräftiges „Rutsch mir den Buckel runter“ entgegensetzen können, wenn ich das einmal so sagen darf, damit er dem notwendigen Engagement am Ende seiner Arbeit wieder entkommt. Die Wurstigkeit des Therapeuten ist eine primitive Formulierung seiner Bescheidenheit, er weiß um die Grenzen seines Einflusses und seine ewige Unbestimmtheit, darauf hat Kurt Ludewig hingewiesen. Wir könnten sagen, die Neugierde und damit die Möglichkeit des Neuen entsteht aus der Vermählung zwischen Interesse und Wurstigkeit. Wer nur Interesse hat, hat meist ein bestimmtes eigenes Ziel im Auge, er ist auf seine Intention festgelegt und damit meist auf eine und eine bestimmte – Lösung. Wer nur wurstig ist, für den sind alle Lösungen möglich, aber er wird sich nicht bemühen, dass tatsächlich irgendeine zum Vorschein kommt. Es ist beides nötig, Engagement und Distanz. Das ist es, was der viel elaborierte Sigmund Freud und noch besser Theodor Reik als gleichschwebende Aufmerksamkeit beschrieben haben. Der Spaß des Therapeuten Spaß hat man dann, wenn sich überraschend neue Ansichten auftun. Das ist ja auch das wesentliche Moment therapeutischen Angebots. Das Witzige hat zwei Momente, wir kennen sie schon, es lässt sich als Phänomen nicht absichtsvoll erzeugen (das Lachen lässt sich nicht zwingen), trotzdem hat es Struktur, ist von seiner Wirkung her eine Bedingung der Möglichkeit, etwas Neues wahrzunehmen. Das Witzige hat 3 Konstruktionselemente Seite 6 von 9 Systemische Notizen 04/04 Therapiepraxis ● formal - eine Rahmenverschiebung der Aufmerksamkeit, ● inhaltlich - das Überraschende, Peinliche, Neue, Riskante, Unanständige, ● kommunikativ - durch die Auslassung wird der Zuhörer zum Konstrukteur, ob er will oder nicht alles Elemente, die alle Postulate systemischer Vorgangsweise darstellen. Und: Ein Witz ist nicht ernst gemeint, er ist keine Behauptung der Gewissheit, sondern eine Andeutung der Möglichkeit. Diese drei Konstruktionselemente lassen sich am Beispiel einer Anekdote über Friedrich den Großen zeigen: Der König inspiziert - in der tiefsten preußischen Provinz - ein Regiment und sieht sich dabei plötzlich einem Gefreiten gegenüber, der ihm selbst, dem Souverän, wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Majestät stutzt und findet die Erklärung: „Seine Mutter hat wohl in der Residenz gedient“. Die Antwort: „Mein Vater, Majestät“. Die Aufmerksamkeit verschiebt sich von der Frage: ‚Warum sieht der Soldat dem König so ähnlich?’ zur Frage: ‚Warum sieht der König dem Soldaten so ähnlich?’ und findet ihren Kulminationspunkt in dem neuen und ungeheuren Gedanken, dass nicht der Vater des Königs ein charmanter Verführer, sondern die Mutter des Königs eine leichtfertige Person gewesen sein könnte. Insofern hat der Witz durchaus feministischen Gehalt, weil er eine kritische Anmerkung zur Markierung unserer Entrüstung macht: Was beim König erlaubt ist, ist bei der Königin ganz unmöglich. Hier geht es um Sex und geradezu undenkbare Variationen davon. Aber der Erzähler sagt davon kein Wort, alles entsteht im Zuhörer, und zwar spontan, ob er will oder nicht, beim Versuch den Gedankengang zu verstehen; oder es entsteht auch nicht, wenn der Gedankengang zu fremd, zu ungeheuerlich - der Unterschied zu groß ist. Strukturell passiert Ähnliches, wenn der Therapeut zu einem klagenden Klienten sagt: „Oh ich verstehe, Sie wollen sagen, das Leben ist selber schuld, wenn es an mir vorbeigeht.“ Hier liegt unwillkürlich der Gedanke nahe, dass der Klient sein Leben ein Stück mehr selbst verantworten könnte, weil plötzlich von Täterschaft die Rede ist, nicht vom Opfersein, aber gesagt wird das nicht. Im Gegenteil die Verwechslung ist Absicht: Nicht Sie sind schuld, nein das Leben selbst etc. Oder wenn der Therapeut zu der Klientin, die sich mit einer Kleinmädchenstimme über ihren Partner alteriert, sagt: „Ich würde es für meinen Geschmack passend finden, wenn Sie jetzt ein kleines bisschen mit dem rechten Fuß aufstampfen“. Frank Farrelly u.a. ermutigen uns ausreichend. Ich trete für das Witzige und Humorvolle in der Therapie ein, das ich für keine akademische Annäherung halte, sondern für eine grundsätzliche. Nur was den Therapeuten selbst verblüfft, ist wirklich witzig. Theodor Reik hat das schon vor vielen Jahrzehnten beschrieben. Bereits Reik schreibt aber auch, dass es dazu Mut braucht (dem Klienten gegenüber, aber auch gegenüber uns selbst angesichts möglicher Verunsicherung gewohnter Überzeugungen). Wenn wir Überraschung riskieren, können wir auch im Unverständlichen und Irritierenden landen, heutig gesagt, „no risk, no fun“. Das Eigenlob des Therapeuten Es ist unwichtig für die Therapie an sich, aber ganz wichtig für den Therapeuten selbst. Zuerst einmal: Gelingt Therapie, sieht der Klient keinen Anlass zum Lob. Es war sein Einfallsreichtum, der die neue Idee aufgegriffen hat, es ist sein Mut, der jetzt durch eine neue Situation gefordert wird; der Beitrag des Therapeuten tritt hier zurück und das ist gut so, seine Leistung wird ja abgegolten, der Klient soll nicht dankbar sein müssen. Der Therapeut kriegt seine Bestätigung nur in der Eigenerzeugung und Präsentation, oft in der anonymisierten Fallbesprechung, in der Erfolge präsentiert werden können, manchmal sogar in Form der Veröffentlichung, die eine Art legitimierte und nützliche Angeberei darstellt. Anzüglich gesagt: Er stellt die Ergebnisse einer unvermeidlichen und nützlichen Selbstbefriedigung einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung, erweitert diese, wenn man will, um das wohltuende Moment des Exhibitionismus. Das ist in Ordnung, solange es innerhalb der Seite 7 von 9 Systemische Notizen 04/04 Therapiepraxis Grenzen des guten Geschmacks bleibt, aber darüber befindet dann ohnedies der Leser, das ist - Risiko des Autors - immer beobachterabhängig. Ich rede hier einem maßvollen Eigenlob das Wort. Es ist für die Lust des Therapeuten an seinem Job durchaus unentbehrlich. Das Scheitern des Therapeuten Das Scheitern des Therapeuten ist aus drei Gründen unvermeidlich. Zum Ersten macht sich der Therapeut immer eine Vorstellung von der Lösung, ob er will oder nicht. Lösungsneutralität verhindert diese Vorstellung nicht, sie stellt sie bloß richtig, insofern sie nur für den Therapeuten etwas bedeutet, nicht für den Klienten. Die Lösung, die der Klient für sich als freies und autonomes Subjekt wählt, wird immer eine andere sein. Insofern wird der Therapeut scheitern, das ist unvermeidlich. Zum Zweiten sind wir als Therapeuten immer mehr mit dem Unveränderlichen als Gegenstand unserer Veränderungsbemühungen befasst: Nicht mehr dieses oder jenes Verhalten, das tatsächlich verschwinden könnte wie Zwang, Angst, Streit etc. sondern Krankheit, Alter, Behinderung etc. sind uns zunehmend auch Thema. Zum Dritten scheitern wir letztlich immer bezüglich der Hoffnung unserer Klienten, dass wir Mühe, Plage, Absurdität aus der Welt schaffen könnten. Genau wie der Geistliche sind wir mit der Hoffnung konfrontiert, das Böse und Absurde - bis hin zum Tod - aus der Welt zu schaffen, zumindest aus der kleinen persönlichen des jeweiligen Klienten. Wir können es nicht, sosehr wir es angesichts von Krankheit, Unglück und Gemeinheit oft wollen. Mit diesem Scheitern versöhnt zu sein ist wahrscheinlich nicht möglich, wäre vielleicht gar nicht gut, aber es als unvermeidlich zumindest gelegentlich zu denken und nicht als persönliche Aufgabe und Herausforderung, halte ich für die wesentliche Glaubensmöglichkeit des Psychotherapeuten. Insgesamt ist das also eine Rehabilitierung der Spontaneität und der Alltäglichkeit, sie sollen dem Therapeutsein entgegen oder besser gegenüber dem Zweifel hinzugefügt werden. Hingegen möchte ich die Annahme, dass wir nicht zweifeln dürften oder gar, dass wir immer gewiss und sicher sein müssten, als unrealistisch und unnütz zurückweisen. Zusammenfassung Der Zweifel ist immer von Gefühlen begleitet, die uns meist überraschen. Er changiert zwischen Wundern und Peinlichkeit. Das macht unser Leben unsicherer und reicher, auch wenn wir die damit verbundenen Einsichten und Erfahrungen ursprünglich lieber vermieden hätten. Der Zweifel ist eminent wichtig, v.a. wegen seiner Wirkung, nicht (nur) der therapeutischen. Der Zweifel macht bescheiden und deswegen gewappnet gegen die einzige Todsünde des Therapeuten, die Idee er bewirke etwas, er brächte das Wunder hervor - das ist guruhaft, auch ok., aber das ist dann etwas Anderes, eher etwas für Religionsgründer als für die Psychotherapie. Zweifel erspart uns so viel Mühe, v.a. die der Arroganz. Der Zweifel sollte keinesfalls utilisiert werden, das hat er nicht verdient, auch nicht von einer Therapieform, die in der Nutzung des Hinderlichen eine ihrer Stärken sieht. Das hieße den Bock zum Gärtner machen und – abgesehen davon, dass der Bock vielleicht kein guter Gärtner ist, er fehlt dann auch der Herde, ohne ihn wird sie nicht gedeihen. Anders gesagt: Der Zweifel ist zu fruchtbar um gleich genutzt zu werden. Der Zweifel steht dem Glauben gegenüber, nicht entgegen. Glaube und Zweifel sind Positionen, die nicht auf Dauer aufrecht erhalten werden können. Wer nur zweifelt, der verzweifelt, wer nur glaubt sieht alle Erfahrung im ewig gleichen Licht. Seite 8 von 9 Systemische Notizen 04/04 Therapiepraxis Was wäre der Sinn des Zweifels für die Therapie? „Technisch“ gesprochen keiner, er mahnt uns aber ständig an die Vorläufigkeit unseres beruflichen Handelns und die Abhängigkeit dieses Handelns von außertherapeutischen Wirkungen und Kontexten. Der Therapeut ist immer ungewiss und deswegen neugierig und immer wieder auf der Suche nach der neuen maßgeschneiderten Lösung. Der Therapeut weiß nichts und kann nichts, wenn er sich hinsetzt und zu arbeiten beginnt. Er fängt immer wieder von vorne an, jeden Tag. Das ist das Schöne und Schöpferische an seiner Arbeit. Der Zweifel ist der notwendige Preis dafür. Der Glaube ist die Münze, in der wir diesen Preis zahlen können ohne zu verzweifeln. LITERATUR: Reik T. (1935) Der überraschte Psychologe. Sijthoffs Uitgeversmaatschappij N.N., Leiden Wetering J. (1978) Lehrjahre in einem Zenkloster. Rowohlt, Reinbek Dieser Artikel ist die Essenz und das Ergebnis eines Vortrags im Rahmen des „Systemischen Kaffeehauses“ im Juni 02 DR. HELMUT DE WAAL ist klinischer Psychologe, Psychotherapeut in freier Praxis (Steyr), Supervisor, Lehrtherapeut für systemische Familientherapie und Autor mehrfacher Veröffentlichungen in systemischer Therapie. Seite 9 von 9