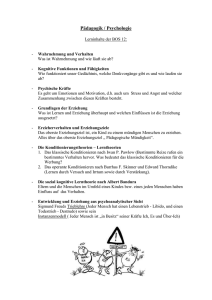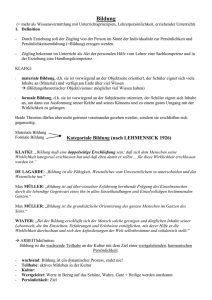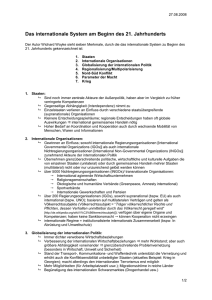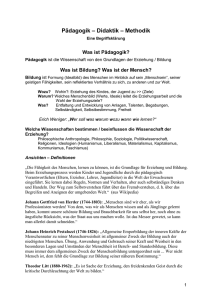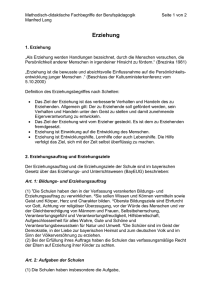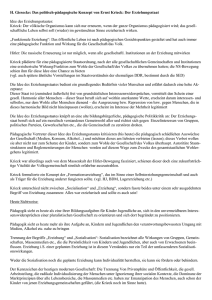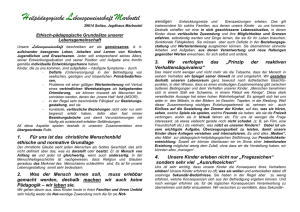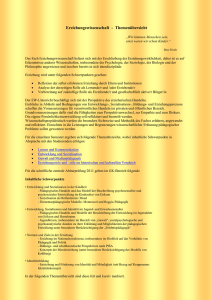Blocklehrveranstaltung
Werbung
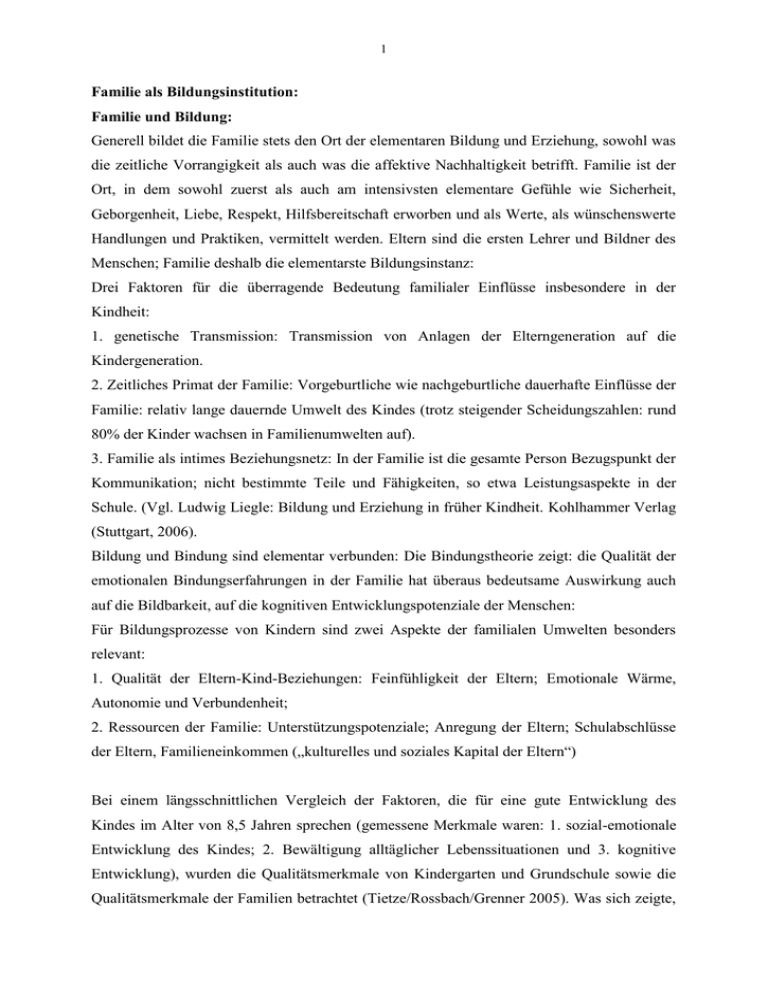
1 Familie als Bildungsinstitution: Familie und Bildung: Generell bildet die Familie stets den Ort der elementaren Bildung und Erziehung, sowohl was die zeitliche Vorrangigkeit als auch was die affektive Nachhaltigkeit betrifft. Familie ist der Ort, in dem sowohl zuerst als auch am intensivsten elementare Gefühle wie Sicherheit, Geborgenheit, Liebe, Respekt, Hilfsbereitschaft erworben und als Werte, als wünschenswerte Handlungen und Praktiken, vermittelt werden. Eltern sind die ersten Lehrer und Bildner des Menschen; Familie deshalb die elementarste Bildungsinstanz: Drei Faktoren für die überragende Bedeutung familialer Einflüsse insbesondere in der Kindheit: 1. genetische Transmission: Transmission von Anlagen der Elterngeneration auf die Kindergeneration. 2. Zeitliches Primat der Familie: Vorgeburtliche wie nachgeburtliche dauerhafte Einflüsse der Familie: relativ lange dauernde Umwelt des Kindes (trotz steigender Scheidungszahlen: rund 80% der Kinder wachsen in Familienumwelten auf). 3. Familie als intimes Beziehungsnetz: In der Familie ist die gesamte Person Bezugspunkt der Kommunikation; nicht bestimmte Teile und Fähigkeiten, so etwa Leistungsaspekte in der Schule. (Vgl. Ludwig Liegle: Bildung und Erziehung in früher Kindheit. Kohlhammer Verlag (Stuttgart, 2006). Bildung und Bindung sind elementar verbunden: Die Bindungstheorie zeigt: die Qualität der emotionalen Bindungserfahrungen in der Familie hat überaus bedeutsame Auswirkung auch auf die Bildbarkeit, auf die kognitiven Entwicklungspotenziale der Menschen: Für Bildungsprozesse von Kindern sind zwei Aspekte der familialen Umwelten besonders relevant: 1. Qualität der Eltern-Kind-Beziehungen: Feinfühligkeit der Eltern; Emotionale Wärme, Autonomie und Verbundenheit; 2. Ressourcen der Familie: Unterstützungspotenziale; Anregung der Eltern; Schulabschlüsse der Eltern, Familieneinkommen („kulturelles und soziales Kapital der Eltern“) Bei einem längsschnittlichen Vergleich der Faktoren, die für eine gute Entwicklung des Kindes im Alter von 8,5 Jahren sprechen (gemessene Merkmale waren: 1. sozial-emotionale Entwicklung des Kindes; 2. Bewältigung alltäglicher Lebenssituationen und 3. kognitive Entwicklung), wurden die Qualitätsmerkmale von Kindergarten und Grundschule sowie die Qualitätsmerkmale der Familien betrachtet (Tietze/Rossbach/Grenner 2005). Was sich zeigte, 2 war, dass die Effekte, die von der Qualität des Familiensettings ausgehen, annähernd doppelt soviel an den Entwicklungsunterschieden erklärten wie die Qualität der institutionellen Settings; d.h. institutionelle Settings kaum die Potenziale bzw. Defizite in den familiären Anregungsbedingungen kompensieren können; Implikation dieses Befundes ist: Entwicklungsförderung kann nur gelingen, wenn eine Qualitätssteigerung in den institutionellen Settings einhergeht auch mit einer Steigerung der Bildungsqualität in den Familien. Insbesondere für die schulischen Leistungen konnten folgende Merkmale identifiziert werden: 1. Hoher Bildungsstand der Mutter 2. Orientierung an einer Erziehung, die auf Unterstützung und Betrachtung des Kindes als eine autonome Persönlichkeit hinzielt, 3. Häusliche Anregungen: Beschäftigung mit Sprache, Spielen, Vorlesen, Geschichten erzählen etc. (Vgl. Liegle, 2006). Gegenwärtig erhält Erziehung und Bildung noch einmal zusätzlichen Wert durch das kostbare Gut „Kind“ und die bewußte Entscheidung (und damit auch Verantwortungsübernahme) für ein Kind (darüber hinaus späte Elternschaft). Kinder das „i-Tüpfelchen“ der eigenen Lebens- und Glücksplanung Starke Emotionalisierung der Familienbeziehungen; Familie als Hort des Glücks; Die Fokussierung auf kindliche Bildung setzt mit der „Entdeckung“ und Wiederentdeckung der Kindheit sowie mit dem Funktionswandel der Familie an: Auf der einen Seite wird eingestanden, dass Kindheit eine eigenständige und für sich bedeutsame Lebensphase ist; auf der anderen Seite hat ein Bedeutungswandel statt gefunden, der auch Implikationen auf die kindliche Bildung und Entwicklung hat, und zwar „Vom Befehlshaushalt zum Verhandlungshaushalt“; Auch juristisch der Wandel von „elterlicher“ Gewalt zu „elterlicher Sorge“. Jedoch sind die gegenwärtigen Sozialisationsbedingungen nicht frei von Ambivalenzen: 1) Populärwissenschaftliche Werke, die einen „Erziehungsnotstand“ (Gerster & Nürnberger, 2001), oder gar eine „Erziehungskatastrophe“ (Gaschke, 2001) diagnostizieren, erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Auch wenn das Aufwachsen in der Postmoderne durchwegs von einer Katastrophensemantik begleitet wird, die über unglückliche Kinder und gestresste Eltern berichtet; zeigt doch andererseits die Empirie auch, dass Kindheit deutlich besser ist als ihr 3 Ruf und Familie aus kindlicher Sicht immer noch der Hort von Glück und Zufriedenheit ist; und das trotz einer Prävalenzrate von etwa 20% psychischer Störungen im Kindesalter. So ergab bspw. eine Befragung von 1319 Kindern (M=11,2 J; SD=0.98 J.; 53% w.; 47% m.; Salzburger Kindersurvey von Anton Bucher, 2001) als wichtigste Faktoren des kindlichen Glücks: gutes Familienklima Anerkennung Lob positives Erleben der Schule Freizeit, Freiraum Freunde. Bei der Messung des Wohlbefindens antworteten die Kinder wie folgt: sehr glücklich glücklich nicht so glücklich eher traurig 54% 39.3% 5.6% 1% (Vgl. Anton A. Bucher: Was Kinder glücklich macht. Historische, psychologische und empirische Annäherungen an Kindheitsglück. Juventa Verlag, Weinheim, 2001.) Die bundesrepublikanische Gesellschaft befindet sich in einem dramatischen demografischen Wandel, dessen Effekte auch die Lebenswelt von Kindern tangiert: der Anteil der Kinder an der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik nimmt sukzessive ab; der Anteil der Älteren bzw. Rentner nimmt zu. Schätzungen für das Jahr 2040 sagen voraus, dass dann in der Bundesrepublik nur etwa 14% unter 18 Jahre sein werden, d.h. Kinder nur lediglich ein Siebtel der Bevölkerung darstellen werden; d.h. auch eine zunehmende Marginalisierung von Kindern; gleichwohl historisch betrachtet Kinder in modernen westlichen Gesellschaften die Gewinner sozialer Modernisierung sind, was bspw. Kinder als eigenständige Persönlichkeiten, Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit der Persönlichkeit des Kindes betrifft. Konsequenzen dieser demografischen Verschiebung: 1. Kinder werden vielmehr Generationen erleben können, so etwa Groß- und Urgroßeltern; 2. Rückgang der Geschwisterzahl führt zu einer Abnahme der horizontalen Verwandtschaft (Cousins, Neffen etc.), aber zu einer Intensivierung der vertikalen Verwandtschaft; 3. Stärkeres Alleinaufwachsen führt zu einer höheren Intensität der emotionalen Beziehung der Eltern und auch ökonomischer Investitionen (Kommerzialisierung der Kindheit); 4 Abnahme von Sozialerfahrungen im geschwisterlichen Verband, die durch institutionelle Sozialisationsagenturen kompensiert werden muss (Kita, Schule); Gleichwohl in Kinder mehr investiert wird, waren aber - und das ist die andere Seite der Aufwachsensbedingungen - bis zum Ende des letzten Jahrhunderts insbesondere kinderreiche Familien und Alleinerziehende von der Armut überzufällig häufiger betroffen, wie sie die untere Tabelle verdeutlicht: Tabelle: Prozentualer Anteil von Familien, die von Armut betroffen sind (Vgl. Fuhrer, 2005, S. 109): 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Alle Haushalte 9.1 8.8 8.5 10.1 9.4 11.2 9.5 9.1 9.5 Paar 1 Kind 7.9 9.4 8.8 7.5 8.9 10.2 6.4 7.5 7.8 Paar >3 Kinder 19.7 20.9 19.8 24.5 25.7 23.2 21.5 21.6 24.7 Ein-Eltern- 29.1 35.3 29.3 26.4 28.2 40.4 33.3 29.5 30.1 Haushalte Darüber hinaus lassen sich aus psychologischer Perspektive folgende Veränderungen in den letzten Jahrzehnten identifizieren, die zu Kennzeichen moderner Gesellschaften geworden sind: Auflösung sozialer Bindungen im Familienleben: Freiheitszuwächse für Erwachsene, aber Verletzung von kindlichen Bedürfnissen nach Stabilität, Geborgenheit und Verlässlichkeit; Medialisierung der Lebenswelt: Informations- und Reizüberflutung; Förderung von passiven und rezeptiven Aneignungsweisen; Steigerung der Sensationslust; irrealistische Erwartungen und Weltsicht; Intensivierung der Leistungs- und Qualifikationsanforderungen: Verlängerung der schulischen und beruflichen Ausbildungswege sowie ein Anstieg elterlicher Bildungsaspirationen; (Vgl. Urs Fuhrer: Lehrbuch Erziehungspsychologie, Bern: Hans Huber, 2005) Die Veränderung von familialen Lebensformen wirkt sich auch auf die Entwicklungsumwelten von Kindern aus, die in erster Linie in folgendem zu sehen sind: 1) strukturelle Veränderungen der Haushaltsformen, 2) aus kindlicher Sicht prekär gewordene Bedingungen der elterlichen Beziehungsgestaltung 3) veränderte Wert- und Erziehungsmuster. 5 Zu 1) Zunahme der Ein-personen-Haushalte (im Jahre 2000 erstmals mit 37% die am häufigsten vertretene Haushaltsform) sowie eine Zunahme an Ein-Eltern-Familien; dadurch steigt der „Wert“ des einzelnen Kindes als sinnstiftend für das eigene Leben; steigende Kinderlosigkeit sowie ein Rückgang der Geburtenrate (gegenwärtig etwa bei 1.4); steigender Anteil von nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften; Anstieg des durchschnittlichen Erstheiratsalters, der gegenwärtig bei Männern bei etwa 30 und bei Frauen bei etwa 28 Jahren liegt. Zu 2) Deutlicher Anstieg der Scheidungsraten seit 1960, so dass für Kinder die Wahrscheinlichkeit, von nur einem Elternteil aufzuwachsen, steigt. Gleichzeitig steigt aber auch die Zahl der Wiederverheiratungen an: etwa 66% der Geschiedenen heiraten erneut, so dass aus kindlicher Sicht die Zahl der Bezugspersonen sich ändert, evtl. Stiefgeschwister hinzukommen, mit denen ein neues Arrangement hergestellt werden muss. Dabei zeigen empirische Studien, dass die Ehestabilität in zusammengesetzten Stieffamilien, bei denen beide Paare ein Kind aus früheren Partnerschaften mitbringen, instabiler zu sein scheint als Stieffamilien, bei denen nur die Mutter ein Kind in die neue Ehe mitbringt (Vgl. Fuhrer, 2005). Auch ist der Trend nicht zu übersehen, dass immer mehr Väter sich in die Erziehung und Entwicklung des Kindes engagieren. Welche Veränderungen in den Eltern-Kind-Beziehungen in dem Sinne, dass ein Elternteil ausgezogen und eine andere Person die psychische Elternschaft übernommen hat, zeigt die untere Tabelle für die letzten 50 Jahre: 6 Tabelle: Anzahl der Veränderungen in den Lebensverhältnissen von Kindern unter 18 Jahren in den östlichen und westlichen Bundesländern (nach Alt, 2001) 19541960 geborene Kinder 19641970 geborene Kinder 19741980 geborene Kinder 19841990 geborene Kinder Keine Wechsel Ein Wechsel Zwei Wechsel Drei Wechsel Vier u. mehr Wechsel West 82,4 9,9 2,6 1,8 3,3 Ost 48,8 30,9 3,3 6,5 10,6 West 80,9 5,6 3,1 3,8 6,6 Ost 63,9 13,7 8,4 6,3 7,8 West 75,5 7,5 4,3 3,7 9,0 Ost 55,9 12,8 9,1 9,4 12,9 West 79,2 6,3 5,0 3,8 5,8 Ost 52,2 24,2 9,7 6,5 7,3 Zu 3) Diese sozialen Veränderungen führen zunächst auf einer sehr globalen Ebene auch zu Ambivalenzerfahrungen und Verunsicherungen der Eltern: Sie haben auf der einen Seite die Aufgabe, ihren Kindern eine Anleitung und Unterstützung zu geben und auf der anderen Seite sie nicht zu bevormunden, sondern eine Ablösung und Freisetzung ihrer Individualität zu gewährleisten, also Bedingungen zu schaffen, wo Kinder ihre Entwicklungen selber gestalten können. Darüber hinaus wird das familiale Binnenverhältnis deutlich stärker emotionalisiert, so dass Liebe und Zuneigung zu den wichtigsten Elementen in Partnerschaft und Elternschaft werden. Die Erziehung des Kindes wird zu einer zentralen Entwicklungsaufgabe der Familie: Subjektivität, Einzigartigkeit, Eigenständigkeit werden zu markanten Zielen der Persönlichkeitsentwicklung. Als ein genereller Trend lässt sich im Verhältnis von Kindern zu ihren Eltern in den letzten Jahrzehnten ein Wandel von einem autoritären zu einem partnerschaftlichen Verhältnis ausfindig machen: aus dem Befehlshaushalt wurde ein Verhandlungshaushalt (Swaan, 1982). Praktiken, die auf Macht, Zwang und körperlichen Druck/Gewalt beruhten, wurden durch stärker diskursive, argumentative Praktiken ersetzt; die Appelle richten sich nun mehr auf die Vernunft des Kindes bzw. auf seine Einsichtsfähigkeit. Gleichzeitig ist jedoch aus kindlicher Sicht hierdurch auch eine subtile und für das Kind kaum bewältigbare Form der 7 Autoritätsausübung zu sehen: das Kind kann sich gegen die Eltern kaum wehren, weil deren Gründe und Argumente so „vernünftig“ sind. Was die veränderten Erziehungs- und Wertmuster betrifft, so zeigen bspw. die Erziehungsziele Ende der 50-er Jahre, die Kemmler und Heckhausen (1959) bei Müttern von 6-jährigen erhoben, folgende typische Ausprägungen: Gehorsam, Ehrlichkeit, Lernbereitschaft, Ordnung, Hilfsbereitschaft, Reinlichkeit, gute Manieren und Höflichkeit. Die Erziehungsziele ab Mitte der Neunziger Jahre (Sturzbecher & Waltz, 1998) zeigen eine deutlich stärkere Orientierung in Richtung Individualität (wie etwa Kritikfähigkeit, Selbstständigkeit), Kreativität und soziale Kompetenz sowie auch Leistungsbereitschaft. Generell wird die Erziehung zur Selbstständigkeit zu einem dominanten Erziehungsziel; Erziehungsziele dagegen, die auf Konformität (Respekt vor Traditionen, Höflichkeit, rituelle Benimm-formen) abzielen, nehmen an Bedeutung ab. Andererseits sind auch hier die Ambivalenzen kaum zu verleugnen: Eltern sind sehr stark um die individuelle Entfaltung ihres Kindes bemüht, möchten dessen Selbstständigkeit fördern. Jedoch sind Eltern z.T. so sehr um die Selbstständigkeit ihrer Kinder bemüht, dass diese kaum Möglichkeiten haben, sich frei zu entfalten, eigene Erfahrungsräume zu erkunden, kaum sich alleine beschäftigen, weil Eltern stets präsent sind, den Kindern Umwelten arrangieren und sie vor jeglichen, auch harmlosen Umweltgefahren schützen möchten und dabei die Kinder überbehüten oder stark kontrollieren (Z.B: per Handy etc.). Denn Kinder müssen für ihre Entwicklung auch entwicklungsgerechte Erfahrungen machen können; institutionelle oder auch elterliche Förderprogramme, die zu früh oder zu spät einsetzen, puffern ihre Effekte ab. Was bspw. die Ausprägung des Leistungsmotivs betrifft, konnte in früherer Forschung Selbstständigkeitsforderung der der Mutter starke nachgewiesen Einfluß werden, der die vorschulischen jedoch aber entwicklungsangemessen sein sollten (also nicht einfach nur in frühen Lebensjahren beginnen sollten; denn dann war eher mit Überforderung und Leistungsversagen zu rechnen). Es sollten also Aufgaben sein, die das Kind mit eigener Anstrengung schaffen kann; auf diese Weise kann das Kind den Zusammenhang zwischen eigenem Bemühen und dem Erfolg erkennen (Rheinberg, 2006). Erziehung und Entwicklung Erziehung und Entwicklung sind als wechselseitige, einander bedingende Aspekte zu verstehen: Erziehung muss auf Entwicklungsgegebenheiten Rücksicht nehmen; gleichzeitig wird Entwicklung aber auch durch bestimmte erzieherische Prozesse erst ermöglicht; 8 Erziehung ist Voraussetzung von Entwicklung und Entwicklung führt seinerseits zu einer Veränderung der Erziehung. Wird Erziehung nur verstanden als eine Einwirkung der älteren Generation auf die jüngere, dann wird die Passivität der kindlichen Natur nur historisch fortgeschrieben; deshalb gilt es vielmehr, die Interaktionen und die wechselseitigen Anregungen und Einwirkungen von Eltern und Kindern zu betrachten und neben formellen Instruktionen von Erziehern/Eltern stärker auf Momente der Selbstbildung zu fokussieren. Selbstbildung meint dabei sowohl Bildung durch eigene Aktivität, Tätigkeit und Aneignung, aber auch im Sinne der Bildung des Selbst als einer wichtigen entwicklungspsychologischen Dimension, als ein Kern der Persönlichkeitsentwicklung. Insbesondere bei Spielumwelten manifestieren sich kindliche Bedeutungskonstruktionen und Aneignungsprozesse wie etwa bei „vorgabewidriger“ Nutzung von Rutschen, Rolltreppen, Zäunen etc., in denen Kinder und Jugendliche ihre Umwelten auf je individuelle Weise aneignen und dadurch zu einer autonomen Bedeutungskonstruktion beitragen. Liegle plädiert, Erziehung nicht nur aus der Perspektive des Erziehenden, des Erwachsenen zu betrachten, sondern Erziehung als ein Handeln zwischen Personen zu betrachten; als einen kommunikativen Prozess wechselseitiger Einwirkung zu verstehen sowie Kinder ebenfalls als Subjekte der Erziehung einzubeziehen; ihre Erfahrung des Erzogenwerdens ist genauso konstitutiv wie elterliche Erziehungsintentionen. In der westlich geprägten erziehungspsychologischen Forschung (Baumrind, 1991; Darling & Steinberg, 1993) wird davon ausgegangen, dass ein autoritativer Erziehungsstil - damit ist eine hohe Zuwendung, Unterstützung, Wärme, hohe Selbständigkeit bei gleichzeitig hohen Forderungen an das Kind gemeint – sich als der optimale für die Entwicklung des Kindes auswirkt, wogegen der autoritäre Erziehungsstil (rigide Durchsetzung der elterlichen Autorität, geringe Selbständigkeit und hohe Kontrolle des Kindes) als eher ungünstig für die Entwicklung des Kindes betrachtet wird. Kulturpsychologische Studien zeigen jedoch, dass eine autoritative Erziehung zwar für euroamerikanische Kinder den optimalen Erziehungsstil darstellt, nicht jedoch für chinesische und andere Kinder mit Migrationshintergrund (Kim & Rohner, 2003, in Leyendecker, 2003). Auch wies bspw. Schneewind (2000) jüngst daraufhin, dass ein autoritärer Erziehungsstil unter bestimmten Umständen, und zwar dann, wenn das Kind unter entwicklungsgefährdenden bzw. delinquenzförderlichen Umwelten aufwächst, was in einigen Fällen für türkische Jugendliche zu vermuten ist, als durchaus funktional und sinnvoll zu betrachten ist. 9 Bildung im Kindergarten: Kitas als lediglich Bewahranstalten haben ihren historischen Ursprung, daran, dass im Zuge der Industrialisierung und Urbanisierung beide Elternteile arbeiten mussten und zum Teil sehr lange Fahrzeiten von der Wohnung zur Arbeit hatten; während dieser Zeit waren oft die Kinder sonst sich selbst überlassen, alleine in der Wohnung oder auf der Straße. Kindergärten sollten diese Situation auffangen und Kinder „ordentlich“ betreuen. Historisch betrachtet ist die Ausweitung der Kindertageseinrichtungen also zum einen eine Antwort auf die massenweise Kinderverwahrlosung seit den 40-er Jahren des 19. Jh., aber auch eine pädagogische Umkehr zu der Konzeption Erziehung statt Arbeit; Kindheit wird so als ein pädagogisches Moratorium verstanden.(Vgl. Martina Löw: Einführung in die Soziologie der Bildung und Erziehung. UTB, Leske & Budrich, Opladen 2003). Noch um die Wende vom 19. zum 20. Jh. starben im Deutschen Reich etwa 25% aller Neugeborenen. (Das erklärt bspw. auch heute noch die hohe Fertilitätsrate in Ostanatolien und in anderen Teilen der Welt). Langsam verbreitet sich die Einsicht, dass sich Bildungsprozesse bereits auch im vorschulischen Alter abspielen und Kindergarten nicht als eine Aufbewahrungsanstaltalt, eine Betreuungsanstalt ist, sondern auch und vordringlich eine Bildungsstätte. Hintergrundannahme: die besondere Bildsamkeit des Menschen in seiner Frühphase; schicksalhafte Bedeutung früher erfolgter oder versäumter/unterlassener Bildungsbiographien für das spätere Leben. Bildung als eine Form der Selbstbildung: als eine Tätigkeit des Subjekts, die auf Aneignung ausgerichtet ist. Diese Selbstbildung erfolgt bspw. häufig im Medium des Spiels, aber auch, wenn Kinder unter sich sind und eine „Form der Kinderkultur“ erzeugen: gemeinsame unabsichtliche Selbstbildung und Selbsterziehung (Vgl. L. Fried: Pädagogische Programme und subjektive Orientierungen. In: L. Fried et al. (2003). Pädagogik der frühen Kindheit (S. 54-85). Beltz: Weinheim.) Was heißt Selbstbildung: Selbstbildung: sowohl Bildung durch eigene Aktivität, Tätigkeit und Aneignung, aber auch im Sinne der Bildung des Selbst als eine wichtige entwicklungspsychologischen Dimension, als ein Kern der Persönlichkeitsentwicklung. Kindliches Spiel zentrales Medium der Bildung in der vorschulischen Phase: Darüber hinaus ist die Bedeutung des Spiels für die Identitätsentwicklung auch ein zentraler Topos des amerikanischen Pragmatismus, insbesondere bei G.H. Mead: 10 Die Entwicklung der Identität in der Kindheit verläuft bei Mead über wesentlich folgende zwei Stränge: a) Sprache und b) Spiel, wobei das Spiel differenziert wird in b 1) „play“ und b 2) „game“. Diese beiden Stränge verlaufen parallel und sind keine sukzessiven Stufen; d. h. das Kind spricht und spielt zugleich. Beginnen wir mit dem Spiel: Die Phase des „game“ ist eine ontogenetisch spätere, höherstufige Form der Rollenübernahme, die auf der Stufe des „play“ aufbaut. Mit „play“ ist eine konkrete Rollenübernahme gemeint; „play“ bezeichnet soziale Spiele, in denen das Kind sich in der Übernahme elementarer Rollen einübt. Hierbei spielt es in seiner Imagination sowohl die Rolle des Akteurs als auch die des komplementären Ko-akteurs einer sozialen Handlung. Bspw. spielt es Mutter und Kind und spricht aus den je verschiedenen Perspektiven und Bedürfnislagen auf die Situation; es spielt etwa sowohl die Rolle des hungrigen Kindes wie die der nährenden Mutter. Weitere Beispiele, die Mead anführt, sind die Komplementärrollen von Lehrer und Schüler oder Polizist und Verbrecher. In solchen konkreten Rollenübernahmen initiiert das Kind imaginäre Interaktionen; es übt für sich konkrete soziale Handlungsanforderungen ein, es erhält und erweitert mit solchen Rollenübernahmen seine Interaktionskompetenz. Mit „game“ ist bei Mead ein organisiertes und mit einem Regelwerk kodifiziertes Gruppenwettkampfspiel gemeint. Es erfordert, auf eine Situation nicht nur aus bestimmten konkreten Perspektiven heraus zu reagieren, sondern aus einer Verschränkung der Perspektiven aller Beteiligten im Spiel, aus der Rolle nicht eines konkreten Anderen, sondern aus der Rolle des „verallgemeinerten Anderen“ (generalized other). Hierbei ist nicht die konkrete Rolle des Einzelnen relevant, sondern seine Funktion, und diese kann prinzipiell von jedem anderen auch ausgefüllt werden. Es sind Formen des Spiels, in denen Spielregeln, und in sozialen Interaktionen gesellschaftliche Normen und Gruppenerwartungen internalisiert werden. Leider hat Mead die Entwicklung dieser in seiner Theoriebildung zentralen Fähigkeiten nicht mit zeitlichen Indizes versehen; es gibt keine Hinweise, ab welchem Alter Kinder die jeweiligen Fähigkeiten der konkreten und abstrakten Rollenübernahme erwerben. Diese Lücke läßt sich m. E. mit Hinblick auf Piagets Untersuchungen zur kognitiven Entwicklung des Kindes, zu seinen Untersuchungen über prä-operationales Denken (bei Kindern der Altersstufe von ca. zwei bis sieben Jahren), konkret-operationales Denken (bei Kindern im Alter von ca. sieben bis elf Jahren) und formal-abstraktes Denken (ab ca. zwölf Jahren), schließen. So ist die von Mead mit „Übernahme der Rolle des verallgemeinerten Anderen“ beschriebene Phase des „game“ erst möglich, wenn das Kind die Stufe des formalabstrakten Denkens, also im Alter von zwölf Jahren, erreicht hat. Präziser müßte man sagen: 11 erst ca. ab diesem Alter kann das Kind die Spielregeln als Konventionen verstehen und sie auch hypothetisch verändern. Natürlich spielen Kinder „games“ auch in einem früheren Alter; nur beachten sie dabei das Regelwerk eher als starr und unveränderlich. Schwieriger dagegen ist die Einordnung der als „play“ beschriebenen Phase: Spiele, in denen das Kind konkrete Rollen und deren Komplementärrollen einnimmt, durchziehen die gesamte Kindheit. Auf der Stufe des „play“ wird, im Gegensatz zum Wettkampfcharakter des „game“, ohne Gewinnabsicht gespielt; die Lust am Spielen ist Selbstzweck. Eine originelle Leistung des Meadschen Ansatzes liegt m. E. in folgendem: Während Entwicklungstheorien sonst entweder eine zunehmende Individualisierung des Kindes (Wygotski) oder eine zunehmende Sozialisierung (Piaget) konstatieren, macht er den Versuch, beide Aspekte zu verschränken; bei ihm laufen Sozialisation und Individuation parallel, sie sind einheitlich; in dem Maße, in dem das Individuum gesellschaftliche Institutionen verinnerlicht, entwickelt es eine besondere Identität. Fortschritt und Ausweitung der Rollenübernahmefähigkeit (Sozialisierung) bedeutet auch eine zunehmende Individualisierung. Die Fähigkeit, das eigene Handeln und die eigenen Absichten mit einer immer größer werdenden Zahl von Perspektiven verschränken zu können, integriert einerseits das Individuum immer besser in gesellschaftliche Zusammenhänge und verleiht andererseits dem Einzelnen immer deutlicher sein „persönliches Profil“. Frühe Bildung aus 4 Perspektiven zu thematisieren: 1. Gesellschaft: Ausbau und hohe Qualität der Frühpädagogik kann das Humanvermögen sichern und internationale Konkurrenzfähigkeit gewährleisten. 2. Kinder: Anspruch jedes Kindes auf Unterstützung und Anregung seiner Lernfähigkeit und Bildungspotenziale (z.B. Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz). 3. Familien: Familie erster und wichtigster Bildungsort; Forderung nach einer engeren Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Kita und der Familie. 4. Professionelle Praxis: Neue Formen der Aus- und Weiterbildung für Fachkräfte; Qualitätsstandards und Evaluationen pädagogischer Fördereinrichtungen.(Vgl. Liegle, 2006) An Bildung bzw. früher Bildung gekoppelte Zielsetzungen sind nicht immer die Ziele und Bedürfnisse der Kinder; „Deutschland braucht mehr Kinder“; darin stimmen viele Rentenexperten, Bevölkerungswissenschaftler, Politiker etc. überein; sind das jedoch auch Ziele der Kinder oder werden Kinder hier instrumentalisiert für andere Ziele? 12 Vielfach werden Kinder für sog. „höhere“ Ziele instrumentalisiert: Z.B. Wettbewerbsfähigkeit einer Gesellschaft; sind das kindliche Bedürfnisse? In der Vorschule wird das Kind „fit“ gemacht für die nächsthöhere Institution, die Grundschule; in der dann wiederum für das Gymnasium; in dieser dann für die Universität etc. D.h. die jeweils mächtigere Institution diktiert die Anforderungen in den jeweiligen Bildungseinrichtungen. Vielleicht wollen Kinder einfach mehr Spielflächen als straffere Bildungspläne und Curricula. Deshalb müssten Bildungsoffensiven in erster Linie an den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder ansetzen (Vgl. Liegle, 2006, S. 9). Was die Investitionen in die frühe Bildung betrifft, so scheinen Grundschulkinder und Kindergartenkinder in Deutschland im internationalen Vergleich stark unterfinanziert zu sein: dagegen sind die Pro-Kopf-Ausgaben in den Siegerstaaten in der OECD- Schulleistungsstudien umso höher, je jünger die Kinder sind (Vgl. Liegle, S. 142). Gegenwärtig wird der Frühförderung viel Aufmerksamkeit geschenkt; Kinder sollen in der Kita kognitive Anregungen bekommen, die die familiären ergänzen und unterstützen, und nicht nur sich still beschäftigen, bis die Eltern sie wieder abholen. Wieweit jedoch Erzieherinnen angemessen qualifiziert sind, um die kognitive Frühförderung zu gewährleisten, ist in Studien umstritten. Subjektive Orientierungen von Erzieherinnen: Diese sind häufig geleitet von bestimmten Analogien, Bildern, Mythen und Narrativen und Kasuistiken, die alle eher eine „Logik des Unscharfen und Ungefähren“ markieren und die Erzieher häufig unter Zeitdruck, Risiko sowie Bedingungen der Komplexitätsreduktion durchführen müssen. Pädagogische Qualität von Bildungseinrichtungen unter drei Aspekten zu betrachten (Tietze et al., 1998): a) Strukturqualität bzw. Rahmenbedingungen der Einrichtung b) Prozessqualität (wie etwa Kind-Betreuer-Verhältnis etc.) und c) Orientierungsqualität: pädagogische Programmatik. Implizite Annahme von Bildungsansätzen: Die dahinter stehenden Absichten können mit den genannten Mitteln in einer bestimmten Situation und bei einem bestimmten Kind auch erzielt werden. Zwar können Programme bestimmte Wirkungen entfalten, jedoch sind diese Wirkungen manchmal auch programmunspezifisch. 13 Weitere Schwierigkeit: junge Menschen brauchen keine am Ideal, oder am Durchschnitt orientierte Pädagogik, sondern eine, die auf ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche sowie ihre sozialen und kulturellen Kontexte zugeschnitten sind. Deshalb sollten pädagogische Programme auch stets auf die impliziten Kindheitsentwürfe hin betrachtet werden, die unausgesprochen mitthematisiert werden (Honig, M.-S. (2003) Institutionen und Institutionalisierung. In: L. Fried et al. (2003). Pädagogik der frühen Kindheit (S. 86-121). Beltz: Weinheim.) Die in Forschung und öffentlichem Diskurs bisher historisch wenige beachtete Institution des Kindergartens erklärt sich Martina Löw aus einer doppelten Abwertung: 1. Kindergarten ein typischer Frauenbereich, 2. Es handelt sich um Kinder (in der kapitalistischen Logik um nicht-produktive Mitglieder), Darüber hinaus vermutet Löw (2003), dass das spezifische Geschlechterverhältnis bereits im Kindergarten konstituiert werde: Exemplarisch erwähnt sie eine Studie in Australien (Bronwyn Davies, 1992), dass im Kindergarten bei der Lektüre von Märchen die Mädchen lernen, sich sowohl mit weiblichen als auch mit männlichen Helden zu identifizieren; die Identifikation mit weiblichen Heldinnen bei Jungen aber geringer sei. Auch gegenwärtig würden Filme von Heldinnen nur von Mädchen angeschaut, während Filme mit (männlichen) Helden beide Geschlechter faszinierten. Im Kindesalter werde so eine Einteilung der Welt in „männlich und weiblich“ gelernt. Kinder – aber generell Menschen- sind nicht die Summe ihrer realisierten und gewussten Möglichkeiten- sondern auch die Summe ihrer (noch) nicht realisierten Möglichkeiten des Selbstseins. Nach Bernfeld hat der professionelle Erzieher es immer mit zwei Kindern zu tun: Mit dem Kind vor sich und mit dem (verdrängten) Kind in sich. Wie sieht es bspw. aus, wenn Betroffene selber befragt werden, ob und warum sie einen Kindergarten brauchen: Bei einer Befragung von 50 Kindern im Alter von 4-bis 6 Jahren äußerten diese sich wie folgt (Vgl. Liegle, 2006): 4 Kinder: Wir brauchen keinen Kindergarten; keine Gründe genant. 25 Kinder: Ja, wir brauchen einen Kindergarten; Gründe u.a.: „Fahrrad fahren, Bücher lesen, Kochtage machen; den Freund Tim sehen; mehr Freunde bekommen“. 9 Kinder: Wir brauchen den Kindergarten, weil die Erwachsenen (bzw. die Eltern) keine Zeit haben und arbeiten gehen. 14 6 Kinder: Wir brauchen eine Kita, damit wir dort lernen und in die Schule gehen können. Andere: diffuse Antworten („Eltern haben Kopfweh“) Wie können generell kindliche Weltdeutungen wissenschaftlich erforscht und rekonstruiert werden? 1. Gezielte Gespräche und Interviews mit den Kindern; 2. Interpretation von Kinderzeichnungen (z.B. Familie in Tieren von Brem-Gräser), sowie projektive Methoden, 3. Auswerten schriftlicher Dokumente, die von Kindern verfasst worden sind. 4. Beobachtung von Kindern und Videoaufzeichnungen, 5. Experimentelle Methoden (z.B. Fremde-Situations-Test zur Erfassung der Bindungsstile), 6. Phänomenologisch orientierte teilnehmende Erfahrung und Begleitung von Kindern. (Vgl. Liegle, 2006). Ein weiterer geisteswissenschaftlicher Zugang: Literarische Berichte: So wird bspw. die Bedeutung der frühen Kindheit in dem ersten psychologischen bildungsbiographischen Romans von Karl Philipp Moritz sehr deutlich: Über Anton Reiser, dem Protagonisten der Geschichte, der aus einer unglücklichen Ehe hervorgeht, wird berichtet. „Unter diesen Umständen wurde Anton geboren, und von ihm kann man mit Wahrheit sagen, daß er von der Wiege an unterdrückt ward. Die ersten Töne, die sein Ohr vernahm und sein aufdämmernder Verstand begriff, waren wechselseitige Flüche und Verwünschungen des unauflöslich geknüpften Ehebandes. Ob er gleich Vater und Mutter hatte, so war er doch in seiner frühesten Jugend schon von Vater und Mutter verlassen, denn er wußte nicht, an wen er sich anschließen, an wen er sich halten sollte, da sich beide haßten und ihm doch einer so nahe wie der andre war. In seiner frühesten Jugend hat er nie die Liebkosungen zärtlicher Eltern geschmeckt, nie nach einer kleinen Mühe ihr belohnendes Lächeln. Wenn er in das Haus seiner Eltern trat, so trat er in ein Haus der Unzufriedenheit, des Zorns, der Tränen und der Klagen. 15 Diese ersten Eindrücke sind nie in seinem Leben aus seiner Seele verwischt worden und haben sie oft zu einem Sammelplatze schwarzer Gedanken gemacht, die er durch keine Philosophie verdrängen konnte“. Ungünstiges Erziehungsmilieu, frühe Vernachlässigung und Traumatisierung und dennoch die Möglichkeit, sich zu bilden, wesentliche Topoi in Moritz` Roman. 16 Schule: Gesellschaftliche Funktionen von Schule nach Fend (Helmut Fend (1980, 2. Aufl. 1981). Theorie der Schule. München: Urban & Schwarzenberg) 1) Qualifikationsfunktion Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen, die zur Ausübung von konkreter Arbeit und zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nötig sind. Reproduktion und Wettbewerbsfähigkeit einer Gesellschaft sollen erhalten und die dazu notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten über Generationen weitergegeben werden. 2) Allokations- und Selektionsfunktion Das Schulsystem dient der Verteilung- durch Leistungsvergleiche und Prüfungen und Abschlüsse- auf die verschiedenen sozialstrukturellen Positionen einer Gesellschaft. 3) Legitimationsfunktion Schulsysteme sind Instrumente der gesellschaftlichen Integration. In ihnen ist die Reproduktion von den Normen, Werten und Interpretationsmustern institutionalisiert, die zur Sicherung der Herrschaftsverhältnisse dienen. 17 Kritisch zu der Frage, ob die Funktionen auch stets erfüllt werden: 1. Qualifikationsfunktion dadurch eingeschränkt, dass Bildungsprozesse langfristige Investitionen sind, Anforderungen des Wirtschaftssystems jedoch kurzfristig wandeln. 2. Allokations- und Selektionsfunktion: Zuweisung in Berufe erfolgt in der Praxis vielfach über geschlechts- und andere spezifische Bahnen; Prüfungen haben nur einen legitimatorischen und nur bedingt einen objektiv differenzierenden Charakter. 3. Integrations- und Legitimationsfunktion: Bildungserfolg macht eher mit den Werten der Mittelschicht vertraut; Pluralisierung der Lebensformen wird zu wenig berücksichtigt. Aus der Kritik an der Schule sind deshalb seit längerem Forderungen laut geworden, dass der Staat sich aus Entscheidungen zurückhalten solle und Schule autonom bzw. teilautonom sein solle. Als Gründe hierfür werden erwähnt: 1. Entlastung der öffentlichen Haushalte (durch Druck, effizient wirtschaften zu müssen) und finanzielle Selbstbestimmung der Schulen. 2. Wahlmöglichkeit der Eltern werden erweitert; Konkurrenz zwischen den Schulen bei ihren Bildungsangeboten wird stimuliert; 18 3. Autonome Schulen könnten effizienter in der Umsetzung ihrer Programme sein; lange Verwaltungswege blieben erspart. (Vgl. Löw, 2003) Was meinen Sie: Wie viel Autonomie sollte Schulen zugestanden werden? Bildung und Hochschule: Die Institution Universität entsteht in Europa im 12. und 13. Jahrhundert; die ersten Universitäten werden zwischen 1158 und 1222 in Bologna, Vicenza und Padua gegründet. 1224 wird die erste Staatsuniversität in Neapel durch Kaiser Friedrich II von Hohenstaufen gegründet; im Jahre 1348 wird in Prag auf deutschem Territorium von Karl IV die erste Universität ins Leben gerufen. Der größte Teil der Lehrenden sind noch Geistliche oder werden Geistliche, um Universitätslehrer zu werden. Die gegenwärtige Praxis, eine Rangliste unter den potentiellen Kandidaten (eine „Dreierliste“) für eine Professur dem Ministerium vorzulegen, geht auf die Praxis zurück, eine Dreierliste bei der Berufung eines Bischofs zu erstellen, und diese nach Rom in den Vatikan zu entsenden (Vgl. Löw, 2003). Auch die Form des Unterrichts, die „Vorlesung“ hat seine mittelalterlichen Wurzeln: Die Vorlesungen dienten, ein Buch öffentlich vorzulesen und dieses zu kommentieren, da die meisten Studierenden sich schlichtweg Bücher nicht leisten konnten und die Vervielfältigung äußerst kompliziert war (noch kein Buchdruck). Immer mehr haben Fürsten versucht, sich dem kirchlichen Einfluss zu entziehen, indem sie eigene Universitäten gründeten, bei dem sie dann die Professoren selber bezahlten, und auch die Unterrichtssprache der Landessprache angepasst war (nicht mehr das Latein, das nur für eine kleine Elite vorbehalten war). Dadurch entstanden zum einen eine Nationalisierung und eine Verweltlichung der universitären Lehre. Auch die Humboldtsche Idee ist ein Versuch, durch einen emphatischen Bildungsbegriff das Bürgertum und die deutsche Nation zu stärken; Frauen spielten auch hier kaum eine Rolle; erst seit 1908 sind Frauen zum Studium an der Universität zugelassen. Die Institution Universität trägt auch heute noch „mittelalterliche“ und „vorkapitalistische“, lokal angebundene Züge. Während im Zeichen der Globalisierung und Mobilität die Logik von Unternehmen es ist, zu expandieren, sehen wir kaum „Filialen“ von erfolgreichen universitären Bildungsstätten wie etwa der Harvard-Universität, der Oxford Universität, der Universität Wien etc. Vermutet wird dahinter ein extremes Sicherheitsbedürfnis und das 19 Motiv, die Reputation und Langlebigkeit einer Institution nicht zu gefährden. Anhäufung von symbolischem Kapital, weniger materiellem Kapital ist distinguierend. (Vgl. Löw, 2003). Das wissenschaftliche Ethos ist dabei, wie Merton in seinen wissenschaftssoziologischen Untersuchungen zeigt, von vier affektiv durchzogenen Normen und Werten geleitet: Zunächst besteht das „Ziel von Wissenschaft“ in der „Erweiterung abgesicherten Wissens“. „Wissenschaft“ bezeichnet im Allgemeinen: 1. einen Komplex spezifischer Methoden zur Wissenssicherung 2. einen Vorrat an akkumuliertem Wissen aus der Anwendung dieser Methoden. 3. einen Komplex kultureller Werte und Verhaltensmaßregeln (das Ethos) 4. beliebige Kombinationen der genannten Momente (Vgl. Robert King Merton: Entwicklung u. Wandel v. Forschungsinteressen. Aufsätze zur Wissenschaftssoziologie. Frankfurt: Suhrkamp, 1985). Das Ethos der Wissenschaft Merton identifiziert vier „Komplexe solcher institutionalisierten Imperative“, die alle funktional (und zweckmäßig) auf die Verfolgung des „Ziels der Wissenschaft“ ausgerichtet sind. Es sind zuallererst institutionell verankerte Normen, die darüber hinaus vom einzelnen Wissenschaftler internalisiert worden sein können: 1. Universalismus: Wahrheitsansprüche, gleich welcher Herkunft, müssen vorab aufgestellten, unpersönlichen Kriterien unterworfen werden, und dem Talent darf die Chance zu einer Karriere in der Wissenschaft nicht verwehrt werden. 2. „Kommunismus“: Wissenschaftliche Erkenntnisse sind allgemeiner Besitz und gehören nicht nur ihrem Entdecker bzw. Produzenten. Ihm kommt stattdessen das Ansehen der Gemeinschaft zu. Geheimhaltung und Patentierung wissenschaftlicher Erkenntnisse sind daher aus wissenschaftsimmanenten Gründen zu verurteilen. 3. Uneigennützigkeit (disinterestedness) Der Wissenschaftler darf sich bei seiner Arbeit nicht von persönlichen Interessen zu unlauteren Mitteln wie der Täuschung hinreißen lassen. 4. Organisierter Skeptizismus Glaubensüberzeugungen werden unvoreingenommen geprüft anhand empirischer und logischer Maßstäbe. Bestimmte (herkömmliche) Urteile und Ansichten werden dafür zeitweilig außer Kraft gesetzt. (Vgl. Merton, 1985). 20 Diskrepanzen zwischen den wissenschaftlichen und den gesellschaftlichen Normen: Einerseits kann die Gesellschaft sich den wissenschaftlichen Normen widersetzen (z.B. Ethnozentrismus), andererseits kann aber auch die Gemeinschaft der Wissenschaftler selbst gegen sie verstoßen (z.B. Aneignung von Kastenstandards), was ein Eingreifen durch die Gesellschaft (d.h. den Staat) notwendig macht. Darüber hinaus auch widersprüchliche Anforderungen im Leben von Wissenschaftlern: Kampf um Individualität (Anerkennung der eigenen Gedanken, Erfindungen und Entdeckungen) sowie das Ethos der Bescheidenheit als Wissenschaftler (sich als Person nicht sehr wichtig zu nehmen). (Vgl. Löw, 2003). Zwar wird hier verallgemeinernd von Wissenschaft gesprochen; ein genauer Blick in den universitären Alltag zeigt, dass sich – statt einer Wissenschaftskultur- vielmehr sogenannte „Fachkulturen“ sowohl bei den Professoren als auch bei Studierenden bilden. So ist in einer Untersuchung festgestellt worden, dass Architekturstudierende und Dozenten bspw. sich anders kleiden (eher schwarz) als Erziehungswissenschaftler (leger, bunt); die Möbel in den Wohnungen anders sind (eher 2. Hand bei Erz. wiss.); die Studienräume häufig bemalt sind und bereits in den ersten Semestern die Erziehungswissenschaftlern Zeichen einer Oppositionskultur signalisieren. (Vgl. Löw, 2003) 21 Schule und Schulleistungsstudien: Historisch betrachtet waren in Europa zwei gesellschaftliche Entwicklungen für eine Generalisierung der Institution Schule verantwortlich: 1. Das Militär: Die Kommunikation in einer modernen Armee war auf Lesekompetenz und Schriftlichkeit angewiesen; 2. Die Protestantische Kirche: Unmittelbarkeit zu Gott durch die Lektüre der heiligen Schrift; insbesondere in den skandinavischen Ländern war ab dem 18. Jahrhundert eine recht starke von der Kirche unterstützte Lesekultur ausgebildet (Vgl. Jürgen Baumert: Deutschland im internationalen Bildungsvergleich. In: N. Killius u.a. (Hg.), Die Zukunft der Bildung. Suhrkamp, Frankfurt, 2002). Gelernt wird in vielen Lebenskontexten; gegenüber dem Alltag liegen jedoch die Vorzüge des schulischen Lernens in folgendem: 1. Systematik 2. Langfristigkeit, 3. Kumulativität. Universelle Strukturelle Merkmale der Institution Schule: 1. Anspruch, Entwicklungsprozesse auf Dauer zu stellen. 2. Institutionalisierung einer Abfolge von leistungsthematischen Situationen, in denen je spezifische Aspekte, und nicht der „ganze“ Mensch im Vordergrund stehen, so etwa bspw. als Lernender in Englisch mit seinen Englischkompetenzen, in Mathe mit Mathematikkompetenzen, nie jedoch als gesamte Person. 3. Doppelter Zeithorizont der Schule: Kumulatives Lernen in der Gegenwart für die Zukunft; die Frage, ob das „jetzt“ Gelernte auch jetzt relevant ist, wird kaum thematisiert; Lerninhalte für eine „ungewisse Zukunft“ hin konzipiert. 4. Primat des Kognitiven in der Schule (insbesondere mit steigenden Schulzeit); Fragen der ethischen, ästhetischen Bildung nachrangig gegenüber der reflexiven Durchdringung von Welt. (Vgl. Baumert, 2002) Gegenwärtige basale Kulturwerkzeuge, ohne deren Beherrschung Aneignung kultureller Produkte fast unmöglich erscheint: Beherrschung der Verkehrssprache mathematische Modellierungsfähigkeit zunehmend fremdsprachliche Kompetenz IT-Kompetenz 22 Selbstregulation des Wissenserwerbs Vergleichende Schulleistungsstudien versuchen, quasi als Systemmonitoring, auf die Erfassung der beschriebenen Basiskompetenzen: Die Grundstruktur der Allgemeinbildung und des Kanons skizziert Baumert (2002), einer der gegenwärtig führenden Bildungsforscher (PISA) wie folgt: PISA-Studie und ihre Ergebnisse: Während bei PISA (2000) die Lesekompetenzen im Mittelpunkt standen, wurden bspw. bei TIMMS die mathematischen Kompetenzen erfasst. Als Grundzüge einer mathematischnaturwissenschaftlichen Grundbildung wurden dabei folgende Annahmen gemacht: (Vgl. Baumert, 2002): Zur mathematischen Grundbildung gehört insbesondere die Fähigkeit, die Anwendbarkeit mathematischer Konzepte und Modelle auf die alltäglichen Problemstellungen zu erkennen. Spezifisch handelt es sich dabei um die Fähigkeit zu beurteilen, ob Sachverhalte mathematisch modellierbar sind oder nicht. Darüber hinaus gehört die Fähigkeit, die einem Problem zu Grunde liegende adäquate, angemessene mathematische Struktur zu erkennen. 23 Als eine weitere Dimension wird die Fähigkeit betrachtet, Aufgabenstellungen in geeignete Operationen zu übersetzen. Zuletzt verlangt eine mathematische Grundbildung auch eine ausreichende Kenntnis und Beherrschung von Lösungsroutinen. In diesem Grundbildungskonzept wird die Abarbeitung von Kalkülen und Algorithmen nicht über Bord geworfen, sondern in einen sinnstiftenden Kontext eingeordnet. (Vgl. Baumert, S. 118). Bei einer ländervergleichenden Betrachtung zeigt, dass insbesondere in Deutschland die Schüler bei den mathematischen Kompetenzen relativ schlecht abgeschnitten haben: Die Gruppe der schwächsten ausgeprägten Kompetenzen (Grundschulniveau) war mit 15.4% bei den deutschen Schülern am stärksten ausgeprägt. Wie sind die Kompetenzstufen im Einzelnen erfasst worden? Hier seien einige Beispiele aufgeführt. Kompetenzstufe I: 24 Bei der deutschen Stichprobe lag die Lösungswahrscheinlichkeit bei dieser Aufgabe für 18Jährige bei 86 Prozent. 14 Prozent unterläuft ein typischer Fehler; sie denken, mehr Schritte seien automatisch größere Schritte. Kompetenzstufe II: Bei einer Wahl in einer Schule mit drei Kandidaten bekam Jan 120 Stimmen, Maria erhielt 50 Stimmen und Georg 30 Stimmen; welchen Prozentsatz der Gesamtstimmen bekam Jan? Wie ist das Ergebnis? 60%. Kompetenzstufe III: 25 Lösung: A ist günstiger: 800 x 12 = 9600 Zeds B: 110 x 900 = 9900 Zeds Kompetenzstufe IV: Lösung (u.a.): 46m x 30m=1380 qm Bei der Schülerbefragung zum Mathematik- und Physikunterricht zeigte sich in Deutschland, dass aus Schülersicht der Mathematikunterricht recht variationsarm und stark rezeptiv ist und insbesondere darin besteht, dass die Lehrkraft zunächst den Gedankengang entwickelt und dann die Schüler diesen Gedankengang mittels zunächst einfacher Aufgaben anwenden. Ein gemeinsames, bspw. auch an typischen Fehlern etc. orientiertes Lernen kam selten zum Einsatz. In den fragend-entwickelnden Unterrichtsteilen neigten die Lehrer sowohl die ganz falschen als auch die ganz richtigen und sofort zutreffenden Antworten eher beiseite zu schieben, da sie eine bestimmte Reihenfolge des Verlaufs entworfen hatten; insgesamt, so schlußfolgert bspw. Baumert, läge die Schwäche dieses Unterrichts im Umgang der Lehrkräfte mit Differenz. (Vgl. Baumert, 2002). Darüber hinaus zeigen sich in den Schulleistungsstudien, dass Schülererfolg insbesondere in Deutschland sehr stark von elterlichem „Bildungskapital“ bzw. Fördermöglichkeiten abhängt. 26 Die Autoren der PISA Studie haben berechnet: Die Chance eines Jugendlichen aus einem Facharbeiterhaushalt, das Gymnasium statt eine andere Schulform zu besuchen, beträgt 3:17; für Jugendliche aus Familien der oberen Dienstklassen beträgt diese Chance annähend 1:1. Darüber hinaus ließ sich bei der ersten PISA-Untersuchung feststellen, dass fehlende Lesekompetenzen die Leistungen aller Schüler schmälerten, während bei einer Verminderung der sozialen Disparitäten das Gesamtniveau steigt; ohne Einbußen bei der Leistungsspitze (Vgl. Löw, S. 66). -- Migrantenkinder und ihr Scheitern an den Bildungsinstitutionen-Migrantenkinder und Jugendliche im Bildungskontext In den Sonderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen sind Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund deutlich überrepräsentiert (Kornmann, 2003). Auch schließen sie im Vergleich zu deutschen Jugendlichen häufiger ihre Schullaufbahn ohne einen Hauptschulabschluss ab; und wenn sie einen Abschluss machen, so sind sie im Vergleich zu Absolventen mit einem Abschluss in Realschulen oder Abitur mit nur lediglich Hauptschulabschlüssen deutlich überrepräsentiert (Granato, 2003). Seit Ende der 90-er Jahre schwankt der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund um 9.5% bis 9.8% in allgemein bildenden Schulen. Zwar zeigt die Entwicklung, dass ihr Bildungserfolg angestiegen ist: so haben bspw. 1989/90 gerade mal 6.4% der Migrantenjugendlichen das Abitur geschafft; 2001/2002 waren es schon etwa 10%. Nach Geschlechtern aufgeteilt, zeigt sich sogar, dass Mädchen erfolgreicher sind als Jungen. Allgemein kann eine steigende Bildungsbeteiligung bei fortdauernder Bildungsbenachteiligung festgehalten werden: Die Zahl der ausländischen Schüler ohne Abschluss ist vom 30 % zu Beginn der 80-er Jahre auf knapp 20% bei den männlichen und ca. 16% bei den weiblichen Jugendlichen mit MH (gegenüber 8.2% bei deutschen Jugendlichen) im Jahre 2001/2002 eindeutig gesunken. Nach wie vor scheint jedoch der Übergang von der Grundschule auf ein Gymnasium eine entscheidende Hürde zu sein: dreimal so viele deutsche Kinder schaffen diesen Übergang im Vergleich zu Kindern mit MH; je nach Bundesland ist die Widerholerrate bei Kindern mit MH doppelt oder viermal so hoch; fast doppelt so viele Jugendliche mit MH – im Gegensatz zu deutschen Jugendlichen verlassen die Schule mit nur einem Hauptschulabschluss: 40 % bei Migrantenjugendlichen gegenüber 24 % bei deutschen Jugendlichen. 27 Die Bildungsnähe der Eltern, vorhandene bzw. fehlende Unterstützung im Elternhaus wirken sich stärker auf die sprachliche Bildung der Kinder aus als die sprachlich-kulturelle Herkunft. Mit Blick auf den familialen Hintergrund lassen sich folgende Bildungsbeteiligungen aufzeigen: Tab.: Bildungsbeteiligung von Migrantenkindern nach familialem Hintergrund: PISA 2000: 60 HS/BS 50 RS 40 30 Gymn. 20 Int Ges. 10 0 Beid. Elt. in D Ein Elt. in D Kein Elt. in D Fam. mit MH gesamt (HS: Hauptschule; BS: Berufsschule; RS: Realschule; Int Ges: Integrierte Gesamtschule) Im internationalen Vergleich zeigt sich für Deutschland eine sehr enge Kopplung zwischen sozialer Herkunft und schulischen Kompetenzen (Vgl. PISA, 2003); Deutschland ist mit Abstand die Nation, in der Schülerleistungen stark von häuslichen sozioökonomischen Variablen abhängen. Dieser Befund hat einige Autoren verleitet, davon zu sprechen, dass wenn Schüler mit Migrationshintergrund dennoch bildungserfolgreich sind, dies nicht wegen, sondern trotz der (Migrantenkinder) benachteiligenden Schule erfolgt (Menke, 2003). Individualisierende Bildungs- und Leistungsideologien verkennen häufig, so bspw. Radtke und Dittrich, die institutionelle Diskriminierung bzw. Benachteiligung von Migranten in Bildungskontexte. Intelligenztest-Ergebnisse von Migrantenkindern in Deutschland variieren mit der Dauer des Aufenthalts: Nach Knöckel (1996; zitiert nach Heller et al., 1998, S. 17) besteht eine Korrelation zwischen SPM-Ergebnis und Dauer des Aufenthalts in Deutschland von r=.60 bei Kindern ausländischer Herkunft (Türkei, Italien, Jugoslawien), die Mittelwertsunterschiede zwischen deutschen bzw. in Deutschland aufgewachsenen Kindern und den frisch hinzugezogenen betrugen mehr als 1,5 Standardabweichungen (14 SPM-Rohwert-Punkte). Nicht ganz so hohe Zusammenhänge mit Einreisealter (r=.33) und Aufenthaltsdauer (r=.38) fand Taschinski (1985) in den 80er-Jahren bei türkischen Kindern, der Effekt bestätigte sich aber: Je länger Schüler durch das hiesige Schulsystem beschult wurden und je länger sie in 28 Mitteleuropa lebten, desto höher war ihre durchschnittliche Intelligenz. Zwar sind die genauen Kausalfaktoren nicht eindeutig beweisbar, die Zusammenhänge zwischen Schuldauer, Beschulungszeitpunkt und Intelligenz der Kinder und damit auch ihrem Ausbildungs- und Berufserfolg werden aber eindeutig belegt. Es scheint aber weniger die Sprachherkunft oder genauer die sprachliche Distanz (Verschiedenheit in Lexik, Grammatik und Pragmatik) zwischen Deutsch und der eigenen Muttersprache relevant zu sein, sondern die Sprachherkunft ist Indikator für unterschiedliche Bildungsnähe der Herkunftsfamilien weitgehend unabhängig von Sprache, Staatsbürgerschaft, Nationalität und ethnisch-rassischer Zugehörigkeit. Bildungsnähe im Sinne von Bildungsniveau der Eltern, Aspirationen, Interessen, Unterstützung, Anregungen, Kontrolle und Förderung im Elternhaus, die Kinder in unterschiedlichem Ausmaß erleben, hat vermittelt über diese Merkmale Auswirkungen auf die Fähigkeitsentwicklung (Zimmermann & Spangler, 2002). Hinzu kommen Sprach- und Verständnisprobleme im Unterricht nicht nur bei frisch hinzugewanderten Kindern und Jugendlichen. Bei später zugewanderten Schülern gibt es zusätzlich noch spezifische Schulwissenslücken. Insbesondere die niedrigen Leseleistungen von Kindern aus Migrantenfamilien bei der PISAStudie konnten statistisch auf einen niedrigen sozioökonomischen Status, kurze Verweildauer in Deutschland sowie auf die Verwendung einer nichtdeutschen Umgangssprache in der Familie zurück geführt werden. Allerdings sind im internationalen und nationalen Vergleich deutliche Unterschiede zwischen Aufnahmeländern erkennbar: Migrantenkinder erreichen in Bayern deutlich bessere Schülerkompetenzen als in Bremen und Nordrhein-Westfalen. Über gleiche Sprachgruppen hinweg erreichen in Deutschland Migranten deutlich schlechtere Schülerkompetenzen als in Skandinavien oder in den Alpenländern. Individuelle kognitive Fähigkeiten erweisen sich auch als kulturelle und gesellschaftliche Leistung des Aufnahmelandes und der Herkunftsländer. Bei den Ergebnissen nationaler und internationaler Vergleichsstudien soll noch auf ein gravierendes Problem hingewiesen werden: die Schulkompetenzen und -leistungen von „Migrantenkindern“. „Ausländer“ werden je nach Studie unterschiedlich definiert, als Schüler mit ausländischem Pass, mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, als Kind von einem oder zwei Elternteilen, die nach Deutschland zugewandert sind (auch Aussiedler), als Kind von einem oder zwei Elternteilen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist oder Schüler aus 29 Familien, bei denen zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird (vgl. Definitionsvarianten bei Gogolin, 2002). Migration als eine spezifische Herausforderung für den Bildungskontext: Migration und sprachlich-kulturelle Vielfalt sind im Bereich der Bildung kein neues Phänomen, sondern durchzieht die gesamte Geschichte des 20. Jh. in Deutschland: So ergab bspw. eine Volkszählung von 1905, das etwa 12 % der Bevölkerung in Preußen in ihren Familien eine andere Sprache als Deutsch (Dänen, Polen, Sorben, Tschechen etc.) sprachen. Ab Mitte der 50-er Jahre hat diese Entwicklung mit der Anwerbung von „Gastarbeitern“ eine andere Dynamik bekommen. Lange Zeit, bis etwa Ende der 70-er Jahre wurde die Bildungsgeschichte von Migrantenkindern unter der Perspektive ihrer Rückkehr betrachtet und Bildungsanstrengungen betrafen nicht so sehr ihre Integration in das deutschen Schulleben, sondern eher die Reintegration in die Herkunftsländer; deshalb die Förderung der Rückehrfähigkeit durch Etablierung eines muttersprachlichen Unterrichts in der Schulen (Vgl. Krüger-Pontratz, 2006). Ab den 80-er Jahren findet ein Paradigmenwechsel von der „Ausländerpädagogik“ zur „interkulturellen Pädagogik“ statt, weil die Evidenz immer erdrückender wird, das auch in Zukunft Kinder mit Migrationshintergrund ein fester Bestand des deutschen Bildungssystems sein werden. Dennoch herrscht in Schulkontexten nicht selten eine kulturalistische bzw. kulturalisierende (d.h. Unterschiede in der Lebenswelt des Einzelnen auf seine bzw. auf die kulturellen Wurzeln der Eltern des Schülers) zurückführende, von einer Mitleidspädagogik geprägte Haltung vor (Schanz, 2006). Da reichen auch einzelne Projekttage oder Projektwochen zum Thema „interkulturelles Zusammenleben“, in der dann die „Fremden“ im Mittelpunkt stehen, nicht aus; vielmehr ist auch Interkulturalität als Mainstream-Aufgabe zu verstehen. Der pädagogische Diskurs im Alltag von den „ausländischen Kindern“ erzeugt auf einer sprachlichen Ebene aufs Neue die Vorstellung, es handelt sich um „Fremde“, die nicht dazu gehören, obwohl vielfach die Kinder hier geboren sind und womöglich auch einen deutschen Pass haben. Hierbei wird häufig der Begriff der institutionellen Diskriminierung für die Erklärung der Benachteiligung/Misserfolg gebraucht. Der Begriff stammt aus der „Black Power“ Bewegung in den 60-er Jahren in den USA und meint, dass Diskriminierungsprozesse nicht nur auf der 30 Ebene des Handelns von einzelnen Institutionen zu finden sind, sondern im organisatorischen Handeln bzw. Netzwerk wie etwa Arbeitswelt, Ausbildungsmarkt, Polizei, Wohnungsmarkt etc. Die Stoßrichtung der Kritik dort war, dass in den zentralen gesellschaftlichen Institutionen die Interessen und Einstellungen der „Weißen“ inkorporiert sind. Dabei wird in der Literatur zwischen direkter institutioneller und indirekter Diskriminierung unterschieden. Während die direkte Diskriminierung Prozesse des regelmäßigen intentionalen Handelns bezeichnet (z.B. Vorschriften, Erlasse, die bestimmte Gruppierungen benachteiligen), wird mit indirekter institutioneller Diskriminierung auf die Bandbreite der institutionellen Vorkehrungen Bezug genommen, bei dem Angehörige bestimmter Gruppen, wie etwa ethnische Minderheiten, überproportional negativ betroffen sind. Dabei resultiert indirekte Diskriminierung häufig aus der Anwendung gleicher Regeln, wobei jedoch verschiedene Gruppen ungleiche Chancen zu ihrer Erfüllung haben. Prozesse institutioneller Diskriminierung sind in der Regel kaum direkt beobachtbar; sind oft normale Alltagskultur, Routine und Habitus von Institutionen und deshalb von den dort tätigen Professionellen kaum hinterfragbar (Gomolla, 2006). Als Gründe für Bildungserfolge bzw. Bildungsbenachteiligung werden auf Seiten der Schüler folgende Aspekte hervorgehoben: Verlauf des Migrationsprozesses, Sicherheit des Aufenthaltsstatus soziale Herkunft bzw. Sozialstatus im Aufnahmeland Bildungsbiografie der Eltern Gegenwärtiges Wohnumfeld der Familie. Andererseits sind die Gründe des Scheiterns nicht nur auf der Schülerseite zu sichern, sondern auch in den Institutionen: denn im internationalen Vergleich zeigt sich, dass Zuwandererkinder mit einer ähnlichen Migrationsgeschichte in Ländern mit einer weniger selektiv ausgerichteten, z.B. in einigen Bundesländern bereits nach der 4. Klasse erfolgenden, Bildungsstrukturen und besseren Unterstützungssystemen deutlich bessere Schulleistungen erzielen. Darüber hinaus wird bildungspolitisch gefordert, dass die Institution Schule sprachlichkulturelle, ethnische und nationale Pluralität im Bildungswesens als eine Normalität anerkennen und die Orientierung an einer homogenen Schülerschaft, bei der Heterogenität als Abweichung fungiert, aufgeben muss (Vgl. Krüger-Potratz, 2006). 31 In einer europäischen Vergleichsstudie hat bspw. Allemann-Ghinda (1999) Schulen in vier europäischen Staaten nach ihrem Umgang mit Schülern mit Migrationshintergrund untersucht: in Deutschland, Schweiz, Frankreich und Italien. Im Einzelnen fokussierte sie auf Berücksichtigung der Herkunftssprachen, Maßnahmen für neu zugezogene Schüler, den Umgang mit Wertkonflikten, die Zweitsprachdidaktik und Lehrerfortbildungen. Im Ländervergleich zeigte sich, dass sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz die Förderung von Migrantenkindern ungünstiger war; es herrschten eher separierende Formen der Beschulung vor; eine Binnendifferenzierung der Schulen – wie etwa bilinguale Unterrichtsformen - war gering ausgeprägt. So hat Schanz bspw. die Erkenntnisse in einer Modellschule in Hannover, die interkulturelle Bildung in die Schulentwicklung zu implementieren versucht hat, systematisch zusammenzustellen: Folgende Prozesse bzw. Aspekte ließen sich dabei identifizieren: 1. Zunächst bedarf es einzelner oder einer Gruppe, das Kollegium von den Chancen eines Aufbruchs in der Schule zu überzeugen. 2. Einbeziehung einer Beratung von außen, die den Prozess langfristig begleitet. 3. Entwicklung einer Dialog- und Konfliktkultur im Kollegium, um sich darüber zu verständigen, was denn eine „gute interkulturelle Schule“ ist. 4. Implementierung der interkulturellen Bildung in die einzelnen Unterrichtsinhalte. 5. Kontinuierliche Unterstützung des Prozesses durch interne und externe Fortbildung. 6. Einbeziehung der Eltern, insbesondere der Eltern mit MH. 7. Öffnung der Schule nach innen (Unterrichtsinhalte, andere Lehrmethoden etc.) sowie nach außen (Dialog mit der Kommune). Ein generelles Problem in Schulen bildet folgendes Dilemma: Eine Vermeidung von Stereotypisierungen führt gelegentlich dann zu einer Differenzblindheit, wenn etwa Lehrer aus einer trivialen Universalismus meinen: „Ich nehme jeden so, wie er ist. Ich mache keinen Unterschied. Kinder sind Kinder.“ Denn in der Tat starten aber nicht alle mit gleichen Ausgangschancen die Schullaufbahn. 32 Guter Unterricht/ gute Lehre: Zunächst sind Sie gefragt: Ihre Schule hat gerade einen Preis bekommen, bei dem einige Ihrer Kollegen für die gute Lehre prämiert werden; es ist noch nicht klar, wer den Preis bekommen wird. Sie als junger Lehrer/in sitzen mit in der Kommission bei der Preisvergabe nächste Woche. Sie möchten sich darauf vorbereiten und stellen sich folgende Fragen: 1. Was müssen Sie wissen, um bei dem Treffen sachkundig argumentieren und eine faire Entscheidung treffen zu können? 2. Was zeichnet guten Unterricht aus? 3. Was sagt aus Ihrer Sicht hierzu die Forschung? (Vgl. Anita Woolfolk: Pädagogische Psychologie: Pearson: München, 2008). These: Guter Unterricht ist vom Lehrer abhängig. Eine Studie in den USA (Harme & Pienta, 2001), die Vorschulkinder bis zur achten Schulklasse beobachtet hat, zeigt, dass die Lehrer-Schüler-Beziehung in der Vorschule eine bedeutende Vorhersagekraft hatte, was Schulleistungen und Schülerverhalten betraf. Operationalisiert wurde die Beziehung über Ausmaß von Konflikten, Abhängigkeit des Kindes vom Lehrer, Zuneigung des Lehrers zum Kind. Trotz Kontrolle von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, kognitive Kompetenzen sagte die Beziehung einige Aspekte des Schulerfolges vorher. Insbesondere Problemschüler (Verhaltensauffälligkeiten in der Vorschule) profitierten am meisten von einer guten Beziehung und gutem Unterricht des Lehrers. Auch konnte gezeigt werden, dass Korrelationen zwischen Lehrerqualität und Schülerleistungen vorhanden waren: Schüler, die von fachlich gut qualifizierten Lehrern sowie von Lehrern, die ihr eigenes Studienfach unterrichteten, angeleitet wurden, hatten bessere Leistungen: (Vgl. Anita Woolfolk: Pädagogische Psychologie: Pearson: München, 2008). Einige Beispiele guter Lehrer aus der Praxis: Eine Grundschullehrerin mit 25 Kindern, die größtenteils einen Migrationshintergrund (in den USA) aufweisen (d.h. sie kommen aus der Dom. Republik, Nikaragua, Mexiko, Puerto Rico und Honduras): bei Schuleintritt sprachen die Kinder kein Englisch; am Ende des ersten Schuljahres wurden sie soweit gefördert, dass sie alle in eine Regelklasse wechseln konnten. Wie machte sie das? 33 Zunächst war der Unterricht auf spanisch, damit sie von allen Schülern verstanden wurde; allmählich ging sie ins Englische über. Auch ermutigte sie die Kinder, sich zu ihrer spanischsprachigen Herkunft zu bekennen sowie jede Möglichkeit zu nutzen, um englisch zu sprechen. Sie stellte allen Kindern ausreichend Material zur Verfügung; auch solchen Kindern, die von Zuhause aus mit wenig Stiften, Scheren, Blätter etc. versorgt waren. Sie setzte viel Musik und Rhythmik ein; betonte und intonierte besonders, damit die Kinder die englische Aussprache besser lernten und um ihre Schüler besser kennenzulernen, machte sie mindestens einmal im Jahr Hausbesuche bei ihnen. (Vgl. Anita Woolfolk: Pädagogische Psychologie: Pearson: München, 2008). Wer war ihr „guter Lehrer“? Beschreiben Sie ihn mal. Was müssen gute Lehrer können: 1. Sie müssen fachlich gut qualifiziert sein; ihr Fachgebiet systematisch kennen. Es reicht nicht allein, richtige und falsche Antworten der Schüler auseinander zu halten, sondern gute Lehrer, „Experten“, können auch hinter den unterschiedlich falschen Antworten der Schüler eine Systematik erkennen und auf diese besonderen Schwächen der Schüler eingehen. Darüber hinaus müssen sie folgende Qualifikationen mitbringen: (Vgl. Anita Woolfolk: Pädagogische Psychologie: Pearson: München, 2008). „Was ein guter Lehrer ist, das weiß doch der gesunde Menschenverstand“. Stimmt das immer? Typische Schul- und Unterrichtssituationen: 1. Situation: Welche Methode soll der Lehrer einsetzen, um Schüler für das Vorlesen im Unterricht auszuwählen? Antwort des gesunden Menschenverstandes: Je nach Zufallsprinzip die Schüler aufrufen, damit jeder darauf gefasst sein kann, jederzeit vom Lehrer aufgerufen zu werden und so mit voller Aufmerksamkeit dem Unterricht folgt. Bei einer bestimmten Reihenfolge könnten sich die Schüler ja ausrechnen, wann sie dran kommen und bis dahin eher weniger aufmerksam sein. Antwort der Forschung: 34 Ogden, Brophy & Evertson (1977) zeigten bereits vor längerer Zeit, dass bspw. in der ersten Klasse im Vorlesen die Schüler bessere Leistungen zeigten, wenn sie im Kreis der Reihe nach vorgelesen hatten; jeder Schüler sollte gleich viel lesen und gleich häufig Rückmeldung erhalten. (Vgl. Anita Woolfolk: Pädagogische Psychologie: Pearson: München, 2008). 2. Situation: Wann sollte der Lehrer leistungsschwachen Schülern helfen? Antwort des gesunden Menschenverstandes: Lehrer sollen ihre Hilfe oft anbieten, weil leistungsschwache Schüler selber nicht erkennen können, wann sie eine Hilfe brauchen und sich eventuell schämen, von sich aus nach Hilfe zu fragen. Antwort der Forschung: Graham (1996) stellte fest, dass Hilfen, die gegeben wurden, noch bevor der Schüler darum bat, eher kontraproduktiv waren. Die anderen Schüler nahmen an, dass der Lehrer diesem Schüler nicht zutraue, die Aufgaben selber zu lösen; ungünstigere Attributionsprozesse („Ich bin unfähig“) und geringere Leistungsmotivation waren die Folge. (Vgl. Anita Woolfolk: Pädagogische Psychologie: Pearson: München, 2008). 35 Was wünschen sich Schüler von einem „guten Lehrer“? Ratschläge einer ersten Klasse an ihre Lehrerpraktikanten und –praktikantinnen. (Vgl. Anita Woolfolk: Pädagogische Psychologie: Pearson: München, 2008). Wie kann der Lehrer Neugier wecken? (Vgl. Mietzel, S. 350ff). Generell entsteht Neugier dann, wenn Menschen mit Situationen konfrontiert werden, die ein mittleres Maß an Neuigkeit, Überraschung oder Unsicherheit enthalten. Es sind Situationen, die sich nicht ganz mit den bisherigen Wissensinhalten decken bzw. mit bisherigen Erfahrungen nicht vereinbar sind bzw. diese in „mittlerem Grade“ in Frage stellen. Neugier vereint zwei gegensätzliche Tendenzen: Situationen, die Unbekanntes enthalten, ziehen den Menschen einerseits an, anderseits sind wir auch bestrebt, uns davor zu distanzieren, weil sie auch stets als Unbekanntes gefährlich werden können; je nachdem, welcher der Impulse die Oberhand gewinnt, wird man sich entweder dem Neuen widmen oder das Neue ablehnen. Ähnliche Ergebnisse zeigt ach die Bindungsforschung: Exploration und Bindungswünsche sind ebenso zwei gegensätzliche Impulse. Für die Unterrichtssituation empfiehlt Brophy (1987) insbesondere in der Einstiegsphase, statt nüchterne Informationen über den Stoff zu liefern, möglichst viel Kontextinformationen einfließen zu lassen: „Stelle einen abstrakten Inhalt so dar, dass er persönlicher, konkreter 36 oder vertrauter wird. Definitionen, Prinzipien oder andere allgemeine oder abstrakte Mitteilungen haben für Schüler solange wenig Bedeutung, wie sie nicht in konkreter Form diskutiert werden“ (Mietzel, S. 356). Deshalb sollten Unterrichtsinhalte so konzipiert werden, dass darin Erfahrungen, Geschichten, Probleme vorkommen, die der Schüler in seine Lebenswelt übersetzen kann und die damit in Beziehung stehen. Es empfiehlt sich, bei bestimmte Fächern, Geographie, Geschichte, Sozialkunde etc. zuvor durch Fragebogen Informationen über Interessen, Kenntnisse (wer z.B. in welchem Land war, welche Hobbies hat etc.) der Schüler einzuholen und diese in die Konzeption des Unterrichts einfliesen zu lassen, um Bekanntheit und dadurch Interesse zu wecken. (z.B. das Projekt „Jasper Woodbury“). Statt an einer sozialen Bezugsgruppe mit Leistungsrückmeldung über Notengebung zu orientieren, wird aus pädagogischer Sicht stärker die Orientierung an Lernzielen empfohlen. Hier gilt es, solche Aufgaben zu stellen, die Schüler bei Anstrengung, unabhängig von ihrem Begabungs- und Fähigkeitskonzept haben, lösen können. Dadurch steigt mit erfolgreicher Bearbeitung die eigene Kompetenz. Vergleichbar ist die Beschäftigung mit sportlichen Übungen, bei denen mit steigernder Beschäftigung das Können besser wird oder der Hobbykocher etc. Schüler mit Lernzielorientierung resignieren weniger, wenn sie scheitern; sie nehmen sich nicht als Versager wahr; auch hohe Anstrengung bzw. lange Beschäftigung wird dann nicht als ein Rückschluss auf die eigene (negative) Begabung wahrgenommen; deshalb können sie ohne Risiko davon Gebrauch machen bzw. sich lange beschäftigen; mit der Zeit erfahren sie den Zusammenhang zwischen Beschäftigung / Anstrengung und dem Ergebnis. Der Unterricht hat nicht nur kognitive Folgen, sondern in der Regel gehen damit auch unbemerkt und ungewollt- emotionale, soziale und persönlichkeitsprägende Prozesse einher. Cage und Berliner (S. 438-454) haben explizit für den Unterricht einige Motivierungstechniken vorgeschlagen, die hier wiedergegeben werden sollen: 1. Sage den Schülern präzis, was sie erreichen sollen: Um Schülerverhalten tatkräftig und richtungsweisend zu unterstützen, muss dem Schüler genaue Anweisungen gegeben werden, was er bei einer Aufgabe erreichen soll. Sie gehen dabei von der Beobachtung aus, dass häufig Lehrer im Unterricht sich auf eine Aufgabe stürzen und die Schüler im Unklaren lassen, was sie genau tun müssen, um die Aufgabe 37 erfolgreich zu lösen bzw. was das Ziel der Aufgabe ist. Brophy (1982) stellte z.B. fest, dass über 20 % aller im Unterricht neu gestellten Aufgaben überhaupt nicht einleitend vorgestellt wurden, sondern die Lehrer einfach mit der Aufgabe anfingen. 2. Lobe den Schüler: Ei verbales Lob, wie etwa „gut“, „sehr schön“, „gute Arbeit“, das kontingent nach angemessenen Leistungen oder nach Annäherungen an angemessenen Leistungen angewandt wird, stellt eine wirkungsvolle Motivierungsmöglichkeit dar. Soziale Anerkennung hat einen starken Einfluss auf das Leistungsverhalten von Schulkindern. Zuviel Lob oder Lob an falscher Stelle kann jedoch zu einer Übersättigung führen und ineffektiv werden. Darüber hinaus führen Cage und Berliner an, dass extravertierte Schüler mehr durch Tadel und introvertierte, die mehr an ihren eigenen Gefühlen und Gedanken interessiert sind, mehr durch Lob zu motivieren sind. Effektives bzw. ineffektives Loben: Effektives Lob: Wird kontingent, d.h. planmäßig erteilt Die Einzelheiten des Erreichten werden spezifiziert Äußert sich spontan; wirkt glaubwürdig; verdeutlicht die klare Zuwendung zum Schüler und seiner Leistung Belohnt das Erreichen unter Einschluss der Bemühungen Informiert den Schüler über seine Kompetenz oder den wert seiner Leistung Stellt für Schüler eine Orientierungshilfe dar Verwendet frühere Leistungen des Schülers als Kontext zur Beschreibung momentaner Leistungen Erkennt die Anstrengung oder den Erfolg bei für diesen Schüler besonders schwierigen Aufgaben an Schreibt Erfolg dem Bemühen und der Fähigkeit des Schülers zu Richtet die Aufmerksamkeit des Schülers auf sein aufgabenbezogenes Verhalten 3. Verwende Tests und Noten mit Bedacht: Tests und Noten werden in der Regel das Leistungsverhalten von jenen Schülern positiv beeinflussen, die in den Noten einen Wert erkennen, der jenseits des Unterrichts liegt (Anerkennung, schulische, berufliche Vorteile etc.), aber die von außerhalb auferlegten Noten können dazu führen, dass der Lerneifer außerhalb des Unterrichtskontextes nachlässt. 38 Tests und Noten sind dann förderlich, wenn sie eingesetzt werden, um den Schüler zu informieren, wen sie ihm als Indikator für die Anstrengung des Schülers dienen; nicht jedoch, wenn sie eingesetzt werden, um den Schüler zu bestrafen oder als Nachweis dienen, wie gut oder schlecht ein Schüler im Vergleich zu den anderen Schülern steht. 4. Spannung, Entdeckung, Neugier wecken Stimuli, die neu, überraschend, komplex oder mehrdeutig sind, lassen eine Wachheit entstehen, die Berlyne (1965) als eine „epistemische Neugier“ bezeichnet hat. Ist diese Neugier vorhanden, ist der Mensch in einem motivierten Zustand; er versucht, das Ausmaß der Unordnung, mit dem er konfrontiert ist, zu mindern. Die Motivation hält so lange an, bis der Konflikt zwischen den kognitiven Schemata aufgelöst ist. Die Schüler können jedoch gelangweilt oder frustriert werden, wenn das Problem so gestaltet ist, dass sie diese nicht lösen können; d.h. es sollte mit ihren kognitiven Kompetenzen auch prinzipiell lösbar sein. 5. Tue gelegentlich etwa Unerwartetes Hier wird vorgeschlagen, im Unterricht gelegentlich bspw. auch den „Spieß“ umzudrehen, derart, dass z.B. die Schüler den Lehrer nach seinen Lernproblemen fragen, die Schüler selber mal einen Test für den Lehrer entwerfen etc. Der Effekt ist, dass die Aufmerksamkeit und die Beteiligung der Schüler steigt, wenn routinisierte Interaktionsmuster gelegentlich durchbrochen werden. 6. „Appetit anreizen“ Schüler sollten gelegentlich kleine Belohnungsproben erhalten, bevor sie mit dem Lernen beginnen. Sie sollten erfahren, was sie noch durch weitere Bemühungen bekommen können, so z.B. den Kindern eine spannende Lektüre kurz vorlesen und sie dann selber lesen lassen. Die Anfangsstadien einer Aufgabe bspw. sollten leicht gehalten werden, so dass die Schüler zu Beginn Erfolgerlebnisse haben. Dann könne sie schrittweise erhöht werden. Aneignung von Kenntnissen sollte zu Beginn mit häufigen Belohnungen einher gehen. 7. Verwende Bekanntes als Beispiele Empfohlen wird bspw. bei Textaufgaben den Schülern bekannte Namen (statt abgedroschene Namen wie Frau Müller oder Herrn Meyer) oder Situationen vorzugeben. 8. Wende das Gelernte auch an 39 Das bisher Gelernte soll auch verwendet werden; dadurch wird auch die Erwartung geweckt, dass das gerade Gelernte auch später wieder gebraucht werden wird; in den jeweiligen Aufgabenstellungen sollten deshalb stets auch Bezüge zum früher Gelernten vorhanden sein. 9. Verwende Simulationen oder Spiele im Unterricht So können bspw. im Sozialkundeunterricht statt eines Vortrages über Drogen- oder Gettoisierungsprobleme diese Szenen von den Schülern in verscheiden Akteure eingeteilt (Polizei, Dealer, Süchtige, Arme etc.) gespielt und daran diskutiert werden. Spielerische Lernmethoden sorgen für Spaß; sorgen für wichtige Lernerfahrungen und können auch dem Lehrer die Möglichkeit geben, die Lernformen der Schüler nachzuvollziehen. 10. Verringere die Attraktivität konkurrierender Motivierungssysteme Hier gilt es zu analysieren, warum Schüler die Schule schwänzen, zu spät kommen oder sich den Leistungsforderungen widersetzen. Welche anderen Motive sind existent? Bedürfnis nach Anerkennung durch andere? Wie etwa bei dem Klassenkasper oder wird das Leistungsbedürfnis in der Schule nicht gut abgedeckt, dafür aber eher im Freizeit oder sportlichen Betätigungen? 11. Minimiere unangenehme Konsequenzen der Schüler bei der Beteiligung am Unterricht Beteiligung des Schülers sollte stets positiv verstärkt werden; aversive Auswirkungen, wie etwa Verlust der Selbstachtung des Schülers, wenn er die Aufgabe nicht richtig löst, oder nicht mitkommt, weil das Tempo zu schnell ist etc. gering halten. Einfluss der Familie auf die Lernmotivation: Die Bedeutung der Familie für die Genese motivationaler Orientierungen ist recht spät, erst ab den 90-er Jahren intensiv erforscht worden; die Forschung war weitestgehend fokussiert auf das Setting „Schule“. Vor dem Hintergrund der Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan hat Wild versicht, die familialen bzw. erzieherischen Haltungen zu eruieren, die Einfluss auf die Lernmotivation des Kindes haben. Dabei knüpft sie auch an die empirischen Belege, die Tausch und Tausch in ihrer Erziehungspsychologie (1973) vorgelegt hatten. 40 In neueren Studien (Ginsburg & Bronstein, 1993; Grolnick & Ryan, 1989) ist empirisch belegt, dass elterliche Autonomieunterstützung eine motivfördernde Wirkung hat bzw. elterliche Kontrolle demotivierende Wirkungen nach sich zieht. Für die Förderung des Kompetenzerlebens konnten längsschnittliche Analysen zeigen, dass ein stimulierender Familienkontext, der sich durch eine hohen Anregungsgehalt und eine starke kulturelle Orientierung auszeichnet, günstig auswirkt und die intrinsische Motivation von Schülern steigert. Was das Zusammenspiel bzw. die Interaktion schulischer und häuslicher Lernumgebungen betrifft, so zeigen sich Leistungs- und Motivationsprobleme dann, wenn Schüler eine Diskontinuität zwischen den in der Familie und in der Schule vorherrschenden Interaktionsformen erkennen (Hansen, 1986). Diesen Befund haben Paulsen, Marchant, Rothlisberg dahingehend differenziert, dass sie nachweisen konnten, dass diese wahrgenommene Inkongruenz nur bei jenen Schülern mit schlechten Leistungen einher ging, die ihre Eltern als gleichgültig, ihre Lehrer aber dagegen als autoritär beschrieben. Wild hat in ihrer Studie mit 169 Schülern im Alter von 11 bis 14 Jahren (M=12,6 J.) eine Fragebogenuntersuchung durchgeführt. Sie konnte darin zeigen, dass Schüler umso stärker intrinsisch motiviert waren, je eher die Lehrer aus der Sicht der Schüler eine autonomieunterstützende Form des Umgangs pflegten, sie über den Unterricht hinausgehendes persönliches Interesse an den Schülern zeigten, und für ein hohes Maß an Stimulation und gut strukturierten Unterricht durchführten. Die Schüler waren dagegen umso stärker extrinsisch motiviert, je mehr sie sich vom Lehrer kontrolliert fühlten. Tabelle: Zusammenhänge zwischen Instruktionsverhalten von Lehrern, elterlichen Schulengagement und der intrinsischen und extrinsischen Schülermotivation (Wild, 2001) Intrinsische Mot. Extrinsische Mot. Lehrer .48** .26** Eltern .27** -.02 Lehrer -.08 .20** Eltern .04 .27** Lehrer .24** .04 Eltern .17* .13 Verhaltensdimension Autonomieunterstützung Kontrolle Struktur 41 Emotionale Zuwendung Stimulation Lehrer .48** .22** Eltern .33** -.01 Lehrer .45** .13* Eltern .34** .05 ** p<.01; *p<.05 Es konnte also gezeigt werden, dass nicht nur die Merkmale des Lehrerverhaltens, sondern auch der elterliche Umgang mit schulischen Belangen einen substanziellen Beitrag zur Aufklärung von Unterschieden in der Lernmotivation hat; schulische und familiale Bedingungen wirkten sich in dieser Studie als kompensatorisch bzw. ergänzend auf die Lernmotivation aus. Das impliziert, dass Förderungen in den jeweiligen Kontexten die Defizite im jeweils anderen Kontext ein Stück aufheben kann.