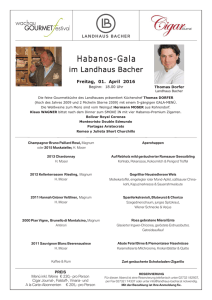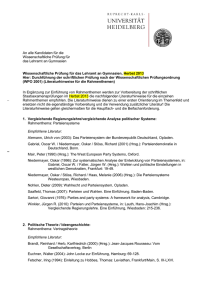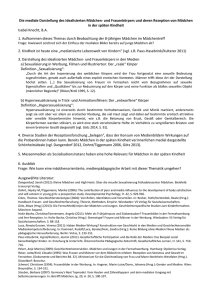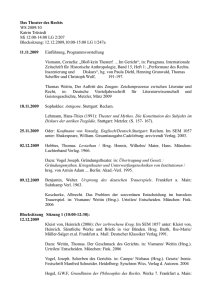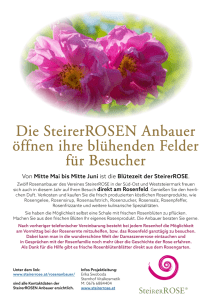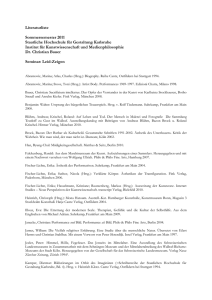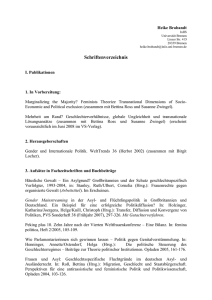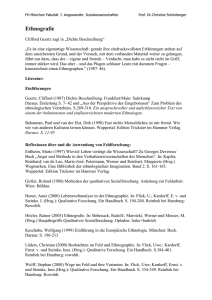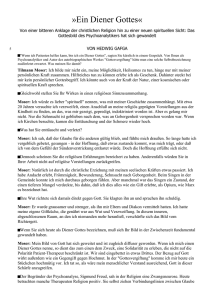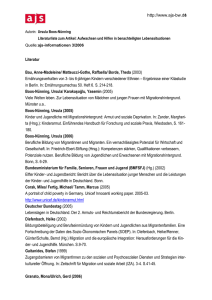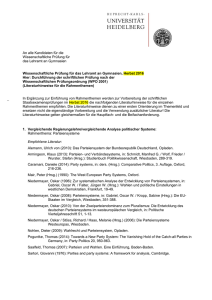1 Neue Medien in Organisationen - Lehrstuhl für Wirtschafts
Werbung

Neue Medien in Organisationen Neue Medien in Organisationen Klaus Moser und Bernad Batinic Universität Erlangen-Nürnberg Version 11/02 Vorbereitet für: H. Schuler (Hrsg.), Organisationspsychologie, Bände D/III/3 und 4 der Enzyklopädie der Psychologie, Göttingen: Hogrefe Anschrift der Verfasser: Prof. Dr. Klaus Moser und Dr. Bernad Batinic Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Lehrstuhl für Psychologie, insbesondere Wirtschafts- und Sozialpsychologie Lange Gasse 20 90403 Nürnberg Tel.: 0911-5302-259 Fax: 0911-5302-243 1 Neue Medien in Organisationen 2 1 1 NEUE MEDIEN IN ORGANISATIONEN ............................................................................................... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 DATENERHEBUNG ................................................................................................................................ 11 2.1 2.2 2.3 3 OFFENHEIT GEGENÜBER DER UMWELT ............................................................................................... 23 DIE LÖSUNG VON KAPAZITÄTSPROBLEMEN ........................................................................................ 25 DIE VERWIRKLICHUNG VON INTERESSEN ............................................................................................ 26 ORGANISATIONEN ALS REAKTION AUF MARKTVERSAGEN .................................................................. 29 NEUERE TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNGEN ........................................................................ 32 4.1 4.2 4.3 4.4 5 DATENERHEBUNGSVERFAHREN IM INTERNET ..................................................................................... 12 DATENQUALITÄT INTERNETBASIERTER ERHEBUNGSVERFAHREN ........................................................ 17 ZUSAMMENFASSUNG .......................................................................................................................... 21 VIRTUELLE ORGANISATIONEN ........................................................................................................ 22 3.1 3.2 3.3 3.4 4 INFORMATIONEN ABRUFEN ................................................................................................................... 6 INFORMATIONEN PUBLIZIEREN .............................................................................................................. 7 INFORMATIONEN AUSTAUSCHEN ........................................................................................................... 9 ZUSAMMENFASSUNG .......................................................................................................................... 11 BREITBANDDATENÜBERTRAGUNG ...................................................................................................... 33 MOBILE INTERNETKOMMUNIKATION .................................................................................................. 35 VIRTUELLE 3-D WELTEN .................................................................................................................... 35 ZUSAMMENFASSUNG .......................................................................................................................... 36 LITERATUR ............................................................................................................................................. 38 Neue Medien in Organisationen 3 1 Neue Medien in Organisationen Einen Beitrag über „Neue Medien“ zu verfassen, ist eine per Definition sehr schwierige Aufgabe, wenn der vorliegende Enzyklopädieband den Anspruch erfüllen will, gleichermaßen aktuell wie für die Zukunft richtungsweisend zu sein. Denn „neu“ ist etwas (z.B. ein Medium) nur eine gewisse Zeit lang. Dies mag ein Blick zwei Jahrzehnte zurück verdeutlichen. Eurich (1982) hat zu jener Zeit festgestellt, dass sich der Begriff „Neue Medien“ gerade zu etablieren beginne. Bereits dieser Autor nimmt eine Umschreibung dieses Begriffs vor, der wir auch heute noch folgen können, wenn er von „hochentwickelten Informations- und Kommunikationstechnologien“ spricht. Was damals „neu“ war, sind wir hingegen weniger geneigt, in den Fokus dieses Beitrags zu stellen: Bildschirmtext, Videotext, Kabelfernsehen und Satellitenfernsehen sind mittlerweile bereits als wohlvertraut, womöglich sogar schon als „veraltet“, bezeichenbar. Das Thema „Neue Medien“ hat in vorliegendem Band einen Querschnittscharakter, sämtliche Bereiche der Organisationspsychologie sind davon betroffen. Warum dem so ist, wird deutlich, wenn wir Medien zunächst einmal lediglich „... als (technische) Träger und/oder Mittler von Informationen ...“ (Kübler & Würzberg, 1982, S. 96) definieren. Bei näherer Betrachtung fällt es nämlich schwer, Strukturen und Prozesse in Organisationen ausfindig zu machen, die nicht mit Medien in Verbindung stehen. „Neu“ ist also von daher nicht, dass Medien in Organisationen eine Rolle spielen, im vorliegenden Beitrag kann es nur um die Frage gehen, welche (neue) Rolle bestimmte – eben neue – Medien spielen. Im folgenden werden wir uns vor allem mit den Möglichkeiten des Internet befassen, der Ort, an dem Informationen abgerufen und publiziert werden und das Medium, über das kommuniziert werden kann. Das Internet ist ein weltumspannendes Netz und kann aus Sicht einzelner Organisationen in zwei Regionen oder Bereiche unterteilt werden, das organisationsinterne „Intranet“ und den Rest, also das „Extranet“. Mit dem Begriff „Intranet“ bezeichnet man einen Verbund von Computern zu einem lokalen Netzwerk, wobei der Datenaustausch zwischen den beteiligten Rechnern auf der Basis eines einheitlichen Übertragungsprotokolls (TCP/IP, Transmission Control Protocol / Internet Protocol) realisiert und der Datenaustausch mit dem Internet mit Hilfe einer Firewall (Filtersoftware) kontrolliert wird. Die grundlegende Anwendungsmöglichkeit in diesem Netzwerk ist das Senden und Empfangen von Datenpaketen. Auf diese Grundfunktion aufbauend wurden verschiedene Neue Medien in Organisationen 4 Internetdienste wie E-Mail (elektronische Post), NetNews (Diskussionsgruppen), FTP (Dienst zum Austausch von Dateien) und das WWW entwickelt. Mit Hilfe dieser Internetdienste können Informationen synchron (z.B. mit Internet-Phone, IRC (Diskussionskanäle), MUDs (virtuelle Welten)) oder asynchron (E-Mail, WWW, Usenet usw.) zwischen den Nutzern ausgetauscht werden. Die Internetdienste unterscheiden sich darüber hinaus in der Anzahl der einsetzbaren Medientypen. So sind E-Mail, IRC und die NetNews rein textbasierte Medien, hingegen können beispielsweise mit Hilfe von I-Phone auch audiovisuelle Daten übertragen werden. Aus Platzgründen verzichten wir darauf, einzelne Medien zu besprechen (z.B. Videokonferenzen, Fax, Voice-Mail), wobei wir annehmen, dass diese in naher Zukunft ohnehin nur noch eine Spezialform von Möglichkeiten des Intranet darstellen werden. Dennoch sollte beachtet werden, dass ein Manko der bisherigen Forschung zu den Auswirkungen neuer Medien in Organisationen darin besteht, dass man sich meist nur auf ein Medium (z.B. E-Mail, Videokonferenz) beschränkt hat. Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe verschiedener Varianten, wie Abbildung 1 zeigt. Abbildung 1: Werkzeuge für Telekooperationen (elektronische Kooperationsformen; in Anlehnung an: Reichwald, Möslein, Sachenbacher, Englberger & Oldenburg, 1998, S. 33) Zeit Synchron - E-Konferenzraum Lokal Raum Disloziert Teleconferencing Asynchron Info-Kiosk für Arbeitsgruppen Telecoordinating 1.1.1.1.1.1 - Videoconferencing - ... Individuell 1.1.1.1.1.2 Zeit - E-Mail - ... 1.1.1.1.1.3 Synchron Asynchron Fokus Kollektiv - Shared Whiteboard - Shared Application - Hypermedia - Workflow Neue Medien in Organisationen 5 Die Globalisierung unserer Gesellschaft und der Wirtschaftsräume führt zu einem steigenden Informations-, Kommunikations- und Koordinationsbedarf in Organisationen. Wie können Unternehmen diese Anforderung bewältigen? Bei der Beantwortung dieser Frage erhält die rasante Entwicklung der Computertechnologie und hier speziell die der Computernetzwerke eine hervorgehobene Bedeutung (Mülder, 2000). Versprechen doch gerade die in den letzten Jahren immer populärer werdenden Intranets u.a. eine grenzüberschreitende, schnellere und effizientere innerbetriebliche Kommunikation, eine einfachere und vor allem kostengünstigere Archivierung von Informationen bis hin zur Steigerung der Identifikation der Mitglieder mit der Organisation. In den vergangenen Jahren haben viele Unternehmen ein Intranet eingeführt oder sie stehen nun kurz vor der Einführung. Die ersten Erfahrungsberichte mit diesem Medium kommen allerdings zu widersprüchlichen Schlussfolgerungen. Einerseits finden sich Dokumentationen über wahre Erfolgsgeschichten (z.B. bei FORD und Boeing, vgl. Batinic & Moser, 1998) und vielversprechende Anwendungen (z.B. elektronische Personalakte, Mülder, 2000; diverse Varianten leistungsbezogener Daten, Lawler, 2000), auf der anderen Seite werden zahlreiche Hinweise zu negativen Effekten bei der Einführung und der Nutzung eines Intranet berichtet. Diese negativen Effekte reichen von innerorganisationalen Widerständen bei der Einführung eines Intranet bis hin zu mangelnder Identifikation von Unternehmensmitgliedern mit ihrer Organisation (vgl. u.a. Wiesenfeld, Raghuram & Garud, 1999a; Heydebrand, 1989). Speziell bei der elektronischen Kommunikation zwischen dem Unternehmen und seinen Zulieferern berichten Kraut, Steinfield, Chan, Butler und Hoang (1999) sowohl von Zeitverlusten als auch von Einbußen bei der Qualität der erzeugten Produkte. Griffith (1998) stellt fest, dass ca. 40% der Maßnahmen zur Einführungen von neuen Technologien in Organisationen scheitern, wofür weniger technologische als vielmehr organisationale Probleme verantwortlich seien. Man erhält nach derartiger Lektüre den Eindruck, dass ein Intranet zwar potentiell Arbeitsbeziehungen im Unternehmen und überhaupt den Informationsfluss in Organisationen verbessert, der tatsächliche Erfolg scheint aber wenig berechenbar zu sein. Erschwert wird eine Einschätzung des teilweise dramatischen Wandels in Organisationen zudem dadurch, dass durch die informationstechnische Revolution verschiedene Ebenen betroffen sind. Beispielsweise steht „Telekooperation“ für Telearbeit, Telemanagement und Teleleistungen. Neue Medien in Organisationen 6 „Diese drei Perspektiven bilden den Rahmen für die Behandlung von Grundformen verteilter Arbeit, für die Diskussion zentraler Aspekte verteilter Koordination und Führung sowie für das Aufzeigen neuer Dienstleistungen“ (Reichwald et al., 1998, S. 7). In zahlreichen Darstellungen werden diese Ebenen nicht klar getrennt, was zu einer weiteren Erschwernis bei dem Versuch führt, die Konsequenzen des Einsatzes Neuer Medien angemessen abschätzen zu können. Sprachen wir bisher von der Nutzung innerbetrieblicher Computernetzwerke, so ist dies eine Verallgemeinerung über eine Vielzahl verschiedener Anwendungsmöglichkeiten, die ein derartiges Netzwerk den potentiellen Nutzern eröffnet (zur Theorie der Medienwahl in Organisationen siehe u.a. Wiest, 1995). Die Nutzungsmöglichkeiten eines Intranet können in drei Bereiche untergliedert werden: Informationen abrufen, Informationen publizieren und Informationen austauschen. Im Folgenden werden diese drei Nutzungsmöglichkeiten genauer betrachtet. In den sich anschließenden Kapiteln gehen wir auf beispielhafte Anwendungsfelder ein, in denen diese drei Funktionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten umgesetzt werden. 1.1 Informationen abrufen Informationen zu spezifischen Themengebieten sind in Organisationen zwar oft vorhanden, aber schlicht für viele Mitarbeiter nicht zugänglich und auffindbar, bzw. das Recherchieren ist unpraktisch und aufwendig. Dieses Problem zu lösen, wird gemeinhin als eine wesentliche Aufgabe des „Wissensmanagement“ bezeichnet (Davenport & Prusak, 1998). Im weitesten Sinne kann das „Informationen abrufen“ auch als „Sekundärforschung“ über bereits zuvor erhobene Daten bezeichnet werden. Dabei unterscheidet man zwischen internen und externen Datenquellen. Interne Quellen sind im Unternehmen selbst erfasste Daten, wie Umsatz-, Kosten- und Kundenstatistiken. Zu den externen Quellen zählen Daten, die nicht im Unternehmen selbst erfasst wurden (z.B. allgemein zugängliche Befragungsdaten, Bevölkerungsstatistiken oder Mediadaten). Die Nutzung des Intranet als interne Datenquelle ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn Daten aus Unternehmensbereichen aus weit entfernten Orten benötigt werden. In Datenbanken gespeicherte Daten können auf diese Weise schnell über das Intranet abgefragt werden. Das externe Internet (bzw. „Extranet“) kann genutzt werden, um Daten wie z.B. Informationen über Rechtssysteme fremder Länder, Marktvolumina, Wachstumsprognosen, Nachfragetendenzen und Kontaktanschriften von Behörden im In- und Ausland anzufordern Neue Medien in Organisationen 7 bzw. direkt einzusehen. Dabei kann man grundsätzlich zwei Vorgehensweisen der Datengewinnung unterscheiden. Zum einen hat man die Möglichkeit, Daten selbst zu recherchieren, beispielsweise über Geschäftsberichte auf Unternehmens-Websites, in onlineArchiven, der Online-Fachpresse oder Abschlußberichten. Zum anderen besteht die Möglichkeit, die Daten über einen Informationsdienst im Internet einzuholen. Derartige Informationsdienste bieten gegen eine Gebühr zahlreiche Markt- und Länderinformationen. Als Beispiele sind hier die Dienste National Trade Data Bank des US-Department of Commerce (www.stat-usa.gov) und die Bundesstelle für Außenhandelsinformation (www.bfai.com) zu nennen (vgl. weiterführend Theobald, 1998). Viele der von der Organisationsleitung und den Mitarbeitern benötigten Informationen liegen in der Organisation bereits vor. Es gestaltet sich jedoch oft problematisch, diese Informationen, auch unter kostenökonomischen Gesichtspunkten, so zu archivieren, dass sie für die Beteiligten problemlos zugänglich sind. Datenbankanwendungen mit elektronischen Suchsystemen sind hier eine Erweiterung der bestehenden Verfahren. Für den Erfolg eines elektronischen Informationsarchivs sind Faktoren entscheidend wie die Transparenz der Inhaltsbereiche des elektronischen Archivs, datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen, Kürze des Wegs zu den Informationsterminals oder die Einfachheit der Recherchesysteme (vgl. zu weiterführenden softwareergonomischen Fragen u.a. Hütwohl, 1994; Widdel, 1996). In zahlreichen Organisationen wird inzwischen über die Einführung von strukturierenden Portalen nachgedacht oder diese befinden sich bereits im Einsatz. In einem beträchtlichen Umfang hat die Neigung in Organisationen zugenommen, die Intranetmöglichkeiten im Bereich von Trainings anzuwenden (z.B. Driscoll, 1997). Dies dürfte insbesondere dort naheliegend sein, wo Wissensinhalte vergleichsweise standardisiert aufbereitet werden können und es sich zugleich als günstig erweist, sie individualisiert abfragen zu können (vgl. Kraiger, 1999; vgl. hierzu weiterführend den Beitrag von Greif, in diesem Band). 1.2 Informationen publizieren Die Möglichkeit, Informationen im elektronischen firmeninternen Netzwerk zu recherchieren, setzt voraus, dass andere diese Informationen in das Netzwerk einstellen und ständig auf dem aktuellen Stand halten. Prinzipiell lassen sich zwei Strategien unterscheiden, die zentrale und die dezentrale Publikation (siehe Krüger, Ott & Funke, 2000). Bei der zentralen Strategie sind Neue Medien in Organisationen 8 spezielle Organisationseinheiten des Unternehmens mit der Pflege und Erweiterung des Informationspools im Intranet betraut. Beispielsweise entscheiden diese Einheiten, welche Informationen an welchen Ort, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt in das Netz eingespeist werden. Diese Strategie garantiert einerseits einen gewissen technischen Qualitätsstandard, anderseits muss viel Aufwand für die Koordination mit den einzelnen Fachabteilungen betrieben werden. Dezentrale Strukturen verlagern die Verantwortung für die Einspeisung von Informationen an die einzelnen Fachabteilungen bzw. an mehr oder weniger alle Mitarbeiter. Der Vorteil dieser Strategie ist offensichtlich, da ohne Medienbrüche und größere Verwaltungswege Informationen der Gemeinschaft bekannt gemacht werden können. Andererseits setzt dies aber auch ein gewisses technisches Wissen und Interesse bei der Belegschaft voraus. Allein schon das Bewusstsein der Notwendigkeit, Informationen anderen Personen zugänglich zu machen, ist hier die erste Hürde, die genommen werden muss. Dabei ist auch zu bedenken, dass Informationen von Firmenmitarbeitern gegenüber Kollegen gelegentlich ganz bewusst zurückgehalten werden, wenn sie sich dadurch einen Vorteil innerhalb der Organisation versprechen (vgl. Neuberger, 1995). Neben diesen beiden strategischen Ausrichtungen existieren zahlreiche Zwischenformen. Beispielsweise geben Organisationen eine zentrale Struktur vor, wobei speziellen Organisationsgliederungen (z.B. dem Betriebsrat) zusätzlich die Möglichkeit geboten wird, eigenverantwortlich Inhalte im Intranet zu verbreiten. Zwei organisationspsychologisch bemerkenswerte Anwendungsbereiche der Möglichkeiten des Intranet seien hier angesprochen, Beiträge zur Organisationsentwicklung sowie zum Personalmarketing. Insbesondere weltweit operierende Unternehmen beklagen nicht nur den hohen Koordinationsaufwand, den die Führung der einzelnen Unternehmensfelder in Anspruch nimmt, sondern auch die Schwierigkeit, den weltweit operierenden Mitgliedern der Organisation ein „Wir-Gefühl“ zu vermitteln oder das organisationale Commitment (Moser, 1996) zu fördern. Im Rahmen der Einführung von Intranets wurden zahlreiche Anwendungen entwickelt, die sich dieser Problematik annehmen. Beispiele hierfür sind organisationsinterne elektronische Diskussions- und Projektgruppen, elektronische Zeitschriften oder WWWPräsentationen von Abteilungen. Bemerkenswert ist zudem, dass es mit Hilfe des Intranets auch möglich ist, gemeinsame „Events“ zu realisieren, die wiederum ein Gruppengefühl bei den Organisationsmitgliedern fördern. Beispiele hierfür sind teamorientierte Wettbewerbe, die im Intranet stattfinden, im Intranet dokumentierte Veranstaltungen oder elektronische Mitarbeiterbefragungen, bei denen kontinuierlich die Rücklaufquoten für einzelne Neue Medien in Organisationen 9 Unternehmensteile im Intranet präsentiert werden. Bei den genannten Beispielen ist das gemeinsame Erleben des Ereignisses besonders wichtig. Das Intranet dient hierbei als schnelle Informations- und Kommunikationsplattform. Ein anderes zunehmend Beachtung findendes Anwendungsfeld für die „Publikation“ von Informationen ist der Bereich des Personalmarketing, also insbesondere die Bekanntmachung offener Stellen. Allerdings wird dies nicht nur im Intranet, sondern auch im Extranet getan. Zudem bietet es sich auch hier an, nicht nur die Publikationsfunktion sondern auch die Interaktionsfunktion des Internet zu nutzen, was im Beitrag von Moser und Zempel (in diesem Band) ausführlicher erläutert wird. 1.3 Informationen austauschen In den bisherigen Ausführungen zu den Nutzungsmöglichkeiten eines Intranet wurden die Arbeitsbeziehungen zwischen den Mitarbeitern, die das Intranet nutzen, nur indirekt tangiert. Bei der dritten Anwendungsmöglichkeit – Informationen austauschen – treten die Nutzer über das Intranet in Kontakt zueinander. Zur Kommunikation und Interaktion im Intranet stehen den Nutzern verschiedene Dienste zur Verfügung und reichen von klassischen E-MailAnwendungen über unimediale synchrone Chats, multimediale Videokonferenzsysteme bis hin zu auf dem WWW-aufsetzende Kommunikationsplattformen (Bentley et al., 1997; George & Jessup, 1997). Sie lassen sich grob anhand der Kriterien „synchron und asynchron“, „textorientiert und multimedial“ sowie „Individual- vs. Gruppenkommunikation“ unterscheiden (siehe auch Döring, 2000a; Batinic, 1998). Ein Beispiel für einen synchronen Kommunikationsdienst ist ein WWW-Chat. Bei diesem unterhalten sich räumlich getrennte Teilnehmer in „Echtzeit“ miteinander, wobei die Teilnehmer rein textbasiert agieren. Unterstützt man das Chat durch das Einspielen von z.B. graphischen Elementen (Bilder, Film usw.), so sprechen wir von synchroner, multimedialer Kommunikation. Bei asynchronen Kommunikationsdiensten werden die Äußerungen der Teilnehmer zunächst zwischengelagert, zwischen Aktion und Reaktion liegt also eine von den Teilnehmern mit beeinflussbare Zeitspanne. Der wohl bekannteste und am meisten genutzte asynchrone Kommunikationsdienst ist E-Mail (Hauptmanns, 1999). Ähnlich wie bei der Post wird bei einer E-Mail eine Nachricht an ein spezifisches Postfach eines Teilnehmers gesandt. Wann dieser seine Post öffnet und beantwortet, bleibt dem Empfänger überlassen. E-Mail ist von seinen Ursprüngen her ein rein textbasierter Kommunikationsdienst. Mit zunehmendem Neue Medien in Organisationen 10 technischen Fortschritt finden sich aber immer mehr multimediale Elemente. Das Versenden von Videonachrichten (Videomail) ist hierfür ein Beispiel. Die aufgeführten Dienste können zur Individualkommunikation oder aber zur Massenkommunikation genutzt werden. Kombiniert man die drei bereits erläuterten Medienmerkmale, ergeben sich insgesamt acht Kommunikationsdienste (vgl. Tabelle 1). Tabelle 1: Kombination von Medienmerkmalen und Beispiele entsprechender Internetdienste (in Anlehnung an Batinic, 1998) unimedial multimedial Individuum Gruppe Individuum Gruppe synchron Chat Chat Videochat Videokonferenz asynchron e-mail Mailingliste HTML-E-Mails WWW-Board Die Kommunikationsdienste werden von den Anwendern unterschiedlich intensiv in Anspruch genommen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. So erfordern beispielsweise multimediale Kommunikationsdienste eine relativ anspruchsvolle technische Grundausstattung auf Seiten des Anwenders. Auch werden besondere Anforderungen an seine technischen Kenntnisse gestellt. Bei der synchronen, textbasierten Kommunikation müssen die Anwender ihre Gedanken relativ zügig in den Computer eingeben, ein Umstand, der überfordern und auch abschrecken kann. Nutzer wählen mehr oder weniger bewusst die für sie passenden Kommunikationsdienste aus der Angebotspalette aus. Treten zwei Akteure medienvermittelt in Kontakt, hängt der Erfolg der Kommunikation, zumindest teilweise, von dem Grad der Passung der präferierten Kommunikationsdienste der beteiligten Personen (siehe „Social Influence Model“ nach Fulk, Schmitz & Steinfield, 1990) und der subjektiv empfundenen Neue Medien in Organisationen 11 „medialen Reichhaltigkeit“ (Döring, 2000a) der einzelnen Kommunikationsmedien ab. 1.4 Zusammenfassung Beim Einsatz von Neuen Medien in Organisationen sind drei Nutzungsmöglichkeiten Informationen abrufen, Informationen publizieren und Informationen austauschen voneinander zu unterscheiden. Für jede der Nutzungsmöglichkeiten stehen verschiedene Dienste und Technologien – mit jeweils individuellen Vorteilen und Problemen - zur Verfügung. In dem nachfolgenden Unterkapitel betrachten wir ein Anwendungsfeld, nämlich das Erheben von Daten im Intra- und Extranet, genauer. 2 Datenerhebung Die Frage nach der Gewinnbarkeit von Daten über das Internet stellt sich in verschiedenen Varianten. Beispiele könnten etwa klassische Marktforschungsdaten sein, aber auch Bewerberinformationen oder Resultate der Potentialanalyse von Mitarbeitern. Auch elektronische Mitarbeiterbefragungen sind eine Variante von internetbasierten Datenerhebungsverfahren. Wir werden in den folgenden beiden Abschnitten zunächst Datenerhebungsverfahren im Internet (und Intranet) vorstellen und dann die Qualität der damit gewonnenen Daten diskutieren. Zur Datenqualität ist anzumerken, dass bisher nur auf sehr wenige Befunde zu Erhebungen mit organisationspsychologischem Fokus zurückgegriffen werden kann (z.B. Kuhnert & McCauley, 1996; Rosenfeld, Doherty, Vicino & Kantor, 1989; Rosenfeld, Booth-Kewley & Edwards, 1993; Stanton, 1998). Zudem ist zu beachten, dass die Generalisierbarkeit eines Teils der Ergebnisse nur mit Einschränkungen möglich ist. So wurden in den 80iger und Anfang bis Mitte der 90iger Jahre unter der Überschrift „computergestützte Mitarbeiterbefragung“ vorwiegend E-Mail-Umfragen durchgeführt (z.B. Parker, 1992; Sproull, 1986). Seit ca. 1995 werden hingegen internetbasierte Befragungen i.d.R. mit Hilfe des firmeninternen WWW realisiert (z.B. Stanton, 1998; Borg, 2000). Immerhin existieren zahlreiche Forschungsarbeiten, die sich mit dem Erheben von Daten im Internet auseinandersetzen. Da bei internetbasierten Befragungen weitgehend auf die gleiche Technologie wie bei intranetbasierten Befragungen zurückgegriffen wird, kann weitgehend von einer Übertragbarkeit ausgegangen werden. Neue Medien in Organisationen 12 2.1 Datenerhebungsverfahren im Internet In den letzten Jahren ist eine Vielzahl von reaktiven und nicht-reaktiven Methoden zur Datenerhebung im Internet entwickelt worden, wobei sich die meisten Anwendungen und Erfahrungen auf das Anwendungsfeld „Marktforschung“ bezogen haben (vgl. zum folgenden Göritz, Batinic & Moser, 2000). Im diesem Abschnitt werden einige exemplarisch ausgewählte internetbasierte Datenerhebungsmethoden vorgestellt und deren besondere Merkmale diskutiert (weitere Erhebungsverfahren, wie z.B. Durchführung von Interviews mittels Roboter und Beobachtung in virtuellen Welten finden sich in Batinic, Werner, Gräf & Bandilla, 1999, Batinic, Reips & Bosnjak, 2002). Befragungen per E-Mail. Befragungen per E-Mail können in Form von Text-E-Mails und HTML-E-Mails durchgeführt werden. Datenerhebung mittels Text-Mails ist die älteste und zugleich auch die einfachste Form der Datensammlung im Internet. Die Probanden erhalten eine E-Mail, die den Fragebogen als einfachen Text enthält (Swoboda, Mühlberger, Weitkunat & Schneeweiss, 1997). Durch die Reply-Funktion des E-Mail-Clients (Software, die das Lesen und Senden von E-Mails ermöglicht) können die Befragten an den entsprechenden Stellen ein X (Kreuz) setzen bzw. einen Text einfügen und danach die E-Mail zurücksenden. Die Nachteile dieser Methode resultieren aus dem geringen Grad an Anonymität und dem geringen Automatisierungs- und Interaktionsgrad. So müssen die Ergebnisse in eine entsprechende Auswertungssoftware übertragen werden, eventuell ist auch ein Ausdrucken der E-Mails erforderlich. Des Weiteren ist es nicht möglich, adaptive Elemente einzusetzen. Die wesentlichen Vorteile gegenüber traditionellen Methoden bestehen in der Asynchronität, der Alokalität, der Einfachheit und der Ökonomie. HTML-E-Mails sind mit Hilfe der Seitenbeschreibungssprache „HTML“ (Hypertext Markup Language) verfasst. Sie können alle interaktiven Elemente beinhalten, die diese Sprache bereitstellt, z.B. Checkboxen, Radiobuttons, Textfelder und Drop-Down-Menüs. Dies vereinfacht nicht nur die Dateneingabe durch die Probanden, sondern die Ergebnisse können auch in einer Datei und ohne eine manuelle Eingabe direkt vom System erfasst werden. Der entscheidende Nachteil von HTML-E-Mails ist, dass viele E-Mail-Clients keine HTML-Mails interpretieren können oder dass diese Funktion oftmals vom Nutzer deaktiviert wird. Für innerbetriebliche Mitarbeiterbefragungen kommt diese Technik mittlerweile kaum noch zum Einsatz. HTML-Fragebögen. Die gebräuchlichste Art der Datenerhebung über das Internet ist der Einsatz von WWW-Seiten (vgl. u.a. Bandilla, 1999; Bandilla & Hauptmanns, 1998; Batinic & Neue Medien in Organisationen 13 Bosnjak, 2000). Der gesamte Fragebogen befindet sich auf einer oder mehreren zusammenhängenden Seiten und enthält verschiedene interaktive Dateneingabefelder, welche HTML bereitstellt. Die Methode, den gesamtem Fragebogen auf einer Bildschirmseite abzubilden, wird bei ca. 80% aller Webumfragen angewandt (MacElroy, 1999). HTMLFragebögen sind einfach und kostengünstig umzusetzen. In den Anfangszeiten waren noch Kenntnisse in HTML und CGI (Common Gateway Interface - Schnittstelle zwischen HTMLDokument und Server) nötig, um funktionsfähige Fragebögen zu entwickeln, aber mittlerweile gibt es diverse Software, die diese Aufgaben übernimmt (z.B. Janetzko, 1999; Batinic, Puhle & Moser, 1999). Autorenprogramme bieten die Möglichkeit, die Reihung von Antwortalternativen zufällig zu variieren, Antwortzeiten zu erfassen und die Eingaben auf Plausibilität zu prüfen. Im Gegensatz zu Befragungen per E-Mail gewährleisten HTMLBefragungen den Teilnehmern einen hohen Grad an Anonymität. Die grundlegenden Vorteile von WWW-Befragungen sind: Die Möglichkeit, große und heterogene Stichproben zu untersuchen, Flexibilität bezüglich des Untersuchungsortes und der Untersuchungszeit und damit verringerte Intrusivität der Forschung, Filterführung, Inputvalidierung in Echtzeit, breiteres Stimuluspotenzial durch Einbindung multimedialer und interaktiver Elemente, Konstanthaltung von Versuchsleitereffekten, Erleichterung transkultureller bzw. übernationaler Untersuchungen, Mitprotokollierung des Respondenten, Fehlerreduktion durch automatisiertes Datenhandling, Vermeidung von Reihenfolgeeffekten durch zufällige Itemund Distraktorfolgen und die Erfassung von Beantwortungszeiten. Die praktische Durchführung einer entsprechenden Mitarbeiterbefragung erfolgt, indem den Mitarbeitern zunächst lediglich die Intranetadresse mitgeteilt wird (z.B. über E-Mail). Diese können dann flexibel über den Zeitpunkt der Bearbeitung entscheiden. Pop-Up Umfragen. Ursprünglich dienten Pop-Up Umfragen der Erfassung von demographischen Daten der Besucher einer Website oder der Rekrutierung von Probanden für weitergehende Untersuchungen. Auch ein Pop-Up Fragebogen ist ein HTML-Fragebogen, die Besonderheit dieser Methode besteht darin, dass mittels JavaScript (eine von Netscape entwickelte Skriptsprache) der Fragebogen in einem separaten Fenster erscheint, das nicht vom Nutzer aufgerufen wird, sondern sich automatisch beim Besuch einer bestimmten Webseite (z.B. der Unternehmenshomepage) öffnet. Dabei besteht die Möglichkeit, die PopUp Umfrage zufallsgesteuert bei jedem n-ten Besucher der Seite öffnen zu lassen (Theobald, 2000; Hagenhoff & Pfleiderer, 1998). Des weiteren kann das Pop-Up Fenster auch beim Verlassen einer Seite geöffnet werden und so als Exit-Fragebogen fungieren. Die Vorteile des Neue Medien in Organisationen 14 sich selbst öffnenden Fensters bestehen in einer erhöhten Aufmerksamkeitswirkung und daraus resultierend einer höheren Antwortquote. Durch zusätzliches Setzen eines Cookies (einer Textdatei auf dem Rechner des Anwenders) kann bewirkt werden, dass pro zugreifendem Client (Browser) der Fragebogen nur einmal aufklappt, mithin Probanden mit dem selben Browser nicht mehrfach befragt werden. Ein weiterer Vorteil gegenüber einem Teilnahmeaufruf z.B. mittels Querverweis oder Werbebanner besteht darin, dass Probanden relativ zeitkonstant befragt werden können, also z.B. immer dann, wenn sie eine bestimmte Aktion ausgeführt haben. Ein Nachteil ist, dass Personen die Ausführung von JavaScript in ihrem Browser teilweise abstellen und Pop-Up's durch Werbungsfilterprogramme (z.B. Webwasher) unterdrückt werden können. Naheliegend ist es, diese Methode dann einzusetzen, wenn Daten sehr kurzfristig benötigt werden und die Zahl der gestellten Fragen deutlich begrenzt ist. Online Focus-Gruppen. Mit Marktforschungsunternehmen Online Erfahrungen Focus-Gruppen gesammelt, haben indem sie vor Chaträume allem zur Untersuchung qualitativer Forschungsfragen verwendet haben (Tse, 1999; Hagenhoff & Pfleiderer, 1998, Prickarz & Urbahn, 2002). Mittlerweile existieren Softwareprodukte, die vielen Anforderungen für die Durchführung einer Online Focus-Gruppe genügen. Die Vorteile gegenüber offline Focus-Gruppen liegen darin, dass geographische Entfernungen keine Rolle spielen und dass sie kostengünstiger und schneller umzusetzen sind. Hagenhoff und Pfleiderer (1998) nennen als weitere Vorteile die durchdachteren Antworten und ein sofort verfügbares Transkript. Nachteile entstehen dadurch, dass durch den fehlenden physischen Kontakt zwischen Interviewten und Moderator/in Körpersprache und paraverbale Äußerungen als Informationsquellen nicht zur Verfügung stehen. Probanden mit geringen PC-Kenntnissen fällt das Tippen der Diskussionsbeiträge schwer. Ebenso treten erwünschte gruppendynamische Effekte wie die wechselseitige Anregung der Teilnehmer seltener auf als in offline Focus-Gruppen (vgl. Greenbaum, 1995). WWW-Boards. WWW-Boards können mittels Internet-Skripts relativ einfach realisiert werden. Hierzu werden auf einer HTML-Seite eine oder mehrere Fragen gestellt, auf welche die Probanden zeitversetzt (asynchron) mittels HTML-Eingabefeldern antworten können. Diese Antworten können wiederum alle anderen Teilnehmer lesen und darauf antworten. Auf diese Weise entsteht ein hierarchischer Diskussionsfaden. Diese Methode eignet sich für einfache Diskussionen, die keinen Moderator erfordern (MacElroy, 1999). Das WWW-Board Neue Medien in Organisationen 15 kann um multimediale Elemente, wie beispielsweise das Einspielen von Bildern, erweitert werden. Inwiefern dieses Medium auch Weg zur Gewinnung von organisationsdiagnostisch relevanten Daten ist, wurde bisher noch nicht systematischer untersucht. Online Panels. Mit „Online Panels“ bezeichnen wir einen „Pool von registrierten Personen, welche sich bereit erklärt haben, wiederholt an marktforscherischen oder wissenschaftlichen Online Untersuchungen teilzunehmen“ (Göritz, Reinhold & Batinic, 2000, S. 62). Bei der Anmeldung zum Online Panel füllen die Teilnehmer einen Stammdatenfragebogen aus. Die dort enthaltenen Variablen dienen bei den späteren Studien als Auswahlkriterien bei der Stichprobenziehung. Die Kommunikation zwischen Untersuchungsleitung und Probanden erfolgt mittels E-Mail und auf der Panel-Website. Um festzustellen, ob sich die Teilnehmer mit ihrer richtigen Postanschrift im Panel angemeldete haben, versenden einige Online Panels postalisch einen Begrüßungsbrief bzw. rufen den Probanden vor der Freischaltung seines Accounts an. Im deutschsprachigen Raum existierten im Juli 2002 ca. 80 Online Panels mit einer Teilnehmergröße von ca. 3.000 bis 30.000 Personen. Für die Teilnahme an den Befragungen erhalten die Probanden eine Belohnung. Verweigerungs- und Abbruchquoten können im Online Panel genau bestimmt werden. Mit dieser Methode lassen sich zeitlich flexible Untersuchungspläne realisieren und Quer-, Trend- und Längsschnittdesigns umsetzen. Um datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu genügen, ist es besonders wichtig, die Personen- und Umfragedaten der Teilnehmer des Panels zu trennen. Nach unserer Einschätzung ist die Anwendbarkeit dieses Ansatzes auf innerorganisationale Fragestellungen als besonders erfolgversprechend einzuschätzen, da die Stammdaten in Form von elektronischen Personalakten oft bereits vorliegen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Mitarbeiter und ihre Vertreter (Personal- bzw. Betriebsrat) keine datenschutzrechtlichen Bedenken anmelden. Logfile-Analysen. Logfiles sind auf dem Server angelegte Protokolldateien, in denen verschiedene Aktionen der Besucher einer Website automatisch aufgezeichnet werden. Methodisch gesehen handelt es sich dabei um eine nicht-reaktive Beobachtung des Nutzerverhaltens auf einer Website. In Protokolldateien werden Zeit, Ort und Aktionsabläufe aufgezeichnet. So lässt sich beispielsweise in Kombination mit Informationen aus der CookieDatei nachvollziehen, wie oft, wann, wie lange und von wo Zugriffe erfolgten und welche Angebote der Seite abgerufen werden (Berker, 1999). Außerdem können in Protokolldateien zahlreiche technische Parameter des Besuchers, wie z.B. die Browserkonfiguration sowie Neue Medien in Organisationen 16 Umgebungsvariablen, wie z.B. der Hostname des Clients, die IP-Adresse (Internet-ProtokollAdresse) oder die vorher besuchte URL (Uniform Resource Locator - Webseitenadresse) mitgeloggt werden. Auf diese Weise sind Rückschlüsse auf mögliche Fehler (z.B. tote Links) oder unergonomischen Aufbau der Website möglich. Wird beispielsweise hauptsächlich die Startseite aufgerufen, weiterführende Inhalte bleiben aber unbeachtet, so kann dies bedeuten, dass die Angebote nicht attraktiv erscheinen oder dass die Navigation sehr unübersichtlich ist. In Tabelle 2 ist ein Ausschnitt des Logfiles der Homepage der Fachgruppe Medienpsychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) dargestellt. Jede Zeile stellt hierbei eine Aktion des anfragenden Rechners (proxy.ct-info.de) dar. Dieser Rechner hat am 24. Oktober die Eingangsseite und eine Minute später die Mitgliedsseite der Fachgruppe angefordert. Zur genauen Analyse und statistischen Aufbereitung von Logfiles stehen Anwendern zahlreiche kostenlos erhältliche Softwareprogramme zur Verfügung. Neue Medien in Organisationen 17 Tabelle 2: Ausschnitt des Logfiles der Homepage der Fachgruppe Medienpsychologie der DGPs Rechneradresse Datum, Uhrzeit und angeforderte Umgebungsinformationen Information proxy.ct-info.de proxy.ct-info.de [24/Oct/2002:14:11:10 +0200] "GET "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; / HTTP/1.0" 200 12420 " Windows 98)" [24/Oct/2002:14:11:11 +0200] "GET "http://www.fg-medienpsychologie.de/" /link.css HTTP/1.0" 304 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)" proxy.ct-info.de [24/Oct/2002:14:12:14 +0200] "GET "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; /mitglieder.php3 HTTP/1.0" 200 Windows 98)" 54648 "http://www.fgmedienpsychologie.de/" proxy.ct-info.de [24/Jul/2002:14:11:26 +0200] "GET "http://www.fg- /images/members/bat.jpg HTTP/1.0" medienpsychologie.de/mitglieder.php3" 200 2249 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)" Potentielle Anwendungsgebiete sind z.B. dort zu sehen, wo Interesse an Informationen über Interessenschwerpunkte existiert. Beispielsweise könnten Logfile-Analysen die Grundlage dafür bilden, die Attraktivität verschiedener Teile des innerbetrieblichen Weiterbildungsprogramms zu ermitteln. 2.2 Datenqualität internetbasierter Erhebungsverfahren Um die Qualität der im Internet erhobenen Daten zu beurteilen, ist es wegen der teilweise großen Unterschiede eigentlich wichtig, die beschriebenen Erhebungsverfahren voneinander zu differenzieren. So können bestimmte Merkmale und Qualitätsindikatoren für einzelne Online-Erhebungsverfahren gelten, für andere wiederum nicht. Datenqualitätsfragen stellen sich vor dem Hintergrund, dass jedes Forschungsmedium, sei es Post, Telefon oder das WWW spezifische Eigenheiten aufweist, aus denen sich verzerrende Effekte ergeben können. Z.B. kann die mangelnde Technikkompetenz oder Unerfahrenheit von Probanden bei einer computergestützten Untersuchung die Angaben der Beantwortenden beeinflussen. Neue Medien in Organisationen 18 Internetbasierte Untersuchungen sind - wie im Übrigen jede Methode - auf Fragestellungen und Materialien beschränkt, die eben mit diesem Medium realisierbar sind. Beobachtungen, wie sie ansonsten gelegentlich im Kontext von Organisationsdiagnosen durchgeführt werden, können z.B. über das Internet nur eingeschränkt realisiert werden. Unglücklicherweise ist die Datenlage bis heute als nur rudimentär zu bezeichnen. Im folgenden besprechen wir daher die Gütekriterienproblematik eher programmatisch und exemplarisch. Objektivität. Die Objektivität von Datenerhebungsverfahren kann untergliedert werden in Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität. Als ein Vorteil der Datenerhebung auf elektronischem Wege wird oft die erhöhte Durchführungs- und Auswertungsobjektivität genannt (vgl. z.B. Batinic & Bosnjak, 2000). Insbesondere HTMLFragebögen erlauben eine Vielzahl von Vorkehrungen, wie etwa das automatische Einlesen der Teilnehmerantworten in Datenbanken für weiterführende statistische Analysen. Als Kehrseite der größeren Flexibilität und (wegen des Fehlens eines/r Versuchsleiters/in) objektiven Durchführung von Untersuchungen im Internet hat man - verglichen mit offline Studien - allerdings auch weniger Kontrolle über die Identität der Probanden und über die Teilnahmesituation (Lander, 1998). Der fehlenden Sicherheit bzgl. der Identität der Probanden kann begegnet werden, indem WWW-Umfragen an geschlossenen und validierten Personengruppen realisiert werden. Neben dem bereits angeführten Online Panels können hier auch E-Mail-Adressverzeichnisse als Grundlage dienen. Um mehr Einblick über die Teilnahmesituation selbst zu erhalten, können Situationsvariablen (Zeitpunkt, Uhrzeit, Rechnerarchitektur usw.) im Rahmen einer WWW-Umfrage automatisch mit protokolliert werden. Reliabilität. Anlass für Zweifel an der Messgenauigkeit ergeben sich primär aus der Besonderheit der Untersuchungs- bzw. Datenerhebungssituation, wobei die im einzelnen unterstellbaren Antwortverzerrungen mit technischen Unzulänglichkeiten bei der Datenerhebung (vgl. Gräf, 1999), der vermeintlich oder tatsächlich fehlenden Anonymität der Erhebungssituation sowie mit der Sorglosigkeit im Prozess der Beantwortung gestellter Fragen in Zusammenhang gebracht wurden. Bereits in einer der ersten Untersuchungen zu Antwortverzerrungen fanden aber Kiesler und Sproull (1986) in einem E-Mail-Fragebogen im Vergleich zu einem Papier-Bleistift Fragebogen weniger fehlende Daten, weniger sozial erwünschtes Antworten sowie offenere Kommentare. Weitere Untersuchungen, die allerdings Neue Medien in Organisationen 19 alle nicht im organisationalen Kontext durchgeführt wurden, ergaben keine Hinweise darauf, dass die Reliabilität der Daten geringer ausfällt als in vergleichbaren Offline-Erhebungen (Batinic, 2001, Hertel, Naumann, Konradt, & Batinic, 2002). Verzerrungen sind eher auf der Ebene der Teilnahmebereitschaft (vgl. unten) zu erwarten. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass bestimmte technologische Vorkehrungen dazu geeignet sein können, die Reliabilität positiv zu beeinflussen. Hierzu zählt die automatisierte Erinnerung der Probanden an versehentlich ausgelassene Items, die flexible Präsentation von Items, um Ermüdungserscheinungen vorzubeugen oder bestimmte Itemantwortformate wie z.B. „Schieber“ (vgl. etwa Batinic et al., 1998). Validität. Die Gültigkeit der über das Internet gewonnenen Daten kann aus unterschiedlichen Perspektiven heraus analysiert werden. Besonders ausführlich hat eine Diskussion um die Repräsentativität der gewonnenen Daten stattgefunden, worauf wir zwar als Erstes eingehen, zugleich aber betonen möchten, dass es sich dabei gerade in psychologischen Untersuchungen im organisationalen Kontext oft um ein nur sekundär beachtenswertes Kriterium handelt. In einem zweiten Teil betrachten wir Befunde zur Konstruktvalidität. Repräsentativität. Sowohl in der Marktforschung als auch in breiter angelegten innerbetrieblichen Mitarbeiterbefragungen wird die Repräsentativität der erhaltenen Ergebnisse für die eigentlich interessierende Population als zentrales Gütekriterium verwendet. Zwei wesentliche Probleme können auftreten, zum einen sind die Betreffenden nicht erreichbar und zum anderen sind sie nicht bereit, an der Datenerhebung teilzunehmen. Das erste Problem stellt sich innerhalb von Organisationen anders dar, denn es läßt sich i.d.R. sicherstellen, dass die Mitarbeiter über einen entsprechenden Zugang verfügen. Die oft postulierte Verzerrung der erreichbaren Grundgesamtheit z.B. in Richtung männlicher, jüngerer, gebildeter Teilnehmer aufgrund der bloßen Zugänglichkeit der Medien ist hier also eher kontrollierbar. Werden WWW-Befragungen als frei zugängliche Untersuchungen realisiert, so besteht die Problematik der Selbstselektion der Probanden (Batinic & Bosnjak, 2000; Bandilla, 1999; Bandilla & Hauptmanns, 1998). Denkbare Verzerrungen ergeben sich dabei in Richtung von Vielnutzern des Internet und in einer Überrepräsentierung von Probanden, die in das jeweilige Umfragethema besonders involviert sind. Allerdings entspricht dieses Vorgehen im Grunde einer Strategie, einen Stapel von Fragebögen an einer beliebigen Stelle auszulegen und dann Neue Medien in Organisationen 20 darauf zu hoffen, dass die vorbeikommenden Personen repräsentativ - für welche Population auch immer - sind. Auch in offline-Untersuchungen werden daher Probanden aufgefordert, an Erhebungen teilzunehmen. Im Falle innerbetrieblicher Mitarbeiterbefragungen können z.B. allen Mitarbeitern entsprechende E-Mails zugesandt werden. Selbstselektionseffekte können allerdings auch dann entstehen, sie werden aber geringer sein und sind auch eher abschätzund kontrollierbar. Tuten (1997) fand, dass bereits das im Betreff der E-Mail formulierte Thema sowie die Bekanntheit des Absenders über das Öffnen und Lesen einer E-Mail entscheidet. Ob der versendete Fragebogen bzw. Teilnahmeaufruf den potentiellen Probanden überhaupt erreicht, ist demnach von seinem Interesse und der Vertrautheit mit dem Absender abhängig. Anderson und Ganzneder (1995) fanden im Rahmen einer E-Mail-Umfrage ebenfalls für die Teilnahme an einer Online Umfrage bedeutende Personenvariablen. Sie betonen insbesondere die Dauer und Intensität der Online Nutzung bzw. insgesamt die „Netzerfahrung“, die beide eine positive Auswirkung auf die Teilnahmebereitschaft haben und somit die Datenqualität (Repräsentativität) beeinflussen. Pop-Up Umfragen versuchen, dem Problem der Selbstselektion durch die direkte Ansprache der potentiellen Probanden zu begegnen. D.h. der User entscheidet zumindest im ersten Schritt nicht selbst, ob er Interesse hat, an der Umfrage mitzuwirken, sondern wird von der Untersuchungsleitung (per pop-up) angesprochen und zur Teilnahme aufgefordert. An dieser Stelle ist nochmals zu betonen, dass bei intranetbasierten Mitarbeiterbefragungen die Grundgesamtheit, auf die man schließen will, bekannt ist und somit - zumindest auf Basis der soziodemographischen Variablen - potentielle Verzerrungen zwischen Stichprobe und Grundgesamtheit feststellbar sind (z.B. Stanton, 1998). Somit ergeben sich hier sogar methodisch günstigere Randbedingungen als bei klassischen marktforscherischen Datenerhebungen. Konstruktvalidität. Unabhängig von der Frage, ob die gewonnenen Daten repräsentativ sind, stellt sich die mindestens genauso wichtige Frage, ob die im Intranet erhobenen Daten konstruktvalide sind, ob sie das (Konstrukt) erfassen, was sie zu erfassen vorgeben. Typischerweise wird hier untersucht, inwiefern sich die Antworten der Befragten bei internetbasierter von einer nichtinternetbasierten Befragung unterscheiden. Zwei prinzipielle Ansätze kommen hierzu in Frage. Erstens können einzelne Antworttendenzen untersucht werden. Beispielsweise fand Sproull (1986) beim Vergleich einer E-Mail-basierten Neue Medien in Organisationen 21 Mitarbeiterbefragung mit FtF-Interviews und Papier-und-Bleistift-Fragebogen eine ähnliche Datenqualität Untersuchungen (Rücklaufquote, teilzunehmen). Antworttendenzen Stanton (1998) und Bereitschaft, verglich eine an weiteren WWW-basierte Mitarbeiterbefragung mit einer parallel durchgeführten Papier-Bleistift-Umfrage. Er kommt zu dem Ergebnis, dass Probanden in der WWW-Umfrage weniger Fragen auslassen als in der Papier-Bleistift-Bedingung. Rosenfeld, Booth-Kewley und Edwards (1993) kommen bei einer Zusammenfassung verschiedener Forschungsarbeiten (Booth-Kewley, Edwards & Rosenfeld, 1992; Rosenfeld et al., 1989) zu dem Schluss, dass die Teilnahme an computergestützten Mitarbeiterbefragungen im Vergleich zu Papier-Bleistift-Umfragen ähnliche Resultate erbringt. Allerdings ist die Interpretation von Antworttendenzen als Validitätsindikatoren fraglich (vgl. Murphy & Balzer, 1989). Zweitens können die Kovarianzmatrizen der erhobenen Konstrukte mit Strukturgleichungsmodellen auf ihre Medienabhängigkeit untersucht werden, wobei hierzu bisher erst eine Studie existiert. Eine Betrachtung der Kovarianzmatrizen der verwendeten Skalen zeigte bei Stanton (1998) keine Unterschiede zwischen den beiden Bedingungen. 2.3 Zusammenfassung In dem vorliegenden Unterkapitel wurden verschiedene Online-Datenerhebungsverfahren vorgestellt. Darüber hinaus wurde anhand von verfahrensvergleichenden Studien die Qualität der im Internet erhobenen Daten diskutiert. Wie gezeigt werden konnte, existieren verschiedene Möglichkeiten, qualitative wie quantitative Daten im Internet zu erheben. Insbesondere HTML-Fragebögen finden in der Praxis vielfältige Anwendung (Batinic, 2001). Die Datenlage zur Objektivität, Reliabilität und Validität von online Erhebungen muss insgesamt als noch nicht zufriedenstellend bezeichnet werden. So existieren nur wenige Studien, die im Hinblick auf Merkmale der Datenqualität Online- mit Offline-Befragungen vergleichen. Die bisher vorliegenden Untersuchungen bestätigen Online-Befragungen eine im Vergleich zu traditionellen Erhebungsmethoden hohe Datenqualität. Neue Medien in Organisationen 22 3 Virtuelle Organisationen Unter „Organisationen“ versteht man im allgemeinen gegenüber ihrer Umwelt offene Systeme, die über eine gewisse Zeitspanne hinweg bestehen, spezifische Ziele verfolgen, eine bestimmte Struktur haben, soziale Gebilde sind und mehr oder weniger formale Verhaltenserwartungen an ihre Mitglieder formulieren. Im Zusammenhang mit der Verbreitung von Neuen Technologien ist in den letzten Jahren vermehrt von der Entstehung „virtueller Organisationen“ die Rede. Im Folgenden werden wir anhand dieses Schlagworts einige mögliche Entwicklungen und Probleme diskutieren. Hierbei wird darauf Wert gelegt, dass von spezifischen Merkmalen einzelner, womöglich schnell veralternder Technologien abstrahiert wird und vielmehr prinzipielle organisationspsychologische Fragen wie Transparenz, Interessengegensätze, Führen oder die Rolle des Vertrauens diskutiert werden. Snow, Lipnack und Stamps (1999) nennen als die drei zentralen Merkmale virtueller Organisationen „multisite, multiorganizational, dynamic“. Die Beteiligten sind also typischerweise an verschiedenen Orten tätig, es gibt äußerst enge Verflechtungen (rechtlich) unabhängiger Organisationen, und virtuelle Organisationen zeichnen sich durch eine ungewöhnlich hohe Dynamik aus (Aufgaben können sehr schnell erledigt werden, Geschäftsbeziehungen ändern sich sehr rasch, Geschwindigkeit ist eine strategische Ressource). Thematisiert werden demnach sowohl die Virtualität der Organisation im Sinne eines sozialen Gebildes als auch die Virtualität der Produkte i.S. einer sehr hohen Reaktionsbereitschaft des Unternehmens auf veränderte Marktsituationen (vgl. Davidow & Malone, 1993). Oder anders formuliert: Unter Virtualisierung von Organisationen werden zwei deutlich verschiedene Verständnisse subsumiert, einerseits Virtualisierung im Sinne von virtuellen Realitäten („Entmaterialisierung“), andererseits im Sinne einer dynamisch-flexiblen Organisationsstrategie. Als in der Literatur häufig erwähnte Merkmale virtueller Organisationen führen Scherm und Süß (2000) vier Elemente an: ergebnisorientierte flexible Teamstrukturen, Delokalisierung von Arbeitsplätzen, temporäre Beschäftigung der Mitarbeiter sowie die Existenz von (nur noch) zwei Hierarchieebenen. Interessant ist, dass „virtuell“ in einer früheren Bedeutung oder Verwendung für „scheinbar“ stand, also etwas, das nicht wirklich existiert, sehr wohl aber wirkt. Man möchte meinen, dass mit dem Begriff „virtuelle Organisation“ zum Ausdruck gebracht werden soll, dass es so aussieht, als würden sie wirken, ohne tatsächlich „existent“ zu sein. Vermutlich leiten sich Neue Medien in Organisationen 23 solche Überlegungen aus der Annahme ab, Organisationen könne man typischerweise „sehen“, und sie seien schon deshalb Wirklichkeit. Dem kann allerdings entgegengehalten werden, dass einige Organisationstheoretiker schon lange vor dem Siegeszug der elektronischen Medien Organisationen als sozial definiert und (re-)konstruiert interpretiert haben (Weick, 1995). Warum entstehen nun aber virtuelle Organisationen und warum sollten sie (besonders) erfolgreich sein? Die Antwort auf diese Frage kann darin gesucht werden, dass die Virtualisierung dabei helfen sollte, charakteristische Organisationsprobleme besonders gut zu lösen. Und umgekehrt sollten virtuelle Organisationen dann mit besonders großen Schwierigkeiten konfrontiert werden, wenn typische Organisationsprobleme durch die Virtualisierung noch verstärkt werden. Im folgenden diskutieren wir vier exemplarische Themen: (1) Organisationen müssen gegenüber ihrer Umwelt offen sein, (2) sie werden geschaffen, um Kapazitätsprobleme zu lösen, (3) sie erlauben es, Interessen zu verwirklichen und (4) sie ermöglichen es, Transaktionen effizienter durchzuführen. 3.1 Offenheit gegenüber der Umwelt Organisationen sind gegenüber ihrer Umwelt offene Systeme (vgl. Katz & Kahn, 1966). Wenn sie über verschiedenste Wege und insbesondere über kommunikationserleichternde Medien mit ihrer Umgebung in Verbindung stehen, dann erhöht sich hierdurch die Offenheit gegenüber der Umwelt. Zudem setzen sich Organisationen aus verschiedenen Subsystemen zusammen. Auch deren Offenheit zueinander sollte aufgrund des Medieneinsatzes entsprechend zunehmen. Die größere Offenheit von Organisationen ist für zwei theoretische Ansätze der Erklärung unternehmerischen Erfolgs von Interesse. Nach der Wachheitsthese („alertness“; vgl. Kirzner, 1979) zeichnet sich ein erfolgreicher Unternehmer vor allem durch das im Vergleich zu Wettbewerbern schnellere Erkennen von Chancen aus. Die einfache Zugänglichkeit vielfältiger Informationen müsste hierfür von Vorteil sein. Bereits im ersten Abschnitt haben wir erläutert, wie Organisationen mit Hilfe der Neuen Medien einfacher und schneller auf eine Vielzahl von Informationen zurückgreifen können. Beispielsweise können aktuellste Marktforschungsdaten oder Kundenwünsche sehr rasch erfasst und umgesetzt werden. Diese Überlegungen setzen nun allerdings voraus, dass die entsprechenden Informationsquellen auch zugänglich sind. Bei genauerer Betrachtung setzt dies dreierlei voraus. Erstens müssen die Daten prinzipiell zur Verfügung stehen bzw. publik gemacht werden. Da Informationen aber einen hohen Wert haben Neue Medien in Organisationen 24 und deren Publikmachen aufwendig ist, kann hiervon nicht unbedingt ausgegangen werden. Zweitens muss die suchende Organisation gewillt und in der Lage sein, die Informationsquellen zu nutzen. Dass dies nicht selbstverständlich ist, dürfte ebenso auf der Hand liegen. Beispielsweise versperren viele Organisationen ihren Mitgliedern den Zugang zu bestimmten Informationen, während in anderen Organisationen die Kompetenz der Mitarbeiter nicht immer ausreicht, um die Daten zu finden oder zu interpretieren. Drittens muss sichergestellt sein, dass die gewinnbaren Daten vertrauenswürdig sind. Offensichtlich haben Organisationen aber oft Interesse daran, nur bestimmte Informationen bekannt zu machen oder Daten eine gewisse „Färbung“ zu geben, wie dies z.B. aus der Forschung über organisationale Kontrollsysteme seit Jahrzehnten bekannt ist (vgl. Lawler, 1975). Nach der These der strukturellen Löcher (Burt, 1992) entsteht unternehmerischer Erfolg durch die Knüpfung eines Beziehungsnetzes, dessen „Knoten“ (Kunden, Lieferanten) nur schwach untereinander verbunden sind. Diese „Schwäche“ besteht u.a. in Informationsmängeln und unzulänglicher Kommunikationsinfrastruktur zwischen den Knoten. Die Chancen für diese Art von Unternehmertum müssten sich eher verschlechtern, wenn sich die Kommunikationsinfrastruktur weiter verbessert und dies zu mehr Transparenz führt. Aber wie bereits erläutert, sind nicht alle Akteure daran interessiert, hierzu auch wirklich beizutragen, wenn es an einer kooperativen Grundhaltung fehlt. Mit den beiden soeben skizzierten Ansätzen wurde bereits deutlich, dass die durch die Neuen Medien ermöglichte große Offenheit zwischen Organisationen nicht sicher und auch nicht immer erwünscht ist. Im innerorganisationalen Kontext ist dies zunächst einmal anders einzuschätzen. Vom Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien lassen sich erhebliche Verbesserungen in der Kooperation der Akteure erwarten. Bei näherer Betrachtung sind allerdings die Auswirkungen elektronischer Informations- und Kommunikationssysteme auf Gruppenprozesse nicht einfach umschreibbar, weil eine ganze Reihe verschiedener Softwaresysteme existiert. Beispielsweise zählen Nunamaker, Briggs und Mittleman (1995) elf verschiedene Groupware-Werkzeuge auf, die neben der unmittelbaren Abfrage und Weitergabe aktueller Informationen auch der Bildung einer Dokumentationsdatenbank, der Konferenzorganisation oder dem Projektmanagement dienen. Es lassen sich durchaus positive Effekte der Verwendung elektronischer Kommunikationstechnologie aufzeigen. Hierfür sind beispielhaft die bisher durchgeführten Untersuchungen zur Verbesserung von Brainstorming durch den Einsatz elektronischer Kommunikations- Neue Medien in Organisationen 25 mittel, die von Diehl und Ziegler (2000) zusammenfassend dargestellt werden, zu nennen. Insbesondere kann demnach der in FtF-Gruppen festgestellte Effekt der Produktionsblockierung (= Norm, nicht zu reden, wenn andere reden), der die Unterlegenheit (Mullen, Johnson & Salas, 1991) von Brainstorming in Gruppen (vgl. Diehl & Stroebe, 1991) im Vergleich zu individuellem Brainstorming erklärt, durch geeignete netzwerkbasierte Techniken reduziert werden. Andererseits kann sich die Offenheit der Informations- und Kommunikationswege zu einem neuen Stressor entwickeln. Hierzu zählen z.B. die eventuelle Informationsüberflutung aufgrund der sehr einfachen Verbreitbarkeit von Daten, die prinzipielle Dokumentation (und damit auch Sanktionierbarkeit) von elektronischer Kommunikation oder unzulängliches Wissensmanagement, das zu einer neuen Form von „Unübersichtlichkeit“ und Gefühlen der Unkontrollierbarkeit führen kann. Bis dato ist aber sicherlich zu wenig erforscht, inwiefern sich tatsächlich neue Belastungs- und Beanspruchungskonstellationen an „informatisierten“ Arbeitsplätzen ergeben (Moser, Preising, Göritz & Paul, 2002). 3.2 Die Lösung von Kapazitätsproblemen Aus einer kapazitätsorientierten Sichtweise entstehen Organisationen, wenn technische oder technologische Umstände die Möglichkeiten von Individuen überfordern. Organisationen entstehen also z.B., weil Einzelne kaum in der Lage sein dürften, Autos oder Flugzeuge zu bauen, komplizierte die Gesundheit wiederherstellende Operationen durchzuführen oder für die Aufrechterhaltung eines friedlichen Zusammenlebens zu sorgen. Bei genauerer Betrachtung kann diese Sichtweise aber lediglich erklären, warum Kooperation entsteht; Kooperation erfordert aber nicht, dass Organisationen entstehen (Ouchi, 1980). Tatsächlich ermöglicht die Virtualisierung von Organisationen Kooperation ohne formale Organisation, woraus sich die Annahme ableiten lässt, dass die Virtualisierung von Organisationen dann zur Verkleinerung (bei gleichzeitiger Vernetzung) von Organisationen führen wird, wenn das Entstehen der Organisation kapazitätsmotiviert war. Die Rückbesinnung darauf, dass Organisationen kooperative Gebilde sind, kann beispielhaft mit zwei Phänomenen in Zusammenhang gebracht werden. Zum einen haben Organisationen ein Interesse daran, die Kooperation möglichst flexibel zu handhaben und z.B. temporäre Beschäftigungsverhältnisse einzugehen (vgl. Galais & Moser, 2001). Zum zweiten können die Arbeitsverhältnisse aber auch dahingehend „virtueller“ werden, dass zunehmend „virtuelle Arbeitsgruppen“ (Hertel & Konradt, 2000) eingeführt werden. Neue Medien in Organisationen 26 Interessanterweise hängt der Versuch, solche Strukturen einzurichten, wesentlich vom Verhalten der beteiligten Führungskräfte ab. Wiesenfeld, Raghuram und Garud (1999b) sehen drei Facetten des Selbstkonzepts von Führungskräften bedroht: Identität, Selbstwertgefühl und Kontrollerleben. Die Identität wird beeinträchtigt, da die Rolle als Führungskraft in Frage gestellt wird, wenn sich die Organisation von einer hierarchischen in eine netzwerkartigen Struktur verändert und der Charakter der Organisation, welcher die Grundlage für die organisationale Identifikation ist, weniger klar ist, insofern Hinweise wie Architektur, (einheitliche) Kleidung oder das (informelle) Verhalten von Kollegen weniger oder nicht mehr zugänglich sind. Das Selbstwertgefühl kann durch negative Erfahrungen beeinträchtigt werden. So kann in virtuellen Arbeitsarrangements durch den fehlenden persönlichen Kontakt auch zeitnahes Feedback auf Bemühungen um „lenkendes Führen“ von Mitarbeitern vermisst und die subjektive Bedeutung der eigenen Position kann als gefährdet wahrgenommen werden, wenn Mitarbeiter allzu selbständig agieren. Das Kontrollerleben ist beeinträchtigt, wenn Führungskräfte keinen uneingeschränkten Zugang mehr zu bestimmten Ressourcen haben. Beispielsweise ist es praktisch unmöglich, Verhalten und Kompetenz von Mitarbeitern unabhängig von den Arbeitsergebnissen zu beurteilen. Cascio (1999) hat diese Auffassung mit der Aussage: „How can I manage them if I can’t see them?“ auf den Punkt zu bringen versucht. Nun könnte gegen die zuletzt genannten Punkte angeführt werden, dass in solchen Fällen lediglich ein unangemessenes Führungsverständnis zum Ausdruck kommt. Wir meinen allerdings, dass hier eine wichtige Funktion von Organisationen angesprochen wird, sie sind auch Orte, in denen persönliche Bedürfnisse befriedigt und Interessen verfolgt werden. 3.3 Die Verwirklichung von Interessen Aus einer interessenorientierten Sichtweise könnte argumentiert werden, dass Organisationen zweckgerichtete Aggregate von Individuen sind, die koordinierte Anstrengungen unternehmen, um explizit anerkannte Ziele zu verfolgen (Blau & Scott, 1962). Paradebeispiele hierfür sind etwa Parteien, Verbände oder Genossenschaften. Aber auch Wirtschaftsunternehmen können so verstanden werden, nämlich als Ort, an dem Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen koordiniert werden. Allerdings sind sich die Individuen in Organisationen - jedenfalls ab einer bestimmten Größe - nur in den seltensten Fällen über ihre Ziele gänzlich einig. Nun könnte man argumentieren, dass virtuelle Organisationen dieses Problem besser zu lösen vermögen. Da Neue Medien in Organisationen 27 Ziele, Interessen und Hintergrundinformationen effizient erfragt und bekannt gemacht werden können, sollte es einfacher sein, Zielkongruenz herzustellen. In Übereinstimmung mit dieser Annahme haben einige Studien gezeigt, dass elektronische Kommunikation zu einer „Versachlichung“ beiträgt. Beispielsweise fand Grote (1994), dass elektronische Kommunikation mehr Elemente von Aufgabenorientierung und weniger Elemente von Mitarbeiterorientierung enthielt als persönliche Kommunikation und Telefongespräche. Solche Befunde werden bemerkenswerterweise allerdings von Verhaltenswissenschaftlern eher als Problem angesehen, zumindest aber wird die Frage, ob der Einsatz Neuer Technologien eher zu einer „Entmenschlichung“ der Kommunikation oder aber eher als neue Chance zu sehen ist, kontrovers diskutiert (Kiesler, Siegel & McGuire, 1984; Kraut et al., 1998; Schachtner, 1999; Garton & Wellman, 1995). Die These von der Versachlichung der Kommunikation in computer-basierten Szenarien wird durch Befunde von Reid, Malinek, Stott und Evans (1996) gestützt. Die Forscher untersuchten in einer experimentellen Versuchsanordnung die Auswirkungen von elektronischer (cvK) vs. Face-to-Face (FtF) Kommunikation in Arbeitsgruppen. Es zeigte sich, dass die cvK Gruppen für die Bearbeitung der gestellten Aufgaben mehr Zeit benötigten als die FtF-Gruppen, die Qualität des Outputs war in beiden Bedingungen vergleichbar. Die Teilnehmer der cvK Gruppen zeigten sowohl weniger sozio-emotionale Reaktionen als auch eine geringere Aufgabenorientierung als die FtF-Gruppen. Reid et al. interpretieren dies dahingehend, dass die Mitglieder von cvK Gruppen bei der Versendung von Nachrichten stärker selegieren und vor allem auf die Faktoren Dringlichkeit und Relevanz achten. Nachdem einige Zeit die „Sachlichkeit“ bzw. stärker aufgabenbezogene Kommunikation als wesentliches Merkmal von cvK herausgestellt worden war (vgl. „Kanalreduktionsmodell“; Döring, 1999, 2000b), ist vor allem durch Untersuchungen von Walther (z.B. Walther & Burgoon, 1992; Walther & Tichwell, 1995) Kritik an der entsprechenden Forschung aufgekommen. Walther (2000) fasst wie folgt zusammen: „Die Untersuchungen zum Modell der Sozialen Informationsverarbeitung weisen darauf hin, dass cvK potentiell eher interpersonell als strikt unpersönlich ist, und dass es möglich und auch wahrscheinlich ist, dass durch Kommunikation via Computer ein ganz normales Niveau der Beziehungsqualität erreicht wird. Zu erwarten ist aber, dass zeitliche Bedingungen und Hinweisreize mit dem Medium auf deutliche und interessante Art und Neue Medien in Organisationen 28 Weise interagieren. CvK mag somit für ad hoc und punktuell für eine bestimmte Aufgabe zusammengestellte Arbeitsgruppen sozial nicht zufriedenstellend sein. Wenn diese Kommunikationsform aber bei weiterlaufenden, langfristigen Teams oder Komitees eingesetzt wird, sind die sozialen Effekte vielversprechend. Anstatt sich über extreme Wege der Normalisierung, z.B. durch die stilisierte Einführung von Beziehungszeichen und Smileys, Gedanken zu machen, solle man Mitglieder von cvK-Teams in einem Kontext von andauernder Zusammenarbeit sich mehr oder weniger selbst überlassen. Sie werden ihre Ausdrucksweise und -möglichkeiten dazu verwenden, Emotionalität im Medium zu generieren“ (S. 17). Ein Vergleich der verschiedenen Modellvorstellungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen medialer Kommunikation auf Arbeitsbeziehungen wurde insbesondere in Arbeiten von Döring (1999, 2000b) vorgenommen. Wesentliches Fazit der entsprechenden Forschung ist, dass die konkreten Folgen der Nutzung elektronischer Kommunikationsmedien von solch verschiedenen Faktoren abhängen wie der (Un-)Reflektiertheit der Verwendung von Medien, der Kooperationsbereitschaft der Beteiligten, den Kompetenzen im Umgang, den Zielen, die die Beteiligten verfolgen oder den Normen im Umgang mit den Medien. Der Befund, dass elektronische Kommunikation aufgrund fehlender sozialer Hinweisreize zur Reduktion typischer Statuseffekte führt, kann einerseits zur Stützung der These der „EntEmotionalisierung“ in der cvK herangezogen werden, anderseits aber auch als Beleg, dass cvK aufgrund fehlender Statusmerkmale eine offene Kommunikation begünstigt (vgl. aber Weisband, Schneider & Connolly, 1995). Bisher haben wir die Sichtweise fokussiert, wonach elektronische Kommunikation zur „Versachlichung“ beiträgt - wobei dies eigentümlicherweise oft als Problem diskutiert wird. Wir meinen, dass es unter bestimmten Bedingungen sehr wohl vorteilhaft ist, eine solche Versachlichung zu erreichen. Bereits im vorhergehenden Abschnitt wurde erläutert, dass Führungskräfte oft Widerstände gegen die Einführung von virtuellen Arbeitsgruppen zeigen. Dies lässt sich auch dadurch begründen, dass sie bestimmte Interessen haben (z.B. Macht, Kontrollerleben), die mit denen ihrer Mitarbeiter nicht unbedingt übereinstimmen. Seit einiger Zeit werden als Vorteile der „neuen Arbeits- und Organisationsformen“ diskutiert, dass sie veränderten Wertvorstellungen und Werthaltungen entgegenkommen: „Sie machen Ziele des Individuums, wie z.B. Symbole, die aus typographischen Zeichen entwickelt seitwärts betrachtet Gesichter darstellen, sind etwa: :-) fröhliches Gesicht, :-( unglückliches Gesicht. Neue Medien in Organisationen 29 Selbstbestimmung, Mobilität und Unabhängigkeit, zu Grundbausteinen organisatorischer Gestaltungskonzepte“ (Reichwald et al., 1998, S. 12). Vor diesem Hintergrund werden womöglich Mitarbeiter die mögliche Offenheit und Sachlichkeit elektronischer Kommunikation anders werten als ihre Vorgesetzten. Noch deutlicher wird dies aus der Perspektive des mikropolitischen Ansatzes der Organisation (Neuberger, 1995), wenn man sich gewahr wird, dass Informationen eine Ressource sind, deren Wert sich darin ausdrückt, dass sie zurückgehalten, beschönigt oder „verkauft“ werden. Elektronische Kommunikation wird hier kaum zur Interessen- bzw. Zielkonvergenz beitragen, sie wird ebenso strategisch eingesetzt werden können wie vieles andere auch. Die Idee eines Interessengegensatzes zwischen einzelnem Mitarbeiter und Organisation ist einer der Kerngegenstände zahlreicher Organisationstheorien und wurde neuerdings wieder im „Prinzipal-Agenten-Dilemma“ aufgegriffen. Dieses Dilemma geht davon aus, dass der Agent (= Ausführende) dem Prinzipal (= Eigner) unterstellt ist. Risiken ergeben sich für den Prinzipal dadurch, dass er Informationsdefizite hat, so über die Art, wie sich der Agent anstrengt, welche Absichten er hat oder welche Qualitätseigenschaften die von ihm erbrachten Leistungen letztendlich aufweisen. Selbstverständlich könnte man nun entgegnen, dass durch entsprechende Verträge zwischen den Partnern solche Risiken möglichst ausgeschaltet werden können. Die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte haben jedoch gezeigt, dass von solchen Verträgen sogar zunehmend abgesehen wird. An deren Stelle treten unvollständige oder „psychologische“ Kontrakte, die insbesondere auf Vertrauen statt Kontrolle setzen. Nun könnte zwar angenommen werden, dass durch elektronische Informations- und Kommunikationssysteme mehr Einblicke in die Art der Leistungserbringung möglich ist. Tatsächlich aber stellen z.B. Reichwald et al. (1998) fest, dass mit zunehmendem Grad an Vernetzung der Stellenwert des Vertrauens zwischen den Beteiligten ganz im Gegenteil sogar bedeutender wird. Dies mag als eine überraschende Kehrtwendung unserer Argumentation anmuten. Die leichte Zugänglichkeit von Informationsund Kommunikationstechnologien erleichtert die Kontrolle, zugleich aber erfordert ihr konsequenter Einsatz einen zunehmenden Verzicht auf eben diese Kontrolle, also Vertrauen? 3.4 Organisationen als Reaktion auf Marktversagen Der Vorteil von Märkten ist, dass dort Transaktionen möglich sind, ohne dass z.B. Kosten für Führungskräfte, Buchhalter oder Personalabteilungen entstehen. Solche Kosten, die entstehen, um die eigentlichen Transaktionen in die Wege zu leiten, werden als Transaktionskosten Neue Medien in Organisationen 30 bezeichnet. In Wettbewerbsmärkten wird durch Preismechanismen gewährleistet, dass günstige Preise erzielt werden. Transaktionskosten entstehen dann, wenn es schwierig ist, den Wert von Gütern oder Dienstleistungen zu bestimmen, weil z.B. das Vertrauen zwischen den beteiligten Parteien (z.B. Verkäufer und Käufer) fehlt. Unter solchen Bedingungen entsteht Aufwand um den Wert von Leistungen schätzen zu lassen, um Verträge juristisch prüfen zu lassen, um Gutachter zu bezahlen usw.: Es entstehen Transaktionskosten. Nach dem Transaktionskostenansatz (Coase, 1937; Williamson, 1975) gibt es Organisationen, weil sie Transaktionen zu geringeren Kosten ermöglichen als der Marktmechanismus. Organisationen haben zwei prinzipielle Vorteile gegenüber Marktbeziehungen. Erstens nutzen sie Beschäftigungsbeziehungen, die von ihrer Natur aus unvollständige Verträge sind (z.B. Kotter, 1973; vgl. den Beitrag von Moser, in diesem Band). In diesen Verträgen ist nicht genau spezifiziert, was Mitarbeiter zu bestimmten Zeitpunkten in der Zukunft zu tun haben. Zudem besteht prinzipiell Gelegenheit, die Leistung der Mitarbeiter kontinuierlich zu kontrollieren. Damit sollen die Verlässlichkeit der Transaktionspartner in Anbetracht begrenzter Rationalität und ungewisser bzw. instabiler Umgebung und die Qualität der Güter oder Dienstleistungen des Transaktionsprozesses sichergestellt werden. Zweitens können Organisationen eine Vertrauensatmosphäre schaffen, in der ein gewisses Maß von Zielübereinstimmung zwischen Organisation und Individuum erreicht werden kann. Dies ermöglicht es wiederum, auf eine umfangreiche Kontrolle der Leistungen von Mitarbeitern zu verzichten, was die Transaktionskosten in Grenzen hält. Nun gibt es aber Aufgaben, bei denen es den beurteilten Personen besonders schwer fällt, die Beurteilungen der Leistungen als gerecht zu empfinden, nämlich dann, wenn sie durch hohe Ambiguität gekennzeichnet sind. In einer Arbeitgeber/Arbeitnehmer-Beziehung sind die Mitarbeiter darauf angewiesen, dass der Arbeitgeber die Löhne gerecht verteilt, und wenn sie dem Arbeitgeber nicht vertrauen, dann werden sie vertraglichen Schutz verlangen (z.B. Vertretung durch Gewerkschaften) und die Transaktionskosten werden zunehmen. Um also Transaktionen effizient abzuwickeln, muss jede Organisation entweder versuchen, die Ambiguität von Leistungsbeurteilungsdimensionen zu reduzieren oder die Zielübereinstimmung zwischen den beteiligten Parteien zu erhöhen. Akzeptiert man die vom Transaktionskostenansatz thematisierten Ursachen für die Entstehung von Organisationen, dann verträgt sich dies nur wenig mit der Vorstellung virtueller Organisationen. Insbesondere fällt es schwer, von elektronischen Informations- und Kommunikationssystemen Beiträge zur (a) Neue Medien in Organisationen 31 Reduktion in der Ambiguität von Leistungsbeurteilungsdimensionen oder (b) Verbesserung der Zielübereinstimmung zu erwarten. Es lässt sich allenfalls dort ein Ansatzpunkt finden, wo die Technologien zum mehr oder weniger kontinuierlichen Überwachen der Arbeitsfortschritte genutzt werden können. Hingegen nehmen die Probleme der Leistungsbeurteilung in technologieintensiven Tätigkeiten eher noch zu (Hesketh & Neal, 1999). Wir sehen zwei prinzipielle Antworten, die in virtuellen Organisationen gegeben werden. Die eine Antwort akzeptiert die aufgezeigten Schlussfolgerungen und bedient sich (oft unwissentlich!) der Einsicht, dass es noch eine dritte Möglichkeit gibt, Transaktionen zu organisieren. Sie geht davon aus, dass die Ziele der beteiligten Parteien auch kongruent sein können und dass Organisationen Maßnahmen ergreifen können, die Ziele zwischen Individuum und Organisation in größere Übereinstimmung zu bringen. Auf diese Art und Weise organisierte Individuen werden von Ouchi (1980) als Clan bezeichnet. In solchen Organisationen spielen Leistungsbeurteilungen eine ganz untergeordnete Rolle und sie zeichnen sich durch „starke“ Organisationskulturen aus (vgl. weiterführend Moser, 1996). Die zweite Antwort widerspricht den Grundannahmen des Transaktionskostenansatzes und geht davon aus, dass Ziele nur klar genug kommuniziert werden und Leistungen in Form von Ergebnissen kontrolliert werden sollten. „Führen durch Zielvereinbarungen“ oder auch „ergebnisorientiertes Führen“ sind die entsprechenden Schlagworte; der in Abschnitt 3.2 angesprochene Kontrollverlust, den viele Führungskräfte befürchten oder bereits empfinden, wird dann zur Tugend definiert: Führungskräfte in virtuellen Organisationen sollen ergebnisorientiert führen, delegationsfähig sein und (im übrigen) ihren Mitarbeitern vertrauen (Cascio, 1999). Reichwald et al. (1998) nennen als weitere Probleme ergebnisorientierten Führens, dass - Ergebnisse wesentlich aufwendiger zu bewerten seien als das Verhalten der Mitarbeiter, - die Betonung der Ergebnisebene zu mehr wahrgenommenem Risiko auf Seiten der Mitarbeiter und damit zu Akzeptanzproblemen führe und Erwähnenswert ist, dass Cascio (1999) auf die Praxis einiger Unternehmen hinweist, neue sowie frisch beförderte Mitarbeiter nicht in virtuelle Arbeitsbeziehungen einzubinden. Offensichtlich wird anerkannt, dass mangelnde (Berufs-) Erfahrung insbesondere persönliche Kommunikation erfordert (vgl. ähnlich Scherm & Süß, 2000), ganz abgesehen von den vielfältigen anderen Zielen organisationaler Sozialisation (vgl. den Beitrag von Moser, in diesem Band). Neue Medien in Organisationen - 32 die Mitarbeiter zusätzliche „Risikoprämien“ einfordern würden. Das Fazit von Reichwald et al. (1998) relativiert schließlich auch aus unserer Sicht durchaus berechtigt die Konsequenzen der Telekooperation: „Gleichwohl bedeuten diese Bedenken kein „Aus“ für die Telekooperation – ganz im Gegenteil. Eine Führung durch Zielvereinbarung anstelle der Zielvorgabe, aber auch organisatorische Führungsmaßnahmen Qualifizierungsmaßnahmen oder wie die regelmäßige Festlegung von Mitarbeitergespräche, Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten, erlauben es, verhaltens- und ergebnisorientierte Formen der Führung im Unternehmen sinnvoll zu kombinieren und direkten Führungsbedarf teilweise zu substituieren. Damit trotz der ungleichen Informationsverteilung (hidden information) Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten aufgebaut werden kann, sind sogenannte Beziehungsverträge sinnvoll. Inwieweit Mitarbeiterführung dabei unter Verzicht auf direkte persönliche Führung gelingen kann, hängt dann in entscheidendem Maße von der Vertrauensbasis zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten, der Motivationsstruktur der Mitarbeiter, der Mitarbeiterqualifikation sowie der Art der Aufgabenplanung und strukturierung ab“ (S. 139). 3. 5 Zusammenfassung Die Virtualisierung von Organisationen durch elektronische Medien eröffnet eine Vielzahl von Herausforderungen an die Organisationspsychologie. In diesem Kapitel wurden einige beispielhafte Fragestellungen erörtert. Ausgehend von den Vor- und Nachteilen der veränderten Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten wurden insbesondere die Herausforderungen an das Verhalten von Führungskräften diskutiert. Exemplarisch wurde wiederholt das Spannungsverhältnis von Vertrauensbereitschaft gegenüber den unterstellten Mitarbeitern auf der einen Seite und dem Plädoye für mehr ergebnisorientiertes Führen auf der anderen Seite herausgearbeitet. 4 Neuere technologische Entwicklungen Neue Medien in Organisationen 33 Stellt man Verfahren und Methoden der Organisationspsychologie vor, deren Ausgestaltung erheblich von der technologischen Entwicklung abhängig ist, so besteht immer die Gefahr, dass mit dem Fortschreiten dieser Entwicklung die gewonnenen Erkenntnisse rasch veralten. Diese Gefahr ist insbesondere bei der Auseinandersetzung mit dem Internet gegeben. Internetdienste, wie beispielsweise das World Wide Web, haben in nur wenigen Jahren seit ihrer Einführung zahlreiche Veränderungen und Erweiterungen erfahren. Um mit unserem Beitrag nicht nur aktuelle Forschungsarbeiten zu reflektieren, sondern dem interessierten Leser auch einen Ausblick auf potentielle zukünftige Forschungsfelder zu ermöglichen, werden wir im Folgenden drei unserer Ansicht nach besonders wichtige technologische Entwicklungen, die sich im Internet vollziehen, aufgreifen. Im einzelnen sind dies Breitbanddatenübertragung, mobile Internetkommunikation und virtuelle 3-D Welten. Wir haben uns somit weitgehend auf technologische Entwicklungen beschränkt, für die bereits im Jahr 2002 Prototypen und erste Anwendungen entwickelt wurden und deren künftige Verbreitung in naher Zukunft abzusehen war. 4.1 Breitbanddatenübertragung Die Geschwindigkeit, mit der man eine Datei aus dem Internet herunterladen bzw. versenden kann, hängt wesentlich von der Datenübertragungsrate pro Zeiteinheit (kbit/s im Download und Upload) des Internetzugangs ab. Als Maß der Geschwindigkeit wird üblicherweise die Einheit „Zeichen pro Sekunde“ verwendet, wobei 10 Datenbits ein Zeichen kodieren. Mit einem „33.600 Modem“ ist es möglich, 3.400 Zeichen pro Sekunde zu übertragen. Mit Hilfe eines ISDN-Anschlusses kann unter optimalen Bedingungen dieser Wert auf 7.500 Zeichen pro Sekunde gesteigert werden. Dies entspricht ca. 6 DIN-A4 Seiten Text, den ein Internetnutzer mit Hilfe eines ISDN-Internetzugangs unter optimalen Bedingungen pro Sekunde empfangen oder versenden kann. Erscheinen diese Werte für die Übertragung von Texten noch recht zufriedenstellend, so ist doch mit ihnen die Übertragung von multimedialen Informationen nur in sehr unzureichender Qualität zu bewerkstelligen. Möchte man beispielsweise Audiodateien in einer CD-ähnlichen Qualität in Echtzeit abspielen, so wird eine Bitrate von 128 kbit/s (bzw. zwei ISDN-Leitungen) benötigt. Im Falle der Übertragung von Filmen, bei denen neben dem Ton auch die Bildinformation mit versendet werden muss, steigt der Bedarf an Bandbreite, d.h. Übertragungsleistung, weiter an. Dies führte dazu, dass Dienste wie Internet-Videokonferenzen, Internet-TV, Internet-Radio oder Internet-Telephonie bisher (Stand: Ende 2002) nur in unzureichender Qualität möglich waren. Neue Medien in Organisationen 34 Seit Anfang 2000 werden in Deutschland Breitbanddatenübertragungszugänge zu einer relativ niedrigen Monatspauschale an Firmen und Privathaushalte vertrieben. Diese neue Zugangsmöglichkeit zum Internet erlaubt eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 768 kbit/s im Download (d.h. 90.000 Zeichen pro Sekunde) und von bis zu 128 kbit/s im Upload (15.000 Zeichen pro Sekunde). Laut Angaben der Deutschen Telekom verfügten im November 2000 in Deutschland über 300.000 Haushalte über einen entsprechenden Breitband-Internetanschluss (der Markenname lautet „T-DSL“). Es ist zu erwarten, dass dieser Übertragungsstandard sich in den folgenden Jahren zunehmend etablieren und die leistungsschwächeren Modems und ISDN-Anschlüsse allmählich ablösen wird. Breitbandige Internetzugänge werden die Verbreitung zahlreicher bisher nur vereinzelt genutzter Angebote im Internet fördern. Anwendungsfelder, die im organisationalen Kontext betroffen sein können, sind: - multimediale und interaktive Lehrfilme werden Seminarteilnehmern über das Internet zugespielt, - virtuelle Arbeitsgruppen tauschen sich in internetbasierten Videokonferenzen aus, - Referenten und Teilnehmer können von „zu Hause aus“ an virtuellen Weiterbildungskonferenzen teilnehmen, - mit Hilfe digitaler Kameras können Face-to-Face Befragungen in einer hohen technischen Qualität im Internet bzw. Intranet realisiert werden. Wie an den Ausführungen zu erkennen ist, begünstigt die Breitbanddatenübertragung vor allem multimediale und interaktive Kommunikation und Interaktion im Internet. Hierbei wird sich das Internet unserer Ansicht nach weg von einem bisher eher textbasierten und statischen hin zu einem multimedialen und interaktiven Medium wandeln. Liegt die entsprechende Hardware vor, ist weiter anzunehmen, dass sich die bestehende Teilung zwischen Fernsehen, Internet und Telefon in Zukunft allmählich auflösen wird. Vorstellbar sind multifunktionale Endgeräte, die die bisher getrennten Medien in einem Gerät miteinander verbinden. Telefonate, während denen man sich gegenseitig Dokumente zuspielt, Fernsehsendungen mit weitergehenden Hintergrundinformationen im Internet und Video-on-demand werden ohne einen Medienbruch möglich sein. Neue Medien in Organisationen 35 4.2 Mobile Internetkommunikation Bereits im Jahr 2002 ermöglichen es Handys, Palmtops und Laptops weitgehend unabhängig von einem lokalen Arbeitsplatz, elektronische Dokumente zu versenden und zu empfangen. Die Datenübertragungsrate dieser Geräte ist jedoch noch gering. Durch die Vergabe der UMTS Lizenzen (Universal Mobile Telecommunications System, einem Datenübertragungsstandard für die Versendung von Informationen über das Handynetz) wird sich dieser Umstand in den kommenden Jahren deutlich wandeln. So sind unter idealen Bedingungen mit Hilfe von UMTS Datenübertragungsraten von bis zu 2 MBit/s möglich. Diese hohe Bandbreite erlaubt das viel einfachere Abspielen und Empfangen von digitalen Videos sowie den Austausch von Dokumenten und sonstigen elektronischen Informationen. 4.3 Virtuelle 3-D Welten In virtuellen 3-D-Welten werden Plätze, Landschaften oder Gebäude graphisch dargestellt. Internetnutzer, die sich in diese „virtuellen Welten“ einwählen, werden dort in Form einer virtuellen Figur in dem Szenario abgebildet, d.h. sie sind für die Dauer der Sitzung „telepräsent“ (zum Konzept der virtuellen Gemeinschaft siehe auch Döring, 2000a; Utz, 1999, 2002). Mittels Tastatur oder eines Joysticks besteht die Möglichkeit, „sich“ in der Umgebung umherzubewegen. Die „eigenen“ Aktionen sind für andere gleichzeitig anwesende Anwender sichtbar. Mit Hilfe eines zusätzlich angebotenen Chats oder per Spracheingabe können Unterhaltungen und Diskussionen geführt werden. In Abbildung 2 ist eine derartige virtuelle Welt beispielhaft dargestellt. Es handelt sich hierbei um eine virtuelle Rekrutierungsmesse der Firma jobfair24. In vier Messehallen sind jeweils sechs Firmen mit einen virtuellen Messestand präsent. Zu festgelegten Terminen sind die Messestände mit Firmenvertretern besetzt und potentielle Bewerber können dort ein Bewerbungsinformationsgespräch führen. Neue Medien in Organisationen 36 Abbildung 2: Virtuelle Messehalle der Firma jobfair24 Die Anwendungsmöglichkeiten für virtuelle Welten sind vielfältig und reichen von Universitäten (Mills & de Araujo, 1999; Breining, 1998) bis hin zu Einkaufszentren, Plattformen für Arbeitsgruppen (Stengel, 1998; Nunamaker, 1997; Noro, Kawai & Takao, 1996) und ganzen Betrieben. Bereits jetzt ist es möglich, virtuelle Welten, wie in Abbildung 2 zu sehen ist, in hoher Qualität darzustellen. In Anbetracht der Erweiterung der Datenübertragungsleistungen im Internet ist für die nächsten Jahre zu erwarten, dass sich die Darstellungsqualität von virtuellen Welten nochmals beträchtlich steigern wird. 4.4 Zusammenfassung Berücksichtigt man die rasante Entwicklung im Bereich der Neuen Medien, gilt es nicht nur aktuelle Forschungsarbeiten zu reflektieren, sondern auch einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder zu geben. Daher wurden drei besonders wichtige technologische Entwicklungen in dem vorliegenden Unterkapitel genauer dargestellt. Im einzelnen sind das: a) Breitbanddatenübertragung, b) mobile Internetkommunikation und c) virtuelle 3-D Welten. Neue Medien in Organisationen 37 Neue Medien in Organisationen 38 5 Literatur Anderson, S. E. & Ganzneder, B. M. (1995). Using electronic mail surveys and computermonitored data for studying computer-mediated communication systems. Social Science Computer Review, 13 (1), 33-46. Bandilla, W. (1999). WWW-Umfragen – Eine alternative Datenerhebungstechnik für die empirische Sozialforschung? In B. Batinic, A. Werner, L. Gräf & W. Bandilla (Hrsg.), Online Research – Methoden, Anwendungen und Ergebnisse (S. 9-19). Göttingen: Hogrefe. Bandilla, W. & Hauptmanns, P. (1998). Internetbasierte Umfragen als Datenerhebungstechnik für die empirische Sozialforschung? ZUMA Nachrichten, 43, 36-53. Batinic, B. (1998). Der Internet-Nutzer – ein rein theoretisches Konstrukt? In W. A. Mahle (Hrsg.), Orientierung in der Informationsgesellschaft (S. 33-44). München: UVK Medien. Batinic, B. (2001). Fragebogenuntersuchungen im Internet. Aachen: Shaker. Batinic, B. & Bosnjak, M. (2000). Fragebogenuntersuchungen im Internet. In B. Batinic (Hrsg.), Internet für Psychologen (2. Aufl., S. 287-317). Göttingen: Hogrefe. Batinic, B. & Moser, K. (1998). Internet im kleinen: Intranet und Extranet. In T. Krüger & J. Funke (Hrsg.), Psychologie im Internet – Ein Wegweiser für psychologisch interessierte User (S. 44-48). Weinheim: Beltz. Batinic, B., Puhle, B. & Moser, K. (1999). Der WWW-Fragebogen-Generator (WFG). In B. Batinic, A. Werner, L. Gräf & W. Bandilla (Hrsg.), Online Research – Methoden, Anwendungen und Ergebnisse (S. 93-102). Göttingen: Hogrefe. Batinic, B., Reips, U.-D. & Bosnjak, M. (2002). (Eds.). Online social sciences. Seattle, Toronto: Hogrefe & Huber Publishers. Batinic, B., Werner, A., Gräf, L. & Bandilla, W. (Hrsg.) (1999). Online Research. Göttingen: Hogrefe. Bentley, R., Appelt, W., Busbach, U., Hinrichs, E., Kerr, D., Sikkel, K., Trevor, J. & Woetzel, G. (1997). Basic support for cooperative work on the World Wide Web. International Journal of Human Computer Studies, 46, 827-846. Berker, T. (1999). WWW-Nutzung an einer deutschen Hochschule - Computer, Sex und eingeführte Namen – Ergebnisse einer Protokolldateienanalyse. In B. Batinic, A. Werner, L. Gräf & W. Bandilla (Hrsg.), Online Research – Methoden, Anwendungen und Ergebnisse (S. 227-243). Göttingen: Hogrefe. Blau, P. & Scott, W. (1962). Formal organizations: A comparative approach. Chandler: San Francisco. Booth-Kewley, S., Edwards, J. E. & Rosenfeld, P. (1992). Impression management, social desirability, and computer administration of attitude questionnaires: Does the computer make a difference? Journal of Applied Psychology, 77, 562-566. Neue Medien in Organisationen 39 Booth-Kewley, S., Rosenfeld, P. & Edwards, J. E. (1993). Computer-administered surveys in organizational settings: Alternatives, advantages, and applications. In P. Rosenfeld & J. E. Edwards (Eds.), Improving organizational surveys: New directions, methods, and applications (pp. 73-101). Newbury Park, CA: Sage. Borg, I. (2000). Früh- versus Spätantworter. ZUMA-Nachrichten, 47, 7-19. Breining, R. (1998). Virtual Reality und Lerntechnologie – Immersive Lern- und Trainingsumgebungen als Qualifizierungswerkzeuge des 21. Jahrhunderts. Personalführung, 31, 58-62. Burt, R. S. (1992). Structural holes. Cambridge, MA: Harvard University Press. Cascio, W. F. (1999). Virtual workplaces: Implications for organizational behavior. In C. L. Cooper & D. M. Rousseau (Eds.), Trends in organizational behavior, Vol. 6: The virtual organization (pp. 1-14). Chichester, England: Wiley. Coase, R.H. (1937). The nature of the firm. Economica, 4, 386-405. Davenport, H. & Prusak, L. (1998). Wenn Ihr Unternehmen wüßte, was es alles weiß …: das Praxisbuch zum Wissensmanagement. Landsberg/Lech: Verlag Moderne Industrie. Davidow, W. H. & Malone, M. S. (1993). Das virtuelle Unternehmen. Frankfurt a.M.: Campus. Diehl, M. & Stroebe, W. (1991). Productivity loss in idea-generating groups: Tracking down the blocking effect. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 392-403. Diehl, M. & Ziegler, R. (2000). Informationsaustausch und Ideensammlung in Gruppen. In M. Boos, K. J. Jonas & K. Sassenberg (Hrsg.), Computervermittelte Kommunikation in Organisationen (S. 89-101). Göttingen: Hogrefe. Döring, N. (1999). Sozialpsychologie des Internet. Die Bedeutung des Internet für Kommunikationsprozesse, Identitäten, soziale Beziehungen und Gruppen. Göttingen: Hogrefe. Döring, N. (2000a). Identitäten, soziale Beziehungen und Gemeinschaften im Internet. In B. Batinic (Hrsg.), Internet für Psychologen (2. Aufl., S. 379-415). Göttingen: Hogrefe. Döring, N. (2000b). Mediale Kommunikation in Arbeitsbeziehungen: Wie lassen sich soziale Defizite vermeiden? In M. Boos, K.J. Jonas & K. Sassenberg (Hrsg.), Computervermittelte Kommunikation in Organisationen (S. 27-40). Göttingen: Hogrefe. Driscoll, M. (1997). Defining internet-based and web-based training. Performance Improvement, 26 (4), 5-9. Eurich, C. (1982). Neue Medien. In H. J. Kagelmann & G. Wenninger (Hrsg.), Medienpsychologie (S. 118-126). München: Urban & Schwarzenberg. Fulk, J., Schmitz, J. & Steinfield, C. W. (1990). A social influence model of technology use. In J. Fulk & C. W. Steinfield (Eds.), Organizations and communication technology (pp. 117-140). Newbury Park, CA: Sage. Neue Medien in Organisationen 40 Galais, N. & Moser, K. (2001). Zeitarbeit als Reintegrationsmaßnahme in ein „normales Beschäftigungsverhältnis“ (S. 251-266). In J. Zempel, J. Bacher & K. Moser (Hrsg.), Erwerbslosigkeit. Opladen: Leske & Budrich. Garton, L. & Wellman, B. (1995). Social impacts of electronic mail in organizations: A review of the research literature. Communication Yearbook, 18, 434-453. George, J. F. & Jessup, L. M. (1997). Groups over time: What are we really studying? International Journal of Human Computer Studies, 47, 497-511. Göritz, A., Batinic, B. & Moser, K. (2000). Online Marktforschung. In W. Scheffler & K.-I. Voigt (Hrsg.), Entwicklungsperspektiven im Electronic Business (S. 187–204). Wiesbaden: Gabler. Göritz, A., Reinhold, N. & Batinic, B. (2000). Marktforschung mit Online Panels: State of the Art. Planung und Analyse, (3), 62-67. Göritz, A. S. & Moser, K. (2000). Repräsentativität im Online-Panel. Der Markt, 155, 156162. Gräf, L. (1999). Optimierung von WWW-Umfragen: Das Online-Pretest-Studio. In B. Batinic, A. Werner, L. Gräf & W. Bandilla (Hrsg.), Online Research – Methoden, Anwendungen und Ergebnisse (S. 159-177). Göttingen: Hogrefe. Greenbaum, T.L. (1995). Focus groups on the internet: An interesting idea but not a good one. Quirck’s Marketing Research Review, 12-46. Griffith, T. L. (1998). Cross-cultural and cognitive issues in the implementation of new technology: Focus on group support systems and Bulgaria. Interacting with Computers, 9, 431447. Grote, G. (1994). Auswirkungen elektronischer Kommunikation auf Führungsprozesse. Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 38, 71-75. Hagenhoff, W. & Pfleiderer, R. (1998). Neue Methoden in der Online-Forschung. Planung und Analyse, (1), 26-30. Hauptmanns, P. (1999). Grenzen und Chancen von quantitativen Befragungen mit Hilfe des Internet. In B. Batinic, A. Werner, L. Gräf & W. Bandilla (Hrsg.), Online Research – Methoden, Anwendungen und Ergebnisse (S. 21-38). Göttingen: Hogrefe. Hertel, G. & Konradt, U. (2000). Führung virtueller Teams: Entwicklung eines Managementkonzepts auf der Basis sozialpsychologischer Modelle. In Jahresdokumentation des 46. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft (S. 273-276). Dortmund: GfA Press. Hertel, G., Naumann, S., Konradt, U. & Batinic, B. (2002). Personality assessment via Internet: Comparing online and paper-and-pencil questionnaires. In B. Batinic, U.-D. Reips & M. Bosnjak (Eds.), Online social sciences (pp. 115-134). Seattle, Toronto: Hogrefe & Huber Publishers. Hesketh, B. & Neal, A. (1999). Technology and performance. In D. R. Ilgen & E. D. Pulakos (Eds.), The changing nature of performance (pp. 21-55). San Francisco: Jossey-Bass Neue Medien in Organisationen 41 Heydebrand, W. (1989). New organizational forms. Work and Occupations, 16, 323-357. Hütwohl, R. (1994). Software-Ergonomie. In E. Gros (Hrsg.), Anwendungsbezogene Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie. Eine Einführung (S. 151-166). Göttingen: Verlag für Angewandte Psychologie. Janetzko, D. (1999). Statistische Anwendungen im Internet. Daten in Netzumgebungen erheben, auswerten und präsentieren. München: Addison-Wesley. Katz, D. & Kahn, R. L. (1966). The social psychology of organizations. New York: Wiley. Kiesler, S. & Sproull, L. S. (1986). Response effects in the electronic survey. Public Opinion Quarterly, 50, 402-413. Kiesler, S., Siegel, J. & McGuire, T. W. (1984). Social psychological aspects of computermediated communication. American Psychologist, 39, 1123-1134. Kirzner, I. M. (1979). Perception, opportunity, and profit: Studies in the theory of entrepreneurship. Chicago: University Press. Kotter, J. P. (1973).The psychological contract: Managing the joining-up processes. California Management Review, 15, 91-99. Kraiger, K. (1999). Performance and employee development. In D. R. Ilgen & E. D. Pulakos (Eds.), The changing nature of performance (pp. 366-397). San Francisco: Jossey Bass. Kraut, R., Steinfield, C., Chan, A.-P., Butler, B. & Hoag, A. (1999). Coordination and virtualization: The role of electronic networks and personal relationships. Organization Science, 10, 722-740. Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukophadhyay, T. & Scherlis, W. (1998). Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being? American Psychologist, 53, 1017-1031. Krüger, T., Ott, R. & Funke, J. (2000). Das WWW als Medium zur Außendarstellung. In B. Batinic (Hrsg.), Internet für Psychologen (2. Aufl., S. 241-260). Göttingen: Hogrefe. Kübler, H. D. & Würzberg, H. G. (1982). Medienforschung. In H. J. Kagelmann & G. Wenninger (Hrsg.), Medienpsychologie (S. 96-117). München: Urban & Schwarzenberg. Kuhnert, K & McCauley, D. P. (1996). Applying alternative survey methods. In A. I. Kraut (Ed.), Organizational surveys: Tools for assessment and change (pp. 233-254). San Francisco, CA: Jossey-Bass. Lander, B. (1998). Güte von Internet-Umfragen – Zur Objektivität, Reliabilität, Validität und Repräsentativität im Internet erhobener Daten. Planung und Analyse, (5), 63-66. Lawler, E. E. (1975). Control systems in organizations. In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology. Chicago: Rand McNally. Lawler, E. E. (2000). Rewarding excellence. San Francisco: Jossey-Bass. Neue Medien in Organisationen 42 MacElroy, B. (1999). Comparing seven forms of online surveying. [WWW document] URL am 24.7.2002: http://www.quirks.com/articles/article.asp?arg_ArticleId=510. Mills, S. & de Araujo, M. M.-T. (1999). Learning through virtual reality: A preliminary investigation. Interacting with Computers, 11, 453-462. Moser, K. (1996). Commitment in Organisationen. Bern: Huber. Moser, K., Preising, K., Göritz, A. & Paul, K. (2002). Informationsüberflutung durch Neue Medien. Dortmund: Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Mülder, W. (2000). Personalinformationssysteme – Entwicklungsstand, Funktionalität und Trends. Wirtschaftsinformatik, 42 (Sonderheft), 98-106. Mullen, B., Johnson, C. & Salas, E. (1991). Productivity loss in brainstorming groups: A meta-analytic integration. Basic and Applied Social Psychology, 12, 3-23. Murphy, K. R. & Balzer, W. K. (1989). Rater errors and rating accuracy. Journal of Applied Psychology, 74, 619-624. Neuberger, O. (1995). Mikropolitik – Der alltägliche Aufbau und Einsatz von Macht in Organisationen. Stuttgart: Enke. Noro, K., Kawai, T. & Takao, H. (1996). The development of a dummy head for 3-D audiovisual recording for transmitting telepresence. Ergonomics, 39, 1381-1389. Nunamaker, J. F. (1997). Future research in group support systems: Needs, some questions and possible directions. International Journal of Human Computer Studies, 47, 357-385. Nunamaker, J. F., Briggs, R. O. & Mittleman, D. (1995). Electronic meeting systems: Ten years lessons learned. In D. Coleman & R. Khanna (Eds.), Groupware: Technology and applications (pp. 149-193). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Ouchi, W. G. (1980). Markets, bureaucracies, and clans. Administrative Science Quarterly, 25, 129-141. Parker, L. (1992). Collecting data the E-Mail way. Training and Development, 46, 52-54. Prickarz, H. & Urbahn, J. (2002). Qualitative Datenerhebung mit Online-Fokusgruppen. Ein Bericht aus der Praxis. planung & analyse, 29, 63-70. Reichwald, R., Möslein, K., Sachenbacher, H., Englberger, H. & Oldenburg, S. (1998). Telekooperation. Berlin: Springer. Reid, F. J. M., Malinek, V., Stott, C. J. T. & Evans, J. St. B. T. (1996). The messaging threshold in computer-mediated communication. Ergonomics, 39, 1017-1037. Rosenfeld, P., Doherty, L. M., Vicino, S.-M. & Kantor, J. (1989). Attitude assessment in organizations: Testing three microcomputer-based survey systems. Journal of General Psychology, 116, 145-154. Neue Medien in Organisationen 43 Rosenfeld, P., Booth-Kewley, S. & Edwards, J.-E. (1993). Computer-administered surveys in organizational settings: Alternatives, advantages, and applications. American Behavioral Scientist, 36, 485-511. Schachtner, C. (1999). Netfeelings – Das Emotionale in der computergestützten Kommunikation. Journal für Psychologie, 7, 33-45. Scherm, E. & Süß, S. (2000). Personalführung in virtuellen Unternehmen: Eine Analyse diskutierter Instrumente und Substitute der Führung. Personalforschung, 14, 79-103. Snow, C. C., Lipnack, J. & Stamps, J. (1999). The virtual organization: Promises and payoffs, large and small. In C. L. Cooper & D. M. Rousseau (Eds.), Trends in organizational behavior (pp. 15-30). Chichester, England: Wiley. Sproull, L. S. (1986). Using electronic mail for data collection in organizational research. Academy of Management Journal, 29, 159-169. Stanton, J. M. (1998). An empirical assessment of data collection using the internet. Personnel Psychology, 51, 709-725. Stengel, M. (1998). Kooperation in virtueller Realität. In E. Spiess (Hrsg.), Formen der Kooperation. Bedingungen und Perspektiven (S. 247-261). Göttingen: Verlag für Angewandte Psychologie. Swoboda, W. J., Mühlberger, N., Weitkunat, R. & Schneeweiss, S. (1997). Internet surveys by direct mailing: An innovative way of collecting data. Social Science Computer Review, 15, 242-255. Theobald, A. (1998). Möglichkeiten und Grenzen der Marktforschung im Internet : Eine anwendungsorientierte Betrachtung. In: Karrenbauer, R.; Lauer, T. (Hrsg.). 4. SaarLorLux Multimedia-Kongreß 1998. Aachen: Shaker Verlag. Theobald, A. (2000). Das World Wide Web als Befragungsinstrument. Wiesbaden: Gabler. Tse, A. C. B. (1999). Conducting electronic focus group discussions among Chinese respondents. Journal of the Market Research Society, 41, 407-415. Tuten, T. L. (1997). Getting a foot in the electronic door: Understanding why people read or delete electronic mail. ZUMA Arbeitsbericht, 8, 1-26. Utz, S. (1999). Soziale Identifikation mit virtuellen Gemeinschaften - Bedingungen und Konsequenzen. Lengerich: Pabst. Utz, S. (2002). Forms of research in MUDs. In B. Batinic, U.-D. Reips & M. Bosnjak (Eds.), Online social sciences (pp. 275-290). Seattle, Toronto: Hogrefe & Huber Publishers. Walther, J.B. (2000). Die Beziehungsdynamik in virtuellen Teams. In M. Boos, K.J. Jonas & K. Sassenberg (Hrsg.), Computervermittelte Kommunikation in Organisationen (S. 11-25). Göttingen: Hogrefe. Walther, J. B. & Burgoon, J. K. (1992). Relational communication in computer-mediated interaction. Human Communication Research, 19, 50-88. Neue Medien in Organisationen 44 Walther, J. B., & Tidwell, L. C. (1995). Nonverbal cues in computer-mediated communication, and the effect of chronemics on relational communication. Journal of Organizational Computing, 5, 355-378. Weick, K. E. (1995). Sensemaking in Organizations. Thousand Oaks, CA: Sage. Weisband, S. P., Schneider, S. K. & Connolly, T. (1995). Computer-mediated communication and social information: Status salience and status differences. Academy of Management Journal, 38, 1124-1151. Widdel, H. (1996). Zur software-ergonomischen Gestaltung und Bewertung der Benutzeroberflächen von Informationssystemen aus psychologischer Sicht. Untersuchungen des Psychologischen Dienstes der Bundeswehr, 31, 213-244. Wiesenfeld, B. M., Raghuram, S. & Garud, R. (1999a). Communication patterns as determinants of organizational identification in a virtual organization. Organization Science, 10, 777-790. Wiesenfeld, B. M., Raghuram, S. & Garud, R. (1999b). Managers in a virtual context: The experience of self-threat and its effects on virtual work organizations. In C. L. Cooper & D. M. Rousseau (Eds.), Trends in organizational behavior (pp. 31-44). Chichester, England: Wiley. Wiest, G. (1995). Medienwahl und Mediennutzung in Organisationen. Communications, 20, 33-47. Williamson, O. E. (1975). Markets and hierarchies. New York: Free Press.