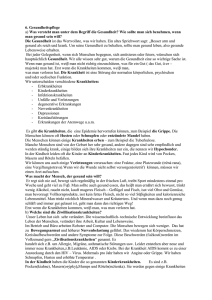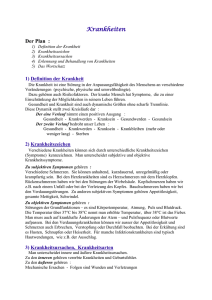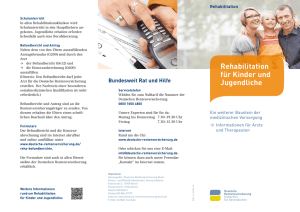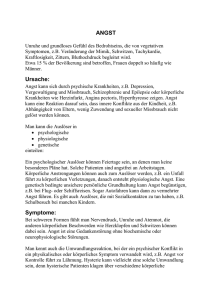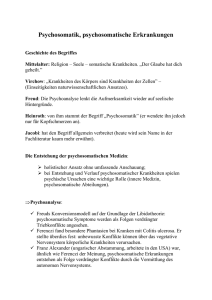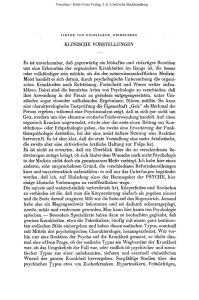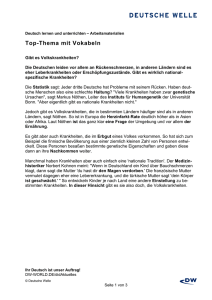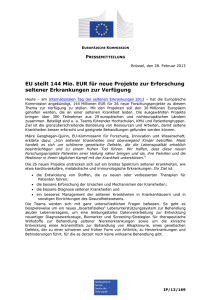Tab. 2.1: Krankheiten: Risiken oder Gefahren?
Werbung

Regionaler Gesundheitssurvey für Trier und Trier-Saarburg 2. Krankheitsbilder als soziale Konstruktionen: Laienkonzepte von Krankheit Rüdiger Jacob, Harald Michels, Martin Richarz, Dorle Springer, Julia Treike, Katja Windelen Der erste Teil des Titels ist bewußt doppeldeutig gewählt.1 In der medizinischen Diskussion bezeichnet der Begriff des Krankheitsbildes mehr oder weniger evidente Symptome, die auf das Vorliegen einer bestimmten Krankheit schließen lassen. Dabei wird häufig von der Annahme ausgegangen, dass Krankheiten objektiver Natur sind, und man diese gleichsam automatisch erkennen kann, wenn man über das dazu nötige Wissen verfügt - der konstruktive Charakter solcher Krankheitsbilder bleibt vielfach ausgeblendet. In den Sozialwissenschaften wird der Begriff "Krankheitsbilder" dagegen auch als Synoym für den Begriff der "Krankheitskonzepte" verwendet, womit laientheoretische Annahmen über die Ursachen, den Verlauf und die Schwere, die Therapiemöglichkeiten, aber auch den "Sinn" von Krankheiten bezeichnet werden. Festzuhalten ist, dass bei beiden Varianten, Krankheiten definiert werden (und zwar von einer mehr oder weniger homogenen sozialen Gruppe), unterschiedlich sind allerdings die jeweiligen Begründungen für die Definitionen (und häufig natürlich auch die Definitionen selbst). Nun könnte man allerdings vor dem Hintergrund der bahnbrechenden Erfolge der medizinischen Wissenschaft in den letzten 100 Jahren für die moderne Gesellschaft annehmen, dass im Fall von Krankheiten Alltagsvorstellungen und Alltagswissen – also Laienkonzepte - als eigenständige Zugangsweisen zu diesem Phänomen obsolet sind und es gerade hier ein allgemein anerkanntes medizinisches Expertenwissen gibt. Dies ist aber nicht der Fall, wie eine Fülle von Untersuchungen gezeigt hat. Krankheiten sind auch heute noch Chiffren für Unsicherheiten und motivieren zu vielfältigen Interpretationen und zwar insbesondere dort, wo das Expertenwissen der Medizin keine Hilfe bietet. Dabei spielt auch der Umstand, dass Krankheiten im wissenschaftlichen Diskurs emotionslos als gleichsam "sinnfreie" Phänomene betrachtet werden, eine entscheidende Rolle. Deutungen von Krankheiten und Sinnattributionen sind in diesem Diskurs nicht zulässig. Was 1 Die folgende theoretische Einführung zu diesem Kapitel ist eine gekürzte und überarbeitete Fassung des Beitrags: Jacob, R.: Krankheitsbilder als soziale Konstruktionen, in: Grundmann, M. (Hrsg.): Konstruktivistische Sozialisationsforschung, Frankfurt 1999, S. 324-347, dort finden sich auch weitere Literaturangaben und Quellenbelege. 11 Regionaler Gesundheitssurvey für Trier und Trier-Saarburg Göckenjan im Zusammenhang mit dem medizinischen Modell der Infektionskrankheiten schreibt, gilt so im Prinzip für alle wissenschaftlichen Krankheitskonzepte: "Die Bakteriologie ... präsentiert .. ein technisch formuliertes und als ebenso steuerbar gedachtes Gefährdungsmodell: Die Katastrophe ist nur mehr eine zufällige Überschwemmung durch Mikroorganismen. ... Kranke sind von dem Mißtrauen befreit, dass mit ihnen etwas "nicht in Ordnung" ist, ihre Krankheit evoziert keinen Ordnungswillen mehr. ... Dieses bakteriologische Katastrophenmodell mußte scheitern, nicht zuletzt, weil es, sich als Naturwissenschaft verstehend, Bedeutungszuweisungen vermeiden zu können glaubte. Denn das Bedürfnis nach Bedeutung besteht fort, wenn Betroffene Krankheit und Tod als Katastrophe erleben; hier muß das Modell eines biologischen Zufalls versagen."2 Die Deutungsabstinenz der modernen Wissenschaft ist insofern also problematisch, als das kranke Individuum mit einer Krankheit und daraus resultierenden Erfahrungen faktisch allein gelassen wird. Eine Krankheit bleibt unverständlich und sinnlos, sofern man nicht auf sozial etablierte Deutungsmuster zurückgreifen kann, die spezifische Sinnerklärungen anbieten. In nahezu allen Gesellschaften lassen sich solche Deutungsmuster beobachten, die körperliche Funktionsstörungen als Manifestation einer vorher verborgenen Wahrheit interpretieren, Krankheiten mit Moralvorstellungen verknüpfen und insbesondere auf individuelle Verfehlungen zurückführen.3 Dies gilt übrigens nicht nur für laienhafte Krankheitsvorstellungen und Ursachenattributionen, auch die jeweiligen medizinischen Theorien vergangener Epochen und Kulturen vermuteten entsprechende Kausalzusammenhänge. So hat z. B. die für unseren Kulturkreis insgesamt prägende christliche Religion mit entsprechenden Vorstellungen die mittelalterliche Medizin stark beeinflußt. Krankheit galt im Christentum ursprünglich entweder als Strafe für Sünden, Besessenheit durch den Teufel oder Folge von Hexerei, und diese ätiologischen Vorstellungen fanden ihren Niederschlag in Krankheitskonzepten und therapeutischen Methoden (und prägen manche Laienvorstellungen bis heute). Aber nicht nur die Frage, wie eine bestimmte Krankheit interpretiert wird, sondern auch, was überhaupt als Krankheit gilt, ist von sozialen Definitionen abhängig und variiert zeitlich und kulturell, wie pointiert folgendes Beispiel von Watzlawick illustriert: "In Indien kann einem als swami, als Heiliger vorgestellt werden, wer im Westen als katatoner Schizophrener diag- 2 Göckenjan 1988, S. 85. 3 vgl. dazu den von Keller 1995 herausgegebenen Band "Krank-Warum". 12 Regionaler Gesundheitssurvey für Trier und Trier-Saarburg nostiziert würde."4 Gerade Abweichungen von einer empirisch oder normativ begründeten Regel sind häufig Gegenstand sozialer Labelingprozesse. Dies gilt nicht nur für Straftaten, sondern auch für Krankheiten. Historisch läßt sich diese soziale Konstruktion von Krankheiten gut an der Karriere psychischer Krankheiten veranschaulichen. 5 Heute auch den meisten Laien zumindest dem Namen nach geläufige Krankheiten wie Schizophrenie, Paranoia oder manisch-depressive Erkrankungen waren bis zum 19. Jahrhundert gänzlich unbekannt und wurden erst im letzten Jahrhundert unterschieden und beschrieben.6 Die zugrundeliegenden Symptome galten vorher nicht als Indikatoren für psychische Krankheiten, sondern wurden interpretiert als Besessenheit, als Ausdruck von Charakterschwäche oder von krimineller Veranlagung. Die Psychiatrie ist denn auch "die bei weitem jüngste der großen Disziplinen der Medizin. Sie konnte sich erst entwickeln, nachdem die Epoche der Aufklärung Ende des 18. Jahrhunderts die Geisteskrankheiten in die Hände der Ärzte zurückgegeben hatte und nachdem die Asyle für Geisteskranke allmählich aus einer Mischung von Zoo und Gefängnis in Heil- und Pflegeanstalten für Geisteskranke umgewandelt worden waren."7 Der Labelingprozeß wird hier recht deutlich: Mit der Zuständigkeit von Ärzten für bestimmte Phänomene (indem man ihnen sukzessive die Leitung für Asyle anvertraute, was wiederum mit dem allmählich steigenden Prestige dieses Berufsstandes zusammenhing) werden diese Phänomene gemäß der spezifischen Weltsicht von Medizinern als Krankheiten definiert. Nur der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass dieser Prozeß bis heute nicht abgeschlossen ist, wie die stetig zunehmende Erstellung von psychiatrischen Gutachten bei Strafprozessen zeigt - mit dem Resultat, dass Verhaltensweisen, die früher als kriminell eingestuft wurden, heute häufig als Krankheitssymptome interpretiert werden. Dieses Beispiel zeigt auch, dass die Medizin sukzessive ihren Zuständigkeitsbereich ausdehnt und als eine Teildisziplin des ausdifferenzierten Funktionssystems "Wissenschaft" eine vergleichsweise neue Erscheinung ist. Historisch gesehen stellen Laientheorien die älteren Konzepte dar. Alltagskonzepte über Krankheiten beinhalten neben Sinnerklärungen stets auch bestimmte Vorstellungen über Therapie oder Prophylaxe. Unterstützung bei diesen existentiellen Fragen 4 Watzlawick 1992, S. 125. 5 vgl. dazu Ackerknecht 1992. 6 vgl. Ackerknecht 1992, S. 148. 7 Ackerknecht 1992, S. 148. 13 Regionaler Gesundheitssurvey für Trier und Trier-Saarburg suchte "man überall, bevor sie auf den Arzt fixiert wurde. Noch am Ende des Mittelalters richtete sich der Hilferuf ... in den Dörfern, in denen der drohende Tod immer gegenwärtig war, aber kein Arzt zur Verfügung stand, beinahe ausschließlich an Wahrsager und Heilkundige, in deren Gebräuchen sich magische und religiöse Rituale eng vermischten. ... In der Stadt dagegen, am Hof vor allem, waren Ärzte seit dem Mittelalter präsent." 8 Auch heute praktizieren "Wunderheiler" und insbesondere auch "Wunderheilerinnen" bevorzugt in ländlichen Gebieten. Zu ihrem therapeutischem Repertoire zählen Praktiken wie Handauflegen, Warzen besprechen oder auch die Verabreichung bestimmter Kräutermischungen. Die Erforschung von Placeboeffekten und der Bedeutung des individuellen Glaubens an die Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen hat Erklärungen für die Erfolge solcher Methoden geliefert. Dass in der Folge speziell ausgebildete Ärzte ein legitimes Zuständigkeitsmonopol für Fragen von Gesundheit und Krankheit erlangen konnten, lag zunächst übrigens nicht an einer höheren Kompetenz, fundiertem Wissen oder frappanten Erfolgen dieses Berufsstandes - wie man vielleicht vermuten würde, nachdem eben von "Wunderheilern" und Placeboeffekten die Rede war. Vielmehr waren manche Vorstellungen des mittelalterlichen Laiensystem in gewisser Weise "moderner" als das damalige medizinische Fachwissen. So wurde z. B. im Laiensystem des Mittelalters und der frühen Neuzeit vermutet, dass Krankheiten "ansteckend" sein könnten. Zur Vermeidung von Krankheiten wurden dementsprechend bereits Erkrankte isoliert. Im medizinisch-gelehrten Denken dieser Zeit wurden die These der Ansteckung dagegen für Aberglauben gehalten.9 Die Qualität der medizinischen Versorgung war lange Zeit ebenfalls wie Lüth es sehr vorsichtig ausdrückt - "wenig erfreulich". 10 Evans, um nur ein Beispiel aus- führlich zu zitieren, weist darauf hin, dass sogar noch Ende des 18. Jahrhunderts die Ärzteschaft alles andere als ein allgemein angesehener Berufsstand war. "Mediziner mit einem Universitätsabschluß waren häufig für den Umgang mit Kranken und Sterbenden schlecht vorbereitet; mit nichts als theoretischem Wissen gerüstet, standen sie weitgehend noch in der Tradition der Säftelehre der alten Griechen. ... Eben wegen der ungewissen Wirkungen ihrer Bemühungen waren die Ärzte außerdem gezwungen, die überall praktizierenden Quacksalber und Kurpfuscher zu dulden, deren Behandlung häufig keineswegs gefährlicher und weniger 8 Herzlich und Pierret 1991, S. 230. 9 vgl. Herzlich und Pierret 1991, S. 132 f: "In der Medizin sollte die Debatte um die Ansteckung und ihre Wirkungsweise bis zu den Entdeckungen Pasteurs andauern." Auch die Cholera wurde von vielen Ärzten bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein nicht als infektiös angesehen; vgl. Evans 1990, S. 331. 10 vgl. Lüth 1974, S. 19. Siehe auch die z. T. recht drastischen Beispiele bei Herzlich und Pierret 1991. 14 Regionaler Gesundheitssurvey für Trier und Trier-Saarburg wirksam waren als ihre eigenen."11 Für den Aufstieg des Berufstandes waren anfänglich also weniger besondere Leistungen und Erfolge der Medizin verantwortlich, vielmehr war entscheidend, dass die Kirche die Konkurrenz der akademisch ausgebildeten Ärzte - die Bader, Wunderheiler und Kräuterfrauen - aus dem Weg räumte und es ihr zudem gelang, deren positives Image als Helfer und Heiler ins Gegenteil zu verkehren. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als Wissenschaftler wie Pasteur, Yersin, Kitasato oder Koch ihre großen Erfolge im Kampf gegen schwere Infektionskrankheiten erzielten, gewann die Medizin zunehmend an Effizienz und Reputation. Gleichwohl zeigen - insbesondere auf dem Land - volksmedizinische Vorstellungen ein ausgeprägtes Beharrungsvermögen, was darauf zurückzuführen ist, dass auch nach der erfolgreichen Etablierung der Medizin das Land mit medizinischer Infrastruktur lange Zeit unterversorgt blieb - und auch heute noch ist die Ärztedichte in ländlichen Regionen deutlich niedriger als in Ballungsgebieten. Volkskundler wie Schenda sehen deshalb in der Persistenz von volksmedizinischen Krankheitstheorien auch ein Deprivationsphänomen.12 Würde diese Persistenz aber ausschließlich auf einer Deprivation beruhen, dann müßte es ausreichen, diese durch eine bessere medizinische Infrastruktur zu beenden. Die Persistenz von Alltagskonzepten über Krankheit ist allein durch eine bessere medizinische Versorgung aber solange nicht aufhebbar, solange es unheilbare Krankheiten und krankheitsbedingten Tod gibt. Entscheidend ist hier, dass volksmedizinisches Wissen und das Vertrauen in Helfer und Heiler, die außerhalb des etablierten Medikalsystems stehen, als eine Form von Heilswissen Bedürfnisse befriedigt, die durch die moderne Medizin und ihre Vertreter, die Ärzte, entsprechend einer anderen Funktionslogik nicht befriedigt werden können. Denn der Heiler ist natürlich auch eine charismatische Figur, an den man sich in existentiellen Notlagen wenden und hoffen kann, dass man auch die entsprechende Hilfe erhält, wobei der Wahl der Mittel prinzipiell keine Grenzen gesetzt sind. Dieses Image haben Ärzte zum Teil zwar auch (noch), sind aber dadurch gewissermaßen im Nachteil, dass die Schulmedizin und deren Wissensbestand samt der etablierten Standesregeln ihnen deutliche Grenzen auferlegen. Sozusagen 11 Evans 1990, S. 271 f. Im Fall der Cholera beispielsweise beschleunigt die Verabreichung von Abführ- und Brechmitteln den Krankheitsverlauf hin zu einem finalen Stadium. Gleichwohl haben bei den Choleraepidemien im 19. Jahrhundert Ärzte eben diese Therapien bei Kranken angewendet und damit "wohl Tausende von Cholerapatienten ... ins Grab gebracht." Evans 1990, S. 433. 12 vgl. Schenda 1985, S. 152. 15 Regionaler Gesundheitssurvey für Trier und Trier-Saarburg "freischaffende" Heiler haben diesbezüglich keine Probleme und können das Image des charismatischen Wunderheilers beliebig kultivieren. Paradox dabei mutet der Umstand an, dass gerade die von der Schulmedizin geforderte Wiederholbarkeit des Erfolges einer Therapie, also die Forderung nach einem verläßlichen Qualitätsstandard, für Heiler nicht nur nahezu vollständig irrelevant, sondern die Negation eines solchen Standards im Gegenteil vielfach geradezu konstitutiv für Charisma ist. Nicht der Mißerfolg wird als Problem angesehen, vielmehr festigen einzelne und eben deshalb unerklärliche Behandlungserfolge, die sich in kein klar erkennbares Muster fügen lassen, den Ruf des wundertätigen Nothelfers. Der Mißerfolg der gleichen Behandlung bei anderen Personen kann dann unter Zuhilfenahme ideosynkratischer Annahmen problemlos erklärt werden und man versucht die nächste Therapie. Dabei scheint der Wandel im Krankheitsspektrum hin zu chronisch-degenerativen und vielfach von der Schulmedizin kaum zu therapierenden Krankheiten sogar für eine Renaissance solcher alternativer Angebote zu sorgen. Chronisch-degenerative Krankheiten sind nicht nur wegen ihrer aktuellen Dominanz im Krankheitsspektrum die gleichsam typischen Krankheiten der modernen Gesellschaft, sondern auch, weil sie in weitaus höherem Maß individuelle Krankheiten sind als die Infektionskrankheiten früherer Jahrhunderte. Denn anders als die Ätiologie von Infektionskrankheiten wird ihre Genese - unbeschadet aller unbestrittenen Umwelteinflüsse - stark von individuellen Verhaltensweisen beeinflußt. Schwere Infektionskrankheiten waren jahrhundertelang idealtypische Beispiele für Gefahren, also für Unsicherheiten die man im Unterschied zu Risiken kaum durch eigenes Zutun beeinflussen oder steuern kann. Ihre Erreger existieren als Folge bestimmter evolutionärer Prozesse, ob man erkrankte war - vor allem bei unsicherem Wissen über die jeweilige Krankheit und ihre Ätiologie - individuell kaum zu beeinflußen, sondern stellte sich als Schicksal dar, dem man bestenfalls durch generelle Meidung oder Isolierung der bereits Erkrankten hoffte, entgehen zu können. Diese Interpretation von Krankheiten als schicksalhaften Gefahren konnte sich grundsätzlich erst mit den Fortschritten der Medizin ändern. Krankheiten, für die nach deren genauerer Erforschung in zunehmendem Maß Impfstoffe, Therapien und verhaltenspräventive Ratschläge zur Verfügung standen, erschienen parallel dazu auch als (grundsätzlich) individuell vermeidbar und wurden zum Risiko. Dies gilt erst recht für chronisch-degenerative Erkrankungen, wo individuelles Tun oder Lassen (natürlich nach Maßgabe der gegebenen mehr oder weniger krankmachenden Rahmenbedingungen) eine wesentliche Erkrankungsursache oder Vermei16 Regionaler Gesundheitssurvey für Trier und Trier-Saarburg dungschance darstellt. In gewisser Weise sind chronische Krankheiten somit auch Spiegel der individuellen Biographie. Dieser generelle Wandel bei der Einschätzung von Krankheiten als Risiken oder als Gefahren zeigt wiederum, dass entsprechende Zuschreibungen sozial bedingt sind und sich nicht aus "natürlichen" Qualitäten des Phänomens gleichsam objektiv und zwingend ableiten lassen. Ob eine Krankheit als Risiko (und damit als durch eigene Handlungen beeinflußbar) oder als Gefahr (die einen als Schicksalsschlag trifft) interpretiert wird, ist sozial konstruiert und sozial vermittelt, wobei sich auch heute noch Unterschiede in der Einschätzung bestimmter Krankheiten zeigen. Gut untersucht ist dies z. B. für AIDS, einer Krankheit, die von bestimmten Personengruppen als Risiko, von anderen als Gefahr angesehen wird. Die Persistenz der Einschätzung von Krankheiten als Gefahren – abgeleitet aus jahrhundertealten Erfahrungen mit Infektionskrankheiten – hängt zum einen damit zusammen, dass die Ätiologie von Infektionskrankheiten sich sehr viel einfacher darstellt, kognitiv besser zu bewältigen ist und damit paradoxerweise insofern Unsicherheit reduziert, als man hier zumindest sicher zu wissen glaubt, warum man erkrankt ist. Außerdem beoabachten wir in den letzten Jahren wieder steigende Inzidenzraten bei "alten" Infektionskrankheiten wie Masern oder Diphtherie, die schon als "besiegt" galten und das Auftreten "neuer" Seuchen mit extrem hohen Letalitätsraten wie AIDS oder Ebola. Beides sorgt dafür, dass Ängste vor einer Ansteckung mit einer schweren Krankheit nach wie vor sehr häufig sind. Grundsätzlich ist die Interpretation von Krankheiten als Gefahren für präventive Maßnahmen ausgesprochen hinderlich, in ihrer Verhaltensimplikation aber konsistent: Wenn man "gegen eine Krankheit" sowieso nichts machen kann und "es kommt, wie es kommen muß", wozu sollte man dann sein Verhalten ändern, sich regelmäßig untersuchen oder impfen lassen. Allerdings muß hier konstatiert werden, dass auch Personen, die eine Krankheit grundsätzlich eher als Risiko ansehen, dies nicht notwendig auch auf die eigene Person beziehen und sich risikominimierend verhalten. In diesem Zusammenhang ist das Reaktionsmuster des "unrealistischen Optimismus" zu erwähnen. Dieser Glaube an die "eigene Unverwundbarkeit" scheint relativ weit verbreitet zu sein und führt zu der Überzeugung, dass das eigene Erkrankungsrisiko im Vergleich zu anderen gering sei. Diese Haltung dürfte sich vielfach, etwa im Fall der Bildung eines Bronchialkarzinoms bei starken Rauchern durchaus als krasse Fehleinschätzung herausstellen, sorgt aber kurz- und mittelfristig für die Beseitigung kognitiver Dissonan17 Regionaler Gesundheitssurvey für Trier und Trier-Saarburg zen, indem man die potentiell schädigende Wirkung bestimmter Verhaltensweisen nicht zur Kenntnis nimmt. Laienkonzepte von Krankheiten, also die Vorstellungen darüber, was überhaupt als Krankheit oder als der Gesundheit abträglich gilt, welche Ursachen und welche Möglichkeiten der Beeinflussung von Krankheiten es gibt, sind mithin die entscheidenden Variablen für das individuelle Konsultationsverhalten, die Akzeptanz ärztlicher Empfehlungen und für präventives Verhalten. Aus diesem Grund haben wir diese etwas umfangreicheren theoretischen Überlegungen an den Anfang dieses Berichtes gestellt. Die folgenden Befunde – nicht nur in diesem Kapitel, sondern auch in den nachfolgenden – sind vor dem Hintergrund dieser Ausführungen zu interpretieren. Auffällig bei Laienkonzepten von Krankheiten ist zudem ihre Inkonsistenz. Dies liegt daran, dass Alltagswissen insgesamt keine geschlossene Theorie darstellt, sondern einen einen Vorrat an unsystematischem Wissen versammelt, welches je nach den aktuellen Erfordernissen gedeutet und verwendet wird. Prinzipielle Widersprüche können wegen der stets situationsbedingten Aktualisierung von Wissen nebeneinander bestehen, ohne dass dies jemanden stören würde oder dass es ständig auffiele. Deutlich wird dies beispielsweise an der Existenz gegensätzlicher Sprichwortpaare: Viele Aussagen des sog. gesunden Menschenverstandes kommen paarweise vor. Es wird uns gesagt, dass sich Gegensätze anziehen, aber es wird uns auch gesagt, dass sich gleich und gleich gern gesellen. Diese Widersprüchlichkeit gilt auch für Alltagstheorien über Krankheiten, die "Wissen" ganz unterschiedlicher Quellen beinhalten, etwa Versatzstücke aus medizinischen Aufklärungskampagnen oder tradiertes Hauswissen. So stimmen z. B. 72,9% der Befragten des vorliegenden Surveys der Meinung zu, dass man schweren Krankheiten durch eine entsprechende Lebensweise vorbeugen kann (Frage 15), 87,4% sind aber auch der Meinung, dass eine schwere Krankheit zufällig jeden treffen kann. Hier zeigt sich exemplarisch der Gegensatz von Risiko- und Gefahrperspektive, wobei die eine oder die andere Sichtweise situationsspezifisch aktualisiert werden dürfte. Insgesamt dominiert bei den Items aus Frage 15 zwar – gemessen an den Zustimmungsquoten - die Risikoperspektive, die auch der zur Zeit quasi offiziellen Sichtweise von Krankheiten entspricht. Zumindest bei schweren Infektionskrankheiten (danach wurde ausdrücklich gefragt) – die derzeit allerdings epidemiologisch (noch?) keine wesentliche Rolle im Krankheitsspektrum der Bundesrepublik spielen - sind aber nach wie vor alte Ängste vor Seuchen und ubiquitärer 18 Regionaler Gesundheitssurvey für Trier und Trier-Saarburg Verbreitung von Erregern vorhanden, wenn man sich die befürchteten Übertragungswege näher ansieht (Frage 71). Über 60% glauben z. B. dass man sich mit solchen Krankheiten in öffentlichen Toiletten oder Turnhallen anstecken kann und immer noch 34% halten Geschirr in Gaststätten für übertragungsrelevant. 15. Gerade über schwere Krankheiten gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen. Wir haben einige davon zusammengestellt. Sagen Sie mir bitte jeweils, inwieweit Sie diesen Vorstellungen zustimmen. (Angaben in Prozent) Ja, Teils/Teils stimme zu A Nein, stimme nicht zu Durch eine bestimmte Lebensweise kann man schweren 72,9 22,3 4,7 87,4 10,1 2,6 77,3 18,5 4,1 14,1 13,3 72,6 27,7 36,8 35,4 Krankheiten vorbeugen. (n=506) B Krankheiten können ganz zufällig jeden treffen. (n=506) C Durch den eigenen Willen kann man den Heilungsprozess stark beeinflussen. (n=507) D Eine schwere Krankheit ist eine Mahnung Gottes. (n=504) E Angesichts der vielen schädlichen Umwelteinflüsse hat man selbst nur einen geringen Einfluss auf die eigene Gesundheit. (n=507) 19 Regionaler Gesundheitssurvey für Trier und Trier-Saarburg 71. Wodurch können Ihrer Meinung nach schwere Infektionskrankheiten übertragen werden? (keine leichte Erkrankung wie eine Erkältung)/(Angaben in Prozent) Ja Nein Weiß nicht (nicht vorlesen) A Benutzung von öffentlichen Toiletten (n=504) 63,3 31,7 5,0 B Turnhalle, Sauna, Schwimmbad (n=506) 60,1 35,8 4,2 C Geschirr in Gaststätten (n=506) 34,0 60,7 5,3 D Stationärer Aufenthalt im Krankenhaus (n=506) 68,6 28,7 2,8 E Küsse (n=505) 53,1 41,8 5,1 F Wartezimmer in Arztpraxen (n=506) 41,1 56,1 2,8 Faßt man die Indikatoren für die Risiko- und die Gefahrperspektive aus Frage 15 zusammen,13 dann ergeben sich folgende Verteilungen: Tab. 2.1: Krankheiten: Risiken oder Gefahren? Krankheiten sind: stimme zu teils-teils stimme nicht zu Risiken 58,5 38,7 2,8 Gefahren 27,2 66,3 6,5 13 Ein in der Datenaufbereitung übliches Verfahren zum Test von Meßinstrumenten auf Eindimensionalität ist die Faktorenanalyse, genauer gesagt die Hauptkomponentenanalyse (PCA, Varimax, Kaiser-Kriterium), mit der ermittelt werden soll, ob Indikatoren – z.B. Statements wie die hier verwendeten – alle zu einer gemeinsamen theoretischen Variable, die man als zugrundeliegenden Faktor bezeichnet, gehören. Ist dies so, dann ist die Korrelation (die Faktorladung) jedes Items mit diesem Faktor hoch (Konvention: größer als .5), mit möglichen anderen Faktoren dagegen niedrig. In der Tat ergeben sich bei entsprechender Analyse zwei Faktoren, die Items A und C korrelieren mit .760 und .711 mit einem Faktor, die Items B und E mit .781 und .724 mit einem zweiten. Inhaltlich kann man diese Faktoren als Risiko- und als Gefahrperspektive von Krankheiten interpretieren. Die Zusammenfassung oder Skalierung der Items erfolgt, indem man die Codezahlen für jeden Befragten addiert, durch die Summe durch die Gesamtzahl der Items (hier: 2) teilt und rundet. Man erhält dann eine neue Variable mit den gleichen Ausprägungen (stimme zu, teils-teils, stimme nicht zu) wie die sie konstituierenden Einzelindikatoren. 20 Regionaler Gesundheitssurvey für Trier und Trier-Saarburg Insgesamt 58,5% der Befragten halten schwere Krankheiten für grundsätzlich vermeid- und beeinflußbare Risiken. 27,2% glauben aber auch, dass solche Krankheiten Gefahren darstellen, die jeden treffen können und auf die man nur geringen Einfluss hat. Ängste vor Ansteckung sind ebenfalls sehr weit verbreitet, wie ein aus den Antworten auf Frage 71 berechneter Summenindex zeigt. Nur 4,3% glauben, dass in keiner der vorgegebenen Situationen die Ansteckung mit einer schweren Krankheit droht, dagegen befürchten annähernd dreimal so viele (11,8%), dass man sich in allen 6 genannten Fällen anstecken kann. Abb. 2.1: Alltagssituationen: Übertragung von schweren Infektionskrankheiten, Zahl der Nennungen (Angaben in Prozent) 25 20,3 20 17,1 17,9 15 15 13,5 11,8 10 5 4,3 0 0 1 2 3 4 5 6 N = 414 Dieser Index korreliert vergleichsweise hoch (Gamma = -.362) mit der Interpretation von Krankheiten als Gefahren. Personen, die diese Einschätzung teilen, befürchten mithin überdurchschnittlich häufig auch Infektionsgefahren in Situationen der Alltagsroutine. Diese Einschätzung hat zudem einen spürbaren Einfluß auf die Einschätzung des allgemeinen Krebserkrankungsrisikos. 50% der Befragten, die Krankheiten als Gefahren einstufen, schätzen das allgemeine Risiko als hoch ein (Frage 68). Sie liegen damit 10 Prozentpunkte über dem 21 Regionaler Gesundheitssurvey für Trier und Trier-Saarburg Durchschnittswert der Stichprobe. Von den Personen, die Krankheiten als Risiko interpretieren, bezeichnen dagegen nur 43% das allgemeine Krebsrisiko als hoch. Die Furcht vor schweren Infektionskrankheiten hat einen signifikanten, allerdings nicht linearen Einfluß auf die Teilnahme an Impfungen gegen Polio, Diphtherie und Tetanus. Signifikant mehr Personen, die Infektionsgefahren im Alltag befürchten, haben sich zumindest einmal gegen diese Krankheiten impfen lassen (zur Messung der Impfbeteilung finden sich genauere Angaben in Kapitel 6). Abb. 2.2: Impfungen gegen Polio, Diphtherie und Tetanus nach Zahl der als mit Ansteckungsrisiken verbundenen Alltagssituation (Angaben in Prozent) 60 56,3 50 43,2 39,3 37,5 40 32,3 30,6 5 6 30 20 16,7 10 0 0 1 2 3 4 N = 414, Sig. = .014, Cramer´s V = .196 In der Tendenz zeichnet sich auch der Einfluß der generellen Interpretation von Krankheiten als Risiken oder Gefahren in der Impfbeteiligung ab, allerdings auf insgesamt sehr niedrigem Niveau, so dass die Ergebnisse nicht durchgängig signifikant sind. Nur 7,3% der befragten Personen, die Krankheiten explizit als Gefahren einstufen, weisen einen vollständig dokumentierten Impfschutz gegen Polio, Diphtherie und Tetanus auf, in der Vergleichsgruppe der Befragten, die dezidiert der Meinung sind, Krankheiten seien beeinflußbare Risiken, sind dies immerhin 12,2%. 22 Regionaler Gesundheitssurvey für Trier und Trier-Saarburg Aufgrund zeitlicher Restriktionen konnten Laienvorstellungen von Krankheit in dem vorliegenden Survey leider nicht differenzierter und ausführlicher erfaßt werden. Immerhin stützen aber auch die mit einem vergleichsweise undifferenzierten und wenig trennscharfen Instrumentarium erhobenen Daten einige der theoretischen Vermutungen und unterstreichen damit die Bedeutung, die Laienkonzepte von Krankheit für die individuelle Gesundheit wie auch für Entwicklungen im Gesundheitswesen haben. 23