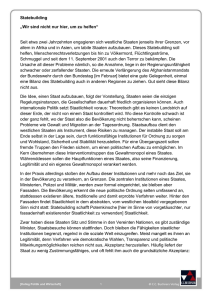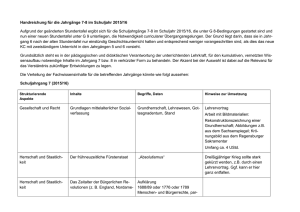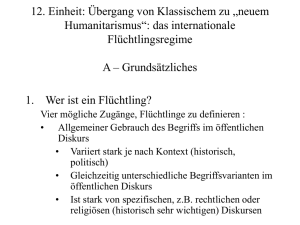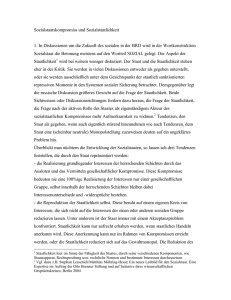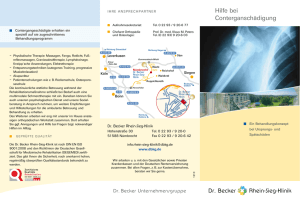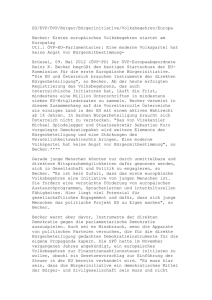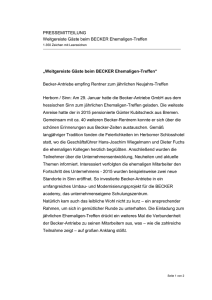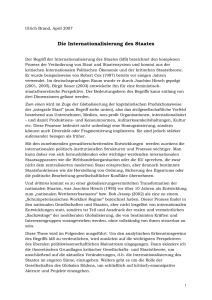Periphere Staatlichkeit
Werbung
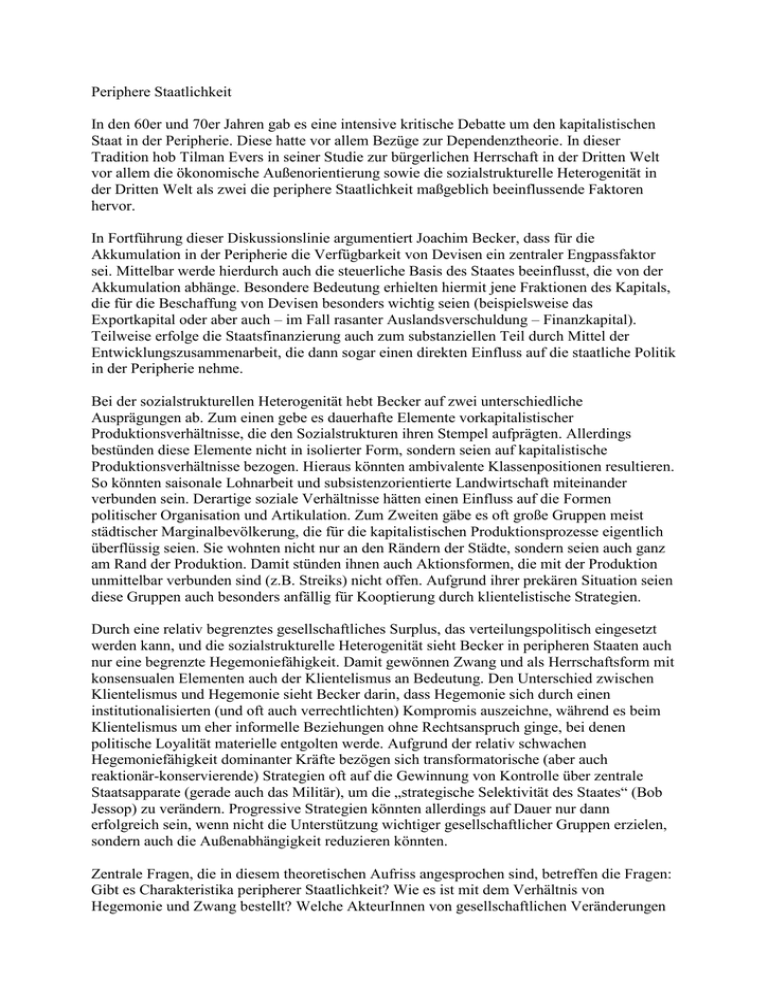
Periphere Staatlichkeit In den 60er und 70er Jahren gab es eine intensive kritische Debatte um den kapitalistischen Staat in der Peripherie. Diese hatte vor allem Bezüge zur Dependenztheorie. In dieser Tradition hob Tilman Evers in seiner Studie zur bürgerlichen Herrschaft in der Dritten Welt vor allem die ökonomische Außenorientierung sowie die sozialstrukturelle Heterogenität in der Dritten Welt als zwei die periphere Staatlichkeit maßgeblich beeinflussende Faktoren hervor. In Fortführung dieser Diskussionslinie argumentiert Joachim Becker, dass für die Akkumulation in der Peripherie die Verfügbarkeit von Devisen ein zentraler Engpassfaktor sei. Mittelbar werde hierdurch auch die steuerliche Basis des Staates beeinflusst, die von der Akkumulation abhänge. Besondere Bedeutung erhielten hiermit jene Fraktionen des Kapitals, die für die Beschaffung von Devisen besonders wichtig seien (beispielsweise das Exportkapital oder aber auch – im Fall rasanter Auslandsverschuldung – Finanzkapital). Teilweise erfolge die Staatsfinanzierung auch zum substanziellen Teil durch Mittel der Entwicklungszusammenarbeit, die dann sogar einen direkten Einfluss auf die staatliche Politik in der Peripherie nehme. Bei der sozialstrukturellen Heterogenität hebt Becker auf zwei unterschiedliche Ausprägungen ab. Zum einen gebe es dauerhafte Elemente vorkapitalistischer Produktionsverhältnisse, die den Sozialstrukturen ihren Stempel aufprägten. Allerdings bestünden diese Elemente nicht in isolierter Form, sondern seien auf kapitalistische Produktionsverhältnisse bezogen. Hieraus könnten ambivalente Klassenpositionen resultieren. So könnten saisonale Lohnarbeit und subsistenzorientierte Landwirtschaft miteinander verbunden sein. Derartige soziale Verhältnisse hätten einen Einfluss auf die Formen politischer Organisation und Artikulation. Zum Zweiten gäbe es oft große Gruppen meist städtischer Marginalbevölkerung, die für die kapitalistischen Produktionsprozesse eigentlich überflüssig seien. Sie wohnten nicht nur an den Rändern der Städte, sondern seien auch ganz am Rand der Produktion. Damit stünden ihnen auch Aktionsformen, die mit der Produktion unmittelbar verbunden sind (z.B. Streiks) nicht offen. Aufgrund ihrer prekären Situation seien diese Gruppen auch besonders anfällig für Kooptierung durch klientelistische Strategien. Durch eine relativ begrenztes gesellschaftliches Surplus, das verteilungspolitisch eingesetzt werden kann, und die sozialstrukturelle Heterogenität sieht Becker in peripheren Staaten auch nur eine begrenzte Hegemoniefähigkeit. Damit gewönnen Zwang und als Herrschaftsform mit konsensualen Elementen auch der Klientelismus an Bedeutung. Den Unterschied zwischen Klientelismus und Hegemonie sieht Becker darin, dass Hegemonie sich durch einen institutionalisierten (und oft auch verrechtlichten) Kompromis auszeichne, während es beim Klientelismus um eher informelle Beziehungen ohne Rechtsanspruch ginge, bei denen politische Loyalität materielle entgolten werde. Aufgrund der relativ schwachen Hegemoniefähigkeit dominanter Kräfte bezögen sich transformatorische (aber auch reaktionär-konservierende) Strategien oft auf die Gewinnung von Kontrolle über zentrale Staatsapparate (gerade auch das Militär), um die „strategische Selektivität des Staates“ (Bob Jessop) zu verändern. Progressive Strategien könnten allerdings auf Dauer nur dann erfolgreich sein, wenn nicht die Unterstützung wichtiger gesellschaftlicher Gruppen erzielen, sondern auch die Außenabhängigkeit reduzieren könnten. Zentrale Fragen, die in diesem theoretischen Aufriss angesprochen sind, betreffen die Fragen: Gibt es Charakteristika peripherer Staatlichkeit? Wie es ist mit dem Verhältnis von Hegemonie und Zwang bestellt? Welche AkteurInnen von gesellschaftlichen Veränderungen gibt es und was für Staatsstrategien können diese verfolgen? Weitere Fragen könnten sich darauf beziehen, wie aus kritischen staatstheoretischen Perspektiven gängige Konzepte wie jenes des neo-patrimonialen Staates mit seinem Fokus auf den inneren Faktoren oder des sogenannten „failed state“ problematisiert werden können? Mit diesen Fragen haben sich jüngst Katharina Lenner und Wolfram Schaffar auseinandergesetzt. Einige Fragen sollen in der Konkretion vertieft werden. Zum Einen geht es um die Linke und den Staat in Lateinamerika. Ausgehend von unterschiedlichen Formen der Einbindung in die internationale Ökonomie, unterschiedlichen Sozialstrukturen und gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen sowie einem sehr unterschiedlichen Ausmaß an Delegitimierung des alten Regimes verfolgen linke Kräfte an der Regierung sehr unterschiedliche politische und ökonomische Strategien in Lateinamerika. Einerseits sollen zentrale Unterschiede herausgearbeitet, andererseits den Gründen für die Unterschiede nachgegangen werden. Zum Zweiten stellen die ehemals staatsozialistischen Länder wichtige Fälle von Transformation der Staatlichkeit und Veränderung der Position in der internationalen Arbeitsteilung (in der Regel eine Peripherisierung) dar. In der Ausgangssituation gab es keine einheimische Bourgeoisie. Ziel der lokal dominanten Kräfte war die Schaffung einer Bourgeoisie und einer bürgerlichen Staatlichkeit. Westliche Regierungen und internationale Organisationen suchten dem Transformationsprozessen eine Richtung zugunsten westlichen Kapitals zu geben. Bei all diesen Gemeinsamkeiten gab es gleichzeitig doch auch signifikanten Unterschiede in den ökonomischen und politischen Ausgangskonstellationen. Aus einer vergleichenden Perspektive soll die Transformation des Staates im Kontext der grundlegenden sozio-ökonomischen Veränderungen analysiert werden.