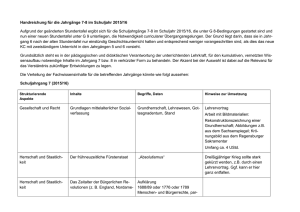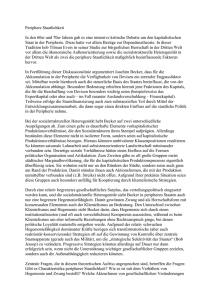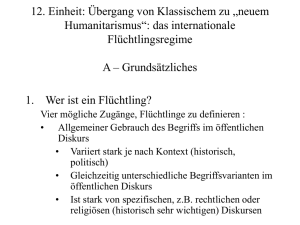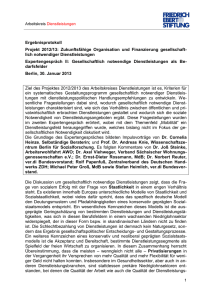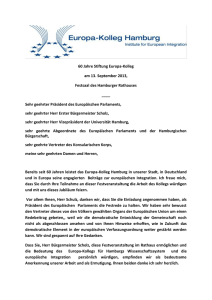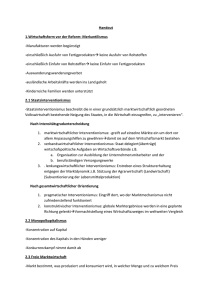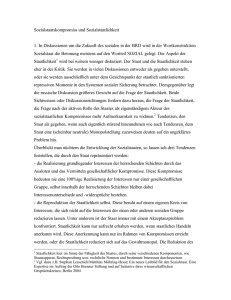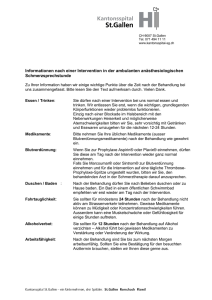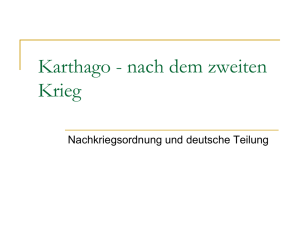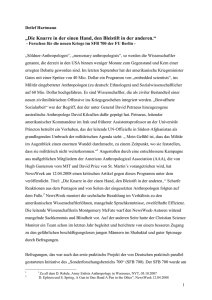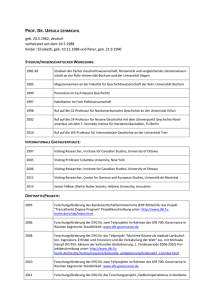Überschrift erste Zeile
Werbung
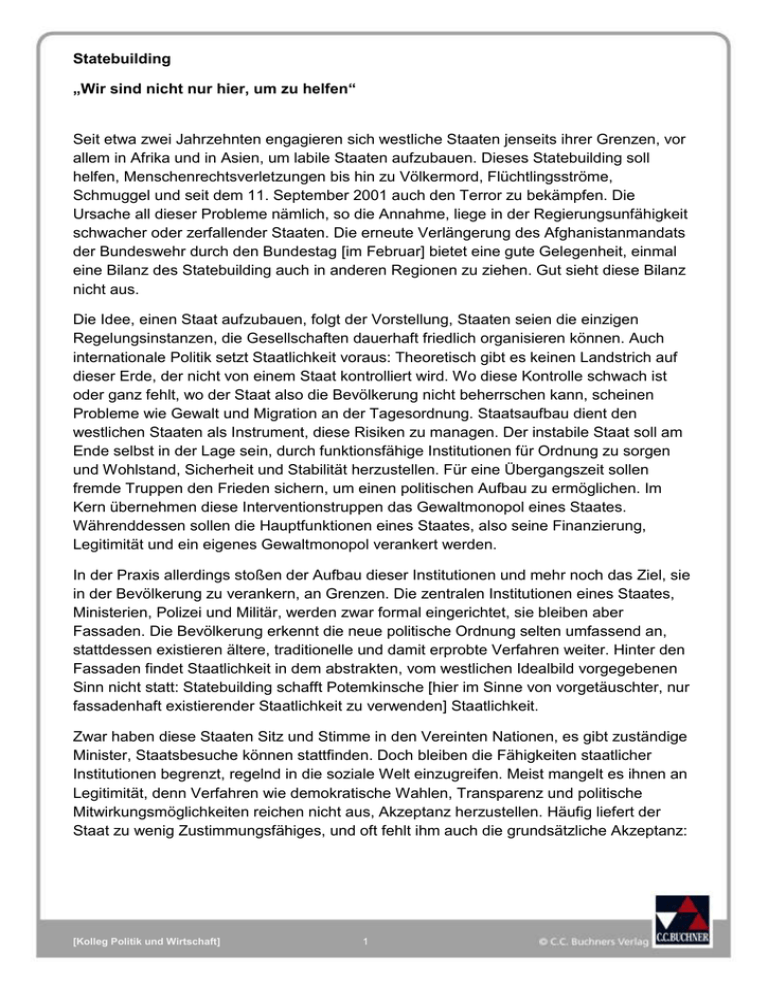
Statebuilding „Wir sind nicht nur hier, um zu helfen“ Seit etwa zwei Jahrzehnten engagieren sich westliche Staaten jenseits ihrer Grenzen, vor allem in Afrika und in Asien, um labile Staaten aufzubauen. Dieses Statebuilding soll helfen, Menschenrechtsverletzungen bis hin zu Völkermord, Flüchtlingsströme, Schmuggel und seit dem 11. September 2001 auch den Terror zu bekämpfen. Die Ursache all dieser Probleme nämlich, so die Annahme, liege in der Regierungsunfähigkeit schwacher oder zerfallender Staaten. Die erneute Verlängerung des Afghanistanmandats der Bundeswehr durch den Bundestag [im Februar] bietet eine gute Gelegenheit, einmal eine Bilanz des Statebuilding auch in anderen Regionen zu ziehen. Gut sieht diese Bilanz nicht aus. Die Idee, einen Staat aufzubauen, folgt der Vorstellung, Staaten seien die einzigen Regelungsinstanzen, die Gesellschaften dauerhaft friedlich organisieren können. Auch internationale Politik setzt Staatlichkeit voraus: Theoretisch gibt es keinen Landstrich auf dieser Erde, der nicht von einem Staat kontrolliert wird. Wo diese Kontrolle schwach ist oder ganz fehlt, wo der Staat also die Bevölkerung nicht beherrschen kann, scheinen Probleme wie Gewalt und Migration an der Tagesordnung. Staatsaufbau dient den westlichen Staaten als Instrument, diese Risiken zu managen. Der instabile Staat soll am Ende selbst in der Lage sein, durch funktionsfähige Institutionen für Ordnung zu sorgen und Wohlstand, Sicherheit und Stabilität herzustellen. Für eine Übergangszeit sollen fremde Truppen den Frieden sichern, um einen politischen Aufbau zu ermöglichen. Im Kern übernehmen diese Interventionstruppen das Gewaltmonopol eines Staates. Währenddessen sollen die Hauptfunktionen eines Staates, also seine Finanzierung, Legitimität und ein eigenes Gewaltmonopol verankert werden. In der Praxis allerdings stoßen der Aufbau dieser Institutionen und mehr noch das Ziel, sie in der Bevölkerung zu verankern, an Grenzen. Die zentralen Institutionen eines Staates, Ministerien, Polizei und Militär, werden zwar formal eingerichtet, sie bleiben aber Fassaden. Die Bevölkerung erkennt die neue politische Ordnung selten umfassend an, stattdessen existieren ältere, traditionelle und damit erprobte Verfahren weiter. Hinter den Fassaden findet Staatlichkeit in dem abstrakten, vom westlichen Idealbild vorgegebenen Sinn nicht statt: Statebuilding schafft Potemkinsche [hier im Sinne von vorgetäuschter, nur fassadenhaft existierender Staatlichkeit zu verwenden] Staatlichkeit. Zwar haben diese Staaten Sitz und Stimme in den Vereinten Nationen, es gibt zuständige Minister, Staatsbesuche können stattfinden. Doch bleiben die Fähigkeiten staatlicher Institutionen begrenzt, regelnd in die soziale Welt einzugreifen. Meist mangelt es ihnen an Legitimität, denn Verfahren wie demokratische Wahlen, Transparenz und politische Mitwirkungsmöglichkeiten reichen nicht aus, Akzeptanz herzustellen. Häufig liefert der Staat zu wenig Zustimmungsfähiges, und oft fehlt ihm auch die grundsätzliche Akzeptanz: [Kolleg Politik und Wirtschaft] 1 Der Staat ist nicht in den Köpfen. Deshalb sind Wahlen und andere Verfahren häufig nur Pflichtübungen, die das Publikum in den Entsendeländern beruhigen sollen. Wenn eine Intervention beginnt, scheint sie den Eingreifenden oft als Beginn einer neuen Zeit. Für die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten aber gibt es keine Stunde null, sondern eine Vorgeschichte an Staatlichkeit, an sozialen Strukturen, an internationalen Verflechtungen. Das Bild, das sich die Eingreifenden von außen machen, um vermeintlich uralte Konflikte zu bearbeiten, entspricht selten den wirklichen gesellschaftlichen Verhältnissen. So versuchten sie nach den Kriegen in Jugoslawien jahrelang, die mythische Multikulturalität Jugoslawiens wiederherzustellen, die jedoch bei näherem Hinsehen eher einem pluralen Monokulturalismus geglichen hatte: einem Nebeneinanderher kultureller Identitäten, die zwar koexistierten, aber wenig Gemeinsamkeiten hatten. In Afghanistan übersah die nach 2001 angestrebte Zentralisierung, dass dort der Staat immer aus sehr lose verknüpften kleineren Herrschaftseinheiten bestand. Diese funktionierten wie eigene kleine Staaten, wären sie in der internationalen Sphäre nicht auf äußere Anerkennung angewiesen gewesen. Nun sollten ihre Herrscher ihre dominierende Stellung aufgeben und an einen von außen eingesetzten Apparat übergeben. Lokale und externe Sicht unterscheiden sich also oft derart, dass gegenseitige Enttäuschungen zwischen internationalen Akteuren und den lokal Handelnden beinahe unvermeidlich sind. In Interventionen wird der Aufbau einer Herrschaftseinheit anhand einer internationalen Norm betrieben, die in den betroffenen Gebieten häufig weniger selbstverständlich ist, als die Akteure im Westen meinen. Dass die Politik des Statebuilding in westlichen Hauptstädten gemacht wird, bringt Bündniserwägungen, wirtschaftliche und normative Überlegungen ins Spiel, die häufig nichts mit der sozialen Wirklichkeit zu tun haben. Lokale Bevölkerungen haben darin wenig bis keine Mitwirkungsmöglichkeiten: Weder stehen ihnen die Planungen für Hilfsmaßnahmen offen noch können sie die zugrunde gelegten Wertvorstellungen beeinflussen. Der internationale Interventionismus ist insofern doppelt verantwortungslos: Zum einen strebt er danach, die Situation von Bevölkerungen zu verbessern, ohne diese an der Zielplanung oder gar deren Überprüfung zu beteiligen. Und zum anderen versuchen nationale Regierungen mit Verweis auf Bündnisverpflichtungen und internationale Absprachen, ihren heimischen Wählern diese Politik als alternativlos zu verkaufen. [...] Die im internationalen Raum gepflegte Politik des Interventionismus ist deshalb nur als organisierte Verantwortungslosigkeit zu beschreiben. Organisationen wie die EU oder die Nato führen die Intervention durch und entziehen sie direkter öffentlicher Kontrolle. Sie tragen dazu bei, Staatsfassaden aufzubauen, denn sie können nicht verhindern, dass gesellschaftliche Verflechtungen am Staat vorbei existieren. [...] [Kolleg Politik und Wirtschaft] 2 Interventionen sind deshalb nicht wirkungslos, sie bringen jedoch nicht das, was sie anstreben. Funktionierende Staatlichkeit wird sich auch nicht mit mehr Geld oder mehr Zeit einstellen, wie oft behauptet wird: Solange die Intervention die gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse mit großer Macht und viel Geld beeinflusst, verhindert sie just die Entstehung selbsttragender politischer Institutionen. Sie widerspricht damit westlichen Grundwerten, nämlich politischer Selbstbestimmung, Souveränität und demokratischer Willensbildung. Berit Bliesemann de Guevara, Florian P. Kühn, in: Die Zeit, 3.2.2011 Aufgaben: 1. Erläutern Sie die Schwierigkeiten, die mit dem momentan praktizierten Statebuilding der internationalen Truppen in NATO- und UNO-Einsätzen verbunden sind. 2. Entwickeln Sie für ein konkretes Land (Afghanistan, Sudan etc.) analog zur Argumentation der Autoren nachhaltige Lösungsstrategien im Rahmen des Statebuilding zur dauerhaften Befriedung. [Kolleg Politik und Wirtschaft] 3