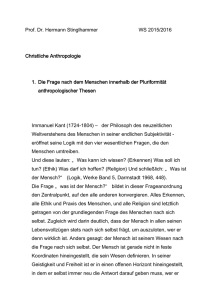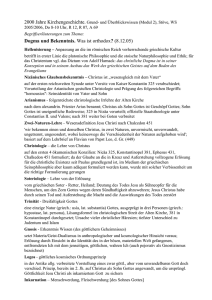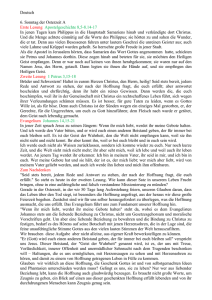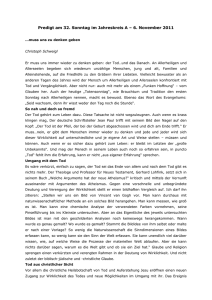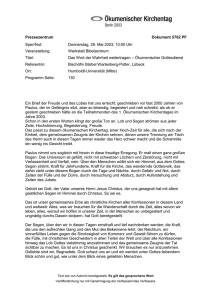Christliche Anthropologie
Werbung
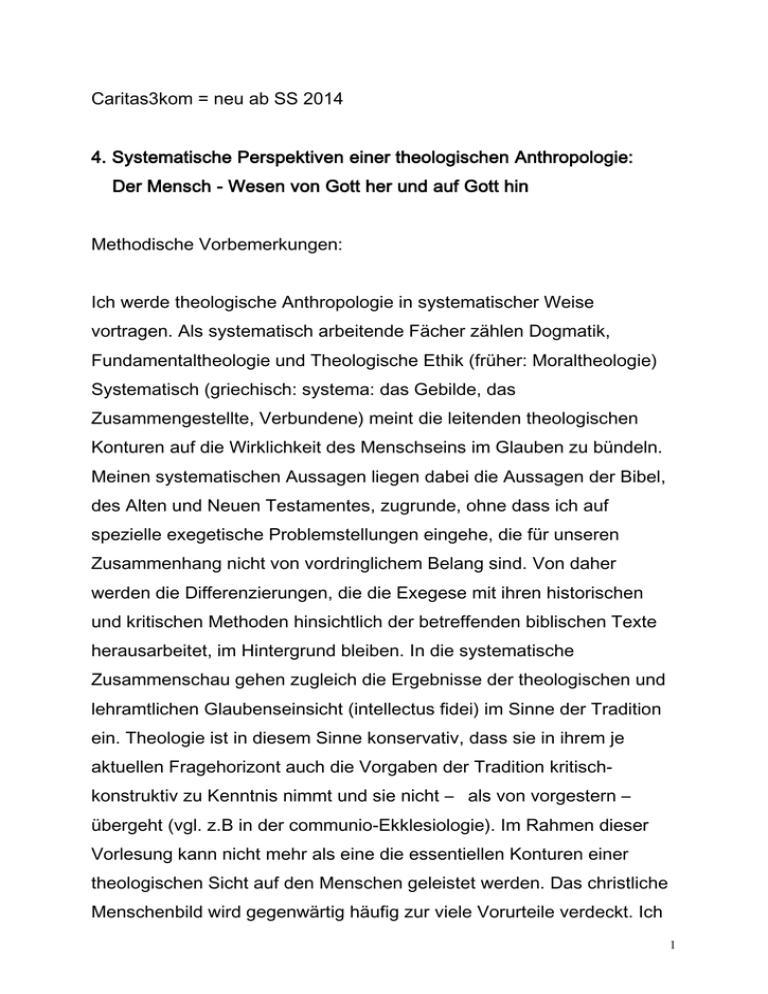
Caritas3kom = neu ab SS 2014 4. Systematische Perspektiven einer theologischen Anthropologie: Der Mensch - Wesen von Gott her und auf Gott hin Methodische Vorbemerkungen: Ich werde theologische Anthropologie in systematischer Weise vortragen. Als systematisch arbeitende Fächer zählen Dogmatik, Fundamentaltheologie und Theologische Ethik (früher: Moraltheologie) Systematisch (griechisch: systema: das Gebilde, das Zusammengestellte, Verbundene) meint die leitenden theologischen Konturen auf die Wirklichkeit des Menschseins im Glauben zu bündeln. Meinen systematischen Aussagen liegen dabei die Aussagen der Bibel, des Alten und Neuen Testamentes, zugrunde, ohne dass ich auf spezielle exegetische Problemstellungen eingehe, die für unseren Zusammenhang nicht von vordringlichem Belang sind. Von daher werden die Differenzierungen, die die Exegese mit ihren historischen und kritischen Methoden hinsichtlich der betreffenden biblischen Texte herausarbeitet, im Hintergrund bleiben. In die systematische Zusammenschau gehen zugleich die Ergebnisse der theologischen und lehramtlichen Glaubenseinsicht (intellectus fidei) im Sinne der Tradition ein. Theologie ist in diesem Sinne konservativ, dass sie in ihrem je aktuellen Fragehorizont auch die Vorgaben der Tradition kritischkonstruktiv zu Kenntnis nimmt und sie nicht – als von vorgestern – übergeht (vgl. z.B in der communio-Ekklesiologie). Im Rahmen dieser Vorlesung kann nicht mehr als eine die essentiellen Konturen einer theologischen Sicht auf den Menschen geleistet werden. Das christliche Menschenbild wird gegenwärtig häufig zur viele Vorurteile verdeckt. Ich 1 hoffe, dass sich zeigt, wie falsch diese Vorurteile häufig sind – nichts aber ist zählebiger als Vorurteile – und wie befreiend die Aussagen einer theologischen Anthropologie zur conditio humana gerade in Bezug auf menschenwürdige Lebensgestalten zur Geltungen gebracht werden können. 4.1. Anthropologie des Alten Testamentes: Der Mensch – zur Gemeinschaft mit Gott berufen Im Alten Testament gibt es eine Fülle verschiedener Anthropologien, die immer von der Entstehungszeit eines Textes und der darin zum Ausdruck kommenden Theologie abhängen. So zeigt sich etwa in der sehr späten Weisheitsliteratur des Buches Kohelet bisweilen auch ein Menschenbild, das sich als existentialistisch und nihilistisch charakterisieren lässt, wenn sein grundlegendes Thema lautet, dass menschliches Leben nichtig und sinnlos – „ Windhauch“- sei. Dennoch findet sich das Gravitationszentrum der atl. Anthropologie in den beiden Schöpfungserzählungen des Anfangs, die in der Endredaktion des AT nach dem Exil gerade an den Anfang gestellt wurden, um in zweifacher Weise dessen leitendes theologisches Essential festzuzurren. Von daher werden uns im Folgenden die sog, 1. und 2. Schöpfungserzählung beschäftigen. 4.1.1. Erste Schöpfungserzählung (Gen 1, 1- 2,4a) 4.1.1.1 Exegetisches Zum Anfang einige kurze exegetische Schlaglichter zum Text. Mit diesem Textabschnitt (=Perikope/ rings umhauenes Stück, lat. Kapitel) befinden wir uns paradoxerweise nicht auf der ältesten Schichte das AT, sondern seiner jüngsten. Die Exegeten nennen sie nach ihren Autoren 2 P/Priesterschrift. Es handelt sich wohl um eine Schöpfungstheologie, die im Babylonischen Exil ( ca. 580 -530) von jüdischen Priesterkreisen verfasst wurde. Das „ Priesterliche“ dieses Lehrgedichtes zeigt am formalen Aufbau und seiner strophenartigen Reihung , wie sie liturgischen Texten zueigen ist (1. – 7. Tag, Redeformel und Gutheißung am Ende: „ Gott sprach“…“und Gott sah, dass es gut war“). In seiner Metaphorik erinnert durchaus an den uralten Babylonischen Schöpfungsmythos „ enuma elisch“ = „ als oben der Himmel noch nicht genannt war“. Allerdings bewirkt der atl. Gottesglaube einen fundamentalen Unterschied: In der 1. Schöpfungserzählung handelt es sich nicht um eine naturhafte Kosmogonie, in der die Welt durch einen Götterkampf entstanden ist, mit dem Ergebnis einer von verschieden numinosen Gottheiten durchsetzten Welt, in der sich der Dualismus des Anfangs manifestiert. Die Schöpfung bleibt atl. die freie Setzung des einen souveränen Gottes, der sie aus seiner kreatorischen Vernunft und Freiheit heraus in einem geistigen Schöpfungsakt (durch das LogosWort) als eine pro-fane, d.h. eine vollkommen endliche Welt an sich freigibt. Darum sind die Gestirne am Himmel eben keine Gottheiten mehr, sondern schlicht funktional gedeutete „ Lichter“, die v.a. als Sonne und Mond dem Rhythmus von Tag und Nacht zugewiesen sind (vgl. Gen 1. 14-19). Wie kommt es nun dazu, dass diese jüngste Textschicht, die sich zusammen mit der ältesten, dem sog. Jahwisten – dazu später mehr – an den Anfang gesetzt ist. Im Grunde bildet diese redaktionelle Komposition die Konsequenz aus dem geschichtstheologischen Basissatz atl. und bibl. Theologie überhaupt, der da lautet: Gott ist als der Herr der Geschichte der Retter seines Volkes Israel. Weil und insofern er dies ist, so dass ihm alle Wirklichkeit dient, ist er zugleich ihr Schöpfer (und kann sie – eschatologisch – auch vollenden). Damit ist die p. Schöpfungserzählung (zusammen mit 3 J) das schöpfungstheologische Vorzeichen für die gesamte Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk Israel, die sich in der Theologie der Propheten schließlich auf die gesamte Welt hin universalisiert (vgl. Jes 2, 3ff). Anders gesagt: Die Schöpfungstheologie steht in theologischer Ableitung zur Heilsgesichte. 4.1.1.2 Inhaltliche Horizonte Der Mensch ist in der Logik der 1. Schöpfungserzählung ein Wesen, das aus den Raum des Kosmos und des Bios aus einer geordneten Struktur herauswächst (Licht – Gewölbe- Land- Wasser- Pflanzen-Licht-FischeVögel-Tiere des Feldes-Mensch als imago Dei, dabei keine moderne evolutive Logik, vgl. erst Pflanzen, dann Licht). Der Mensch ist also Bios und in den Raum der Biologie hineingestellt. Aber er wird in einer – im Text markierten „ Lasst uns Menschen machen“, Gen 1, 26, besonderen - Selbstaufforderung Gottes zu seiner schöpfungstheologischen Bestimmung berufen: Abbild Gottes zu sein. Das heißt nun bereits, dass der Mensch immer unter sein Niveau fällt, wo er sich „ zurück zur Natur“ bestimmen will (vgl. Rousseau, Ökologie). Denn der Mensch ist als dieses Abbild Gottes immer schon in einen anderen Horizont gestellt, der besagt, dass Menschsein und damit sein In-der-Welt-sein einer theologischen Kultivierung bedarf. Ohne Gott verkommt das Menschsein des Menschen auch in seinen naturhaften Lebensbezügen. Diese besondere Bestimmung des Menschen bringt P in der Formulierung „ imago Dei“ (Gen 1, 26). Damit wird nicht so sehr eine äußere Bestimmung des Menschseins benannt, wie etwa sein aufrechter Gang oder seine Sprache, durch die er sich von den Tieren absetzt. Vielmehr wird hier eine allen kategorialen Verhältnissen des 4 Menschen zugrundliegende Relationsbestimmung benannt, die die spezifische Differenz des Menschen markiert: Er ist jenes Wesen, das in ein derartiges Verhältnis zu Gott gesetzt ist, dass Gott sich in ihm erkennen kann. Als Abbild Gottes ist es seine Bestimmung das kreatürliche Spiegelbild Gottes und sein Repräsentant in der Schöpfung zu sein. Der zugrundeliegende hebräische Begriff „ saelem“ meint dementsprechend die Statue als Repräsentant des Königs im Land, damit er in allen Regionen des Reiches präsent ist. Diese Bildtheologie findet ihren „ Sitz im Leben“ in der altägyptischen Königstheologie. Demzufolge ist der Pharao – und nur er – der Repräsentant Gott in seinem Reich. Diese aristokratisch-exklusivistische Anthropologie wird nun vom Gottesbegriff Israels her „ demokratisiert“: nicht der Pharao allein ist Repräsentant Gottes, sondern jeder und jede, der und die Mensch ist und so in einen fundamentalen Beziehung zum Schöpfer steht. Zwar gilt auch für das AT, dass jedem Mensch für sich Vernunft und Freiheit und damit das zukommt, was in der europäischen Tradition (aus seinem theologischen Ursprungsmilieu heraus) „ Person“ heißen wird im Sinne einer geistigen Selbstzentriertheit“ aus der heraus er ein Ich zu seiner Um – und Mitwelt verhalten kann. Die Personalität des Menschen, gründet in seinem unmittelbaren Verhältnis zu Gott. Insofern kommt jedem Menschen seine unantastbare Würde zu. Aber dieses Ich in seiner menschliche Vernunft und Freiheit ruht nicht in sich selbst. Sie ist der Reflex seines Gottesbezugs, in dem dieses Ich nicht nur gründet, sondern in dem es sich durch sein Selbst- und Weltverhältnis auch erfüllt. Das eben heißt: Von Gott her steht so der Mensch auch sich selbst und der Welt gegenüber, um beide zu gestalten. Dass der Mensch schöpfungstheologisch über die Welt hinausragt, ermöglicht es ihm so, sich selbst und Welt zu haben, ohne einfach passgenau – und damit unfrei – in seine „ Umwelt“ eingepasst zu sein. Daher kann 5 Johann Gottfried Herder (+1803) im Zeitalter der Aufklärung in diesem theologischen Sinn vom Menschen als dem „ ersten Freigelassenen der Schöpfung“ sprechen. Das aber heißt zugleich, dass die „ Zentriertheit“ des Menschen als freie Vernunft in einem größeren Horizont verortet ist, nämlich in der freien Vernunft Gottes, der das Maß seines Wirklichseins ist. Das heißt, der Mensch ergreift sich in seinem Selbst- und Weltverhältnis erst dort in einer stimmigen Weise, wo er sich als das Wesen der Transzendenz, d.h. als Wesen des Überstiegs vollzieht und sich an Gott rückbindet (religere, Religion). Anders gesagt: die Zentriertheit des Menschen ist durch alle Exzentrizität des Weltverhaltens zugleich unausweichlich Exzentrizität auf Gott (W. Pannenberg). Mit anderen Worten: Gott gehört – mit allen Konsequenzen – in die Wesensbestimmung des Menschen hinein. Mit dem Ansatz der transzendentalen Theologie Karl Rahners gesagt: Der Mensch ist „ Geist in Welt“ und „ Hörer des Wortes“, so dass er in allen Seinsvollzügen „ immer schon“ in einem größeren Horizont steht, auf den er sich in seiner geschichtlichen Freiheit zu – oder eben wegbewegt. Letztlich besagt dies, dass der Mensch das Wesen der Selbstüberschreitung ist, dass er es nicht mit sich selbst und seiner Welt genug sein lassen kann („ die Welt ist nicht genug“), sondern er in einer Selbstbescheidung mit dem Endlichen „ unter Niveau bleibt“. Das heißt zugleich, dass Gott als Schöpfer – so die manifeste Auffassung der Moderne bis heute – nicht zum Milieu der Selbst-entfremdung des Menschen wird, sondern zum Ort seiner Selbstidentität. Die klassische Formel der Theologie hierfür lautet dementsprechend: „ desiderium naturale in deum“. In Bezug auf die Gottesbeziehung des Menschen, die sich im Raum seiner geschichtlichen Existenz realisiert, wurde in der Theologie von Augustin bis heute die Formulierung gen 1, 26 wichtig: „ als unser Abbild, uns ähnlich“. Die lateinischen Begriffe „ imago“ und 6 „ similitudo“, denen hebräisch „ sealem“ und „ demut“ zugrunde liegen, werden auf eine geschichtliche Spannung ausgelegt, der zufolge der Mensch seine grundgelegtes Bild (imago/ saelem) auf die Verähnlichung mit Gott zu gestalten (similitudo/ demut). Damit wird die imago zum schöpfungstheologischen Datum für das heilsgeschichtliche Ziel der similitudo. Daraus ergibt sich etwa als Konsequenz für die Aufklärung, dass in keiner Weise von einem heilen Urzustand, der durch den Sündenfall verlorengegangen wäre, nicht auszugehen ist. Vielmehr war und ist der ursprüngliche Index des Menschen hin auf eine „ werdende Gottesebenbildlichkeit“ (Herder), die er in seinem geschichtlichen Vollzug einzuholen hat. Dass dies durch den sog. Sündenfall, d.h. durch die verweigerte Exzentrizität auf Gott hin, nicht möglich wurde, ändert nichts an diesem grundlegenden schöpfungstheologischen Verhältnis. Vielmehr ereignet sich dieser Sündenfall geschichtlich je neu, wo der Mensch seine Selbsttranszendenz nicht leistet, sondern sich in sich selbst und seiner eigenen Welt rundet und damit die Spannung von Ich und Gott auf den Ichpol zurückwendet. Das wird zur wesentlichen Sünde des Menschen, in der er sich in seinem eigenen Sein verletzt, sofern er Gott als Bestimmungspol seiner selbst außer Acht lässt. Anders gesagt: indem er sich selbst absolut setzt. Gott bildet die schöpfungstheologischen „ Ordnung“ des Menschseins, so dass er die ins wahre Sein findet, wenn er die Wahrheit Gottes lebt. Modern formuliert, seine Transzendenz bestimmt so auch seine kategorialen, geschichtlichen Handlungsfelder. Wenn also Gott selbst als der Schöpfer der Welt Hingabe an das Andere ist, der es „ am Fest des Lebens“ teilhaben lässt (Origenes), dann sind Liebe, Kommunialität und Proexistenz die Formen, wie sich der Mensch in seinem In-der-WeltSein auf Gott beziehen kann, ja Gott tun kann. 7 Diese verdeutlich P in Bezug auf die bestimmenden Horizonte seines Menschseins: den Bezug zur Mit- und Umwelt. In Bezug auf die personale Mitwelt hält P daran fest, dass der Mensch keine absolute Individualität, sondern Sozialität ist, dass der Mensch für sich allein ein „ halber Mensch“ ist, der in das Sein mit andere hineingestellt ist, damit er die Transzendenz der Liebe leben kann. Analog zum Gottesbezug gilt: erst am Du wird der Mensch er selbst. Diese Wirklichkeit sieht P vor allem im Verhältnis von Mann und Frau, wenn es in Gen 1, 27 heißt: „ Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.“ Auch hier liegt eine fundamentale Aussage der Anthropologie vor, durch die sich die biblische Tradition von anderen Kultivierungen des Menschseins abhebt. Denn es gilt die Positivität von Mann und Frau in der Transzendenz der Liebe, in der sie in ihre leibhaftige Gemeinschaft am Geheimnis Gottes partizipieren. In der Zauberflöte von Mozart heißt es darum: „ Weib und Mann, Mann und Weib rühren an die Gottheit an“. Gerade weil der Mensch als imago dei zur Liebe berufen ist, lebt er für P. in der Polarität der Geschlechter. Er ist nur so – in seiner sozialen Gottebenbildlichkeit – der, in dem Gott sich erkennen kann. Darum wird in an dieser Stelle in P vom Menschen als eine „ Plurale tantum“ gesprochen. Der Mensch ist der eine Mensch nur im Plural, in dem er sich als Liebesein verwirklichen, in dem er in seiner kreatürlichen Existenz am Sein Gottes partizipieren kann (vgl. dazu die Theologie des Hohen Liedes). Wie sehr sich diese Geschlechterlehre in ihrer Positivität abhebt von der griechischen Kultur, zeigt sich daran, dass im Schöpfungsmythos Platons Mann und Frau das Ergebnis eines kosmischen Unfalls sind, durch den der eine Mensch in zwei Hälften zerbrochen ist. Mann und Frau stehen nun unter dem Zwang des Eros. 8 Sie suchen die ursprüngliche Einheit wiederherzustellen und kommen doch nie mehr ganz zueinander. Mann und Frau in ihrem Zueinander sind so ein Fluch. Für das atl. Menschsein ist es eine Positivität, ein Segen. Zugleich – diese Perspektive ins Allgemeinmenschliche erweiternd – liegt darin auch die Einheit der Gottes- und Nächstenliebe als Inhalt des atl. Gebotes und der jesuanischen Verkündigung begründet. Wer Gott liebt, kann sich in seiner Sozialität nur stimmig auf Gott beziehen, wo er seine Sozialität als Liebe, zumal als Caritas zum Nächsten in Not lebt (vgl. das Gleichnis vom barmherzigen Samariter Lk 10, 25-37). Der erste Johannesbrief sagt es kurz und bündig so: „ Wer sagt, dass er Gott liebt und seinen Bruder hasst, ist ein Lügner.“(1 Joh 4, 20). Der zweite kategoriale Bereich ist das Verhältnis des Menschen zur untermenschlichen Schöpfung, also zur Natur. In seiner Herrschaft über die Tiere der Erde (vgl. Gen 1, 26) soll der Mensch den Schöpfer repräsentieren. Das aber heißt, es muss sich um ein Herrschen handeln, das die lebensvermehrende Wirkung des Segens Gottes in der Welt vergegenwärtigt. Es ist nun die Aufgabe des Menschen die Lebensfreundlichkeit des Schöpfers durch sein Tun in und an der Welt präsent zu halten. Nach E. Zenger (vgl. Gottes Bogen in den Wolken. Untersuchungen zur Komposition und Theologie der priesterschriftlichen Urgeschichte, Stuttgart 1983 SBS 112) drückt dies die erste Schöpfungserzählung dadurch aus, dass sie dieses herrscherliche Tun des Menschen mit dem hebräischen Verb radah kennzeichnet. Radah meint nun nicht ein Herrschen im Sinne von Unterwerfen, sondern ein Handeln im expliziten Sinne von Hüten und Hegen. Radah wurzelt daher in der Welt der Hirten. Dieses Bild hat ja Jesus im Blick auf Gott und sich selbst aufgegriffen. Der gute Hirt, der sich um das Wohl seiner Schafe sorgt und sich für sie einsetzt, damit sie gut leben können. Darin wird 9 radah zu einem explizit schöpferkonformen Tun sofern Gott selbst sich atl. als der „ gute Hirt“ der Schöpfung kundgibt (Ez 34, 11-22) bzw. ntl. von Jesus selbst als dieser „ gute Hirt“ verkörpert wird (vgl. Joh 10, 11ff). Solches „ Herrschen“ ist gemeint, wenn der Mensch in seinem Weltbezug seine Gottebenbildlichkeit umsetzen soll: eine proexistente Haltung in der Sorge um das Leben-können der anderen Geschöpfe. An der Stelle Gottes soll der Mensch das Haus des Lebens für alle bewohnbar und im Frieden halten. Von daher ist in der Perspektive des AT der Unfriede zwischen Mensch und Kreatur eine Folge der Sünde des Menschen. Wo er sich zum Herrscher der Welt aufschwang, pervertiert er die Ordnung des friedlichen Miteinanders. Zeichen dieses Unfriedens ist der gestörte Schöpfungsfriede zwischen Mensch und Tier bis hin zum Töten der Tiere, das von Gott nur als Konsequenz der Sündigkeit des Menschen in der Geschichte toleriert wird (Gen 9, 1ff). Von daher ist es die Vision der endgültigen Heilszeit, die ein versöhntes Miteinander von Mensch und Tier sowie der Tiere untereinander in einem universalen Frieden anzielt (vgl. Jes 11, 5-9). Aus dieser grundlegenden Qualifizierung des Gott repräsentierenden Tuns des Menschen lässt sich nicht nur eine ökologische Theologie herleiten, die sich etwa gegenwärtig auf unseren Umgang mit Tieren im Sinne der Massentierhaltung fokussiert (vgl. Rainer Hagencord: Gott und die Tiere; „ Kein Rohling für die Fleischindustrie“). Die angemahnte Umkehr findet ihren Grund in der schöpfungstheologischen Geschwisterlichkeit von Mensch und Tier, sofern in ihnen Blut fließt, das „ göttliche Fluidum“ des Lebens (vgl. Gen 9, 4f). Zum anderen – und darauf wird in diesem Kontext explizit Bezug genommen – ist der Mensch „ Abbild Gottes“ (Gen 9, 6), als er für die Mitgeschöpfe Sorge trägt. In dieser Perspektive kommt etwa das Menschsein eines Franz von Assisi zu liegen oder - im evangelischen Bereich - Albert Schweitzer 10 und seiner Forderung einer „ Liebe zu allem, was lebt“. Von Gott her ist der Mensch also in seiner Aufgabe der Repräsentanz zu einer lebendförderlichen Kultur bestimmt. Denn – und dies ist ein weiteres Argument – nicht er ist die „ Krone der Schöpfung“, sondern die Vollendung der gesamten Schöpfung am 7. Tag im Sabbat Gottes (Gen 2, 3). Das aber heißt, dass nicht allein der Mensch, sondern mit ihm die Schöpfung als ganze zur Gemeinschaft mit Gott berufen ist. Die besondere Rolle des Menschen liegt darin, im Namen Gottes die Schöpfung selbst zu befrieden. 4.1.2. Die zweite Schöpfungserzählung ( Gen 2, 4b – 2, 25) 4.1.2.1. „ Exegetisches“ Auch zu dieser zentralen schöpfungstheologischen Perikope nur kurze Anmerkungen aus dem Raum der historisch-kritischen Exegese. Mit dieser Stelle haben wir die ältere Schöpfungstheologie vor uns. Sie stammt wohl aus dem Jerusalem der Zeit zwischen 1000 und 900 v. Chr. Israel ist von einem Nomadenvolk zu einem Volk von ansässigen Bauern und Handwerkern geworden. Mit dem Kultheiligtum in Jerusalem (950 v. Chr.) bildet sich ein Mittelpunkt eines Reiches ab, das wie ein Kreis um das erwählte Volk aufgezirkelt ist. Diese unterschiedliche kulturelle Situation schlägt sich in dieser Schöpfungstheologie in einer ganz eigenen Bildwelt nieder, die – nach dem verwendeten Gottesnamen – JHWH- dem sog. Jahwisten als Verfasser(gruppe) zugeschrieben wird. Das erstaunliche dabei ist, dass diese unterschiedliche Bildwelt letztlich von derselben anthropologischen Überzeugung getragen ist wie P. Insofern können wir uns hier kürzer fassen. Hinzugefügt sei nur noch, dass auch hier menschheitsalte Traditionen theologisch verarbeitet wurden. 11 4.1.2.2. Inhaltliche Horizonte Als erstes zeigt sich, dass Gott für den Menschen einen Garten, ein Paradies (vgl. Islam) anlegte, in den er den Menschen hineinsetzte (Gen 2, 8 u 15). Gott baut eine menschenförmige Welt um ihn herum – wie ein großer Gärtner. Der evangel. Alttestamentler G. von Rad spricht daher zurecht davon, dass der Mensch als Mitte in einen kosmischen Zirkel gesetzt wird, der ganz und gar dem Menschen zugestaltet ist, Schöpfung also als ein anthropozentrischer Kosmos. Zugleich teilt der Mensch eine fundamentale Bestimmung dieser ganzen Wirklichkeit. Er ist – wie alles Lebendige – aus adamah, aus feuchtem Lehmboden gemacht. Und Gott agiert hier ganz archaisch wie ein Toepfer (= Koran). Dementsprechend lautet der Gattungsname des Menschen in der 2. Schöpfungserzählung auch „ Adam“, d.h.: der von der Erde genommene. Damit wird zugleich der Spielraum des Menschen vor Gott benannt: er ist endlich, er ist gemacht, er ist ens ab alio. Er gründet nicht in sich selbst, er ist nicht autonom. Sein Ort vor Gott ist die Erde, seine Geschöpflichkeit. Mit aller anderen lebendigen Kreatur teilt der Mensch es, ein atmendes Wesen zu sein, eine nephesh haya, eine lebendige Seele. Allerdings wird hier der Begriff nephesh nicht in unserem abendländischen Sinn als Seele bezeichnet, also nicht im Sinne einer vom Leib getrennten Substanz. Darauf ist gleich in einem kurzen Exkurs zurückzukommen. Nephesh haya meint im semitischen Denken vielmehr „ ein lebendiges Wesen“, das durch die Gurgel atmet. So meint nephesh vor allem das Lebendige, für das pars pro toto die Kehle steht. Diese Charakteristik teilt der Mensch auch mit den Tieren, die ebenso nephesh haya sind. Die spezifische Differenz zu ihnen liegt nun darin, dass der Mensch seinen Lebensatem unmittelbar von Gott bekommt: Gott „ blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der 12 Mensch zu einer nephesh haya – zu einem lebendigen Wesen.“ (Gen 2, 7). In dieser wunderbaren Metaphorik wird letztendlich ausgedrückt, was P im Begriff der imago dei zu fassen suchte: die Unmittelbarkeit des geschöpflichen Menschen aus Gott, der buchstäblich sein göttliches Milieu ausmacht, in dem der Mensch allererst lebendig wird. Zugleich wird damit auch die bleibende Relationalität markiert, in die die menschliche Kreatur eingewiesen ist: Sein auf Gott zu, weil radikal Sein von Gott her. Im eindrücklichen Bild des Atems wird so die radikale Paradox des Menschen ausgesagt. Er ist zwar von der Erde und lebt als Endlicher auf der Erde, aber in alle dem ist er bezogen auf Gott, der als sein Ursprung auch sein Ziel ist. Erst aus der Gottesbeziehung heraus wird der Mensch in sein Wesen freigesetzt. Auch hier gilt also wieder, dass Gott unauslöschlich in die Definition kreatürlichen Menschseins eingeschrieben ist, dass der Mensch ohne Gott nicht in seine Bestimmung hineinfindet, eben weil er ontologisch eine auf Unendlichkeit bezogene Endlichkeit ist. Zudem wird auch hier in der 2. Schöpfungserzählung der Mensch in seine Hütefunktion gegenüber der übrigen Schöpfung eingewiesen – „ damit er den Garten bebaue und behüte“ (Gen 2, 15). Und dies unter der normierenden Vorgabe Gottes, die das (menschheitsalte) Tabu Gottes markiert, vom Baum der Erkenntnis zu essen (Gen 2, 17). Auch hier zeigt sich der Mensch eingewiesen in seine wesenhafte Exzentrizität, die es ihm verbietet, nach seinem eigenen Willen zu leben. Und auch die Sozialität des Menschen ist J wichtig. Der Mensch findet in den Tieren, die er benennen darf, die also auf seine Identität bezogen sind, nicht das adäquate Gegenüber (Gen 2, 19.20). Erst in der Frau wird der Mensch Adam ganz. Eva – die Mutter alles Lebendigen – ist Fleisch von seinem Fleisch (Gen 2, 23). Und eben dies – die absolute Gleichwertigkeit von Frau und Mann - wird im Bild von der Rippe 13 veranschaulicht, sofern diese aus der Herznähe des Mannes genommen wird. Letztlich wird hier auf die erotische Unruhe des Mannes angespielt, der in sich eine Leerstelle der Sehnsucht fühlt, die er nicht durch sich selbst, sondern durch die Frau stillen kann. Dies gilt natürlich umgekehrt ebenso. Aber entscheidend ist für J hier die Ergänzungsbedürftigkeit der Geschlechter und nicht die Unterordnung der Frau unter den Mann. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass in der männerdominierten Gesellschaft der Semiten dezidiert davon die Rede ist, dass der Mann Vater und Mutter verlässt, um sich an seine Frau zu binden, um mit ihr ein Fleisch zu werden (vgl. Gen 2, 24). Der Mann gerät in der Werbung um die Frau quasi unter sein Niveau. Es geht also nicht um Ehe auf der Ebene des „ Sachenrechts“, sondern um gleichberechtigte Liebe, also nicht um Unterordnung. Es geht – biblisch- um die Einheit des Einander-Erkennens, um die gegenseitige Einheit in der Liebe, in der Mann und Frau zugleich in der Gegenwart Gottes stehen. Darum brauchen sie sich nicht zu schämen (vgl. Gen 2, 25). Wir sehen, wie auch hier J noch einmal – wie auch P - die drei Grundachsen des Menschseins vor Gott auszieht: Die ontologische Transzendenz des Menschen zu Gott, in dem er als Mensch erst zu sich selbst kommt. Und die dementsprechende innerweltlich-kategorialen Realisierung dieser Seinsachse in seiner Beziehung zur Um- und Mitwelt. Das heißt, wo der Mensch sein In-der-Weltsein in all seinen Facetten von Gott her als dem Pol seiner Wahrheit übernimmt, wird er selbst seinsgerecht und wahr. Anders gesagt: „ Glauben ist Sein“. (S. Kierkegaard, Krankheit zum Tode). In onto-logische Sprache übersetzt heißt dies: In seiner Geschöpflichkeit ist der Mensch schon immer das ens relationale. Von Gott her – der sich in seiner Freiheit zum Anderen der Welt bestimmt hat – ist er nicht ein Individuum, das dazu noch in 14 Beziehungen steht. Er ist Individuum von diesen Beziehungen und in ihnen. Diese sind und bleiben für sein Selbstwerden konstitutiv. Praktisch heißt dies: Der Mensch übernimmt sein Wesen dort, wo er sich in Liebe auf den und das Andere seines selbst übersteigt und dort in seiner menschlichen Freiheit Gottes Proexistenz mitvollzieht. Er affirmiert so in seinem Tun Gottes Praxis als eine lebensfördernde Beziehungskultur als den theonomen Grund für gelingendes Menschsein. Von Gott her trägt Menschsein die Dimension des Relationalen. Für eine theologische Anthropologie heißt dies umgekehrt: wo der Mensch sich dieser theonomen Bestimmung als Wesen der Gemeinschaft und der Hingabe verweigert, schädigt er zugleich sich selbst. Wo er sie als bestimmenden Grund seiner Freiheit übernimmt, übernimmt er seine Wesensbestimmung im Sinne der Gottebenbildlichkeit (vgl. Bischof Kamphaus: „ Mach´s wie Gott, werde Mensch!“). Zugleich wird sein Tun zur sakramentalen Vergegenwärtigung Gottes in der Welt, wie Benedikt XVI in seiner Antrittsenzyklika „ Deus caritas est“ formuliert hat: „ Wo absichtslos die Liebe getan wird, wird Gott getan.“ Von daher erschließt sich auch der innere Zusammenhang des biblischen Doppelgebotes (wie es im Dekalog formuliert ist), das Jesus als die Mitte seiner Verkündigung übernimmt: „ Du sollst Gott lieben aus ganzem Herzen. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (vgl. Mk 12, 29ff par). In der selbstlosen Nächstenliebe tut der Mensch „ was Gott ist“ und bejaht insofern Gott als Wahrheit für sich selbst. 15 4.1.2.3 Exkurs zur Leib-Seele-Problematik: An dieser Stelle ist eine Anmerkung zu einer „ gängigen“ christlichen Sicht des Menschen als einem Doppelwesen mit Leib und Seele fällig. In dieser Perspektive wird der Mensch traditionell in diese beiden Teile (Leib und Seele) zerlegt. Dem Leib kommt dabei die niedere animalische - Natur zu. Der Seele wurden die höheren und reineren und daher auch die „ theologischen“ Qualitäten zugesprochen. Diese Sicht auf den Menschen, wie sie als sog. Platonismus vor allem von Augustinus auf her für westliche Theologie prägend wurde, hat letztlich zu einer Halbierung des Heiles des Menschen im Sinne einer Entweltlichung der Gottesbeziehung geführt. Christliche Praxis wurde über lange Zeiten als Spiritualität der Entleiblichung wirksam, wo doch gerade in der Eucharistie der Leib des Herrn im Mittelpunkt stand wie auch christliche Auferstehungshoffnung nicht ohne die Dimension der verklärten Leiblichkeit auskommt. Aber der prägende Platonismus und Augustinismus konnte das Ineinander beider Dimensionen für das Menschseins nicht zusammenhalten, bis eben dahin, dass der geschöpfliche Leib für den Gottesbezug des Menschen kaum mehr relevant war. Er war nur äußerliches Instrument, während in der Vernunftseele des Menschen das geistige Prinzip der Gottesbeziehung gesehen wurde. Christsein gestaltete sich so als ein Komplex vielfacher Verdrängungen und Abspaltungen bis in die noch nicht lange zurückliegende Vergangenheit. Diese Entleiblichung christlichen Heiles provozierte dann als (über)kompensatorische Nachholvorgänge die leibund lustbezogenen Lebensgestalten der Moderne. Es ist nun durchaus theologisch aufregend zu sehen, dass das Menschenbild des Alten Testamentes diese Trennung des Menschen in einen sinnlich-sündhaften Leib und eine gute, geistige und darin gottfähige Seele nicht kennt. Für das AT ist der Körper nicht das 16 Gefängnis der Seele (soma saema), aus dem diese wieder zu befreien wäre. Diese unheilvolle Sicht steuert erst die griechischen Philosophie bei, die dann vor allem in der Zeit der Kirchenväter in einer verhängnisvollen Weise in die Spiritualität des Christentums eingegangen ist und für die paradigmatisch – wie schon gesagt – der Name Augustinus steht. In der Sicht der hebräischen Bibel ist der ganze Mensch in seiner leibhaftigen Verfasstheit geschenktes Leben von Gott her: eben nephesh haya, wie wir in der zweiten Schöpfungserzählung hörten. Und darum ist alles am Menschen und die ihn umgebende geschöpfliche Wirklichkeit gut, ja sehr gut (vgl. erste Schöpfungserzählung). Darum hat der gläubige Jude des AT keinen Anlass seinem Leib, seiner Sexualität und allem Geschöpflichen gegenüber misstrauisch zu sein und sie mit dem Makel des Nicht-sein-Sollenden zu belegen. Er darf und muss seine Gottesbeziehung im Horizont seiner Geschöpflichkeit leben und ihm dafür danken. Denn der Mensch ist kein reiner Geist, er ist verleiblichter Geist. So zeigt sich der Glaubende des At dankbar für die Gabe des Lebens und der Schöpfung als ganzer. Gutes Leben ist ein Segen von Gott her. Insofern sieht sich der atl. Mensch von seinem Schöpfer zu einer freudigen Diesseitigkeit ermächtigt, in der ihm auch der Wein von Gott vergönnt ist, der „ das Menschenherz erfreut“ (Psalm 104, 14). Der jüdische Mensch weiß sich von Gott als ganzer zum Fest des Lebens berufen. So ist auch die erotische Beziehung zwischen Mann und Frau die geschöpfliche Teilhabe am Liebesein Gottes (vgl. das Hohelied der Liebe). Es ist für den Gläubigen im Raum des AT ein Zeichen der Gnade vor Gott, lebenssatt zu sterben, also das Leben als gute Gabe Gottes verkostet zu haben. Kurzes Leben gilt daher als Fluch (vgl. Jes 65, 16c-25). Dieses Bewusstsein, als ganzer Mensch zusammen mit anderen im Heilsraum Gottes zu stehen, spiegelt sich 17 auch im Verhalten Jesu. Er war offensichtlich kein Asket wie Johannes der Täufer, war Gast bei Festen und Hochzeiten, was ihm sogar den Vorwurf einbrachte, „ ein Fresser und Säufer“ (Mt 11,19) zu sein. Der Mensch muss daher in der Logik des AT und NT nicht aus sich selbst und seiner Welt auswandern, um seine Gottesbeziehung leben zu können. Worum es geht ist lediglich, dass er sich in seinem In-derWeltsein und in seinem Selbstverhältnis von Gott her bestimmt. Denn sein geschöpfliches Sein ruht nicht in ihm auf, sondern in seiner Gottesbeziehung. Als ein Sein von Gott her trägt er die Wahrheit seines selbst nicht in sich, sie vermittelt sich ihm in seinem Gottesverhältnis. Auch hier gilt wieder: Sein wächst aus dem Glauben, Zentralität steht immer schon im Horizont der Exzentrizität. Von Gott her wird der Mensch als Mensch wahr. Vor dieser Logik des atl. Glaubens, wie sie auch das NT durchzieht, gilt aber auch: wo der Mensch die Gabe mit dem Geber verwechselt, wo er also die Dimensionen seiner endlichen Existenz absolut setzt und sie idolisiert, weil er Gott als Fluchtpunkt der Wirklichkeit ausblendet, pervertiert er seine seinsbegründende Relation: Er vergöttlicht das Endliche und verkennt, dass der göttliche Gott allein es ist, in dem sich seine geschöpfliche Existenz vollenden kann. Für das AT gilt: der Mensch darf sich in seiner Existenz unbedingt bejahen. Er ist sich selbst von Gott als gute Gabe geschenkt. Aber er kann diese Gabe nur dort wirklich annehmen, wo er sich selbst als ein Versprechen auf mehr anerkennt. Wo er seine onto-logische Relation verkehrt und sich selbst zum Absolutpol der Wirklichkeit macht, wird ihm das Leben – biblisch gesprochen – zum Fluch. Der sich absolut gebärdende Mensch kann die Grundströmungen seiner Existenz nicht mehr auf den Pol Gottes hin kultivieren, in dem sie sich allein beruhigen könnten. Er wird immer mehr zum in sich verkrampften Mensch, dem homo in se incurvatus, von dem 18 – gut augustinisch - Martin Luther gesprochen hat. Der Mensch also, der sich seine eigene Welt baut, als ob es Gott nicht gäbe – „ quasi deus non daretur.“ Damit sind wir theologisch beim Menschen als Sünder und Erbsünder angekommen. 4.2. Menschsein konkret - die verweigerte Transzendenz oder: Der Mensch in der Sünde Aus den bisherigen Daten der atl. Anthropologie zeigte sich: Der Mensch kann die Wahrheit seines Seins als Geschöpf vor Gott nicht anders vollziehen als in seinem freien Überstieg zu Gott, der sein gesamtes Selbst- und Weltverhalten bestimmt. Auf dem Hintergrund dieser grundlegenden Seinsordnung des Menschen entfaltet das AT das Drama des Menschen vor und mit Gott als Perspektive der verweigerten Transzendenz. Was heißt dies? Der Mensch will sich in der Logik des AT gerade nicht in verdankender Weise auf Gott beziehen und darin Gott als den maßgebenden Ursprung seiner Existenz anerkennen. Er – so die zentrale Aussage der sog. Sündenfallerzählung - will selbst sein „ wie Gott“ (Gen 3,5), ohne sich auf dessen Wahrheit zu beziehen. Anders gesagt: Der Mensch setzt seine eigene Zentralität absolut und blendet seine Exzentrizität aus. Mit Kierkegaard: er will verzweifelt nicht er selbst sein, also nicht Geschöpf sein. Er beansprucht eine Autonomie ohne Gott, aus theonomer Autonomie wird eine „ autonom sein wollende Autonomie“ Dies ist der freiheitstheologische Sinngehalt der sog. Sündenfallgeschichte in Gen 3 mit ihren mythenhaften Zügen, die in ihrer Metaphorik auf die faktische Wirklichkeit des Menschen von Anfang an hinweisen (Gen 3, 1-24), der versucht, sich in absoluter Weise aus sich selbst zu bestimmen und sich zum alleinigen Maßstab der 19 Wirklichkeit zu erheben. Anders formuliert: Der Mensch gerät in den Selbstwiderspruch, weil er sich dem Angebot Gottes verweigert sich als endliche Freiheit im Raum dessen unendlichen Freiheit vollziehen zu können, insofern er sich von Gott bestimmen lässt. Damit ist Sünde als ein Datum menschlicher Freiheit markiert, als das „ Verbleiben im Eigenen“ (J. Ratzinger), wo der Mensch sich dem freien Angebot der Gottesbeziehung (= Gnade: Gott, der sich in Freiheit schenkt) verweigert, um sich von seiner eigenen endlichen Wirklichkeit her zu bestimmen (der Mensch strandet in seiner sinnlichen Wahrnehmung, aus der heraus er nicht zur Anerkennung der Wahrheit Gottes findet. Das wird die theologische Tradition in verschiedenen Gewichtungen zwischen reformatorischer und katholischer Theologie – als die menschliche Konkupiszenz identifizieren, d.h. seine dominante Sinnlichkeit, die letztlich die Wahrnehmung des Menschen gefangen nimmt. In dieser Hinsicht ist die Sündenfallgeschichte von Gen 3 keineswegs als ein historischer Bericht mißzuverstehen. Es handelt sich ja um eine theologische Deutung der Gegenwart durch einen fiktiven Rückblick in die geschichtlichen Ursprünge (= Ätiologie, ta aitia: die Ursprünge). Darin findet die Erfahrung des Menschen ihren Ausdruck, dass etwas in ihrem In-der-Welt- und Menschsein „ nicht in Ordnung ist. Dazu gleich Genaueres. Man kann also sagen: Wie die ersten Schöpfungserzählungen ein Bild vom Menschen entworfen haben, wie Gott ihn sich erträumt hat (positiver Mythos), so beschreibt die sog. Sündenfallgeschichte den Menschen, der von Anfang an faktisch Sünder war, sofern er sich aus sich selbst heraus bestimmen und die Norm seiner Wahrheit (auto – nom) sein wollte. Wir brauchen also keine Historizität annehmen, auch nicht den Monogenismus eines ersten Menschenpaares, sondern schlicht unsere Anthropologie zugrunde legen, wonach der Mensch erst in der Transzendenz, im Sprung des 20 Glaubens, in die Wahrheit Gottes und seiner selbst hineinfindet – und sich dies nicht zu leisten traut, weil er – gnadentheologisch gesprochen – dem Angebot Gottes misstraut und sich seine eigene Welt und Wahrheit baut, als bei seinem Ich und seiner Welt, letztendlich bei seiner eigenen Wahrheit verbleibt. Wo der Mensch onto-logisch in die Beziehung zu Gott eingewiesen ist, so dass er sich erst in Gott ergreift, ist dieses Moment in eine prekäre Freiheit gelegt, die sich in ihre Selbstzentrierung und der Absolutsetzung der Wirklichkeit ihre relationalen Bestimmung zu Gott hin verweigert. Dies ist die konkrete conditio humana, die er in seiner Vorfindlichkeit zeigt. Der Mensch ist – so W. Pannenberg – peccator in re – er ist faktisch immer schon Sünder, lebt in seiner Selbst- und Weltzentriertheit faktisch seine reale Gottesferne. Paulus beschreibt diese Phänomen eindringlich in seinem Römerbrief: „ Sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie behaupteten weise zu sein, und wurden zu Toren. Sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern… Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge, sie beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers.“ (Röm, 1, 21ff). Theologisch wird diese paulinische Aussage – mit unterschiedlichen Nuancen zwischen katholischer und evangelischer Anthropologie – in den Begriff der Konkupiszenz (Begehrlichkeit) gefasst. Gemeint ist damit, dass der Mensch sich in seinem Selbstbewusstsein, das wesentlich von seinem Ich ausgeht, im Raum des Endlichen verfängt (dem Raum des „ uti“, während er auf den Raum des „ frui“hingeordnet ist. Sünde ist so die Wahl des Menschen gegen den Gottesglauben, gegen Gott als das erfüllende Ziel endlicher Freiheit. Und daraus zieht Paulus die Konsequenz: „ so kam durch die Sünde der Tod in die Welt, weil alle sündigten“. (vgl. Röm 5, 12). Nebenbei: Auch für Kant ist dies in seinem 21 vernunftorientierten Denken das unauslotbare Geheimnis des Menschen, wie er angesichts der Wahrheit bewusst und entschieden aus der Wahrheit fallen kann, so dass es die Schuld – religiös gesprochen – die Sünde des Menschen ist, die ihm selbst zuzurechnen bleibt im Sinne der Ursünde (paccatum originale originans). In den folgenden Kapiteln Gen 4-11 entfaltet die Genesiserzählung – wiederum im Sinne einer mythologisch gefärbten Ätiologie („ das was niemals war und immer ist“) die Folge dieser Lebens im Schatten Gottes. Es zeigt sich das Böse, die Egoismen der Menschheit, die aus der Ursünde hervorgehen, weil jeder Einzelne sich nun absolut setzt. Wo der Mensch nicht mehr zur Transzendenz auf Gott hin fähig ist, wird auch seine soziale Transzendenz korrumpiert: Kain erschlägt Abel, menschlicher Gigantismus greift um sich (Göttersöhne vermischen sich mit Menschenfrauen, Gen 6, 1ff), bis dahin, dass die Menschheit im Turmbau zu Babel die Grenze zwischen Erde und Himmel überbrücken will (Gen 11, 1ff). Und so verfallen sie der Strafe ihres Tuns, sie verstehen sie eine Sprache des Seins nicht mehr, sind aus der Einheit gefallen in die Zerstreuung des Menschseins (vgl. Gen 11, 7ff). Zugleich wirft dieses Leben in der Entfremdung zur göttlichen „ Quelle des Lebens“ seine Schatten auch auf die menschliche Existenz überhaupt: das Leben – arbeiten und gebären – wird mühsam (Gen 3, 16ff), die Liebe zwischen Mann und Frau vergiftet, (ebd). Mit der Entfernung von Gott als der Quelle des Lebens mindert sich die Lebenskraft des Menschen, so dass der Tod als Sold der Sünde, wie Paulus dann sagen wird (vgl. Röm 5, 12), zur Wirklichkeit seines Lebens wird (vgl. Gen 3, 20). Anders und freiheitstheologisch formuliert: Der Mensch erlebt sich in einem vielfach verstellten Freiheitsraum, aus dem er selbst nicht wieder einfach aussteigen kann. Er hat sich zum Sündersein bestimmt. Sein Ort ist so „ Jenseits von Eden“. Er lügt sich darin zugleich in seine 22 eigene Wahrheit hinein, versucht so das „ Nicht-in-Ordnung“ in ein „ Inder-Ordnung“ zu verändern – und verstrickt so umso mehr in seiner „ Sünde“ – in einem falschen, unrechten Sein. Darauf zielt die scholastische Bestimmung des malum morale als einem Mangel an Gutsein. Sündersein ist defizientes Menschsein, ist darin Selbstschädigung, sofern der Mensch sich „ unter sein Seinkönnen“ begeben hat. Von daher liegt im Moment des falschen Seins der theologische Anknüpfungspunkt für die (paulinische) Gnadentheologie und Soteriologie als Eröffnung zum erlösten Menschseins in der neuen Gemeinschaft mit Gott von Gott her. Hier wären dann die verschiedenen Perspektiven der Christologie zur Geltung zu bringen. Im Kontext der Sünde ist auch der Begriff der Erbsünde - Augustin spricht vom peccatum haereditarium - der in seiner Eindeutschung so wohl auf Martin Luther zurückgeht von Bedeutung. In ihm wird – gegen die unterstellte augustinische Sicht einer quasi-biologischen Realität der Erbsünde - die soziale Dimension menschlicher Sündigkeit benannt. Die Reichweite menschlicher Schuld ist nie auf das Private beschränkt, sondern tangiert notwendig immer auch andere (vgl. dazu Pröpper II 699). Zwar ist es so, dass Sünde im eigentlichen Sinn jeweils ein Akt aus unvertretbarer personaler Freiheit ist. Dennoch ergibt sich aus dem Miteinander menschlicher Freiheitsräume eine Situiertheit der Freiheiten, in der diese sich positiv, aber eben auch negativ beeinflussen. Dies bedeutet, dass menschliche Freiheiten als Folge menschlicher Sünde in Konstellationen des Irrtums, der Verschattung und falschen Handelns geraten, das ihr eigenen Handeln in einer dramatischen Weise mitbestimmt, so dass sie Dimensionen fehlgeleiteter Freiheit in den eigenen Akt übernehmen. Diese soziale Situiertheit, die den Menschen daran hindert, auf Gott hin und so seinsgerecht – in Bezug auf sich und den anderen - zu leben, trägt eine eigene Dynamik in sich, die im 23 Extremfall die Frage aufwerfen kann, ob jemand im subjektiven Sinn Sünder ist, wenn ihm nicht etwa die Möglichkeit genommen ist, ein eigenes Gewissen auszubilden. Vielleicht ist diese Möglichkeit in vielen Bereichen unserer Gesellschaft längst wirklich geworden. Im Zusammenhang der Situiertheit menschlicher Freiheit kommt dann auch die Taufe als Befreiung von der Erbsünde zu liegen. Von Gott her wird dem Menschen eine neue Situation, ein neuer Anfang inmitten der Menschheit möglich gemacht (Gnade), der in der unverstellten Gottesbeziehung des Getauften besteht, von dem her er zu einer neuen Existenz im Sinne eines Vermögens zum Guten befähigt wird. Letztlich steht so die Beichte in der Verlängerung der Taufe, in der dieser neue Anfang in der Geschichte eines Menschen immer neu eingeholt werden kann. Wie schon betont: in diesem Verständnis von Erbsünde braucht nicht mehr das augustinische Modell des sog. Monogenismus sowie der Vererbung der Ursünde Adams (Konkupiszenz) mittels des sexuellen Aktes herangezogen werden. Auch wenn das Konzil von Trient (15451563) in seinem Dekret zur Erbsünde gegen Pelagius festhält “propagatione, non imitatione“ (DH1513), ist damit nicht der sexuelle Akt gemeint, sondern die Einheit des Menschengeschlechts in der Sünde, unsere „ Brüderlichkeit in der Sünde“(D. Bonhoeffer). In einer freiheitstheologischen Sicht (Hermeneutik) ist diese Wirklichkeit wohl plausibler einzuholen als auf der Ebene einer quasi-genetischen Logik, auf die das Konzil von Trient auch nicht anspielen wollte. Es geht um eine geschichtlich- kollektive Seinsbestimmung des Menschen vor Gott ohne Gott. Diese lässt sich nur als freiheitliche wirklich als Schuld bzw. Sünde bestimmen, ansonsten wäre sie lediglich Schicksal und so Notwendigkeit, damit aber keine Schuld. Paulus formuliert dies Ankommen der erbsündlichen Tendenz in der personalen Sünde des Einzelnen so (vgl. Röm 7,19): „ Denn ich tue 24 nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will.“ In jeder aktuellen Sünde wird letztlich die Ablehnung Gottes aktuell, das grundsätzlich in der Menschheit als ganzer „ da“ ist. Der Mensch weigert sich sowohl einzeln wie kollektiv, der zu sein, der er sein kann und sein soll: Mensch als imago dei, um so dem Willen Gottes zu entsprechen. Theologische Anthropologie ist so: Modalanthropologie, eine Anthropologie die eine neue „ Art und Weise“ (modus), ein neues Können des Menschseins von Gott her (in der Gnade) aufzeigt. Die theologische Rede von der Erbsünde macht deutlich, wie sehr der einzelne Mensch, aber auch ganze Institutionen gegen die Wahrheit Gottes und so gegen die eigene Humanität anleben – und wie schwer die Umkehr fällt, die dazu gefordert ist, auch dies sowohl im einzelnen Leben wie auf der Ebene von Institutionen und Strukturen (vgl. die Rede von der „ strukturellen Sünde“). 4.3. Beten als geschöpflicher Grundakt (F. Ullrich) Ich hatte bereits im Zusammenhang der Leib-Seele-Problematik darauf hingewiesen, dass sich die geschaffene endliche Freiheit in der Logik des AT nur stimmig vollzieht, wenn sie sich selbst auf Gott als Ursprung und Ziel ihres Daseins bezieht – und damit den Mehrwert von Welt und Mensch erkennt. Eben diesen Grundakt des Menschen benennt der Begriff des „ Transzendierens“, den Überstieg aus dem Zentrum des eigenen Ich auf den Pol des Schöpfers, von dem her er sich selbst geschenkt und an sich frei gegeben ist. Für das gelingende Menschsein des Menschen heißt dies zunächst, dass er sich in seiner geschöpflichen Endlichkeit positiv bejahen darf als eine Existenz, die von Gott gewollt ist und von Gott zur Teilhabe an seinem Leben gerufen ist – und zwar als endliche Freiheit. D.h. zunächst: Mein Dasein ist so 25 ein Gut und kein Unsinn. Der endliche Mensch ist von Gott als Geschöpf – so Origenes – zum Fest des Lebens gerufen. Dieses SichGegebensein führt aber notwendigerweise zum Akt der Verdankung Gott gegenüber, von dem her alles - inklusive meines selbst - wesentlich Gabe ist. In diesem Gegebensein erweist sich die Wirklichkeit als herkünftig vom Schöpfergott selbst, der sich zum Ziel seiner Schöpfung bestimmt hat. Das aber heißt, wo der Mensch sein Gabesein und damit die Gabe der Welt anerkennt, erschließt sich ihm sein Dasein als Beziehung zu einem Größeren, von dem her an sich freigegeben ist, um sich in ihm zu vollenden. Anders formuliert: Im Bewusstsein meiner Geschöpflichkeit ist bereits das onto- logische Moment der Transzendenz auf Gott gegeben, in der sich die Wahrheit meiner selbst und meiner Welt erschließt als eine Vorlauf auf Gott, sofern ich das geschöpfliche Echo seines Rufes im endlichen Sein bin. Mit meiner Geschöpflichkeit ist damit zugleich die radikale Vorläufigkeit alles Endlichen gegeben. Dies aber nicht so, dass das Endliche nichts wäre. Vielmehr trägt es in sich eine Verheißung auf jenes „ Mehr“, das sich in Gott erfüllen kann (vgl. negativ: den Mythos von Sysiphos, der von sich aus das Endliche auf das Absolute hin überwinden will.) Anders formuliert, der Mensch steht nur dann in einer stimmigen Weise bei sich selbst und seiner Welt, wo er sich in seine ihm geschenkte Gottesrelation hineinstellt, die das unhintergehbare Paradox des Menschen ausmacht, sich als endlicher nur in Gott erfüllen zu können, dies aber auch zu dürfen, sich so von Gott an sich selbst gegeben zu sein, dass Gott sich ihm schenken kann. Nikolaus Cusanus, einer der bedeutendsten Mystiker an der Schwelle zur Neuzeit (15. Jh.), formuliert dies in einem Gebet so: „ Wie könntest du dich mir geben, wenn du nicht zuvor mich mir gegeben hättest? Wenn ich in der Stille der Beschauung ruhe, antwortest du, Herr, in meinem innersten Herzen: Sei 26 du dein, so bin ich dein.“ (De visione die, Kap VII). Darum, so der Beter weiter: „ O Herr, Du hast es in meine Freiheit gelegt, dass ich mein sein kann, wenn ich es nur will. Gehöre ich darum nicht mir selbst, so gehörst auch Du nicht mir. Du machst die Freiheit notwendig, da Du nicht mein sein kannst, wenn ich nicht mein bin. Und weil Du es in meine freie Entscheidung gelegt hast, zwingst Du mich nicht, sondern erwartest, dass ich mein eigenes Sein erwähle.“ (ebd.) Mit anderen Worten: Erst wo wir uns in unserem geschöpflichen Selbstsein autonom als Sein zu Gott übernehmen, und uns frei für Gott entscheiden, kann Gott der erfüllende Gehalt meines Selbst sein. Dies hat – nebenbei – erhebliche Konsequenzen für die Art und Weise der Glaubensvermittlung. Entweder wird sie relevant für den Vollzug des Menschen, oder aber sie schwebt über ihm und wird menschlich bedeutungslos. Es kann daher letztlich nur darum gehen, dem denkerisch und lebenspraktisch auf den Grund zu gehen, dass mit der Erfahrung meiner eigenen – endlichen Freiheit – zugleich eine Dynamik des Überstiegs mitgegeben ist, die mich in meinem gesamten Existenzvollzug auf jene unendlichen Gott hin in Bewegung setzt, in dem dieses Freiheitsstreben sich erfüllen darf – noch einmal: durch alle Endlichkeit hindurch und als Erfüllung dieses konkreten Endlichkeit. Dies aber bedeutet, dass der Mensch zu einer distanzierten Gelassenheit ermächtigt wird, die sich weder positiv noch negativ im Raum des Endlichen festmachen muss, sondern es auf Gott hin auch lassen kann. Anders gesagt: Im Transzendenzvollzug wird er frei aus der Angst um sich selbst in einer gelassenen Annahme des Lebensgeschickes als seines Weges zu Gott als sein Vor-lauf in die Vollendung. Ihren leibhaftig-geschichtlichen Ausdruck findet die geschöpfliche Transzendenzbewegung im Gebet. In Formen des Lobes und des Dankes wie auch in Formen des Bitte und 27 Fürbitte vollzieht sich der Mensch als eine verdankte Existenz, die sich nicht aus sich selbst heraus setzt, sondern immer schon von einem Anderen her ist, eben jener „ Quelle des Lebens“, von der die Beter des Psalmes sprechen, wenn sie Gott für das Geschenk des Lebens danken und loben, ihn aber auch in Gefahr, Sünde und Todesnot um diese Gabe des Lebens bitten, die darin besteht, dass Gott sich dem Beter wieder zuwendet. Beispiele dazu Ps 33 (Ein Loblied auf den mächtigen und gütigen Gott), Ps 38 (Die Klage eines Kranken) Ps 46 (Gott, unsere Burg), Ps 57 (Geborgenheit im Schutz Gottes) Ich möchte in diesem Zusammenhang auf eine paradoxe Form menschlichen Gottvertrauens hinweisen: Vertrauen des Menschen zu Gott in der Form von Klage und Anklage. Wo das AT vom Vertrauen des Menschen zu Gott spricht, geht es nicht um eine zahme und blutleere Spiritualität. Es geht um ein Vertrauen, in dem der ganze Mensch in allen Facetten des Leidens mit Gott ringt. Das AT hält dafür sogar eine eigene Gattung bereit: Die Klagelieder. Der Protagonist aller menschlichen Klage vor Gott ist aber Hiob. Hiob begibt sich in einen Rechtsstreit mit Gott auf Leben und Tod. Es wird hier im AT das Ringen eines Menschen mit Gott beschrieben, in dem Gott selbst auf die Anklagebank des Leidenden gezerrt wird. Dieser fromme Hiob schleudert Gott alles entgegen, was ein leidender Mensch Gott entgegenschleudern kann. Und er definiert Gott dabei als Un-Gott, als Monster. Das Überraschende an diesem Buch ist, dass Gott gerade diesem klagenden Hiob antwortet. Er antwortet nicht dem Theologenfreunden des Hiob, die unbedingt darauf festhalten, dass Hiobs Leiden sein muss, was es theologisch sein soll, Leiden und Strafe für irgendeine Schuld. Genau dagegen protestiert Hiob und hält daran fest, dass er ein schuldloser Mensch ist. Nicht den Theologenfreunden 28 Hiobs antwortet Gott. Vielmehr beschuldigt er sie, dass sie nicht recht von ihm gesprochen haben. Aber Hiob, so die letzte Perspektive dieser Legende, hat recht von Gott gesprochen, weil er in seiner Klage am Gott des Lebens festhalten wollte gegen den Gott des Unheils. Das Buch Hiob stellt den Menschen hinein in die Unerklärlichkeit des Leidens. Aber es stellt ihn zugleich vor einen Gott, der zwar geheimnisvoll ist wie das Leben selbst, aber auch im Leiden anrufbar ist für den Menschen – als der Freund des Lebens. Mit Hiob bekommt der leidende Mensch sein gottverbrieftes Klagerecht vor Gott selbst. Gott anerkennt, dass manchmal nur die Form der Klage und Anklage die einzige Weise ist, in der der Mensch an Gott festhalten kann. Das Buch Hiob löst die Frage nicht, warum es Leiden gibt. Es gibt als Lösungshorizont nur an, dass der Mensch sein Leiden nur bestehen und überstehen darf, auch in der Form der Klage und Anklage des Menschen, die zum paradoxen Ausdruck seines Glaubens wird. Gott ist in der Klage anrufbar als der, der einen Weg durch das Leid ermöglicht (vgl. Buch SchwienhorstSchönberger). Von daher schließt das Buch Hiob in folgender Weise: „ Vom Hörensagen nur hatte ich von dir vernommen (sagt Hiob); jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum widerrufe ich und atme auf, in Staub und Asche. Die Hand leg ich mir auf den Mund... Ich habe dich erkannt“ (Hiob 42,2.5.6). Gott stellt sich dem Menschen als Klagemauer seines Lebens zur Verfügung. Der alttestamentliche Mensch hat daher ein gottverbrieftes Recht auf Klage und Anklage vor Gott. Gott ist Gott gerade auch des „ homo patiens“ Das Buch Hiob steht daher gegen jede halbierte Spiritualität, die nur Lob und Preis als Form des Betens zulässt, Klage und Anklage aber als unfromm und als unschicklich zurückweist. Dann aber kann Beten schnell zu einem vertrösteten Zynismus werden, der den Menschen in seinem konkreten Leiden nicht ernst nimmt. Der 29 Mensch will und darf als Ganzer vor Gott vorkommen, in seinem Glück und in seinem Leid. Dies gehört zur Leidenspastoral Gottes selbst. Klage ist oft die einzige Weise, wie der Mensch manchmal noch an einem Sinn festhalten kann. Eine therapeutische Pastoral im Namen Gottes muss dies aushalten können ohne spirituell zu beschwichtigen. Das bedeutet aber auch, dass es eine Kultur der Klage auch in unseren Liturgien geben müsse. Dass es sie kaum gibt, zeigt, dass unsere sog. Leidenspastoral auch häufig von Verdrängung durchsetzt ist. Alfred Delp hat dies einmal so gesagt: Der große Wert des Hiob-Buches ist es, die Schattenseite des Lebens in den Gottesbezug hineinzustellen und zu einem Weg mit Gott zu machen. Vielleicht gilt gerade hier am meisten, was Johann Baptist Metz als Qualität jedes Betens benannt hat: Unterbrechung. Unterbrechung des Alltags. Unterbrechung der sog. Normalität. Aber auch Unterbrechung des Leidens, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Gerade die Perspektive des leidenden Menschen in seinem Verhältnis zu Gott schlägt den Bogen zur neutestamentlichen Anthropologie, sofern im Blick auf den Gekreuzigten Gott selbst zur Antwort auf das Leiden des Menschen wird. Den verschiedenen Perspektiven der neutestamentlichen Anthropologie wenden wir uns in einem nächsten Hauptpunkt zu. 30 5. Neutestamentliche Perspektiven auf das Menschsein Das NT stellt im Blick auf die theologische Gestalt Jesus Christus die anthropologischen Perspektiven, die das AT auf das Menschsein angelegt hat. Von ihm her wird erst sichtbar was in Wahrheit Sünde – Leben ohne Gott – und was befreites, erlöstes und darin wahres Menschseins vor und mit Gott ist. Mit Karl Rahner könnte man so sagen, dass die Christologie die Erfüllung und Vollendung der Anthropologie wie auch deren Gericht ist, in dem die Sünde im Menschsein offenbar wird. Christologisch wird so das Wesen des Menschseins in ein helleres Licht gestellt wird. Das Vatikanum II sagt dies so: „ Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf. Denn Adam, der erste Mensch, ist das Vorausbild des künftigen, nämlich Christus, des Herrn. Christus, der neue Adam, macht eben in der Offenbarung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe dem Menschen den Menschen selbst voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung. Es ist also nicht verwunderlich, dass in ihm die eben genannten Wahrheiten ihren Ursprung haben und ihren Gipfelpunkt erreichen.“(GS 22). – Gemeint sind darin die dramatischen Spannungen des Menschen, SozialitätWesen des Menschen und Sünde, Vernunfterkenntnis, Sittlichkeit und Gewissen, Endlichkeit und Tod: erst in Christus lässt sich das Rätsel des Menschen, das vor allem im Tod aufbricht, auf - werden die Spannungen der Endlichkeit im Endlichen auf Gott hin ausgespannt und darin entspannt (vgl. GS 12-21). Von Christus her wird greifbar, wie Menschsein glückt als Menschseins vor und mit Gott. Auch hier zeigt sich, Glaube ist Sein, sofern sich die größere Möglichkeit des Menschseins in die religiösen Vernunft zu erkennen gibt: Der Mensch findet seine Identität nicht aus sich selbst, er ist soteriologisch von Gott 31 her bestimmt (vgl. Die scholastische Lehre vom desiderium naturale in Deum). Der Mensch kann sich in seiner Endlichkeit nur im Unendlichen beruhigen. In diesem Zusammenhang möchte ich vor allem die christologischen Spitzenaussagen des NT angehen und anthropologisch auswerten. Als erstes und fundamentales Datum ist hier der Begriff Inkarnation, die Menschwerdung Gottes zu nennen. 5.1. Inkarnation – christologische Vertiefung der Menschenwürde In der Inkarnation wird der atl. Begriff der Gott-ebenbildlichkeit in einer bedeutsamen Weise eingetieft. Sofern – johanneisch gesprochen - in der Inkarnation Gott selbst in die Existenz des Fleisches des Menschen, zumal des Sünders, eingeht, ist endliches Menschsein Chiffre und Spur Gottes. Der Mensch gehört in die Gottesgemeinschaft hinein, ja ist schon in Gott, weil er in seinem geschöpflichen Sein in Gott gründet. Die Gabe, die dem Menschen zuteil wird, ist nicht einfach er selbst und dann Gott, sondern er selbst in Gott, sofern Christus der Seinsgrund allen Menschseins ist. Wo Menschsein bestimmungsmäßig in die Wirklichkeit Gottes gehört, sind alle anders und doch jeder gleich. Eine erste Spur zeigt sich in der Demokratisierung der Menschenwürde, wie sie etwa Paulus im Zusammenhang seiner Tauftheologie formuliert, wenn er sagt: „ Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus (als Gewand) angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihre alle seid >einer< in Christus Jesus.“ (Gal 3,26ff). Damit werden alle sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Rollenzusammenhänge vorläufig. Die essentielle Bestimmung des Menschen ist es, „ en Christo“ – und zwar „ einer“ zu sein. 32 Von daher ist das Potential eines biblischen „ Kommunitarismus bzw. Sozialismus“ gerade in den politischen Utopien der Moderne nicht zu überschätzen (vgl. Karl Marx, Lenin, Fidel Castro), auch wenn es im Raum der Kirche selbst oft ungenützt blieb. Kirchliche Strukturen hätten sich von der Tauftheologie her durch ein Ethos der Gemeinschaftlichkeit, durch communial-dialogische Praxis auszuweisen. 5.2. Die christo- logische Wahrheit als der Weg zum menschlichen Menschsein In der Sicht neutestamentlicher Theologie lässt sich formulieren, dass Christus als der Weg zum Menschsein des Menschen vorgestellt wird. Er ist darin „ Weg, Wahrheit und Leben“ (vgl. Joh 14,6). Christus ist nach dem Evangelium der menschliche Mensch, weil er sich ganz vom Willen Gottes her entwirft, so dass in ihm Zentralität und Exzentrizität zur Deckung kommen. Er wird zum wahren Menschen, weil er Gott in seinem Leben ganz da ist. Dem entspricht die christologische Lehraussage von Chalkedon (451) von Christus als „ wahrer Gott und wahrer Mensch“. Was hier auf der Ebene von göttlicher und menschlicher Natur gesagt wird, lässt sich auf im Horizont von lebendiger Beziehung im Sinne des vorher gesagten plausibel machen: In Jesus lebt eine menschliche Freiheit – in der Person des Sohnes – ganz auf den Vater hin. Es geht um die gesamte Existenz, sein Leben, sein Sterben, Freud und Leid, Alltäglichkeit und Fest, sein gesamtes Ich lebt im Horizont Gottes – und eröffnet dem Menschen in seiner eigenen Freiheit ein neues Menschseins auf Gott hin. Und das meint Gnade: Von Gott her wird dem Menschen eine neue Möglichkeit seiner 33 Gottesbeziehung eröffnet, die er aus sich selbst heraus als Sünder nicht mehr finden und leisten kann. Die patristische Soteriologie (Erlösungslehre) spricht in diesem Zusammenhang vom „ admirabile commercium“, dem wunderbaren Tausch, der sich in Christus vollzieht: Gott nimmt unsere endliche Freiheit auf sich, damit er uns mit der seinen beschenken kann. Der Festgesang zu Weihnachten sagt dies so: „ Denn einen wunderbaren Tausch hast Du vollzogen, Dein göttliches Wort wurde ein sterblicher Mensch und wir Menschen empfangen dein göttliches Leben in Christus“ Darin wird Christus zum neuen Spielraum für die Freiheit des Menschen aus Gott heraus. In seiner Nachfolge eröffnet sich für den gläubigen Menschen eine neue Kultur des Menschseins. Insofern lässt sich im Anklang an ein Wort von Bischof Kamphaus sagen: „ Mach’s wie Gott werde Mensch“- oder mit Gregor von Nyssa: „ Unser Spiel spielt in seinem Spiel“ Christus selbst ist so die Gnade Gottes, ist Ausdruck und Realisierung der Menschenfreundlichkeit und Güte Gottes (vgl. Tit 3,4), die dem Menschen umsonst – gratis – geschenkt wird, um ihn so in einen neuen Handlungsraum seines Menschseins zu heben, der grundsätzlich – auch im Raum der Endlichkeit schon „ in Christus“ spielt, und so schon über den Tod der Sünde hinaus ist, also sein Leben „ in, durch und mit“ Gott lebt. Christliche Existenz wird so transparent als Ermöglichung eines neuen Menschseins in Christus (vgl. 2 Kor 5,17: „ nova creatura). Insofern ist Christus in seiner Praxis der Gnade Gottes in Person, die zu einem neuen Lebensstil befreit, in der der Mensch nicht mehr ängstlich um sich selber kreisen braucht (vgl. Gal 5,1: Erlösung ist: „ zur Freiheit befreit sein“). Indem sich der Mensch daher innerlich zu Christus entschließt und ihn zu seinem Wirkprinzip macht, eröffnet sich ihm eine neue Existenzfähigkeit. Es geht um ein „ Gehen in den Fußstapfen Jesu“, um 34 ein absolutes Vertrauen auf einen gütigen Vater. (vgl. Mt 6,25f.; Lk 12,22f.). Und es geht von da her um ein neues Menschsein aus dieser Bindung an den Vater, das den Menschen auch in ein neues Weltethos hineinstellt. Es geht dabei in der Perspektive Jesu um mehr als um die natürlichen Bindungen und die geschöpfliche Beheimatung des Menschen. Es geht um ein Leben im Horizont des göttlichen Willens (wie im Himmel, so auf Erden) und darum um eine radikale Hinwendung zum Du, zumal dem beschädigten Du. Wir kennen dazu ja die entsprechende Stelle des Evangeliums wie etwa das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25-37) und Jesu eindringliche Rede vom Weltgericht (Mt 25,31-46). Hierin liegt ja die theologische Begründung für jedes caritative Tun in der Kirche: Wenn in jedem Menschen Gott gegenwärtig ist, kann sich menschliches Tun nicht am Menschen vorbei auf Gott beziehen (was ihr einem meiner Geringsten Brüder getan habt, ihr habt es mir getan, heißt es in der Weltgerichtsrede Jesu). Und zum anderen: der Mensch kann seine Menschlichkeit nur leben, indem er nach den Worten des Johannesevangeliums die Wahrheit Gottes tut, der Liebe ist. (Joh 3,21). Das bedeutet – johanneisch gesprochen - eine Kultur der Fußwaschung (vgl. Joh 13) und eine Koinzidenz von Kultus und Ethos. Der christo - logische Fundamentalsatz dazu lautet bei Markus: „ Denn der Menschensohn kam nicht, bedient zu werden, sondern zu dienen und zu geben sein Leben als Lösegeld für die vielen“. (Mk 10,42-45). – Und eben darin ist Christus der Zusammenfall von Gottesdienst und Liebesdienst. Dass solche Praxis einer echt selbst-losen Humanität dem Menschen nicht einfach nur aus sich heraus möglich ist, zeigt sich an unserer Selbsterfahrung. Wir geraten darin sehr schnell an unsere Grenzen (vgl. das Beispiel des Franziskus mit dem Aussätzigen). 35 Darüber hinaus spüren wir, dass wir eine neue menschliche Praxis benötigen. Unsere tagtägliche Erfahrung ist es, dass wir durch das Ausgrenzen anderer uns selbst schädigen. Wo andere draußen bleiben müssen, werden sie ihre Rechte anmelden und es kommt zu Konflikten im Großen und im Kleinen, in denen mit der Freiheit der Anderen immer auch die eigene Freiheit beschädigt wird. Theologisch heißt dies: Wo der Mensch – aus Gnade - in Gott zu wohnen anfängt, macht er das Leben selbst bewohnbar. Wo der Mensch in der Lebenspraxis Gottes zu Hause ist, rettet er das eigene Menschsein und das Menschsein der anderen – und rührt an die Erfahrung vom „ auferstandenen Leben“. Das Gemeinte drückt das NT so aus: In Christus wird uns der Ausstieg aus einer inhumanen, „ einer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise“ (1 Petr 1,18) von Gott her – aus Gnade - ermöglicht. Gemeint ist: Christo – logisch finden wir einen Einstieg in eine sinnvolle Humanität, sofern wir in die Praxis seiner Liebe einsteigen: „ Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir einander lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod.“ (1 Joh 3,14). Und das heißt: im Tod der Beziehungslosigkeit, im Tod der Anonymität, dem zerstörerischen Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt, von kollektiver und individueller Einsamkeit und Isolation. Der Raum der Praxis Jesu wird darin plausibel als Umkehr vom sozialen Tod in all seinen Formen als Ausdruck des ent-fremdeten Lebens. In Christus wird der Mensch zur Humanität des Lebens befreit, weil er zur Humanität Gottes ermächtigt wird. In Christus können wir beginnen zu tun, was und wie Gott ist – und geraten so schon jetzt in die Möglichkeit des Himmels („ das Heil in der Geschichte“). 36 5.3. Durchkreuzte Endlichkeit – zur anthropologischen Bedeutung des Kreuzes Nach wie vor gilt mit Georg Büchner: das Leiden und Sterben des Menschen ist der Fels des Atheismus. Die Negativ-Erfahrungen menschlichen Lebens gehen mit dem Glauben an einen gütigen Gott nicht zusammen. Von daher gilt vielen Menschen die Botschaft vom Kreuz durchaus als ein theologischer Zynismus und als eine Provokation. Wie lässt sich das Kreuz anthropologisch im Sinne eines lebens- und leidensgedeihlichen Menschenbildes auswerten und verstehen? Zunächst einmal ist festzuhalten: Sicher nicht im Sinne einer Leidensund Todessehnsucht, die sich dem Leben verweigert. Alle Formen von Nekrophilie sind Ausdruck psychischer Krankheit. Theologisch gilt: Der Mensch ist für das Glück des Lebens geschaffen, nicht für das Leid, oder – beide Dimensionen übersteigend: er ist für Gott und sein Heil geschaffen. Von daher bleibt theologisch im Blick auf das Kreuz zu betonen: Es ist das eindringliche Zeichen des Protests Gottes gegen alle Tode des Menschen. Im Kreuz durchkreuzt Gott diese radikale Endlichkeit des Menschen. Diese setzt sich zusammen aus den vielen individuellen und sozialen Toden, die in den großen Tod am Ende der Tage einmünden. In diese anthropologische Wirklichkeit ist das Kreuz hineingestellt. Es ist die Praxis der Leid-Durchkreuzung Gottes im Namen des Lebens. Insofern ist der Resonanzboden auf das Kreuz der endliche Mensch, der an seiner Endlichkeit zuletzt nur scheitern kann. Vor diesem Hintergrund erschließt sich das Kreuz nicht als Wirklichkeit jenes Opfers, das Gott angesichts der Sünde des Menschen fordert, um in seinem beleidigten 37 Zorn besänftigt zu werden, wie eine durchschnittliche Interpretation der Satisfaktionslehre des Anselm von Canterbury im Blick auf das sog. „ übergebührliche Opfer“ Jesu Christi sagt. Am Kreuz zeigt sich vielmehr eine Freiheit der Liebe, die bis ins Letzte geht (Benedikt XVI.), weil sie um das Lebenkönnen ihres Geschöpfes kämpft. „ Stark wie der Tod ist die Liebe“ heißt es im atl. Hohenlied der Liebe. Und die Christologie des NT fügt hinzu. „ und sie ist stärker wie er“. So ist das Kreuz der Ausdruck der letztmöglichen Entschiedenheit Gottes für seinen Menschen. Im Kreuz geht Gott in Leiden und Tod in das Seinsund Sinnwidrige ein. So werden wir nicht einfach vom Leiden und vom Tod erlöst. Aber wir werden in ihnen erlöst. Weil Leiden und Tod nicht mehr gott- und darin sinnlos sind, sondern ein Weg mit und zu Gott sind. Wo Gott im Tod (als Tod der Gott-losigkeit) anwesend ist, erfährt dieser Tod eine existenzielle Umdeutung. Er ist nicht mehr ein Letztes, sondern ein Vorletztes und wird ein Weg der Gleichzeitigkeit mit Gott – auf das Leben hin. Was heißt dies: In der Perspektive des Kreuzes als Weg hinein in das Leben wird der Mensch befreit zu einer gelassenen Endlichkeit und Abschiedlichkeit, die auf seine irdische „ Auslöschung“(Thomas Bernhard) zuläuft. Denn er weiß diese Abschiedlichkeit unterfangen von der je größeren Reichweite göttlichen Lebens, an dem er in allen seinen Existenzialen partizipiert: „ nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir“, so sagt es Paulus Gal 2, 20. Für eine Anthropologie der Zeitlichkeit und Endlichkeit heißt dies: Unser „ Spiel“ spielt bereits in „ seinem Spiel“(Gregor von Nyssa), in dem auch der Tod Ausdruck seiner je-größeren Freiheit ist, die uns im Existenzraum Jesu Christi als. „ Licht und Leben“ (vgl. Joh 1,1-16) schon jetzt offen steht. 38 Vom Kreuz her wird der Mensch befreit zu einer Auferstehung, schon jetzt als Antizipation der großen Auferstehung am Ende der Tage. Der Mensch wird darin ermächtigt „ über den Tod hinweg“ zu leben und seine Abschiedlichkeit in einer erlöst-gelassenen Weise zu tragen und zu ertragen. Er wird befreit, sich mit seiner Endlichkeit auszusöhnen und an seiner kleinen Alltäglichkeit abzuarbeiten, weil er darin dennoch jung bleiben darf bis in den Tod (Hans Urs von Balthasar). Und er wird darin zugleich frei von seiner Sorge um sich selbst, weil er sein Leben bereits in Gott gesichert weiß. Gerade in einem Gott, der mir mein Leben auch noch im Tod garantiert, werde ich frei zur Proexistenz – und partizipiere eben so am Sein Gottes, das mich immer schon über den Tod hinaushebt („ von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag“, D. Bonhoeffer). So ist das Kreuz nicht das Zeichen, das für einen zynischen oder gar bösartigen Gott steht. Es steht für eine Liebe, wie sie größer nicht gedacht werden kann, weil sie auch noch das Nichts des Todes umfängt – und gerade so die österliche Seinsmacht der Liebe erweist: „ stark wie der Tod ist die Liebe. Und sie ist stärker wie er.“ Der Gekreuzigt- Auferstandene ist so – nach Karl Rahner - der neue Mensch, der durch den Tod hindurch den Weg ins Leben gefunden hat. Christo-logisches Menschsein heißt so, sich auch im Leiden und Sterben von Gott finden und retten lassen. 39 6. Christo- logische Praxis geglückten Menschseins: Ein neues KreaturSein vor Gott (vgl. 2 Kor 5,17) Paulus formuliert in seinem zweiten Brief an die Korinther: „ Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung: Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden“…. 6.1. Leben von der (U-topie) der Auferstehung her - Wider die Ermäßigung des Menschseins Unsere anthropologische Analyse hat uns einen Menschen vor Augen gestellt, dessen Sehnsucht nach Leben maßlos ist. Wir sind ständig unterwegs auf der Suche nach dem „ Leben in Fülle“(Joh 10, 10). Und es hat uns einen Menschen gezeigt, der in seinen Maßlosigkeiten notwendig an der Endlichkeit des Lebens selbst scheitert. Im Blick auf das AT sowie auf das NT öffnete sich ein Raum für den endlichen Menschen, indem er sich in seinem endlichen Leben und in seinem Sterben auf Gott hin überschreiten konnte. Die Bibel des Alten und Neuen Testamentes nimmt dem Menschen dabei gerade seine Maßlosigkeiten nicht. Sie fordert ihn nicht zu einer Form von menschlicher Selbstbescheidung auf, in der er sich mit seiner Endlichkeit einfach abfinden soll. Dies ist der Weg, den vor allem die Psychologie gegangen ist und immer noch geht: Menschsein als Versöhnung mit der Endlichkeit als Endlichkeit. Die Bibel des AT und des NT sagt dem Menschen vielmehr im Gegenteil: Er soll nicht vorschnell zufrieden sein. Er soll maß-los sein, weil er gerade im Endlichen nicht zufrieden sein kann. Der Glaube will gerade diese Maßlosigkeiten des Menschen in bewusster Weise wachhalten, damit der Mensch nicht vergesse, wer er wirklich ist. Der Glaube widersteht 40 darin einer Reduzierung und Ermäßigung des Menschseins. Er optiert für eine Maßlosigkeit, die in der Gottesbeziehung des Menschen aufruht, christologisch formuliert: In seiner Verheißung auf Leben über den Tod hinaus. Das biblische Menschenbild spricht von dem Menschen, der sich mit nicht weniger als mit „ Leben in Fülle“ selbst zufrieden geben darf (vgl. Marie Luise Kaschnitz: Ein Leben nach dem Tod: „ Glauben sie, fragte man mich, an ein Leben nach dem Tode und ich antwortete: Ja.... Mehr also, fragen die Frager erwarten sie nicht nach dem Tode? Und ich antwortete: Weniger nicht“.) Diese christliche Utopie des Menschseins, in der die Ursehnsüchte des Menschen in einer positiven Weise in Gott verankert und verwurzelt sind, führen zu einer ganz neuen Praxis des Menschseins im Glauben. Wo ich mein Leben in Gott verwurzeln kann, wo ich mein Leben aus der Wirklichkeit der Zukunft her übernehmen kann, wo ich leben kann von den Verheißungen Gottes her, kann ich in Jesus Christus die U-topie maßlosen Menschseins wagen, d.h. ich kann das Risiko eingehen, mehr zu wollen als die „ Abfindungen“, die mir die Gesellschaft zubilligen will. Im Glauben ist es mir möglich, meine menschlichen Sehnsüchte in Gott zu verorten - schon jetzt. Sofern ich im Glauben meine Sehnsüchte in Gott bereits vorweggenommen, versichert, weiß, werde ich frei zu einer gelassenen Endlichkeit. Glaube heißt dann Umkehr aus den billigen Sicherungen hinein in die Sicherheit Gottes. In diesem Widerstand gegen die billigen Abfindungen der Gesellschaft ist Religion und Glaube gerade nicht Opium für das Volk. Die U-topie der Hoffnung in Christus führt mich vielmehr in eine kritische Distanz zu den endlichen Verheißungsgestalten und stellt mich in einen Horizont, der mir erlaubt, mich von Gott her mit der radikalen Fragmenthaftigkeit meiner Existenz auszusöhnen in einer Kultur der Ge-lassenheit, die alles – positiv wie negativ – auf Gott hin übersteigen kann. Das Biotop seines 41 Lebenkönnens ist Gott selbst, weil allein Gott die „ Fülle meines Lebens“ (vgl. Joh 10, 10) ist. Dies wird eindringlich deutlich in der sog. Versuchungsgeschichte Jesu, wie sie in den synoptischen Evangelien in Mt 4,1-11 vorgestellt wird. In dieser Versuchungsgeschichte finden wir im Grunde eine theologische Kultur, wie der Mensch mit seinen Lebensheiligtümern - Name, Macht, Heimat und Besitz - in einer humanisierenden und für ihn entlastenden Weise umgehen kann. Auf eine genauere Exegese kann hier verzichtet werden. Nur so viel: Diese – wohl legendenhafte – Erzählung vor dem eigentlichen Beginn des messianischen Sendung Jesu will darauf verweisen, dass die Messianität Jesu in seinem radikalen Sohnesgehorsam (er ist ja der Sohn) liegt, in dem er leistet, was das Volk Israel in seinen Versuchungen in der Wüste nicht leisten konnte. Darum ist er das paradigmatische Vorbild für die Christen in seiner Nachfolge. Sie sollen im christo-logischen Gehorsam gegenüber Gott in ihre geschöpfliche Bestimmung hineinfinden. „ Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt; dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete: In der Schrift heißt es: Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die Heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich herab; denn es heißt in der Schrift: Seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. 42 Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es auch: Du sollst den Herrn deinen Gott nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg; er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan. Denn in der Schrift steht: Vor dem Herrn, deinen Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab, und es kamen Engel und dienten ihm.“ In dieser biblischen Erzählung zeigt sich, in welch positive bzw. negative Kontexte die menschliche Sehnsucht geraten kann. Es wird dabei vor allem die Versuchung des Menschen durchbuchstabiert, sich in seinen Maßlosigkeiten auf den Raum der Endlichkeit zu verkürzen. Darin aber wird die Kraft menschlicher Urwünsche in einer diabolisch-teuflischen Weise zersetzt, so dass sein Menschseins verkommt. Die verendlichten Wünsche des Menschen wenden sich schließlich gegen ihn. Von daher widersetzt sich Jesus der teuflischen Versuchung, aus Steinen Brot zu machen. Mit Brot kann der Mensch im Hier und Jetzt leben. Brot steht damit für eine Beheimatung in der Endlichkeit. Brot besitzen heißt: nur auf dieser Welt zu Hause sein. Dagegen setzt Jesus die theologische Kultivierung von Heimat: Das Brot der Endlichkeit macht den Menschen nicht satt. Die eigentliche Heimat des Menschen ist Gott. Dorothee Sölle sagt daher einmal zurecht: „ Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, er stirbt auch den Tod am Brot allein.“ Im zweiten Fall ist ausdrücklich die Versuchung benannt, sich auf Kosten Gottes einen Namen zu machen, Gott zum Vollzugsgehilfen der eigenen Größenphantasien, zuletzt der eigenen Vorstellung von Freiheit zu machen. Die Versuchung zum menschlichen Größenwahn mit Hilfe 43 Gottes, der das Gabesein der Existenz hinter sich gelassen hat. Die Alternative Jesu lautet daher: Der Mensch findet zu seinem Namen gerade in Gott. Er muss in sich nicht selber machen und besorgen, sondern darf ihn sich von Gott schenken lassen. Dies ist die Versuchung der Gegenwart. In der Logik Jesu hat Gott selbst den Namen des Menschen, seine Identität und Würde, bereits in seine Hände eingeschrieben hat (vgl. Jes 43,1: „ Ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein.“). In der dritten Versuchung geht es um das Gegengöttliche weltlicher Macht. Hier sagt sich der Mensch in einer absoluten Weise von Gott los. Letztlich integriert diese Perspektive auf die erste Versuchung: Der Mensch will sich den göttlichen Absolutpol einverleiben in seiner eigenen, ins unendliche gesteigerten Macht. Gerade hier aber strandet er am Ufer einer „ schlechten Unendlichkeit“, die seiner maßlosen Sehnsucht gerade nicht entspricht. Er wird wie ein Fisch auf dem Trocknen, der in immer mehr Zuckungen verfällt, weil er aus dem Meer der Unendlichkeit ans Ufer der Endlichkeit gesprungen ist. Anders gesagt: Wo der Mensch seine Sehnsucht nach Unendlichkeit immer nur mit Endlichem füttern kann, wird er nicht satt, verfällt seine Sehnsucht der Un-Kultur seiner Süchte, die alleine der Logik „ Mehr desselben“ folgen. Die Versuchungsgeschichte Jesu verkennt oder verbietet dabei gerade nicht das Positive der menschlichen Urwünsche. Sie insistiert auf ihrer messianischen – auf Gott bezogenen Qualität. Oder anders: Dass die Welt dem Menschen nicht genug ist. Dies führt zu einer veränderten Kultivierung der menschlichen Urwünsche, auf die ich nun abschließend eingehen will. Ich möchte dabei - in Anlehnung an Paul-Michael Zulehner - die sogenannten evangelischen Räte auf diese Kultur menschlicher Urwünsche hin auslegen. Diese evangelischen Räte bündeln sich in der Trias von: Jungfräulichkeit, Gehorsam, Armut. Als diese sind sie in der Regel den 44 religiösen „ Hochseilakrobaten“ und den theologischen „ Virtuosen “ in der Kirche zugeordnet. Ich bin der Meinung, dass sich darin – es sind ja Räte des Evangeliums für alle - eine erlösende Kultur gelingenden, endlichen Menschseins vor Gott formulieren lässt. Ich möchte dies im Folgenden noch kurz andeuten. Ich optiere dabei für eine christliche Kultur menschlicher Urwünsche. Menschlichkeit muss maßlos sein, soll der Mensch nicht zu einem reinen Bedürfniswesen verkommen. Der Mensch ist nur dort bei sich, wo er immer wieder neu über sich hinaus ist, darum ist der Glaube ein Weg in das menschliche Menschsein, in dem sich die Spannungen und Sehnsüchte des Menschen in Gott ausspannen und beruhigen können. 6. 2. Die evangelischen Räte als Kultur menschlicher Urwünsche im Glauben 6.2.1 Jungfräulichkeit: Kultur der Erwartung - die Existenz in der Hoffnung als Einspruch gegen ein Leben im „ Jetzt“ Der evangelische Rat der „ Jungfräulichkeit“ bezieht sich dabei auf das bekannte Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen (Mt 25,113). Jungfräulichkeit meint im Kontext des Evangeliums nicht einfach eine zölibatäre Existenz. Der Fokus der Jungfräulichkeit liegt im Kontext des Evangeliums in dessen Schlusssatz: „ Seid also wachsam! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.“ Jungfräulichkeit meint hier also vor allem die Fähigkeit der Weitsicht, die aus einem jungfräulichen, reinen Blick erwächst. Es geht in der Jungfräulichkeit um die Weitsicht eines klaren und ungetrübten Sicht des Glaubens auf die Wirklichkeit: „ Selig, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen“ (Mt 5, 8). Also darum, sein Leben nicht einfach nur im Hier und Jetzt 45 festzumachen, sondern darüber hinaus offen zu sein, wach zu bleiben für das Aus-ständige, das Kommende von Gott her. Jungfräulichkeit meint eine Haltung der Erwartung, die darin immer schon über die vorfindliche Gegenwart hinaus ist und gerade so die Gegenwart – in ihrer Vorläufigkeit – ernst nimmt, ohne sie „ überspringen“ zu müssen. Aber in ihr kultiviert sich das Wissen um den Mehrwert des Lebens, der nicht im „ Jetzt – und zwar sofort“ aufgeht. Solche Jungfräulichkeit wird in zwei Lebenshaltungen konkret: Die eine ist die Verweigerung einer bürgerlichen Sattheit, die es sich irgendwie mit dem Leben hier und jetzt genug sein lässt. Es geht um ein Unterwegssein in der Erwartung auf das Je-Mehr. Und die zweite ist eine Kultur des Neuanfangs, der sich eine letzten Depression widersetzt. Dabei kann dieser Neuanfang auch in der Versöhnung mit meinem Leben, wie es konkret geworden oder auch nicht geworden ist, liegen. Wo ich die volle Erfüllung meines kleinen Lebens von und in Gott erwarten darf, werde ich ermächtigt zu meiner Endlichkeit. Wo ich mich in meiner Erwartung auf Gott verlassen darf, kann ich frei werden zu einer Kultur der Ge-lassenheit, zu einem Lebensstil der Losigkeiten. 6.2.2. Kultur des Ge-horsams: Haltung der Hingabe - gegen die Diktatur des Ich Der zweite evangelische Rat wendet sich im Gehorsam vor allem gegen den Zwang zu dominieren wollender Macht. Was heißt dies? Zunächst ist Macht grundsätzlich positiv. Nur wer Macht hat, kann auch etwas machen. Das heißt: Der evangelische Rat wendet sich nicht gegen Macht an sich, sofern sie dem Guten dient. Er wendet sich gegen einen speziellen Umgang mit Macht. Es geht um den autoritären Umgang. Solche Macht hat nur, wer sie braucht und missbrauchen will. Es geht 46 um Macht im Sinne von Überlegenheit und Stärke. Damit kommt diesem evangelischen Rat des Gehorsams eine eminent kriteriologische Funktion für unser gegenwärtiges Menschenbild zu. Gutes - gelingendes - Menschsein wird bei uns in Verbindung gebracht mit Mächtigsein. Und Mächtigsein ist die Macht des Stärkeren, die Macht die sich einer nehmen kann. Unsere gesellschaftliche Unkultur der Macht ist kämpferisch und ausbeuterisch. Sie wendet sich immer gegen die Macht des anderen, der zugleich immer Rivale ist. Ein solches Spiel der Macht ist nicht nur in einem unmittelbaren Visavis von Menschen gegeben. Solche Macht inkarniert sich vor allem auch in Strukturen und Institutionen. Gerade als solche anonymisierte Macht wirkt sie lebenszersetzend auf die Freiheit des Menschen ein. Der evangelische Rat gegen diesen destruktiven Umgang mit Macht ist letztlich Hingabe. Gehorsam meint dabei nun, seine Macht, seine Fähigkeit etwas machen zu können, ins Spiel zu bringen im Gehorsam auf den anderen. Das heißt: Macht als Gehorsam meint eine Praxis des Hinhörens, des Wertschätzens und Anerkennens und eines Sichbestimmen-lassens vom anderen her - und dabei vor allem vom schwächeren Anderen her. Gerade vom anderen Schwächeren her wird die Umkehr unseres gängigen Machtverständnisses auf Gehorsam hin sichtbar. In seinem berühmten Buch „ Die hilflosen Helfer“ hat der Psychotherapeut Wolfgang Schmidbauer schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass viele Menschen gerade aus ihrer eigenen Schwäche heraus in helfende Berufe einsteigen, damit sie es mit noch Schwächeren zu tun bekommen. Sie beziehen ihre Stärke also nicht aus sich selber, sondern vom Schwächeren her. Die Schwächeren sind sozusagen die geheimen Vollzugsgehilfen des eigenen Traums von Macht über andere. Hier wird nun der Unterschied von Macht im Sinne von Gehorsam deutlich: Macht 47 inszeniert sich – und darin ist sie christo-logisch also ein „ Machen“ und Tun in der Autorität des Schwächeren. Der Andere, der Schwache, wird zur Maßgabe meines Tuns. Ihm habe ich zu gehorchen, damit mein Tun ein menschliches Tun wird im Horizont des Anderen. Auch Institutionen sind umkehrbedürftig in Bezug auf solchen Gehorsam dem Schwächeren gegenüber. Das heißt: Es ist grundsätzlich die Frage zu stellen, ob ein Machen im Bereich caritativen Handelns an seiner Primärmotivation orientiert ist, im Dienst des schwachen Menschen zu stehen oder ob sich nicht im Grunde Sekundärmotivationen nach vorne schieben, in denen der Schwache selbst in den Dienst einer bestimmten institutionellen Option genommen wird. Kontext eines solchen gehorsamen Machens ist letztlich die Praxis Jesu. Wo sein Leben im Gehorsam an den Vater verortet ist, wird er frei - wie Karl Rahner gesagt hat - der Rettungsschwimmer Gottes für die Menschen zu werden. Das heißt: Wo ich mich nicht permanent um mich selber sorgen muss, weil ich darauf vertrauen kann, dass sich Gott in einer letzten Weise um mein Leben sorgt, kann ich mein Leben aus der Hand geben, kann ich mein Leben für den anderen hergeben. Von hier aus wird das christliche Menschenbild ein not-wendender Einspruch gegen die Diktatur des Ich, sofern es den Menschen im Hören in eine gemeinsame Würde einsetzt, die sich im Miteinander der Geschwisterlichkeit konkretisiert, die den anderen in seiner Bedürftigkeit wahrnimmt. Ich finde diese Wirklichkeit des Menschseins sehr zutreffend formuliert in dem Wort: „ Der Mensch ist zerbrechlich wie Brot.“ Dieses Wort ist bezogen auf die Praxis des Heiligen Franziskus, der sich in einer buchstäblichen Weise den Ins-Aus-Gesetzten (den Aussätzigen) zugewendet hat. Der Ausgesetzte, das ist der leidende und der 48 zerbrechliche Mensch. Der Ausgesetzte, das ist der, dessen Leben zerkrümelt wie Brot. Aber dieses Wort: „ Der Mensch ist zerbrechlich wie Brot“ hat auch noch eine andere Richtung. Der Mensch kann sich für andere hingeben. Er kann gerade für die Zerbrechlichen wie gutes, wie lebensspendendes Brot sein. Von daher ist das Zerbrechen des Brotes im Grunde die christologische Formel für gelingendes Menschsein: Der Mensch vollzieht sein Wesen in einer gelingenden Weise im Dasein für andere. Er partizipiert darin nach dem existentiellen Verständnis eines Franziskus in der Seinsform Jesu Christi selbst. Er betritt daher den Raum eines Lebens und einer Liebe, die nach dem Zeugnis der Bibel erst Leben ist, Leben mit der Verheißung, stärker zu sein als der Tod. In seinem eigenen Zerbrechlichsein ist ein jeder von uns darauf angewiesen, dass ein anderer ihm das Brot der Menschlichkeit reicht. Franz von Baader hat dies einmal so formuliert: Die Menschen sind Anthropophagen, d.h.: die Menschen sind Menschen-esser. Menschen können nur leben und überleben, indem sie sich gegenseitig zur Nahrung werden. Dies eignet den Mensch seiner substantiellen Weise an. (Franz von Baader: „ Alle Menschen sind im seelischen, guten oder schlimmen Sinn unter sich: Anthropophagen. Werke IV (1853) 223-242). Der Weg in dieses nährende Miteinander ist der Gehorsam dem anderen gegenüber. 6.2.3. Armut – Welt und Leben miteinander teilen Wie sich die christliche Utopie des neuen Menschseins sich auch einer humanisierend auf den Urwunsch des Besitzen-wollens auswirkt, lässt sich noch am evangelischen Rat der Armut zeigen. Wer in seiner Sehnsucht nach „ Leben in Fülle“ (Joh. 10, 10) über den Horizont der 49 Endlichkeit hinausblickt, und den Reichtum des Lebens in Gott fest macht, wird frei vom Zwang, alles haben zu müssen. Letztlich wird er zu einer neuen Kultur des Habens ermächtigt, die nicht alles für sich allein haben muss, sondern sein Haben in den Dienst aller stellen kann. Der eindimensionale, horizontale Mensch wird so der Mensch des Habenmüssens, der das Glück des Lebens mit dem Haben selbst identifiziert: „ mein Haus, mein Auto, meine Frau…“. Dabei macht der Mensch im Sog der Statussymbole die frustrierende Erfahrung, dass sie einsam machen und letzten, tragenden Lebenssinn nicht ermöglichen. Von daher wird es für eine humane Kultivierung des Menschseins im Bereich des Habens notwendig sein, dass Menschen wieder fähig werden, ihr wesentliches Menschsein in einem Füreinander in einer neuen Kultur der Geschwisterlichkeit jenseits von Leisten und Haben zu erlernen. Wo im dreieinigen Gott der Reichtum seines Seins im Zueinander, in der Armut des Sich-Hergebens liegt, wo keiner in Gott etwas für sich behalten will, liegt der Reichtum des Menschseins – als Vorahnung des Himmels – nicht im Habenmüssen, sondern im Miteinander-Teilen des Lebens, im Armwerden zugunsten des Anderen. Armut im Sinne des gemeinsamen Habens, Miteinander jenseits allen Egoismus wäre so die Kultur eines neuen Reichtums, der aus dem Gottesglauben ermöglicht wird, weil Gott selbst seinen Reichtum schon längst mit uns geteilt hat, und arm wurde um des Lebens willen. In Gott wird der Mensch frei, dass es ein Leben jenseits der Dinge gibt. Martin Luther hat einmal gesagt, „ woran dein Herz hängt, dort ist in Wahrheit dein Gott.“ Wo der Mensch die endlichen Dinge vergötzt, wird er eben zum Sklaven seiner Götzen. Sein Habenmüssen begrenzt sein Sein. Viele Menschen spüren heute bereits diese Zwänge und Unfreiheiten. In Amerika macht sich seit längerem eine neue Kultur „ Kultur der Bescheidenheit“ breit. Hier lernen Menschen wieder in einer neuen 50 Weise, dass sie die Dinge so haben sollen, dass nicht die Dinge den Menschen haben und versklaven. Nach dem christlichen Verständnis des Menschen ist eine solche Kultur des Verzichtes, d.h. eine Kultur des gelassenen Haben-könnens (nicht Haben-müssens) im Gottesverhältnis des Menschen begründet. Eine Kultur der „ Losigkeiten“, wo Menschen darauf verzichten können etwas einmal nicht zu haben, wo Menschen auch geduldig ertragen können, Dinge und Lebensziele zu verlieren, ein Handlungsstil der nicht einfach in privatistischer Weise alles für sich haben will, sondern in solidarischer Weise auf ein gemeinsames Besitzen der Güter der Erde offen ist, ist in einer letzten Weise nur dort möglich, wo der Mensch sein Lebensrecht in einer unbedingten Weise in Gott selbst verwurzelt weiß. Das heißt: der Gottesglaube ist der Garant für eine menschliche Kultur solidarischen Menschseins, in der sich der Mensch den neuen Luxus leisten kann, sich nicht mehr alles leisten zu müssen. Dort findet der Mensch wieder Zeit für das Leben, für Muse, echte Begegnung, für Leben, das gerade als geteiltes Leben eine Ahnung vom Leben in Fülle ist. Es zeigt sich also im Blick auf die heilsamen Räte des Evangeliums: Wo im Glauben Gott die utopische Verortung der menschlichen Maßlosigkeiten und Lebensheiligtümer ist (Theologie des ewigen Lebens), wird der Mensch zu einer gläubig-humanen Stilisierung seines Lebens frei gesetzt. Er ist ermächtigt, seine Sehnsucht im Glauben zu bejahen und ernst zu nehmen. Er darf sich darauf einlassen, alle positiven Spuren gelingenden Lebens und gelingenden Miteinanders als eine positive Verheißung auf das je mehr des Menschseins in Gott anzunehmen. Das christliche Bild vom Menschen spricht daher so von ihm, dass er seinen großen Hoffnungen treu bleiben kann, weil Gott der Utopie des Menschseins treu bleibt. Gerade darin wird der Mensch frei, seine 51 Endlichkeit zu bejahen und er wird darin frei zu einer Geschwisterlichkeit, in der er jenseits von Macht und Habenmüssen das Leben mit den anderen teilen kann – als eine Vorahnung vom „ Leben in Fülle.“(Joh 10, 10). So erweist sich das christliche Menschenbild als Real-Utopie erlösten und gelingenden Menschseins. 52