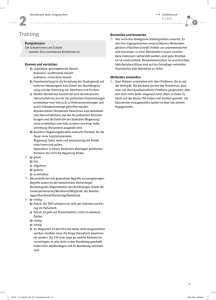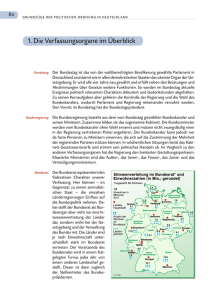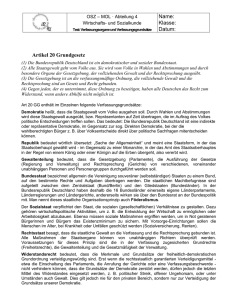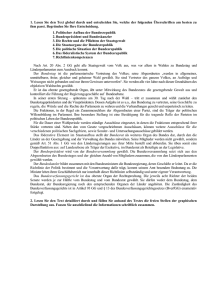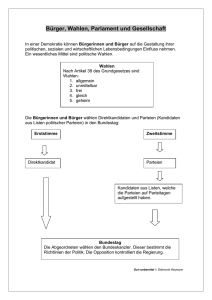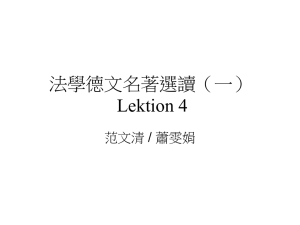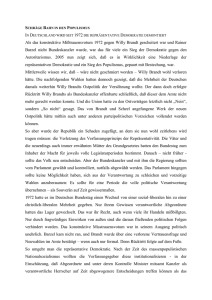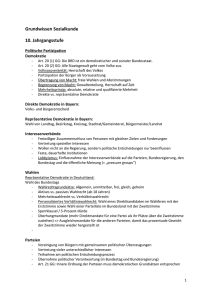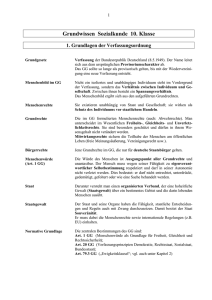Die Theorie geht so: In der repräsentativen Demokratie werden die
Werbung

POPULISTISCHE DEMOKRATIE UNAUFLÖSBARER BUNDESTAG UND ABSCHAFFUNG DES BUNDESRATES WÜRDEN HELFEN Die Theorie geht so: In der repräsentativen Demokratie werden die Herrschenden auf Zeit gewählt. In dieser Zeit haben sie die politischen Entscheidungsbefugnisse, sind an Weisungen und Aufträge nicht gebunden und sollen dem Wohle des Volkes dienen. Ist die Zeit der Herrschaft abgelaufen, sollten sich alle politischen Akteure – Regierung und Opposition – dem Volke zur Wahl stellen, und das soll dann für eine neue Periode bestimmen, wer im Lande herrscht. Die Praxis geht so: In der populistischen Demokratie haben zu Herrschaft Bestimmte nicht die Kraft zum verantwortungsvollen Handeln, wenn sie sich nicht sicher sind, ob das Volk gerade hinter ihnen steht. Dann kürzen sie ihre Zeit ab und wenden sich auf Gedeih und Verderb an die Wähler, um eine Legitimation einzufordern, die ihnen eigentlich aus dem Parlament zufließen sollte. In der Theorie hätte Willy Brandt, der 1969 zum Bundeskanzler gewählt worden ist, bis 1973 regieren und seine Ostpolitik festigen können. Dies um so mehr, als Rainer Barzel es am 27. April 1972 nicht geschafft hatte, Brandt durch das konstruktive Misstrauensvotum im Bundestag aus dem Amte zu drängen. In der Praxis stellte Bundeskanzler Brandt im Bundestag am 20. September 1972 die Vertrauensfrage. Mit einer einkalkulierten Niederlage durch Stimmenthaltung der Kabinettsmitglieder machte er so den Weg frei für Neuwahlen. Die 1972er Bundestagswahl wurde zu einem Plebiszit für Willy Brandt und seine Ostpolitik. In der Theorie war Helmut Kohl 1982 der voll legitimierte Bundeskanzler, nachdem er 1982 anstelle von Helmut Schmidt durch konstruktives Misstrauensvotum vom Bundestag in dieses Amt gewählt worden war. In der Praxis jedoch versetzte Kohl durch eine fingierte Niederlage bei einer seiner Wahl auf dem Fuße folgenden Vertrauensfrage den Bundespräsidenten in die Lage, den Bundestag aufzulösen und Neuwahlen anzuordnen. Widerstrebend folgte das Staatsoberhaupt diesem Verfahren, das auch die um ihre Existenz bangende FDP gar nicht schätzte. Die 1983er Wahl brachte der neuen schwarz-gelben Koalition die Mehrheit (und den Grünen ihren ersten Einzug in den Bundestag!). Diese Mehrheit erst hielt Kohl als Legitimation für ausreichend, um als Regierungschef zu wirken. In der Theorie hätte Gerhard Schröder bis 2006 weiterregieren können, auch wenn ihm zuletzt in Düsseldorf und andernorts die Felle davongeschwommen waren. Im Bundestag 1 hatte er seine aus 2002 stammende Mehrheit, und der Bundesrat – die „Länderkammer“ - hat keine Silbe mitzureden bei der Wahl oder Abwahl des Kanzlers. In der Praxis versetzte die Wahlniederlage seiner SPD Gerhard Schröder Ende Mai 2005 jedoch so in Angst und Schrecken, dass er sich an Brandt und Kohl erinnerte und Neuwahlen nach fingiertem Vertrauensverlust im Bundestag anstrebte. Theoretisch soll der Bundesrat Länderinteressen in die Bundespolitik einbringen, so dass es für eine Bundesregierung keine Katastrophe sein müsste, wenn eine große Mehrheit der Ministerpräsidenten aus der Konkurrenzpartei kommt. Länderinteressen sind Länderinteressen: Bremen will den Hafen sichern, NRW die Steinkohle, Brandenburg braucht Industrie und Rheinland-Pfalz hält viel von der Förderung des Weinanbaus. Ob in den Landeshauptstädten „Rot“ oder „Schwarz“ führt – daran ändert sich nichts. Praktisch aber ist der Bundesrat zum Laufsteg bundespolitisch ambitionierter Ministerpräsidenten geworden, die – um in ihren eigenen Parteien zu imponieren – parteipolitisch ausgerichtet handeln. Das hat Lafontaine so getan gegen die Regierung Kohl, und das tun Koch-Wulf-Müller-Stoiber gegen die Regierung Schröder. In der Theorie muss der Bundespräsident Horst Köhler nicht dem Kanzler folgen, sollte dieser tatsächlich eine Vertrauensfrage im Bundestag verlieren und ihn anschließend um die Auflösung des Bundestages bitten. In der Praxis wird Köhler Schröder folgen, denn nicht nur der Kanzler - auch die CDU, die CSU und die FDP – jene Parteien, die Köhler in der Bundesversammlung gewählt haben, wollen vorgezogene Neuwahlen, denn die Wechselstimmung ist da. In der Theorie ist nicht nur der Kanzler, sondern sind vor allem die Bundestagsabgeordneten 2002 für vier Jahre gewählt worden und haben daher einen Anspruch auf diese Wahlperiode in voller Länge. In der Praxis jedoch werden die Abgeordneten sich höchstens verhalten gegen Neuwahlen wehren, denn die gesamte öffentliche Meinung will Neuwahlen. Da hilft es auch nichts, wenn jetzt manch einer nachrechnet, welch gesellschaftlicher und materieller Verlust ihn durch die verkürzte Wahlperiode erwartet. In der Theorie bereiten sich die politischen Parteien auf Wahlen vor, wenn die Entscheidungen über Wahlen und deren Termin gefallen sind. In der Praxis haben die großen Parteien bereits vorab Kanzler- und die kleinen Spitzenkandidaten. Der ist bei den Grünen „eingebettet“, bei der FDP schon jetzt unbeliebt, und eine sich neu formierende Linke hat zwei davon, die jeweils ihrer verlorenen Zukunft hinterlaufen. 2 In der Theorie kann sich ein Spitzenkandidat erst etablieren, wenn die „Basis“ der normalen Kandidaten steht, denn von denen soll er ja die „Spitze“ sein. Innerparteiliche Demokratie soll eigentlich von unten nach oben gehen. In der Praxis sind die bekannten Spitzenkandidaten nichts als virtuelle Medienerscheinungen, denn sie sind von keiner gesetz- oder satzungskonformen Versammlung nominiert, sondern von jeweiligen Oligarchien ausgerufen worden. Innerparteiliche Demokratie geht eben von oben nach unten. In der Theorie bestimmen die Wähler am Wahltag, wer die Mehrheit im Bundestag haben und regieren soll. Dann soll der Bundespräsident einen Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers vorschlagen, der von mehr als 50 % der Abgeordneten gewählt werden muss, um dem Bundespräsidenten seine Ministerliste zur Ernennung vorschlagen zu können. In der Praxis haben die Umfrageinstitute und die Medien schon entschieden, dass Angela Merkel im Herbst Bundeskanzlerin wird, und Frau Merkel berät bereits mit Herrn Stoiber und Herrn Westerwelle (sicherheitshalber auch mit ihm) darüber, wer in der neuen Regierung welches Amt übernehmen soll. In der Theorie hat Deutschland eine gute, durch die Erfahrungen von Weimar und dem Nationalsozialismus geprägte Verfassung: parlamentarisch und repräsentativ. Nach den ständigen Regierungs- und Parlamentswechseln in Weimar wollte man eine stabile Regierung und ein starkes Parlament. Parlamentsauflösungen sollten die Ausnahme sein. Entscheidungen sollten nach sachkundigem Diskurs der auf Zeit Gewählten getroffen werden: Nach dem plebiszitären Anwandlungen der Nazis misstraute man der direkten Demokratie. Die Macht sollte zugleich gut austariert sein zwischen dem Bund und den Regionen: Dafür wurde der Bundesrat geschaffen als ein Rat der Landesminister, die an der Politikgestaltung verantwortlich mitwirken sollten. In der Praxis hat Deutschland 2005 eine populistische Verfassung: personalisiert und mediatisiert. Die schnell wechselnden Stimmungen des Publikums machen heute jene zu Politikstars, die sie morgen wieder fallen lassen. Joschka Fischer hat das gerade erlebt. Politik wird populistisch betrieben: Wenn eine Reform nicht sofort anschlägt, werden die Politiker ausgewechselt, und die heutige Opposition wird möglicherweise ernten können, was die heutige Regierung gesät hat. Schließlich spielt sich die Herrschaft nicht zwischen den Verfassungsorganen wie Bundestag und –rat ab, sondern sie liegt bei den Oligarchien der Parteien. Wenn die hüben die Mehrheit haben, drüben aber noch nicht, blockieren sie eben, bis im Staate nichts mehr geht und bis ihnen auch drüben die Mehrheit zufällt. 3 Was ist zu tun? Soll man die Theorie der Praxis anpassen? Das hieße, den Politikerberuf nur Medienbegabten zugänglich zu machen, die Mitglieder in den Parteien abzuschaffen und nur die dortigen Managements entscheiden zu lassen, das Land durch Plebiszite zu regieren. Das aber hieße auch, dass sich nichts bewegte und das Land international weiter abfiele. Während andere sich anstrengen würden, sicherte man sich hierzulande mehr und mehr ab, und die Gesellschaft der Egoisten würde das Gemeinwesen zugrunde richten. Besser ist es, an der Theorie einiges zu ändern, damit auch die Praxis sich ändert. Ein Schritt wäre, die vorzeitige Auflösung des Bundestages durch den Bundespräsidenten – jenes von Brandt, Kohl und wahrscheinlich auch Schröder genutzte Schlupfloch aus der rein repräsentativen Demokratie - in der Verfassung zu streichen. Dann würde jeweils nach vier Jahren abgerechnet, nicht später, aber auch nicht früher. Ein anderer Schritt wäre, den Bundesrat abzuschaffen. Es kann kein Gegenparlament geben. Die Ministerpräsidenten der Länder haben ihre Aufgaben in Düsseldorf, München, Dresden, Hannover und Wiesbaden. In Berlin sind andere dran, und denen sollen sie nicht ins Handwerk fuschen. Im Parlamentarischen Rat wurde bei der Diskussion unserer Verfassung erwogen, ob man den Bundesrat oder den Senat nach amerikanischem Vorbild will. Die Zeit ist gekommen, einzugestehen, dass das Unikum Bundesrat – jenes aus Ministern zusammengesetzte Quasiparlament – sich nicht bewährt hat: Er ist ein Vetospieler. An seine Stelle sollte ein vom Volke gewählter Senat mit zwei Senatoren pro Bundesland treten. Er müsste von demjenigen geleitet werden, der die Richtlinien der Politik bestimmt: dem Bundeskanzler. Bei Stimmengleich sollte er entscheiden. Die Unauflösbarkeit des Bundestages vor Ende der Wahlperiode und damit seine Stärkung, verbunden mit der Abschaffung des Bundesrates und einer weiteren Aufwertung des Bundeskanzlers: Diese Reform würde Deutschland helfen. So würde der Verfassungsanspruch sich prägend auf die Verfassungswirklichkeit auswirken. Die Praxis würde wieder der Theorie folgen – zum Wohle des Ganzen. Jürgen Dittberner (Der Autor ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Potsdam. 8.6.05) 4