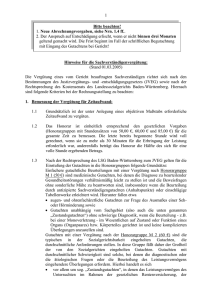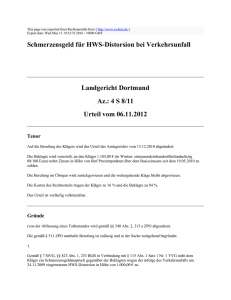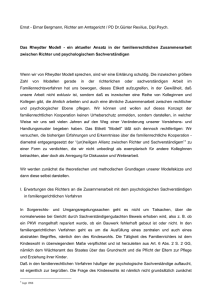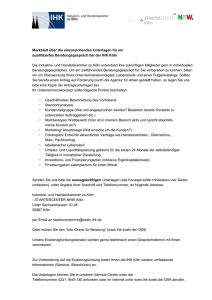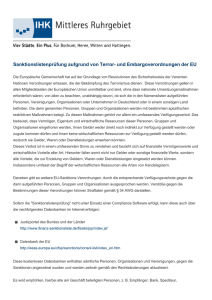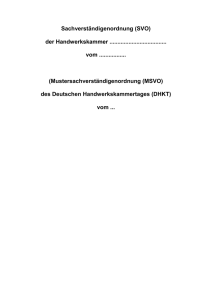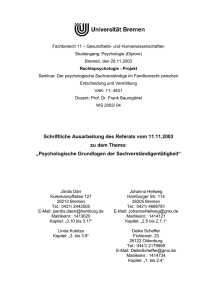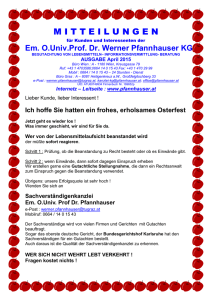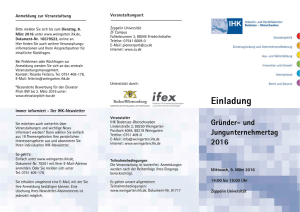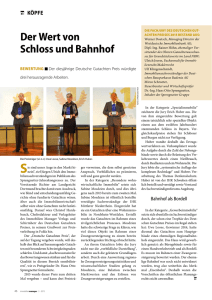Die Richtlinien zur Mustersachverständigenordnung
Werbung

Die Richtlinien zur Mustersachverständigenordnung §1 Bestellungsgrundlage 1.1 Rechtsgrundlage 1.1.1 Materiell-rechtliche Grundlage für die öffentliche Bestellung ist § 36 GewO. Die Industrie- und Handelskammern sind nach § 36 Abs. 4 GewO befugt, Sachverständigenordnungen zu erlassen, soweit die Landesregierungen von ihrer Befugnis, Durchführungsvorschriften zu erlassen, keinen Gebrauch gemacht haben (§ 36 Abs. 3 GewO). Die Sachverständigenordnungen sind Satzungen der zuständigen Industrieund Handelskammern. Den zulässigen Inhalt der Satzung regelt § 36 Abs. 3 GewO. 1.1.2 Auf die öffentliche Bestellung besteht ein Anspruch, wenn die Bestellungsvoraussetzungen (§ 3 MSVO) erfüllt werden. 1.1.3 Die öffentliche Bestellung kann nur auf Antrag erfolgen. 1.2 Zuständigkeit 1.2.1 Die Industrie- und Handelskammern sind sachlich für die öffentliche Bestellung von Sachverständigen auf allen wirtschaftlichen und technischen Sachgebieten zuständig mit Ausnahme der Hochsee- und Küstenfischerei, der Land und Forstwirtschaft, des Garten- und Weinbaus. Für einige Sachgebiete gibt es darüber hinaus in den Bundesländern unterschiedliche sachliche Zuständigkeiten von Bestellungskörperschaften und Behörden. Soweit sonstige Vorschriften des Bundes oder der Länder über die öffentliche Bestellung oder Vereidigung von Personen bestehen, findet § 36 GewO keine Anwendung (vgl. § 36 Abs. 5 GewO). 1.2.2 Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach der beruflichen oder gewerblichen (Haupt-) Niederlassung als Sachverständiger (vgl. 17.1). 1.3 Sachgebiete 1.3.1 Die öffentliche Bestellung kann nur für ein bestimmtes Sachgebiet erfolgen. „Bestimmt" bedeutet, dass das Sachgebiet, für das der Sachverständige bestellt werden soll, möglichst genau zu beschreiben und abzugrenzen ist. Die Industrie- und Handelskammern haben bei der Auswahl und Abgrenzung der Sachgebiete einen weiten Ermessensspielraum, der die Bedürfnisse der Praxis, insbesondere die Nachfrage nach bestimmten Sachgebieten berücksichtigt (vgl. 3.1 und 3.2). Sachgebiete, die vom Publikum nicht oder nur selten nachgefragt werden, sind nicht bestellungsfähig. 1.3.2 Das einzelne Sachgebiet sollte möglichst eng gefasst werden. In bestimmten Bereichen (z. B. Bauschäden) kann es jedoch zur Vermeidung von Kosten und der Einschaltung einer Vielzahl von Sachverständigen erforderlich sein, auch Sachverständige für ein breitgefächertes Sachgebiet zu bestellen (vgl. 3.1). 1.3.3 Die vom Arbeitskreis „Sachverständigenwesen" beim DIHK erarbeiteten Sachgebietseinteilungen sind im Interesse einer bundeseinheitlichen Bestellungspraxis anzuwenden (vgl. 3.1). 1.4 Bestellungsfähiger Personenkreis 1.4.1 Die Industrie- und Handelskammern können sowohl Gewerbetreibende als auch Freiberufler, sowohl Selbständige als auch Angestellte öffentlich bestellen und vereidigen, sofern im Einzelfall die Voraussetzungen für die öffentliche Bestellung gegeben sind (vgl. § 3 MSVO). 1.4.2 Es können nur natürliche Personen, nicht aber Personengesellschaften oder juristische Personen öffentlich bestellt werden. §2 Öffentliche Bestellung 2.1 Rechtsnatur und Zweck 2.1.1 Die öffentliche Bestellung ist keine Berufszulassung, sondern die Zuerkennung einer besonderen Qualifikation, die der Aussage des Sachverständigen einen erhöhten Wert verleiht. Durch die öffentliche Bestellung erhält der Sachverständige keine hoheitlichen Befugnisse. Die öffentliche Bestellung dient ausschließlich dem Zweck, Gerichten, Behörden und privaten Auftraggebern Sachverständige zur Verfügung zu stellen, die persönlich integer sind und eine fachlich richtige sowie unparteiische und glaubhafte Sachverständigenleistung gewährleisten. 2.1.2 Die öffentliche Bestellung ist darüber hinaus ein Hilfsmittel bei der Suche nach Sachverständigen, die durch eine öffentlich-rechtliche Einrichtung wie die Industrie- und Handelskammer persönlich und fachlich überprüft worden sind und überwacht werden. Die von öffentlich bestellten Sachverständigen erbrachten Leistungen genießen aus diesem Grund besonderes Vertrauen. 2.2 Umfang der öffentlichen Bestellung 2.2.1 Die Aufgaben eines Sachverständigen können sowohl die Erstattung von Gutachten als auch weitere Sachverständigentätigkeiten sein, wie Beratungen, Überwachungen, Überprüfungen, Erteilung von Bescheini- gungen sowie schiedsgutachterliche und schiedsgerichtliche Tätigkeiten. 2.2.2 Die Aufzählung ist nicht abschließend, wie sich aus § 36 GewO ergibt. 2.3 Beschränkungen, Befristungen, Auflagen 2.3.1 Beschränkung Inhaltliche Beschränkung bedeutet, dass der Sachverständige z. B. bestimmte Tätigkeiten nicht ausüben oder in bestimmten Regionen oder für bestimmte Auftraggeber nicht als Sachverständiger tätig sein darf, weil sonst seine Objektivität und Glaubwürdigkeit nicht gewährleistet wären. 2.3.2 Befristung Die öffentliche Bestellung wird jeweils auf 5 Jahre befristet. Dies gilt nicht für Sachverständige, die aufgrund einer früheren MSVO unbefristet bestellt wurden (§ 26 Abs. 1 S. 2 MSVO). Läuft die auf der Grundlage einer bisherigen MSVO erfolgte Bestellung mit kürzerer oder längerer Befristung aus, gilt für die Verlängerung der öffentlichen Bestellung die neue fünfjährige Befristung. Bei einer Erstbestellung kann die Frist von 5 Jahren unterschritten werden. Mit Ablauf der Frist erlischt die Bestellung. Der Sachverständige kann jedoch vor Ablauf der Frist einen Verlängerungsantrag stellen. Die IHK muss dann erneut prüfen, ob sämtliche Bestellungsvoraussetzungen, insbesondere die besondere Sachkunde und die persönliche Eignung, vorliegen (vgl. 4.4). 2.3.3 Auflagen Die öffentliche Bestellung kann jederzeit mit Auflagen verbunden werden (§ 2 Abs. 3 MSVO). Beispiele: • Einem Angestellten einer Behörde oder eines privaten Arbeitgebers kann die Auflage erteilt werden, am Beginn jedes Gutachtens das Arbeits- bzw. Dienstverhältnis offen zu legen (vgl. § 3 Abs. 3 MSVO). • Einem Sachverständigen kann die Auflage erteilt werden, an Fortbildungsveranstaltungen oder an einem Erfahrungsaustausch teilzunehmen (vgl. § 16 MSVO). Auflagen können im Zusammenhang mit Aufsichtsverfahren gegen öffentlich bestellte Sachverständige von Bedeutung sein, wenn sie unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes als milderes Mittel gegenüber dem Widerruf der öffentlichen Bestellung in Betracht kommen (vgl. 23.3.3). Kommt der Sachverständige solchen Auflagen nicht nach, kann seine Bestellung widerrufen werden (vgl. 23.3). 2.4. Bestellungsakt 2.4.1. Der Sachverständige wird in der Weise öffentlich bestellt und vereidigt, dass ihm die Bestellungsurkunde ausgehändigt und ihm erklärt wird, • er sei als Sachverständiger für das in der Bestellungsurkunde genannte Sachgebiet nach Maßgabe der Vorschriften der Sachverständigenordnung öffentlich bestellt, • er müsse von nun an die darin zum Ausdruck kommenden Pflichten einhalten Daraufhin ist er gemäß § 5 MSVO zu vereidigen. Mit der öffentlichen Bestellung ist die Verpflichtung des Sachverständigen verbunden, den Eid bzw. die Bekräftigung nach § 5 MSVO zu leisten. 2.4.2 Öffentliche Bestellung und Vereidigung bilden einen einheitlichen Vorgang und haben in rechtlicher Hinsicht dieselbe Funktion, nämlich das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Glaubwürdigkeit und Objektivität des Sachverständigen zu begründen und zu bekräftigen. 2.4.3 Anlässlich seiner öffentlichen Bestellung ist der Sachverständige außerdem nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Verpflichtungsgesetzes vom 2.3.1974 (BGBI l Seite 469/547) auf die gewissenhafte Einhaltung seiner Obliegenheiten zu verpflichten und auf die strafrechtlichen Folgen einer Verletzung dieser Pflichten hinzuweisen. 2.5 Rechtsfolgen der Bestellung 2.5.1 Durch die öffentliche Bestellung entsteht ein besonderes öffentlichrechtliches Rechtsverhältnis. Der Sachverständige muss von nun an seine Sachverständigentätigkeiten auf dem Bestellungsgebiet als von der Industrie- und Handelskammer öffentlich bestellter Sachverständiger erbringen. Der Sachverständige unterliegt der Aufsicht der Industrie- und Handelskammer, die die Einhaltung der Pflichten des Sachverständigen aus der Sachverständigenordnung überwacht und bei Pflichtverstößen Auflagen erteilen oder die öffentliche Bestellung widerrufen kann. 2.5.2 Durch die Aushändigung der Sachverständigenordnung und der Richtlinien erhält der Sachverständige einen Überblick über sämtliche ihm obliegenden Rechte und Pflichten (vgl. 6.4). 2.5.3 Der Gesetzgeber hat folgende Sonderbestimmungen für die öffentlich bestellten Sachverständigen erlassen: • Sie sind in Zivil- und Strafverfahren bevorzugt zur Gutachtenerstattung heranzuziehen (vgl. §§ 404 Abs. 2 ZPO, 73 Abs. 2 StPO). • Sie sind grundsätzlich verpflichtet, die von ihnen verlangten Gutachten zu erstatten (z. B. §§ 407 Abs. 1 ZPO, 75 Abs. 1 StPO). • Sie unterliegen einer mit Strafe bewehrten Schweigepflicht (vgl. § 203 Abs. 2 Nr. 5 StGB). • Sie haben in einigen Sachbereichen besondere Prüfzuständigkeiten und in einigen Rechtsbereichen (z. B. § 558 a Abs. 2 Nr.3 BGB) besondere Gutachtenzuständigkeiten. • Ihre Bezeichnung „öffentlich bestellter Sachverständiger" ist durch § 132 a StGB gesetzlich geschützt. • Sie haben zunehmend eine Prüfung von Sachverhalten mit anschließender Ausstellung einer positiven oder negativen Bescheinigung vorzunehmen (z. B. § 641 a BGB). 2.6 Überregionale Geltung 2.6.1 Die Tätigkeit des öffentlich bestellten Sachverständigen ist nicht auf den Bezirk der Industrie- und Handelskammer beschränkt, von der er öffentlich bestellt worden ist, sondern er kann im gesamten Bundesgebiet sowohl für Gerichte, Behörden als auch private Auftraggeber tätig werden. 2.6.2 Der Sachverständige darf sich auch im Ausland als öffentlich bestellter Sachverständiger bezeichnen, wenn dies dort erlaubt ist und er die Vorschriften der Sachverständigenordnung einhält. §3 Bestellungsvoraussetzungen 3.1. Das abstrakte Bedürfnis 3.1.1. Eine öffentliche Bestellung ist nur möglich, wenn das abstrakte Bedürfnis für das beantragte Sachgebiet gegeben ist. 3.1.2. Das abstrakte Bedürfnis liegt vor, wenn eine häufige, nachhaltige oder verbreitete, nicht unbedeutende oder nur gelegentliche Nachfrage nach Sachverständigenleistungen auf dem beantragten Sachgebiet besteht. 3.1.3. Ein wichtiges Indiz für das Vorliegen des abstrakten Bedürfnisses ist gegeben, wenn der Antragsteller eine größere Anzahl bereits gefertigter Gutachten vorlegen kann. Das abstrakte Bedürfnis ist auch dann gegeben, wenn es sich um Sachgebiete handelt, für die z.B. fachliche Bestellungsvoraussetzungen vorliegen oder eine größere Anzahl von öffentlichen Bestellungen bei anderen IHKs gegeben ist. Es empfiehlt sich eine Recherche im GfI-Verzeichnis oder den Sachverständigenverzeichnissen der IHKs. 3.1.4. Bei Sachgebieten, für die bisher keine öffentlichen Bestellungen vorliegen oder festgestellt werden können, ist das abstrakte Bedürfnis zu prüfen. Dabei sollte zunächst geklärt werden, ob das beantragte Sachgebiet ein Teilbereich eines bereits bestellfähigen Sachgebietes ist oder ein völlig neues Sachgebiet (vgl. auch 3.2.2). Im ersten Fall sollte unter Beteiligung von Fachleuten (z.B. öffentlich bestellen Sachverständigen, Fachausschüssen) abgeklärt werden, ob das Teilsachgebiet wirklich als eigenständiges neues Bestellungsgebiet sinnvoll ist. Im zweiten Fall sollte durch Umfrage über den DIHK bei allen IHKs, ggf. auch einschlägigen Verbänden, anderen sachkundigen Stellen oder auch auf verwandten Sachgebieten öffentlich bestellten Sachverständigen ggf. auch Gerichten überprüft werden, ob eine ausreichende Nachfrage nach Sachverständigenleistungen auf diesem Sachgebiet besteht. Wegen der präjudizierenden Wirkung von öffentlichen Bestellungen auf neuen Sachgebieten gegenüber anderen IHKs sollte davon abgesehen werden, ohne eingehende Überprüfung und Beteiligung des DIHK bzw. des Arbeitskreises Sachverständigenwesen öffentliche Bestellungen auf bisher nicht bestellfähigen Sachgebieten vorzunehmen. 3.1.5 Die konkrete Bedürfnisprüfung ist wegen des Rechtsanspruches auf öffentliche Bestellung und Vereidigung unzulässig. Konkrete Bedürfnisprüfung bedeutet, die öffentliche Bestellung davon abhängig zu machen, ob auf einem bestimmten Sachgebiet bereits eine ausreichende Zahl von Sachverständigen vorhanden ist. 3.2. Bestimmung der Sachgebiete 3.2.1. Die IHK bestimmt den Sachgebietstenor auf der Grundlage des gestellten Antrags. Dabei soll sie sich an die vom Arbeitskreis verabschiedete Übersicht der Sachgebiete halten. Dies ist erforderlich, um die Verständlichkeit und Vergleichbarkeit der Sachgebiete der einzelnen Sachverständigen für die Öffentlichkeit zu gewährleisten. Die einheitliche Tenorierung ist auch Grundlage für die Aufstellung von fachlichen Bestellungsvoraussetzungen, die der Prüfung der besonderen Sachkunde zugrunde gelegt werden (vgl. 3.7.2). 3.2.2. Im Interesse der Einheitlichkeit sollen weitere Sachgebietsbezeichnungen mit dem DIHK abgestimmt werden. Teilgebiete von definierten Sachgebieten sind nur ausnahmsweise bestellungsfähig. Dabei darf weder das abstrakte Bedürfnis entfallen noch die Verständlichkeit für potentielle Auftraggeber leiden. 3.3. Maßgeblicher Sitz 3.3.1. Über den Antrag auf öffentliche Bestellung kann nur dann entschieden werden, wenn der Bewerber seine berufliche (Haupt-) Niederlassung (vgl. 17.1) im IHK-Bezirk hat. 3.3.2. Der Bewerber hat mit dem Antrag eine Erklärung darüber abzugeben, ob und ggf. wann und wo er bereits früher einen Antrag auf öffentliche Bestellung als Sachverständiger gestellt hat. 3.4. Altersgrenzen 3.4.1. Von den in § 3 Abs. 2 Buchst b MSVO festgelegten Altersgrenzen kann nicht abgewichen werden; sie sind zwingender Natur. 3.4.2. Für die Einhaltung der Altershöchstgrenze kommt es auf die Einreichung des vollständigen Antrages bei der IHK an. Die Vollständigkeit richtet sich nach dem Antragsformular der IHK. Andererseits reicht ein lediglich „fristwahrend“ gestellter Antrag nicht aus. Fehlen im Antragsformular aufgeführte Unterlagen, liegt kein vollständiger Antrag vor. Werden jedoch im Verfahren weitere oder neue Gutachten nachgefordert, berührt dies die Rechtzeitigkeit des Antrages nicht. 3.5. Persönliche Eignung 3.5.1. Persönliche Eignung liegt nur dann vor, wenn der Sachverständige die Gewähr für Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Glaubwürdigkeit und für die Einhaltung der Pflichten eines öffentlich bestellten Sachverständigen bei der Gutachtenerstellung oder Erbringung der sonstigen Sachverständigenleistungen bietet. Begründete Zweifel am Vorliegen dieser Eigenschaften rechtfertigen bereits die Ablehnung der öffentlichen Bestellung. 3.5.2. Folgende Voraussetzungen sind in diesem Zusammenhang insbesondere zu prüfen: Der Sachverständige muss bei der Gutachtenerstattung oder der Erbringung sonstiger Sachverständigenleistungen persönlich und beruflich unabhängig sein. Er muss seine Gutachten in eigener Verantwortung erstatten können und darf nicht der Gefahr einseitiger Beeinflussung oder fachlicher Weisung bei der Erstattung seiner Gutachten beziehungsweise der Erbringung seiner Sachverständigenleistungen ausgesetzt sein (vgl. § 8 Abs. 1, 2 MSVO). Der Sachverständige muss in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Das bedeutet insbesondere, dass der Sachverständige keine eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO für sich oder einen Dritten abgegeben haben darf und weder persönlich noch für einen Dritten im Schuldnerverzeichnis nach § 915 ZPO eingetragen sein darf. Dies bedeutet weiter, dass über das Vermögen des Sachverständigen kein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet oder mangels Masse abgelehnt sein darf. Dies bedeutet schließlich, dass über das Vermögen einer Handelsgesellschaft, dessen Geschäftsführer oder Gesellschafter er ist, nicht das Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt sein darf. Eine Bestellung kann in solchen Fällen nur dann ausnahmsweise in Betracht kommen, wenn ausgeschlossen ist, dass das Ansehen des Sachverständigen in der Öffentlichkeit Schaden genommen hat und die Gefahr der Erstattung von Gefälligkeitsgutachten nicht besteht. Der Sachverständige muss zuverlässig sein. Es darf deshalb über ihn keine einschlägige Eintragung im Bundeszentralregister oder Gewerbezentralregister vorliegen. Der Sachverständige muss in der Lage sein, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Gutachten auftretenden physischen und psychischen Belastungen auszuhalten. 3.6. Arbeits- oder Dienstverhältnis 3.6.1. Sachverständige, die in einem Arbeits-, Dienst- oder Beamtenverhältnis stehen, können öffentlich bestellt werden, wenn der Arbeits- bzw. Anstellungsvertrag so ausgestaltet ist, dass die Gewähr für Unparteilichkeit und Unabhängigkeit gegeben und die Einhaltung der sonstigen Pflichten eines öffentlich bestellten Sachverständigen gewährleistet ist, die Sachverständigentätigkeit persönlich ausgeübt werden kann, der Sachverständige bei seiner Tätigkeit im Einzelfall keinen fachlichen Weisungen unterliegt, er seine Leistungen gemäß § 12 als von ihm selbst erstellt kennzeichnen kann und der Arbeitgeber ihn in dem erforderlichen Umfang freistellt. 3.6.2. Der Nachweis ist durch eine entsprechende schriftliche Erklärung des Arbeitgebers oder Dienstherrn zu erbringen. In Zweifelsfällen kann die IHK die Vorlage des Arbeits- oder Dienstvertrages oder dessen einschlägiger Teile verlangen. 3.6.3. Die Freistellungserklärung muss mindestens folgenden Inhalt haben: „Herr/Frau ... ist befugt, als öffentlich bestellte(r) Sachverständige(r) auf dem Sachgebiet....... tätig zu werden und wird hierfür in dem erforderlichen Umfang freigestellt (Begrenzung auf eine bestimmte Zeitspanne ist zulässig). Ich/Wir bestätige(n) als Arbeitgeber/Dienstherr, dass Herr/Frau die Tätigkeit als öffentlich bestellte(r) Sachverständiger) unter Einhaltung der Pflichten aus der Sachverständigenordnung der IHK ...... also insbesondere unabhängig, frei von fachlichen Weisungen und persönlich ausüben kann. Er/Sie kann schriftliche Leistungen selbst unterschreiben und mit dem Sachverständigenrundstempel versehen. Der Widerruf dieser Freistellung kann nur gegenüber der IHK erklärt werden." Soweit die Freistellung nicht unmittelbar gegenüber der IHK widerrufen wird, ist der Sachverständige verpflichtet, die IHK über den Widerruf unverzüglich zu unterrichten. 3.7. Besondere Sachkunde und fachliche Bestellungsvoraussetzungen 3.7.1. Der Sachverständige muss auf dem Sachgebiet, für das er öffentlich bestellt werden möchte, überdurchschnittliche Fachkenntnisse, praktische Erfahrung und die Fähigkeit, sowohl Gutachten zu erstatten als auch die in § 2 Abs. 2 genannten Leistungen zu erbringen, nachweisen. 3.7.2. Maßgebend für die Überprüfung dieser Kriterien sind der berufliche Werdegang, die fachlichen Prüfungsabschlüsse und die durch langjährige Berufspraxis erworbenen Erfahrungen. Die Überprüfung erfolgt soweit vorhanden - anhand von besonderen fachlichen Bestellungsvoraussetzungen, die für das jeweilige Sachgebiet bundeseinheitlich durch den Arbeitskreis beschlossen werden. 3.7.3. Der Nachweis der besonderen Sachkunde ist durch den Sachverständigen zu führen. Er ist nicht schon dadurch erbracht, dass er seinen Beruf in fachlicher Hinsicht bisher ordnungsgemäß ausgeübt und/oder einen einschlägigen Studienabschluss erworben hat. Schriftliche Unterlagen allein reichen zum Nachweis der besonderen Sachkunde in aller Regel nicht aus (vgl. 4.3). 3.7.4. Zum Inhalt der besonderen Sachkunde gehört weiter, dass der Sachverständige in der Lage ist, auch schwierige fachliche Zusammenhänge mündlich oder schriftlich so darzustellen, dass seine gutachterlichen Äußerungen für den jeweiligen Auftraggeber, der in aller Regel Laie sein wird, verständlich sind. Hierzu gehört auch, dass die vom Sachverständigen dargestellten Ergebnisse so begründet werden müssen, dass sie für einen Laien verständlich und nachvollziehbar und für einen Fachmann in allen Einzelheiten nachprüfbar sind (vgl. 11.1, 11.6). 3.8. Technische Einrichtungen Der Sachverständige muss über die zur Ausübung seiner Sachverständigentätigkeit erforderlichen Einrichtungen verfügen. Dies bedeutet nicht, dass er alle technischen Einrichtungen selbst zu Eigentum erwerben muss; es reicht vielmehr aus, dass ihm die erforderlichen Einrichtungen in einer Weise zur Verfügung stehen, dass der Zugriff, soweit erforderlich, jederzeit möglich ist und seine Unabhängigkeit und Unparteilichkeit nicht gefährdet werden. 3.9. Verlegung der Hauptniederlassung in einen anderen IHK-Bezirk 3.9.1. Die Regelung in § 3 Abs. 4 dient dazu, im Regelfall einen fließenden Übergang in der Zuständigkeit von der einen auf die andere IHK zu gewährleisten. Da die Rechtsgrundlagen der öffentlichen Bestellung bundesweit einheitlich bestimmt sind, kann der Verwaltungsaufwand im Interesse des Sachverständigen und der IHK auf das unabdingbar Notwendige reduziert werden. Eine erneute Überprüfung der persönlichen Eignung und der besonderen Sachkunde kommt nur ausnahmsweise in Betracht, etwa wenn zeitgleich mit dem Niederlassungswechsel des Sachverständigen massive Beschwerden eingehen oder andere Gründe auftauchen, die Anlass zu einer Überprüfung geben. Oder es könnte ein laufendes Verfahren fortzusetzen sein. Die Beurteilungsparameter, die die neu zuständige IHK anlegt, sind denen in einem Widerrufsverfahren unmittelbar vergleichbar. Daraus folgt, dass diese Überprüfung nicht aus Anlass des Niederlassungswechsels, sondern nur deshalb erfolgt, weil die neuen Tatsachen zufällig im Zeitraum des Niederlassungswechsels auftauchen. Der Sachverständige soll in einer solchen Situation durch den Niederlassungswechsel weder besser noch schlechter gestellt werden 3.9.2. Verlegt ein Sachverständiger, dessen öffentliche Bestellung unbefristet ist, seine Niederlassung in den Bezirk einer anderen IHK, so wird sie dort nach den Maßgaben der geltenden Sachverständigenordnung befristet werden, da die unbefristete Bestellung mit dem Niederlassungswechsel erlischt (§ 22 Abs. 1b MSVO); die Übergangsvorschrift in § 26 MSVO gilt insoweit nicht. §4 Verfahren 4.1. Entscheidungsfindung Über den Antrag auf öffentliche Bestellung entscheidet die örtlich zuständige IHK (vgl. 1.2.2 und 3.3.1). Sie ist verpflichtet, sich zum Vorliegen der Bestellungsvoraussetzungen, insbesondere zur persönlichen Eignung und besonderen Sachkunde, eine eigene Überzeugung zu bilden, wobei Zweifel am Vorliegen der Bestellungsvoraussetzungen zu Lasten des Bewerbers gehen. Die Überzeugungsbildung beruht auf den vom Bewerber vorgelegten Nachweisen und Unterlagen sowie eigenen Ermittlungen der IHK. 4.2. Anhörung Vor der Entscheidung müssen die Ausschüsse und Gremien zu dem Antrag gehört werden, die nach der SVO der zuständigen IHK zu beteiligen sind. Die IHK ist an deren Stellungnahme nicht gebunden. 4.3. Vorgehen bei der Überprüfung Zur Überprüfung der besonderen Sachkunde werden in der Regel Informationen, insbesondere Referenzen von früheren Auftraggebern, Kollegen oder sonstigen Bekannten des Sachverständigen eingeholt und bereits erstattete Gutachten und sonst vorgelegte fachliche Unterlagen (z. B. eine bereits erfolgte Zertifizierung) überprüft. Für die Berücksichtigung von Zertifizierungen durch eine Zertifizierungsstelle, die im Rahmen des Deutschen Akkreditierungsrats (DAR) für die Personenzertifizierung entsprechend DIN EN 45.013 von der Trägergemeinschaft für Akkreditierung (TGA) akkreditiert wurde, wird auf die dazu geltenden Grundsätze (DIHK-Rundschreiben vom 04. Juli 2000 - einschließlich des Fragebogens an die Zertifizierungsstelle) verwiesen (siehe Anlage zu den Richtlinien). Da die IHK Gewissheit haben muss, ob der Bewerber über die besondere Sachkunde verfügt, kann sie authentische Nachweise des Bewerbers verlangen. Der Sachverständige hat die Zustimmung des Auftraggebers zur Verwendung der Gutachten im Bestellungsverfahren einzuholen. Erteilt der Auftraggeber die Zustimmung nicht, kann der Sachverständige das Gutachten auch in anonymisierter Form vorlegen, soweit dadurch die Nachprüfbarkeit nicht beeinträchtigt wird. Der Bewer- ber hat in aller Regel seine besondere Sachkunde, die insbesondere die Fähigkeit beinhaltet, auch schwierige fachliche Problemstellungen schriftlich und mündlich in verständlicher und nachvollziehbarer Weise darzustellen, vor einem einschlägigen Fachgremium unter Beweis zu stellen. Besteht für das in Frage kommende Sachgebiet kein festinstalliertes Fachgremium, soll der Bewerber seine besondere Sachkunde vor einem „ad-hoc-Fachgremium" oder einer neutralen sachkundigen Person nachweisen. Bei einer solchen Überprüfung, die rechtlich eine Begutachtung der besonderen Sachkunde ist, sollte immer ein Vertreter der für den Bewerber örtlich zuständigen IHK anwesend sein. Der DIHK leistet bei der Suche nach solchen Fachgremien und Personen Hilfestellung. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Veröffentlichungen des IfS zu den fachlichen Bestellungsvoraussetzungen und die darin enthaltene Zusammenstellung aller Fachgremien der IHKs im Bundesgebiet hingewiesen. 4.4. Wiederbestellung Der öffentlich bestellte Sachverständige unterliegt einer regelmäßigen Überwachung durch die bestellende IHK. Bei der Wiederbestellung i.S. von § 2 Abs. 4 MSVO kann die IHK deshalb einen Nachweis fordern, dass der Sachverständige weiterhin über die notwendige Qualifikation verfügt. Dazu kann stichprobenweise die Vorlage von Gutachten und/oder der Nachweis verlangt werden, dass sich der Sachverständige in der erforderlichen Weise weitergebildet hat. Sind die Voraussetzungen für die Wiederbestellung gegeben, besteht ein Anspruch auf Verlängerung. Der Sachverständige wird dann für fünf Jahre wiederbestellt, es sei denn, er hat bei der Wiederbestellung bereits das 63. Lebensjahr überschritten. In diesem Fall erfolgt die Wiederbestellung wegen § 22 Abs. 1 Buchstabe d) nur für den bis zur Vollendung des 68. Lebensjahres verbleibenden Zeitraum. §5 Vereidigung 5.1. Der Eid Der Sachverständigeneid ist die ernsthafte und feierliche Versicherung des Sachverständigen, nach der eigenen Überzeugung, unparteiisch und gewissenhaft Gutachten zu erstatten und Sachverständigenleistungen zu erbringen. Gleichzeitig verspricht er damit, die Pflichten nach der Sachverständigenordnung einzuhalten. 5.2. Erstreckung auf die Prozessordnungen Die Vereidigung im Rahmen der öffentlichen Bestellung ist eine allgemeine Vereidigung im Sinne der Strafprozess- und Zivilprozessordnung sowie anderer Prozessordnungen. 5.3. Rechtsfolgen einer Eidesverletzung 5.3.1. Verstößt der Sachverständige gegen die durch den Eid besonders bekräftigten Pflichten nach der Sachverständigenordnung, kann seine öffentliche Bestellung widerrufen werden. Durch den Widerruf der Bestellung wird der Eid gegenstandslos; es bedarf daher keiner besonderen Rücknahme des Eides. Ein Sachverständiger darf sich nach dem Widerruf der Bestellung nicht mehr als „vereidigter Sachverständiger" oder „ehemals öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger" o.ä. bezeichnen (vgl. 22.6). 5.3.2. Bezieht sich der Sachverständige im Rahmen eines Zivil- oder Strafprozesses ausdrücklich auf den geleisteten Eid, treffen ihn die strafrechtlichen Folgen, die sich aus den §§ 154 ff. StGB ergeben, wenn er eine falsche Aussage machen würde. Die Bezugnahme auf den Eid kann in einem Zivilprozess auch durch schriftliche Erklärung erfolgen. 5.3.4. Wird der Sachverständige in einem Gerichtsverfahren vereidigt oder bezieht er sich in einer entsprechenden Formel unter dem Gutachten auf den vor der IHK geleisteten Eid und leistet er dabei einen Falscheid, entstehen insoweit besondere Schadensersatzpflichten (vgl. 14.11). §6 Aushändigung von Bestellungsurkunde, Rundstempel, Ausweis und Sachverständigenordnung 6.1 Bestellungsurkunde, Ausweis und Rundstempel haben den Zweck, jedem potentiellen Nachfrager dokumentieren zu können, dass der Sachverständige öffentlich bestellt und vereidigt und wer die zuständige Bestellungsbehörde ist. 6.2 Bestellungsurkunde, Ausweis und Rundstempel bleiben Eigentum der IHK, so dass sie nach Rechtskraft eines Widerrufs oder einer Rücknahme (§ 23 MSVO) oder nach Eintritt eines Erlöschensgrundes (§ 22 MSVO) auf Grund des Eigentumsrechts der IHK wieder zurückzugeben sind. Ein öffentlich-rechtlicher Rückgabeanspruch ergibt sich daneben aus § 24 MSVO. 6.3 Die Bestimmungen der Sachverständigenordnung gelten als Satzungsrecht für jeden öffentlich bestellten Sachverständigen (vgl. 2.1.1). Es bedarf zu ihrer Wirksamkeit damit nicht zusätzlich einer Unterwerfungserklärung des Sachverständigen (z. B. durch eine vom Sachverständigen unterschriebene Verpflichtungserklärung). Die Aushändigung soll dazu dienen, dem Sachverständigen nachdrücklich auf seine Rechte und Pflichten aufmerksam zu machen. 6.4. Mit der Aushändigung der Richtlinien erhält der Sachverständige eine ausführliche Information über diese Rechte und Pflichten, so dass er sich bei einem Pflichtenverstoß oder in einem Widerrufsverfahren nicht auf Unkenntnis berufen kann. §7 Bekanntmachung 7.1 Die öffentliche Bekanntmachung der Bestellung und Vereidigung eines Sachverständigen ist in dem jeweiligen Veröffentlichungsorgan (Presseorgan) der betreffenden IHK vorzunehmen. Des Weiteren sollte nach Möglichkeit auch eine Bekanntmachung in anderen Medien erfolgen, um die Bestellung und Vereidigung einer breiten Öffentlichkeit und damit allen Nachfragern unverzüglich zugänglich zu machen. In gleicher Weise sind wesentliche Sachgebietsänderungen und das Erlöschen von Bestellungen (§ 22 Abs. 3 MSVO) bekannt zu machen. Eine Bekanntmachung im Internet kann erfolgen, wenn der Sachverständige zugestimmt hat. Eine Zustimmung des Sachverständigen ist wegen des öffentlichen Interesses anzustreben. 7.2 Daten der Bekanntmachung können Name, Adresse, Kommunikationsmittel, Bestellungstenor, Tag der Bestellung und Bestellungskörperschaft des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen sein. Sie sind von der zuständigen IHK aufzuzeichnen. Dabei ist zu beachten, dass der Sachverständige für potentielle Auftraggeber erreichbar sein muss. Zu den üblichen Kommunikationsmitteln zählen derzeit Telefon, Mobiltelefon, Fax, E-Mail- und Internetanschrift. Weitere Kommunikationsmittel, durch die der Sachverständige zu erreichen ist, sollten gleichfalls aufgenommen werden. Diese Daten werden in die von den IHKs regional oder überregional herausgegebenen Sachverständigenverzeichnissen aufgenommen und verbreitet. Die Verzeichnisse werden nach Sachgebieten gegliedert und innerhalb eines Sachgebiets alphabetisch geordnet. 7.3 Die IHK kann zum Zwecke der Erstellung eines bundes- und/oder landesweiten Verzeichnisses die Daten auch speichern oder einem von ihr beauftragten Dritten gespeichert oder in anderer Form zur Verfügung stellen. 7.4 Die öffentliche Bestellung erfolgt ausschließlich im öffentlichen Interesse. Die IHK kann deshalb jedermann auf Anfrage Name, Adresse, Bestellungstenor, Kommunikationsmittel und Bestellungskörperschaft eines öffentlich bestellten Sachverständigen mitteilen. Sie kann darüber hinaus diese Angaben Interessenten wie Gerichten, Behörden, Rechtsanwälten und sonstigen Nachfragern in Listenform zur Verfügung stellen. §8 Unabhängige, weisungsfreie, unparteiische Aufgabenerfüllung gewissenhafte und 8.1. Unabhängigkeit erfordert: 8.1.1 Der Sachverständige darf bei der Erbringung seiner Leistung keiner Einflussnahme von außen unterliegen, die geeignet ist, seine Feststellungen, Bewertungen und Schlussfolgerungen so zu beeinflussen, dass die gebotene Objektivität der Leistung und die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen nicht mehr gewährleistet sind. 8.1.2 Der Sachverständige darf bei der Übernahme, Vorbereitung und Durchführung eines Auftrags keiner Einflussnahme persönlicher, wirtschaftlicher oder beruflicher Natur unterliegen. Mithin darf ein Sachverständiger 8.1.2.1 keine Gefälligkeitsgutachten erstatten, zum Beispiel keine fachlichen Weisungen seiner Auftraggeber befolgen oder deren Wünschen hinsichtlich eines bestimmten Ergebnisses entsprechen, wenn diese das Ergebnis verfälschen. 8.1.2.2 keine Gutachten für sich selbst, Verwandte, Freunde oder sonstige Personen erstatten, zu denen er in einem engen persönlichen Verhältnis steht. 8.1.2.3 keine Gutachten über einen längeren Zeitraum ganz überwiegend für nur einen einzigen Auftraggeber (z. B. eine bestimmte Versicherung) erbringen. 8.1.2.4 keine sonstigen Bindungen vertraglicher oder persönlicher Art eingehen, die seine Unabhängigkeit bei der Gutachtenerstattung in Frage stellen können. 8.1.3 Das Einkommen eines angestellten Sachverständigen oder eines Sachverständigen in einer Sozietät darf nicht an die Zahl und die Ergebnisse seiner Gutachten gekoppelt werden. 8.2 Weisungsfreiheit bedeutet: 8.2.1 Der Sachverständige darf bei der Erbringung seiner Leistungen nicht vertraglich verpflichtet werden, Vorgaben einzuhalten, die die tatsächlichen Ermittlungen, die Bewertungen und die Schlussfolgerungen derart beeinflussen, dass unvollständige oder fehlerhafte Gutachtenergebnisse verursacht werden. 8.2.2 Es muss sorgfältig zwischen Anweisungen zum Gutachtengegenstand, Beweisthema und Umfang des Gutachtens auf der einen und der sachund ergebnisbezogenen Weisung auf der anderen Seite unterschieden werden. Der erste Teil der Alternative ist rechtlich nicht zu beanstanden, weil nur der Auftraggeber bestimmen kann, was Gegenstand einer gutachterlichen Untersuchung sein soll. Der zweite Teil der Alternative kann nur unter den Voraussetzungen von 8.2.1 akzeptiert werden. 8.2.3 Die Ausführungen zu 8.2.1 und 8.2.2 gelten uneingeschränkt für Sachverständige im Angestelltenverhältnis. In diesem Fall sind jedoch orga- nisatorische Weisungen des Arbeitgebers an den angestellten Sachverständigen zulässig. Mithin kann der Arbeitgeber beispielsweise die Arbeitsbedingungen, die Urlaubszeit und die Verteilung der Aufträge regeln. 8.3. Gewissenhaftigkeit erfordert: 8.3.1 Sorgfältige Prüfung, ob das Beweisthema (bei Gerichtsauftrag) oder der Auftrag (bei Privatauftrag) in seinem wesentlichen Inhalt innerhalb des Sachgebiets liegt, für das der Sachverständige öffentlich bestellt ist. Bei negativem Ergebnis hat der Sachverständige den Auftraggeber darauf hinzuweisen, dass er für das in Frage kommende Sachgebiet nicht öffentlich bestellt ist. Zweifelsfälle sind vor Auftragsübernahme mit dem Auftraggeber oder notfalls mit der IHK zu klären. Betrifft der Auftrag nur zum Teil das eigene Sachgebiet, so ist der Auftraggeber auch auf diesen Umstand hinzuweisen. Nur auf dessen ausdrücklichen Wunsch darf ein weiterer, fachlich zuständiger Sachverständiger hinzugezogen werden. 8.3.2 Unverzügliche Prüfung, ob der Auftrag innerhalb der gesetzten oder vereinbarten Frist oder in angemessener Zeit durchgeführt werden kann. Ist das nicht der Fall, muss der Sachverständige den Auftraggeber vor Übernahme des Auftrags entsprechend unterrichten und dessen Antwort abwarten. 8.3.3 Unverzügliche Prüfung, ob der Sachverständige die Annahme des Auftrages wegen Besorgnis der Befangenheit (vgl. unter 8.4) oder gesetzlichen Verweigerungsgründen (vgl. unter 10.2) ablehnen sollte oder sich vom Gericht vom Auftrag entbinden lassen sollte (vgl. 10.3). Ablehnen sollte der Sachverständige die Übernahme des Gutachtenauftrages bei einem Privatauftrag auch dann, wenn er Grund zur Annahme hat, dass das Gutachten missbräuchlich verwendet oder das Ergebnis verfälscht werden soll. Vorsicht ist geboten, wenn bei der Besprechung des Gutachtenauftrags vom Sachverständigen bestimmte Zusicherungen hinsichtlich des Ergebnisses des Gutachtens verlangt werden oder gewünscht wird, dass bestimmte Tatsachen oder Unterlagen unberücksichtigt bleiben sollen. 8.3.4 Unverzügliche Bestätigung der Auftragsannahme sowie des Einganges wichtiger Unterlagen (z. B. Gerichtsakten, Beweisstücke und dergl.). 8.3.5 Bei gerichtlichem Auftrag Hinweis an das Gericht, wenn der angeforderte Kostenvorschuss in auffälligem Missverhältnis zu den voraussichtlichen erwachsenen Kosten des Gutachtens steht. Vor Arbeitsbeginn ist die Entscheidung des Gerichts abzuwarten. Sinngemäß besteht eine entsprechende Aufklärungspflicht auch gegenüber einem privaten Auftraggeber; bei Privatauftrag wird darüber hinaus eine vorherige Honorarvereinbarung empfohlen, falls keine staatliche Gebührenordnung gilt. 8.3.6 Unterrichtung des Auftraggebers über Verzögerungen während der Bearbeitung des Auftrags. Eine entsprechende Unterrichtungspflicht besteht auch dann, wenn sich während der Bearbeitung herausstellt, dass die Durchführung des Auftrages teurer wird als ursprünglich angenommen. 8.3.7 Jeder Auftrag ist mit der Sorgfalt eines öffentlich bestellten Sachverständigen zu erledigen und dabei der aktuelle Stand von Wissenschaft, Technik und Praxiserfahrung zu berücksichtigen. Gutachten sind systematisch aufzubauen, übersichtlich zu gliedern, nachvollziehbar zu begründen und auf das Wesentliche zu beschränken (vgl. 11.6). Es sind alle im Auftrag gestellten Fragen zu beantworten, wobei sich der Sachverständige genau an das Beweisthema bzw. an den Inhalt des Auftrages zu halten hat. Die tatsächlichen Grundlagen für eine Sachverständigenaussage sind sorgfältig zu ermitteln und die erforderlichen Besichtigungen sind persönlich durchzuführen. Kommen für die Beantwortung der gestellten Fragen mehrere Lösungen ernsthaft in Betracht, so hat der Sachverständige diese darzulegen und den Grad der Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit der einzelnen Lösungen gegeneinander abzuwägen. Die Schlussfolgerungen im Gutachten müssen so klar und verständlich dargelegt sein, dass sie für einen Nichtfachmann lückenlos nachvollziehbar und plausibel sind. Ist eine Schlussfolgerung nicht zwingend, sondern nur naheliegend, und ist das Gefolgerte deshalb nicht erkenntnissicher, sondern nur mehr oder weniger wahrscheinlich, so muss der Sachverständige dies im Gutachten deutlich zum Ausdruck bringen (siehe auch 11.6). 8.3.8 Der Sachverständige hat in der Regel das IHK-Merkblatt „Der gerichtliche Gutachtenauftrag“ aus dem Selbstverlag des Deutschen Industrieund Handelskammertages und die von den IHKs herausgegebenen Mindestanforderungen an Gutachten für die einzelnen Sachgebiete zu beachten (siehe auch 11.7). 8.4. Unparteiisches Verhalten erfordert: 8.4.1 Der Sachverständige hat seine Leistungen so zu erbringen, dass er sich weder in Gerichtsverfahren noch bei Privatauftrag dem Einwand der Befangenheit aussetzt. Er hat bei der Vorbereitung des Gutachtens strikte Neutralität zu wahren, muss die gestellten Fragen objektiv und unvoreingenommen beantworten und darf zu den Auftraggebern und in Gerichtsverfahren - zu den Prozessparteien nicht in einem Verhältnis stehen, dass zu Misstrauen Anlass gibt. Auf Gründe, die geeignet sind, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen, hat er seinen jeweiligen Auftraggeber unverzüglich hinzuweisen. 8.4.2 Der Sachverständige darf nicht zu Personen, Unternehmen, Organisationen oder Behörden in Abhängigkeit stehen, die mit den einzelnen Gutachtenaufträgen in Verbindung gebracht werden können. Unabhängigkeit von Personen bedeutet, dass der Sachverständige grundsätzlich keinen Auftrag übernehmen kann, wenn er mit dem Auftraggeber - in Gerichtsverfahren mit einer Prozesspartei - verheiratet, verwandt, verschwägert oder befreundet ist (vgl. 8.1.2.2 und 10.2). 8.4.3 Der Sachverständige muss bei der Auftragsdurchführung neutral sein und muss bei der Behandlung von Sachfragen den Grundsatz der Objektivität beachten. Bei den notwendigen Handlungen, Maßnahmen und Arbeiten zur zweckmäßigen Erledigung eines Auftrages hat er bereits den Anschein der Parteilichkeit und der Voreingenommenheit zu vermeiden. 8.4.4. Neutralität während der Gutachtenerstattung bedeutet, dass der Sachverständige bei Gerichtsauftrag zur Orts- und Objektbesichtigung stets beide Parteien lädt und auch beide Parteien teilnehmen lässt und dass er die jeweils andere Partei unterrichtet, wenn er bei einer Partei Unterlagen anfordert oder Auskünfte einholt. Im übrigen sollten während der Erarbeitung des Gerichtsgutachtens keine einseitigen Kontakte zu den Parteien stattfinden. 8.4.5 Objektivität in Sachfragen bedeutet, dass der Sachverständige keine Vorurteile gegen ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Untersuchungsmethode oder eine bestimmte Lehrmeinung haben darf. In gleicher Weise sind ungerechtfertigte Bevorzugungen unzulässig. Falls erforderlich, hat er sich mit abweichenden Methoden und Lehrmeinungen im Gutachten in der gebotenen Sachlichkeit auseinander zusetzen. 8.4.6 Der Sachverständige darf keine Gutachten in derselben Sache - auch nicht zeitlich versetzt - für beide sich streitenden Parteien erstatten, es sei denn, beide Parteien erklären sich ausdrücklich damit einverstanden. 8.4.7 Der Sachverständige darf keine Sachverständigenleistungen in eigener Sache erbringen, der zugleich Inhaber eines Handelsgeschäfts dieser Warengattung ist (z. B. Sachverständiger für Orientteppiche oder Briefmarken fügt den von ihm verkauften Waren von ihm selbst gefertigte Echtheitszertifikate bei). 8.4.8 Der Sachverständige, der ein eigenes Geschäft hat oder Makler ist, darf nicht ein Objekt bewerten, von dem er von vornherein, also bei Gutachtenübernahme weiß, dass er es danach selbst ankaufen will oder zum Verkauf vermitteln soll. Ein solches Verhalten erweckt in der Regel den Anschein der Parteilichkeit. Ein solches Geschäft ist dem Sachverständigen nur dann erlaubt, wenn er erst nach Abgabe des Gutachtens den Verkaufs- oder Vermittlungsauftrag erhält. §9 Persönliche Aufgabenstellung und Beschäftigung von Hilfskräften 9.1 Der Sachverständige ist grundsätzlich verpflichtet, seine Gutachten und andere Sachverständigenleistungen (§ 2 Abs. 2 MSVO ) in eigener Person zu erarbeiten bzw. zu erbringen. Für den gerichtlichen Bereich ergibt sich diese Pflicht aus § 407 a Abs. 2 ZPO, für den privaten Bereich aus dem Inhalt des Eides nach § 36 GewO. 9.2 Dies bedeutet, dass der Sachverständige die wesentlichen Teile der Tatsachenermittlung und –feststellung, die Orts- und Objektsbesichtigung, die Schlussfolgerungen, die Beurteilungen und die Bewertungen grundsätzlich in eigener Person durchzuführen hat. Sämtliche Sachverständigenleistungen müssen auf der Anwendung der fachlichen Qualifikation und der Erfahrung des beauftragten Sachverständigen beruhen. Auf die Ausnahmefälle in 9.7. wird verwiesen. 9.3 Es ist mithin nicht zulässig, dass der Sachverständige nur formal und nach außen hin die Verantwortung für die unter seinem Namen abgegebenen gutachterlichen Äußerungen übernimmt. Er muss seine Leistungen vielmehr in den wesentlichen Teilen selbst erbringen, um sie jederzeit selbst vor Gericht oder gegenüber seinem privaten Auftraggeber vertreten, erläutern, ergänzen oder zu abweichenden Feststellungen und Meinungen anderer Sachverständigen Stellung nehmen zu können. 9.4 Hilfskräfte darf der Sachverständige grundsätzlich nur bei der Vorbereitung seiner Gutachten und sonstigen Leistungen einsetzen. Dabei kann Hilfskraft nur derjenige sein, der, sei er beim Sachverständigen angestellt oder Selbständiger, auf demselben Sachgebiet tätig ist wie der beauftragte Sachverständige, dessen fachlichen Weisungen befolgen muss, seiner Kontrolle unterliegt und dem Sachverständigen entsprechend seinen Fähigkeiten zuarbeitet. Einer Hilfskraft können und dürfen nur solche Aufgaben übertragen werden, die der Sachverständige aufgrund seiner Sachkunde auch hätte persönlich erledigen können. Andernfalls kann der Sachverständige für die Richtigkeit der Hilfskraftarbeiten nicht mehr die Verantwortung übernehmen. 9.5 Die beim Sachverständigen angestellten öffentlich bestellten Sachverständigen oder die mit ihm in einer Sozietät arbeitenden Sachverständigen sind keine Hilfskräfte im vorgenannten Sinne. Auch der vom beauftragten Sachverständigen – mit oder ohne Einwilligung des Gerichts oder des sonstigen Auftraggebers – hinzugezogene Sachverständige einer anderen Fachdisziplin ist keine Hilfskraft im Sinne von § 9 MSVO. Werden solche Sachverständigen eingeschaltet – aus welchen Gründen auch immer – handelt es sich um ein Gemeinschaftsgutachten; dabei muss deutlich gemacht werden, wer für welchen Teil des Gutachtens verantwortlich zeichnet. 9.6 Aus den Vorgaben der Punkte 9.1 bis 9.5 leiten sich folgende Konsequenzen ab: 9.6.1 Der Sachverständige trägt unabhängig von Art und Umfang der Mitwirkung von Hilfskräften und ihrer Überwachung für Inhalt und Ergebnis seiner konkreten gutachterlichen Leistung persönlich die volle und auf keinen anderen abwälzbare Verantwortung. 9.6.2 Der Sachverständige darf Hilfskräfte grundsätzlich nur zu Vorbereitungsarbeiten heranziehen. Vorbereitungsarbeiten sind solche Tätigkeiten, die keine fachliche Ausfüllung von Erfahrungssätzen, Beurteilungsspielräumen oder Ermessensentscheidungen erfordern, sondern sich auf die Feststellung von Tatsachen beschränken. Beispielhaft seien Tätigkeiten wie Messungen, Fotografieren, Herstellung von Analysen, Materialprüfungen genannt. Orts- und Objektsbesichtigungen muss der Sachverständige grundsätzlich selbst vornehmen. 9.6.3 Der Umfang der Tätigkeiten von Hilfskräften ist im Gutachten kenntlich zu machen. 9.6.4 Der Sachverständige darf die Arbeitsinhalte und -ergebnisse seiner Hilfskraft nicht ungeprüft oder nur formal geprüft übernehmen. Vielmehr muss er sich selbst in den konkreten Fall einarbeiten und muss die Arbeitsergebnisse seiner Hilfskraft auf fachliche Plausibilität hin nachprüfen. 9.7 Von den unter 9.2 bis 9.6.2 aufgeführten Vorgaben darf nur dann abgewichen werden, wenn es sich um einen außergerichtlichen Auftrag handelt, der Auftraggeber vor Auftragsübernahme durch den Sachverständigen nachweisbar der intensiveren Mitwirkung einer Hilfskraft zustimmt und Art und Umfang der Mitwirkung der Hilfskraft im Gutachten offengelegt werden. 9.8 Unterzeichnet der Sachverständige ungeprüft oder nur formal ein Gutachten, das von seiner Hilfskraft vorbereitet, entworfen oder formuliert wurde, verstößt er in grober Weise gegen seine Pflicht zur persönlichen Aufgabenerfüllung. 9.9 Der Sachverständige muss seine Hilfskräfte im Hinblick auf ihre fachliche Eignung und ihre persönliche Zuverlässigkeit im Einzelfall sorgfältig auswählen, einweisen, anleiten, überwachen und fortbilden. Art und Umfang der Verpflichtung zur Überwachung und Anweisung im Einzelfall bestimmen sich nach dem Maß ihrer Sachkunde, Erfahrung und Zuverlässigkeit sowie den Gegebenheiten des konkreten Auftrags, vor allem der Schwierigkeit der einzelnen gutachterlichen Leistung. 9.10 Der Sachverständige hat sicherzustellen, dass durch seine Hilfskräfte nicht gegen den Pflichtenkatalog der MSVO verstoßen wird. Insbesondere muss die Hilfskraft im Arbeitsvertrag auf die Einhaltung der Schweigepflicht verpflichtet werden. Weiterhin muss der Sachverständige dafür Sorge tragen, dass sich seine Hilfskraft angemessen weiterbildet. 9.11 Es ist nicht zulässig, dass die Hilfskraft ein Gutachten allein oder zusammen mit dem beauftragten Sachverständigen unterschreibt (vgl. 11.8 und 12.4). 9.12 Die Hilfskraft darf den Sachverständigen nicht, auch nicht vorübergehend, vertreten. 9.13 Der Sachverständige soll beim Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung auch die Tätigkeiten seiner Hilfskraft in erforderlichem Umfang absichern. § 10 Verpflichtung zur Gutachtenerstattung 10.1 Inhalt und Umfang der Pflicht zur Gutachtenerstattung sind unterschiedlich geregelt und hängen davon ab, ob der Sachverständige vom Gericht oder von privater Seite beauftragt wird. 10.1.1 Der vom Gericht ernannte Sachverständige hat der Ernennung Folge zu leisten, wenn er für das betreffende Gebiet öffentlich bestellt ist oder wenn er die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis die Voraussetzung für die Begutachtung ist, öffentlich zum Erwerb ausübt ( § 407 Abs. 1 ZPO; § 75 Abs. 1 StPO). 10.1.2 Beim Privatauftrag gibt es für den Sachverständigen zwar keine Pflicht, jeden Auftrag anzunehmen. Sinn und Zweck der öffentlichen Bestellung verlangen jedoch vom Sachverständigen, dass er seine Arbeitskraft zu einem angemessenen Teil auch für Gutachten im außergerichtlichen Bereich zur Erledigung von Gutachtenaufträge zur Verfügung stellt. Verweigert er nachhaltig und ohne berechtigten Grund solche privaten Gutachtenaufträge, kann seine Bestellung widerrufen werden. 10.2 Ein vom Gericht beauftragter Sachverständiger kann die Erstattung eines Gutachtens aus denselben Gründen verweigern, die einen Zeugen zur Zeugnisverweigerung berechtigen ( §§ 408 Abs. 1 S. 1, 383, 384 ZPO; §§ 76 Abs. 1 Satz 1, 52,53 StPO). Beispielsweise können folgende Verweigerungsgründe in Betracht kommen: Der Sachverständige ist mit einer Partei oder dem Beschuldigten verlobt, verheiratet, verwandt, verschwägert oder es besteht eine Lebenspartnerschaft. Der Sachverständige gehört einer Berufsgruppe an, die bestimmte Tatsachen nicht weitergeben darf, weil sie ihm als Vertrauensperson anvertraut oder bekannt geworden sind ( Geistliche, Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, Berater usw.). Liegen solche Verweigerungsgründe vor, ist der Sachverständige berechtigt, den Auftrag abzulehnen. 10.3 Der Sachverständige kann bei Gerichtsauftrag auch aus anderen Gründen vom Gericht von der Pflicht zur Gutachtenerstattung entbunden werden ( § 408 Abs. 1 Satz 2 ZPO, § 76 Abs. 1 Satz 2 StPO). Solche Gründe sind insbesondere dann gegeben, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, berechtigte Zweifel an seiner Unparteilichkeit aufkommen zu lassen ( Besorgnis der Befangenheit). Es kommen aber auch Gründe wie Urlaub, Überlastung, Krankheit, fehlende Sachkunde u.ä. in Betracht. In all diesen Fällen kann der Sachverständige die Übernahme des Auftrags nicht von sich aus verweigern, sondern muss bei Gericht einen Antrag auf Entbindung von seiner Gutachtenpflicht stellen. 10.4 Bei Privatauftrag sollte der Sachverständige von sich aus den Auftrag ablehnen, wenn Verweigerungsgründe oder Gründe für eine Entpflichtung im Sinne von 10.2 oder 10.3 vorliegen. Allerdings gibt es keine dem Gericht vergleichbare Stelle, die die Verweigerungsgründe überprüfen oder ihn vom Auftrag entbinden kann. Auch die IHK ist hierzu nicht befugt, kann aber in Zweifelsfällen um Rat gebeten werden. Eine Ablehnung des Privatauftrags ist auch dann gerechtfertigt, wenn der Auftraggeber die vertraglichen Konditionen, insbesondere das Honorar nicht akzeptiert. § 11 Form der Leistungen 11.1 Das schriftliche Gutachten und andere schriftliche Sachverständigenleistungen müssen in gedruckter Schrift gefertigt sein. Die erste Seite muss den Vorschriften des § 12 MSVO entsprechen. Das Gutachten und andere schriftliche Sachverständigenleistungen müssen mit der eigenhändigen Unterschrift des Sachverständigen und seinem Rundstempel versehen sein. 11.2 Nutzt der Sachverständige die elektronische Form, kann er Unterschrift und Rundstempel einscannen. Um die Fälschungssicherheit zur gewährleisten, hat er die qualifizierte Signatur zu benutzen. 11.3 Wird das Gutachten von zwei oder mehreren Sachverständigen desselben Sachgebiets oder unterschiedlicher Sachbereiche erarbeitet, muss zunächst im Gutachtentext kenntlich gemacht werden, welcher Sachverständige für welche Teile verantwortlich ist. Sodann müssen alle beteiligten Sachverständigen das Gutachten nach den Regeln von 11.1 Gutachtenerstattung; gemeinschaftliche oder 11.2 unterzeichnen und mit ihren Rundstempeln versehen. Eine Hilfskraft nach § 9 Abs. 4 MSVO ist kein Sachverständiger im Sinne dieser Regelung. 11.4 Übernimmt ein Sachverständiger beispielsweise die Ergebnisse eines Materialprüfungsamtes oder eines anderen Gutachtens, hat er im Gutachten darauf hinzuweisen. 11.5 Möchte der Sachverständige Gutachtenformulare benutzen, so ist dies nur dann gestattet, wenn er durch die darin enthaltenen Vorgaben oder Beschränkungen nicht in seiner Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Anwendung seiner Sachkunde beeinträchtigt wird. Inhalt und Umfang seiner gutachtlichen Äußerungen, insbesondere die Vollständigkeit, der systematische Aufbau, die übersichtliche Gliederung, die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit der Gedankengänge und der Ergebnisse dürfen durch Vorgaben des Formulars nicht beeinträchtigt werden. 11.6 Im Übrigen muss das Gutachten systematisch aufgebaut und übersichtlich gegliedert sein; in den Gedankengängen für den Laien nachvollziehbar und für den Fachmann nachprüfbar sein; (Nachprüfbarkeit bedeutet, dass die das Gutachten tragenden Feststellungen und Schlussfolgerungen so dargestellt sind, dass sie von einem Fachmann ohne Schwierigkeiten als richtig oder als falsch erkannt werden können.) auf das Wesentliche beschränkt bleiben; unter Berücksichtigung des jeweiligen Adressaten verständlich formuliert sein und hat unvermeidbare Fachausdrücke nach Möglichkeit zu erläutern. 11.7 Für einige Sachgebiete haben die IHKs Mindestanforderungen an Gutachten herausgegeben, die den fachlichen Standard festschreiben und die Sorgfaltspflichten des Sachverständigen in fachlicher Hinsicht konkretisieren. Diese Mindestanforderungen sind grundsätzlich einzuhalten. Weicht der Sachverständigen in Ausnahmefällen von diesen Anforderungen ab, so hat er dies im Auftrag zu vermerken und die Gründe hierfür im Gutachten anzugeben (siehe auch 8.3.9) 11.8 Diese Richtlinien gelten ohne Einschränkungen auch für Sachverständige im Angestelltenverhältnis (vgl. auch 12.7). Der Sachverständige darf das Gutachten zwar auf dem Briefbogen seines Arbeitgebers oder Dienstherrn erstellen; er muss aber auch die in § 12 MSVO vorgegebenen Angaben machen. Und schließlich muss auch der angestellte Sachverständige durch eigenhändige Unterschrift und Beifügung des Rundstempels nach außen hin die Verantwortung für den Inhalt des von ihm gefertigten Gutachtens übernehmen. Der Arbeitgeber oder Dienstherr darf das Gutachten nicht mitunterschreiben ( gegenzeichnen). § 12 Bezeichnung als „öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger“ 12.1 Der Sachverständige muss in allen Fällen seiner gutachterlichen Tätigkeit und der ihm sonst obliegenden Aufgaben auf seinem Bestellungsgebiet seine Bezeichnung (jeweils mit dem vollständigen Bestellungstenor einschließlich der zuständigen Bestellungskörperschaft) und seinen Rundstempel verwenden. Dabei muss er das vollständige Sachgebiet so angeben, wie es in der Bestellungsurkunde verzeichnet ist. Auf Visitenkarten, in Anzeigen und in der Werbung kann er diese Hinweise in verkürzter Form verwenden; dabei ist jedoch das Irreführungsverbot des § 3 UWG zu beachten. 12.2 Andere Bezeichnungen, Anerkennungen, Zulassungen, Zertifizierungen Mitgliedschaften und vergleichbare Hinweise im Briefkopf von Gutachten und Geschäftsbriefen sind zulässig, wenn sie nicht irreführend, also geeignet sind, über die fachliche und persönliche Qualifikation des Sachverständigen zu täuschen. 12.3 Unter das Gutachten oder andere schriftliche Leistungen darf der Sachverständige nur seine Unterschrift und seinen Rundstempel setzen. Im Falle der elektronischen Übermittlung unter Verwendung der qualifizierten elektronischen Signatur kann er Unterschrift und Rundstempel einscannen. 12.4 Eine weitere Unterschrift, beispielsweise des Arbeitgebers oder der Hilfskraft ist nicht zulässig (vgl. 9.11 und 11.8). Ein weiterer Rundstempel, beispielsweise eines Verbandes oder einer Zertifizierungsstelle, ist ebenfalls nicht erlaubt. Nur wenn die Benutzung des Rundstempels gesetzlich vorgeschrieben ist, ist ein weiterer Rundstempel zugelassen. Schließlich kann eine weitere Unterschrift mit entsprechendem Rundstempel angebracht werden, wenn es sich um ein Gemeinschaftsgutachten von zwei selbständigen Sachverständigen im Sinne von 11.3 handelt. 12.5 Ist der Sachverständige auf weiteren Sachgebieten als Sachverständiger tätig, darf er dies im Briefkopf vermerken. Dabei hat er aber darauf zu achten, dass auch für den flüchtigen Durchschnittsleser klar erkennbar wird, für welches Sachgebiet er öffentlich bestellt ist und für welches nicht. Gleiches gilt für den Hinweis auf eine sonstige berufliche Tätigkeit ( z. B. Architekt, Ingenieurbüro). In allen Fälle ist das Irreführungsverbot des § 3 UWG zu beachten. 12.6 In den Fällen einer Sozietät (§ 21 MSVO) – in welcher Rechtsform auch immer – gelten die vorstehenden Richtlinien in gleicher Weise. Es müssen alle Sachverständigen mit ihren jeweiligen Sachgebieten aufgeführt werden, und es muss dabei jeweils erkennbar werden, wer öffentlich bestellt ist und wer nicht. 12.7 Die vorstehenden Richtlinien gelten ohne Einschränkungen auch für Sachverständige im Angestelltenverhältnis (vgl. dazu 11.8) § 13 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten 13.1 Die Regelung bezieht sich auf alle Sachverständigenleistungen, wie sie sich aus § 2 Abs. 2 MSVO ergeben. 13.2 Die Aufzeichnungen dienen der Kontrolle über die Einhaltung der Pflichten des Sachverständigen. Deshalb müssen sie vollständig, übersichtlich und chronologisch geordnet sein. Eine bestimmte technische Form (z.B. Tagebuch) ist nicht vorgesehen. Neben der herkömmlichen Schriftform ist es beispielsweise zulässig, die erforderlichen Aufzeichnungen und Daten in elektronischer Form (z.B. auf Festplatte, CD-Rom oder Diskette) vorzuhalten. Sollte diese Aufbewahrungsform gewählt werden, hat der Sachverständige sicher zu stellen, dass die gespeicherten aufzuzeichnenden und aufzubewahrenden Daten ohne einen unverhältnismäßigen Aufwand zur Einsicht durch Berechtigte (vgl. § 20 MSVO) in allgemein lesbarer Form zur Verfügung stehen. 13.3 Der Sachverständige hat seine Leistung oder den begutachteten Gegenstand in den Aufzeichnungen so zu beschreiben, dass eine spätere Identifizierung zweifelsfrei ohne weitere Ermittlungen und Einsichtnahme in die Akten möglich ist. 13.4 Bei mündlich erbrachten Leistungen sind Auftraggeber, Gegenstand der Leistung, Datum und Ergebnis der Leistungserbringung schriftlich (s.o.) festzuhalten. Bei mündlich erstatteten Gerichtsgutachten genügt eine Aufzeichnung über den Tag der Vernehmung, das Gericht, die Prozessparteien und das Aktenzeichen des Verfahrens, weil das Ergebnis des Gutachtens durch Protokollierung aktenkundig wird. 13.5 Wird das Gutachten nicht erstattet, so sind die Gründe dafür festzuhalten (z.B. Ablehnung wegen der Besorgnis der Befangenheit oder Abbruch wegen Abschluss eines Vergleichs). 13.6 Der Sachverständige muss nachträgliche Änderungen der Aufzeichnungen kenntlich machen. Dies gilt insbesondere auch für Aufzeichnungen in elektronischer Form. 13.7 Der Sachverständige muss von sich aus prüfen, ob zum besseren Verständnis der Art und des Umfangs seiner Tätigkeit als Sachverständiger sowie zum Nachweis über Einzelheiten von ihm getroffener Feststellungen (beispielsweise zum Zwecke der Abwehr von Haftungsansprüchen) weitere Unterlagen aufzubewahren sind. § 14 Haftungsausschluss; Haftpflichtversicherung 14.1 Der Sachverständige ist seinem Auftraggeber zum Ersatz vorsätzlich oder fahrlässig verursachter Schäden verpflichtet. 14.2 Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit kann vom Sachverständigen weder ausgeschlossen noch der Höhe nach beschränkt werden. Weitere gesetzliche Verbote für Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen sind zu beachten. 14.3 Der Sachverständige soll für sich und seine Mitarbeiter eine Berufshaftpflichtversicherung in angemessener Höhe abschließen und diese während des Zeitraums seiner öffentlichen Bestellung aufrecht erhalten. Die Höhe der Versicherung muss sich nach dem Umfang seiner möglichen Inanspruchnahme richten. Der Sachverständige soll seine Haftpflichtversicherung – auch im eigenen Interesse - in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit hin überprüfen. 14.4 Wird der Sachverständige in einem Zusammenschluss mit anderen Sachverständigen tätig, bei dem die Haftung des Einzelnen ausgeschlossen oder beschränkt ist (siehe § 21 MSVO), soll dieser sich Haftpflicht versichern. Die Deckungssumme der Haftpflichtversicherung soll dem Haftungsrisiko des Zusammenschlusses entsprechen. Wählt der Sachverständige für einen Zusammenschluss im Sinne des § 21 MSVO eine Rechtsform, die die Haftung auf das Vermögen des Zusammenschlusses beschränkt (z.B. GmbH, § 13 Abs. 2 GmbHG), soll er dafür Sorge tragen, dass die Gesellschaft über eine angemessene Haftpflichtversicherung verfügt. Für eine Gesellschaft, deren Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt ist, gilt eine Haftpflichtversicherung nur dann als angemessen, wenn die Haftungshöchstsummen deutlich über denen für die einzelnen Sachverständigen des Zusammenschlusses liegen. § 15 Schweigepflicht 15.1 Die Schweigepflicht ist ein maßgeblicher Grund für die Vertrauenswürdigkeit des öffentlich bestellten Sachverständigen. Der Sachverständige darf weder das Gutachten noch Tatsachen oder Unterlagen, die ihm im Rahmen seiner gutachtlichen Tätigkeit anvertraut worden oder bekannt geworden sind, unbefugt offenbaren, weitergeben oder ausnutzen. Die Pflicht zur Verschwiegenheit umfasst alle Tatsachen, die er durch seine Tätigkeit als öffentlich bestellter Sachverständiger erfahren hat, sofern diese nicht offenkundig sind. Auch die Tatsache seiner Beauftragung ist gegebenenfalls geheim zu halten. So dürfen Dritten nicht ohne weiteres auf Anfrage Auskünfte über den Inhalt oder Umstände der Gutachtenerstattung erteilt werden. Wenn z.B. Versicherungsgesellschaften, denen das Gutachten eines Kraftfahrzeugsachverständigen vorgelegt worden ist, Rückfragen haben, ist das Einverständnis des Auftraggebers zur Auskunftserteilung einzuholen, wenn es nicht aus den Umständen oder der Interessenlage unterstellt werden kann. 15.2 Diese Schweigepflicht gilt auch für alle im Betrieb des Sachverständigen mitarbeitenden Personen. Der Sachverständige hat dafür zu sorgen, dass die Schweigepflicht von den genannten Personen eingehalten wird. 15.3 Eine befugte Offenbarung liegt dann vor, wenn der Auftraggeber den Sachverständigen ausdrücklich von der Schweigepflicht entbindet. Es empfiehlt sich, sich die Zustimmung des Auftraggebers schriftlich geben zu lassen. Der Sachverständige darf allerdings Dritten, denen der Auftraggeber das Gutachten zugänglich gemacht hat, unter Schonung der berechtigten Belange des Auftraggebers das Gutachten z.B. erläutern. 15.4 Der Sachverständige darf die bei seiner Gutachtertätigkeit erlangten Kenntnisse in anonymisierter Form für sich oder Dritte verwerten (beispielsweise zum Zweck des Vergleichs, der Statistik oder des Erfahrungsaustausches). In diesen Fällen muss der Sachverständige jedoch sicherstellen, dass - auch nicht mittelbar - Rückschlüsse auf den Auftraggeber, den konkreten Gutachtenfall oder das begutachtete Objekt möglich sind. 15.5 Eine befugte Offenbarung liegt auch dann vor, wenn der Sachverständige aufgrund von Vorschriften dazu verpflichtet ist (z.B. nach § 20 MSVO oder nach der ZPO). Der Sachverständige ist auch verpflichtet, als Zeuge im Strafprozess auszusagen. Die Zeugnispflicht geht hier der Schweigepflicht vor. Er hat auch kein Auskunftsverweigerungsrecht nach der Abgabenordnung. 15.6 Die Schweigepflicht gilt auch, wenn die öffentliche Bestellung des Sachverständigen erloschen (§ 22 Abs. 1 MSVO) oder sein Auftraggeber verstorben ist. 15.7 Da der öffentlich bestellte Sachverständige auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten förmlich verpflichtet worden ist , stellt die Verletzung der Schweigepflicht eine strafbare Handlung nach § 203 Abs. 2 Nr. 5 StGB dar; die oben genannten Ausnahmen von der Schweigepflicht gelten auch hier. § 16 Fortbildungspflicht und Erfahrungsaustausch 16.1 Es reicht nicht aus, dass der Sachverständige nur im Zeitpunkt seiner Bestellung über das notwendige Fachwissen verfügt und fähig ist, Gutachten zu erstatten. Beide Bestellungsvoraussetzungen müssen während der gesamten Dauer der öffentlichen Bestellung vorhanden sein. Der Sachverständige hat sich daher ständig über den jeweiligen Stand der Wissenschaft, der Technik und die neueren Erkenntnisse auf seinem Sachgebiet zu unterrichten. Zur Fortbildung gehört aber nicht nur die Ergänzung des unmittelbaren Fachwissens, sondern auch Weiterbildung im allgemeinen Sachverständigenwissen (z. B. Vertrags-, Prozess-, Haftungs-, Gebühren- und Schiedsgutachterrecht sowie im öffentlichen Recht hinsichtlich des ihn betreffenden Pflichtenkatalogs). 16.2 Zu diesem Zweck hat sich der Sachverständige nachweisbar in der erforderlichen Weise, insbesondere durch regelmäßige Teilnahme an Kursen, Seminaren und Fortbildungslehrgängen, die von kompetenten Stellen angeboten werden, sowie durch laufendes Studium der Fachliteratur und von Fachzeitschriften fortzubilden. Zur Fortbildung gehört auch die Teilnahme am fachlichen Erfahrungsaustausch (z. B. Teilnahme an Fachkongressen) in erforderlichem Umfang, soweit es diesen auf dem Sachgebiet gibt, für das er öffentlich bestellt ist. Entsprechende Nachweise sind fortlaufend, spätestens bei einem Antrag auf Verlängerung nach Ablauf der Befristung vorzulegen (vgl. 4.4). § 17 Haupt- und Zweigniederlassung 17.1 Berufliche (Haupt-)Niederlassung des Sachverständigen ist der Ort, von dem aus der Sachverständige seine Sachverständigentätigkeit ausübt. Die berufliche (Haupt-)Niederlassung des Sachverständigen ist ausschließlich im Hinblick auf die Tätigkeit als Sachverständiger, nicht nach der sonstigen beruflichen Tätigkeit zu bestimmen. Dort, wo der Sachverständige für seine Sachverständigentätigkeit über einen zum dauernden Gebrauch eingerichteten, ständig oder regelmäßig von ihm benutzten Raum verfügt, befindet sich regelmäßig seine (Haupt-) Niederlassung. 17.2 Eine Zweigniederlassung kann nur errichtet werden, wenn die in § 17 Abs. 2 MSVO genannten vier Kriterien erfüllt sind: 17.2.1 Der Sachverständige muss - wie für die (Haupt-)Niederlassung - über einen zum dauernden Gebrauch eingerichteten, ständig oder regelmäßig von ihm benutzten Raum verfügen. 17.2.2 In der Zweigniederlassung muss der Sachverständige entweder persönlich erreichbar sein oder sich vertreten lassen. Aufgrund der modernen Verkehrs- und Telekommunikationsmittel kann die Erreichbarkeit des Sachverständigen auch dann gesichert sein, wenn mehrere Niederlassungen bestehen. Sobald dies nicht mehr möglich ist, muss die Niederlassung mit einem Sachverständigen besetzt sein, der in der Lage ist, den Sachverständigen fachlich zu vertreten. 17.2.3 Durch eine oder mehrere Zweigniederlassungen darf die Erfüllung der Sachverständigenpflichten nicht beeinträchtigt werden. Es sind daher nur so viele Zweigstellen zulässig, dass die Hauptniederlassung und die Zweigstellen noch ordnungsgemäß betrieben und von der zuständigen (bestellenden) IHK überwacht werden können. Die IHK, in deren Bezirk die Zweigniederlassung liegt, unterstützt die zuständige IHK. 17.3 Zweigniederlassungen sind genehmigungspflichtig, damit die beteiligten IHKs überprüfen können, ob die Tätigkeiten des Sachverständigen ordnungsgemäß ausgeübt werden können und werden. Der Sachverständige hat einen Anspruch auf Genehmigung, wenn die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt sowie befristet werden. 17.4 Die aufsichtsführende IHK holt eine Stellungnahme derjenigen IHK ein, in deren Bezirk die Zweigniederlassung errichtet werden soll. Die tatsächliche Inbetriebnahme der Zweigniederlassung muss angezeigt werden (siehe § 19 Buchst. b MSVO). 17.5 Sämtliche Vorschriften über die Haupt- und Zweigniederlassung finden auf Niederlassungen von Zusammenschlüssen nach § 21 MSVO entsprechende Anwendung. § 18 Kundmachung; Werbung 18.1 Der Sachverständige unterliegt bei seiner Werbung den Bestimmungen der §§ 1 und 3 UWG. 18.2 Der Sachverständige hat sich bei der Kundmachung seiner Tätigkeit und bei seiner Werbung Zurückhaltung aufzuerlegen. Aufmachung und Inhalt seiner Selbstdarstellung müssen dem Ansehen, der Funktion und der hohen Verantwortung eines öffentlich bestellten Sachverständigen gerecht werden. Zulässig ist danach eine Werbung, die lediglich hinweisenden und informierenden Charakter hat und das Leistungsangebot des Sachverständigen in der äußeren Aufmachung und der inhaltlichen Aussage objektiv darstellt. Zu unterlassen sind dagegen aufdringliche und anreißerische Werbeaussagen. 18.3 Der Sachverständige darf seine öffentliche Bestellung sowie seine Sachverständigentätigkeit in Tageszeitungen, Fachzeitschriften, Branchenfernsprechbüchern, Adressbüchern und im Internet bekannt geben. Solche Anzeigen dürfen nach Form und Inhalt nicht reklameartig aufgemacht sein und müssen sich auf die Bekanntgabe des Namens, der Adresse, der Sachgebietsbezeichnung, der öffentlichen Bestellung und der bestellenden Kammer beschränken. 18.4 Der Sachverständige darf in Anzeigen und auf seinen Briefbögen außer auf seine Sachverständigentätigkeit nicht auf seine sonstige berufliche oder gewerbliche Tätigkeit hinweisen, wenn dies gegen §§ 1 und 3 UWG verstößt. Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn der Hinweis auf die öffentliche Bestellung so in den Mittelpunkt gerückt wird, dass dem angesprochenen Dritten der Eindruck nahe liegt, der Sachverständige sei auch bei seiner sonstigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit besonders qualifiziert oder vertrauenswürdig (Image-Transfer). Umgekehrt darf der Sachverständige bei Tätigkeiten auf anderen Sachgebieten als denjenigen, für die er bestellt ist, oder bei Leistungen im Rahmen seiner sonstigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit auf seine öffentliche Bestellung nur dann Bezug nehmen, wenn dadurch die §§ 1 und 3 UWG nicht verletzt werden (vgl. § 12 Abs. 3 MSVO). 18.5 Der Auftraggeber darf nach Absprache mit dem Sachverständigen auf seinen Produkten oder in der Produktbeschreibung darauf hinweisen, dass sein Produkt von dem betreffenden öffentlich bestellten Sachverständigen überprüft worden ist. Ansonsten darf der Sachverständige nicht im Zusammenhang mit den beruflichen oder gewerblichen Leistungen Dritter werben oder für sich werben lassen. 18.6 Soweit der Sachverständige standesrechtlichen Regeln zur Werbung unterliegt (z. B. als Architekt, Ingenieur, Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater), bleiben diese unberührt. § 19 Anzeigepflichten 19.1 Der Sachverständige ist verpflichtet, der IHK alle Veränderungen in seinem persönlichen Bereich mitzuteilen, die Auswirkungen auf seine Tätigkeit haben können. So muss die IHK, da sie auf Anfrage Gerichten oder privaten Interessenten Sachverständige benennt, wissen, wo und wie der Sachverständige erreichbar ist, und darüber unterrichtet sein, wenn er z. B. durch Krankheit oder Auslandsaufenthalt drei Monate und länger gehindert ist, seine Tätigkeit auszuüben. Der Sachverständige ist daher verpflichtet, die IHK zu unterrichten, wenn er seine (Haupt-) Niederlassung oder seine Wohnung ändert, eine Zweigniederlassung errichten oder ändern will. Im übrigen hat der Sachverständige auch Änderungen seiner Telefon- oder Telefaxnummer und sonstigen Kommunikationsmitteln, die er als Sachverständiger benutzt, mitzuteilen. 19.2 Die Tätigkeit als öffentlich bestellter Sachverständiger muss mit seiner sonstigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit vereinbar sein. Insbesondere dürfen Unparteilichkeit und Unabhängigkeit wegen Interessenkollision nicht beeinträchtigt und seine zeitliche Verfügbarkeit nicht in unzumutbarem Umfang eingeschränkt werden. Deshalb hat der Sachverständige die Änderung der ausgeübten oder die Aufnahme einer weiteren beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit, insbesondere den Eintritt in ein Arbeits- oder Dienstverhältnis oder die Gründung von Zusammenschlüssen (§ 21 MSVO), ebenso den Widerruf einer vom Arbeitgeber bzw. vom Dienstherrn erteilten Freistellung (vgl. 3.6.) anzuzeigen. 19.3 Die Pflicht zur Unterrichtung der IHK erstreckt sich auch auf solche Umstände, die seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder seine persönliche Eignung für die Tätigkeit als Sachverständiger in Frage stellen können. Die IHK ist daher bei eidesstattlichen Versicherungen und Insolvenzverfahren zu informieren. Auch bei Strafverfahren ist die IHK zu unterrichten und über den Stand des Verfahrens auf dem laufenden zu halten. § 20 Auskunftspflichten und Überlassung von Unterlagen 20.1 Auf Verlangen der IHK hat der Sachverständige unverzüglich und auf seine Kosten alle Auskünfte zu erteilen, die erforderlich sind, um Art und Umfang seiner Tätigkeit überwachen zu können. Hierunter fallen auch Tatsachen, die nicht unmittelbar mit Gutachten oder anderen Sachverständigentätigkeiten zusammenhängen. Voraussetzung ist, dass ihre Kenntnis zur Würdigung der besonderen Sachkunde, der Unparteilichkeit, Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und anderer Grundlagen der persönlichen Eignung sowie der Einhaltung der Sachverständigenpflichten erforderlich ist. Dazu gehören z. B. Rahmenverträge über Sachverständigenleistungen über einen längeren Zeitraum, Korrespondenz über Beschwerden, Werbe- und Informationsmaterial, Bestätigungen über Fortbildungsmaßnahmen und Erfahrungsaustausch, Nachweise einer nach Art der versicherten Risiken und Höhe angemessenen Haftpflichtversicherung. 20.2 Der Sachverständige kann diese Auskünfte gemäß § 15 Abs. 3 MSVO nicht mit dem Hinweis auf seine Schweigepflicht verweigern, da die IHK als zuständige Bestellungskörperschaft im Rahmen ihrer Überwachungspflicht über die Sachverständigen zur Einholung dieser Auskünfte berechtigt ist. § 21 Zusammenschlüsse mit Sachverständigen 21.1 Der Sachverständige ist in seiner Wahl frei, in welcher Rechtsform er tätig werden will. Er kann allein, auch in der Rechtsform der GmbH, arbeiten; er kann sich mit anderen Sachverständigen seines oder anderer Sachgebiete in der Rechtsform z. B. der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, der GmbH, der Partnerschaftsgesellschaft zusammentun. Soweit solche Gesellschaften rechtlich verselbständigt sind, werden sie selbst Partner der Verträge über Sachverständigenleistungen. Anderes gilt nur bei gerichtlichen Aufträgen, die sich direkt an einzelne Sachverständige richten. Auch wenn die Sachverständigen-Gesellschaft Vertragspartner für Sachverständigenleistungen wird, ändert sich nichts daran, dass der Sachverständige aufgrund seiner öffentlichen Bestellung verpflichtet ist, für die Einhaltung des Pflichtenkatalogs Sorge zu tragen. Ist das nicht möglich, bleibt ihm nur die Alternative, entweder aus der Gesellschaft auszuscheiden oder auf die öffentliche Bestellung zu verzichten. Gesellschaftsvertrag und sonstige interne Organisationsregeln dürfen die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Sachverständigen nicht gefährden. Eine Gefährdung ist regelmäßig anzunehmen bei fachlichen Weisungsbefugnissen anderer Gesellschafter, kaufmännischer Geschäftsführer, der Gesellschafterversammlung; wenn die Zuweisung eingegangener Aufträge nicht nach einer weitgehend objektivierten Geschäftsverteilung erfolgt. 21.2 Schließt sich ein öffentlich bestellter Sachverständiger mit nicht öffentlich bestellten Sachverständigen zusammen, hängt seine uneingeschränkte fachliche und persönliche Vertrauenswürdigkeit nicht mehr allein von ihm, sondern auch von der Gesellschaft ab. Den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen trifft daher die Verpflichtung, seine Partner auf die Einhaltung solcher Pflichten aus der Sachverständigenordnung zu verpflichten, deren Nichtbeachtung Wirkungen auf seine öffentliche Bestellung haben können. Das sind im Kern z. B. eine jedenfalls vergleichbare Qualifikation, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, die Wahrung der Grundsätze der Höchstpersönlichkeit, eine uneingeschränkte persönliche Eignung und die Schweigepflicht. Nicht einschlägig sind dagegen solche Pflichten, die nur zwischen der IHK und dem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zu Überwachungszwecken bestehen. 21.2.1 Die IHK kann unmittelbar weder auf die Gesellschaft noch auf deren nicht öffentlich bestellte Mitglieder Einfluss nehmen. Dazu fehlt es an rechtlichen Beziehungen. Der öffentlich bestellte Sachverständige muss selbst dafür Sorge tragen, dass die Tätigkeit der anderen Partner seine uneingeschränkte Vertrauenswürdigkeit nicht gefährdet. Gelingt das nicht oder ist aufgrund bestimmter Umstände dieses Vertrauen der Öffentlichkeit zerstört, auch ohne dass der öffentlich bestellte Sachverständige selbst dafür die Verantwortung trägt, kann ein Widerruf der öffentlichen Bestellung in Betracht kommen. 21.2.2 Der Zusammenschluss der Sachverständigen und deren einzelne Mitglieder unterliegen dem gesetzlichen Verbot nach § 3 UWG, über ge- schäftliche Verhältnisse zu täuschen. Eine Täuschung kann auch in der Verschleierung liegen. Die Sachverständigen müssen deshalb klarstellen, welcher einzelne von ihnen welche Art Qualifikation in Anspruch nimmt. Pauschale Bezeichnungen auf gemeinsamen Drucksachen, Briefbögen, Praxisschildern wie z. B. ".. freie, zertifizierte und öffentlich bestellte Sachverständige .... " sind unzulässig. Solche Handhabung betrifft nicht nur das Rechtsverhältnis zwischen dem öffentlich bestellten Sachverständigen und der IHK. Bei Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht kann die IHK unmittelbar gegen die Gesellschaft und die nicht öffentlich bestellten Sachverständigen vorgehen. § 22 Erlöschen der öffentlichen Bestellung 22.1 Die Erklärung des Sachverständigen nach § 22 Abs. 1 Buchst. a) MSVO muss klar und unmissverständlich geäußert werden. 22.2 § 22 Abs. 1 Buchst. b) MSVO korrespondiert mit § 3 Abs. 2 a) MSVO. Daher erlischt die öffentliche Bestellung bei einer Sitzverlegung; der Sitz ist dort, von wo aus der Sachverständige seiner Sachverständigentätigkeit nachgeht (vgl. 17.1). Das muss nicht das Büro seiner sonstigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit sein. Kommt es zu einer Sitzverlegung aus dem Zuständigkeitsbereich der bestellenden IHK, muss der Sachverständige bei der für den neuen Sitz zuständigen IHK erneut einen Antrag auf öffentlich Bestellung stellen, falls er wiederum öffentlich bestellt werden möchte, die ihn im Regelfall erneut öffentlich bestellen und vereidigen wird. Die jetzt zuständige IHK wird von der früher zuständigen die vollständigen Sachverständigenakten anfordern. Wegen des Verfahrens im Einzelnen siehe die Ausführung zu 3.9. 22.3 Auch nach Ablauf einer zeitlich befristeten Bestellung nach § 22 Abs. 1 Buchst. c) MSVO erlischt die Bestellung. Die IHK sollte regelmäßig von sich aus rechtzeitig vor Ablauf der Befristung den Sachverständigen fragen, ob der Sachverständige die Erneuerung der öffentlichen Bestellung wünscht. Er kann dann rechtzeitig einen Verlängerungsantrag stellen. Die IHK ist gegenüber der Öffentlichkeit verpflichtet sicherzustellen, dass ein Sachverständiger während der Dauer der öffentlichen Bestellung z. B. seiner Pflicht zur Weiterbildung nachkommt und über eine ausreichende gerätetechnische Ausrüstung verfügt. Außerdem muss sie wissen, ob auf einem bestimmten Sachgebiet in ausreichender Zahl Sachverständige zur Verfügung stehen. Sie sollte den Sachverständigen an die Notwendigkeit einer ausreichenden Haftpflichtversicherung erinnern. Sie wird deshalb aus Anlass der Verlängerung den Sachverständigen anhand eines vorbereiteten Fragebogens um nähere Angaben zu seiner bisherigen Tätigkeit bitten. Im Einzelnen sollten dies mind. Fragen sein: zu Umfang und Angemessenheit der Haftpflichtversicherung, zur Anzahl der in den vergangenen 5 Jahren erstellen Gutachten (getrennt nach Gerichts- und Privatgutachten), zur technischen Ausrüstung, zur Bearbeitungsdauer, einschl. der Frage, ob Gutachtenaufträge wegen Überlastung zurückgewiesen werden mussten, evtl. Wartezeiten, zu Spezialkenntnissen zur Fortbildung. 22.4 Voraussetzungen der Verlängerung einer aus Altersgründen erlöschenden Bestellung sind die unveränderte physische und psychische Fähigkeit des Sachverständigen, die von ihm verlangten Sachverständigenleistungen innerhalb angemessener Zeit zu erbringen, sowie die unbeeinträchtigte besondere Sachkunde. Sind diese Voraussetzungen zu bejahen, bleibt der Ausnahmefall zu prüfen. Die einmalige Verlängerung kann die in § 2 Abs. 4 MSVO normierte Frist von 5 Jahren deutlich unterschreiten. 22.5 Das Erlöschen der öffentlichen Bestellung wird im Mitteilungsorgan der IHK bekannt gemacht. Auf die Ausführungen zu 7.1 und 7.2 wird verwiesen. 22.6 Mit Erlöschen der öffentlichen Bestellung wird die Vereidigung gegenstandslos. Der Sachverständige darf sich nunmehr z. B. nicht mehr als "vereidigter Sachverständiger" oder als "vormals vereidigter Sachverständiger" u. ä. bezeichnen (vgl. auch 5.3). Auch eine Bezugnahme auf die frühere öffentliche Bestellung ist unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten unzulässig. § 23 Rücknahme, Widerruf 23.1 Die Rücknahme oder der Widerruf einer öffentlichen Bestellung ist eine Ermessensentscheidung. Die IHK muss dieses Ermessen erkennbar ausüben. 23.2 Eine rechtswidrige öffentliche Bestellung kann z. B. zurückgenommen werden, wenn der Sachverständige sie durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren. Beispiele: Der Sachverständige hat die im Antragsverfahren vorgelegten Gutachten nicht persönlich erstattet; er hat gefälschte Zeugnisse oder Nachweise seiner Berufsausbildung vorgelegt; er verschweigt trotz Erklärungsaufforderung Vorstrafen oder Ordnungswidrigkeitenverfah- ren; er erbringt den Nachweis der besonderen Sachkunde vor Fachgremien nicht durch selbst erarbeitete Gutachten. Der Sachverständige kann sich nicht darauf berufen, er habe die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben nicht erkannt, wenn ihm insoweit grobe Fahrlässigkeit anzulasten ist. Der Vertrauensschutz des Sachverständigen in den Fortbestand seiner öffentlichen Bestellung als begünstigendem Verwaltungsakt wird in den §§ 43 ff Verwaltungsverfahrensgesetz des jeweiligen Landes im einzelnen geregelt. 23.3 Die öffentliche Bestellung kann widerrufen werden, wenn die IHK aufgrund nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, die öffentliche Bestellung abzulehnen, und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde. Sie darf die öffentliche Bestellung auch widerrufen, wenn eine mit ihr verbundene Auflage nicht erfüllt worden ist. Die IHK wird also einen Widerruf prüfen, wenn sich nach der Bestellung ergibt, dass der Sachverständige nicht mehr über die erforderliche fachliche und persönliche Eignung verfügt oder seine Einrichtungen nicht mehr den Anforderungen genügen, von denen die Bestellung abhängig war (§ 3 MSVO). 23.3.1 Ein Widerruf kann beispielsweise in Betracht kommen, wenn der Sachverständige Blanko-Gutachtenformulare mit seiner Unterschrift und Stempel Mitarbeitern oder Dritten zur Verfügung stellt, der Sachverständige Straftaten im Zusammenhang oder angelegentlich seiner Sachverständigentätigkeit begeht (Diebstahl während eines Ortstermins). Das können auch Straftaten sein, die nicht in zumindest mittelbarem Zusammenhang mit der Sachverständigentätigkeit stehen. Von Bedeutung ist, ob sie geeignet sind, begründete Zweifel an der persönlichen Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen, z. B. Trunkenheitsdelikte. Bereits bei Einleitung eines Ermittlungsverfahrens kann der Widerruf einer öffentlichen Bestellung geboten sein; die Entscheidung darüber hängt von der Schwere des Strafvorwurfs und der Dringlichkeit des Tatverdachtes ab. der Sachverständige eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO für sich oder einen Dritten abgeben musste und entweder persönlich oder für einen Dritten in das Schuldnerverzeichnis nach § 915 ZPO eingetragen ist, über das Vermögen des Sachverständigen ein Insolvenzverfahren beantragt, eröffnet oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wurde; dasselbe gilt bei einer Gesellschaft, deren Vorstand, Geschäftsführer oder Gesellschafter der Sachverständige ist. Die IHK wird in diesem Fall prüfen, inwieweit der Sachverständige noch über die notwendige Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit verfügt, d. h. die persönliche Eignung noch gegeben ist. der Sachverständige dergestalt unbegründete und nicht nachvollziehbare Gutachten erstattet, dass diese für Auftraggeber oder Dritte nicht verwertbar oder verwendbar sind. 23.3.2 Das Verfahren der IHK zur Prüfung eines Widerrufs wird durch strafrechtliche Ermittlungen weder hinsichtlich des Verfahrensganges noch des Ergebnisses präjudiziert. Strafverfahren und Wiederrufsverfahren orientieren sich an unterschiedlichen Maßstäben. Trotz Einstellung eines Strafverfahrens oder Freispruchs aus Rechtsgründen ist deshalb ein Widerruf der öffentlichen Bestellung nicht ausgeschlossen, wenn begründete Zweifel an der persönlichen Eignung des Sachverständigen nicht ausgeräumt werden können. 23.3.3 Vor einer Rücknahme oder einem Widerruf muss geprüft werden, ob nicht geringere Eingriffe wie z. B. die Erteilung von Auflagen das erforderliche Ergebnis erzielen oder gewährleisten. Die IHK muss prüfen, ob der Widerruf die geeignete, notwendige und nicht außer Verhältnis zum erstrebten Ziel stehende Maßnahme ist. Erklärt sich z. B. der betroffene Sachverständige bereit, für die Zeit eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens bis zur Entscheidung über eine Anklageerhebung die öffentliche Bestellung ruhen zu lassen, bedarf es in diesem Sinne vorerst keines Widerrufs. Es kann auch ausreichend sein, den Sachverständigen auf den Pflichtverstoß hinzuweisen und ihm mitzuteilen, dass im Wiederholungsfall der Widerruf ausgesprochen werden kann. 23.3.4 Die IHK wird In aller Regel prüfen, ob die sofortige Vollziehung des Widerrufs oder der Rücknahme anzuordnen ist. 23.4 Jede Rücknahme bzw. jeder Widerruf ist schriftlich zu begründen. In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Entscheidungsgründe mitzuteilen. Da es sich in beiden Fällen um Ermessensentscheidungen handelt, muss die IHK auch die Gesichtspunkte erkennen lassen, von denen sie bei der Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist. Ihren Bescheid versieht sie mit einer Rechtsbehelfsbelehrung. § 24 Rückgabepflicht von Bestallungsurkunde, Ausweis und Stempel 24.1 Da gemäß § 6 Abs. 1 MSVO Ausweis und Rundstempel im Eigentum der IHK verbleiben, kann sie nach Erlöschen der Bestellung deren Herausgabe verlangen. Die Rückgabepflicht auch für die Bestallungsurkunde folgt im übrigen aus der Bestimmung des Verwaltungsverfahrensgesetzes des jeweiligen Landes, die die Rückgabe von Urkunden und Sachen nach unanfechtbarem Widerruf Rücknahme oder Wirksamkeitsende eines Verwaltungsaktes (Ablauf der öffentlichen Bestellung) regelt. 24.2 Die IHK kann den Anspruch nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrens- oder Vollstreckungsgesetzes des jeweiligen Landes durchsetzen. § 25 Entsprechende Anwendung 25.1 Mit dieser Bestimmung werden die Eichaufnehmer, Messer, Schauer, Stauer, Güterbesichtiger und ähnliche Vertrauenspersonen erfasst (§ 36 Abs. 2 GewO), die auf den Gebieten der Wirtschaft zur Feststellung bestimmter Tatsachen in Bezug auf Sachen und zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Vornahme bestimmter Tätigkeiten öffentlich bestellt werden können. 25.2 Die IHK kann für diesen Personenkreis auch besondere Satzungen erlassen, falls dazu eine Notwendigkeit besteht (z. B. für die Änderung der Altersgrenzen und Ergänzung des Pflichtenkataloges). § 26 Inkrafttreten 26.1 Die Sachverständigenordnung und jede spätere Änderung müssen von der Vollversammlung der IHK als Satzung beschlossen und von Präsident und Hauptgeschäftsführer ausgefertigt werden. Das Inkrafttreten richtet sich nach den für die jeweilige IHK geltenden Vorschriften. 26.2 Neue Bestimmungen gelten grundsätzlich auch für bereits bestellte Sachverständige. Es gibt insoweit keinen Vertrauensschutz. Eine Ausnahme wurde aus Gründen der Rechtssicherheit mit der Einführung der fünfjährigen Regelbefristung (2.4) für bisher unbefristet bestellte Sachverständige gemacht. Insoweit wird für diesen Personenkreis eine Bestandschutzregelung eingeführt.