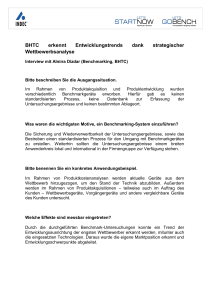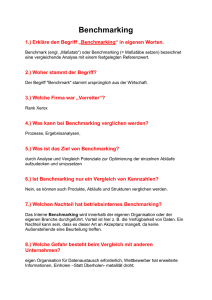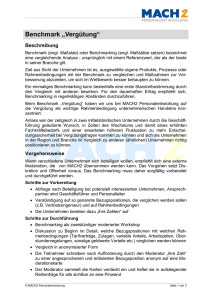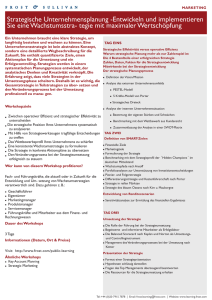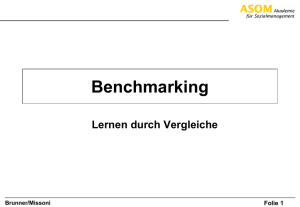Benchmarking - Hochschulkurs
Werbung

Ulrich Schreiterer - CHE Benchmarking1 Seit die Begriffe „Benchmark“ und „Benchmarking“ Mitte der 80er Jahre zum ersten Mal in Managementpraxis und –theorie auftauchten, haben sie auch außerhalb privater Unternehmen und betriebswirtschaftlicher Seminare eine steile Karriere erlebt. Grob gesprochen, handelt es sich beim „Benchmarking“ um ein innovationsorientiertes Management- und Steuerungsinstrument im Spektrum der Total-QualiyManagement Bewegung. Es bezeichnet den Prozess zielorientierter, systematischer Vergleiche von Produkten und Dienstleistungen, Organisationsstrukturen und Geschäftsabläufen zwischen verschiedenen Unternehmen, Organisationen oder Unternehmenseinheiten. Das Wort „benchmark“ stammt aus der Landvermessung und steht dort für Fixpunkte bei Höhen- und Richtungsvergleichen. Ausgehend von der sehr einfachen Überlegung, dass es für jedes Problem, jede Aktivität und jedes Anliegen einer Unternehmung oder Organisationseinheit irgendwo vorbildliche Lösungen gibt, geht es beim Benchmarking zunächst darum, entsprechende „best practises“ aufzuspüren. Sind sie gefunden, können nicht nur Leistungslücken in der dem Benchmarking unterzogenen Organisation aufgedeckt werden. Idealiter sind die Vergleiche vielmehr so angelegt, dass sie auch die Ursachen für Leistungsunterschiede sichtbar machen. Die Identifikation von „best practises“ an Hand geeigneter, problembezogener Schlüsselmetriken steht zwar im Mittelpunkt des Benchmarking. Aber es erschöpft sich nicht darin, auch wenn es vielfach so scheinen mag. Hierin liegt der wesentliche und leider oft übersehene Unterschied zwischen „benchmarks“ und „benchmarking“: Bezeichnen erstere quasi unverrückbare Maßstäbe oder Normen, meint letzteres einen komplexen Prozess. Benchmarking erschöpft sich also nicht in Kennzahlenvergleichen, sondern zielt darüber hinaus, auf eine direkte Steuerungswirkung. Die Organisationen sollen die Information der benchmarks für zielorientierte organisatorische Lernprozesse nutzen. Die daraus gewonnen Anregungen für die Gestaltung der eigenen Praxis sollen aufgegriffen und möglichst konsequent umgesetzt werden, so dass im Ergebnis des Benchmarking-Prozesses eine bessere performance möglich wird. Benchmarking wird damit zu einem „self-improvement tool“ für Organisationen, das dazu beiträgt, diese veränderungssensitiv und lernfähig zu machen: Der Blick über den eigenen Gartenzaun soll konkrete Anhaltspunkte für die Optimierung von Gütern und Prozessabläufen liefern, also stets auf Veränderungen hin ausgerichtet sein. Das sind hohe Ansprüche, die bereits im Entschluss, ein Benchmarking durchzuführen, erst recht aber im Verfahrensdesign ihren Niederschlag finden müssen. Denn recht verstanden ist Benchmarking ein komplexes und aufwendiges Unternehmen, sehr pragmatisch, aber alles andere als trivial. Die Bereitschaft, sich selbst schonungslos „in die Karten schauen zu lassen“, gehört ebenso dazu wie die Bereitschaft, 1 Erschienen in: Anke Hanft (Hrsg.), Grundbegriffe des Hochschulmanagements, Neuwied/Kriftel: Luchterhand 2001, S. 21-25 2 die im Prozess gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Der Anlass, ein Benchmarking durchzuführen, kann daher ein bestimmter Problemdruck oder die bewusste Entscheidung sein, sich mit anderen Organisationen zu messen: Wo stehen wir, wie gut könnten wir sein und wie können wir das erreichen? Benchmarking ist aus der Unternehmenspraxis erwachsen und von Beratungsfirmen aufgegriffen worden. Mit großem Erfolg angewandt hat es erstmals die amerikanische Firma Xerox (Camp,R. 1994). Seither wird es von vielen Großunternehmen in der ganzen Welt genutzt, und zwar sowohl für brancheninterne als auch branchenfremde Vergleiche. Gängige Beispiele für positive Erfahrungen mit diesem Instrument sind die Optimierung von Lagerhaltung und Distributionswegen, der Produktentwicklung und der Produktionsorganisation. Eine theoretische Modellbildung hat das Benchmarking bisher noch nicht erfahren. Nach einer „best practise“ des Instruments zu suchen, wäre wohl auch nicht sinnvoll. Denn es beschreibt einen im Grunde sehr einfachen methodischen Ansatz, verschiedene Bereiche und Aspekte wirtschaftlicher Aktivitäten oder Strukturen von Unternehmen und Organisationen unter ausgewählten Aspekten zu analysieren. Je nachdem, welchem Ziel und welcher sachlichen Materie das Benchmarking dienen soll, wird man deshalb tunlichst unterschiedliche Vorgehensweisen für den systematischen Vergleich wählen müssen. Bewertungsmaßstäbe können nicht ex ante vorgegeben werden, sondern resultieren aus dem Vergleichsprozess. Jede Art von Normierung ist dem Benchmarking fremd. Die Frage, welche konkreten Schlußfolgerungen sich daraus für die eigene Praxis ergeben und welche Maßnahmen für deren Verbesserung zu ergreifen sind, muss jede am Benchmarking beteiligte oder ein Benchmarking durchführende Organisation ohnehin selbst entscheiden. Allerdings lassen sich grundsätzlich zwei verschiedene Objektbereiche und, davon unabhängig, typische Verfahrensschritte eines Benchmarkings ausmachen. Bei den Benchmarking-Objekten unterscheidet man gemeinhin zwischen Produkt- bzw. Kostenbenchmarking auf der einen Seite und einem Benchmarking von Prozessen andererseits. Im Prozessbenchmarking werden quantitative Daten um qualitative Beschreibungen angereichert, indem es Aktivitäten (Aufgaben, Strategien und Prozessabläufe) in Organisationen unabhängig von deren funktionaler Gliederung untersucht. Sein Ziel kann die Vereinfachung und Beschleunigung von Prozessen sein, eine effektivere Aufgabenintegration und damit letztlich doch auch wieder die Reduktion von Kosten und die Optimierung des Ressourceneinsatzes. Am Anfang jedes Benchmarkings steht die Frage, wer oder was zu welchem Zweck miteinander verglichen werden soll. Im ersten Schritt sind daher zunächst einmal die Referenzeinheiten (eine oder mehrere externe, branchengleiche oder branchenfremde oder organisationsinterne Einheiten/Prozesse) auszuwählen und anschließend die Indikatoren zu erarbeiten, die die Untersuchungsmaterie quantitativ (durch Daten und Kennzahlen) oder qualitativ (Schlüsselprozesse) am besten abbilden können. Danach ist zu entscheiden, ob es sich um ein kompetitives oder kooperatives Benchmarking handeln soll. Im ersten Fall will sich eine Organisation oder ein Unternehmen am Beispiel anderer, am Benchmarking selbst aber nicht direkt beteiligter Einrichtungen messen. Beim kooperativen Benchmarking hingegen arbeiten unterschiedliche Einrichtungen auf gleichberechtigter Basis zusammen und tauschen vertraulich Daten und Informationen aus, die von speziellen Projektteams zusammengesucht und aufbereitet werden. 3 Typologisch lassen sich in der Kombination dieser Merkmale (extern/intern; quantitativ/qualitativ; kompetitiv/kooperativ; branchenintern/branchenfremd) 16 verschiedene Benchmarking-Methoden unterscheiden. Alle haben jeweils charakteristische Stärken und Schwächen, was zeigt, wie notwendig es ist, das Verfahren sorgfältig auf die damit verfolgten Ziele und die unterschiedlichen Objektbereiche hin abzustimmen. Überhaupt hängt der Ertrag und damit der Erfolg eines Benchmarking wesentlich davon ab, dass es gelingt, „passende“ Vergleiche und Analysekriterien zu finden. Dies ist umso mehr zu betonen, als es alles andere als einfach ist, Ziele, Leistungen und Geschäftsabläufe unterschiedlicher Organisationen tatsächlich vergleichbar zu machen und „unverzerrt“ zu bewerten. Das Benchmarking im engeren Wortsinne umfaßt schließlich die Sammlung und Aufbereitung dieser Daten/Informationen, die vergleichende Beschreibung und Bewertung unterschiedlicher Leistungsprofile und die Bestimmung von „best practises“. Genauso wichtig ist allerdings parallel dazu die Bestimmung der Leistungs- bzw. Zielerreichungslücken zwischen der erwiesenen „best practise“ und den anderen Untersuchungseinheiten sowie deren Rückführung auf bestimmte Faktoren. Abgerundet wird das Verfahren schließlich durch Maßnahmen, die die Organisationen oder Unternehmen zu besseren Problemlösungen befähigen sollen. Damit sollte bereits deutlich geworden sein, dass Benchmarking ein flexibler, prinzipiell offener und iterativer Prozess ist. Im Bereich öffentlicher Verwaltungen und Dienstleistungen hat Benchmarking bislang zwar noch keine große Rolle gespielt. Dennoch gibt es auch dort deutliche Tendenzen, dieses Instrument zu nutzen. So zielten zum Beispiel einige jüngsthin von der Bertelsmann-Stiftung durchgeführte Referenzprojekte darauf ab, Strukturen und Prozesse in der Kommunal- und Finanzverwaltung mit Hilfe systematischer Leistungsvergleiche transparenter, kundennäher und effizienter zu gestalten. Ähnliche Anliegen verfolgen auch verschiedene Netzwerke von Schulen und öffentlichen Bibliotheken. Seit Anfang der 90er Jahre gab es zuerst in den USA, dann aber auch in Europa verschiedene Benchmarking Projekte im Hochschulbereich. Dafür haben sich kooperativ-externe Verfahren in geschlossenen Clubs auf der Basis freiwilliger Mitgliedschaft als besonders geeignet erwiesen. Standen in den USA zunächst strikte Kosten-Benchmarkings hochschulspezifischer Dienstleistungen und Geschäftsabläufe im Vordergrund, sind es in Europa heute vor allem qualitative Prozesse und Organisationsstrukturen: Strategisches und operatives Hochschulmanagement (CHEMS/ESMU), Mittelverteilung, Ressourcenmanagement und Controlling-Modelle (BMC des CHE), Studienprogramme und Management Informationssysteme (European Consortium of Innovative Universities). Demgegenüber spielen die Kerngeschäfte Lehre und Forschung bisher eine nur sehr untergeordnete Rolle. Die Quality Assurance Agency in Großbritannien (QAA) ist mit ihrem Versuch gescheitert, durch ein Benchmarking bestimmte inhaltliche Standards für Studienprogramme zu ermitteln. Allerdings ist dieser Versuch auch wiederum ein gutes Beispiel dafür, dass sich Benchmarking keinesfalls zur Durchsetzung politisch definierter Normen im Hochschulbereich eignet, sondern nur als Instrument in den Händen des Hochschulmanagements wirkungsvoll sein kann. 4 Fazit Benchmarking dient der Selbstbeobachtung und vor allem der Selbststeuerung von Organisationen. Indem es ihre Stärken und Schwächen ausleuchtet, trägt es zweifellos dazu bei, die Leistungsfähigkeit und Effektivität der einzelnen Hochschulen in einem wettbewerblichen Hochschulsystem zu verbessern. Die aktive Rolle, in der jeder Beobachter zugleich Beobachteter ist, unterscheidet das Benchmarking zugleich auch klar von anderen Arten der vergleichenden Datenerhebung im Hochschulbereich. Für die Organisationskultur autonomer, eigenverantwortlicher Hochschulen sollte es daher zu einem selbstverständlich genutzten Steuerungsinstrument werden. Literatur Bandemer, Stephan von: Benchmarking, in: Blanke, B. u.a. (Hrsg.), Handbuch zur Verwaltungsreform. Opladen 1998, S. 362-369 Camp, Robert C.: Benchmarking. München/Wien 1994 Housley, John: Benchmarking – is it worth it?, in: Perspectives: Policy and Practice in Higher Education 3.1999, S. 74 – 79 Lamla, Joachim: Prozessbenchmarking. München 1995 UNESCO (Hrsg.): Benchmarking in Higher Education. A Study conducted by the Commonwealth Higher Education Management Service, Paris 1998 (New Papers on Higher Education Studies and Research No. 21) Yorke, Mantz: Benchmarking Academic Standards in the UK, in: Tertiary Education and Management 5. 1999, S. 81-96 Websites: http://sme.belgium.eu.net/esmu/activities/strategic/esmuchems.htm http://www.qaa.ac.uk/public/hq/hq4/bench.htm http://www.detya.gov.au/archive/highered/otherpub/Execsumbench.htm