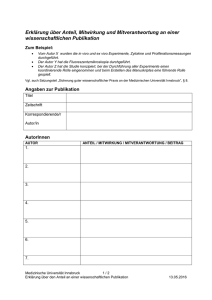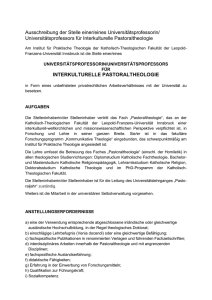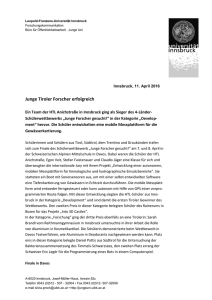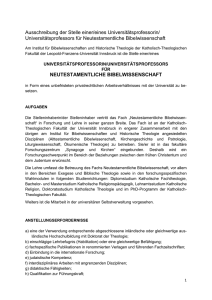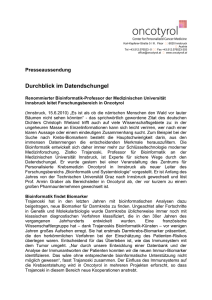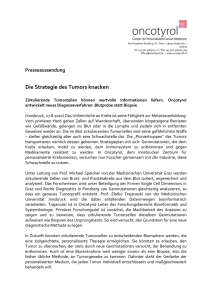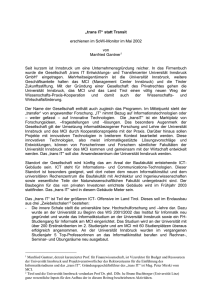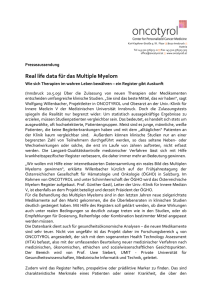100 Jahre Alte Geschichte
Werbung

100 JAHRE ALTE GESCHICHTE IN INNSBRUCK Franz Hampl zum 75. Geburtstag Herausgegeben von REINHOLD BICHLER 2 INHALTSÜBERSICHT Seite Zum Geleit.......................................................................................................................... I. Beobachtungen zu Traditionen und individuellen Schwerpunkten in der Innsbrucker althistorischen Forschung und Lehre (verfaßt von Peter W. Haider) 3 5 II. Die vier Fachvertreter der ersten hundert Jahre Innsbrucker althistorischer Forschung und Lehre 1. Rudolf von Scala (verfaßt von Godehard Kipp)........................................... 11 2. Carl Friedrich Lehmann-Haupt (verfaßt von Günther Lorenz).................... 23 3. Franz Miltner (verfaßt von Christoph Ulf)................................................... 35 4. Franz Hampl (verfaßt von Ingomar Weiler)................................................. 45 III. Franz Hampls Wirken und die jüngere Forschung am Innsbrucker Institut für Alte Geschichte (verfaßt von Reinhold Bichler)............................................. 58 IV. Schriftenverzeichnis (mit Bibliographie der Schüler Franz Hampls)............. 71 3 ZUM GELEIT Jubiläen zu feiern gehört zum festen Ritual etablierter Gesellschaften, vom Gedenken im privaten Kreis bis hin zum Staatsakt. Wir wollen doch zeigen, wer wir sind, wollen wissen, manchmal auch verdrängen, woher wir kommen, wollen uns Mut machen für die Zukunft. Auf akademischem Boden haben solche Gedenkfeiern seit jeher ihren festen Platz. So gilt es - trotz des leisen Bedenkens, daß sich Nostalgie gerade dort gerne einstellt, wo der Blick in die Zukunft auch bange macht - die hundert Jahre festlich zu begehen, die unsere Alte Geschichte nunmehr an der Innsbrucker Alma Mater als eigenständiges Fach besteht, eine Bilanz über Forschung und Lehre dieser Ära zu ziehen und der Gelehrten zu gedenken, die ihrer Disziplin hier in Innsbruck Namen und Ansehen zu geben wußten. Nun trifft sich dieses Hundertjahrgedenken mit dem 75. Geburtstag von Franz Hampl, der die ganzen langen Jahre von 1947 bis 1982 die Geschicke des Althistorischen Instituts geleitet hat. Das gab meinen Mitarbeitern und mir den entscheidenden Anstoß, diese Jubiläumsschrift zu gestalten. Hampls wissenschaftliche Verdienste bedürfen keiner rechtfertigenden Worte und reichen weit über Österreich hinaus. Sein ungebrochenes Engagement in der Lehre, das sich in den letzten Jahren zunehmend der Erwachsenenbildung verschrieben hat, ließ ihn für nahezu zwei Generationen von Geschichtslehrern an unseren Höheren Schulen und für zahllose Freunde der Alten Kulturen zu einer äußerst markanten Persönlichkeit werden. So darf ich ihm hier nicht nur namens seiner Kollegen und Schüler im engeren Sinne, sondern auch namens ungezählter Hörer, Vortragsbesucher und Reiseteilnehmer danken, denen er tiefe Eindrücke und Erfahrungen im Umgang mit den Alten Kulturwelten wie im Blick auf unsere Gegenwart geschenkt hat, unermüdlich auf kritische Urteilskraft bedacht. Der Stellung unserer Landesuniversität entsprechend galt und gilt Hampls Wirken in einem ganz besonders intensiven Maß auch den bildungspolitischen Anliegen Südtirols und Vorarlbergs, Länder, denen er ja auch durch seinen Lebensweg engstens verbunden ist. Ich freue mich, daß die Träger der bildungspolitischen Institutionen in der Stadt Innsbruck und den Ländern Tirol und Vorarlberg auch in Würdigung dieser seiner Wirksamkeit die ihm gewidmete Jubiläumsschrift großzügig gefördert haben. Mein herzlicher Dank gilt daher den Herren Landeshauptleuten Dr. Herbert Kessler und Dr. Fritz Prior sowie Herrn Bürgermeister Romuald Niescher. Ohne alle Umschweife haben sie sich mit ihren Mitteln in den Dienst der Sache gestellt. Nicht nur den gewählten, mit politischem Mandat betrauten Kulturgewaltigen möchte ich hier meinen aufrichtigen Dank aussprechen, sondern auch den entsprechenden Förderern und Förderinnen in den Kulturämtern: Frau Hofrat Dr. Viktoria Stadlmayr, die mit Herrn Dr. Robert Gismann zusammen im Amte der Tiroler Landesregierung die Verdienste Professor Hampls um die Südtiroler Bildungspolitik honorierte, Herrn Hofrat Dr. Ernst Eigentler, der mit Herrn Dr. Christoph Mader in der Kulturabteilung der Tiroler Landesregierung an der Förderung unserer Schrift wirkte, Herrn Dr. Reinhold Bernhard, der sich für uns im Kulturreferat des Landes Vorarlberg bemüht hat, und Frau Senatsrat Dr. Gertrude Donath im Kulturamt der Stadt Innsbruck. Neben der finanziellen Hilfe sei auch der anderweitigen Unterstützung bei der Herausgabe dieser 4 Jubiläumsschrift ein herzliches Dankeswort ausgesprochen. Herr em. Univ.-Prof. Dr. Franz Huter ermöglichte liebenswürdigerweise ihre Aufnahme in die Forschungen zur Innsbrucker Universitätsgeschichte, eine Reihe innerhalb der Veröffentlichungen der Universität Innsbruck, die Frau Dr. Friederike Maier-Böttcher in bewährten Händen hält. Selbstlos stand Herr Univ.-Prof. Dr. Gerhard Oberkofler im Universitätsarchiv wiederholt mit Rat und Tat bei der Genese dieser Schrift helfend zur Seite. Um die sorgfältige Erarbeitung der vorgelegten Bibliographien schuf sich unsere langjährige Institutsbibliothekarin Frau Eva Maria Pyrker nicht geringe Meriten. Dank gebührt auch Herrn Univ.-Prof. Dr. Hermann Ölberg, der uns die Herstellung des Schriftsatzes auf Geräten der Redaktion am Institut für Sprachwissenschaft und dabei vor allem die exzellente Betreuung der Typoskripte durch Frau Barbara Stefan vermittelte. Ohne Namensnennung danke ich zuletzt den Schreibkräften an unserem Institut und den Kollegen und Mitarbeitern, die die lenkende Hand des Herausgebers zu spüren hatten, für ihre Geduld. Freilich sollte einer aus ihrem Kreis doch noch eigens genannt werden: Herr Doz. Dr. Peter W. Haider regte als erster dazu an, das Hundertjahrjubiläum unseres Faches durch eine Festschrift zu feiern. Möge diese Jubiläumsschrift ein bleibendes Stück wissenschaftsgeschichtlicher Forschung werden und als Zeichen des Dankes für alle, die vor uns am Innsbrucker Institut für Alte Geschichte gewirkt haben, eine geneigte Leserschaft finden. Reinhold Bichler 5 Beobachtungen zu Traditionen und individuellen Schwerpunkten in der Innsbrucker althistorischen Forschung und Lehre Die Universität Innsbruck war die letzte im deutschsprachigen Raum, an der der historische Abschnitt der ‚Alten Geschichte‘ aus der Gesamtgeschichte ausgegliedert und als eigenständiges Fach in Lehre und Forschung eingerichtet worden war. Dies geschah im Jahre 1885 durch die Ernennung des gebürtigen Wieners Rudolf von Scala zum Privatdozenten für besagtes Fach. Ihm war schließlich mit Jahresbeginn 1897 die ordentliche Professur für Alte Geschichte verliehen worden. Ein weiterer Schritt zur Emanzipation dieses Faches erfolgte dann im Jahre 1901 mit der Einrichtung eines „Archäologischen und epigraphischen Seminars“, das eine Art Vorstufe zu dem erst seit dem Wintersemester 1937 unter Franz Miltner eingerichteten „Institut für Alte Geschichte“ darstellte. In seiner Ägide erhielt das Institut auch den ersten Assistentenposten zugewiesen, während bis dahin alle an einer wissenschaftlichen Karriere interessierten Doktoren ihren Lebensunterhalt durch die Ausübung eines Zweitberufes, z.B. als Mittelschullehrer, zu bestreiten gezwungen waren. Trotz der Ernennung Heinrich Sittes zum Extraordinarius für Archäologie (1912) bekleidete Rudolf von Scala allein das Amt der Vorstandschaft am Archäologisch-epigraphischen Seminar. Seit der Berufung des schon international bekannten Althistorikers Carl Friedrich Lehmann-Haupt aus Konstantinopel nach Innsbruck (1918) fungierten dann beide Professoren als Vorstände. Wenn man die nun schon 100 Jahre währende Forschung und Lehre zur Alten Geschichte an der Innsbrucker Universität überblickt, so fällt einem fürs erste auf, daß in dieser Zeit nur vier Professoren, darunter ein Nichtösterreicher, wirkten; mit anderen Worten: jedem dieser Ordinarii war eine relativ lange Zeit des Wirkens am Innsbrucker Lehrstuhl beschieden. Weiters darf der Umstand als bemerkenswert gelten, daß in diesem langen Zeitraum nur wenig mehr als 20 Studenten eine Dissertation in diesem Fach verfaßt haben, aber immerhin 6 Doktoren nach ihrer Habilitation einen Lehrstuhl erhielten: Fritz Schachermeyr und der Grieche Johannes Papastavrou als Schüler LehmannHaupts, Karl Völkl, der bei Miltner dissertiert und sich in der Ära F. Hampls habilitiert hatte, in Salzburg, sowie Fritz Gschnitzer in Heidelberg, Ingomar Weiler in Graz und Reinhold Bichler, der derzeitige Inhaber des Innsbrucker Lehrstuhls für Alte Geschichte. Diese drei Letztgenannten dürfen als Schüler Franz Hampls gelten. Dies zeigt auch schon die nachhaltige Wirkung der Lehrtätigkeit Lehmann-Haupts und Hampls, wobei allerdings erst letzterer eine „Schule“ im engeren Sinne, nämlich die der vergleichenden Betrachtung früher Hochkulturen in universalhistorischer Sicht in Innsbruck begründet hat. Während der 65 Semester von 1885 bis 1917, als R. v. Scala einem Ruf nach Graz folgte, vermochte er seine Studenten, die - wie auch heute noch - in überwiegender Anzahl Lehramtskandidaten waren, durch seinen mitreißenden Vortrag für sein Fach zu begeistern. Dies lag nicht allein an seinem rhetorischen Talent, sondern zweifellos auch in seinem weiten Interessens- und Wissenshorizont begründet, von dem die Hörer entsprechend profitierten. So zeigen einerseits seine Schriften und andererseits sein damaliges Vortrags- wie Lehrprogramm, daß er die einzelnen 6 geographischen Räume bzw. Kulturvölker vom Vorderen Orient über Griechenland, Rom und Byzanz bis zu den Illyrern, Kelten und Germanen von der Urgeschichte an bis zumindest ans Ende der Antike behandelte. In seinen zwei publizierten Gesamtdarstellungen der griechischen Geschichte - jeweils unter dem Titel „Das Griechentum“ - führte er eine sogar bis ans Ende des 19. Jahrhunderts. Für Innsbrucker Verhältnisse geradezu als revolutionär darf dabei die starke Betonung des entwicklungsgeschichtlichen Gedankens bezeichnet werden, der faktisch zu der Erkenntnis führt, daß die griechische Kultur ihre höchsten Leistungen allemal im Zeitraum des sogenannten „Hellenismus“ erbracht hatte. Der ursprüngliche, von R. v. Scala stammende Titel für seine Gesamtdarstellungen ,,Entwicklungsgeschichte des griechischen Volkes bis zur Kaiserzeit“ darf als stellvertretend für seine Art, wohl auch die anderen antiken Völker zu betrachten, gelten. Damit hatte R. v. Scala eine Tradition eröffnet, der von seinem Nachfolger Lehmann-Haupt zumindestens insofern in den Lehrveranstaltungen seines achtsemestrigen Zyklus‘ über „Allgemeine Geschichte des Altertums“ Rechnung getragen wurde, als er die Kulturen des Alten Orients und jene der ägäischen und italischen Welt synchron behandelte. Nach dem Tode Lehmann-Haupts riß diese breitgefächerte und entwicklungsgeschichtlich ausgerichtete Behandlung der Alten Geschichte unter dem aus Wien kommenden Franz Miltner (1934-1945) aber ab. Darüber hinaus berücksichtigte Miltner auch die Kulturen des Alten Orients nur mehr am Rande. So hielt er nur noch einmal eine Vorlesung über Ägypten und referierte zweimal über die Hethiter. Die Zyklusvorlesungen gab er gänzlich auf. Daß damit für die Studenten wie für Dissertanten am Institut eine erhebliche Einengung des historischen Problemverständnisses und der Sachinformation verbunden war, versteht sich bei Miltners starker Fixierung einerseits auf griechisch-römische Kriegsgeschichte mit Schwerpunkt auf dem Seewesen und andererseits auf römisch-germanische Beziehungen von selbst. Erst unter Franz Hampl (1947-1981) sollte die entwicklungsgeschichtliche Betrachtung aller frühen Hochkulturen der Alten und schließlich auch der Neuen Welt in Innsbruck eine Neubelebung in Lehre und Forschung von bisher noch nicht dagewesenem Ausmaß erfahren. Dies läßt sich auch an seiner entsprechenden Reisetätigkeit und schließlich an einschlägigen Exkursionen ablesen. R. v. Scala hatte sich, trotz seiner Erkenntnis vom Wandel der Geschichte, noch nicht vom statischen Klischeebild des „griechischen“, des „römischen“ und des ,,germanischen Wesens“ zu trennen vermocht. Trotz dieses inneren Widerspruchs sichert ihm seine grundsätzlich wichtige Einsicht in die evolutionären Vorgänge in der Geschichte unsere Anerkennung. Aus dem geographisch wie zeitlich weit gespannten geistigen Rahmen R. v. Scalas heraus versteht sich auch seine Beschäftigung mit den „wichtigsten Beziehungen des Orients zum Occidente im Alterthum“ wie „in Mittelalter und Neuzeit“. Daß er auch mit dieser Thematik bei seinen Hörern Anklang fand, zeigt u. a. die Dissertationsarbeit von Anton Wolf über „Griechische und ägyptische Elemente in der Kultur der Ptolemäer“ (1904). Nahtlos führte dann Lehmann-Haupt die Diskussion um die Frage nach der Form und der Intensität der Beziehungen zwischen dem ägäischen Raum und den Kulturen des Vorderen Orients vom 3. bis ins l. Jahrtausend v. Chr. hauptsächlich in seinen historischen Übungen und Vorlesungen weiter. So erstaunt es nicht, wenn sein ihm persönlich 7 nahestehender Schüler Fritz Schachermeyr, den er nach Innsbruck gerufen hatte, dieses Thema in seiner Dissertation „Ägäis und Vorderasien in ihren Beziehungen zu Ägypten“ (1921) auf dem damaligen Wissensstand aufarbeitete. Schachermeyr sollte es auch sein, der die bisherige Innsbrucker Tradition, im Rahmen der Alten Geschichte auch die Kulturen des Alten Orients und ihre vielseitigen Beziehungen untereinander wie speziell diejenigen zur ägäischen Welt der Bronze- und Eisenzeit in Forschung und Lehre zu berücksichtigen, weitertrug und schließlich an das Wiener Institut verpflanzte, während der 1933 als Nachfolger Lehmann-Haupts aus Wien berufene Franz Miltner die bisherige Innsbrucker Tradition auch in dieser Hinsicht nicht fortsetzte. Was an historischen Problemen der ägäischen Vor- und Frühgeschichte bei R. v. Scala noch im weiteren Rahmen seiner Darstellung zur griechischen Geschichte und in dem der „Umrisse der ältesten Geschichte Europas“ inkludiert besprochen worden war, hatte sich bei Lehmann-Haupt im ersten Teil seiner Zyklusvorlesung wie auch in einer einschlägigen Lehrveranstaltung über „Die kretischhelladisch-mykenische Kultur: ihre Grundlagen, ihre Beziehungen und ihr Ausgang (mit Lichtbildern und Dokumentation)“ bereits zu einem speziellen Anliegen in Lehre und Forschung entwickelt - eine Thematik, über die sich F. Miltner nur ein einziges Mal, nämlich im WS 1935/36 unter dem Titel „Frühgeschichte der ägäischen Welt“, zu referieren gedrängt sah. Die methodischen und sachlichen Mängel der bis dato herrschenden Theorie, in den Trägern der mittel- und späthelladischen Kultur auf dem griechischen Festland bereits die historisch griechischen Stämme (ausgenommen die Dorer) zu sehen, aufzeigend, setzte sich dann Franz Hampl mit dem besagten Thema wieder besonders intensiv und klärend auseinander. Kehren wir zurück zu R. v. Scala. Dieser legte regelmäßig in seinen Lehrveranstaltungen auch ein besonderes Gewicht auf die Sozialgeschichte. Ein Schwerpunkt, der u.a. auch in einem so interessanten Kapitel wie „Polybios und die Frauen“ im l. Band seiner Polybios-Studien greifbar wird und der in der Dissertationsarbeit seines Schülers Heinrich Rohn über die ,,Öffentliche Wohltätigkeit bei den Griechen“ (1904) wissenschaftliche Früchte trug. Die damals pionierhafte Leistung, der Sozialgeschichte einen entsprechenden Stellenwert in der Lehre einzuräumen, sollte unter den Nachfolgern R. v. Scalas auf dem Innsbrucker Lehrstuhl jedoch erst in allerjüngster Zeit wieder eine schwerpunktmäßige Fortführung in den Lehrveranstaltungen I. Weilers (bis zu dessen Berufung nach Graz im Jahre 1976) und dann R. Bichlers finden. Ähnlich liegen die Dinge in der Frage, wie weit andere Bereiche der Sozialgeschichte zu behandeln seien. Verfassungsgeschichte, Staatslehre, Völkerrecht und Wirtschaftsgeschichte sind Themen, die R. v. Scala selbst auch in schriftlicher Form behandelt hat. Es sei nur an sein Werk über die „Staatsverträge des Altertums“ im Zeitraum von den Kulturen des Alten Orients bis zum Jahre 338 erinnert. Zudem widmete sich einer seiner Schüler, Emmerich Pillewitzer, in der Doktorarbeit Fragen der Verwaltung und Wirtschaft im Ptolemäerreich („Die Zivilbeamten im Reich der Ptolemäer“, 1904). Aus der Ära Lehmann-Haupts kann in diesem Zusammenhang allenfalls nur auf die Dissertation von Edith Tabarelli-Holzer verwiesen werden, die sich mit der „Diözese Illyrium (sic!) von Diokletian 8 bis zum Untergang des weströmischen Reiches“ (1921) beschäftigt hat. Verfassungsfragen, Staatsverträge und rechtliche Verhältnisse fanden schließlich in den Lehrveranstaltungen Franz Hampls wieder ihren angestammten Platz. Dieser Thematik hatte F. Hampl schon in seiner Leipziger Zeit Arbeiten wie z.B. über das Königtum bei den Makedonen, über die lakedämonischen Periöken, die griechischen Staatsverträge im 4. Jh. v. Chr. und dann in Innsbruck seine Analysen der Karthagerverträge gewidmet. Nicht zufällig blieb derartigen Fragestellungen auch sein erster Innsbrucker Schüler F. Gschnitzer in gewissem Ausmaß bis heute treu, indem er über die Gemeinden Vorderasiens zur Achämenidenzeit, über die Stellung abhängiger Orte in Griechenland, über griechische Stammstaaten und Staatsverträge arbeitete. Hampls Hinwendung zur vergleichenden Behandlung früher Hochkulturen in universalhistorischer Sicht, die erst im Verlauf der 60er Jahre erfolgte, gewann dem Institut dann innerhalb kurzer Zeit vier Dissertanten und den Grazer Assistenten I. Weiler. Ein Thema, das - wiederum abgesehen von F. Miltner - von allen bisherigen Innsbrucker Lehrkanzelinhabern in Theorie und Praxis der Alten Geschichte behandelt wurde, stellt die Frage dar, wie weit einer sagen- (bzw. märchen-)haften und mythischen Überlieferung ein historischer Kern innewohnt oder nicht. R. v. Scala, der diesen fraglichen Kern noch als „historischen Hintergrund“ definierte, analysierte dabei nicht allein das einschlägige Erzählgut der Griechen und Römer, sondern zog dafür in vorbildlicher Weise auch dasjenige der Ägypter, Mesopotamier, Perser, Inder und Chinesen mit heran. Diese vergleichende Sicht ermöglichte ihm auch bereits grundsätzlich wichtige Einsichten über die Gattung „Sage“ zu gewinnen, wenn er sich von der Vorstellung, jede derartige Überlieferung müsse einen historischen Kern besitzen, letztlich auch nicht zu trennen vermochte. Gleiches gilt für Lehmann-Haupt, der aber im Gegensatz zu R. v. Scala nie in so umfassender Weise Sagenforschung betrieben hat. Auch hier greift erst wieder Franz Hampl das Thema „Mythos - Sage Märchen“ einerseits in universalhistorisch-vergleichender Sicht und andererseits im speziellen Fall der Ilias auf, um mit aller Eindringlichkeit im Methodischen wie im Sachlichen darzulegen, daß keineswegs jeder derartigen Überlieferung ein historischer Kern zugrunde liegen muß. Wohl aber flössen in die betreffenden Erzählungen im Laufe der langen Überlieferungszeit Elemente der geistigen und materiellen Kultur verschiedener Epochen mit ein, die man als Teile eines jeweiligen “Hintergrundes“ bezeichnen darf. R. v. Scala und F. Hampl verbinden des weiteren Fragen zur Geschichtstheorie. War es ein Anliegen des ersteren, außer den individuellen Faktoren auch die wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und sittlichen Wirkkräfte in der modernen Geschichtsschreibung entsprechend berücksichtigt zu sehen, so lag es letzterem am Herzen, gegen die Tendenz, in allen historischen Belangen nur noch gesellschaftliche Ursachen geltend zu machen, den Anteil der individuellen Triebkräfte, Wünsche, Motive bzw. der geistigen und künstlerischen Leistungen in der Geschichte herauszustellen. Alle Innsbrucker Althistoriker verbindet dagegen die Einsicht, wie erkenntnisreich Studienreisen für den Historiker sind. Wissen wir von v. Scala, daß er Italien, Griechenland, Kleinasien, Nordafrika und vielleicht auch Persien bereist hat, und können wir feststellen, daß Lehmann-Haupt Griechenland, 9 Kleinasien und besonders Armenien bestens kannte und daß Miltner die antiken Zeugnisse in Italien, Griechenland und in der westlichen Türkei persönlich studierte, so war es F. Hampl vergönnt, außer dem heutigen Gebiet Rotchinas und Schwarzafrikas fast alle Länder ehemaliger Hochkulturen in der Alten wie in der Neuen Welt aus eigener Anschauung kennenzulernen. Darüber hinaus betrachtete es dieser auch stets für seine Pflicht, den Studenten durch regelmäßig angebotene (und stets ausgebuchte) Exkursionen die persönliche Kenntnis der wichtigsten antiken Stätten in Italien und Griechenland, gelegentlich auch solcher über diesen geographischen Raum hinaus, sowie der großen europäischen Museen zu vermitteln. Quellenkritische Studien sind ein weiterer Bereich, in dem sich R. v. Scala, Lehmann-Haupt und F. Hampl die Hände reichen, wobei sich bei v. Scala und bei Hampl zudem eine fast identische Auswahl an Autoren, nämlich besonders Polybios, Diodor und Livius, findet und sich folglich auch beide mit der Frage des Ausbruchs des l. Punischen Krieges befaßten. In der Beschäftigung mit Alexander d. Gr. und seinem Königtum läßt sich zudem eine Linie von Miltner über Hampl zu R. Bichler ziehen, der sich in seiner Habilitationsschrift mit der grundsätzlichen Frage, was unter „Hellenismus“ verstanden zu werden pflegt, kritisch auseinandersetzte. Was jedoch allen genannten Inhabern des Innsbrucker Lehrstuhls für Alte Geschichte gemeinsam eigen war und auch noch weiterhin ist, stellt, wie - soweit noch greifbar - von ehemaligen Hörern immer wieder betont wird, die Fähigkeit dar, in den Lehrveranstaltungen nicht nur frei zu sprechen, sondern auch einen lebendigen und zudem sachlich-kritischen bis polemischen Vortrag zu bieten. Nach der Jahrhundertwende bereicherten in zunehmendem Ausmaß auch Lichtbilder die verschiedenen Lehrveranstaltungen. Nachdem hier nun versucht worden war, Gemeinsamkeiten und Traditionen im Innsbrucker Althistorischen Institut aufzuzeigen, sei abschließend noch auf besondere individuelle Schwerpunkte und Leistungen der Innsbrucker Althistoriker zwischen 1885 und 1981 verwiesen. Für R. v. Scala darf man hier seine Gesamtdarstellungen zur Griechischen Geschichte nennen - eine Tradition, an die erst I. Weiler wieder anknüpfte - und seine unvollendete Römische Geschichte, das Thema „Bevölkerungsprobleme Altitaliens“ und Fragen zur Provinzialgeschichte Rätiens hinzuzählen. Bei Lehmann-Haupt, dem einzigen Nichtösterreicher auf dem Innsbrucker Lehrstuhl, der sich bereits durch seine Tätigkeit in Liverpool, Oxford und Konstantinopel einen internationalen Namen gemacht hatte, muß auch nach seiner Armenienexpedition in den Jahren 1898 bis 1900 seine weitere wissenschaftliche Auswertung derselben, vor allem die Erstellung des Corpus Inscriptionum Chaldicarum, in der Innsbrucker Zeit genannt werden. Im Rahmen der epigraphischen Abteilung des von ihm zu betreuenden archäologisch-epigraphischen Seminars hielt Lehmann-Haupt regelmäßig Übungen an griechischen und lateinischen Inschriften in Originalen und Nachbildungen ab. Zwar maß F. Miltner im Rahmen seiner Lehrveranstaltungen der Epigraphik noch immer eine größere Bedeutung zu, doch wurde diese Hilfswissenschaft unter ihm und den Nachfolgern nicht mehr mit jener Intensität betrieben wie unter seinem Vorgänger. Was Franz Miltner betrifft, so litt seine Forschung zum antiken Seekriegswesen an einer einseitigen Überschätzung in bezug auf die damaligen politischen 10 Auswirkungen desselben. Sein Bild der Spartaner wie der Germanen, wobei er letzteren nicht weniger als zehn von zweiundzwanzig Seminaren gewidmet hat, sollte gemäß dem nationalsozialistischen Zeitgeist, der sich auch in seinen Schriften zu diesem Thema wiederfindet, seinen Hörern „Vorbild und Mahnung“ sein. Miltners bleibendes Verdienst liegt jedoch in seiner umfangreichen Grabungstätigkeit. Sowohl für die Erforschung der Vor- und Frühgeschichte auf österreichischem Boden in Imst, Wilten, Vill bei Innsbruck wie in Aguntum und in Lavant in Osttirol als auch für seine gediegenen archäologischen Arbeiten in Ephesos gebührt ihm nachhaltige Anerkennung. F. Hampls Lehre und Forschung war geprägt von einer stets kritischen Auseinandersetzung mit Quellen und ihrer Auswertung in der Sekundärliteratur des eigenen Faches, die ihren Schwerpunkt stets im grundsätzlich Methodischen besaß. Hinzu kam die universalhistorisch vergleichende Arbeit, die sich besonders im Bereich der Religionsgeschichte wie in der Mythen- und Sagenforschung als außerordentlich ertragreich erwies. Und nicht zuletzt zeichnete sein Lehrangebot die konsequente Berücksichtigung der Geistes- und Kulturgeschichte bei den von ihm behandelten Kulturen aus. Daß darüber hinaus außer einem reichen Exkursionsangebot in seinem Vortrag allenthalben aktuelle Bezüge zur Zeitgeschichte geboten wurden, sicherte ihm stets volle Hörsäle. Damit glauben wir die nachweisbaren Traditionen und die wichtigsten individuellen Schwerpunkte in der nun hundert Jahre währenden althistorischen Forschung und Lehre an der Universität Innsbruck skizziert zu haben. Der an weiteren Einzelheiten zur Tätigkeit der jeweiligen Lehrstuhlinhaber interessierte Leser möge diese den folgenden Abschnitten dieser Festschrift entnehmen. Peter W. Haider 11 Rudolf von Scala Als mit Erlaß des Ministeriums für Cultus und Unterricht in Wien vom 25.6.1885 der Beschluß der philosophischen Fakultät der Universität Innsbruck vom 6.5. desselben Jahres, Herrn Dr. Rudolf von Scala als Privatdozenten für Alte Geschichte zuzulassen, bestätigt wurde, hatte an Innsbrucks Universität die Stunde Null für eine eigenständige Entwicklung des Faches ‚Alte Geschichte‘ geschlagen. Bislang war diese Disziplin nur nebenbei in der Lehre von Fachkräften der mittelalterlichen, neueren und der österreichischen Geschichte mit behandelt worden; nun konnte der junge Dozent v. Scala das Fach über die Lehre hinaus auch in der Forschung vertreten. Rudolf von Scala kam aus Wien. Er wurde dort als Sohn des Ministerialsecretärs Louis von Scala und dessen Ehefrau Coralie, geb. de Rudder, am 11.7.1860 geboren. Über seine Kindheit und Jugend sagen die noch erhaltenen Quellen wenig aus. Sein Vater starb früh (1862), und so wuchs er unter der Vormundschaft und Obhut seines älteren Bruders Arthur von Scala auf. Dieser war Leiter des Österreichischen Handelsmuseums (vormals: Orientalisches Museum); später stand er dem Museum für Kunst und Industrie vor. Ein anderer Bruder war als Betriebsdirektor der Staatsbahnen zuerst in Innsbruck, später in Villach tätig. R. v. Scala scheint also in einem großbürgerlichen Milieu aufgewachsen zu sein, dem er auch in seinem späteren Leben treu blieb. Nach dem mit Auszeichnung absolvierten Gymnasium (zuerst in Wien, dann in Linz) studierte er in Wien und wurde dort vor allem Schüler von Max Büdinger, einem Historiker, der durchaus noch mit dem Anspruch auftrat, das ganze Fach ‚Geschichte‘ zu vertreten. Tendenzen in dieser Richtung sind später auch noch bei seinem Schüler deutlich zu bemerken. Am historischen Seminar der Universität bekleidete R. v. Scala in der letzten Zeit seines Studiums den Posten eines Bibliothekars. Er promovierte bei Büdinger mit einer Arbeit über den „Pyrrhischen Krieg“, nachdem er drei Monate zuvor die Lehramtsprüfung für Geographie und Geschichte abgelegt hatte. Es war dies vornehmlich eine quellenkritische Untersuchung. Die philosophische Fakultät der Universität Wien hielt die Leistungen des jungen R. v. Scala einer Promotion sub auspiciis imperatoris ac regis Francisci Josephi I. für würdig, welche am 25.7.1882 vonstatten ging. Nach seiner Promotion wirkte R. v. Scala kurze Zeit als Probelehrer am Franz-Josephs-Gymnasium in Wien und dann als supplierender Hauptlehrer an der Lehrerbildungsanstalt in Salzburg. Hiernach absolvierte er - mit einem Stipendium des Unterrichtsministeriums bedacht - weitere Studien in Tübingen und Bonn. In Tübingen hörte er den Althistoriker Alfred von Gutschmid. Die Begegnung mit diesem eine Art antiker Universalgeschichte betreibenden Gelehrten dürfte ihn ähnlich geprägt haben wie vorher Max Büdinger. Wohl nicht so intensiv wirkten auf den jungen Wissenschaftler Heinrich Nissen und Hermann Usener, die er gleichfalls in Bonn kennenlernte. Warum sich R. v. Scala entschloß, sich gerade in Innsbruck und nicht etwa in Wien zu habilitieren, ist nicht schwer zu erraten. Innsbruck war im Jahre 1885 die einzige deutschsprachige Universität des Reiches, an der das Fach ‚Alte Geschichte‘ noch nicht in irgendeiner Form institutionalisiert war. Ein Antrag des Innsbrucker Altphilologen August Wilmanns zur Errichtung einer Lehrkanzel für Alte 12 Geschichte war 1872 von der philosophischen Fakultät abgelehnt worden. In Innsbruck bestand also noch eine echte Zukunftschance für einen voll ausgebildeten Althistoriker. Daß die Familie von Scala vor ihrer Verankerung in Wien in Tirol beheimatet war und ihr dort noch immer ein Haus eignete, nämlich das Schneebergschlössel in Hall, mag den Entschluß R. v. Scalas, einen wesentlichen Karrieresprung an Innsbrucks Universität zu wagen, mitbestimmt haben. Ein wenig eigenartig muten die Umstände der Habilitation R. v. Scalas an. Er reichte nämlich keine eigene Habilitationsschrift ein, sondern seine inzwischen gedruckte Dissertation. Die Annahme dieser Arbeit als zur Habilitation geeignet erfolgte dann, obwohl der Erstgutachter Prof. Arnold Busson glaubte, prinzipielle Bedenken gegen die von R. v. Scala angewandte Methode der Quellenforschung erheben zu müssen. Bedenken, die auch heute noch nicht an Relevanz verloren haben, denn in vielem kam der junge Wissenschaftler über bloße, z. T. nicht sehr scharfsinnig begründete Vermutungen nicht hinaus. Das Habilitationsgutachten Bussons, das kühl und über längere Passagen eher negativ gehalten ist, erweckt fast den Eindruck, daß mit der Habilitation R. v. Scalas der Innsbrucker Fakultät gegen deren Intention von Wien aus ein Kandidat aufoktroyiert wurde. Auf jeden Fall dürfte R. v. Scala eine unterschwellige Unzufriedenheit mit seiner aus Wien kommenden Person schnell beiseite geräumt haben. Schon beim Kolloquium und beim Probevortrag anläßlich seiner Habilitation scheint er negative Urteile bzw. Vorurteile gegenüber seiner wissenschaftlichen Befähigung beseitigt zu haben, wird ihm hier doch ausdrücklich Gelehrsamkeit und ein kritisches Urteil attestiert, gerade auch von Busson: Der Habilitand habe sein Thema ‚Die Begründung der Römerherrschaft in Italien‘ „in ganz ausgezeichneter Weise“ behandelt. Schließlich wurde R. v. Scala schon einige Jahre später, nämlich 1892, auf einen Antrag der philosophischen Fakultät vom Jahre 1890 zum unbesoldeten a. o. Professor ernannt. Zugleich wurde ihm für seine Vorlesungen ein jährliches Honorar von fl. 1.000,- bewilligt. Zwei Jahre später wurde seine Professur von einer unbesoldeten in eine besoldete umgewandelt. Auch die folgenden Stufen seiner wissenschaftlichen Karriere erstieg der junge Gelehrte in Innsbruck; insgesamt 32 Jahre blieb er der Universität dieser Stadt verbunden. Der nächste Schritt war die Ernennung zum Ordinarius für ‚Alte Geschichte‘ im Jahre 1896 mit Wirkung 1.1.1897. Die Ernennung R. v. Scalas erfolgte ad personam. Noch hatte also die ‚Alte Geschichte’ nicht eine solche Wertschätzung erlangt, daß man eine systematisierte Lehrkanzel für das Fach für notwendig befunden hätte; dies, obwohl ‚Alte Geschichte’ im Lehramtsstudium ihren fixen Platz hatte. Vor R. v. Scala hatte der Lehrkanzelinhaber für ‚Allgemeine Geschichte’, Arnold Busson die althistorische Betreuung der Lehramtsstudenten inne. Diese hatte er, was die Lehrveranstaltungen anbelangt, schon ab 1885 weithin dem jungen Privatdozenten überlassen. Nach seinem Abgang 1891 übernahm R. v. Scala auch die Prüfungsagenden. Mit der Ernennung zum Ordinarius erst hatte v. Scala eine Position erreicht, welche ihn wirtschaftlich ganz auf eigene Füße stellte. Vielleicht erklärt auch dies den späten Zeitpunkt, zu dem R. v. Scala sich verehelichte. Die Auserwählte, die er im Jahre 1898 heimführte, stammte aus dem 13 bekannten Geschlecht der von Bülows und war Tochter des nicht ganz unbedeutenden preußischen Gesandten und bevollmächtigten Ministers beim Hl. Stuhl, Otto von Bülow. Dieser führte in Rom, unterstützt von seiner 1866 geborenen Tochter Maria - die Gattin war schon verstorben -, ein offenes Haus, „ein wahres Heim für deutsches Geistesleben“, wo ,,Staatsmänner, Kardinäle, Gelehrte und Künstler sich versammelten“. Zu diesen Gelehrten zählte offenbar auch R. v. Scala, der bei vielen Italienreisen Rom oft und gerne besuchte und dabei dann die einzige Tochter des preußischen Diplomaten kennen und lieben lernte. Verbindendes Moment war u.a. sicherlich beider Begeisterung für die antike Kunst und ihr gemeinsames Interesse für die Musik, vor allem die Richard Wagners. Maria von Scala, die sich selbst dichterisch betätigte, gebar ihrem bei der Eheschließung schon fast vierzigjährigen Gatten noch fünf Kinder, von denen die zwei ersten und die zwei letzten Zwillinge waren: Otto-Erwin, Irmingard, Wolfgang, Reimer, Rudolf. Über Rudolf von Scalas weiteres Leben fließen die Quellen spärlich. Daß ihm zweimal die Würde des Dekans der philosophischen Fakultät verliehen wurde (1903 und 1911) und er einmal als Rector magnificus fungieren durfte (1907), gehörte zum üblichen cursus honorum im damals noch kleinen Lehrkörper. Daß R. v. Scala das Fach ‚Alte Geschichte’ in seiner Eigenständigkeit salonfähig machte, dokumentiert sich am klarsten im Jahre 1901 in der Einrichtung eines „archäologisch-epigraphischen Seminars“ in zwei Abteilungen, als deren Vorstände die jeweiligen Professoren der Alten Geschichte und Archäologie fungieren sollten. Gleichwohl hatte R. v. Scala zeitweise die Alleinvorstandschaft des Seminars inne, wohl deswegen, weil man dem jungen, wissenschaftlich unausgewiesenen Archäologen Heinrich Sitte, der 1912 ohne vorherige Habilitation Extraordinarius geworden war, die Ehre der Vorstandschaft eines Seminars nicht schon zubilligen wollte. Wenn man das inzwischen recht beträchtliche Ansehen R. v. Scalas in Rechnung stellt, frägt man sich natürlich, was den inzwischen 57jährigen Ordinarius im Jahre 1917 veranlaßte, einem Ruf als Nachfolger von Adolf Bauer an die Universität Graz zu folgen. Vermutlich galt Graz damals als höherrangig als die Innsbrucker Universität, zudem bestanden in Graz wohl auch bessere Arbeitsbedingungen (Bibliothek, Dotation). Indizien dafür, daß sich R. v. Scala in Innsbruck nicht wohlgefühlt hätte, gibt es keine. In Graz war dem Gelehrten nur noch ein kurzes Wirken beschieden. Er erlebte noch die Ernennung zum Hofrat, verstarb dann aber zwei Jahre später am 8.12.1919. Ob er wirklich „ein Kriegsopfer“ war, „dem als hochgemutem Vorkämpfer deutschen Wesens der Kummer über der Deutschen Unglück und Schmach das Herz zerfraß“, wie sein Innsbrucker Nachfolger Lehmann-Haupt in einem Nachruf schrieb, mag dahingestellt bleiben. Laut der Anzeige seines Todes durch seine Familie starb R. v. Scala „nach langem schwerem Leiden an einer Herzlähmung“. Richtig ist allerdings, daß Innsbrucks erster Althistoriker tatsächlich im Sinne des Nachrufs von Lehmann-Haupt von ausgesprochen deutschnationaler Gesinnung war. So gehörte er, obwohl katholischen Glaubens, auch noch nach seiner Studentenzeit als Mitglied der schlagenden Landsmannschaft Germania in Wien an. Außerdem bestand ein Teil seiner schriftlichen Produktion in Zeitschriftenartikeln, in welchen er beredt, ja fanatisch seiner deutsch-völkischen Gesinnung Ausdruck verlieh. Noch dreißig Jahre nach dem Tode R. v. Scalas konnte sich im Jahre 1949 Heinrich Ritter von 14 Srbik in einem Gedenkartikel auf R. v. Scala der „reinen und heißen deutschen Gesinnung“ des Innsbrucker und Grazer Althistorikers erinnern. Die schriftliche Produktion R. v. Scalas war nicht allzu groß. Vier Bücher, die Mitwirkung an einer Weltgeschichte und nicht gerade zahlreiche wissenschaftliche Kleinschriften und Aufsätze waren die publizistische Frucht seiner Lebensarbeit. Auffallend ist, daß seine wissenschaftliche Produktion nach der Ernennung zum Ordinarius merklich nachließ. Die wissenschaftliche Kleinarbeit lag R. v. Scala nicht so sehr, er war vielmehr ein Mann der großen Würfe, der Zusammenschau und Überblicke. Die Weite des Horizonts des Gelehrten wurde schon zu seiner Zeit gewürdigt. Vor allem griff er in Forschung und Lehre weit über das Nominalfach hinaus, blickte auf die mittelalterliche und neuzeitliche Geschichte und vergaß auch Urgeschichte und Alten Orient nicht. Inhaltlich zeigt sich seine Vielfalt darin, daß er sich - anders als weithin üblich auch mit der Kulturgeschichte befaßte und sich insbesondere auch in die antike Sozialgeschichte vertiefte. R. v. Scala erfüllte gerade im letzteren Punkt eine Art Pionierfunktion, was auch den wissenschaftlichen Behörden auffiel, denn eine wesentliche Auflage bei seiner Ernennung zum Ordinarius wurde die regelmäßige Abhaltung seiner sozialgeschichtlichen Vorlesungen, deren besonderen Wert der damalige Unterrichtsminister Gautsch gegenüber Kaiser Franz Joseph betonte. Wie wir aus zeitgenössischen Berichten entnehmen dürfen, war R. v. Scala ein begnadeter Lehrer. Immer wieder hört man von ihm, daß er bei den unterschiedlichsten Materien die Hörer in seinen Bann schlagen konnte, und dieser seiner Begabung entsprechend legte der Gelehrte einen wesentlichen Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit in die Lehre, hielt nicht nur seine vorgeschriebenen Vorlesungen, sondern engagierte sich weit darüber hinaus bis in jene Bereiche, die wir heute mit dem Ausdruck ‚Erwachsenenbildung’ titulieren würden. Daß er längere Zeit nicht nur Vertreter seiner Fakultät, sondern zugleich Vorsitzender des „Ausschusses für die volkstümlichen UniversitätsVorträge“ der Universität Innsbruck gewesen ist, ist nur eines der Indizien für sein Engagement in der Öffentlichkeitsarbeit. Hierin eröffnete er ebenso wie in seiner starken Berücksichtigung der Kulturund Sozialgeschichte sowie mit seinem universalen Interesse eine Innsbrucker althistorische Tradition, die sich über die wechselvolle Geschichte des Faches dortselbst gehalten bzw. nach Unterbrechungen wieder neu etabliert und partiell sogar gesteigert hat. Es spricht für R. v. Scalas weiten Horizont, daß ihm gleich zwei Gesamtdarstellungen der griechischen Geschichte anvertraut wurden. Das waren zum einen die Abschnitte über die griechische Geschichte in Hans F. Helmolts mehrbändiger, von einem illustren Kreis höchst angesehener Gelehrten verfaßten „Weltgeschichte“ (Nr. 30, Nr. 33 Bibliographie R. v. Scala), zum anderen die Kurzdarstellung des Themas in der bekannten Sammlung des Teubner-Verlags „Aus Natur und Geisteswelt“ (Nr. 50). Bemerkenswert an seiner ‚Griechischen Geschichte’ in der Helmolt’schen ,,Weltgeschichte“ ist vor allem der Umstand, daß der Autor die griechische Geschichte anders als generell üblich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts n.Chr. verfolgte. Eine solche Zusammenfassung der griechischen Geschichte von der Vorzeit bis zur Gegenwart aus der Hand einer Person dürfte in deutscher Sprache kein zweites Mal mehr geschrieben worden sein. Man wird diese ‚Griechische 15 Geschichte’ daher, obwohl sie in vielem sicher veraltet ist, auch heute noch mit Interesse lesen können. Die vielgepriesene Rhetorik R. v. Scalas dürfte indes heute wohl nicht mehr allzusehr beeindrucken. Bei einer näheren Inspektion der beiden ‚Griechischen Geschichten’ R. v. Scalas fällt zunächst die starke Betonung des entwicklungsgeschichtlichen Gedankens auf. Es ist bekannt, daß evolutionistische Theorien um die Jahrhundertwende in der Völkerkunde, Religionsgeschichte, Soziologie und anderen Disziplinen recht verbreitet gewesen sind. In der eigentlichen Geschichtswissenschaft und speziell in der Alten Geschichte vermochten sie hingegen kaum Fuß zu fassen. Dort wurden üblicherweise statische Bilder von den Griechen bzw. den Römern entworfen und insofern die historische Realität verfehlt. Demgegenüber versuchte R. v. Scala ganz bewußt, unterschiedliche, einem Entwicklungsgesetz unterliegende Epochen der griechischen Geschichte herauszuarbeiten. Es ist erstaunlich, wie gut dies damals schon gelungen ist. Lange vor Wilhelm Nestles in dieser Hinsicht bis heute unübertroffenem Buch „Vom Mythos zum Logos“ vermochte R. v. Scala in knappen Worten den Entwicklungsweg griechischen Denkens von einer vorrationalen Phase der homerischen Zeit zur Aufklärungsphase des 6. und 5. Jahrhunderts zu schildern. Und anders als vielen Historikern damals wie heute ist R. v. Scala die Zeit des 4. Jahrhunderts und des folgenden Hellenismus keineswegs eine Epoche des Verfalls, sondern eine Zeit weiterer, die älteren Errungenschaften vertiefender und erweiternder Blüte. Er verweist hier etwa auf die vielen neuen Erkenntnisse der Wissenschaften in hellenistischer Zeit, auf die neuen philosophischen Denkansätze oder auf die Kunst, die sich nun auch genrehafte Themen aus der Alltagswelt eroberte. Daß R. v. Scala die Frage nach den eigentlichen Ursachen der von ihm dargestellten Entwicklung der griechischen Geschichte nicht stellte, wird man ihm kaum verübeln können. Er stand wie alle Evolutionisten seiner Zeit in dem Banne der Idee eines der Geschichte immanenten Fortschrittsprinzips, das als metaphysische Letztursache der historischen Entwicklung nicht weiter zu hinterfragen sei. Freilich hält R. v. Scala den von ihm verdienstvollerweise eingeführten Entwicklungsgedanken nicht ganz konsequent durch. Auch er postuliert (vgl. die Titel von Nr. 33 u. Nr. 50) ein Wesen des Griechentums etwa im Gegensatz zum Römertum oder Deutschtum, ohne wahrzunehmen, daß dies zu einer Relativierung der von ihm erkannten Entwicklungslinien führen mußte. Tatsächlich spielt dann auch die im Vorwort zu Nr. 50 angesprochene Wesensfrage bei der tatsächlichen Darstellung der griechischen Geschichte kaum eine Rolle mehr; der Entwicklungsgedanke - man könnte auch sagen: die Macht des Faktischen - obsiegt. Konsequenterweise kann dann der Gelehrte auch die Entwicklung des griechischen Volkes als ein „Stück der Menschheitsentwicklung“ (Nr. 50, 96) bezeichnen und damit dem am Innsbrucker althistorischen Institut bis heute hochgehaltenen Gedanken der Möglichkeit einer Universalgeschichte Raum geben. Anders lagen die Dinge offenbar beim mündlichen Vortrag. Hier kam immer wieder zum Vorschein, daß R. v. Scala die griechische Kultur als eine Einheit sah und sie als ,,Grundlage der Welt“ bewertete. Diese unhistorische werthafte Haltung den Griechen gegenüber kommt in einem Vortrag in Bregenz mit dem Titel „Weltstellung des 16 Griechentums“ besonders deutlich zum Ausdruck. Ganz im Gegensatz zu seinen ‚Griechischen Geschichten’ wird hier der griechischen Kultur eine alles überragende Stellung gegeben; nicht nur für die Kultur der Gegenwart sei sie von entscheidendster Bedeutung, sondern auch vielen anderen Kulturen bis hin nach China habe ihre Ausstrahlung wesentliche Impulse gegeben. Eine zweite Sonderheit in den beiden ‚Griechischen Geschichten’ R. v. Scalas, die gleichfalls in der Innsbrucker ‚Alten Geschichte’ zur Tradition geworden ist, stellt die starke Berücksichtigung der kulturellen und sozialen Wandlungen in der griechischen Geschichte dar. Diese Aspekte nehmen in den beiden Werken ebensoviel Platz ein wie die bloße Ereignisgeschichte. R. v. Scala ging hier durchaus umfassend vor; er berücksichtigte die Literatur der Griechen ebenso wie ihre bildende Kunst, ihre Religion genauso wie ihre Philosophie, die wissenschaftlichen Errungenschaften wiederum wie die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen. Daß angesichts des begrenzten Umfangs der Werke die Auswahl der vorgelegten Fakten einer gewissen Subjektivität nicht entbehrte, war wohl unvermeidlich. Liebe zu den Errungenschaften der griechischen Kultur spricht fast aus jeder Seite seiner Darlegungen. Diese Liebe verführt ihn da und dort zu unangebrachten Wertungen. Ein Beispiel soll dies illustrieren. R. v. Scala schreibt da über die griechischen Siege in den Perserkriegen: „Sie bedeuten den Sieg der in ihrer Willenskraft ausgebildeten Einzelindividuen über die große Masse, die nur durch einen Einzelwillen geführt wird; sie bedeuten den Sieg der religiösen Freiheit ... sie bedeuten die Rettung und Sicherung der allen Griechen gemeinsamen Geistesgüter, die Abwehr frevlen Angriffs auf die künftigen Erzieher des Menschengeschlechtes“ (Nr. 50, 40). Hier ist alles falsch oder schief. Auch zu den Lebzeiten R. v. Scalas waren jene Quellen schon bekannt, die zeigen, daß es in Athen oder im athenischen Heer eine breite Masse gab, die weitgehend willenlos und unkritisch ihren Führern folgte, daß von einer religiösen Freiheit nicht die Rede sein kann, wenigstens nicht im Gegensatz zu den persischen Verhältnissen, daß die allen Griechen gemeinsamen Geistesgüter eine Wunschvorstellung sind. Auch die persönliche großbürgerliche Einstellung des Althistorikers führt zu einigen seltsam anmutenden Aussagen, etwa wenn er meint, daß in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts in Athen „eine rücksichtslose Ausbeutung der oberen Klassen durch die unteren Platz gegriffen hat“ (Nr. 50, 52). Die beiden ‚Griechischen Geschichten’ R. v. Scalas haben seinen Namen sicherlich weit verbreitet. Wie sehr ihm an dieser Breitenwirkung lag, zeigt das Faktum, daß er auch an einer „Römischen Geschichte“ und einem „Handbuch der alten Geschichte“ arbeitete, diese aber offensichtlich vor seinem relativ frühen Tod nicht mehr vollenden konnte. Jene Bücher R. v. Scalas, die sich ausschließlich an die Fachkollegen richteten, erschienen alle schon vor der Jahrhundertwende. Zunächst seien „Die Studien des Polybios“ erwähnt, eine auf zwei Bände angelegte Monographie, von denen freilich nur der erste im Jahre 1890 erschien. Offenbar reizten den Innsbrucker Althistoriker solche ihrem Wesen nach eng umgrenzte Fachuntersuchungen im Laufe seiner persönlichen Entwicklung immer weniger, so daß er auf eine Fortsetzung dieses Werkes verzichtete. So blieben seine „Studien des Polybios“ ein echter Torso. Die wesentlichsten 17 Kapitel über Polybios als Historiker und Geograph waren nämlich dem zweiten Bande vorbehalten. Von anderen Werken zu Polybios unterscheidet sich das Opus R. v. Scalas dadurch, daß es vor allem den vielfältigen geistigen Einflüssen auf Polybios nachzuspüren versuchte. Des Polybios Verhältnis zur griechischen Dichtung von Homer bis zu seiner Zeit herab sowie das zur griechischen Philosophie von Heraklit bis zur Stoa werden im ersten Band ausführlich, z.T. sicher ein wenig spekulativ behandelt. Der 2. Band zu den „Studien des Polybios“ blieb nicht das einzige vorangekündigte, dann aber nicht erschienene Werk R. v. Scalas. Zu erwähnen wären hier eine niemals publizierte „Geschichte der Epigonen“ und ein Buch, das den Titel „Streitfragen auf dem Gebiet der alten Ethnographie und Geographie“ tragen sollte. Ein weiteres Werk R. v. Scalas blieb wiederum unvollendet. Es handelt sich um „Die Staatsverträge des Altertums“, von denen 1898 ein erster Band erschien. Er enthielt eine Sammlung aller damals bekannten inschriftlich oder literarisch erhaltenen Staatsverträge der orientalischen und griechischen Geschichte bis zum Jahr 338 v. Chr., selbstverständlich mit einem quellenkritischen Apparat und Erläuterungen versehen. Es ist dies wohl jenes Werk R. v. Scalas, das die längste Zeit ein Standardwerk geblieben ist. Erst 1962 wurde es durch Hermann Bengtsons einschlägige Arbeit ersetzt. Daß R. v. Scala den zweiten Teil dieses Buches nicht beenden konnte noch 1917 war er an der Arbeit daran -, wird man ihm wohl kaum zur Last legen können. Auch Bengtson, der es ja wissen muß, meint, daß angesichts der Fülle der Verträge vor allem aus hellenistischer Zeit die Arbeit daran „einem einzelnen über den Kopf wachsen mußte“. Daß R. v. Scala bei seinem Werk auf die altorientalischen Staatsverträge, soweit sie damals schon bekannt bzw. publiziert waren, nicht verzichtete, zeigt uns erneut, daß er nicht zu den vielen Althistorikern mit einem eng umgrenzten Forschungsgebiet gehörte. Es ist bekannt, daß er in dieser Hinsicht nicht allein stand. Doch die große Mehrheit war einseitig auf die griechisch-römische Geschichte oder gar nur einen Teil derselben fixiert und wollte z.T. auch mit der Kulturgeschichte wenig zu tun haben. R. v. Scala hingegen scheute sich nicht, die Fachgrenzen weit zu sprengen, wenn ihn irgend etwas außerhalb dieser Grenzen reizte. So verfaßte er eine rein literarhistorische Schrift über den Lyriker Emanuel Geibel (Nr. 3). Eine andere kleine Publikation mit dem Titel „Geschichte und Dichtung“ (Nr. 4) verband R. v. Scalas literarische und historische Interessen und zeigt ihn überraschenderweise auch insofern als eine Art Vorläufer seines späteren Nachfolgers F. Hampl, als er über mehr als die Hälfte des Raums das Thema ‚Sage und Geschichte’ behandelt und dabei nicht nur von den Sagen der Griechen und Römer ausgeht, sondern auch solche der Mesopotamier, Ägypter, Perser, Inder und Chinesen mit berücksichtigt. Daneben stützt er sich auch auf modernes Volksgut. Die Ergebnisse R. v. Scalas können als Ansätze zu einer Typologie der Sage, gewonnen aus dem Vergleich der herangezogenen Erzählungen, gewertet werden. R. v. Scala betont die große Rolle, welche die Phantasie hierbei spielte. Auf einen grundsätzlich vorhandenen historischen Kern der Sagen - er selbst spricht von „historischem Hintergrund“ (Nr. 4, 16) - möchte er dennoch nicht verzichten. Hier wie in einer Reihe von spekulativ-philosophischen Ideen, die er an die Sagen heranträgt, werden wir R. v. Scala heute nicht mehr folgen. Eher abwegig erscheint in dieser Schrift auch das harte Urteil über 18 moderne historische Romane, sie könnten „vom historischen Standpunkte kein Culturbild der Vergangenheit liefern“ (Nr. 4, 25). Abgesehen davon, daß sich ein solches Pauschalurteil doch wohl falsifizieren ließe, wird R. v. Scala mit seiner Verwerfung des historischen Romans den Intentionen wohl so mancher Romandichter, die mit ihren Werken keineswegs immer ein getreues Bild der historischen Vergangenheit liefern wollen, nicht ganz gerecht. R. v. Scala selbst allerdings will eine Ausnahme gelten lassen: den ,,Roman aus der Vergangenheit des deutschen Volkes“ (Nr. 4, 27), den „nationalen Roman“ (Nr. 4, 28 f.). Schönstes Beispiel hierfür sei F. Dahns „Ein Kampf um Rom“. Die Ausnahme begründet er mit dem für seine Person aufschlußreichen Gedanken, daß die Vergangenheit des eigenen Volkes „kraft der Liebe und Begeisterung“ des Dichters und „kraft der ja noch in uns fortlebenden Grundzüge“ „reicher und voller erfaßt werden“ könne als kraft der wissenschaftlichen Analyse seitens des Historikers (Nr. 4, 27 f.). Mit der zuletzt besprochenen Abhandlung sind wir zu den Kleinschriften und Aufsätzen R. v. Scalas gekommen. Auffallend ist auch hier wiederum die Weite seines Horizonts. Von der Vorgeschichte bis hin zum 19. Jahrhundert reichen die Themen. Es ist bezeichnend für den Gelehrten, daß er in seiner Rektoratsrede 1908 sich sozusagen als Bahnbrecher der damals in Innsbruck noch gar nicht institutionalisierten Vor- und Frühgeschichte mit „Umrisse (n) der ältesten Geschichte Europas“ zu Wort meldete. Andere in diese Kategorie fallende, wenngleich ein wenig näher bei der eigentlichen ‚Alten Geschichte’ bleibende Aufsätze widmen sich der Frühgeschichte Italiens (Nr. 39, Nr. 41; vgl. auch Nr. 36) und lassen eine große Vertrautheit mit der archäologischen sowie sprachhistorischen Arbeitsweise erkennen. Daß gerade auf diesem Gebiet seine Ergebnisse weithin obsolet geworden sind, ist nicht überraschend. Doch dürfte ihm, etwa in der These von der Herleitung der etruskischen Kultur aus dem minoischen Bereich, auch schon zu seiner Zeit kaum Gefolgschaft erwachsen sein. Am zeitlich anderen Ende der Veröffentlichungen R. v. Scalas steht seine kleine Schrift über den Wirtschaftswissenschaftler und Sozialpolitiker Friedrich List. Hier konnte er seinen sozial- und wirtschaftshistorischen Interessen frönen. Das waren im gegebenen Fall freilich nicht rein akademische Interessen. R. v. Scala hatte offensichtlich eine innere Affinität zu den sozial- und wirtschaftspolitischen Ideen des deutschen Politikers und Gelehrten. Dies bewog ihn wohl auch, sich für die Errichtung eines Denkmals für den im Jahre 1846 in Kufstein freiwillig aus dem Leben geschiedenen List einzusetzen. Die Stadt Kufstein griff tatsächlich diese Idee R. v. Scalas auf, und am 29.11.1906, sechzig Jahre nach dem Tode Lists, konnte R. v. Scala die Gedenkrede anläßlich der Enthüllung des List-Denkmals in Kufstein halten. Es ist schade, daß der Gelehrte keine schriftliche Spezialarbeit aus dem Gebiet der antiken Sozialgeschichte hinterlassen hat, so daß seine diesbezüglichen Erkenntnisse und Vorstellungen kaum noch rekonstruierbar sind. Auch die Dissertation seines Schülers Heinrich Rohn ,,Öffentliche Wohltätigkeit bei den Griechen“ (1904), die wohl ein Licht auf den Lehrer hätte fallen lassen, ist nicht mehr auffindbar. R. v. Scalas Vortrag vor dem 4. Deutschen Historikertag 1896 in Innsbruck „Individualismus und Sozialismus in der Geschichtschreibung“ ist geschichtstheoretischer Natur und bezieht sich auf den damals tobenden ‚Lamprecht-Streit’. Dem Gelehrten ging es hier darum, vor einer 19 ausschließlich individualistisch-biographischen Geschichtsschreibung zu warnen und den neben den „individuellen Factoren“ ,,stärker maßgebenden socialpsychischen Factoren: Wirtschaft, Sprache, Sitte, Cultus, Religion, Sittlichkeit, Wissenschaft und Kunst“ (Nr. 25, 27) zu ihrem Recht zu verhelfen. Geschichte ist nach R. v. Scala zwar auch das Ergebnis des Wirkens von Einzelpersönlichkeiten, aber er sieht wohl ebenso richtig, daß die - natürlich von Individuen mit geschaffenen - Sozialgebilde, Wirtschaftsstrukturen, Religionsformen, Moralvorstellungen usw. eine solche Eigendynamik entfalten können, daß dadurch die persönlichen Wirkungsmöglichkeiten des Einzelnen wieder stark beschränkt werden. Wenn R. v. Scala diese in der Geschichte wirkenden Faktoren jeweils ganz an die Nation binden will - „innerhalb der Nationen spinnt sich das wahre geschichtliche Leben ab“ (Nr. 25, 27) -, dann vertrat er damit eine zu seiner Zeit und auch noch einige Jahrzehnte darüber hinaus gängige These. Heute werden wir einer Art metaphysischen Letztverankerung des Nationalen kaum mehr das Wort reden. In R. v. Scalas althistorischen Publikationen tritt seine politische Gesinnung am ehesten in der Zeichnung des Isokrates und seines Gegenspielers Demosthenes zutage (Nr. 17, 24). R. v. Scala verwahrt sich zwar expressis verbis gegen eine Ehrenrettung des vielgeschmähten ‚Vaterlandsverräters’ Isokrates und scheut sich auch nicht, den griechischen Redner auf philosophisch-dialektischem Gebiet einen „eitlen Schwätzer“ (Nr. 17, 6 u. 22) zu nennen. Dann aber begeistert er sich für dessen weitschauende Pläne und den von ihm verfolgten Panhellenismus. Im Gegensatz zu der eher engstirnigen Politik des Demosthenes habe Isokrates ein wahrhaft zukunftsweisendes Programm entwickelt, ein Programm, welches allein imstande gewesen wäre, den „Erbfeind“ Persien zu zähmen und zugleich den Zwiespalt der Staaten Griechenlands zu beseitigen sowie die alten republikanischen Tugenden wie Sittenstrenge und Liebe zum Vaterland - an deren historische Realität R. v. Scala im Gegensatz zu uns Heutigen noch glaubte - wiederherzustellen. Isokrates habe mit einem für seine Zeit selten hellen Blick eingesehen, daß die alten republikanischen Verfassungen nur ein Hindernis seien für das notwendige Befreiungswerk und daß nur ein unabhängiger Monarch geeignet sei, die getrennten Geister Griechenlands zu einen. Welcher aufmerksame Leser von R. v. Scalas Gedankengängen mußte - damals in den neunziger Jahren - seine Worte nicht auch als politisches Programm für die Gegenwart empfinden? Wenn man weiß, daß einst die großdeutsche Geschichtsschreibung mit Julius von Ficker ihren hervorstechendsten Vertreter gerade an Innsbrucks Universität hatte, wird man nicht so verwundert sein, daß ein Innsbrucker Althistoriker an einem Thema aus seinem engeren Fachbereich großdeutsche politische Konzeptionen anklingen ließ. Eine weitere Gruppe von Aufsätzen zu Polybios, Diodor und Livius zeigt, daß R. v. Scala Ziel und Methode seiner Dissertation auch noch in späteren Publikationen beibehalten hat (Nr. 18, Nr. 19, Nr. 23). Unter anderem versuchte er, erhaltene Bruchstücke des Naevius auf Polybios zurückzuführen, um diese hierdurch besser verständlich zu machen (Nr. 21). Wahrscheinlich ist es purer Zufall, daß sich R. v. Scala und F. Hampl, die beiden Althistoriker, die am längsten in Innsbruck amtierten, in einem Abstand von 70 bis 80 Jahren in einem Fall zu ziemlich dem gleichen Spezialproblem äußerten, nämlich zum l. Punischen Krieg. De facto zeigen sich 20 zwischen den beiden Wissenschaftlern hier kaum Berührungspunkte. Geht es R. v. Scala um ein rein quellenkritisches Problem - er suchte nach einer schriftlichen Quelle für die Darstellung dieses Krieges bei dem Dichter Naevius -, so sucht F. Hampl die Richtigkeit bzw. Unrichtigkeit von Theorien über die Verursacher des l. Punischen Krieges zu erweisen. Zwei weitere Aufsätze R. v. Scalas sollen zum Schluß noch einmal den Gelehrten zeigen, wie er weit über die Grenzen seines eigenen Fachgebiets hinausgreift. Sie gelten den Beziehungen zwischen Orient und Okzident (Nr. 9, Nr. l l) und weisen R. v. Scala als profunden Kenner östlicher Kulturen aus, nicht nur der des nahen, sondern auch der des fernen Ostens. Die diffusionistischen Tendenzen, die in einem ,,ex oriente lux“ bzw. ,,ex occidente in orientem lux“ gipfeln, bleiben freilich höchst prekär. Zu deutlich zeigt sich uns, daß die Entwicklung der Kulturen im Osten und Westen im wesentlichen unabhängig voneinander erfolgte und die tatsächlich nachweisbaren gegenseitigen Einflüsse doch eher nur Randbereiche oder Äußerlichkeiten betreffen. Zuletzt ein Blick auf R. v. Scalas Lehrtätigkeit, wie sie die Vorlesungsverzeichnisse ausdrücken. Neben den natürlich immer wiederkehrenden allgemeinen Vorlesungen über Abschnitte der griechischen und römischen Geschichte, die erst ab 1895 in zyklischer Form vorgetragen werden, findet sich ein vielfältiges Spektrum an behandelten Themen: Verfassungsgeschichte, Staatslehre, Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Philosophie- und Geistesgeschichte, Kriegsgeschichte, Bevölkerungslehre, Provinzialgeschichte, Byzantinische Geschichte, Geschichte der Germanen, Historiographie, Epigraphik. Papyrologie, Quellenkritik, moderne Geschichtsschreibung zur Antike. Daß die Lehrtätigkeit R. v. Scalas bei den Hörern besonders gut ankam, ja daß sie die nachhaltigste Frucht des Schaffens des Gelehrten gewesen ist, darin sind sich alle heute noch auffindbaren Stimmen einig. So verwundert es nicht, daß R. v. Scala ein häufiger Gast bei diversen wissenschaftlichen Kongressen und Versammlungen gewesen ist und dort mit mancherlei Vorträgen aufwartete. Ebensowenig überrascht es, daß der Gelehrte seine Lehrtätigkeit über den engeren Kreis der Fachhörer hinaus ausdehnte und sich in der Erwachsenenbildung engagierte, wobei sich seine diesbezügliche Tätigkeit bis nach Südtirol und Vorarlberg erstreckte. Gerade in Vorarlberg hatte er als Vortragender einen solchen Bekanntheitsgrad, daß sich der Feldkircher Anzeiger veranlaßt sah, nach seinem Tode einen Nachruf auf ihn zu veröffentlichen. Diese Verbundenheit zu Vorarlberg ließ wiederum auf R. v. Scalas Seite einen landesgeschichtlichen Aufsatz zu „Brigantiums Frühzeit“ entstehen (Nr. 43). R. v. Scala hatte in seiner 32jährigen Wirksamkeit in Innsbruck nur drei Doktoranden, die seltsamerweise alle im gleichen Jahr 1904 dissertierten. In den Gutachten über diese leider allesamt nicht mehr auffindbaren Doktorarbeiten lobt und bemängelt (die Ausstellungen überwiegen!) R. v. Scala neben so obligaten Punkten wie Quellen- und Literaturkenntnis fast nur die formale Gestaltung der Arbeiten. Wenn man weiß, welch heiße Fehden in der wissenschaftlichen althistorischen Literatur gerade damals um die Zuverlässigkeit vorgebrachter Thesen ausgetragen wurden, muß das diesbezügliche Schweigen R. v. Scalas doch eher verwundern. Dahinter dürfte das Postulat stecken, wonach die Geschichtsdarstellung in erster Linie Werte zu vermitteln habe, hierbei aber eine angemessene Sprache und eine ausgefeilte formale Gestaltung unumgänglich seien: „So sind wir 21 verpflichtet, nur die Höhengrate zu wandeln ... Wir nützen der Geschichte ..., wenn wir nur das auswählen, was wahrhaft lebt und alles beiseite lassen, was ... als Einzelereignis bedeutungslos wird“. Es scheint nicht ganz ausgeschlossen, daß dieses Postulat und die daraus erwachsene Wertschätzung der formalen sprachlichen Gestaltung einer wissenschaftlichen Arbeit mit dazu beigetragen haben, ihren Urheber an einem größeren Ausstoß von Publikationen zu hindern, heißt es doch in einer zeitgenössischen Würdigung von ihm: ,,Vor allem aber ist das, was aus seiner Feder endlich die Schwärze des Druckes erreicht, feinste Ziselierarbeit, die Frucht jahrelangen Sammelns, Sichtens und Schweißens“, und R. v. Scala selbst bezeichnet in einer seiner Abhandlungen die Geschichtsschreibung ausdrücklich als Kunst. Von der Liebe R. v. Scalas und seiner Frau zur Musik war schon die Rede. Insbesondere galt diese Liebe der Musik Richard Wagners. Wir erfahren hier Näheres aus einer Reihe von persönlichen Briefen Cosima Wagners und deren Tochter Eva an den Innsbrucker Gelehrten, die sich noch im Nachlaß desselben befinden. Offensichtlich zählte die Familie von Scala zum engeren Bekanntenkreis der verwitweten Cosima Wagner, denn in diesen Briefen kommen solche Familieninterna der Wagners zur Sprache, wie sie wohl einem offiziöseren Bekannten gegenüber nicht geäußert worden wären. Es geht hier u. a. um Krankheit, Urlaub, die Entwicklung und berufliche Betätigung der Wagner’schen Kinder und dergleichen Dinge mehr. Auch daß die von Scalas persönliche Gäste im Hause Wahnfried gewesen sind, läßt sich diesen Briefen bzw. erhaltenen Einladungskärtchen entnehmen. Daneben ist in diesen Briefen viel von der Arbeit Cosimas und ihrer Kinder an der Verwaltung des musikalischen Nachlasses Richard Wagners die Rede oder von der bis zur Erschöpfung gehenden Tätigkeit im Zusammenhang mit den Bayreuther Festspielen. Über R. v. Scala erfahren wir naturgemäß, weil seine Gegenbriefe fehlen, nicht so viel. Seine Musikbegeisterung, seine deutschnationale Gesinnung, sein Selbstverständnis als Wissenschaftler, seine vielen Reisen, vor allem zu den Zentren der antiken Kulturen, werden jedoch angesprochen. Wie diese persönliche Bekanntschaft zwischen der Wagner’schen und Scala’schen Familie zustande kam, ist schwer zu sagen. Über Hans von Bülow, den mit Maria von Scala verwandten Exehemann Cosimas, dürfte sich die Beziehung eher nicht angebahnt haben, denn der älteste erhaltene Brief Cosimas datiert schon fünf Jahre vor der Verlobung und Eheschließung R. v. Scalas. Neben der Musik war die bildende Kunst, vor allem die der Antike, ein besonders gern beackertes Interessensfeld des ersten Innsbrucker Althistorikers. Dieser Liebhaberei, die sich mit seinem Arbeitsgebiet ja engstens berührte, dienten zahlreiche Studienreisen nach Italien, Griechenland, Kleinasien und Nordafrika, vielleicht auch nach Persien; außerdem besuchte er die berühmtesten Antikensammlungen in ganz Europa. Möglicherweise stammt ein Teil der Lichtbilder, die der Gelehrte bei seinen Vorlesungen und Vorträgen benutzte, von diesen Reisen. Das Interesse R. v. Scalas und seiner Frau an der antiken Kunst brachte beide dazu, selbst Antiken und andere Kunstwerke zu sammeln. R. v. Scalas eingehende Beschäftigung mit der Archäologie schlug sich auch darin nieder, daß er sowohl zum Mitglied des k. k. Österreichischen Archäologischen Instituts als auch zu dem des kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts ernannt wurde. Eine letzte, von R. v. Scala selbst genannte Liebhaberei war schließlich die Obstzucht. 22 R. v. Scala gehört sicher nicht zu den ganz Großen unseres Faches. Der Umfang seines Oeuvres ist relativ klein; nirgendwo in seinen Schriften hat er wirklich bahnbrechende Wege gewiesen, wenngleich er auch mit der Behandlung der Sozialgeschichte der Antike in seinen Vorlesungen und seiner entwicklungsgeschichtlichen Sichtweise fortschrittliche Züge an den Tag legt; nur eines seiner Bücher ist für Jahrzehnte ein Standardwerk geblieben; nüchterne, stringent-klare Beweisführung war nicht immer seine Stärke, viel lieber hielt er sich in den Höhengefilden der unvergänglichen Werte der Antike auf oder bei dem, was er dafür hielt. ,,Die wahrhaft künstlerische Belebung der wissenschaftlich erforschten Vergangenheit“ sah er als „höchste Aufgabe der Geschichtschreibung“ an (Nr. 25, 28). Wenn dennoch sein Name nicht ganz der Vergangenheit anheimfallen sollte, dann deshalb, weil er - sicher mehr intuitiv als methodisch reflektiert - einen Weg ging, den damals wie heute relativ wenige Althistoriker einschlagen, obwohl seine Fruchtbarkeit doch schon oft genug an konkreten Beispielen demonstriert wurde: Ich meine R. v. Scalas Standpunkt, die Geschichte als Einheit anzusehen, als Einheit trotz der Vielzahl der Völker und Kulturen und als Einheit, insofern erst das Zusammenwirken von politischer Geschichte, Kulturgeschichte, Sozialgeschichte und Wirtschaftsgeschichte ein abgerundetes Bild der Vergangenheit ergibt. R. v. Scala hat sich, ungeachtet der sicher notwendigen, heute mehr als je unumgänglichen Spezialisierung, an der er einerseits selbst mit Detailstudien Anteil nahm, die er andererseits, soweit das seine Arbeitskräfte zuließen, bis in die Einzelheiten verfolgte, den Blick für die großen Zusammenhänge und Entwicklungslinien, die der Geschichte erst ihren Reiz geben und sie vielleicht auch zu einer Lehrmeisterin machen, bewahrt. Godehard Kipp 23 Carl Friedrich Lehmann-Haupt Am l. Oktober 1918 übernahm ein Gelehrter, der schon hoch im sechsten Lebensjahrzehnt stand, den Innsbrucker Lehrstuhl für Alte Geschichte. Nicht jedem Forscher ist es vergönnt, in diesem Alter wissenschaftliches Neuland zu erschließen oder auch nur eine umfangreiche Publikationstätigkeit zu entfalten; bei C. F. Lehmann-Haupt aber durfte man in dieser Hinsicht viel erwarten, denn er brachte von seinem vorangegangenen Lebensweg eine Menge unveröffentlichter Quellen, Herausgebervorhaben, Fragestellungen und Ideen mit. Die Atmosphäre der Hamburger Familie Lehmann, in die er im Jahre 1861 geboren wurde, hat in ihm wohl früh den Sinn für Kunst, Geschichte und fremde Länder geweckt: Der Vater war Bibliothekar, Schriftsteller und Dickens-Übersetzer; ein Onkel lebte in London als Kaufmann, die beiden anderen Brüder des Vaters zählten zu den erfolgreichsten Porträtmalern ihrer Zeit, nämlich Heinrich Lehmann in Paris und Rudolf Lehmann in London. Nach dem Besuch der Gelehrtenschule des Johanneums in Hamburg absolvierte Lehmann zunächst das Studium der Rechte in Heidelberg, Leipzig, Berlin (l. Staatsprüfung) und Göttingen, wo er 1883 promovierte. Aber schon während der juristischen Ausbildung wandte er sich philologischen und historischen Studien zu, denen ab 1883 seine Aufmerksamkeit ganz gehörte. Maßgeblich dafür war der Eindruck, den bedeutende Althistoriker und Orientalisten auf ihn gemacht hatten: In Leipzig hörte er Friedrich Delitzsch, einen der Begründer der Assyriologie in Deutschland; der Forschungsrichtung, die dieser wies, folgte Lehmann später in seiner Beschäftigung mit außermesopotamischen Keilschrifttexten und mit alttestamentlichen Fragen. In Göttingen begegnete er dem Delitzsch-Schüler Paul Haupt und folgte dem erst Fünfundzwanzigjährigen, der einen Ruf an die neu gegründete Johns-Hopkins-Universität in Baltimore erhalten hatte, für das Studienjahr 1883/84 nach Amerika. Nach Deutschland zurückgekehrt, dissertierte er in Berlin bei Eberhard Schrader, der dort den Lehrstuhl für semitische Sprachen innehatte. Die Dissertation über die Keilinschriften, die sich auf den Regierungsantritt des Šamaššumukin (Assurbanipals Bruder und Vizekönig in Babylon) beziehen, legte Lehmann nach altem Brauch in lateinischer Sprache vor. Der Text mit seinem Ineinander von Keilschrift, Transkription und lateinischer Übersetzung bzw. Kommentierung zeigt gleichsam auf einen Blick die Breite des Bildungsganges, den Lehmann 1886 mit einem zweiten, dem philosophischen, Doktorat in Berlin abschloß. Beruflich fand er zunächst die bescheidene Stelle eines ‚wissenschaftlichen Hilfsarbeiters’ an der Ägyptischen Abteilung der Königlichen Museen zu Berlin. Seine Publikationen beschäftigten sich in dieser ersten Periode ganz überwiegend mit dem assyrisch-babylonischen Gewichtssystem und dessen Einflüssen auf die entsprechenden Systeme der griechisch-römischen Welt; dazu kam die stark erweiterte Fassung der Dissertation, die als Band 8 der „Assyriologischen Bibliothek“ 1892 erschien. Ab dem genannten Jahr trat ein neuer Themenkreis hinzu, was einer Bekanntschaft zu danken war, die Rudolf Virchow vermittelt hatte. 24 Der berühmte Arzt und Begründer der Zellularpathologie hatte in jüngeren Jahren zum Zwecke anthropologischer Studien das Kaukasusgebiet bereist; nun, im Alter, förderte er auf vielfältige Weise deutsche Expeditionen in diese Region und in den Vorderen Orient überhaupt. Im Rahmen dieser Bestrebungen beauftragte er auch einen Chemiker namens Waldemar Belck, der im russischen Transkaukasien, genauer gesagt, in Kedabeg bei Kalakent nördl. des Goktscha- (heute Sevan-)Sees in der Elektrolyse eines Kupferbergwerks der Firmengruppe Siemens tätig war, mit prähistorischen Forschungen. Belck entdeckte dort nicht nur vorgeschichtliche Gräber, aus denen er Gürtelbleche barg, die Virchow später veröffentlicht hat, er begann nach den Ur-Armeniern zu suchen, reiste 1891 nach Eriwan (Jerevan) und Van und nahm dort Abklatsche von Keilinschriften, die der Forschung damals noch Rätsel aufgaben. Durch Entdeckungen von Friedrich Eduard Schulz (1828/29) und durch Forschungen von H. A. Layard (1859), A. H. Sayce und St. Guyard war zwar schon eine Anzahl solcher Inschriften bekannt, und man hatte festgestellt, daß die unbekannte Sprache, die sich dahinter verbarg, weder semitisch noch indogermanisch sein konnte, aber weiter war man noch nicht in das Geheimnis eingedrungen. Nun brachte Virchow Belck mit Lehmann zusammen, der nach den Königsnamen auch den Inhalt der stehenden Formeln in den Inschriften und schließlich ein immer weitergehendes Textverständnis erschloß. Alljährlich bis 1897 veröffentlichten Belck und Lehmann nun gemeinsam in verschiedenen Zeitschriften Studien über Herrscher, Geschichte und Kultur jenes Volkes, das sie nach seinem Hauptgott als Chalder bezeichneten - heute ist es unter dem Namen Urartäer bekannt. Auch Lehmanns Habilitationsvortrag (gehalten 1893, gedruckt 1894) trug den Titel „Das vorarmenische Reich von Van“. Der junge Privatdozent der Alten Geschichte begann nun an der Universität Berlin mit Lehrveranstaltungen über das alte Mesopotamien, die ihn sofort auf zahlreiche ungelöste Probleme der Chronologie führten. Gleich in den ersten Weihnachtsferien seiner Lehrtätigkeit reiste er nach London, um im Britischen Museum einschlägige Keilinschriften zu studieren; als Frucht längerer Studien auf diesem Gebiet erschien 1898 die umfangreiche Arbeit ,,Zwei Hauptprobleme der altorientalischen Chronologie und ihre Lösung“. Es ging dabei zum einen um eine Herabdatierung Tiglatpilesers I. und der kassitischen Dynastie um 100 Jahre durch Korrektur eines Schreibfehlers und zum anderen um eine Verkürzung des zeitlichen Abstandes zwischen Naramsin und Nabonid um 1000 Jahre. Auch in diesem Fall nahm Lehmann einen Schreibfehler der Keilschriftquelle an und kam so vom Datum 3750 v. Chr. für Naramsin, das ihm nach dem archäologischen Befund unmöglich schien, auf das noch immer viel zu hohe Datum 2750 v. Chr. Aus der Bekanntschaft mit Waldemar Belck war mittlerweile eine Freundschaft geworden, und schon seit 1893 hegten beide den Plan, ihre gemeinsamen Unternehmungen mit einer Forschungsreise nach Armenien zu krönen. Jahrelang verhinderten kurdische Wirren das Vorhaben, aber 1898 war es soweit. Mit russischen Eisenbahnen und Schiffen reisten beide bis Tiflis, dann ging es, meistens zu Pferd und mit Tragtieren, zunächst an den Goktscha-(Sevan-) See, dann über Eriwan (Jerevan) ins persische Täbris. Nach Umrundung des Urmia-Sees betraten die beiden bei Baschkala osmanisches Gebiet. Nach längerem Aufenthalt in Van und Umgebung gelangte man unter winterlichen 25 Bedingungen über den Taurus an den Tigris und stromabwärts bis Mosul/Ninive und Nimrud/Kalach, dann einer chaldisch-(urartäisch-) assyrischen Bilingue wegen bis fast auf den Kelischin-Paß an der osmanisch-(irakisch-) persischen Grenze. Da Belck zu einer Gerichtsverhandlung nach Van zurückberufen wurde, reiste Lehmann allein in nordwestlicher Richtung weiter: In der Stadt Maijafarikin (heute Silvan nö. Diyarbakir) entdeckte er das antike Tigranokerta wieder, am obersten Westtigris besuchte er den durch Naturvorgänge entstandenen Tigris-Tunnel, um dann dem Lauf des Euphrat zu folgen. Im Raum Arapkir erreichte die Route ihren westlichsten Punkt, dann ging es über Erzurum und, nach dem Wiedersehen mit Belck, über Kars nach Tiflis zurück. Die Unternehmung dauerte rund eineinhalb Jahre und hatte durchaus den Charakter einer abenteuerlichen Expedition: Räuberische Überfälle und Scharmützel mit Kurden waren trotz Kavallerieeskorte an der Tagesordnung; Belck entging bei einem Alleingang am Sipan-Dagh (heute Süphan-Dagi am Nordufer des Van-Sees) nur knapp dem Tode durch Raubmord - daher später die erwähnte Gerichtsverhandlung. Auf dem Berg Toprakkale bei Van führte Lehmann Grabungen durch, von den Inschriften fertigte er Papierabklatsche an, einige exponierte Exemplare am Zitadellenfelsen von Van las und photographierte er als erster mit einem Teleobjektiv; die christlichen Würdenträger und Gläubigen versetzte er in helle Aufregung, indem er den Kirchenmauern Quader mit urartäischen Inschriften entnehmen ließ, um deren Rückseite lesen zu können. Immerhin vermehrte sich der urartäische Quellenbestand solcherart auf das Doppelte. Die beiden Forscher betrieben aber auch mit Sextanten, Baro- und Thermometer landeskundliche Studien; sie suchten die Furten und Pässe, die Xenophon mit den 10.000 griechischen Söldnern benutzt haben mochte, und sie nahmen die Sprache, die Erzählungen und Lieder, die Sitten und Bräuche der damaligen christlichen und mohammedanischen Bevölkerung Armeniens auf. Es war also ein wissenschaftlich außerordentlich wertvolles und umfangreiches Material, um dessen Auswertungsrechte nun nach der Rückkehr ein bitterer Konflikt zwischen den beiden Freunden ausbrach. Er erwuchs wohl auch aus der prekären Situation, daß offiziell Belck der Leiter der Expedition gewesen war und Lehmann nur sein Mitarbeiter, der freilich allein die nötigen Fach- und Sprachkenntnisse besaß, um die antiken Funde gleichsam zum Sprechen zu bringen. Kleinliche wissenschaftliche Kontroversen folgten rasch, die Freundschaft schlug in Feindschaft um, die Wege trennten sich. Was die Fundmaterialien und Aufzeichnungen betraf, behielt Lehmann die Oberhand und war damit im Besitz einer Basis für eine bedeutende wissenschaftliche Tätigkeit und Laufbahn. Das Jahr 1901 brachte die außerordentliche Professur für Alte Geschichte in Berlin. Lehmann trat damit in einen Kreis namhafter akademischer Lehrer ein; dazu zählten Friedrich Delitzsch, Bruno Meissner, Maximilian Streck, Hugo Winckler und Eduard Meyer. Es war für diesen Kreis charakteristisch, daß er einen umfassenden Begriff vom Fach Alte Geschichte besaß, der den ganzen Alten Orient mit einschloß, und daß den Wechselbeziehungen zwischen Mesopotamien, Israel, Kleinasien, dessen ältere Geschichtsquellen sich eben erst zu erschließen begannen, und der griechisch-römischen Welt ein besonderes Forschungsinteresse galt. Ganz in diesen Geist passen 26 Lehmanns programmatisch-bekenntnishafte Worte: ,,... nicht als Spezialist auf orientalischem Gebiet bin ich gereist, sondern als Historiker, dessen eigentliches Forschungsgebiet das ganze Altertum bis zu seinen späten Ausgängen in spätrömischer und frühbyzantinischer Zeit“ war und dessen Absicht darin bestand, die „Gegenwart als Ergebnis des geschichtlichen Werdegangs“ zu begreifen. Solche Übereinstimmung im großen Rahmen konnte freilich persönliche Konflikte im Detail nicht verhindern. Es kam zu scharfen Gegensätzen zwischen Lehmann und Hugo Winckler sowie Felix Peiser, den ehemaligen Studienfreunden aus der Schrader-Schule, die seine Leistungen jetzt unverdient herabsetzten. In dem Jahr, in dem er die außerordentliche Professur erhielt, schloß der Vierzigjährige die Ehe mit Therese Haupt (geb. 1864), der Tochter eines Schulrats und Lyceumsdirektors in Stettin, Otto Haupt. 1903 kam ihr Sohn Hellmut, 1904 die Tochter Miriam zur Welt. Seit 1905 führte Lehmann den Doppelnamen Lehmann-Haupt. Mit vorsichtiger Skepsis wagte sich Lehmann im bewußten Jahr 1901 auch an den Versuch, eine Fachzeitschrift für die Alte Geschichte zu gründen; er gab ihr den Namen „Klio“. Die Gründung hatte wider Erwarten Bestand und erwarb im Lauf der Jahrzehnte hohes Ansehen. Vom dritten Jahrgang an fungierte Ernst Kornemann in Tübingen als Mitherausgeber; er war auch in fast jeder Nummer als Verfasser eines Beitrags vertreten. Auch Karl Julius Beloch kam in diesen ersten Jahrgängen sehr oft zu Wort, ferner K. Regling, L. Weniger (mit Studien über Olympia), E. Hohl (über Geschichte der Kaiserzeit), A. v. Premerstein (über Marc Aurel). Dem Nachruf auf Mommsen im Jahrgang 1904 gab Lehmann ein kaum bekanntes Porträt des Verstorbenen bei, das sein Onkel Rudolf anno 1859 gezeichnet hatte. Zusammen mit dem Umstand, daß Mommsen schon als junger Mann ein Gedicht auf ein Gemälde Rudolf Lehmanns geschrieben hatte, wirft dies ein Licht auf die vielfältigen Beziehungen der Familie Lehmann zum Hause Mommsen. Unter den zahlreichen kleineren Studien, die Lehmann-Haupt in der „Klio“ und anderswo publizierte, standen damals Vor- und Teilberichte über die Armenienreise im Vordergrund; weitere wichtige Themenkreise bildeten neben der mesopotamischen Geschichte weiterhin die Metrologie und Hellenistisches. In Armenien hatte er urartäische Bewässerungskanäle kartiert, deren Bau die volkstümliche Überlieferung im Lande der Semiramis zuschrieb - Anstoß genug, sich mit der sagenhaften Semiramis-Tradition auseinanderzusetzen. Nicht nur Lehmanns erster Aufsatz in der „Klio“ galt diesem Thema, sondern auch ein kleines Buch mit dem Titel „Die historische Semiramis und ihre Zeit“ (1910). Mit großem Scharfsinn versuchte er darin, den Weg von der assyrischen Regentin Sammuramat zur Sagengestalt zu rekonstruieren, wobei er modischer Tradition eine besondere Rolle zuschrieb; darüber hinaus fühlte er sich durch diese erfolgreichen Studien in der fragwürdigen Annahme bestärkt, in jeder Sage müsse sich auf jeden Fall ein historischer Kern verbergen. Die aufblühende Assyriologie hat zahlreiche Angaben, die das Alte Testament als historische Fakten aus dem alten Israel präsentiert, falsifiziert und außerdem nachgewiesen, daß die Israeliten in geistig-kultureller Hinsicht stark von Babylonien beeinflußt, ja sogar von ihm abhängig waren. Was 27 diesen letzten Punkt betrifft, schossen die sogenannten Panbabylonisten unter den Assyriologen freilich mitunter über das Ziel und boten damit nicht nur den Fachleuten, sondern auch konservativen Gemütern, die sich in ihrem Bibelglauben verletzt sahen, Angriffsflächen. Mit der Schrift „Babyloniens Kulturmission einst und jetzt“ wollte Lehmann, wie der Untertitel zeigt, „ein Wort der Ablenkung und Aufklärung zum Babel-Bibel-Streit“, der die Emotionen außerordentlich aufwühlte, sprechen (1903). Er korrigierte vor allem Friedrich Delitzsch vorsichtig dort, wo ihm dieser allzu schroff und vollständig Abhängigkeit des alttestamentlichen Judentums „von Babel“ zu postulieren schien, und er wies aufgebrachte Gegner, denen wegen Delitzschs Diffusionismus die ganze Assyriologie zum roten Tuch wurde, auf kulturgeschichtliche Leistungen Mesopotamiens hin, die ganz unabhängig von der Frage ihres Einflusses auf Israel ihren Wert besaßen. 1907 und 1910 erschienen dann die ersten Monographien, die der Öffentlichkeit den Ertrag der Armenienexpedition boten: „Materialien zur älteren Geschichte Armeniens und Mesopotamiens“ (183 S.) und der erste Band von „Armenien einst und jetzt“ (543 S.). Dieser erste Teil des großangelegten Werkes schildert im Stil einer chronologischen, anschaulichen und spannenden Reisebeschreibung den Gang der Expedition, soweit sie eben eine Reise war, während die Beschreibung des eher stationären Aufenthalts im urartäischen bzw. armenischen Zentralraum rund um den Van-See ausgeklammert blieb. Besonders markante Partien dieses Bandes gelten der Rekonstruktion des Weges der Söldnertruppe unter Xenophon am Kentrites-Fluß (Botan Cayi), der Suche nach dem antiken Tigranokerta, der Rekonstruktion der Schlacht, die Lucullus dort 69 v. Chr. gegen König Tigranes von Armenien geschlagen hat, und der historischen Interpretation der Inschriften, die die assyrischen Könige am ‚Tigris-Tunnel’ und an der Quelle von Babil (beim heutigen Çizre) angebracht haben. Im Jahre 1911 erschienen gleich drei Schriften zur Geschichte des alten Israel, die Lehmann-Haupt in einem deutlichen Gegensatz zur tiefergehenden Quellenkritik eines Karl Julius Beloch und Eduard Meyer zeigen. Er wollte von der sagendurchwobenen Geschichte Israels nämlich nur direkt widerlegbare konkrete Details abstreichen, es gelang ihm hingegen nicht, sich von alttestamentlichen Erzählungen mit sagenhaftem Charakter ganz zu lösen und notfalls die entstehenden Lücken im Geschichtsbild offen zu lassen. All diese Publikationen lagen vor, als Lehmann-Haupt im Jahre 1911 als „Gladstone Professor of Greek“ an die Universität Liverpool berufen wurde. Die langjährigen familiären und wissenschaftlichen Kontakte zu England haben bei dieser Berufung sicher eine Rolle gespielt; auch waren Berufungen über Staats- und Sprachgrenzen hinweg damals noch häufiger als heute. Die Antrittsvorlesung galt der Gestalt Solons als ,,poet, merchant and statesman“ (gedruckt 1912). Bald kamen auch an dieser englischen Universität Funktionen hinzu, die seiner Vielseitigkeit entsprachen: Leiter der Abteilung für Orientalische Geschichte und Archäologie am dortigen Institut für Archäologie, Reader für Orientalische Geschichte, Supplierung des Lehrstuhls für Alte Geschichte in Oxford 1913/14, Mitherausgeberschaft bei den ,,Liverpool Annals of Archeology and Anthropology“. 28 Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs warf auch in der Welt der internationalen Wissenschaft Gräben auf: Lehmann-Haupt verließ England fast fluchtartig - Mobiliar und wissenschaftliche Bestände mußten zurückbleiben - und meldete sich in Deutschland freiwillig zum Militärdienst, der allerdings über einen Einsatz im Gefangenenlager Zossen bei Berlin nicht hinausging. Er wurde nämlich für eine Supplierung in Greifswald und nachher für Konstantinopel freigestellt. Aber Lehmann-Haupt betätigte sich publizistisch im deutschnationalen Sinne: Die Rede „Der Krieg und das Deutschtum im Auslande“ und die Flugschrift „Von Waterloo bis Antwerpen“ (beide 1915) forderten insbesondere die Deutschen im Ausland dazu auf, mehr Selbstbewußtsein zu zeigen, sich sprachlich und kulturell nicht im geringsten anzupassen und allen negativen Informationen über Deutschland und seine Politik energisch entgegenzutreten. Wie bereits angedeutet, erhielt Lehmann-Haupt im Jahre 1915 eine Berufung an die - im Zuge der deutsch-osmanischen Bündnispolitik - neu gegründete Universität in Konstantinopel. Übrigens legte man ihm erst nach dem Abschluß der Verhandlungen eine schriftliche Fassung des Dienstvertrags mit einer Zusatzbestimmung vor, die alle öffentlichen Äußerungen über innere Verhältnisse des Osmanischen Reiches der Zensur durch die türkischen Behörden unterwarf. Das nötigte ihn, aus dem zweiten Band des Armenienwerkes, dessen Druck damals angelaufen war, alle Passagen über die bedrängte Lage der christlichen Armenier zu streichen. In Konstantinopel blieb er trotz bemühter Vortragstätigkeit eher isoliert. Vor allem aber zeichnete sich der Zusammenbruch der Mittelmächte und damit der deutsch-osmanischen Sonderbeziehungen ab, und so ist es mehrfach verständlich, daß Lehmann-Haupt gerne den Ruf nach Innsbruck annahm. Auslandsaufenthalt und Krieg behinderten naturgemäß die Forschung; immerhin sind drei größere Arbeiten aus dieser Periode zu nennen: In Gercke-Nordens ,,Einleitung in die Altertumswissenschaft“ erschien die Darstellung der ,,Griechischen Geschichte bis zur Schlacht bei Chaironeia“, die mehrere Auflagen erlebte. Neuerlich unterstrich er hier, ausdrücklich im Gegensatz zu Eduard Meyer, daß nach seiner Meinung jede (also auch eine sagenhafte!) Überlieferung bis zum direkten Beweis des Gegenteils als historisch anzusehen sei. Von diesem - heiklen - methodischen Postulat sind bis zu einem gewissen Grad etliche weitere Lehrmeinungen getragen, die für seine Darstellung der griechischen Geschichte charakteristisch sind: Hinter der Überlieferung vom Trojanischen Krieg stand nach Meinung Lehmann-Haupts ein Kriegszug mykenischer Griechen gegen Troja VI, und die Etrusker mußten, aus Kleinasien kommend, um 1050 v. Chr. in Italien gelandet sein, um sich später bis nach Rätien auszubreiten. Die Ergebnisse der unausgesetzten Beschäftigung mit antikem Maß und Gewicht schlugen sich im großen Zeitschriftenbeitrag „Vergleichende Metrologie und keilinschriftliche Gewichtskunde“ (1912) und im RE-Artikel „Gewichte“ (RE Suppl. 111, 1918, Sp. 588-654) nieder. Wie sonst, so auch auf diesem Gebiet, verkündete er energisch die Prinzipien, nach denen er arbeitete: Man kann Gewichtsnormen aus Fundgegenständen erschließen, auch wenn sie nicht ausdrücklich in Texten genannt werden; Münzen sind unmittelbare Fortsetzer des in abgewogenen Stücken umlaufenden Metalls und daher für die Metrologie relevant; Regionen und Epochen, die Normaleinheiten oder 29 deren Bruchteile gemeinsam haben, stehen in einem Verkehrs- und Kulturzusammenhang. Die Schwierigkeiten steckten freilich damals und weiterhin in den Detailproblemen. Eine Unterteilung der Mine in 50 oder 60 Teile, unterschiedliche Normen des assyrisch-babylonischen Gewichts, ein konkreter Zusammenhang griechischer und römischer Maß- und Münzeinheiten mit den orientalischen - all dies wird in den genannten Schriften diskutiert. Einleitend wurde es schon gesagt: Die Innsbrucker Philosophische Fakultät durfte sehr bereichernde und anregende Lehrveranstaltungen und eine rege Publikationstätigkeit erwarten, als sie Lehmann-Haupt nach dem Weggang Rudolf von Scalas nach Graz primo et unico loco für die Nachfolge vorschlug. Während des Sommersemesters 1918 supplierte der klassische Philologe Ernst Kalinka, und am 11. September 1918, also nur wenige Wochen vor dem Zusammenbruch der Monarchie, unterzeichnete Kaiser Karl die Ernennung (ad personam) zum ordentlichen Professor der Geschichte des Altertums, mit Wirksamkeit zum l. Oktober 1918. Die damit verbundene Lehrverpflichtung umfaßte 5 Wochenstunden pro Semester, außerdem sollte jedes dritte Semester ein Collegium publicum über Fachthemen in allgemein verständlicher Form stattfinden, und als Mitdirektor des Archäologisch-Epigraphischen Seminars (neben dem Archäologen Heinrich Sitte) hatte der neue Professor zwei Semesterwochenstunden Seminar abzuhalten. Das Verfahren zur Anrechnung der im Ausland verbrachten Dienstzeiten wurde erst im Jahre 1924 abgeschlossen. Lehmann-Haupt war Mitglied des historischen Seminars, das damals gemeinschaftlich von Hermann Wopfner (Österreichische Geschichte), Harold Steinacker (Geschichte des Mittelalters) und Ludwig Pastor (Neuere Geschichte) geleitet wurde - dem Letztgenannten folgte im Jahre 1923 Ignaz Philipp Dengel. Zum weiteren Kollegenkreis zählten die klassischen Philologen Ernst Diehl und Julius Jüthner und die Orientalisten Thomas Friedrich und August Haffner. Frau Therese Lehmann-Haupt lebte sich an dem neuen Wohnort gut ein. Ihren schriftstellerischen Neigungen folgend, verfaßte sie Märchen für Kinder, sie teilte aber auch die halb politischen, halb humanitären Bestrebungen ihres Gatten, von denen noch zu sprechen sein wird, in gefühlsbetonter Weise: So schrieb sie Gedichte über Deutsch-Südtirol und schilderte den Leidensweg der Armenier in der Türkei nach dem Augenzeugenbericht eines zwölfjährigen Knaben. Die Kinder wurden nun erwachsen, der Sohn Hellmut bildete sich zum Kunsthistoriker und Buchwissenschaftler aus und ging im Jahre 1929 in die USA; er lebt heute in Columbia (Missouri). Die Tochter Miriam wurde Schauspielerin und Sängerin und blieb länger in Innsbruck als ihr Bruder. Nach ihrer Eheschließung mit einem Engländer namens Greene übersiedelte sie nach England. Sie ist im Jahre 1981 verstorben. Lehmann-Haupt selbst engagierte sich in der Nachkriegszeit, wie bereits angedeutet, gegen politisches und menschliches Unrecht, das der Krieg und die auf ihn folgenden Grenzziehungen mit sich gebracht hatten. So richtete er als Reaktion auf eine Erklärung des amerikanischen Präsidenten Wilson vom 24. April 1919, die dessen Abrücken vom Selbstbestimmungsrecht in Sachen Südtirol andeutete, an diesen einen persönlichen Brief, in dem er ihn als früheren Studiengenossen an der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore ansprach und an ihn appellierte, sich richtig über die 30 Volkstumsgrenzen zu informieren und nach den von ihm selbst aufgestellten nationalen Prinzipien zu entscheiden. In den folgenden Jahren trat Lehmann-Haupt auch immer wieder für die Sache der Armenier ein. An mehreren Stellen seines großen Armenienwerks schilderte er anklagend die verschiedenen Stadien des Drucks und der Verfolgung, denen dieses Volk schon vor dem Ersten Weltkrieg ausgesetzt war (Gemetzel in Sassun 1894 und Van 1896), und die verheerenden Massaker und Deportationen während des Krieges. In Fridtjof Nansen, der als Oberkommissar des Völkerbundes mit dem Problem befaßt war, gewann er einen Freund und Mitstreiter, der ihm sein Buch „Betrogenes Volk“ gewidmet hat. Die Anklage mündete in die Forderung nach Wiedergutmachung, die unerfüllt blieb. Doch zurück zu Lehmann-Haupts Tätigkeit als akademischer Lehrer und Forscher: Er las in Innsbruck einen achtsemestrigen Hauptvorlesungszyklus. Besonders die ersten Abschnitte dieser Vorlesung lassen noch die alte Berliner Tradition erkennen, den Alten Orient und die griechischrömische Welt synchron und in ihren Verflechtungen zu behandeln. Dies illustriert etwa der Vorlesungstitel „Von Tiglatpileser IV. und Pheidon von Argos bis zum peloponnesischen Kriege“ (SS 1919). Für die weiteren Vorlesungen wählte Lehmann-Haupt besonders oft die römische Kaiserzeit und die Einführung in die griechische und römische Epigraphik zum Thema. Die Epigraphik dominierte, der Lehrverpflichtung gemäß, auch in den Übungen; dazu traten die vorderasiatischgriechischen Beziehungen als bevorzugtes Thema für diesen Lehrveranstaltungstyp. Die Seminare galten in der Regel bedeutenden Quellentexten, unter denen Herodot, Xenophon, Polybios, Livius, Cicero und die Historia Augusta mehrfach aufscheinen. Oftmals werden im Vorlesungsverzeichnis ausdrücklich Lichtbilder und Demonstrationen angekündigt. Lehmann-Haupt las, zum Leidwesen seiner Hörer, oft zu früher Morgenstunde (um 7 Uhr), ohne Manuskript, mitunter ziemlich unsystematisch, denn die wissenschaftliche Polemik trieb ihn gern vom Hundertsten ins Tausendste. Der eher klein gewachsene, weißhaarige Herr machte auf seine Hörer - es waren in den Seminaren im Durchschnitt acht bis zwölf, in den Vorlesungen etwa zwanzig - nach übereinstimmender Aussage einen starken persönlichen Eindruck. Die meisten Studierenden strebten das Mittelschullehramt an; fünf haben bei Lehmann-Haupt in Innsbruck promoviert - sie seien hier in chronologischer Reihenfolge genannt: Friedrich Schachermeyr (1920) über „Ägäis und Vorderasien in ihren Beziehungen zu Ägypten“; Ernst Siecke (1921) mit „Studien zu Herodots babylonischem Logos“; Edith Tabarelli-Holzer (1921) über ,,Die Diöcese Illyrium von Diokletian bis zum Untergang des weströmischen Reiches“; Hildegard Zillmer (1925) „Zur Geschichte des Kaisers Marc Aurel“; Johannes Papastavrou (1932) ,,Zur Geschichte von Amphipolis“. Die Dissertationsgutachten, die im Universitätsarchiv aufbewahrt werden, zeigen, daß der Gutachter vor allem auf die Heranziehung aller denkbaren und auch entlegenen Quellen in der jeweils besten Edition und auf Sprachgewandtheit in der Darstellung Wert legte. Der Grieche Johannes Papastavrou war zwar der letzte, aber an Lebensjahren keineswegs der jüngste unter Lehmann-Haupts Dissertanten. 1893 geboren, war er in seiner Heimat im Gymnasialdienst tätig, bis er 1940 in die akademische Laufbahn eintreten konnte. Er bekleidete 31 althistorische Lehrstühle in Thessaloniki und Athen; er trug zu den RE-Supplementen bei; vor nicht allzu langer Zeit ist sein Buch über Themistokles in einer deutschen Übersetzung erschienen. Der erste unter den oben genannten Schülern aber war jener, der Lehmann-Haupt persönlich am nächsten stand und der es in seinem Fach am weitesten gebracht hat: Fritz Schachermeyr. Schon seine Doktorarbeit galt einem typischen ‚Lehmann-Haupt-Thema’; nach der Promotion unterstützte er seinen Lehrer durch vielfältige Mitarbeit bei der Vorbereitung des ,,Corpus Inscriptionum Chaldicarum“ (vgl. dazu unten), er kam in der ,,Klio“ zu Wort, und im Jahre 1928 konnte er die Habilitation beantragen. Der Leser der ,,Etruskischen Frühgeschichte“, die er als Habilitationsschrift vorlegte, wird rasch erkennen, daß sich Lehrer und Schüler mit Bezug auf diesen Fragenkomplex auf ganz parallelen Gedankenbahnen bewegten. Mehr noch, es fand ein intensiver Ideenaustausch statt, denn Schachermeyr arbeitete - wie andere Schüler - oft mit der Privatbibliothek des Professors in der Schöpfstraße 4/11 und konnte sich auch mit den recht umfangreichen einschlägigen Passagen im damals noch unveröffentlichten Manuskript des Armenienwerkes auseinandersetzen. Der Kommission, die unter dem Vorsitz Heinrich Sittes stand, schlug Schachermeyr für den Probevortrag drei Themen vor, die sich ebenfalls stark mit den Forschungsperspektiven LehmannHaupts berührten: „Die Achäer in den hethitischen Texten“ wurden schließlich ausgewählt; daneben standen die „Grenzen der historischen Rückerinnerung bei den Griechen“ und „Gedanken zum Niedergang der griechischen und der hellenistischen Kultur“ zur Wahl. Die ägäische Frühzeit ist für Schachermeyr denn auch zeitlebens ein zentrales Thema seiner Forschung geblieben. Bald nach der Habilitation übernahm er den Lehrstuhl in Jena; mit seinem Lehrer blieb er zunächst in Verbindung so redigierte er mit ihm einige Bände der „Klio“ -, doch kam es nicht zuletzt wegen Differenzen über sprachliche und stilistische Fragen zur Entfremdung. Die Nachfolge in Innsbruck hat Schachermeyr vor allem deshalb nicht angetreten, weil man ihm lediglich eine außerordentliche Professur anbot. Unter den Arbeiten, die in Innsbruck den Schreibtisch Lehmann-Haupts verließen, seien zunächst zwei hervorgehoben, die, wie so viele frühere, im Schnittfeld orientalischer und griechisch-römischer Geschichte angesiedelt waren: Im Band 16 (1919) der „Klio“ schloß er eine längere Reihe von Studien über „Berossos’ Chronologie und die keilinschriftlichen Neufunde“ mit einem besonders ausführlichen Beitrag ab, in der Realenzyklopädie behandelte er das Stichwort „Satrap“ auf mehr als 100 Spalten (1923). Die Bearbeitung der „Geschichte des alten Orients“ für die 3. Auflage von Ludo Moritz Hartmanns Weltgeschichte hat er in der „Klio“ selbst kurz kommentiert: Es ging ihm dabei darum, die Kulturgeschichte nicht mehr getrennt von der politischen, sondern als organischen Bestandteil der Gesamtgeschichte erscheinen zu lassen, und er wollte auch die Kunstgeschichte gebührend beachtet sehen. In der Rückschau ist es leicht, über die letzten Forschungsergebnisse zu lächeln, die er auch noch einbaute: Der ägyptische Reichseiniger Menes sei mit 4186 ±2 zu datieren (nach Borchardt), und der Hethiterkönig Mursilis hätte um 1320 v. Chr. Beziehungen zu den „achäischen Aiolerkönigen Antarvas (griech. Andreas) und Tavagalavas (griech. Eteokles)“ unterhalten (nach Forrer). 1926 erschien dann endlich der erste Halbband des zweiten Bandes von „Armenien einst und jetzt“. 32 Der Druck war zu Beginn des Krieges stecken geblieben, und nun dauerte es Jahre, bis der Verfasser die verstreuten Materialien aus England, Konstantinopel und Berlin nach Innsbruck zusammengezogen hatte. Dieser Band galt den Forschungen im Gebiet rund um den Van-See und in Nord-Assyrien; die Schilderung erreicht gewisse Höhepunkte in den Abschnitten über den MenuasKanal, der in der Neuzeit Semiramis-Kanal hieß, und über die zweisprachige Kelischin-Stele. 1931 folgte der zweite Halbband, in dem der erzählerische Schwung verebbte: Lange Erörterungen und Kontroversen durchbrechen die letzten Reiseschilderungen, der scharfzüngige und polemische Kämpfer, der sich in den Vorlesungen äußerte, wird auch hier vernehmbar. Der Versuch eines Nachweises, daß die Urartäer aus der Südwestecke Kleinasiens in ihre späteren Sitze gekommen seien und daß die etruskische Kunst ihre Herkunft aus dem gleichen Raum nicht verleugnen könne - die „zoomorphe Junktur“ spielt dabei eine besondere Rolle -, all dies nimmt breiten Raum ein. Allzu oft sollen Ähnlichkeiten in der materiellen Kultur Wanderungen von Völkern und Volksteilen nahelegen. Der Eindruck des Überholten ist hier aus heutiger Sicht am stärksten. Viel mehr bleibenden Wert darf die letzte große Publikation aus dem armenischen Material für sich beanspruchen, die Lehmann-Haupt mit der Unterstützung Felix Bagels und Fritz Schachermeyrs ins Werk setzte: Das „Corpus Inscriptionum Chaldicarum“ sollte alle bis dahin bekannten urartäischen Inschriften in ähnlicher Qualität wie Mommsens CIL darbieten. Die Abklatsche wurden aus Berlin nach Innsbruck transportiert, Photographien aus Istambul angefordert, um dies möglich zu machen. Das Vorhaben blieb allerdings nach dem Erscheinen der ersten zwei Lieferungen (jeweils Text- und Tafelband, 1928 und 1935) bis heute unvollendet liegen. Mit dem l. Oktober 1932, also nach Ablauf des Ehrenjahres, wurde Lehmann-Haupt in den dauernden Ruhestand versetzt. In der Zeit der Vakanz hielt er noch bis zum Sommersemester 1936 Lehrveranstaltungen ab; die beiden letzten waren wieder seinem engsten Spezialgebiet gewidmet, nämlich den assyrischen und vorarmenischen Keilinschriften. Die Redaktion der „Klio“ behielt er noch bis zum Band 29 (1936) in Händen. Es ist auffällig, daß in den dreißiger Jahren der Rezensionsteil dieser Zeitschrift stark an Umfang zugenommen hat. Zu den mehrfach mitwirkenden Rezensenten zählte damals neben F. Miltner, K. Glaser und K. Jax auch Gertrud Fussenegger, die sich als Schriftstellerin einen Namen gemacht hat. Ab 1937 hat dann Franz Miltner, der Nachfolger auf dem Lehrstuhl für Alte Geschichte, die Schriftleitung als Erbe übernommen. Lehmann-Haupt blieb aber Mitarbeiter bis zum Jahrgang 1938. Die Festschrift, die zum siebzigsten Geburtstag des Gelehrten im Jahre 1931 erschienen war, besteht fast ausschließlich aus einem vollständigen Schriftenverzeichnis, das nicht weniger als 195 Publikationen aufzählt. In den Jahren des Ruhestandes kamen noch rund zwanzig Titel dazu (vgl. den bibliographischen Anhang am Ende des vorliegenden Bandes). Die Mehrzahl der kleineren Arbeiten dieser Schaffensperiode galt der Geschichte Kleinasiens, unter den größeren ,,Klio“-Aufsätzen widmeten sich zwei den Geschicken altorientalischer Herrscher und Dynastien: „Zur Ermordung Sanheribs und zur Thronbesteigung Asarhaddons“ und „Iranisches“ (über Probleme der frühen Achaimenidengeschichte im Lichte mesopotamischer Quellen). 33 Zwei Beiträge dieser Jahre sind besonders charakteristisch für Lehmann-Haupt: Nicht ohne Stolz nützte er seine intensiven brieflichen und telegraphischen Kontakte zum Ausgräber von Knossos, A. J. Evans, aus, um den Lesern der „Klio“ im Jahre 1932 aus erster Hand über das neuentdeckte ‘Tempelgrab’ in Knossos zu berichten und seine historischen Überlegungen daran anzuknüpfen. Die Ähnlichkeit der eben freigelegten Anlage mit dem von Diodor IV, 76 in Herakleia Minoa auf Sizilien lokalisierten Minosgrab wertete er vorschnell als Beweis, daß tatsächlich ein Herrscher des minoischen Kreta auf Sizilien gestorben und begraben worden sei. Eine Art von Summe der metrologischen Forschung brachten dann die ,,Forschungen zum antiken und ostasiatischen Gewichtswesen“ (1936). In diesem Artikel ging er mit der jüngeren Forschergeneration und ihren Methoden bei der Bestimmung antiker Münz- und Gewichtsnormen streng ins Gericht und warf ihnen einen Rückschritt auf diesem Gebiet vor. Ob zu Recht, muß dem Urteil des Spezialisten überlassen bleiben. Am 24. Juli 1938, einige Monate nach dem deutschen Einmarsch in Österreich, ist Carl Friedrich Lehmann-Haupt einem Herzleiden erlegen. Seine Frau folgte ihm einige Monate später, kurz nach der Reichskristallnacht, freiwillig in den Tod. Möglicherweise hat dieser Umstand Gerüchten Nahrung gegeben, auch er hätte in den politisch stürmischen Tagen jenes Jahres den Freitod gesucht. Der Verfasser ist diesen Berichten nachgegangen und zum Schluß gekommen, daß sie nicht den Tatsachen entsprechen. Man darf allerdings vermuten, daß die Ereignisse für den greisen Gelehrten und seine Gemahlin seelische Erschütterungen mit sich brachten. Auf der einen Seite schließlich waren beide zeitlebens und nicht etwa erst in später Anpassung betont deutschnational eingestellt gewesen und empfanden den 12. März als „großen Tag“. Auf der anderen Seite können sie die Entwicklung nicht übersehen haben, die sie selbst in eine Gefahrenzone trieb: Als sich das ‘Gaurechtsamt’ mit entsprechender Fragestellung nach der Abkunft des Ehepaares Lehmann-Haupt erkundigte, erhielt es vom Rektorat die Auskunft, die Frau sei „nach unserem Wissen“ rein arisch und „auch er wohl nicht Volljude“. Aber es gab offenbar Belastungen, die dazu führten, daß sich niemand gerne zu ihm bekannte. Und so muß der Chronist bemerken, daß Lehmann-Haupt kaum eines Nachrufs gewürdigt wurde - in der von ihm selbst gegründeten „Klio“, deren Redaktion er seinem Lehrkanzelnachfolger anvertraut hatte, erschien kein einziges Wort des Gedenkens. Der Schluß einer Biographie drängt wohl zu einer zusammenfassenden Würdigung, mag sie auch angesichts eines so langen und reichen Forscherlebens ein wenig vermessen erscheinen. Betrachten wir also die wichtigsten Tätigkeitsfelder eines Historikers! Die bedeutendsten und bleibenden Leistungen Lehmann-Haupts betreffen sicherlich die Vermehrung und Erschließung der Quellen. Der Bogen spannt sich hier von den neuassyrischen Šamaššumukin-Texten über griechische Inschriften Kleinasiens bis zum volkskundlichen Material aus dem untergegangenen christlichen Armenien; im Zentrum steht aber die Sammlung und Übersetzung der urartäischen Inschriften, deren systematische Edition freilich unter seiner Hand nur bis zum zweiten Drittel des Vorhabens gedieh. Was die wissenschaftliche Erklärung der Daten und Fakten anlangt, die uns die Quellen liefern, steht wiederum Urartu im Vordergrund: Lehmann-Haupt entwarf als erster ein umfassendes, in den 34 wesentlichen Zügen richtiges Bild einer ganzen neuentdeckten Kultur. Es versteht sich von selbst, daß die Forschung seither vieles ergänzt und manche Details korrigiert hat, und auch Lehmann-Haupts Versuche, die Herkunft der Urartäer zu klären und ihnen eine kulturhistorische Schlüsselstellung zuzuweisen, waren wohl etwas voreilig; aber er hat eine Entdeckerchance genutzt, wie sie Historikern nur selten zuteil wird. Daneben verdienen die Beiträge zur Metrologie und zur Rekonstruktion der mesopotamischen Geschichte besondere Erwähnung. Auf diesem Gebiet steht Lehmann-Haupt in einer Reihe mit vielen anderen Forschern, die sich um die Verkürzung der anfänglich viel zu hoch angesetzten altorientalischen Chronologie verdient gemacht haben. Andere Korrekturen am bis dahin üblichen Geschichtsbild ergaben sich aus den kriegsgeschichtlichen Studien (Zug der Zehntausend, Tigranokerta) und der Sagenkritik, die sich allerdings in Grenzen bewegte. Auch als akademischer Lehrer, der historisches Wissen direkt weitervermittelt und die Vergangenheit lebendig macht, hat Lehmann-Haupt bei seinen Hörern offenbar einen starken Eindruck hinterlassen, selbst wenn die Polemik gelegentlich auf Kosten der Klarheit ging. Die damals schon seltene Verbindung altorientalischer und klassischer Sprach- und Quellenkenntnisse erweiterte auch in der Lehre seine Möglichkeiten und seinen Horizont. Dennoch ist es ihm nicht gelungen, auf der Ebene der Universität eine ‘Schule’ zu begründen sogar mit jenem Schüler, der ihm am ehesten kongenial war, mit F. Schachermeyr, kam es zur Entfremdung. Und so bleibt die Erinnerung an einen markanten akademischen Einzelgänger. Günther Lorenz 35 Franz Miltner Franz Miltner wurde am 28.10.1901 als Sohn eines Ministerialrates in Wien geboren. Seine künftige Laufbahn erscheint wie von Kindesbeinen an vorgezeichnet. An den Besuch des Gymnasiums und dessen Abschluß mit ausgezeichnetem Erfolg im Jahre 1921 schließt sich ein Studium an, das sich auf die klassischen Altertumswissenschaften konzentriert: Klassische Philologie und Klassische Archäologie stehen im Vordergrund. Der junge Student ist gleich mit dem wissenschaftlichen Betrieb eng verbunden und arbeitet schon ein Jahr nach dem Studienbeginn als Bibliothekar am Archäologisch-epigraphischen Seminar der Universität Wien, dann auch als archäologischer Stipendiat. Die Dissertation „Studien zu den römischen Schiffstypen“ wird von dem Archäologen Emil Reisch und dem Philologen Emanuel Löwy begutachtet. Die Liebe zu diesem Themenkreis sitzt sehr tief. Um sich auf diesem Gebiet praktische Kenntnisse zu erwerben, hatte schon der Gymnasiast beinahe zwei Sommermonate lang im Jahre 1920 auf einer Schiffswerft in Kiel gearbeitet. Auf die 1925 mit Auszeichnung abgelegten Rigorosen aus Klassischer Archäologie in Verbindung mit Klassischer Philologie folgt ein Jahr später die Lehramtsprüfung aus Latein und Griechisch. Miltner verfolgt seinen Weg sehr zielstrebig. Schon als Student begleitete er Rudolf Egger nach Carnuntum, nach Maria Saal und aufs Zollfeld. Mehrere Reisen führten ihn nach Italien; vier Wochen lang vergleicht er im Frühjahr 1924 den Palimpsest des Fronto für Edmund Hauler an der Ambrosiana in Mailand. Im Sommer 1925 nimmt er an einer von Josef Keil und Adolf Wilhelm geleiteten Forschungsreise nach Kilikien teil. Den Spätherbst desselben Jahres verbringt Miltner in Griechenland und den antiken Städten an der Küste Kleinasiens. Im Verein Klassischer Philologen, der nach dem Vorbild von Studentenverbindungen in Aktivitas, Inaktivitas, Alte Herren, Gönner, Ehrenmitglieder usw. organisiert ist, figuriert er 1924 als Obmann. Die deutsch-nationale Ausrichtung der Mitglieder dürfte nach Ausweis der Mitteilungen des Vereins Klassischer Philologen wie in so vielen gleichartigen anderen Studentenvereinigungen dieser Zeit vorherrschend gewesen sein. 1929 wird auch Frau Helene Miltner, geb. Zurunic, als Gönner in diesen Kreis aufgenommen, der den jungen Miltner besonders stark beeinflußt zu haben scheint. Das Vereinsleben war ungemein lebendig: studentische Kneipen, wissenschaftliche Arbeitskreise und Übungen, Feiern, Ehrungen und daneben mehrfach im Jahr wissenschaftliche Vorträge, meist von ‘Alten Herren’ gehalten und nicht selten im vollen Wortlaut im Vereinsorgan publiziert. Man stößt auf bekannte Namen: Rudolf Egger, Josef Keil, Karl Vretska, Albin Lesky. Von ihnen, insbesondere von J. Keil, hat Miltner manche Anregung erfahren, die er später in eigene Forschung umsetzen wird. Von 1924 bis 1930 - er wird dann von Harald Petrikovits abgelöst - fungiert er als Schriftleiter der Vereinsmitteilungen und veröffentlicht darin seine ersten wissenschaftlichen Arbeiten, die philologischen und archäologischen Fragen gelten (Nr. l, 2, 3 der Bibliographie). Bemerkenswert für den weiteren Lebensweg Miltners ist der in einer dieser frühen Publikationen unternommene, geradezu programmatische Versuch, von der Isolierung einzelner Schiffstypen im überlieferten - archäologischen - Material zu einer ethnischen Ausdeutung dieser Typen zu gelangen. 36 Die Grundfelder der wissenschaftlichen Betätigung von Franz Miltner sind aus diesen ersten Anhaltspunkten schon abzuleiten: Er ist und bleibt begeisterter Archäologe, gelobter Epigraphiker; ihn interessiert in hohem Maß all das, was mit (Kriegs-) Schiffen zusammenhängt, und er meint, daß sich in Schiffstypen nationale Wesenseigenheiten ausdrücken. Doch damit erfolgt schon ein Vorgriff auf spätere Abschnitte von Miltners Biographie. Kehren wir noch einmal zurück ins Wien der zwanziger Jahre und damit zu Miltners ersten selbständigen Schritten im damaligen Wissenschaftsbetrieb. Schon 1927 wird der Sechsundzwanzigjährige als ‚Nachfolger’ für den als Ordinarius für Alte Geschichte an die Universität Greifswald berufenen J. Keil provisorischer Assistent, 1929 wissenschaftlicher Assistent am Österreichischen Archäologischen Institut (ÖAI), dessen Direktorat zwischen 1909 und 1933 Emil Reisch bekleidete, während in den folgenden, für das ÖAI schwierigen Jahren Camillo Praschniker und Rudolf Egger dessen Geschicke bestimmten. Umgebung und Aufgaben waren nicht dazu angetan, neue Wege in der Art und dem Bereich des Forschens zu suchen. Mehrfach wird der junge Wissenschaftler mit selbständiger Grabungsleitung betraut, so in Ephesos als zeitweiliger Vertreter des Grabungsleiters J. Keil, in Carnuntum und Altsmyrna. Seine Frau Helene hat ihn dabei kräftig unterstützt (Nr. 17). In diese Zeit fallen auch einige in ihrer Charakteristik schon angesprochene Arbeiten: eine philologische Anmerkung zum Bericht des Livius über die Schlacht von Cannae mit den für den Schlachtverlauf daraus zu ziehenden Konsequenzen (Nr. 6); die Publikation der antiken Lampen in Eisenstadt, ebenso jene der Lampen im Klagenfurter Landesmuseum (Nr. 7, 10), und schließlich Arbeiten, in denen der Weg von der archäologischen Erfassung antiker Hinterlassenschaft zum Seewesen hin zur Umsetzung in historisch-politische bzw. kriegsgeschichtliche Fragestellungen erkennbar wird: die Veröffentlichung des pränestinischen Biremenreliefs (Nr. 8), eine Steuerruderdarstellung (Nr. 9) und 1930 „Der taktische Aufbau der Schlacht bei Salamis“ (Nr. 12). Mit dieser letztgenannten Arbeit ist wesentlich stärker als mit der kurzen Skizze zur Schlacht bei Cannae der künftige - historische - Weg vorgezeichnet, der vorläufig im umfangreichen Artikel in dem 5. Supplement zur Realencyclopädie ,,Seekrieg und Seewesen“ (Nr. 15) kulminiert. Im Sommersemester 1932 wird Miltner für Griechische Geschichte und Altertumskunde in Wien habilitiert. Als Habilitationsschrift wird der Artikel in der RE „Seekrieg und Seewesen“ angenommen. Die im Verfahren gestellte Frage, warum Miltner um die venia legendi für Griechische Geschichte und Altertumskunde ansuche und nicht um jene für Klassische Archäologie, wird damit beantwortet, daß er sich nach eigener Aussage zu wenig „mit den Aufgaben der großen statuarischen Kunst“ beschäftigt habe. Im selben Jahr 1932 wird Miltner auch Korrespondierendes Mitglied des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches. In dem der Habilitation folgenden Jahr erscheinen zwei Arbeiten historischer Natur. In den Jahresheften des ÖAI befaßt sich Miltner mit der Frage von Alexanders Strategie bei Issos (Nr. 19) und bringt auch hier seine Auffassung vom Vorrang des Seekriegs vor dem Landkrieg zum Tragen. Auch in der zweiten, ebenfalls noch in Wien entstandenen Arbeit erweitert der junge Dozent sein Blickfeld auf eine in die frühhellenistische Geschichte führende Frage; er will den staatsrechtlichen Unterschied zwischen den europäischen und den asiatischen Teilen im 37 Alexanderreich und unter seinen Nachfolgern ausfindig machen (Nr. 18). Miltner macht rasch Karriere. Da für die philosophische Fakultät der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck der umworbene Wunschkandidat von Lehmann-Haupt. Fritz Schachermeyr, nicht mehr erreichbar war, weil diesem ein ad personam gewährtes Ordinariat, wie es auch Lehmann-Haupt innegehabt hatte, nicht zugesichert werden konnte, sollte „die hoffnungsvollste jüngere österreichische Kraft“, wie Miltner von dem damaligen Rektor in Innsbruck, Harold Steinacker, genannt wurde, vor allen anderen Kandidaten zum Zug kommen. Am 13.9.1933 wird Miltner nach Innsbruck auf die auf ein Extraordinariat zurückgestufte Lehrkanzel berufen. Die ihm zugefallene Aufgabe konnte Miltner nicht sofort erfüllen, da er als Beirat der türkischen Regierung für Denkmalschutz und Denkmalpflege seit 1933 in Ankara weilte. Der emeritierte Lehmann-Haupt supplierte inzwischen die Lehrkanzel. Miltner nimmt jedoch sein zukünftiges Betätigungsfeld ernst. Darauf weist der spärlich erhaltene Briefwechsel zwischen ihm und dem Dekan der philosophischen Fakultät, Hermann Ammann, also zwischen Ankara und Innsbruck. Miltners organisatorischer Hauptwunsch nach Vorlesungszeiten früh am Morgen erinnert an Vorgänger und auch Nachfolger auf dem Lehrstuhl. Im Herbst 1934 beginnt Miltner mit seinen Lehrveranstaltungen in Innsbruck. Sein Name war aber durch die Übersiedlung nach Innsbruck in Wien nicht vergessen worden. Er wird 1937 in den Dreiervorschlag für die Besetzung des Lehrstuhls von Adolf Wilhelm aufgenommen, auf den dann Josef Keil berufen wurde. 1940 erfolgte die Ernennung zum ordentlichen Professor. Seit 1939 ist er als außerordentlicher Professor kommissarischer Dekan, mit Beginn der ordentlichen Professur vom 1.10.1940 an bis zum 27.l.1943 regulärer Dekan der philosophischen Fakultät, zwischen dem 2. Trimester 1940 und dem Wintersemester 1942/43 auch im Senat der ‚Deutschen Alpenuniversität’ vertreten. 1941 wird er für einen Ruf an die neue Universität Straßburg in die engere Wahl genommen. Unter Hinweis auf seine wichtige und ungemein aktive politische Betätigung dringt der Rektor der Universität Innsbruck, Harold Steinacker, gegenüber dem Reichserziehungsministerium darauf, daß Miltner auch weiterhin in Innsbruck bleiben soll, mit der Aussicht, ihn „für Wien aufzuheben, dessen große Tradition er in seinem Fach als einstiger Sekretär des Österr. Archäologischen Institutes und durch seine Arbeit in Kleinasien als letzter und einziger trägt.“ 1943 wird er zum Korrespondierenden Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien gewählt. Als Dekan setzt sich nun Miltner selbst für die Rückberufung des ihm geistesverwandten Volkskundlers Adolf Helbock ein und betreibt gleichermaßen mit Erfolg die Installierung eines prähistorischen Ordinariats. Die überaus positive Beurteilung durch den in seiner politischen Einstellung eindeutig zu klassifizierenden Mediävisten und Rektor der Universität (seit 14.3.1938 bis zum WS 1942/43) Harold Steinacker wirft ebenso wie die von Miltner als Dekan gesetzten Aktivitäten helles Licht auf seine politische Haltung. Steinacker bezeichnet in dem schon zitierten Brief an Harmjanz den jungen Ordinarius als den „wirklichen Führer“ einer kleinen Mannschaft (zusammengesetzt aus K. Pleyer, W. Ehmann, W. Körte , K. H. Halbach, zu denen später ein noch zu berufender Prähistoriker, ferner P. J. Junge sowie W. Del Negro kommen sollten), die den neuen Geist in der philosophischen Fakultät trage. Darüber hinaus gilt Miltner dem Rektor „auch in den allgemeinen Universitätsangelegenheiten“ als der aktivste 38 Mitarbeiter, wobei er auf die Verbindung zum Gau hinweist und seine Ämter an der Universität aufzählt. Und deren bekleidet das junge Fakultätsmitglied tatsächlich eine erstaunliche Zahl. Er ist über Jahre hinweg - schon als außerordentlicher Professor - Dekan und Senator, ist im Dozentenbund für Presse und Propaganda und im Amt für Wissenschaft des Dozentenbundes, dessen Leitung in den Händen Steinackers liegt, für Alte Geschichte zuständig. Im Studentenwerk leitet Miltner vom WS 1938/39 bis zum Wintersemester 1943/44 den Förderungsausschuß, was ihm gemeinsam mit den anderen Funktionen eine nicht geringe Macht verleiht. Doch vorerst zurück zu den Anfängen als Universitätslehrer in Innsbruck! Die Zahl der Hörer des neuen Ordinarius ist beachtlich. Er liest vor gefüllten Hörsälen, ca. 70 Studenten folgen schon im WS 1935/36 seinem frei gehaltenen Vortrag. Die Wahl der von ihm in seinen Lehrveranstaltungen behandelten Themen aus dem weiten Bereich der Alten Geschichte läßt deutlich werden, daß seine politische Gesinnung nicht in direkter Korrelation zum Erstarken des 3. Reiches zu sehen ist, sondern schon in die deutschnationale und wehrhafte Stimmung der Wiener Zeit zurückreichen muß. So beginnt für ihn die Geschichte Roms stets mit dem ‚Ringen ums Mittelmeer’; den Schwerpunkt legt er auf das Ende der Republik und die Kaiserzeit. Besonders in den Seminaren, in 10 von den 22 in Innsbruck gehaltenen, also in beinahe der Hälfte, beschäftigte er sich mit dem Germanenthema. Innerhalb der griechischen Geschichte konzentriert er sich auf das 5. Jh. v. Chr., auf die Auseinandersetzung zwischen Athen und Sparta und die Form der griechischen Demokratie. Nur selten schließt er daran einen Ausblick auf das Reich Alexanders des Großen an. Sein Lieblingsthema, der antike Seekrieg, erscheint unter Titeln wie ‚Seewesen und Seefahrt der Alten’ oder auch als ‚Antike Taktik und Strategie’. Selten figuriert unter den Lehrveranstaltungen der von ihm anderwärtig betonte Zusammenhang zwischen Antike und abendländischem Europa. Miltner findet auch im engeren Sinn Schüler. Das beweist einerseits die Zahl der bei ihm ab 1936 aufscheinenden Promovenden, andererseits auch die Teilnahme einer nicht geringen Zahl von Studenten an den von seiner Frau Helene dokumentierten Ausgrabungen in Vill bei Innsbruck. In diesem engeren Schülerkreis befanden sich ohne Zweifel eine Reihe von Studenten, die den politischen Vorstellungen des Lehrers sehr nahe standen, doch ist gleichzeitig festzuhalten - und daran wird ein gewisser innerer Widerspruch in der Haltung Miltners sichtbar -, daß der Innsbrucker Althistoriker ungeachtet seiner klaren politischen Ausrichtung auch für deutlich Andersdenkende bei gegebener fachlicher Qualifikation Partei nahm. So legte Miltner als Dekan einer Anstellung des im Cartellverband führend tätig gewesenen Robert Muth als Assistent von Albin Lesky nichts in den Weg, obwohl Muth, der spätere Extraordinarius (seit 1950) und Ordinarius für Klassische Philologie (seit 1958) an der Universität Innsbruck, öffentlich in- und außerhalb der Universität gegen Miltner wegen der gravierenden politischen Auffassungsunterschiede aufgetreten war. Und Miltner setzte sich auch für die Bestellung des im Cartellverband aktiven Dr. Genelin zum Assistenten an der Urgeschichtlichen Sammlung ein. Die wissenschaftliche Produktion Miltners bleibt in der Zeit nach seiner Berufung vorerst noch in den bisherigen Bahnen. Epigraphische Arbeiten sind die Frucht seines Aufenthalts in der Türkei. Seine 39 Frau Helene steht ihm auch hier zur Seite (Nr. 21, 24, 25). Daneben bringt er noch die in Ephesos gewonnenen Ergebnisse zu Papier (Nr. 26). Doch dann treten zunehmend historische Themen in den Vordergrund. Noch in Ankara wendet sich der frisch ernannte Extraordinarius einer ohne Zweifel von J. Keil angeregten Problemdarstellung zu. Er möchte die Sage von der Rückkehr der Herakliden für die Frage der Einwanderung der Dorer in Griechenland fruchtbar machen (Nr. 20). Das ist in seinen Augen deshalb möglich, weil diese Erzählung in ihren Hauptpunkten den historischen Ablauf der Ereignisse widerspiegeln soll. Die Dorer - das darf bei der Berücksichtigung der schon herausgestellten Neigung Miltners nicht überraschen - sollen die Peloponnes nicht auf dem Landweg, sondern über das Meer auf dem Umweg über Kreta erreicht haben. Die Arbeit weist zwei Charakteristika auf, die auch weiterhin die wissenschaftliche Produktion Miltners bestimmen werden: einmal die eben erwähnte Vorliebe, die Schiffahrt gegenüber allen auf dem Festland gelegenen Möglichkeiten stark hervorzuheben, das andere Mal die Hinwendung zu einem Thema, das mit Fragen, die im zeitgenössischen Deutschland gestellt werden, auffällig harmoniert wie hier das DorerThema. Der erstgenannte Strang im Miltnerschen Schrifttum kehrt schon ein Jahr später in der gedruckten Antrittsvorlesung in Innsbruck vom 22.11.1934 über die Bedeutung des Hellesponts in der griechischen Geschichte wieder (Nr. 22). Seit dem - wie Miltner sagengläubig meint, griechischen Angriff auf Troia spielen die Dardanellen eine entscheidende Rolle in der griechischen Kriegsführung: im Perserkrieg, der Auseinandersetzung zwischen den Makedonen und Athen, jener zwischen den Seleukiden und Rom. In pathetischen Worten unter Verwendung von nationalistischem und biologistischem Vokabular trägt er seine Argumente vor. In dem in demselben Klio-Band erscheinenden Aufsatz, betitelt „Pro Leonida“ (Nr. 23), streicht Miltner gegen die Krittelei von Beloch, d.h. gegen dessen Zweifel an der militärischen Zweckmäßigkeit des Verhaltens von Leonidas an den Thermopylen, das Zusammenspiel der Landstreitmacht mit der Flotte heraus, weshalb das Opfer des Leonidas und seiner Krieger „aus der tiefen Erkenntnis heraus (erfolgt sei), daß nur sein Tod dem Vaterland die Waffe erhalten konnte, die allein den endgültigen Sieg im Freiheitskampf zu bringen vermochte ... Und so darf er als der große Held der Nation anerkannt bleiben, denn er war vielleicht der einzige Grieche, der mit Wissen sich geopfert hat, nicht für die Polis, sondern fürs gesamte Vaterland.“ Der Hauptvorwurf, den Miltner in seiner ansonsten ungemein lobenden Darstellung des Perikles für die Realencyclopädie (Nr. 27) an den athenischen Strategen richtet, ist der, daß der ,,Staatsmann“ in der ägyptischen Expedition „dem Parteidoktrinär wertvolle Volkskräfte“ geopfert habe. Im selben Jahr 1937 erscheint eine weitere Arbeit, die einem mehr und mehr die Arbeitskraft Miltners beanspruchenden Themenkreis gewidmet ist: die Publikationstätigkeit zur Germanenfrage setzt ein. Die Blickrichtung geht vorerst noch von Rom aus: „Augustus’ Kampf um die Donaugrenze“ (Nr. 28) wird zur strategisch geplanten Unternehmung - die Flotte spielt dabei nach Miltners Auffassung eine entscheidende Rolle -, die dem römischen Imperium seine natürlichen Grenzen erschließen soll. Im folgenden Jahr erscheint in der populären Reihe „Bilder aus dem deutschen Leben“ ein voll auf 40 den ‚Zeitgeist’ eingehendes Büchlein mit dem Titel ,,Germanische Köpfe in der Antike“ (Nr. 30). Was der Innsbrucker Althistoriker an germanengeschichtlichen Untersuchungen in den nächsten Jahren vorlegen wird, ist hier grundgelegt. Die Blickrichtung ist eine andere geworden. Nun gibt der Germane Heimat und Volk nicht „frecher Fremdherrschaft“ preis; das neue germanische Volk benötigt auch neues Land; dafür ficht es seinen Heldenkampf, den es deshalb zu führen imstande ist, weil es zu seiner völkischen Einheit gefunden hat. Aber der Erfolg in diesem Kampf ist nur dann gewährleistet, wenn führerhafte Figuren, die mit Heimat und Volk eng verbunden sind, an der Spitze der Unternehmungen stehen. Ariovist, Arnim, Civilis, Alarich und Geiserich werden diesen Anforderungen voll gerecht; Marbod und Stilicho fehlt die gesunde Weiterentwicklung ihrer Anfänge, weil ihr Wirken nicht im Dienste ihres Volkes steht, sie losgelöst von der Heimat agieren. Diese Schrift ist nur zum Teil ein Lippenbekenntnis. Bleiben zwar Miltners Lehrveranstaltungen nach Aussage ehemaliger Hörer von derartigen Einflüssen in Form expliziter Wertungen frei - Gleiches gilt im wesentlichen auch für die von ihm erstellten Dissertationsgutachten -, so lassen die nun folgenden Titel seiner Schriften das enge Verhältnis zum Nationalsozialismus deutlich werden, auch wenn nicht in jedem Fall diese Ausrichtung im Text offensichtlich zu erkennen ist: „Der Germanenangriff auf Italien in den Jahren 102/1 v. Chr.“ (Nr. 35); „Die Lage von Noreia“ (Nr. 36); „Die Schlacht im Elsaß ...“ (Nr. 37); ,,Um germanische Einheit“ (Nr. 39). Über das seit 1939 erschienene germanenkundliche Schrifttum und jenes zur griechischen Geschichte referiert Miltner in der von ihm mit L. Wickert seit 1937 herausgegebenen „Klio“ mehrfach. Die Auswahl der Schriften, wie insbesondere die direkt angesprochenen Wertungen, zum Teil in der Form kritischer Bemerkungen, lassen der Interpretation über Miltners Einstellung keinen Spielraum. Sicherlich zu Recht deutet wohl auch aus diesen Gründen K. Christ an, daß sich im Niveau der Zeitschrift gewisse Konzessionen an die politische Situation erkennen ließen. Daneben behandelt Miltner weiterhin ein schon hinreichend bekanntes Thema: die Beschäftigung mit dem Seekrieg wird an die Fragen der Zeit in der Arbeit „Der Geist des antiken Seekampfes“ (Nr. 34) herangeführt. Das fällt Miltner umso leichter, als er dabei in Variationen Vorstellungen artikulieren kann, die ihn seit seinen wissenschaftlich greifbaren Anfängen begleiten. War es damals die Absicht, bestimmte Schiffstypen mit bestimmten Völkern in Korrelation zu bringen, so ist nun der Zweck der Ausführungen, das Wesen eines Volkes in einen Konnex mit der Art der Kriegsführung zu bringen. Darin zeige sich die geistige und moralische Haltung eines Volkes. Die sachliche Basis für diese Erörterungen findet sich im beinahe zehn Jahre älteren RE-Artikel von 1931. Den Höhepunkt der antiken Seekriegsführung sieht Miltner im 5. Jh. v. Chr., als wenige, offensiv orientierte griechische Schiffe in großer Disziplin auf den Meeren agierten. Diesem Nachweis dient auch seine Beschäftigung mit Themistokles (Nr. 31), schließlich auch die letzte vor dem Ende des Krieges erschienene Schrift „Landkrieg und Seekrieg im Altertum“ (Nr. 45). Die Identifizierung Miltners mit nationalsozialistischem Gedankengut, wie sie aus seinen Schriften hervorgeht, steht in deutlicher Korrelation mit seinem hochschulpolitischen Engagement. Miltner war nicht nur passives Mitglied im Nationalsozialistischen Deutschen Dozentenbund (NSDDB), sondern 41 griff sehr aktiv mit Vorträgen in die Geschehnisse ein, um der ‚Bewegung’ weitere Geltung zu verschaffen. Dennoch war auch er nicht - wie übrigens keiner der Althistoriker - bereit, den Gesamtkomplex der Antike einschließlich der altorientalischen Kulturen als Aufgabengebiet und Bereich der Fragestellungen aufzugeben bzw. sich einschränken zu lassen. Im Gegenteil: Seine Ausführungen sollten dem Nachweis dienlich sein, daß die Antike insgesamt als Wegbereiter des europäischen Abendlandes anzusehen sei, eine Auffassung, mit der er im Dozentenbund und auf den von diesem veranstalteten ‚Lagern’ hervortrat. Die Rolle, die Miltner innerhalb des Dozentenbundes spielte, wird an den Belobigungen, die F. Schachermeyr stets für ihn fand, erkennbar. Als Ergebnis des Lagers in Würzburg erscheint 1941 ein Aufsatz mit dem programmatischen Titel „Die deutsche Aufgabe der Altertumswissenschaft“ (Nr. 38) im Organ des Dozentenbundes ,,Deutschlands Erneuerung“. Sein von ihm habilitierter Schüler Peter Julius Junge äußert sich hier mit dem Thema ,,Die Aufgabe der Altertumswissenschaft im Osten“. Doch Miltners Engagement reicht darüber ein gutes Stück hinaus und auch weiter zurück. Schon 1938/39 verfaßt er einen Vorschlag für die Errichtung eines Rassenkundlich-Historischen Instituts in Rom. Hier soll die Aufarbeitung des archäologischen Materials in Verbindung mit der Auswertung der schriftlichen Überlieferung, auch einer prosopographischen Auswertung der Inschriften nach rassenkundlichen Gesichtspunkten, erfolgen. Der Innsbrucker Althistoriker richtet sein Schreiben zunächst ans Reichserziehungsministerium über den Innsbrucker Rektor Steinacker, ans Auswärtige Amt und an den Präsidenten des Deutschen Archäologischen Instituts. Obwohl Miltner dann von den vom Kuratorium der Stiftung „Ahnenerbe“ eingesetzten Begutachtern prinzipielle Zustimmung erntet, wird das Projekt - nicht zuletzt wohl wegen Interessenskollisionen bei der Verteilung allfälliger finanzieller Mittel - nicht realisiert. Gemeinsam mit Schachermeyr profiliert er sich auch mit seinen Vorträgen innerhalb des Dozentenbundes als besonders engagierter Vertreter des neuen Geistes. So darf es eigentlich nicht überraschen, daß gerade Miltner von dem Sicherheitsdienst aufgefordert wird, die Bedeutung der Alten Geschichte darzustellen und das Fach zu rechtfertigen. Die etwa im Juni 1941 verfaßte Stellungnahme liegt abschriftlich im Universitätsarchiv Innsbruck noch vor. Die grundsätzliche Berechtigung, Altertumswissenschaft zu betreiben, wird zu Beginn aus Passagen aus Hitlers „Mein Kampf“ abgeleitet und daraus, daß sich die Altertumswissenschaft in ihrer Gesamtheit nach den Ausführungen Miltners - den Rassegedanken zu eigen gemacht habe. In diesem sechs Seiten umfassenden ‚Geheimpapier’ beruft sich der aktive Parteigenosse auf den andernorts kritisierten H. F. K. Günther. Inhaltlich gesehen beharrt Miltner auch hier auf der Einheit der Antike, die ,,in jener Auseinandersetzung des Nordens mit dem Orient begründet ist, die mehr als ein Jahrtausend umspannt“. Damit gelingt es ihm, die Beschäftigung mit dem Abendland als Ganzem zu rechtfertigen; nicht nur Griechen, auch Römer sind nordisch bestimmt. Daneben wendet er sich hier allerdings - in völligem Kontrast etwa zu der einige Jahre früher veröffentlichten Rezension von W. Jaegers „Paideia“ - gegen einen Humanismus, „der sich eine Steigerung des Einzelnen ohne Bezug auf das Volksganze zum Ziele setzt“. Und im Bemühen, die Altertumswissenschaften insgesamt zu verteidigen, leugnet er, daß „eine Richtung dieser Art“ gegenwärtig existiere, und setzt gleichzeitig 42 diese „Spielart“ des Humanismus als eine liberalistisch bestimmte vom ‘eigentlichen’ Humanismus ab. Daran schließt die Forderung an, den lateinischen und griechischen Sprachunterricht zu fördern, um den Modellfall Antike, mit dessen Hilfe man bis zur Frühgeschichte des eigenen Volkes vorstoßen könne, studieren zu können. Er weist jede konfessionelle Bindung „der antiken Bildungsgüter“ zurück. Auf den praktischen Lehrbetrieb eingehend meint er, daß die Hörerzahl im Hinblick „auf die Kriegsverhältnisse nicht unbefriedigend“ sei, aber insgesamt nicht ausreichend, und schließt mit der Vision: ,,Neben den Offizieren (sic!), der heute unsere Soldaten zu ihrem unerhörten Siegeszuge für Großdeutschland führt, muss morgen der Lehrer treten, der unsere Jugend zur inneren Erfassung des Reiches führt“. Der deutlichste Niederschlag der hier offenbar werdenden, von der Überlebenskraft des Nationalsozialismus geprägten Gesinnung findet sich in dem natürlich auch vom Thema her einschlägigen Aufsatz „Sparta. Vorbild und Mahnung“ (Nr. 42). Mit ihm schließt sich der Rahmen, unter dem Miltners Arbeiten in dieser Zeit stehen, indem er auf die Beschäftigung mit den Dorern im Jahre 1934 zurückverweist. Die Terminologie, somit auch die Anpassung Miltners ist gegenüber diesen Anfängen zu ungemein weitreichender, allem Anschein nach auch überzeugter Gefolgschaft geworden. Daß man in diesen Jahren auch anders schreiben konnte, beweist der Innsbrucker Althistoriker selbst mit einer Arbeit, die bezeichnenderweise in jener Zeitschrift erscheint, die nach dem Urteil von K. Christ ihr Niveau auch in der NS-Ära halten konnte, nämlich im ‚Hermes’: „Zwischen Trebia und Trasimen“ (Nr. 43). Wenn auch Miltner seine alte These zu erkennen gibt, daß die nur mittelbare Bekämpfung des Gegners, d.h. ohne den Einsatz des eigenen Lebens, allemal zur Niederlage rühren muß, so trifft dieser Vorwurf hier doch die Römer und nicht den - semitischen Punier Hannibal, dem gegenüber er auch andernorts seine Bewunderung nicht verhehlt. Anders wird das beinahe selbe Thema in der im gleichen Jahr 1943 publizierten Schrift „Wesen und Gesetz römischer und karthagischer Kriegsführung“ in dem von J. Vogt herausgegebenen Gemeinschaftswerk „Rom und Karthago“ behandelt, an dessen Spitze der Aufsatz von F. Schachermeyr über ,,Karthago in rassengeschichtlicher Betrachtung“ steht. Hier gilt Miltners Schelte pauschal den Puniern, um daraus deren Niederlage zu erklären. Der defensive Charakter, den Miltner in der Kriegsführung der Karthager erkennt, sei zu verwerfen, weshalb jene althistorischen Kollegen, die anderen Bewertungsmaßstäben anhängen, jetzt und schon früher herbe Kritik trifft. Auf dem universitätspolitischen Feld hat Miltner Erfolge zu verzeichnen. Schon für das Wintersemester 1937/38 erreicht er die organisatorische Trennung von Archäologie und Alter Geschichte. Das bis dahin existierende Archäologisch-epigraphische Seminar wurde in ein Archäologisches Seminar und ein Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik geteilt. Mit 1.10.1940 wird Miltner zum ordentlichen Professor. Seine Berücksichtigung für die Besetzung der Lehrkanzel in Straßburg wurde schon erwähnt, ebenso seine Wahl zum Korrespondierenden Mitglied der Akademie in Wien. 1942 gelangte in München der bis dahin von Walter Otto bekleidete Lehrstuhl für Alte Geschichte zur Neubesetzung. Der Dozentenbund läßt nun Miltner seine intensive Unterstützung angedeihen. Gegen das Reichserziehungsministerium und den Münchner Fakultätsvorschlag wird vom 43 Dozentenbund wie auch vom Amt Rosenberg der hinter Helmut Berve und Josef Vogt gemeinsam mit Wilhelm Ensslin und Hermann Bengtson an dritter Stelle gereihte Innsbrucker Althistoriker forciert. Die Lehrkanzel blieb jedoch aufgrund dieser Querelen vorläufig unbesetzt und Miltner daher auch weiterhin in Innsbruck. Im Jahre 1945 schlägt all diese Förderung für Miltner ins Negative um. Aufgrund einer Anordnung der provisorischen Landesregierung für Tirol, mitgeteilt in einem Schreiben vom 23.7.1945, hat der 44jährige Ordinarius des Seminars für Alte Geschichte und Epigraphik aus dem Dienst auszuscheiden. Für die Dauer von drei Monaten, ab 1.8.1945, werden ihm noch Bezüge von RM 300.- gewährt. Helene Miltner sichert in dieser Zeit durch ihre Unterrichtstätigkeit der Familie den Unterhalt. Miltner selbst nimmt jede sich bietende Verdienstmöglichkeit wahr. Noch Kürschners Deutscher Gelehrtenkalender von 1954 enthält daher die Angabe ,,Hilfsarbeiter und Handelsangestellter“, was insofern obsolet ist, als der entlassene Althistoriker schon 1947 als a. o. Univ.-Professor in den Ruhestand versetzt wurde. In die nun folgende kurze Zeit der Vakanz der Innsbrucker Lehrkanzel fällt die Promotion von Karl Völkl (1946), dessen Dissertation vom Mediävisten Richard Heuberger und dem Altphilologen Karl Jax begutachtet wurde. Völkl habilitierte sich 1956 in Innsbruck und vertritt seit 1967 als o. Professor das Fach Alte Geschichte an der Universität Salzburg. Miltners Verbindungen nach Wien, zu den alten Lehrern, den Bekannten und Freunden aus der Studienzeit und aus der Zeit im Verein für Klassische Philologen waren nie abgerissen. So kann Miltner ab 1950 die Grabungen in Aguntum weiterführen und gräbt von 1948 bis 1956 im Auftrag des ÖAI und der Tiroler Landesregierung auf dem Kirchbichl in Lavant (Nr. 48, 49, 50). Für die Nachfolge von Josef Keil auf dem Lehrstuhl für Griechische Geschichte an der Universität Wien wird Miltner für Fritz Schachermeyr zum ernsthaften Konkurrenten, doch wurde der letztere schließlich wohl um den starken Meinungsdiskrepanzen in und außerhalb der Fakultät ein Ende zu bereiten primo et unico loco gereiht. 1954 findet er als Staatsarchäologe I. Klasse beim ÖAI, zu dessen Direktor seit 1949 Josef Keil zuerst allein, dann gemeinsam mit Otto Walter (1951-53) und Fritz Eichler bestellt worden war, wieder eine feste Anstellung und übersiedelt zurück in seine Heimatstadt. Die Themen der wissenschaftlichen Beschäftigung Miltners - hat man die gesamte bisherige Produktion vor Augen - veränderten sich nur unwesentlich. Mit der Rückkehr zum ÖAI treten naturgemäß Arbeiten archäologischer Provenienz wieder in den Vordergrund. Doch die erste in der Nachkriegszeit und nach seiner Entlassung als Universitätslehrer gedruckte Arbeit bezieht sich - wie die beinahe 25 Jahre früher erschienene Dissertation - auf die schon damals als wesentlich empfundene Herstellung einer Korrelation von Schiffstypen und ethnischen Besonderheiten: „Über die Herkunft der etruskischen Schiffe“ (Nr. 46). Wieder in die Sphäre des Seekriegs führen ,,Der Okeanos in der persischen Weltreichsidee“ (Nr. 54), aber auch die Bemerkungen zum Alexanderfeldzug (Nr. 59), wobei sich Miltner nicht enthalten kann anzudeuten, daß der Zweite Weltkrieg wegen der Schwäche auf der See verloren gegangen sei. Auf prosopographisch orientierte Artikel für die Realencyclopädie (Nr. 53) folgen Überlegungen „Zur Frühgeschichte der Phöniker“ (Nr. 56), 44 philologisch geprägte Studien „Aus der Frühgeschichte des Namens Europa“ (Nr. 57), „Wesen und Geburt der Schrift“ (Nr. 60), schließlich eine Art Wiederaufnahme bzw. Anschluß an die Forschungen zum Staatssystem des Reichs von Alexander III. und seiner Nachfolger (Nr. 61, 62, 67). Auch das Germanenthema wird nicht beiseite geschoben: „Von germanischer Waffenübung und Kriegskunst“ lautet der Festschriftbeitrag für Konrad Ziegler (Nr. 58); daneben steht der unvollendete Artikel für die RE „Vandalen“ (Nr.63). In der Rezeption durch jüngere althistorische Kollegen figuriert Franz Miltner besonders mit seinem 1955 erschienenen Aufsatz „Die Grenzmark zwischen Antike und Mittelalter“ (Nr. 65), der für wert erachtet wird, in den von P. E. Hübinger herausgegebenen Sammelband „Zur Frage der Periodengrenze zwischen Altertum und Mittelalter“ aufgenommen zu werden. Der Anstoß für die hier angestellten Überlegungen - das zu vermuten erscheint legitim - dürfte in seinen früheren Versuchen liegen, das Altertum als Einheit zu erweisen und somit die Ausgliederung der ‚ostischen’ Kulturen daraus zu verhindern. Wie immer man diesen Versuch bewerten mag, er beweist eines doch recht klar: Die Anschauungen, die Miltner vor 1945 vertreten hat, sind in ihren Grundzügen nicht als ephemere Anbiederung an den ‘Zeitgeist’ zu betrachten, sondern entsprechen durchaus seinen wesentlichen Grundvorstellungen sachlicher wie wertender Natur. Auf archäologischem Gebiet erwarb sich nun Miltner vor allem durch seine Tätigkeit in Ephesos bleibende Verdienste (Nr. 66). Nach einer Voruntersuchung im Jahre 1954 führte er alljährlich großangelegte Grabungen durch, setzte erstmals technisches Gerät in großem Umfang für die Erdarbeiten ein und bemühte sich besonders auch um die Wiederaufrichtung der Ruinen. Unermüdlich wirbt er für diese Grabung, und geradezu selbstverständlich ist auch seine letzte Publikation diesem Ort gewidmet: ,,Ephesos. Stadt der Artemis und des Johannes“ (Nr. 68). 1958 erhält Miltner als Anerkennung den Theodor-Körner-Preis. Infolge einer Gehirnblutung erblindet Miltner auf einem Auge. Wohl aus dem Bewußtsein, daß die Zeitspanne für seine Arbeit nicht mehr lange bemessen sein dürfte, erklären sich nach übereinstimmender Aussage des Lehrers und des Kollegen, J. Keil und F. Eichler, seine rastlose Tätigkeit, unablässig sich ablösende Grabungskampagnen und dichte Aufeinanderfolge von Publikationen. Das alles überfordert die geschwächte Gesundheit. Am 23. Juli 1959 ist Franz Miltner einer zweiten Gehirnblutung erlegen. Christoph Ulf 45 Franz Hampl Eine Vorbemerkung in eigener Sache: Meine erste persönliche Begegnung mit Franz Hampl fällt in das Jahr 1962. Auf einer Reise nach Südtirol nächtigte ich in einem Innsbrucker Hotel. Nach einem Telephonanruf im Institut für Alte Geschichte am Innrain hieß es, Herr Professor Hampl werde im Hotel vorbeischauen, was dann auch bald geschah. Die Überraschung war groß, der erste Eindruck ein bleibender - Seine Magnifizenz kam mit dem Fahrrad. Als dann wenig später Franz Hampl in Graz für mehrere Jahre die Supplierung der Lehrkanzel übernommen hatte, eröffneten sich mir viele Möglichkeiten, diesen radfahrenden Althistoriker auch als Wissenschaftler und akademischen Lehrer näher kennen und schätzen zu lernen, zumal ich auf seine Einladung hin von 1967 bis zu meiner Berufung an die Karl-Franzens-Universität als sein Mitarbeiter am Institut für Alte Geschichte in Innsbruck wirken durfte. In diesen dreizehn Jahren enger Zusammenarbeit (von 1964 - 1976), bei der ich natürlich der nehmende Teil war, prägte sich mir das Bild einer Persönlichkeit ein, das zugegebenermaßen allein schon wegen der Dankbarkeit, die ich für Franz Hampl empfinde, nicht frei von Subjektivismen bleiben kann. I. Als Sohn des altösterreichischen Generalstabshauptmanns Arno Hampl und dessen Ehefrau Charlotte, geb. Reifferscheidt, am 8. Dezember 1910 in Bozen geboren, verlor Franz Hampl gleich zu Beginn des Ersten Weltkrieges seinen Vater. Die Witwe übersiedelte daraufhin mit ihren beiden Töchtern und dem schulpflichtigen Franz nach kurzem Zwischenaufenthalt in Innsbruck (1916/17), wo sie im gleichen Hause wie der Althistoriker Rudolf von Scala wohnte, nach Schwarzenberg in Vorarlberg. Diesem aus zahlreichen eindrucksvollen Bregenzerwälderhäusern bestehenden Dorf, aus dem auch die bekannte, mit J. J. Winckelmann in Verbindung stehende klassizistische Malerin Angelica Kauffmann stammt, hat sich Franz Hampl stets aufs engste verbunden gefühlt. Nicht oft bin ich jemandem begegnet, in dessen Erinnerung der Heimatort einen so nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. Das wissen wohl auch die Besucher seiner Lehrveranstaltungen zu bestätigen. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat es Franz Hampl, der inzwischen nach Deutschland gegangen war, wieder hierher zurückgezogen, und es mußten noch Jahre nach dem Ruf an die Universität Innsbruck verstreichen, ehe die Familie aus dem ,,Ländle“ an den neuen Dienstort übersiedelte. Die ersten Vorlesungsmanuskripte wurden noch in Schwarzenberg und seiner Umgebung ausgearbeitet, und die engen Kontakte zu Vorarlberg und seiner dörflichen Bevölkerung haben sich bis heute erhalten. Manches aus dem Brauchtum, dem Sagen- und Märchenschatz dieses Landstriches hat sich den Hörern eingeprägt, und regelmäßig pflegte Franz Hampl auf Exkursionen in Rom die Studenten auf das Grab der großen Künstlerin in S. Andrea delle Fratte hinzuweisen. Die Beherrschung des Schwarzenberger Dialektes ermöglichte es ihm, sich gleichsam neben seinem ostösterreichischen Assistenten in einer „Geheimsprache“ mit Studenten und Kollegen aus dem Bregenzerwald zu unterhalten. Studienweg, Krieg und akademische Laufbahn haben Franz Hampl von seiner zweiten Heimat weit weg geführt. Nach dem Besuch der Oberrealschule in Dornbirn (1921-28) und der Ablegung der 46 Ergänzungsprüfungen für Realgymnasien und humanistische Gymnasien in Feldkirch führten den seit Jugendjahren von der Geschichte und ihrer Erforschung Faszinierten seine Wanderjahre als Studenten nach Leipzig, von dort nach Frankfurt und Kiel, ehe erneut Leipzig für einige Jahre sein Wohnsitz wurde. Es wird wohl nicht ohne Einfluß auf Franz Hampls Lebensweg gewesen sein, daß sein berühmter und auch begüterter Onkel Hans Driesch, Begründer des sog. kritischen Vitalismus und von 1922 bis 1933 o. Professor an der traditionsreichen Universität in Leipzig, seine Sommerferien gerne am Bödele bei Dornbirn verbrachte. Das hatte schon seinerzeit die Beziehung der Familie zu Schwarzenberg geprägt und die Übersiedlung Franz Hampls vom ,,Ländle“ in die Sachsenmetropole wohl erleichtert. Zum Studium der Alten Geschichte dürfte der bekannte Biologe und Naturphilosoph seinen Neffen kaum inspiriert haben, lese ich doch in einer Philosophiegeschichte über jenen: „Nur die Geschichte bleibt jenseits der Betrachtung, - Driesch hielt von ihr so wenig wie Schopenhauer“. Franz Hampl hat zwar auch Lehrveranstaltungen seines Onkels besucht und als Historiker stets mit besonderer Aufmerksamkeit den Forschungsstand der Biologie und vor allem der Evolutionstheorie verfolgt (wovon die treue Institutsbibliothekarin, Frau Eva-Maria Pyrker, wohl ein Lied zu singen weiß), aber sein primäres Berufsinteresse stand seit Jugendjahren fest: Er wollte Historiker werden. Aus der langen Reihe von Professoren und Dozenten, deren Lehrveranstaltungen Franz Hampl besuchte, seien einige ausgewählt: H. Berve, M. Geizer, H. Prinz, 0. Th. Schulz (Alte Geschichte); E. Brandenburg, W. Goetz, H. Grundmann (Mittlere und Neuere Geschichte); F. Altheim, E. Bethe, H. Drexler, R. Harder, F. Jacoby, F. Klingner, A. Körte, K. Reinhardt, W. Theiler (Klassische Philologie); W. H. Schuchhardt, B. Schweitzer (Archäologie); F. Heinemann, Th. Litt, P. Tillich, Th. Wiesengrund/Adorno (Philosophie). In Leipzig erfolgten in knappen Abständen Promotion zum Doktor der Philosophie (1934) sowie Habilitation und Dozentur für das Fach Alte Geschichte (1937 und 1939), in Leipzig erhielt Franz Hampl nach dem Weggang von Hans Schaefer auch eine Assistentenstelle bei Helmut Berve (ab l. Mai 1934), mit dem er bis zu dessen Tod fachliche und persönliche Kontakte pflegte. Als Famulus wurde er in den offenbar selektiven Kreis der Berve-Schüler aufgenommen, doch bemerkt Franz Hampl in seinem Nachruf zu Helmut Berve, daß es „nie zur Bildung einer Schule im engeren Sinn des Wortes“ gekommen sei. Immerhin hat sich Franz Hampl aus jenen Tagen einige Eindrücke bewahrt, von denen Berves Kontaktbereitschaft zu Kollegen verwandter oder fremder Fächer, die das interdisziplinäre Gespräch „mit Freunden und nicht zuletzt mit Studierenden“ pflegten, zu den stärksten zählt: „Die geselligen Abende im Hause der Ludolf-Colditz-Straße in Leipzig, wo über die verschiedensten historischen Themen zunächst referiert und dann diskutiert wurde, blieben gewiß jedem, der dabei sein durfte, in lebhafter Erinnerung“ (a.O. 415). Von den Studienkollegen am Leipziger Institut erinnert sich Alfred Heuß noch an diese Jahre, Reminiszenzen, die er mir freundlicherweise in einem Brief am 4. Dezember 1984 mitteilte. Darin verweist Heuß darauf, „daß die sog. ‘Berveschule’ ohne jeden menschlichen Kontakt untereinander war“, und auf „Berves mangelndes Talent auf diesem Gebiet. Er widmete sich viel mehr fachfremden Studenten. Aber hier war H. eine Ausnahme. B. kümmerte sich um ihn, was seine äußeren Verhältnisse anging, mehr als 47 sonst um einen. Er nahm H. auch als Wohngenossen in sein Haus ... und machte ihn später auch zum Famulus. Auch übte er wohl beträchtlichen Einfluß auf den Gang seines Studiums aus. H. kam durch B. in die Studienstiftung, sein auswärtiges Studium in Kiel und Frankfurt ist gewiß auch auf Rat von Berve zustandegekommen (Kiel wegen Jacoby, Frankfurt wegen Geizer) ... Eine der wenigen Gemeinsamkeiten mit uns anderen bestand darin, daß er ebensowenig wie wir ein Freund des Dritten Reiches war. Das war insofern merkwürdig, als Berve selbst Wert darauf legte, als ein zuverlässiger Gefolgsmann zu gelten. Bei Hampls - äußerlich - nahem Verhältnis zu B. lag darin natürlich eine ganz besondere Delikatesse“. Hier in Leipzig lernte Franz Hampl auch seine zukünftige Frau Edith, geb. Weber, als Studierende kennen, die er zu Beginn des Zweiten Weltkrieges heiratete und die ihm in ihrer Umsicht wohl alle Möglichkeiten bot, sich ganz der Forschung und der Lehre widmen zu können. Dieser Ehe entstammen die drei Töchter Ruth, Gisela und Angelika. Schon wenige Jahre nach Erlangen der venia docendi erhielt Franz Hampl einen Ruf auf das Extraordinariat für Alte Geschichte in Gießen, wo durch die Übersiedlung des damals dort lehrenden Kurt Stade nach Königsberg die Lehrkanzel frei geworden war. Etwa gleichzeitig wurde Franz Hampl von der Philosophischen Fakultät in Jena für den Lehrstuhl nach Hans Schaefer, der nach Heidelberg ging, primo loco gereiht. Und das, obwohl es in einem kritischen Gutachten über Franz Hampl (und H. Bengtson) hieß, beide Dozenten hätten „die Behandlung von Fragen, die eine rassische Geschichtsbetrachtung stellt“ (a.0. 79), vermieden. Zwar hatte Franz Hampl den Ruf nach Gießen als beamteter a. o. Professor angenommen, doch kam es zu keiner faktischen Lehrtätigkeit an diesem traditionsreichen Institut: Zunächst leistete er nämlich als einfacher Soldat in Polen und Rußland Kriegsdienst, den dann eine infektiöse Gelbsucht unterbrach; später hinderten ihn seine Entsendung an die Kriegshochschule in Hannover und sein Einsatz als Offizier (zuletzt als Hauptmann) bei den Kämpfen in Italien (besonders um Monte Cassino) und schließlich, nach dem Weltkrieg, die Auflösung der Universität Gießen an der Realisierung seiner ersten Berufung. Daß Franz Hampl auch unter den Belastungen der Kriegsereignisse den Althistoriker nicht verleugnen konnte, beweisen beispielsweise seine Versuche, einer Kompanie den Minervatempel in Assisi nahezubringen, oder, bei anderer Gelegenheit, die Schlacht am Trasimenersee zu rekonstruieren und die Schiefe Schlachtordnung beim Exerzieren nachzubilden. Nach den Kriegsjahren und einer kurzen amerikanischen Kriegsgefangenschaft in der Tschechoslowakei dürfte es für Franz Hampl wohl deprimierend gewesen sein, ,,als er sich 1945/46 nach dem Wiederbeginn der Vorlesungen erkundigte und sich zur Lehrtätigkeit und zum Wiederaufbau zur Verfügung stellte“, zur Kenntnis nehmen zu müssen, daß die philosophische Fakultät der Universität Gießen ihre Pforten nicht mehr öffnen werde. Aber lange brauchte der Professor mit einer fünfjährigen „Dienstzeit“ außerhalb des Hörsaals nicht zu warten. Schließlich genoß der junge Althistoriker aus dem Kreis der Leipziger Berve-Schüler, zu dem so bekannte Forscher wie A. Heuß, W. Hoffmann, E. Kirsten, H. Rudolph und H. Schaefer zählen, keine geringe Reputation. Einem Ruf auf das Ordinariat in Mainz (1946), wo Franz Hampl nur drei Semester lang lehrte, folgte bald ein weiterer an jene Universität, von der sich Franz Hampl dann zeitlebens nicht mehr trennen sollte, trotz weiterer ehrenvoller Einladungen auf althistorische 48 Lehrkanzeln in Graz - wo Franz Hampl primo et unico loco vorgeschlagen wurde - und Bonn. Sein Vorgänger am Innsbrucker althistorischen Institut war Franz Miltner (1933-1945). Die Verbundenheit Franz Hampls mit der Innsbrucker Universität, die sich auch in der Wahl zum Dekan (1952/53) und zehn Jahre später zum Rector magnificus ausdrückte, währte eine ganze Ära lang von 1947 bis über das Jahr der Emeritierung, 1981, noch hinaus. In diesen Jahren hat sich Franz Hampl auch in organisatorischer Hinsicht, sowohl als akademischer Funktionär (ich möchte das Wort „Würdenträger“ bewußt vermeiden) wie auch als langjähriger Direktor der Lehramtsprüfungskommission (vom WS 1957/8 bis ins WS 1982/3), große Meriten erworben, wobei er in seiner Sparsamkeit stets (und zu Recht) darauf stolz war, lange Zeit ohne Sekretariat auszukommen. Bleibende Verdienste schuf er sich auch um die Südtiroler Bildungspolitik, sei es in der Ausbildung zahlreicher Südtiroler Studierender in Innsbruck, sei es in seinen Aktivitäten im Rahmen des Südtiroler Bildungszentrums und in Gemeinschaftsprojekten von Innsbruck und Padua. Vor allem aber trägt er - nach mehrfachen Bemühungen in Rom - einen maßgeblichen Anteil daran, daß der von Südtirolern in Österreich erworbene akademische Grad eines Magisters heute auch in Italien anerkannt wird. Alle diese Verdienste gaben den Ausschlag für die Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich. Anerkennung für seine wissenschaftlichen Arbeiten erfuhr Franz Hampl unter anderem durch die ehrenvolle Mitgliedschaft am Deutschen Archäologischen Institut sowie durch die Verleihung des griechischen Phönixordens; die österreichische Akademie der Wissenschaften hat den international renommierten Gelehrten dagegen bis heute nicht zu ihrem Mitglied gemacht. Als Emeritus ist Franz Hampl erfreulicherweise nicht in Gram von seinem Institut geschieden. Zum wöchentlichen Jour-fixe der Innsbrucker Althistoriker erscheint Franz Hampl - wie ich vom Hörensagen weiß - mit einiger Regelmäßigkeit, soferne ihn nicht Verpflichtungen, vor allem in der Erwachsenenbildung, die ihm in den letzten Jahren ein ganz besonderes Anliegen geworden ist, davon abhalten. II. Bezüge zwischen Biographie und Bibliographie herzustellen, hat in jedem Fall etwas Vordergründiges, Triviales an sich. Daß die ersten Publikationen von Franz Hampl in ihrer Themenstellung den Prägestempel des prominenten Doktorvaters tragen, scheint kaum anzweifelbar. Dennoch wäre zu bedenken, daß schon früh mit einer Wechselwirkung zwischen Lehrer und Schüler gerechnet werden kann, und das Studium von Berves Arbeiten aus dieser Zeit läßt nicht ausschließen, daß hier auch manches Eingang gefunden hat, was als Produkt eines regen geistigen Austausches zwischen Generationen anzusehen wäre. So meine ich den von Franz Hampl in seiner gedruckten Dissertation „Der König der Madedonen“ (Nr. l*, 1934) entwickelten Gedanken zur ambivalenten Position des Herrschers - König nach innen und zugleich mächtiger Privatmann nach außen - in H. Berves Tyrannenbild wieder erkennen zu können. Da heißt es bei Berve beispielsweise, die „lockere Struktur der spätarchaischen Poleis“ gestatte es durchaus, eine eigene ‚Private Außenpolitik’ zu 49 verfolgen. Und gerade in bezug auf die hier angesprochenen Philaiden hatte Franz Hampl bereits 1939 die besagte These aus seiner Doktorarbeit erneut - allerdings unter einem anderen Aspekt aufgenommen, und zwar in seiner von der Fachwelt vielbeachteten Studie „Poleis ohne Territorium“ (Nr. 10, 1939). In diese erste schöpferische Forschungsphase des Assistenten, der wohl noch nicht von Lehre und Verwaltung allzusehr eingeschränkt war, gehören auch so aufwendige und scharfsinnige Untersuchungen wie „Olynth und der chalkidische Staat“ (Nr. 3, 1935), „Die lakedämonischen Periöken“ (Nr. 5, 1937), „König Philippos“ (Nr. 7, 1938), „Zur angeblichen koinh\ ei0rh&nh von 346 und zum Philokrateischen Frieden“ (Nr. 8, 1938) und vor allem die als „Preisschrift der Fürstlich Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzig“ herausgebrachte Habilitationsschrift „Die griechischen Staatsverträge des 4. Jahrhunderts v. Christi Geb.“ (Nr. 6, 1938). Retrospektiv betrachtet bleibt wohl unbestritten, daß Franz Hampl sich in seinen ersten Publikationen mit verfassungsgeschichtlichen Problemen bei den Griechen befaßte, wie sie auch bei H. Berve damals im Vordergrund standen. F. Gschnitzer, der sich 1957 in Innsbruck für Alte Geschichte habilitierte und dessen wissenschaftliche Reputation im Bereich der griechischen Staatskunde und Verfassungsgeschichte international wohl unbestritten ist, nennt diese „Arbeiten der Leipziger Jahre“ - und hier spricht der Heidelberger Althistoriker zugleich als ‚Enkelschüler’ Berves „bahnbrechende Untersuchungen“. Und A. Heuß meint in dem bereits oben zitierten Brief, daß ,,Hampls Leipziger Arbeiten ... reine Eigenbaugewächse“ waren, die u. a. Berve zu dessen Spartabüchlein (Meyers Kleine Handbücher Bd. 7, 1937) „inspiriert hätten“, was freilich nicht für die faschistischen Elemente darin gilt; weiter lese ich bei Heuß: „Er (= Franz Hampl) war damals der scharfsinnigste Forscher auf dem Gebiet des griechischen Staats ... Wenn von einer Berveschule im Hinblick auf den antiken Staat gesprochen wurde, besaßen Hampls Arbeiten die größte Leuchtkraft.“ Fragen der römischen Geschichte wendet sich Franz Hampl erst in den frühen fünfziger Jahren zu: Am Anfang stehen hier Untersuchungen „Zur Lokalisierung der Schlacht bei Noreia“ (Nr. 12, 1950) und „Zur römischen Kolonisation in der Zeit der ausgehenden Republik und des frühen Prinzipates“ (Nr. 13, 1952). Mit diesen Jahren beginnt auch die umfangreiche Rezensententätigkeit zur griechischen wie römischen Geschichte. Natürlich hat man in Rechnung zu stellen, daß die Wirren des Weltkrieges und der ersten Jahre danach, in denen die meisten altertumswissenschaftlichen Publikationsorgane vor großen Schwierigkeiten standen und in denen Franz Hampl auch seine ersten Vorlesungszyklen auszuarbeiten hatte, für die fast zehnjährige Lücke zwischen 1939 und 1948 im Schriftenverzeichnis des Jubilars verantwortlich zu machen sind. Offensichtlich korreliert jedoch die ständige Ausweitung der Forschungsanliegen, die ja in den folgenden Jahrzehnten für Franz Hampl geradezu als ein Markenzeichen gilt, mit der Innsbrucker Lehrtätigkeit. Denn bald finden die erweiterten Fachinteressen in seinen Schriften und Buchbesprechungen ihren Niederschlag. Trotz dieses interessenbedingten Wandels haben alle Schriften einen gemeinsamen Nenner: die ausgesprochen nüchterne und kritische Darstellungsweise, der jeder Hang zum Pathetischen fehlt. Man könnte dem 50 Gesamtwerk ein Wort Epicharms als Motto vorausschicken: „Sei nüchtern und mißtrauisch - das sind die Gelenke des Geistes“ (Epich. Fr. 13 D). Die Beachtung dieses Imperativs hat Franz Hampl auch seinen Hörern stets vorgelegt. Das gilt sogleich auch für den hier im Anschluß behandelten Forschungsgegenstand. Die Studien zu Alexander, zunächst zu seinen Hypomnemata und letzten Plänen (Nr. 15, 1953), dann zur Beurteilung seiner Persönlichkeit in der modernen Forschung (Nr. 16. 1954), erscheinen prima vista zwar als eine Annäherung an Fragestellungen der Dissertation, doch zeigt die Lektüre, ebenso wie das Endergebnis, in welches diese Untersuchungen gleichsam münden, nämlich die als Taschenbuch erschienene Biographie: „Alexander der Große“ (Nr. 21, 1958, ²1965) rasch und eindeutig, daß völlig neue Forschungsperspektiven zu den älteren hinzukommen. Anders nämlich als die Alexanderforschung seit J. G. Droysen entnimmt Franz Hampl den Quellen kein wie immer geartetes rationales Grundkonzept, demzufolge der Makedonenkönig eine Vereinigung von Orient und Okzident unter ökumenischer Herrschaft und somit eine Verschmelzungspolitik angestrebt habe. Überhaupt könne der Akzent in der Einschätzung dieser Herrscherpersönlichkeit bei einem recht beträchtlichen Teil der Entschlüsse und Handlungen Alexanders „auf Emotionen und nicht ausschließlich auf rationale, nüchterne Einsichten“ (GakW II, 1975, 219) gesetzt werden. Mit dieser rigorosen Absage an ‚Orient-Okzident-VerschmelzungsideeHistoriker’ und ‚Alexander-Kulturmission-Historiker’, die seiner Meinung nach insofern einer beschönigenden Historie huldigen, als sie das Wirken des Makedonenkönigs von Ideen und Konzepten bestimmt sehen, verweist Franz Hampl zugleich auf andere Persönlichkeiten der Universalgeschichte, denen aufgrund ihrer inneren Einstellung „eine möglichst ideale Gestaltung ihrer Herrschertätigkeit“ sehr wohl als ernsthaftes Anliegen bescheinigt und deshalb aus seiner Sicht der Ehrentitel eines ‚Großen’ der Geschichte verliehen werden könne. Da diese Gestalten die Geschichtsauffassung Franz Hampls kennzeichnen, seien sie kurz so genannt, wie sie Franz Hampl selbst einmal aufzählte: Solon, Ashoka, Jayavarman VII., Shi Huang-Ti, die Adoptivkaiser von Hadrian bis Mark Aurel, Friedrich II. von Hohenstaufen, Heinrich IV. von Frankreich-Navarra, Cromwell, Peter der Große von Rußland, Kaiser Meji und sein großer Helfer Ito (a.O. 225), zu denen noch so manche markante Persönlichkeit trat wie last but not least der Aztekenherrscher Netzahualcoyotl. Ein Platz im Ehrenbuch der Geschichte steht nach Franz Hampl natürlich nicht nur großen Politikern und Staatsmännern zu, heißt es doch an anderer Stelle der gleichen Studie: „Wir kennen noch eine Art von historischer Größe, die Größe von Männern, die kraft entsprechender Anlagen zu neuen Konzeptionen auf dem Gebiete des Geistes, der Sittlichkeit, des Rechtes und der Kunst gelangten und eben damit die kulturelle Entwicklung vorwärtstrieben. Gerade wir heute sind geneigt, diesen Großen den Vorzug vor jenen anderen zu geben, die sich vornehmlich mit dem Schwert in das Buch der Geschichte eintrugen“ (a.O. 218). Ich glaubte hier ausführlicher zitieren zu dürfen, weil sich an dieser schon von Jacob Burckhardt aufgeworfenen Frage nach der historischen Größe eine grundsätzliche Seite im Geschichtsdenken Franz Hampls auftut. Daß das griffig formulierte Urteil über Alexander in der Altertumswissenschaft nicht ohne 51 Resonanz blieb, dokumentiert nicht nur die Rezeption von Franz Hampls Ergebnissen bei Jakob Seiberts einschlägigem Forschungsbericht, sondern auch etwa ein aus dem Nachlaß Konrad Krafts von H. Gesche herausgegebenes Werk, dessen Titel „Der ‚rationale’ Alexander“ gleichsam als Alternative zum Alexanderbild Franz Hampls verstanden werden darf. Es mag nicht purer Zufall sein, daß etwa in der gleichen Zeit, in der Franz Hampls Alexanderstudien beginnen, auch geschichtsphilosophische und wissenschaftstheoretische Fragestellungen in den Vordergrund rücken und in der Publikationsliste aufscheinen. Eine Schlüsselstellung möchte ich in dieser Hinsicht dem umfangreichen HZ-Aufsatz „Grundsätzliches zum Werke A. J. Toynbees“ (Nr. 14, 19-52) einräumen, zumal hier neben begriffsgeschichtlicher Analyse (Was ist Kultur?), neben Methodenreflexion und neben der Frage nach Gesetzmäßigkeiten in der Geschichte erstmals ein Grundakkord im geschichtswissenschaftlichen Opus von Franz Hampl angeschlagen wird, der in zahlreichen späteren Studien bis hin zu seinen vorerst letzten Arbeiten in immer wieder neuen lehrreichen Varianten durchklingt: das Thema vom Kulturverfall und damit die Frage nach allgemeinen Formen der Kulturentwicklung. Toynbees Hypothese, „daß von sechsundzwanzig bisher nachweisbaren Kulturen fünfundzwanzig zugrunde gingen oder heute im Sterben liegen“ (Nr. 14,464 f.) und sich der Niedergang überall in den gleichen drei Stufen (Zeit der Wirren, der späten Scheinblüte und des Barbarensturms) vollziehe, veranlaßt Franz Hampl erstmals, „die notwendigen, sehr weitgehenden grundsätzlichen Vorbehalte zu machen und die Grenzen zu ziehen, die Toynbee trennt von den Forschern, für die begriffliche Klarheit, methodische Sauberkeit, Folgerichtigkeit in der Durchführung der Gedanken und strikter Verzicht auf Betrachtungen rein phantastischen Inhaltes die selbstverständlichen Voraussetzungen für alles wissenschaftliche Arbeiten bilden“ (a. 0. 466). Sehen wir von Franz Hampls umfangreicher Rezensionstätigkeit ab, so spannt sich der Bogen seiner methodisch-kritischen Arbeiten zu Fragen des Kulturverlaufs von den beiden weiteren HZAufsätzen ,,’Stoische Staatsethik’ und frühes Rom“ (Nr. 20, 1957/1979) und „Römische Politik in republikanischer Zeit und das Problem des ‚Sittenverfalls’“ (Nr. 23, 1959/1979), die in der Studie „Das Problem des Aufstiegs Roms zur Weltmacht“ (Nr. 46, 1979) thematisch noch eine spätere Ausweitung erfahren, über die Antrittsrede anläßlich der Inauguration zum Rektor mit dem Thema „Das Problem des Kulturverfalls in universalhistorischer Sicht“ (Nr. 28, 1963) bis zu den beiden Abhandlungen „Zum Problem der Einheit des Altertums“ (Nr. 32, 1966) und „Gedanken zur Diskussion über die Grenzscheide zwischen Altertum und Mittelalter“ (Nr. 33, 1967). Daß die Beschäftigung mit der Problematik eines Kultur- und Sittenverfalls und der generellen Thematik der Entwicklungsgeschichte - will sie für den Historiker Ersprießliches leisten und das Niveau von Epigonen der Hesiod’schen Weltzeitalter-Lehre überwinden - neben klarem Terminologieverständnis und methodisch transparentem Verfahren eine breite Vergleichsbasis erfordert, hat Franz Hampl in diesem Kontext als grundlegende Prämisse erkannt. Damals, d.h. in der Auseinandersetzung mit Toynbee, wurde Franz Hampls Postulat einer universalhistorischen Betrachtungsweise erstmals in Ansätzen sichtbar. Zwar dominiert in dieser Studie noch der Vergleich mit griechischer Kunst und 52 Kultur, doch kommen, bedingt durch die kritische Auseinandersetzung mit Toynbee, neben Ausblicken auf neuzeitliche Kulturen auch schon solche auf Primitivvölker, auf die präkolumbische und kretisch-minoische Kultur, auf Altägypten und Altpersien vor (Nr. 14, 458 ff). Zuletzt hat Franz Hampl zur Notwendigkeit einer universalhistorischen Sicht bei der Beschäftigung mit dem Problem des Kulturverfalls in seinem teilweise bekenntnishaft formulierten „Rückblick und Ausblick“ (1979) Stellung bezogen (GakW III, 1979, 318 ff). III. In der Retrospektive hat es für mich den Anschein, daß der englische Kulturphilosoph so etwas wie ein erster Reibebaum für Franz Hampl geworden ist. Jedenfalls vollzog sich in jenen Jahren Franz Hampls Abrücken von der traditionsreichen staatskundlich orientierten Althistorie, das ihn zu einem Kulturhistoriker par excellence werden ließ. Die damit verbundene Hinwendung zu neuen Problembereichen weisen vor allem die drei Bände der ,,Geschichte als kritische Wissenschaft“ (GakW I-III, 1975/1979) aus. In ihnen lassen sich drei Forschungsschwerpunkte hervorheben. Sie haben ihren Niederschlag zunächst wohl in den attraktiven Donnerstagnachmittag-Vorlesungen gefunden, sind dann aber erwartungsgemäß auch in den übrigen Lehrveranstaltungen und in den Publikationen abgehandelt worden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit seien diese neuen, für einen Althistoriker keineswegs selbstverständlichen Interessensbereiche im folgenden kurz dargestellt. l. Geschichtstheorie und Geschichtsphilosophie Von Toynbee führt der Weg zu einer langen Reihe moderner Geschichtsdenker, mit denen sich Franz Hampl auseinandersetzt (z.B. O.Spengler, K. Jaspers, K. Löwith, K. Breysig, A. Weber, A. Rüstow, H. Freyer, Th. de Chardin), er führt aber zugleich auch zu grundsätzlichen Methodenfragen der Geschichtswissenschaft. Hierbei stehen die Probleme der Wahrheitsfindung und Wertung, der Terminologie und der Kommunikationsschwierigkeiten im Zentrum der Disputationen. Sozusagen zwangsläufig bewirken diese Erörterungen über induktive und deduktive Methode, über Definitionstheorie sowie Probleme der Verifikation und Falsifikation auch eine Auseinandersetzung mit modernen Denkrichtungen wie dem „Kritischen Rationalismus“ Karl Poppers und seiner Schule (GakW III, 1979, 328 ff.), aber auch mit Paul K. Feyerabend und Thomas S. Kühn, wobei Franz Hampl mit Polemik nicht geizte. In der Kritik an Feyerabend und Kühn wird Franz Hampls Einstellung zur ,,Relativierung wissenschaftlicher Aussagen“, zur ,,Abwertung ... und (sozusagen) Irrationalisierung jeglicher wissenschaftlicher Erkenntnis“ (GakW III, 1979, 325, 328) in scharf umrissenen Konturen sichtbar. Was die universalhistorischen und hier besonders die diffusionistischen und mythologischen Studien anlangt, so führen die Reflexionen über Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft vor allem dort, wo es um kulturelle Gemeinsamkeiten geht, zu einer kaum minder kritischen Beschäftigung mit dem Strukturalismus, wie er beispielsweise von Claude Levi-Strauss in dessen ,,Anthropologie structurale“ (1958) propagiert wird, obwohl gerade der strukturalistische 53 Forschungsansatz für den komparativ arbeitenden Historiker wichtige Materialien zu liefern imstande wäre. In den Bewertungen der beiden Welten der Natur- und Kulturvölker, bei denen die Strukturalisten den erstgenannten Völkern nach Franz Hampl einen Vorzug einräumen, indem sie ,,etwa das ‚existentielle’ und ‚strukturale’ (und als solches natürlich höher einzuschätzende) Denken der Primitiven mit dem ‚rationalen’ und (damit überholten) ‚historisierenden’ Denken der Europäer“ konfrontieren (GakW I, 1975, 158), vermag Franz Hampl kaum eine Erkenntnisbereicherung zu registrieren. Solche Typologien und Einstellungen, die den Eurozentrismus ins Gegenteil verkehren und dadurch erst recht perpetuieren, haben Franz Hampl mehrfach veranlaßt, sich - ideologiekritisch mit der pauschalen Bewertung, vor allem natürlich Abwertung ganzer Völker und Kulturen auseinanderzusetzen. 2. Die universalhistorische Perspektive Ausgehend von einem umfangreichen Katalog historisch brisanter Fragen wie beispielsweise über Entstehung und Niedergang von Hochkulturen, kulturelle Diffusion, Humanisierungstendenzen in der Weltgeschichte, Individuum und Gemeinschaft, typische Merkmale von Völkern und Kulturen, Abhängigkeit der kulturellen Evolution von Milieu und Begabung, stellt Franz Hampl in einer programmatisch ausgerichteten Abhandlung zur universalhistorischen Betrachtungsweise fest: ,,Niemand kann mit guten Gründen bestreiten, daß Fragen dieser Art l. an und für sich legitim sind und jeden Historiker angehen; daß sie 2. nicht gleichsam von obenher durch Intuition oder Kontemplation oder Meditation, sondern nur empirisch aus der Einsicht in bzw. aus einer Vertrautheit mit den konkreten geschichtlichen Vorgängen und Verhältnissen heraus erfolgreich angegangen werden können und daß 3. als unabdingbare Voraussetzung für die Klärung solcher Grundfragen die Ausrichtung auf das Ganze der Geschichte gelten muß“ (GakW I, 1975, 133). Als Modellstudien hierfür mögen neben den auf breitere Basis gestellten Kulturverfallsanalysen vor allem „Universalgeschichte am Beispiel der Diffusionstheorie“ (Nr. 39, 1975), „Vergleichende Sagenforschung“ (Nr. 44, 1978), „Vergleichende Kunstgeschichte“ (Nr. 45, 1978) und zuletzt ,,Universalhistorische Vergleiche und Perspektiven zum Themenkreis ‚Politik-Staatsethik-Sittenverfall im republikanischen Rom’“ (Nr. 47, 1979) sowie „‚Denkwürdigkeiten’ und ‚Tatenberichte’ aus der Alten Welt als historische Dokumente“ (Nr. 48, 1979) gelten. Gerade in diesen universalhistorischen Betrachtungen kommen die vielfältigen Erkenntnisse und Erfahrungen, die Franz Hampl bei seinen in den sechziger Jahren einsetzenden großen Bildungsreisen sammelte, zum Tragen. Eine umfangreiche Dokumentation von mehr als 8000 Dias, die seither von seinen Mitarbeitern noch erweitert wurde, fiel dabei gleichsam als ‚Nebenprodukt’ für das Institut ab. Diese Reisen führten Franz Hampl außer in den mediterranen Raum in den Vorderen und Mittleren Orient, nach Süd- und Zentralasien sowie in den Fernen Osten und zu den Zentren der präkolumbischen Kulturen Mittel- und Südamerikas. Mehrere dieser archäologischen Zentren sowie die berühmtesten Museen der Welt hat Franz Hampl wiederholt besucht. Solche Reiseerfahrungen, kombiniert mit intensivem Literatur- und Quellenstudium, haben das Fundament für jene Vergleichende Geschichtswissenschaft gelegt, wie sie am Innsbrucker Institut für Alte Geschichte von Franz Hampl und seinen Mitarbeitern in 54 Lehrveranstaltungen und Publikationen kultiviert wird. In den von Franz Hampl herausgegebenen Sammelbänden „Kritische und vergleichende Studien zur Alten Geschichte und Universalgeschichte“ (Hampl - Weiler 1974) sowie „Vergleichende Geschichtswissenschaft. Methode, Ertrag und ihr Beitrag zur Universalgeschichte“ (Hampl - Weiler 1978) zeigt sich insofern erstmals nach außen hin ein Ansatz zur Schulebildung, als die Aufgeschlossenheit für die komparative Methode als zentrales Instrumentarium des Althistorikers einen Konsens der Mitarbeiter mit ihrem Lehrer dokumentiert. Äußerlich findet dieser Forschungsschwerpunkt auch in der von Bundesminister Dr. Herta Firnberg genehmigten und bestätigten Erweiterung der ordentlichen Lehrkanzel für Alte Geschichte in eine solche für „Alte Geschichte und Vergleichende Geschichtswissenschaft“ seinen Ausdruck. Die sukzessive Erweiterung der universalhistorischen Forschungsperspektiven zeigt sich im Werk Franz Hampls schließlich, wie kaum anders zu erwarten, in der kritischen Auseinandersetzung mit dem spekulativen Charakter diverser Modelle einer „Verfallsideologie“ und anderer geschichtsmorphologischer Gedankengebäude. Von welch erstaunlicher Interessensvielfalt Franz Hampls universalhistorisches Engagement getragen ist, zeigt sich gerade auch darin, daß er Wissensbereiche, die im konventionellen Wissenschaftsverständnis des Althistorikers kaum einen Platz finden, wie etwa Biologie, Pädagogik, Psychologie, Ethnologie, Ethologie, Anthropologie und Paläontologie, in seine Forschungen mit einbezieht. 3. Mythos und Geschichte Dieser für Franz Hampls wissenschaftliches Opus ebenfalls sehr kennzeichnende Forschungskomplex erweist sich bei näherem Hinsehen als mehrdimensional. Den terminologischen und wissenschaftsgeschichtlichen Problemen und vor allem solchen der rationalisierenden, historisierenden und symbolischen Interpretation von ‚Mythen’ - die lediglich als Synonym für ‚Sagen’ verstanden werden - gilt hierbei sein besonderes Augenmerk. Die Abhandlung „‚Mythos’ ‚Sage’ - ‚Märchen’“ (Nr. 40, 1975) mag hierfür als Paradigma und zugleich als Visitenkarte des Gelehrten gelten. Zwar haben sich seiner Auffassung nach schon ganze Forschergenerationen aus vielen Wissensgebieten bis hin zu der von ihm wenig geschätzten Tiefenpsychologie mit diesen Themen beschäftigt, wirkliche Fortschritte seien ihnen aber indessen dort völlig versagt geblieben, wo ihre Erörterungen und Kontroversen auf terminologische, im Endeffekt eine babylonische Sprachverwirrung mit sich bringende Diskurse hinausliefen. Mit großer Akribie widmet sich Franz Hampl dabei auch dem Problem der weitgehenden Gleichsetzung von Sage und Geschichte, wie sie bekanntlich im Altertum - unbeschadet rationalistischer Korrektur- und allegorischer Deutungsversuche - allgemein in Geltung war. Diese Identität behauptet sich aber ebenso wie die Tendenz zu letztlich naiver Rationalisierung und Allegorisierung der sagenhaften Traditionen auch in der neueren und neuesten Zeit insofern, als z.B. nach wie vor der Heldensage als sozusagen integrierender Bestandteil zumindest ein ‚historischer Kern’ zugewiesen wird, was Franz Hampls grundsätzliche Kritik hervorrief und zur Forderung nach einer klaren Scheidung eines möglicherweise, aber nicht unbedingt bestehenden - ‚historischen Kerns’ von einem - allemal 55 gegebenen - ‚historischen Hintergrund’ führte. Ein Paradebeispiel für die Reichweite der Konsequenzen, die aus der modernen Gleichsetzung von Sage und Geschichte resultieren, ist der altertumswissenschaftliche „Dauerbrenner“ der - vorgeblichen - Historizität des Trojanischen Krieges. In dieser Frage deklariert sich Franz Hampl so pointiert, daß er seinen Beitrag dazu unter die für manchen Altertumsfreund noch immer als provozierend empfundene formelhafte Überschrift stellt: „Die Ilias ist kein Geschichtsbuch“ (Nr. 26, 1962/1975). Mit dem Problem der Sagengläubigkeit sieht sich der Innsbrucker Historiker auch bei einem anderen Forschungsproblem der griechischen Frühzeit, und zwar der Gräzisierung Griechenlands, konfrontiert. Wollen doch - so Franz Hampl - die „Sagengläubigen ... bis heute nicht an der Gleichung ‚homerische Welt = Heroic Age = mykenische Welt’“ rütteln lassen, was ,,zweifellos die Crux Nr. l in dem ganzen Problemkomplex“ der Einwanderungsfrage darstellt, „und zwar deshalb, weil es sich sozusagen um den Herrgottswinkel vieler einschlägig tätiger Männer handelt und jeder Versuch einer Korrektur dieser Vorstellungen sofort Emotionen erregt, die ihrem Wesen nach rationalen Erwägungen unzugänglich sind“ (GakW II, 1975, 165). Dieses Zitat aus dem Nachtrag (Nr. 41, 1975) zum Aufsatz „Die Chronologie der Einwanderung der griechischen Stämme und das Problem der Nationalität der Träger der mykenischen Kultur“ (Nr. 25, 1960/1975) bringt freilich nur ein Argument aus jener Beweiskette, mit der der Verfasser gegen die traditionelle Frühdatierung der griechischen Wanderbewegungen zu Felde zieht. Franz Hampl datiert sie in die letzten Jahrhunderte des 2. Jahrtausends, woraus konsequenterweise folgt, daß auch die Gleichsetzung „mykenisch = griechisch“ zurückzuweisen sei. Damit bringt übrigens Franz Hampl - was von seinen Kritikern gelegentlich übersehen wird - eine von der Altertumswissenschaft seit fast hundert Jahren immer wieder verdrängte These von F. Dümmler und F. Studniczka in deren Schrift „Zur Herkunft der mykenischen Cultur“ bewußt wieder zurück in die Diskussion. Selbstredend stützt sich Franz Hampl dabei auf neue Forschungsergebnisse, resultierend aus Studien der Linear-B-Texte, der Keramik, Stilphasen, der Zerstörungshorizonte der Paläste auf Kreta und auf dem griechischen Festland, der Ausgrabungen auf Zypern, der Dialekt- und Sprachgeschichte sowie der anthropologischen Befunde u.a.m., die zur Stützung dieser These hinzugekommen sind. IV. Die genannten drei Arbeitsbereiche stellen, wie gesagt, nur Forschungsschwerpunkte dar. Anderes mußte hier außer Betracht bleiben; so die in den letzten Jahren zunehmenden religions- und kultgeschichtlichen Arbeiten (Nr. 50-52) sowie die historiographischen Studien zu Herodot (Nr. 43), Thukydides (Nr. 4), Polybios (Nr. 22, 36), Sallust (Nr. 23), Tacitus (Nr. 17) u.a. oder die auch die Gegenwart häufig miteinschließenden militärhistorischen Interessen, die das Schrifttum von Franz Hampl in gleichem Maße akzentuieren wie regelmäßige Exkurse im Rahmen seiner Lehrveranstaltungen. Wer sich ein umfassendes Bild von der Vielseitigkeit, vom Interesse an Theorie und Praxis der Geschichtswissenschaft und der Geistes- und Naturwissenschaft als Ganzes, sowie vom Temperament 56 des Historikers Franz Hampl machen wollte, müßte ihn wohl auch als akademischen Lehrer, als Vortragenden kennen. Für sein Engagement in der Lehre haben ihm seine Hörer - nach meiner Erfahrung - stets mit vollen Hörsälen gedankt (was auch für die nicht pflichtigen Spezialvorlesungen gilt). Kritische Informationen in Wort und Bild - die Dia-Sammlung stand fast ständig im Einsatz -, oft heftige Diskussionen mit Studierenden, und in den Seminaren auch mit seinen Mitarbeitern, polemische Exkurse zur Forschungslage, Vermittlung von Begeisterungsfähigkeit für den Beruf des Historikers haben Franz Hampl zeitweilig geradezu zu einem Lehrer mit charismatischen Zügen werden lassen, vor denen dann die angehenden Historiker, deren Kritikfähigkeit und Aufgeschlossenheit für Grundfragen der Geschichte Franz Hampl ganz bewußt zu fördern trachtete, meist haltmachen. Seine Lehrtätigkeit am Institut für Alte Geschichte in Innsbruck erstreckt sich über 36 Jahre, vom SS 1948 bis WS 1983/84, was, Kriegseinsatz und die Leipziger Assistentenzeit mitgerechnet, runde 50 Jahre aktive Dienstzeit ergibt; sie umfaßt somit einen Zeitraum, der allein Anlaß genug wäre, einige Überlegungen statistischer Art anzustellen. In diesen Jahren hat Franz Hampl 32mal Römische, 23mal Griechische Geschichte in den Hauptvorlesungen sowie ein gutes dutzendmal den Alten Orient und Ägypten in weiteren Vorlesungen behandelt und insgesamt 67 Seminare veranstaltet (die mehrjährige gleichzeitige Tätigkeit als Supplent an der Karl-Franzens-Universität in Graz nicht mitgerechnet). Neben diversen Spezialvorlesungen zu griechischen und römischen Staatsverträgen, zur Papyrologie und Epigraphik, Etruskologie, Römerzeit in Österreich, zu Alexander, Cicero, Caesar, Augustus und anderen großen Gestalten des Altertums, zu Antike und abendländischer Kultur und zur Geschichte im Unterricht finden erwartungsgemäß die drei ausführlicher besprochenen Forschungsschwerpunkte dabei ihren Niederschlag. Mit den Jahren zeigt sich immer deutlicher die Kongruenz von Lehre und Forschung im Kalender der Vorlesungstätigkeit. Darin lassen sich sechzehn spezielle Lehrveranstaltungen zum Themenkreis „Geschichtstheorie, Geschichtsphilosophie“ - von den proseminaristischen Einführungen in die Methode des wissenschaftlichen Arbeitens in der Alten Geschichte abgesehen - ausmachen, wobei „Grundfragen der Geschichte“ ab dem WS 1949/50, „Die großen geschichtstheoretischen Systeme der neuen und neuesten Zeit“ erstmals im SS 1960 angeboten werden. Zumindest fünfundzwanzigmal werden Fragen der Universalgeschichte und Vergleichenden Geschichtswissenschaft thematisch in den Vordergrund gerückt. Obwohl die dreistündige Vorlesung „Das Altertum. Die Stellung der alten Völker und Kulturen im Gesamtverlauf der Weltgeschichte“ (WS 1954/55) bereits die universalhistorische Dimension zeigt, muß betont werden, daß Lehrveranstaltungen dieses Inhalts dann vor allem ab den frühen siebziger Jahren immer häufiger werden. Der dritte Aspekt, „Mythos und Geschichte“, erscheint im Lehrprogramm expressis verbis siebenmal, und zwar zum ersten Mal im WS 1964/65 mit der zweistündigen Vorlesung „Mythos, Heldensage und Geschichte“, deren betont universalhistorisch konzipierte Variante dann im SS 1972 unter dem Titel „‚Mythos’ - ‚Sage’ - ‚Märchen’ bei den Völkern der Alten Welt“ zum Vortrag gelangt. Insgesamt weisen die Vorlesungsverzeichnisse der 72 Innsbrucker Semester für Franz Hampl 216 althistorische Lehrveranstaltungen mit etwa 480 Wochenstunden aus, die zahlreichen ein- bis 57 zweiwöchigen Exkursionen nicht mitgezählt. Das ergibt bei Annahme von jeweils fünfzehnwöchigen Semestern eine Gesamtlehrdauer von 7200 akademischen Stunden. Der Titel der (vorerst?) letzten Vorlesung „Ende der griechisch-römischen Welt und neue Anfänge“ mag ein Quentchen Wunschdenken enthalten und ehemalige Hörer nostalgisch stimmen. Daß im gleichen Semester der neue Institutsvorstand eine Überblicksvorlesung „Alte Hochkulturen und frühe Antike“ ankündigt, darf wohl als Signal dafür verstanden werden, daß diese in Österreich in ihrer universalhistorischen Ausrichtung singuläre althistorische Lehrtradition eine Fortsetzung findet. Dafür spricht auch, daß seit Jahren die jüngere Generation von Mitarbeitern in einem periodischen Zyklus Lehrveranstaltungen zur Vergleichenden Geschichtswissenschaft anbietet. Das Werk von Franz Hampl in einem Epilog zu würdigen, erscheint aus mehreren Gründen unangebracht. Der Gelehrte besitzt, wie seine neuesten Arbeiten vor Augen führen, eine ungebrochene Schaffenskraft. Ungebrochen ist auch seine Vitalität als Reisender und Vortragender. Das erhellt nicht allein daraus, daß ich Franz Hampl bei meinen drei Innsbruckfahrten in den letzten Jahren nicht antraf, weil er gerade im Ausland tätig war, sondern auch aus einem Brief, den ich vor kurzem erhielt und dem ich entnehme, daß er soeben mit einer Reisegruppe zu seiner sechsten Romexkursion in diesem Jahr (1984) aufbreche. Gerade in der Erwachsenenbildung liegt ein neuer Arbeitsbereich. Anstelle einer hier vielleicht erwarteten zusammenfassenden Würdigung möchte ich daher Franz Hampl lieber selbst zu Wort kommen lassen, indem ich aus seinem Vorwort „Anstatt eines Mottos“ zum ersten Band seiner ,,Geschichte als kritische Wissenschaft“ einige Sätze zitiere. Sie sagen mit aller Deutlichkeit, worum es ihm in der geschichtlichen Erforschung unserer Welt vor allem geht: „Wolfgang Schadewaldt setzte über den ersten Teil seines - 1943 erschienenen - Buches ‚Von Homers Welt und Werk’ eine Stelle aus dem Platonischen Dialog ‚Gorgias’ als Motto: ‚Du sagst ja immerfort dasselbe!’ - ‚Mehr noch! Es geht auch immer um dasselbe.’ Dieses Motto hätte, so will mir scheinen, auch hier einen guten Platz. Ich denke dabei ... vor allem ... daran, daß es, vom Grundsätzlichen und Methodischen her gesehen, in der Tat immer um dasselbe geht. Daß dabei kritische Auseinandersetzungen mit anderen Forschern einen breiten Platz einnehmen, resultiert aus der - von der methodischen Grundeinstellung nicht zu trennenden - Überzeugung, daß der Fortschritt jeder Wissenschaft nicht zuletzt darin besteht, daß Thesen und Hypothesen, selbst wenn sie sich allgemeiner Anerkennung erfreuen, immer wieder überprüft und, falls neues Material und neue vertretbare Gesichtspunkte es nötig erscheinen lassen, korrigiert werden. Kritische Auseinandersetzung soll freilich nicht als gleichbedeutend mit Polemik verstanden werden. Es handelt sich nicht darum, Krieg zu führen, also dem griechischen Wort, von dem sich ‚Polemik’ ableitet, Ehre zu machen, sondern immer nur darum, Beiträge zur Klärung von - uns alle angehenden - Problemen zu geben. Ob bzw. inwieweit dieses Ziel erreicht wurde, muß die Zukunft zeigen“ (GakW I, 1975, V). * Die Nummern bezeichnen die Schriften nach dem Verzeichnis von R. Bichler in diesem Band. Ingomar Weiler 58 Franz Hampls Wirken und die jüngere Forschung am Innsbrucker Institut für Alte Geschichte Geleitwort Bisweilen sind die Geschicke einer Institution recht eng mit dem Werdegang der Persönlichkeiten verknüpft, die sie leiten. Immerhin prägte Franz Hampl von den hundert Jahren, seit denen nunmehr die Alte Geschichte als eigenständiges Fach an der Leopold-Franzens-Universität zu Innsbruck etabliert ist, ein volles Drittel mit seinem unverkennbaren Stil. Sein ungebrochenes Engagement für die Betrachtung der ‚großen Männer’ in der Geschichte - freilich fiel das Urteil über sie oft sehr kritisch aus und auch ‚große Frauen’ blieben nicht unvergessen! - und seine stete Reverenz vor den raren Fällen der Weltgeschichte, in denen Vernunft und Humanität die Herrschaft eines ersten Mannes prägten, haben ganzen Studentengenerationen als Markenzeichen seiner Lehre gegolten. Insgeheim mochte Hampl diese seine historischen Überzeugungen auch durch die eigene, fast fürstlich zu nennende Position gekräftigt sehen, die er in Institut und Fakultät, vor allem aber im Kreise seiner etliche Hunderte zählenden Lehramtskandidaten so lange Jahre genießen konnte. Und ein ähnliches Verhältnis wechselseitigen Einflusses dürfte zwischen Hampls ungezählten, schon seit langem Kontinente übergreifenden und stets in der Rolle des souveränen Führers gemeisterten Exkursionen und Gesellschaftsreisen und seinem immer lebhafteren Interesse an universalhistorischen Perspektiven bestehen. Es braucht dabei kaum ausgesprochen zu werden, daß der Universalhistoriker Hampl sein Publikum denn nicht nur im Hörsaal, sondern gerade auch „vor Ort“ zu fesseln versteht. Welche Wirkung Hampl aber auf seine unmittelbaren Schüler und Mitarbeiter ausübte und welche Impulse er dem Forschungsbetrieb am hiesigen Institut gab, das soll im Zentrum der folgenden Betrachtungen stehen. In ihnen wird viel von Hampls Arbeiten und denen seiner Schüler die Rede sein, soll gezeigt werden, welche Bahnen Hampl der jüngeren Forschung am Innsbrucker Institut wies und wieweit die dort Tätigen eigene Wege suchen. Da mag recht leicht der Eindruck eines unziemlichen Lokalpatriotismus entstehen. Doch bin ich recht zuversichtlich, daß eine geneigte Leserschaft diesen Bericht als Bericht verstehen und einen bisweilen zu hochgestimmten Ton dem festlichen Anlaß zuliebe, aus dem diese Schrift nun einmal entstanden ist, nachsehen wird. l. Die frühgriechische Welt und ihr staatlich-kulturelles Umfeld in kritisch-vergleichender Sicht Eine folgenschwere Zäsur mit traditionellen Grenzen der Antike vollzog Hampl in zwei Schriften der beginnenden 60er Jahre, die ihn auf das Feld der kretisch-mykenischen Kultur und zur MythenForschung führten. Dabei leitete ihn tiefes Mißtrauen gegen das konventionelle Verständnis der mykenischen als der ersten griechischen Kultur und des homerischen Epos als einer dafür einschlägigen Quelle. Seine unerbittlich auf methodische Klarheit dringende Attacke gegen die communis opinio wurde in mancher Hinsicht schicksalhaft für die weitere Institutsgeschichte. Die Akzentuierung der Diskontinuität zwischen den mediterranen Frühhochkulturen und den auf ihrem Terrain erwachsenen jüngeren Hochkulturen mit archaisch-primitiven Anfängen wuchs sich zu einem 59 Forschungsfeld aus, das eine erste Zone systematischen Vergleichs zwischen Kulturformen der klassischen Antike und außerantiken Kulturen repräsentiert. Stets blieb dabei die Frühgeschichte Griechenlands im Brennpunkt des Interesses. Das Erlebnis von Nichtbeachtung und Ablehnung als Reaktion auf die radikale Abkehr von einem liebgewonnenen Bild der griechischen Frühzeit trug das Seine dazu bei, daß dieser spezifische Forschungsansatz - schon zur intellektuellen Selbstbehauptung zunächst von Hampl selbst erneut mit Verve zur Diskussion gestellt wurde. Dem Lehrer folgten alsbald die Schüler, in der Lehre wie in der Forschung. Zweifellos kam es diesem Unternehmen sehr zugute, daß sich in jüngster Zeit eine Spätdatierung so gut wie aller Linear-B-Texte, die ja meist als Kronanwälte einer griechischen Identität der mykenischen Kultur bemüht werden, durchzusetzen scheint und daneben die archäologische Evidenz einer Serie von Zerstörungshorizonten im gesamten Umfeld der ägäischen Spätbronzezeit wuchs. Denn damit werden die traditionelle, von Hampl ja so energisch angefochtene Sicht einer ersten ‚griechischen Landnahme’ schon zu Beginn des 2. Jahrtausends und die Beschwörung einer Kontinuität zwischen mykenischer Welt und ‚Dark Ages’ immer prekärer. Ob sich freilich das vertraute Bild eines mykenisch-griechischen Heldenzeitalters je wird revidieren lassen, bleibt recht fraglich. Dem Innsbrucker Institut aber ist ein spezifisches Forschungsfeld erwachsen, in dem nun die Beziehungen zwischen der ägäischen Region im Übergang von bronzezeitlichen Kulturen zu denen des alphabetischen Griechenlands und den benachbarten mediterranen und orientalischen Kulturen im Zentrum stehen. Dieser erste Kreis althistorisch-vergleichender Forschung am hiesigen Institut stellt für sich genommen keineswegs ein Novum dar, darf vielmehr einem recht breiten Traditionsstrom althistorischer Forschung in einem weitherzigeren Sinne zugerechnet werden, der auch in der älteren Institutsgeschichte Wurzeln hat. Ein stärkeres Bewußtwerden der gemeinsamen Forschungsanliegen, ohne zu vergessen, daß Hampls kritisch-polemische Grundhaltung neue Wege gewiesen hatte, prägt die Arbeiten, die in Hampls Nachfolge nun in erster Linie von P. W. Haider gestaltet werden, Arbeiten, in denen sich intensives archäologisches Interesse und enge Vertrautheit mit den altorientalischen Hochkulturen und vor allem dem Alten Ägypten geltend machen. Voraussetzung und Folge seiner Forschungen und Forschungsvorhaben zum Verhältnis zwischen Ägäis und benachbarter mediterran-altorientalischer Kulturwelt (Nr. 73, 74 Schriftenverzeichnis) stellen einzelne Studien dar, die sich unmittelbar mit spezifischen Themen der minoischen und der mykenischen Kultur einerseits (Nr. 71, 72) und den Beziehungen zwischen dem Pharaonenhof und außerägäischen Nachbarregionen (und zum Teil unterworfenen Regionen) Ägyptens andererseits (Nr. 75, 76) beschäftigen. So vermögen die Pfade des Forscherdrangs von der Irritation am liebgewordenen Usus, einen historisch greifbaren Hintergrund des homerischen Epos in mykenischen Gefilden zu suchen, bis zu Detailfragen der Ägyptologie zu führen. Doch Hampls Kreuzzug gegen den Glauben, das Epos spiegle die mykenische Kultur, und seine Betonung der Diskontinuität zwischen dieser und der der folgenden Jahrhunderte stimulierten auch die direkte Beschäftigung mit jenen gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnissen, die das Epos 60 tatsächlich repräsentiert. Diese vor allem auf ihre archaisch-ursprünglichen Züge zu mustern und in der Folge eine Neubewertung der ‚homerischen Gesellschaft’ zu versuchen, zählt daher gleichermaßen zu den aktuellen Institutsvorhaben. Hampls Schüler und Enkelschüler Ch. Ulf widmet sich diesem Projekt. 2. Probleme der klassischen Altertumswissenschaft im Lichte kulturvergleichender Studien Die Zeit des homerischen Epos entwicklungsgeschichtlich als ‚Frühzeit’ zu begreifen, auch wenn es chronologisch relativ spät anzusetzen ist, das läßt sich im nachhinein als Ausgangspunkt einer ganz besonderen Strömung in der Innsbrucker althistorischen Forschung erkennen: Archaisch-ursprüngliche Verhaltensweisen, Kulturelemente und Institutionen der klassischen Antike sollen durch sie und ihre räumlich-zeitliche Nachbarwelt weit überschreitende vergleichende Betrachtung von analogen oder ähnlichen Phänomenen in ein helleres Licht gerückt werden. Als Aufgabe bewußt und in Hampls Vorlesungs- und Exkursionstätigkeit schrittweise immer intensiver wahrgenommen, hat dieses Programm schon in den 60er Jahren bestanden, ehe sich dann, zunächst besonders in Schriften aus Hampls Schule, eine regelrechte Tradition althistorischer Studien unter universalhistorischer Perspektive entfaltete. Einen ersten Schritt setzte I. Weiler in seiner der Einstellung der Griechen zum Wettkampf gewidmeten Habilitationsarbeit. Denn er suchte in einer abschließenden Partie das ‚agonale Prinzip’, ein vermeintlich nur dem Griechentum in vollem Maße eigenes Kulturelement, durch Beleuchten des Analogons in einer Reihe außerantiker Gesellschaften und Kulturen nicht mehr isoliert, sondern in seinen universalhistorischen Dimensionen zu begreifen (Nr. 109). Gemeinsam mit seinem Lehrer betrieb Weiler die - 1973 erfolgte - Erweiterung der Innsbrucker althistorischen Lehrkanzel: „Alte Geschichte und vergleichende Geschichtswissenschaft“ hieß fortan auch offiziell die Devise für Lehre und Forschung. Eine Sammelpublikation des Titels „Kritische und vergleichende Studien zur Alten Geschichte und Universalgeschichte“, im Folgejahr herausgebracht (Nr. II), stellte diese Devise in praxi vor. Zwei Erstlingsschriften in diesem Sammelwerk machen besonders deutlich, wie nun - auf dem für Hampls Lehre so charakteristischen Forschungsfeld archaisch-rituellen Verhaltens - spezifische und notorisch umstrittene Fragen der griechischen bzw. der griechisch-römischen Religionsgeschichte durch penible Quellenkritik einerseits und durch vergleichende Studien andererseits erhellt und geklärt werden sollen. Dabei weitet G. Lorenz das Terrain, aus dem Analoga für die komparatistische Arbeit gewonnen werden, bis auf die Welt der Naturvölker aus (Nr. 83), während G. Kipp sich besonders dem methodischen Aspekt seines Themas widmet (Nr. 79). Beides darf als charakteristisch für Hampls Schule angesehen werden. Beide Verfasser gingen im übrigen von Themen aus, die sich aus ihren jeweils noch traditioneller orientierten Dissertationen ergaben. Dissertanten setzten diese Forschungslinie, die zur Klärung klassisch-althistorischer Fragen in komparativer Umschau die Antike weit überschreitet, fort. Seine umfangreichen militärgeschichtlichen Interessen und Kenntnisse machte M. Wieser dem Thema des Kleinkriegs im Altertum zunutze. 61 Besonders die neuere Kolonialgeschichte erschloß ihm eine Fülle frappanter Entsprechungen zu grundsätzlichen Aspekten der Konfrontation von Staatsmacht und organisierter Guerilla, die sich schon in der griechisch-römischen Welt vielfach dem Betrachter zeigen. So vermochte er, von der Antike ausgehend, durch die vergleichende Betrachtung bestimmte ‚general patterns’ der Kriegsgeschichte exakter zu erfassen (Diss. M. Wieser 1976). Sein Kollege Ch. Ulf wiederum suchte in seiner Dissertation über die römischen Lupercalia einen ganz konkreten, uns nur schlecht bezeugten und vielfach mißinterpretierten Ritus dadurch präziser zu begreifen, daß er - vorwiegend ethnologisch ausgerichtet - nach möglichst engen Analoga des rituellen Verhaltens Ausschau hielt, wobei es um den Vergleich komplexer Verhaltensweisen, nicht nur irgendwelcher Details geht (Nr. 88). Für die Drucklegung der Arbeit akzentuierte er dann noch stärker die Partien methodologischer Reflexion über sein komparatives Verfahren. Leicht aphoristische Akzente, die die Weite seiner Bildung ebenso eindrucksvoll belegen wie die in der conditio humana gegründete Ubiquität des untersuchten Phänomens, setzte H. Aigner, als er sich in seiner Habilitationsschrift dem Selbstmord in Mythos und Lebensrealität der Griechen widmete und dabei nicht mit universalhistorischen Analoga geizte. Schon der Titel seiner Studie verrät im übrigen eine kleine Hommage an seinen Kollegen und nachmaligen ‚Habilitationsvater’ I. Weiler, mit dem er einst gemeinsam - nach dem Tode von Erich Swoboda - die Jahre erlebte, in denen F. Hampl die Grazer Lehrkanzel supplierte. So darf H. Aigner als Dissertant Hampls (Diss. H. Aigner 1968) und als ein der Innsbrucker komparatistischen Tradition besonders verbundener Grazer Kollege in diesem Bericht figurieren, zumal ihn auch ein Platz auf der Liste der zur Nachfolge Hampls vorgeschlagenen Bewerber mit Innsbruck verbindet. Die beiden Grunddimensionen des Vergleichens, die Besonderheit eines Phänomens im Kontrast zu erhellen und die allgemeinen Aspekte eines Phänomens gegen isolierte Betrachtung zu betonen, sucht G. Lorenz in seinem aktuellen Habilitationsprojekt zu einer geschlossenen Einheit zu verbinden. Eine entwicklungsgeschichtlich orientierte, auf ein Wachsen an Humanität und Rationalität ausgerichtete Untersuchung der antiken Krankenbehandlung steht im Zentrum der Arbeit. In für Innsbruck typischer Weise gilt dabei das Bemühen auch einer möglichst umfangreichen universalgeschichtlichen Erfassung gerade der primitiv-archaischen Elemente der Krankheitsbehandlung und medizinischen ‚Theorie’, die sich auch in der klassischen Welt noch zäh gehalten haben (Nr. 57). Hampl selbst beleuchtete in einer seiner jüngsten Schriften den Ritus, Vestalinnen lebendig zu begraben, in nun schon gewohnt universalhistorischer Ausrichtung (Nr. 51). Zuvor aber wandte er sich mit vergleichenden Studien einem im Prinzip anderen Themenfeld als den bislang gestreiften zu: den alten und neuen - Verfallsvorstellungen, die sich gerade an Phasen starken kulturellen und sozialen Wandels entzünden. Dazu griff er das Thema seiner Rektoratsrede (Nr. 28) und das Thema seiner ideologie- und forschungskritisch ausgerichteten Attacken auf die Verklärung altrömischer Verhältnisse (Nr. 20, 23) erneut auf. Durch zahlreiche außerantike Parallelen demonstrierte er Beliebtheit und Fragwürdigkeit der verbreiteten Neigung, ‚frühe’ Kulturphasen als ‚gesund’ zu verklären und ihre grausamen Züge zu verschleiern, dagegen in ‚späten’ Kulturphasen Dekadenz und 62 moralischen Verfall zu wittern und ihre humanen Züge zu verkennen (Nr. 47). 3. Komparatistische Arbeiten in universalhistorischer Absicht À la longue führt die vergleichende Betrachtungsweise in universalhistorische Dimensionen. Dieser Überzeugung trug Hampl schon seit langen Jahren bei der Gestaltung seiner Lehre Rechnung, ehe sie sich auch in seinen Forschungen nachhaltiger auswirkte. Mit einer ersten systematischen Studie, in der nun ein bestimmtes Phänomen konstant durch die Kulturräume der Welt verfolgt wird, stellte sich P. W. Haider als Dissertant und gleich darauf auch als Mitarbeiter am ersten Gemeinschaftswerk Hampls und seiner Schüler vor. Einmal mehr figuriert dabei ein Ritus, der für Anfangsphasen von Hochkulturen Signifikanz besitzt, nämlich die Mit-Bestattung eines (zuvor getöteten) fürstlichen Gefolges beim Tode des Herrn, als Kardinalthema (Nr. 68, 69). Hampl selbst spürte in zwei Spätschriften ebenfalls, freilich in stärker gelockerter Gestaltung, typisch archaischen Vorstellungsund Verhaltensweisen quer durch die Welt nach. Zum einen stellte er eine Reihe von Mythen zusammen, die in aitiologischer Tendenz, und zwar durch merkwürdige Kultbilder angeregt, gebildet wurden (Nr. 49). Zum anderen suchte er die überraschend starke Verbreitung apotropäischer Riten und Darstellungen in den Kulturen und Gesellschaften dieser Welt gegenwärtig zu machen und wies auf die anthropologische Grundkonstante der Dämonenfurcht (Nr. 52). Wie sehr sich elementare Verhaltensweisen in verschiedenen Gesellschaften und Kulturen immer wieder in frappanter Analogie ausformen, beschränkt sich nicht auf das bislang ins Zentrum gerückte Terrain ritueller Gebräuche und kultischer Vorstellungen. Auch das politische Verhalten kann in strukturell ähnlichen Situationen ähnlich gestaltet, fast ritualisiert ablaufen und einer komparativen Studie Stoff zum Nachdenken liefern. Hampl zeigt dies durch seine quellenkritische Auseinandersetzung mit einer - ebenfalls quer durch die Weltgeschichte laufenden - Reihe von Selbstdarstellungen von Herrscherpersönlichkeiten, die ihre eigene Genese und Position durch Propaganda und Lüge (oder Selbsttäuschung?) verschleiern (Nr. 48). Elementar und ritualisiert, politisch keineswegs ohne Relevanz, so stellt sich auch ein Themenkreis dar, den zu bearbeiten I. Weiler besonders berufen war: der Sport, dessen Ausgestaltung er über die Antike hinaus auch in den Hochkulturen Ägyptens und des Vorderen Orients dokumentierte. Sein damaliger Mitarbeiter Ch. Ulf nahm sich dabei der Frage des Sports bei den Naturvölkern an und verstärkte so die universalhistorische Note des Werks (Nr. 117). Dieses ist in seiner Ausrichtung recht stark den Impulsen verpflichtet, die Weiler aus Innsbruck mit nach Graz genommen hatte, der Stätte seines Wirkens als Lehrstuhlinhaber seit 1976, so daß seine Nennung hierorts rechtens sein dürfte. Und noch mehr gilt das für Weilers Studie über das Los von Witwen und Waisen in der Alten Welt, eine Studie, die ganz bewußt den seinerzeit mit Hampl propagierten Forschungsansatz pflegt. Schon das hohe Maß an methodischer Reflexion über die Nutzung des Vergleichs und das erklärte Ziel, ein elementares soziales, ja allgemein menschliches Problem in seinen diversen Lösungsversuchen unter universal- und entwicklungsgeschichtlichen Aspekten zu untersuchen, lassen ahnen, daß Weiler hier einen Abschiedsgruß an Innsbruck gestaltete, der denn auch dem Universalhistoriker F. Hampl 63 expressis verbis gewidmet ist (Nr. 115). Eine Berufung Weilers zur Nachfolge Hampls nach dessen Emeritierung im Jahre 1981 konnte schließlich zum Bedauern aller Institutsangehörigen nicht realisiert werden. Den Nutzen universalhistorischer Betrachtung vermag nicht nur ihre Bewährung in praxi, sondern auch ihre Absenz per negativum zu demonstrieren. Weilers ideologiekritisch orientierter Beitrag für das mit Hampl herausgebrachte erste Gemeinschaftswerk des Instituts macht dies recht deutlich. In ihm rügte Weiler die starke Tendenz, gerade auch seitens prominenter Fachvertreter, die verschiedenen Völkerschaften der Alten Welt in klischeehafter Weise zu charakterisieren. Nicht zuletzt ist es ein Mangel an universalhistorischer Perspektive, der solcherart platten Vorurteilen zum Glanz wissenschaftlicher Weihe verhilft (Nr. 110). Gerade diese - vermißte - universalhistorische Perspektive könnte auch davor feien, sich vorschnell der suggestiven Kraft so mancher Kulturtrift-Lehre zu ergeben. F. Hampl widmete diesem Gesichtspunkt eine ebenso programmatische wie unerbittliche Abhandlung über den Diffusionismus (Nr. 39). Universalgeschichtliche Betrachtung kann aber auch dem Zwecke nutzbar gemacht werden, unseren methodisch oft nicht unbedenklichen Umgang mit vertrauten historischen Kategorien und Gattungsbegriffen einer Revision zu unterziehen. Hampl zeigte dies anhand der Begriffe des Mythos, der Sage und des Märchens, einem Thema, dem seit langem sein lebhaftes Interesse galt und das in seinen Vorträgen einen wichtigen Platz einnahm und einnimmt. In Kenntnis des Erzählguts diverser Naturvölker und der Mythenwelt außereuropäischer Hochkulturen will Hampl so manche fixe Vorstellungen, die sich mit diesen ‚Gattungsbegriffen’ verbinden, erschüttern (Nr. 40). Aber natürlich frägt sich schon in Hinblick auf die thematische Reichweite all der nun vorgestellten Arbeiten, ob denn diese vielbeschworene universalhistorische Betrachtungsweise ihrerseits einen klaren und methodisch tragfähigen Weg zu historischer Erkenntnis weisen kann oder ob sie nicht vielmehr - gerade beim heutigen Entwicklungsstand der einzelnen Fachdisziplinen - zu Dilettantismus führen muß. 4. „Vergleichende Geschichtswissenschaft“ - Methodologische Reflexion und wissenschafsgeschichtliche Umschau F. Hampl spürte bereits relativ früh, sich gegen das Mißverständnis universalhistorischer Forschung als Illusion des Alleswissens, gegen den Topos von der Unzugänglichkeit kategorial fremder Kulturen und gegen andere Vorwürfe auf ähnlicher Linie wenden zu müssen, und tat dies in einer größeren Apologie der eigenen Forschungsansätze, seinem Beitrag für das erste gemeinsam mit I. Weiler publizierte Sammelwerk (Nr. 38). Ein zweites sollte bald folgen, das sich schon ex titulo der Präsentation jenes weiten Forschungsfeldes widmete, auf dem seit einigen Jahren auch in Innsbruck, wie eben dargelegt, recht fruchtbare Arbeiten gedeihen: der Vergleichenden Geschichtswissenschaft. In meinem eigenen Beitrag zu diesem Unternehmen suchte ich die Einschätzung komparativer Verfahren in der Historie sowohl im theoretischen Urteil der letzten zwei Jahrhunderte als auch in der aktuellen wissenschaftstheoretischen Diskussion darzustellen und ihre methodischen Aspekte zu 64 klären und so dem Werk eine Art theoretischer Fundierung zu geben (Nr. 59). Die Herausgeber und die weiteren Mitarbeiter an diesem programmatischen Gemeinschaftswerk hatten dagegen einen anderen Weg zu beschreiten, nämlich den vielfachen Nutzen vergleichender Betrachtung in wissenschaftsgeschichtlich orientierten Studien zu Einzeldisziplinen zu demonstrieren. Bemerkenswerter- und, wie er selbst einräumt, bedauernswerterweise gestaltete dabei I. Weiler, der Motor auch dieses Gemeinschaftsunternehmens, die einzige Abhandlung, die sich den Resultaten vergleichender Forschung in einer der üblicherweise unter der ‚Geschichte’ im akademischen Betrieb subsumierten Disziplinen widmet. Gerade sein gelungener Nachweis der großen Relevanz komparatistischer Verfahren in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte läßt den Wunsch lebendig werden, auch in anderen klassischerweise zur Geschichte im engeren Sinn gehörenden Sparten entsprechende Erträge der Komparatistik zusammenzustellen (Nr. 114). Anders als Weilers konsensorientierte, auf die Präsentation der Forschung ausgerichtete Studie nimmt sich Hampls eigene, mit Polemik nicht geizende Erörterung des Vergleichens in der Kunstgeschichte aus, zu der ihn schon seit langer Zeit ein lebhaftes Interesse hinzog, ein Interesse, dem er oftmals im Vortrag - im Hörsaal wie auf Exkursionen - beredten Ausdruck verlieh (Nr. 45). Und gleich noch einem weiteren Thema, dem er nicht minder intensive Neigungen entgegenbrachte, wandte sich Hampl in diesem Werke zu: der vergleichenden Sagenforschung und ihren methodischen Problemen (Nr. 44). Damit ist ein Terrain betreten, auf dem er und seine Innsbrucker Mitarbeiter selbst schon forschend tätig waren. Von daher betrachtet ist es zu verstehen, daß auch die weiteren wissenschaftsgeschichtlichen Beiträge in diesem Gemeinschaftswerk Phänomenkomplexen gelten, die für die Innsbrucker althistorische Forschung schon notorische Attraktivität hatten. So bot G. Lorenz eine komprimierte Darstellung der Hauptströmungen der Religionsgeschichte, wobei die Relevanz komparativer Betrachtung im Mittelpunkt steht, und schloß daran eine systematische Darlegung der Hauptresultate und der möglichen Zukunftsperspektiven vergleichender religionshistorischer Arbeit (Nr. 84). P. W. Haider hatte sich hinwieder die Aufgabe gestellt, die komparative Forschung auf dem Felde der Ethnologie zunächst in ihrer wissenschaftsgeschichtlichen Genese und dann in ihrer Praxis an elementaren Fällen vorzuführen (Nr. 70). Seine weiteren Ausführungen zeigen die innige Verknüpfung zwischen den traditionellen Anliegen Vergleichender Geschichtswissenschaft und dem Bestreben, fundamentale Aspekte für eine entwicklungsgeschichtlich und kulturmorphologisch orientierte Weltgeschichte zu gewinnen. Aber kann ‚Weltgeschichte’ überhaupt noch ernsthaftes Ziel des um Wissenschaftlichkeit bemühten Historikers sein ? 5. Methodisch-kritische Reflexionen über geschichtsphilosophische, wissenschaftstheoretische, wissenschaftsgeschichtliche und didaktische Fragen Leicht läßt sich die Frage nach den Möglichkeiten, Weltgeschichte zu betreiben, gewiß nicht beantworten. Daß just zu diesem Thema Alfred Heuß, seit den gemeinsamen Leipziger Jahren bei Helmut Berve mit F. Hampl verbunden, 1975 in einem Gastvortrag in Innsbruck sprach, ohne eine entschiedene Antwort geben zu wollen, mag dies noch unterstreichen. Hampl jedenfalls hat sich 65 unermüdlich dem Ziel verpflichtet, als akademischer Lehrer die ‚großen Linien’ und die ‚grundsätzlichen Fragen’ der Geschichte in den Vordergrund seiner Erörterungen zu stellen, ob es nun um die Dämonie der Macht geht, die als Schatten über den Großen der politischen Geschichte schwebt, oder um die Wege, die einzelne Große der Geistesgeschichte aus den Bindungen kultischritueller wie gesellschaftlicher Traditionen zur Freiheit künstlerischer Gestaltung und - vor allem aufgeklärten Denkens führten. Und ein gutes Stück Überzeugung, seinen Beitrag zu einer entwicklungsgeschichtlich begriffenen Weltgeschichte auf dem Boden der Erfahrungswissenschaft leisten zu können, trug auch den Elan, mit dem Hampl in einzelnen Schriften gerade ‚grundsätzliche’ Fragen anging. Beiträge zu einer breitangelegten Darstellung der Weltgeschichte zu verfassen, lag und liegt hingegen nicht so recht in Hampls Wesen. Umso lebendiger gestaltete sich seine meist im Hörsaal betriebene Auseinandersetzung mit namhaften Vertretern einer - wie man heute gerne sagt - ‚materialen Geschichtsphilosophie’. Seine Gefechte gegen Männer wie Spengler, deren spekulative Gedankengebäude er mit Verve am Boden der Empirie zertrümmerte, zählen gewiß in der Erinnerung zahlreicher Hörer zu den Glanzstücken von Hampls polemisch-kritischer Kunst. Die Resonanz dieser Auseinandersetzung mit aktuellen wie obsoleten geschichtsphilosophischen Konzeptionen läßt sich in Hampls Schriften nicht in der Dichte greifen wie in Kollegmitschriften, läßt aber doch einige Kontinuität erkennen, wenn man seine kritische Studie zu Toynbee aus dem Jahre 1952 zu der über Teilhard de Chardin aus dem Jahre 1973 stellt und dazu seine 1968 aus Vorträgen erwachsene, 1975 in erweiterter Form publizierte Kritik an deutschen Geschichtsdenkern dieses Jahrhunderts betrachtet (Nr. 14, 37, 35). Hampls Schüler folgten ihm bislang noch nicht auf dieses Parkett. Allerdings zähle ich es zu meinen Aufgaben als akademischer Lehrer, den Studierenden eine kritische Einführung in Entwicklung und Hauptwerke der Geschichtsphilosophie zu vermitteln. Etwas anders steht es um ein zweites Forschungsfeld, das - besonders im Angelsächsischen ebenso mit dem Begriff der Geschichtsphilosophie verbunden ist: es ist die erkenntnis- bzw. wissenschaftstheoretische Reflexion über die theoretischen Grundlagen und methodischen Prinzipien unserer Disziplin. In für ihn so charakteristischer Weise zog Hampl auch auf diesem Gebiet mit harter Kritik, die ihre Kräfte aus einer Art veredelten ‚gesunden Hausverstands’ als wesentlicher Entscheidungsgrundlage bezieht, gegen dunkle Gedanken und - in seinen Augen - leider ‚schicke’, aber doch bedenkliche Modernismen zu Felde (Nr. 34). Ich bin ihm hierin zwar ein Stück Wegs gefolgt, habe mich aber doch wesentlich stärker an aktuelle Debatten und ihre Sprachrituale angepaßt, was seinen unmittelbaren Niederschlag in mehreren Aufsätzen zum Problem historischer Erklärungen und in Artikeln zu wissenschaftstheoretischen Grundfragen der Historie fand, publiziert in vorwiegend philosophisch orientierten Organen (Nr. 56, 57, 58 und 60). Dagegen zeigt meine Dissertation noch direkt den Stil des Schülers, der sich Hampls methodisch-kritische Attacken gegen alle mögliche Untugend des neueren Schrifttums zum Vorbild nahm, um dann seinerseits seine kritische Attitüde an Schulbuchdarstellungen der Alten Welt - diese ganz im Sinne Hampls immer weiträumig begriffen zu erproben (Nr. 53). Aus dieser Erstlingsarbeit erwuchsen zwei Aufsätze, die vor allem die Tendenz 66 zu Klischee, Moral und weltanschaulich geprägter Klitterung im Bild der Alten Völker und Kulturen, wie es sich in typischen Schulbuchdarstellungen findet, aufzeigen und kritisieren (Nr. 54, 55). Die wesentlichen Anregungen dazu und das methodische Instrumentarium gewann ich aus Hampls Lehrtätigkeit und - nicht zuletzt - auch aus mancher verbalen Fehde mit dem Lehrer, die sich in heißen Seminarsitzungen entzündete. Daß methodische Erörterungen für elementare Probleme der historischen Praxis ausschlaggebende Bedeutung zu gewinnen vermögen, auch wenn das die historische Zunft nicht immer gerne hört, demonstrierte Hampl mit zwei Abhandlungen über die Frage einer Epochengrenze zwischen Altertum und Mittelalter (Nr. 32, 33). Ohne sich mit den gedanklich-theoretischen Voraussetzungen vertraut zu machen, auf denen unser Usus, Geschichte in Epochen zu gliedern, ruht, laufen Unternehmungen mit dem erklärten Ziel, das Wesen einer Epoche zu erfassen, unweigerlich ins Leere. Klarheit in der Argumentation, Kenntnis der aktuellen Fachdiskussion und wissenschaftsgeschichtliche Einsichten müssen miteinander verbunden werden, sollen die seit Generationen umstrittenen Probleme der Epochenbildung in sinnvoller Weise erörtert und nicht in müßigem Wortschwall totgeredet werden. Nicht zuletzt in dieser Überzeugung darf ich mich als Schüler Hampls betrachten. Und so empfing auch meine Habilitationsschrift über Geschichte und Problematik des Epochenbegriffs ‚Hellenismus’ starke Anregung durch seine Schriften und seine Lehre. Meinen eigenen Weg suchte ich darin dann vor allem in intensiveren begriffs- und wissenschaftsgeschichtlichen Forschungen und wohl auch in einer Einstellung, die sich mehr um Konsens als um Polemik müht, ohne die kritische Grundhaltung zu verleugnen (Nr. 61). Wissenschaftsgeschichte als Medium zu erleben, das aufklärend und bisweilen beschämend wirken kann und so gar nicht dem Bedürfnis nach geistiger Nabelschau entgegenkommt, war mir eine wertvolle Erfahrung. Sie gemacht zu haben, schulde ich Hampl Dank. Mit dem Komplex der Epochen- und Periodisierungsfragen ist ein Feld angesprochen, das sich nicht nur mit Konsul Briests Worten als weit erweist, sondern auch von den Horizonten universalhistorischen Interesses und geschichtsphilosophischer Gedankenhöhe wieder dorthin zurückführt, wo unsere Disziplin zu Hause ist: in die Welt der klassischen Antike. Von ihr ist schließlich alle Forschungstätigkeit Hampls ausgegangen und ihr ist er bis heute treu geblieben, auch wenn ihn seine vielseitigen Interessen am Schreibtisch wie auf Reisen oft weit von ihr weggeführt zu haben scheinen. 6. Studien zur römischen Geschichte In seiner Leipziger Zeit noch ganz der griechischen Staats- und Verfassungsgeschichte ergeben, bot erst seine Innsbrucker Lehrtätigkeit F. Hampl den entscheidenden Anlaß, sich mit seinen Forschungen auch der römischen Geschichte zuzuwenden. Aus der Reihe von neun, zum Teil kleineren Studien der Jahre 1950 bis 1960 ragen drei hervor, die sich quellen- und forschungskritisch mit dem Phänomen der beschönigenden Historie und seinem Gegenstück, der pejorativen Verzerrung, auseinandersetzen. Gerade diese Studien waren Hampl denn auch so wichtig, daß er sie in den folgenden Dezennien vertiefte und erneut in der Fachwelt zur Diskussion stellte. Zum einen ging es um die Verklärung 67 altrömischer Verhältnisse vor der Folie eines vermeintlichen Sittenverfalls ab der späten Republik (Nr. 20, 23), ein Thema, das Hampl auch zu universalhistorischer Betrachtung anregte (Nr. 47). Zum anderen wurde die Neigung nicht weniger Forscher, nur zögernd den tendenziösen Elementen in Tacitus’ Werk entgegenzutreten und nach wie vor die Unverdorbenheit der Germanen oder die Bösartigkeit des Kaisers Tiberius für Tatsachen zu nehmen, einer strengen Rüge unterzogen (Nr. 17). Die übrigen Arbeiten der genannten Gruppe widmeten sich klassischen Fragen der römischen Staatsgeschichte und Aspekten der Kaiserzeit, darunter spezifisch provinzial-geschichtlichen Themen, ein Feld, das Hampl in späteren Jahren zu meiden begann (Schriftenverzeichnis Nr. 12, 13, 18, 19, 22, 24). Wenn sich nun jüngst P. W. Haider diesem Forschungsfeld, konkret auf Tirol bezogen, zuwendet, so wird damit an alte, aber schon abgerissene Traditionen neu angeknüpft (Nr. 77). Hampls jüngere Arbeiten zur römischen Geschichte weisen im Grunde in eine Richtung. Er macht es sich zur Hauptaufgabe, die in der Regel völlig skrupellose Entfaltung des römischen Weltreichs illusionslos zu betrachten und die Verantwortung der führenden Akteure für ihre Taten herauszustellen. Polemische Hiebe gelten dementsprechend einer strukturgeschichtlichen Betrachtung, die den Willen der Machthaber an sozio-ökonomische Grundkonstellationen gebunden sieht und ihre persönlichen Entscheidungen in der Folge als weniger relevant bemißt (Nr. 30, im übrigen eine Studie, die bereits bemüht ist, universalhistorische Parallelen geltend zu machen; Nr. 36 und 46). Auch Hampls komparatistische Studie über die Neigung großer Herrscherpersönlichkeiten, ihre Position zu beschönigen und auch durch Lüge zu verschleiern, ist aus seiner kritischen Beschäftigung mit den Heroen der römischen Geschichte, mit Caesar und dem Princeps Augustus, allmählich erwachsen (Nr. 48). Eine Einladung zur Mitarbeit an der Propyläen-Literaturgeschichte bot schließlich Hampl die willkommene Gelegenheit, seine Gedanken über die ihm wesentlichen Züge vor allem der frühen römischen Religion für ein weiteres Publikum in einer Überschau darzustellen (Nr. 50), während ja seine anschließend publizierte, schon früher erwähnte vergleichende Studie zum Vesta-Kult (Nr. 51) spezifischen Detailproblemen nachgeht. Den Schülern und Mitarbeitern Hampls vermittelte seine Beschäftigung mit der römischen Geschichte rege Impulse für ihre Lehrtätigkeit, ganz besonders in der quellenkritischen Distanz zur fable convenue des frühen Rom und seiner vorgeblichen späteren Dekadenz. Unmittelbare Forschungen aber regte Hampl auf ‚römischem Boden’ dagegen weniger an als auf anderen Gebieten. Immerhin gilt es einige Dissertationen zu nennen, die sich - in unterschiedlicher Affinität zu Hampls Ausrichtung - besonders Quellenfragen der römischen Geschichte und Aspekten der römischen Machtausweitung in der späten Republik zuwenden, sich zuletzt - wie schon anderen Orts erwähnt aber auch auf Aspekte des altrömischen Kultus, nunmehr in vergleichender Sicht, erstrecken. Durch Hampls vorübergehende Tätigkeit in Graz, wo er von 1965 bis 1968 die - nach dem Tode E. Swobodas vakante - Lehrkanzel supplierte, vermehrte sich die Zahl der Dissertanten, die sich römischen Forschungen zuwandten (Dissertationsverzeichnis Teil b). Mit einschlägigen Studien stellten sich dann auch die Grazer Etruskologin L. Aigner-Foresti und Hampls schon genannter 68 Schüler H. Aigner als Mitarbeiter des ersten von Hampl und Weiler herausgegebenen Sammelwerks ein, das ja nicht zuletzt die Reichweite von Hampls Wirkung auf die jüngere Forschung veranschaulichen sollte. 7. Griechische Geschichte In dem zuletzt angesprochenen, den Freunden des Innsbrucker Instituts gewidmeten Band, figuriert auch F. Gschnitzer - erst jetzt genannt, nach dem Rang seines Namens aber ganz vorne zu reihen! -, und zwar mit einer Studie über die Institution der Prytanen. Soweit man Gschnitzer, einen Dissertanten aus Hampls Innsbrucker Anfangsjahren (Diss. Gschnitzer 1951), der sich schon 1957 habilitieren konnte und seit 1962 in Heidelberg Alte Geschichte lehrt, als Schüler Hampls betrachten darf, muß sich der Blick auf Hampls Leipziger Arbeiten der Jahre 1934 bis 1939 richten, auf stolze elf Titel zur griechischen Staats- und Verfassungsgeschichte, vornehmlich des 4. Jahrhunderts (Schriftenverzeichnis Nr. 1-11). Von diesen Studien wie wohl auch von Hampls früher Innsbrucker Lehrtätigkeit gingen gewiß recht lebendige Impulse auf Gschnitzers Werk aus. Steht dieses auch nicht direkt in unserer Erörterung von Hampls Wirken auf die jüngere und aktuelle Innsbrucker Forschung zur Debatte, so darf doch angemerkt werden, daß ein Grundakkord, der sich durch Gschnitzers stets auch sprachwissenschaftlich akribische Studien zur griechischen Staats-, Verfassungs- und Sozialgeschichte zieht, nämlich die präzise Differenzierung stammstaatlicher und stadtstaatlicher Strukturen und der Grade von staatlicher Freiheit in der griechischen Welt, deutlich die Affinität des ehemaligen Schülers zu Hampl, vor allem eben dem Hampl der Leipziger Arbeiten, erkennen läßt, mögen sich auch später beider Wege - über Fragen der Einschätzung der mykenischen Kultur wie der Möglichkeit und Notwendigkeit universalhistorischer Umschau - getrennt haben. Mit seiner entwicklungsgeschichtlich wie systematisch aufgebauten Präsentation der Funktionsvielfalt der diversen Prytanen und deren historischer Genese unterstrich Gschnitzer, in welcher Hinsicht er sich als Schüler Hampls versteht. Auf die Forschung seiner späteren Schüler übten Hampls Schriften der ersten Phase eher geringe Wirkung aus. Allerdings trug I. Weiler in seiner als Einführungswerk wie als Forschungsbilanz gestalteten Griechischen Geschichte ihren Resultaten entsprechend Rechnung (Nr. 112). Hampls Weg aus der Berve-Schule zu unverkennbarer Eigenart nimmt in seinen - insgesamt vier Arbeiten über Alexander den Großen besonders plastische Konturen an, spannt sich ihr Bogen doch von den frühen fünfziger Jahren bis 1975 (Nr. 15, 16, 21, 42). Wie dabei die quellenkritische Erörterung realer und vermeintlicher politischer Pläne Alexanders schrittweise der elementaren Frage nach der Schattenseite historischer Größe und der fatalen Tendenz der Forschung, ihre Heroen in glänzendes Licht zu tauchen, Platz macht, das verrät einiges über Hampls Entwicklung und über seine Sicht der großen Akteure auf der Bühne des historischen Geschehens. Daß wesentliche Elemente von Hampls Alexanderbild in der Lehre seiner Schüler fortleben, nimmt nicht wunder. In ihren Forschungen allerdings haben diese bislang Herrscherpersönlichkeiten und Kriegsherren gemieden. Alexander wie überhaupt die großen 69 Nicht bestimmte Forschungen Hampls - eine flüchtige Skizze kritischer Gedanken zu den Olympischen Spielen im Altertum wäre vielleicht zu nennen (Nr. 29) -, wohl aber seine stete Polemik gegen Klischeevorstellungen vom ‚griechischen Menschen’ und gegen diverse Auswüchse beschönigender Historie haben I. Weiler stimuliert, sein sportwissenschaftliches Interesse an klischeebelasteten Fragen der antiken Athletik und Agonistik zu erproben. Dabei verdient es aber auch eine ältere Innsbrucker Forschungstradition, der Weiler wertvolle Anregungen dankt, besonders hervorgehoben zu werden: es sind die im Rahmen der Klassischen Philologie gepflegten Studien über das antike Athletentum und Wettkampfwesen, verbunden besonders mit dem Namen von Julius Jüthner und in jüngerer Zeit durch Robert Muth weitergeführt. - Weilers kritische Bemerkungen zum Griechen-Barbaren-Schema (Nr. 104), erst recht dann seine Zweifel am agonalen Grundcharakter des frühgriechischen Menschen zeigen Affinität zu Hampl’scher Kritik, zumal sie sich auf einem Forschungsfeld geltend machen, das für Hampls Schule charakteristisch ist: dem der frühen Mythenwelt (Nr. 106). Nach der Ausarbeitung seiner - ins Komparatistische ausgeweiteten Habilitationsschrift über den Agon im Mythos (Nr. 109) setzte Weiler dann mit unmittelbaren Studien zum antiken Sportwesen, bis hin zur klassischen Frage nach dem Ursprung der Olympischen Spiele, diese Linie seiner Forschungen fort und blieb ihr auch nach seiner Übersiedlung an die Grazer Lehrkanzel treu (vgl. Schriftenverzeichnis Nr. 108, 111, 113, 116, 118, 119, 120, 123). Seine schon früher vorgestellte Geschichte des Sports in der Alten Welt stellt das bislang umfangreichste Resultat von Weilers sporthistorischen Arbeiten dar (Nr. 117). Ch. Ulf, der ja auch einen Abschnitt über Sport bei den Naturvölkern in diesem Werk gestaltet hat, zeigte sich überdies noch mit einigen kleineren Studien zu Aspekten der antiken Sportgeschichte als einschlägig tätiger Partner (Nr. 89-94). Fraglos gingen von Hampls Vorlesungen und Seminaren zur griechischen Kulturgeschichte verstanden in einem weiten Sinne des Wortes, der religiöse Vorstellungen und kultische Rituale ebenso einschließt wie philosophisches und (vor-)wissenschaftliches Gedankengut - ganz besonders starke Impulse auf seine Hörer und Mitarbeiter aus. Nicht umsonst entwickelte sich I. Weiler, der zunächst in der Tradition von E. Swoboda in Graz Studien zur Provinzialgeschichte, vor allem Pannoniens, verfaßt hatte (vgl. Nr. 96-102), gerade in Innsbruck zum Verfasser einer einführenden Griechischen Geschichte, die - was keineswegs selbstverständlich war! - in einigen Längsschnitten auch die Bereiche der Religion und der künstlerisch-geistigen Kultur in all ihren Sparten behandelte und sich im übrigen, wie schon erwähnt, um eine ausgewogene Integration von Hampls Arbeiten in die diversen Forschungsbilanzen bemühte (Nr. 112). Auch die stark entwicklungsgeschichtlich orientierte, dem Erwachen von rationaler und humaner Geisteshaltung gewidmete Dissertation über die Einstellung der Griechen zum Tier, mit der G. Lorenz ein spezifisches Terrain der Kulturhistorie betrat (Diss. Lorenz 1972), verrät in vielen Zügen die Resonanz, die Hampls Lehrtätigkeit zu evozieren vermochte, auch was die methodische Sorgfalt betrifft. Penible Quellenkritik und Gewichtung der Argumente, das könnte denn auch als Motto über den Studien von G. Kipp stehen, in denen er einige komplizierte Streitfragen über frühe griechische Riten und Gebräuche zu entwirren sucht und so seine Verbundenheit mit Hampls methodischen 70 Postulaten dokumentiert (Diss. Kipp 1973). Ebenso lassen noch meine eigenen jüngsten Arbeiten zur griechischen Geschichte deutlich den geistigen Anstoß erkennen, den sie Hampls Lehre danken. Mehr noch als seine große Mängelrüge, die er der Herodot-Forschung präsentierte (Nr. 43), ermunterte mich die Mitarbeit an seinen einschlägigen Seminaren dazu, eigene Wege hin zu einem kritischeren und tieferen Verständnis von Herodots meisterlichem Werk zu suchen (Nr. 63, 65, 66). Auch meine Studien über Entwicklung und politische Relevanz der griechisch-hellenistischen Staatsutopie (Nr. 62, 64), deren folgenreichste Gestaltung ja Platons Fiktion von Ur-Athen und Atlantis darstellt, danke ich letzten Endes dem Seminarerlebnis: den heftigen Debatten über das „Scheinproblem Atlantis, das alle fünf bis zehn Jahre erneut die Gemüter bewegt (woran leider auch Männer der Wissenschaft die Schuld tragen!)“. Der stärkste Einfluß auf seine Mitarbeiter aber ging wohl von Hampls eingangs zitierten Schriften über die griechische Frühgeschichte aus. Konsequenter Zweifel an der griechischen Identität der mykenischen Kultur und die Akzentuierung des Kulturbruchs, der letztere von der Welt des homerischen Epos trennt, sind zu fixen Bestandteilen der Lehre am hiesigen Institut geworden, so fix, daß sie geeignet sind, einer gewissen Idiosynkrasie der Hörerschaft Vorschub zu leisten. Von diesem Thema aber gingen - und das ist es wert, nochmals gesagt zu sein - jene entscheidenden Anregungen aus, die allmählich zum Forschungsunternehmen „Alte Geschichte und Vergleichende Geschichtswissenschaft“ führten, das schließlich zum Signum der Ära Hampl wurde. Damit sind unsere Erörterungen wieder an ihrem Ausgangspunkt angelangt. Sollte gleichwohl der Eindruck entstanden sein, daß der Kreislauf der Betrachtungen eher recht verschlungen wirkt als wohlgerundet, so möge der Leser seine Seele an der metaphorischen Kraft dieser Schlingbewegungen aufrichten: Es galt schließlich den Kranz zu winden für ein Jubiläum, das da heißt: 100 Jahre Alte Geschichte in Innsbruck - und 75 Jahre Franz Hampl. Reinhold Bichler 71 Schriftenverzeichnis Franz Hampl und Schüler A I. Sammelpublikationen F. Hampl, Geschichte als kritische Wissenschaft, hrsg. v. I. Weiler, Bd. I-III, Darmstadt 1975/79, zitiert als: GakW I-III. II. Kritische und vergleichende Studien zur Alten Geschichte und Universalgeschichte, hrsg. v. F. Hampl - I. Weiler, Innsbruck 1974 (= Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft 18), zitiert als: Hampl-Weiler 1974. III. Vergleichende Geschichtswissenschaft. Methode, Ertrag und ihr Beitrag zur Universalgeschichte, Darmstadt 1978 (= Erträge der Forschung 88), zitiert als: Hampl-Weiler 1978. B Schriften von Franz Hampl 1 Der König der Makedonen, Diss. Leipzig, Weida i. Thür. 1934. 2 'Oi Bottiaioi, in: Rheinisches Museum N.F. 84, 1935, 120-124. 3 Olynth und der chalkidische Staat, in: Hermes 70, 1935, 177-196. 4 Thuk. III, 75, l und der Terminus spondai/, in: Philologus 91, 1936, 153-160. 5 Die lakedämonischen Periöken, in: Hermes 72, 1937, 1-49. 6 Die griechischen Staatsverträge des 4. Jahrhunderts v. Christi Geb. (= Preisschriften der Fürstlich Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzig 54) Leipzig 1938; Neudruck: Rom 1966. 7 König Philippos, in: Neue Jahrbücher für Antike und deutsche Bildung l, 1938, 411-423. 8 Zur angeblichen koinh\ ei0rh/nh von 346 und zum Philokrateischen Frieden, in: Klio 31, 1938, 371-388. 9 Zu IG2 40-41, in: Hermes 73, 1938, 474-477. 10 Poleis ohne Territorium, in: Klio 32, 1939, 1-60; Neudruck in: Zur griechischen Staatskunde, hrsg. v. F. Gschnitzer (WdF 96) Darmstadt 1969, 403-473. 11 Die griechischen Staatsverträge des 4. Jahrhunderts v.Chr., in: Forschungen und Fortschritte 15, 1939, 61-63; engl. in: Research and progress 5, 214-219. 12 Zur Lokalisierung der Schlacht bei Noreia, in: AnzAW 3, 1950, 187-192. 13 Zur römischen Kolonisation in der Zeit der ausgehenden Republik und des frühen Prinzipates, in: Rheinisches Museum N.F. 95, 1952, 52-78. 14 Grundsätzliches zum Werke A. J. Toynbees, in: HZ 173, 1952, 449-466. 15 Alexanders des Grossen Hypomnemata und letzte Pläne, in: Studies presented to David Moore Robinson, Vol. II, Washington 1953, 816-829; Neudruck in: Alexander the Great: The Main Problems, ed. G. T. Griffith, Cambridge 1966, 307-321. 16 Alexander der Grosse und die Beurteilung geschichtlicher Persönlichkeiten in der modernen Historiographie, in: La Nouvelle Clio 6, 1954, 91-136. 17 Beiträge zur Beurteilung des Historikers Tacitus, in: Natalicium Carolo Jax septua-genario a. d. VII. Kal. Dec. MCMLV oblatum Pars I, ed. R. Muth, redegit I. Knobloch (IBK 3) Innsbruck 1955, 89102; erw. in: GakW III, 1979, 267-294. 18 Die Gründung von Konstantinopel, in: Südost-Forschungen 14, 1955, 9-22. 19 Die Carnuntum-Tagung 1955 (Tagungsbericht), in: AnzAW 8, 1955, 249-252. 20 „Stoische Staatsethik" und frühes Rom, in: HZ 184, 1957, 249-271; Neudruck in: Das Staatsdenken der Römer, hrsg. v. R. Klein (WdF 46) Darmstadt 1966, 116-142 und in: GakW III, 1979, 1-21. 21 Alexander der Grosse (= Persönlichkeit und Geschichte 9) Göttingen 1958, 21965. 22 Das Problem der Datierung der ersten Verträge zwischen Rom und Karthago, in: Rheinisches Museum 101, 1958, 58-75. 23 Römische Politik in republikanischer Zeit und das Problem des ,,Sittenverfalls“, in: HZ 188, 1959, 497-525; Neudruck in: Das Staatsdenken der Römer, hrsg. v. R. Klein (WdF 46) Darmstadt 1966, 72 143-177; erw. in: GakW III, 1979, 22-47. 24 Kaiser Marc-Aurel und die Völker jenseits der Donaugrenze. Eine quellenkritische Studie, in: Festschrift zu Ehren Richard Heubergers (= Schlern-Schriften 206) Innsbruck 1960, 33-40. 25 Die Chronologie der Einwanderung der griechischen Stämme und das Problem der Nationalität der Träger der mykenischen Kultur, in: Museum Helveticum 17, 19.60, 57-86; erw. in: GakW II, 1975, 100-139 (+Nachtrag ebd. 139-198). 26 Die Ilias ist kein Geschichtsbuch, in: Serta philologica Aenipontana, hrsg. v. R. Muth (IBK 7-8) Innsbruck 1962, 37-63; erw. in: GakW II, 1975, 51-99. 27 Zum Forschungsbericht: Die ägäische Frühzeit (AnzAW XIV, 1961, 129-172), in: AnzAW 15, 1962, ll-16. 28 Das Problem des Kulturverfalls in universalhistorischer Sicht, Antrittsrede gehalten anläßlich der Inauguration zum Rector magnificus des Studienjahres 1962/63, Innsbruck 1963; erw. in: GakW I, 1975, 252-298. 29 Die Olympischen Spiele im Altertum, in: Olympia - einst und jetzt, Schriftl. R. Muth (= Vortragsreihe der Univ. Innsbruck und des Kulturamtes der Stadt Innsbruck aus Anlaß der IX. Olymp. Winterspiele 1964) Innsbruck 1964, 9-20. 30 Caesarenwahnsinn, in: Corolla memoriae Erich Swoboda dedicata, Graz 1966, 126-136. 31 Grundsätzliches zur Frage der Methode der Geschichtswissenschaft, in: Die Philosophie und die Wissenschaften. Simon Moser zum 65. Geburtstag, Meisenheim a. Glan 1966, 329-349; erw. in: GakW I, 1975, 1-32. 32 Zum Problem der Einheit des Altertums, in: Festschrift Karl Pivec zum 60. Geburtstag, hrsg. v. A. Haidacher u. H. E. Mayer (IBK 12) Innsbruck 1966, 151-165; erw. in: GakW II, 1975, 82-304 (sub titulo: Die Frage der Einheit des Altertums). 33 Gedanken zur Diskussion über die Grenzscheide zwischen Altertum und Mittelalter, in: Festschrift Leonhard C. Franz zum 70. Geburtstag, besorgt v. O. Menghin und H. M. Ölberg (IBK 11) Innsbruck 1965 (recte 1967) 133-141; erw. in: GakW II, 1975, 305-318. 34 „Information und Kommunikation“ in der Sicht eines Historikers, in: Information und Kommunikation, Referate und Berichte der 23. Internat. Hochschulwochen Alpbach 1967, hrsg. v. S. Moser, München-Wien 1968, 189-197; erw. in: GakW I, 1975, 33-72. 35 Deutsche Geschichtsdenker unserer Zeit in kritischer Sicht (Trattazione critica di filosofi della storia tedeschi del nostro tempo), in: Praelectiones Brixinenses 1968, 23-39; erw. in: GakW I, 1975, 73110. 36 Zur Vorgeschichte des ersten und zweiten Punischen Krieges, in: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt (Joseph Vogt zu seinem 75. Geburtstag), hrsg. v. H. Temporini, Teil I: Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik Bd. l, Berlin-New York 1972, 412-441. 37 Teilhard de Chardin als Geschichtsdenker, in: Evolution der Welt, Versuche über Teilhard de Chardin, hrsg. v. H. Reinalter, Innsbruck 1973, 41-63; erw. in: GakW I, 1975, 111-131. 38 Universalhistorische Betrachtungsweise als Problem und Aufgabe. Ihre Bedeutung in Theorie und Praxis der modernen Geschichtswissenschaft, in: Hampl-Weiler 1974, 121-155; erw. in: GakW I, 1975, 132-181. 39 Universalgeschichte am Beispiel der Diffusionstheorie, in: GakW I, 1975, 182-236. 40 ‚Mythos’ - ‚Sage’ - ‚Märchen’, in: GakW II, 1975, 1-50. 41 Die Chronologie der Einwanderung der griechischen Stämme und das Problem der Nationalität der Träger der mykenischen Kultur. Mit Nachtrag: Die Forschung nach 1960. Neue Gesichtspunkte und Ergebnisse, in: GakW II, 1975, 100-198. 42 Alexander der Große. Persönlichkeit und historische Bedeutung, in: GakW II, 1975, 202-232. 43 Herodot. Ein kritischer Forschungsbericht nach methodischen Gesichtspunkten, in: Grazer Beiträge. Zeitschrift für die klassische Altertumswissenschaft 4/1975, 97-136; erw. in: GakW III, 1979, 221266. 44 Vergleichende Sagenforschung, in: Vergleichende Geschichtswissenschaft. Methode, Ertrag und ihr Beitrag zur Universalgeschichte, hrsg. v. F. Hampl - I. Weiler (EdF 88) Darmstadt 1978, 132-169. 45 Vergleichende Kunstgeschichte, in: Vergleichende Geschichtswissenschaft. Methode, Ertrag und ihr Beitrag zur Universalgeschichte, hrsg. v. F. Hampl - I. Weiler (EdF 88) Darmstadt 1978, 204-242. 46 Das Problem des Aufstiegs Roms zur Weltmacht. Neue Bilanz unter methodisch-kritischen Aspekten, in: GakW III, 1979, 48-119. 47 Universalhistorische Vergleiche und Perspektiven zum Themenkreis ‚Politik - Staatsethik Sittenverfall im republikanischen Rom’, in: GakW III, 1979, 120-158. 73 48 ‚Denkwürdigkeiten’ und ‚Tatenberichte’ aus der Alten Welt als historische Dokumente. Ein Beitrag zur Glaubwürdigkeit von Selbstdarstellungen geschichtlicher Persönlichkeiten, in: GakW III, 1979, 167-220. 49 Kultbild und Mythos. Eine ikonographisch-mythologische Untersuchung, in: Forschungen und Funde. Festschrift Bernhard Neutsch (IBK 21) Innsbruck 1980, 173-185. 50 Römische Religion, in: Propyläen Geschichte der Literatur I: Die Welt der Antike, Frankfurt a. M.Berlin -Wien 1981, 321 -342. 51 Zum Ritus des Lebendigbegrabens von Vestalinnen, in: Festschrift Robert Muth, hrsg. v. P. Händel W. Meid (IBK 22) Innsbruck 1983, 165-182. 52 Der Mensch und die Dämonen. Methodisches und Grundsätzliches zum Thema „Dämonenangst und Dämonenabwehr“, in: Die Geisteswissenschaften stellen sich vor, hrsg. v. W. Krömer - 0. Menghin (Veröffentlichungen der Univ. 137) Innsbruck 1983, 109-121. 53 2000 Jahre Bregenz - im Blickwinkel des Althistorikers, in: Montfort. Vierteljahresschrift für Geschichte und Gegenwartskunde Vorarlbergs 37, 1985, 7-17. 54 Brigantium - blühende Stadt im Römischen Reich, in: 2000 Jahre Bregenz. 15 v. Christus- 1985, hrsg. v. Amt d. Landeshauptstadt Bregenz 1984/5. 55 Einige Probleme der Forschung zum Hannibalischen Krieg in alter und neuerer Sicht, in: Rivista Storica dell’Antichità 13/14, 1985/6. C Arbeiten aus Hampls Schülerkreis a) Reinhold Bichler 53 Kritische Beiträge zum Problem der Geschichtsdarstellung in Schulbüchern. Exemplarische Erörterungen am Beispiel der Behandlung der Alten Welt in einer repräsentativen Auswahl von Geschichtslehrbüchern für Höhere Schulen in der Bundesrepublik Deutschland nebst einem Ausblick auf die entsprechenden Verhältnisse in Lehrbüchern Österreichs, maschinschriftl. Dissertation, Innsbruck 1973, 263 S. 54 Über Klischee, Moral und weltanschauliche Tendenzen im Bild der Alten Welt in den Geschichtslehrbüchern der BRD, in: Internationales Jahrbuch für Geschichts- und Geographieunterricht, Jg. 15, 1974, 97-131. 55 Über das Bild der Alten Welt in österreichischen Geschichtslehrbüchern, in: Hampl- Weiler 1974, 47-74. 56 Erklären die Historiker geschichtliche Phänomene ohne Bezug auf Gesetze?, in: Conceptus. Zeitschrift für Philosophie, Jg. 9, Nr. 26, 1975, 46-65. 57 Die Pragmatik des Ursachebegriffs der Historiker, in: Conceptus, Jg. 10, Nr. 27, 1976, 62-71. 58 ‚Intentionale Erklärungen‘. Kritische Gedanken zu Georg Henrik von Wrights Sicht der Erklärung, in: Grazer Philosophische Studien. Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie 2, 1976, 173-188. 59 Die theoretische Einschätzung des Vergleichens in der Geschichtswissenschaft, in: Vergleichende Geschichtswissenschaft. Methoden, Resultate und ihr Beitrag zur Universalgeschichte, hrsg. v. F. Hampl - I. Weiler (EdF 88) Darmstadt 1978, 1-86. 60 Artikel ‚Geschichtswissenschaft‘ und ‚Historizismus‘, in: Handbuch wissenschaftstheoretischer Begriffe, hrsg. v. J.Speck, Bd. 2, Göttingen 1980, 254-258, 282f. 61 ‚Hellenismus‘. Geschichte und Problematik eines Epochenbegriffs (IdF 41) Darmstadt 1983, 219 S. (= für den Druck überarbeitete erw. Fassung der Habilitationsschrift Innsbruck 1980). 62 Utopie und gesellschaftlicher Wandel. Eine Studie am Beispiel der griechisch-hellenistischen Welt, in: Gesellschaftliche Prozesse, hrsg. v. K. Acham, Graz 1983, 15-27. 63 Herodot und die Macht des Geldes, in: Exportgewerbe und Außenhandel vor der Industriellen Revolution. Festschrift Georg Zwanowetz, hrsg. v. F. Mathis - J. Riedmann, Innsbruck 1984, 1124. 64 Zur historischen Beurteilung der griechischen Staatsutopie, in: Grazer Beiträge 11, 1984, 179-206. 65 Die ‚Reichsträume‘ bei Herodot, in: Chiron 15, 1985 (im Druck). 66 Der Synchronismos von Himera und Salamis. Eine quellenkritische Studie zu Herodot, in: Festschrift A. Betz, hrsg. v. G. Dobesch - E. Weber (im Druck). 67 Politisches Denken im Hellenismus, in: Handbuch der Politischen Ideen, hrsg. v. I. Fetscher, Red. H. Münkler, Bd. I: Außereuropäische Hochkulturen und Antike (Projekt). b) Peter Haider 74 68 Gefolgschaftsbestattungen in universalhistorischer Sicht. Ein Beitrag zur Vergleichenden Geschichtswissenschaft, Diss. Innsbruck 1974. 69 Gefolgschaftsbestattungen in universalhistorischer Sicht, in: Hampl-Weiler 1974, 89-120. 70 Vergleichende Völkerkunde, in: Hampl-Weiler 1978, 170-203. 71 Grundsätzliches und Sachliches zur historischen Auswertung des bronzezeitlichen Miniaturfrieses auf Thera, in: Klio 61, 1979, 285-307. 72 Zum frühhelladischen Rundbau in Tiryns, in: Forschungen und Funde. Festschrift B. Neutsch, hrsg. v. Institut für Klassische Archäologie d. Universität (IBK 21) Innsbruck 1980, 157-172. 73 Zu den Beziehungen zwischen Griechenland, Libyen und Ägypten im späten 2. sowie in der ersten Hälfte des I.Jahrtausends v. Chr., Habil.-Schrift Innsbruck 1982 (Drucklegung: Darmstadt, vorauss. 1985, i. d. Reihe Impulse der Forschung). 74 Zu den wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen zwischen Mykene und dem ägyptischen Hof von ca. 1450-1250 v. Chr., in: Exportgewerbe und Außenhandel vor der industriellen Revolution. Festschrift G. Zwanowetz, hrsg. v. J. Riedmann - F. Mathis (Veröffentlichungen d. Univ. 142) Innsbruck 1984, 25-30. 75 Die hethitische Stadt Arušna in ägyptischen Ortsnamenlisten des Neuen Reiches, in: Göttinger Miszellen 72, 1984, 9-14. 76 Zum Moab-Feldzug Ramses‘ II., in: Studien zur Altägyptischen Kultur 13, 1985 (im Druck). 77 Tirol zur Römerzeit, in: Geschichte des Landes Tirol Bd. l, Bozen 1985 (im Druck). c) Godehard Kipp 78 Studien zur frühgriechischen Kultpraxis unter besonderer Berücksichtigung methodischer Gesichtspunkte, Diss. Innsbruck 1973. 79 Zum Herakult auf Samos, in: Hampl-Weiler 1974, 157-209. 80 Vergleichende Rechtsgeschichte. Eine kommentierte bibliographische Dokumentation, unveröffentlichtes Manuskript, 154 S. 81 Gedanken zur Frage der Möglichkeit einer Vergleichenden Rechtsgeschichte, unveröffentlichtes Manuskript, 32 S. d)Günther Lorenz 82 Die Einstellung der Griechen zum Tier. Ihre Entwicklung von Homer bis Theophrast (mit einem Ausblick auf das frühe Rom), Diss. Innsbruck 1972. 83 dem Leben der Tiere bei frühen Griechen und Römern und bei den Naturvölkern?, in: Hampl-Weiler 1974, 211-243. 84 Vergleichende Religionsgeschichte, in: Hampl-Weiler 1978, 88-131. 85 C. F. Lehmann-Haupt, in: Neue Deutsche Biographie Bd. 14 (im Druck). 86 Hippokratische Medizin und chinesische Akupunktur - ein Vergleich, in: 16. österr. Historikertag, Krems 1984, Tagungsbericht (im Druck). 87 Antike Krankenbehandlung in historisch-vergleichender Sicht. Studien zum konkretanschaulichen Denken (Habilitations-Projekt). e) Christoph Ulf 88 Der Luperkalienritus in der Sicht der Vergleichenden Geschichtswissenschaft, Diss. Innsbruck 1978; gedruckt in erw. Form: Das römische Lupercalienfest. Ein Modellfall für Methodenprobleme in der Altertumswissenschaft (IdF 38) Darmstadt 1982. 89 Die Einreibung der griechischen Athleten mit Öl. Zweck und Ursprung, in: Stadion 5,1979,220-238. 90 (Mit I.Weiler:) Der Ursprung der antiken Olympischen Spiele in der Forschung. Versuch eines kritischen Kommentars, in: Stadion 6, 1980, 1-38. 91 Der Sport bei Naturvölkern, in: I.Weiler, Der Sport bei den Völkern der Alten Welt, Darmstadt 1981, 14-52. 92 Einige Bemerkungen zum Ursprung der antiken Olympischen Spiele mit einem knappen Ausblick auf ihre Wirkungsgeschichte, in: H. Andrecs, E. Niedermann, S. Redl (Hrsg.), Sport in unserer Zeit. Texte zum Verständnis der Olympischen Idee, Heft l. Bundesministerium für Unterricht und Kunst, Wien 1983, 23-27. 93 Artikel ‚Sport‘, in: Wörterbuch der Völkerkunde, hrsg. v. W. Hirschberg, Berlin 1985. 94 Artikel ‚Spiel‘, in: Wörterbuch der Völkerkunde, hrsg. v. W. Hirschberg, Berlin 1985. 95 Die homerische Gesellschaft. Analyse und Lokalisierung im historischen Prozeß (Habilitations- 75 projekt). f) Ingomar Weiler 96 Die Gräberstraße von Carnuntum, in: Carnuntum-Jahrbuch 1961, 52-60. 97 Pannonien in diokletianischer Zeit, Diss. Graz 1962. 98 Huic Severo Pannoniae et Italiae urbes et Africae contigerunt, in: Historia 13, 1964, 373-376. 99 Orbis Romanus und Barbaricum, in: Carnuntum-Jahrbuch 1963/64, 34-39. 100 Zur Augusteisch-Tiberischen Inschrift von Emona (zusammen mit Jaro Sasel), in: CarnuntumJahrbuch 1963/64, 40-42. 101 Münzfunde 1963/64, in: Carnuntum-Jahrbuch 1963/64. 102 Beiträge zur Verwaltung Pannoniens zur Zeit der Tetrarchie, in: Situla 8, 1965, 141-157. 103 Der Werdegang des Instituts für Geschichte des Altertums und Altertumskunde an der Universität Graz, in: Zeitschrift des historischen Vereins für Steiermark 58, 1967, 13-21. 104 Greek and Non-Greek Worid in the Archaic Period, in: Greek, Roman, and Byzantine Studies 9, 1968,21-29. 105 Titus und die Zerstörung des Tempels von Jerusalem - Absicht oder Zufall?, in: Klio 50, 1968,139158. 106 Agonales in den Wettkämpfen der griechischen Mythologie (Veröffentlichungen d. Univ. Innsbruck 19) 1969, 31 S. 107 Der Katzen-Mäuse-Krieg in der Johanneskapelle auf der Pürgg, in: Zeitschrift des historischen Vereins für Steiermark 61, 1970, 71-82. 108 Julius Jüthners Beitrag zur Geschichte des antiken Sports, in: Festschrift Universität und Sport, Innsbruck 1972, .21-33. 109 Der Agon im Mythos. Zur Einstellung der Griechen zum Wettkampf (IdF 16) Darmstadt 1974, 341 S. (= leicht überarbeitete Habilitationsschrift, Innsbruck 1971). 110 Von ‚Wesen‘, ‚Geist‘ und ‚Eigenart‘ der Völker der Alten Welt. Eine Anthologie altertumswissenschaftlicher Typisierungskunst, in: Hampl-Weiler 1974, 243-291. 111 War Alexander der Große wirklich ein Sportsmann?, in: Signale der Zeit. Festschrift für Joseph Recia, Schondorf-Stuttgart 1975, 271-279. 112 Griechische Geschichte. Einführung, Quellenkunde, Bibliographie (Die Altertumswissenschaft) Darmstadt 1976, 304 S. 113 AIEN ARISTEUEIN. Ideologiekritische Bemerkungen zu einem vielzitierten Homerwort, in: Stadion I, 2, 1976, 199-227. 114 Der Vergleich und vergleichende Aspekte in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, in: HamplWeiler 1978, 243-283. 115 Zum Schicksal der Witwen und Waisen bei den Völkern der Alten Welt, in: Saeculum 31, 1980, 157-193. 116 Philostrats Gedanken über den Verfall des Sports, in: Sportwirklichkeit. Beiträge zur Didaktik, Geschichte und Soziologie des Sports. Festschrift E. Niedermann, Wien 1981, 97-105. 117 Der Sport bei den Völkern der Alten Welt. Eine Einführung, Darmstadt 1981, 305 S. 118 Der Ursprung der antiken Olympischen Spiele in der Forschung. Versuch eines kritischen Kommentars (gemeinsam mit Ch. Ulf), in: Stadion 6, 1981, 1-38. 119 Einige Bemerkungen zu Solons Olympionikengesetz, in: Festschrift Robert Muth (IBK 22) Innsbruck 1983, 573-582. 120 Sport im Mythos - Kampf der Götter und Athleten, in: Sport in unserer Zeit, Heft l, 1983, 28-33. 121 Zum Alten Orient im Geschichtsunterricht. Ein Betrachtungsansatz, in: MEQOR HAJJIM. Festschrift Georg Molin, hrsg. v. I. Seybold, Graz 1983, 409-426. 122 Zur Xenophobie und ähnlichen Einstellungen gegenüber dem Fremden bei den Völkern der Alten Welt. Eine Anregung für den Geschichtsunterricht, in: Domus Austriae. Festschrift H. Wiesflecker, Graz 1983, 426-435. 123 Das Olympische Sportprogramm im Altertum, in: Sport in unserer Zeit, Heft 2, 1984,29-33. D Verzeichnis der von Franz Hampl als Erstgutachter betreuten Dissertationen a) Universität Innsbruck Franz Kaufmann, Roms Ausgreifen nach dem Osten, Diss. Innsbruck 1949. 76 Fritz Gschnitzer, Die Gemeinden Vorderasiens zur Achaimenidenzeit, Diss. Innsbruck 1951. Karl Bleimfeldner, Kimon und seine Politik, Diss. Innsbruck 1952. Josef Donnenberg, Die Götterlehre Walter Friedrich Ottos: Weg oder Irrweg moderner Religionsgeschichte?, Diss. Innsbruck 1961. Wilfried Pabst, Quellenkritische Studien zur inneren römischen Geschichte der älteren Zeit bei T. Livius und Dionys von Halikarnaß, Diss. Innsbruck 1969. George John Szemler, The Priests of the Republic. A Study of Interactions Between Priesthoods and Magistracies, Diss. Innsbruck 1971; gedruckt Brüssel 1972 s. t. The Priests of the Roman Republic (Collection Latomus Vol. 127). Günther Lorenz, Die Einstellung der Griechen zum Tier. Ihre Entwicklung von Homer bis Theophrast (mit einem Ausblick auf das frühe Rom), Diss. Innsbruck 1972. Reinhold Bichler, Kritische Beiträge zum Problem der Geschichtsdarstellung in Schulbüchern. Exemplarische Erörterungen am Beispiel der Behandlung der Alten Welt in einer repräsentativen Auswahl von Geschichtslehrbüchern für Höhere Schulen in der Bundesrepublik Deutschland nebst einem Ausblick auf die entsprechenden Verhältnisse in Lehrbüchern Österreichs, Diss. Innsbruck 1973. Godehard Kipp, Studien zur frühgriechischen Kultpraxis. Unter besonderer Berücksichtigung methodischer Gesichtspunkte, Diss. Innsbruck 1973. Peter Haider, Gefolgschaftsbestattungen in universalhistorischer Sicht. Ein Beitrag zur Vergleichenden Geschichtswissenschaft, Diss. Innsbruck 1974. Martin Wieser, Der Kleinkrieg in der Antike. Beiträge zur Militärgeschichte aus der Sicht der Vergleichenden Geschichtswissenschaft, Diss. Innsbruck 1976. Christoph Ulf, Der Luperkalienritus in der Sicht der Vergleichenden Geschichtswissenschaft, Diss. Innsbruck 1978; gedruckt Darmstadt 1982 s. t. Das römische Lupercalienfest. Ein Modellfall für Methodenprobleme in der Altertumswissenschaft. Reinhard Preindl, Kritische Beiträge zum Problem der Geschichtsdarstellung in der populärwissenschaftlichen Literatur. Exemplarische Erörterung am Beispiel der Alten Welt in einer repräsentativen Auswahl von populärwissenschaftlichen Sachbüchern, Diss. Innsbruck 1981. b) Universität Graz Dr. med. Maria Gherardini, Studien zur Geschichte des Kaisers Commodus, Diss. Graz 1964. Heribert Aigner, Das Heer als Machtfaktor in der ausgehenden römischen Republik, Diss. Graz 1968; gedruckt Innsbruck 1974 s. t. Die Soldaten als Machtfaktor in der ausgehenden römischen Republik. Luciana Aigner, Tesi ipotesi e considerazioni sull’origine degli Etruschi, Diss. Graz 1972; gedruckt Wien 1974. Reinhold Bichler 77 Schriftenverzeichnis Rudolf von Scala 1 Der pyrrhische Krieg, Diss. Berlin-Leipzig 1884. 2 Die Iberische Frage, in: Das Ausland 57, 1884, 861 ff. 3 EmanuelGeibel, 1885. 4 Geschichte und Dichtung. Ein Vortrag, Linz 1885. 5 Zur Charakteristik des Verfassers der Rhetorica ad Herennium, in: Jahrbücher für classische Philologie 131, 1885, 221-224. 6 Ein neues Buch Schliemann’s: Tiryns, in: Österreichische Monatsschrift für den Orient 12, 1886, 31-33. 7 Die Berge im Zendavesta, in: Das Ausland 59, 1886, 941-943. 8 Enge Beziehungen zwischen Griechenland und Ägypten, in: Österreichische Monatsschrift für den Orient 12, 1886, 106-110. 9 Über die wichtigsten Beziehungen des Orientes zum Occidente im Alterthum, Vortrag Wien 1886. 10 Cypern vor der römischen Herrschaft, in: Österreichische Monatsschrift für den Orient 13, 1887, 8385 und 100-102. 11 Über die wichtigsten Beziehungen des Orientes zum Occidente in Mittelalter und Neuzeit, Vortrag Wien 1887. 12 Ein Blick in die Glanzzeiten von Rhodos, in: Österreichische Monatsschrift für den Orient 14, 1888, 59-61 und 69-71. 13 Die Studien des Polybios I, Stuttgart 1890. 14 Theodoros a!deoj bei Polybios, in: Rheinisches Museum für Philologie 45, 1890, 474-476. 15 Zur philosophischen Bildung des Isokrates, in: Jahrbücher für classische Philologie 143, 1891, 445448. 16 Sprichwörtliches bei Polybios, in: Philologus 50, 1891, 375-377. 17 Isokrates und die Geschichtschreibung, in: Verhandlungen der 41. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner zu München, Leipzig 1892, 102-125. 18 Die Hauptquelle der römischen Königsgeschichte bei Diodoros, in: Jahrbücher für classische Philologie 145, 1892,417-422. 19 Griechische Verse bei Livius, in: Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 43, 1892, 108-110. 20 Ein Brief des Aristoteles an Alexander den Großen in arabischer Übersetzung, in: Österreichische Monatsschrift für den Orient 18, 1892, 47-48. 21 Römische Studien. I. Die Darstellung des l. punischen Krieges bei Naevius. II. Alte Sagen und eine junge Legende, in: Festgruß aus Innsbruck an die 42. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Wien, Innsbruck 1893, 119-151. 22 Fabius und Nikias, in: Jahrbücher für classische Philologie 147, 1893, 599-600. 23 Neue Polybiosbruchstücke bei Hieronymus, in: Verhandlungen der 42. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Wien, Leipzig 1894, 357-359. 24 Der hellenische Bund des Demosthenes, in: Verhandlungen der 43. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Köln, Leipzig 1896, 174-176. 25 Individualismus und Sozialismus in der Geschichtschreibung, in: Das Leben. Vierteljahresschrift für Gesellschaftswissenschaften und sociale Cultur l, 1897, 17-28. 26 Friedrich von List, in: Zukunft 17, 1897, 449-454. 27 Die Staatsverträge des Altertums I, Leipzig 1898. 28 Doxographische und stoische Reste bei Ammianus Marcellinus. Ein Beitrag zur Geschichte der allgemeinen Bildung des 4. Jhs. n. Chr., in: Festgabe für Max Büdinger, Wien 1898, 117-150. 28 a Zur Einführung, in: Zeitschrift für alte Geschichte l, 1899, 3 f. 29 Ein Österreichischer Generallandtag, in: Zukunft 30, 1900, 326-331 und 376-379. 30 Griechenland, in: Weltgeschichte, hrsg. v. H. F. Helmolt, Bd. 4, Leipzig-Wien 1900, 255-296. 2. Aufl. Bd. 3, Wien-Leipzig 1914. 31 Max Büdinger, in: Historische Vierteljahrschrift 5, 1902, 441-442. 32 Was uns noth thut. Ein Weg zur Besserung der österreichischen Verhältnisse. Leipzig 1903. 33 Das Griechentum seit Alexander dem Großen, in: Weltgeschichte, hrsg. v. H. F. Helmolt, Bd. 5, Leipzig-Wien 1905, 1-116. 2. Aufl. in: Weltgeschichte, hrsg. v. A. Tille, Bd. 4, Leipzig-Wien 1919, 104-214. 34 Friedrich List, Leipzig 1906. 78 35 Umrisse der ältesten Geschichte Europas, Rektoratsrede, Innsbruck 1908. 36 Sizilische Studien, in: Innsbrucker Festgruß von der philosophischen Fakultät dargebracht der 50. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Graz, Innsbruck 1909, 29-41. 37 Die Behandlung der griechischen und römischen Geschichte an den höheren Schulen, in: Vergangenheit und Gegenwart 2, 1912, 19-24. 38 Aicune osservazioni sulla cronologia dei monumenti detti ,,hetei“, in: Bollettino Riassuntivo III. Congresso Archeologico Internazionale, Rom 1912, 63. 39 Anfänge geschichtlichen Lebens in Italien, in: HZ 108, 1912, 1-37. 40 Das Fortleben der Eratosthenischen Maße, in: Verhandlungen des 18. Deutschen Geographentages zu Innsbruck 1912, Berlin 1912, 206-217. 41 Bevölkerungsprobleme Altitaliens, in: Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 42, 1912,49-58. 42 Persönlichkeiten, Volkskräfte und Staatsmächte im vorigen Jahrhundert, in: Deutsche Revue 39, Januar 1914, 1-12. 43 Aus Brigantiums Frühzeit, in: Archiv für Gesellschaft und Landeskunde Vorarlbergs 10, 1914, 2946. 44 Die Constituio Antonina, in: Papyrus-Studien und andere Beiträge. Dem Innsbrucker Philologenklub zur Feier seines vierzigjährigen Bestandes, Innsbruck 1914, 30-40. 45 Wofür kämpfen wir Deutsch-Österreicher?, in: Deutsche Arbeit 14, 1914, 10-13. 46 Zolleinigung („Zollunion“) zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn, in: Deutsche Arbeit 14, 1914, 73-74. 47 Sozialpolitik nach dem Kriege, in: Deutsche Arbeit 14, 1914, 210-212 und 268-270. 48 Wissenschaft und Patriotismus, in: Deutsche Revue 39, Dezember 1914, 264-268. 49 An Deutschland, in: Süddeutsche Monatshefte 1914 oder 1915, 772-773. 50 Das Griechentum in seiner geschichtlichen Entwicklung (= Aus Natur und Geisteswelt 471), Leipzig-Berlin 1915. 51 Vier welthistorische Urkunden zum Krieg 1914, in: Deutsch-Österreich 4, Heft 4, 1915, 106-114. 52 Otto von Bülow. Ein Mitarbeiter Bismarcks beim deutsch-österreichisch-ungarischen Bündnis, in: Deutsche Revue 41, Januar 1916, 5-12. 53 Die Entwicklung des Deutschtums in Österreich, in: Der Panther 4, 1916, 1341- 1346. 54 Römische Inschriften aus Bayern, in: Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 67, 1916, 1-8. 55 Deutschland und Österreich-Ungarn, in: Deutsche Revue 41, 3. Quartal 1916, 82-86. 56 Zur Geschichte des Altertums im Unterricht, in: Vergangenheit und Gegenwart 7, 1917,1-5. Godehard Kipp Ergänzendes Schriftenverzeichnis C.F. Lehmann-Haupt In der Festschrift „C. F. Lehmann-Haupt zum 70. Geburtstag zum 11. März 1931 zugeeignet“, Leipzig 1931, ist ein nahezu vollständiges Verzeichnis der bis dahin erschienenen Publikationen des Gelehrten veröffentlicht. Einzelne Ergänzungen dazu bzw. eine Fortsetzung bis zum Lebensende Lehmann-Haupts werden im folgenden vorgelegt. 1 Über sprachliche und geschichtliche Ergebnisse aus Lieferung I des Corpus Inscriptionum Chaldicarum, in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft N.F.7, 1928. LIV. 2 Vorarmenische Chalder, Kleinasiaten, Etrusker, in: Wissenschaftlicher Bericht über den 5. Deutschen Orientalistentag in Bonn, Leipzig 1928, 48. 3 Vorarmenische Chalder, Kleinasiaten, Etrusker, in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft N. F. 9, 1930, *108-*109. 4 Vorarmenische Chalder, Kleinasiaten, Etrusker, in: Wissenschaftlicher Bericht über den 6. Deutschen Orientalistentag in Wien, 1930, 48. 5 Die (halbe) Goldmine der Dareikennorm als Gebrauchsgewicht im alten Iberien, in: Forschungen und Fortschritte 7, 1931, 394-395. 6 Nachträgliches zu Alexanders Zug in die Oase Siwa, in: Klio 24, 1931, 376-380. 7 Das Tempelgrab des Priesterkönigs zu Knossos. Arthur J. Evans’ neueste Entdeckung, in: Klio 25, 1932, 169-196. 79 8 Der Sturz des Kroisos und das historische Element in Xenophons Kyropädie, II, in: Wiener Studien 50, 1932, 152-159. 9 Zur Ermordung Sanheribs und zur Thronbesteigung Asarhaddons, in: Klio 26, 1933, 165-185. 10 Iranisches, in: Klio 26, 1933, 347-360. 11 Buzanta (Byzanz) (mit J. Karst), in: Klio 26, 1933, 363-367. 12 Neuerscheinungen und Funde, in: Klio 26, 1933, 136-149. 13 Zur Erwähnung der Ionier in altorientalischen Quellen, in: Klio 27, 1934, 74-83. 14 Zur Erwähnung der Ionier in altorientalischen Quellen, 2. Jawan und die Völkertafel, in: Klio 27, 1934, 286-294. 15 Zu den Kalliasdekreten, in: Klio 27, 1934, 337-339. 16 Zu Buzanta, in: Klio 27, 1934, 340. 17 Budge, E. A. Wallis †, in: Klio 27, 1934, 362. 18 Neuerscheinungen und Neufunde, in: Klio 27, 1934, 187-196 und 348-352. 19 Die historische Bedeutung der Athena Lemnia des Pheidias, in: Klio 28, 1935, 187-189. 20 Geschichte und Philologie in der chaldischen Forschung, in: Klio 28, 1935, 324-337. 21 Corpus Inscriptionum Chaldicarum, 2. Lieferung. Textband IX-XIII, Sp. 57-168 mit Abb., Tafelband l Bl, Taf. XLIII-LXV, Berlin 1935. 22 Forschungen zum antiken und ostasiatischen Gewichtwesen, in: Klio 29, 1936, 250-286. 23 W. Kubitschek †, in: Klio 29, 1936, 348-349. 24 Beiträge in: J. Papastavru: Amphipolis. Geschichte und Prosopographie, in: Klio Beih.37, 1936. 25 Von aussterbenden Vorderasiatischen Sprachen, in: Analecta orientalia 12, 1936 oder 1937, 207224. 26 Epigraphisch-Archäologisches aus Georgien und Armenien, in: Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 45, 1938, 161-168. Günther Lorenz Schriftenverzeichnis Franz Miltner 1 Die Datierung des Areopagitikos des Isokrates, MVPhW (Mitteilungen des Vereines klass. Philologen in Wien) l, 1924, 42-46. 2 Studien zu den römischen Schiffstypen, masch. Diss. Wien 1925. 3 Zur Samia des Menander, MVPhW 2, 1925,4. 4 Epigraphe ex Ephesu, in: Archaiologikon Deltion 9, 1925, 118-120. 5 Schiffsdarstellungen auf einem Relief, MVPhW 3, 1926, 72-84. 6 Zum Berichte des Livius über die Schlacht bei Cannae, in: Wiener Studien 45, 1927, 251-253. 7 Die antiken Lampen in Eisenstadt, JÖAI 24, 1929, Beibl., 145-180. Nachtrag zu den antiken Lampen in Eisenstadt, JÖAI 26, 1930, Beibl., 113-114. 8 Das praenestinische Biremenrelief, JÖAI 24, 1929, 88-111. 9 Eine Steuerruderdarstellung aus dem pisidischen Antiochia, JÖAI 25, 1929, 120. 10 Die antiken Lampen im Klagenfurter Landesmuseum, JÖAI 26, 1930, Beibl., 67-114. 11 Ein Iphigenierelief in Stuhlweißenburg, MVPhW 7, 1930, 61-68. 12 Der taktische Aufbau der Schlacht bei Salamis, JÖAI 26, 1930, 115-128. 13 Das zweite Amphitheater von Carnuntum, Wien 1931.²1932. ³1936. 41939. 51949. Grabungsbericht in: Der Römische Limes in Österreich 17, 1933, 1-72. 14 Die Marienkirche in Ephesos, in: Kirchenkunst 3, 1931, 23-27. 15 Seekrieg und Seewesen, RE Suppl. V, 1931, Sp. 864-962. 16 Dionysos’ Kindheit als Lampenbild, JÖAI 27, 1932, 174. 17 (Mit Helene Miltner:) Bericht über eine Voruntersuchung in Alt-Smyrna, JÖAI 27, 1932, Beibl., 127-188. 18 Die staatsrechtliche Entwicklung des Alexanderreiches, in: Klio 26, 1933, 39-55. 19 Alexanders Strategie bei Issos, JÖAI 28, 1933, 69-78. 20 Die Dorische Wanderung, in: Klio 27, 1934, 54-68. 21 Ein Epigramm aus der Umgebung von Konya, in: Wiener Studien 53, 1935, 150-154. 22 Die Meerengenfrage in der griechischen Geschichte, in: Klio 28, 1935, 1-15. 23 Pro Leonida, in: Klio 28, 1935, 228-241. 24 Nouvelles inscriptions de la region d’Haymana, in: Turk tarih 3, 1936, 91-99. 80 25 (Mit Helene Miltner:) Epigraphische Nachlese in Ankara, JÖAI 30, 1937, Beibl., 9-66. 26 Das Cömeterium der Sieben Schläfer (Forschungen in Ephesos IV, 2), Baden bei Wien 1937. 27 Perikies und andere Träger dieses Namens, RE XIX l, 1937, Sp. 748-791. 28 Augustus’ Kampf um die Donaugrenze, in: Klio 30, 1937, 200-226. 29 Die entwicklungsgeschichtliche Stellung der kleinasiatischen Alphabete, FF 14, 1938,407-408. 30 Germanische Köpfe der Antike, Potsdam 1938. 31 Des Themistokles Strategie, in: Klio 31, 1938, 219-243. 32 Gli studi austriaci sulla figura e l’opera di Augusto e sulla fondazione dell’impero romano (Quaderni Augustei, Studi stranieri VI.) Rom, Ist. di Studi Romani 1938. 33 Die erste milesische Kolonisation im Südpontus, in: Anatolian Studies pres. to W. H. Buckler, Manchester Univ. Pr. 1939, 191-195. 34 Der Geist antiken Seekampfes, in: Neue Jahrbücher für Antike und deutsche Bildung 3,1940,48-56. 35 Der Germanenangriff auf Italien in den Jahren 102/1 v. Chr., in: Klio 33, 1940, 289-307. 36 Die Lage von Noreia, in: Carinthia I, 131, 1941, 289-302, und in: Aus dem römischen und germanischen Kärnten, Festschrift für R. Egger zum 60. Geburtstag, Klagenfurt 1942,42-55. 37 Die Schlacht im Elsaß (58 v. Chr.), in: Klio 34, 1941/42, 181-195. 38 Die deutsche Aufgabe der Altertumswissenschaft, in: Deutschlands Erneuerung 25, 1941, 2-11. 39 Um germanische Einheit, in: Die Antike 18, 1942, 57-70. 40 Die Antike als Einheit in der Geschichte, in: Das neue Bild der Antike, hrsg. v. H. Berve, Bd. 2, Leipzig 1942, 433-453. 41 Die Antike, Grundlage europäischer Zielsetzung, in: Deutschlands Erneuerung 26, 1942, 172-182. 42 Sparta, Vorbild und Mahnung, in: Die Antike 19, 1943, l-29. 43 Zwischen Trebia und Trasimen (218/17 v. Chr.), in: Hermes 78, 1943, 1-21. 44 Wesen und Gesetz römischer und karthagischer Kriegsführung, in: Rom und Karthago, hrsg. v. J. Vogt, Leipzig 1943, 203-261. 45 Landkrieg und Seesieg im Altertum, in: Völker und Meere, Aufsätze und Vorträge, hrsg. v. E. Zechlin, Leipzig 1944, 62-102. 46 Über die Herkunft der etruskischen Schiffe, JÖAI 37, 1948, Beibl., 113-122. 47 Römerzeit in österreichischen Landen, Brixlegg-Innsbruck 1948. 48 Zum Siedlungswesen im Norikum der Spätantike, in: Carinthia I, 140, 1950, 278-284. 49 Lavant und Aguntum. Die frühgeschichtlichen Ruinen bei Lienz in Osttirol, Baden bei Wien 1950, und Lienz 1951. Grabungsberichte in: JÖAI 38, 1950, Beibl. 37-102; 40, 1953, Beibl. 93-156, und 15-92; 41, 1954, Beibl. 43-84; 42, 1955, Beibl. 71-96; 43, 1956, Beibl. 89-124, und in: FF 27, 1953, 89-90, 153-155. 50 Zur Frage der Kontinuität römischer Siedlungen in Österreich, in: Miscellanea G. Galbiati II (Fontes Ambrosiani 26), Mailand 1951, 117-134. 51 Der Tacitusbericht über Idistaviso, RhM N.F. 95, 1952, 343-356. 52 Zur Themistoklesherme aus Ostia, JÖAI 39, 1952, 70-75. 53 Cn. Pompeius Magnus, REXXI2, 1952, Sp. 2062-2211. Cn. Pompeius Magnus der Jüngere, ebd. 2211-2213. Sex. Pompeius Magnus, ebd. 2213-2250. Cn. Pompeius Strabo, ebd. 2254-2262. 54 Der Okeanos in der persischen Weltreichsidee, in: Saeculum 3, 1952, 522-555. 55 M. Porcius Cato Uticensis u. andere Porcii Catones, RE XXII l, 1953, Sp. 168-211 u.165-168. 56 Zur Frühgeschichte der Phöniker, in: Südostforschungen 12, 1953, 154-165. 57 Aus der Frühgeschichte des Namens Europa, in: Orpheus I, 1954, 14-21. 58 Von germanischer Waffenübung und Kriegskunst, in: Convivium, Beiträge zur Altertumswissenschaft. K. Ziegler zum 70. Geburtstag, Stuttgart 1954, 131-153. 59 Bemerkungen zum Alexanderfeldzug in Kleinasien und Syrien, in: Südostforschungen 13, 1954, 121. 60 Wesen und Geburt der Schrift, in: Historia mundi, hrsg. v. F. Valjavec, Bd. 3, Bern 1954, 27-41. 61 Mazedoniens Aufstieg zur Weltmacht, wie Nr. 60, 271-304. 62 Der Aufbau der hellenistischen Staatenwelt, wie Nr. 60, 305-327. 63 Vandalen, RE VIII A l, 1955, Sp. 298-335 (unvollendet). 64 Ethnische Elemente antiker Schiffsformen, in: Gymnasium 62, 1955, 18-28. 65 Die Grenzmarke zwischen Antike und Mittelalter, in: Südostforschungen 14, 1955, 21-34. 66 Grabungsberichte aus Ephesos, in: JÖAI 42, 1955, Beibl. 23-60; 43, 1956, Beibl. 1-64; 44, 1959, 81 Beibl. 243-380; 45, 1960, Beibl. 1-76, und in: Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Wien 93, 1956, 43-52; 94, 1957, 13-25; 95, 1958, 79-89; 96, 1959, 31-43, und in: Türk arkeoliji dergisi 7, 1957, 20-25; 9, 1959, 25-32, und in: Anatolia 3, 1958, 21-34. 67 Der Untergang der hellenistischen Staatenwelt, in: Historia mundi, Bd. 4, Bern 1956, 39-52. 68 Ephesos. Stadt der Artemis und des Johannes, Wien 1958. Eva-Maria Pyrker - Christoph Ulf