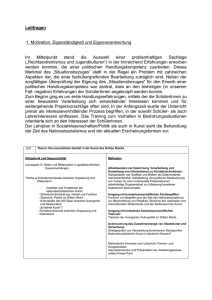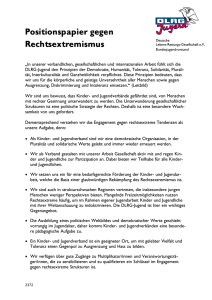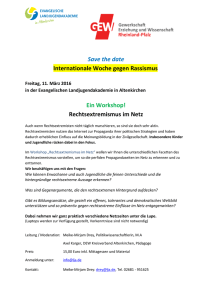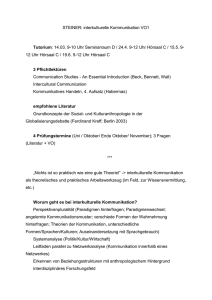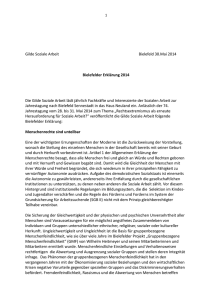als
Werbung
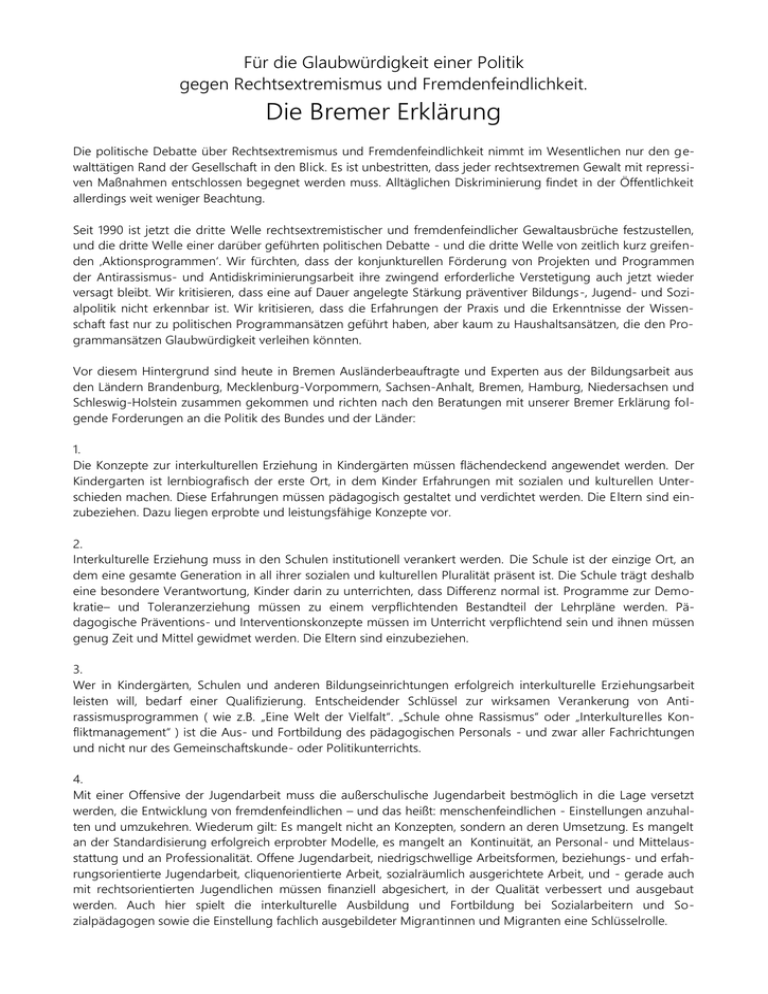
Für die Glaubwürdigkeit einer Politik gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Die Bremer Erklärung Die politische Debatte über Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit nimmt im Wesentlichen nur den gewalttätigen Rand der Gesellschaft in den Blick. Es ist unbestritten, dass jeder rechtsextremen Gewalt mit repressiven Maßnahmen entschlossen begegnet werden muss. Alltäglichen Diskriminierung findet in der Öffentlichkeit allerdings weit weniger Beachtung. Seit 1990 ist jetzt die dritte Welle rechtsextremistischer und fremdenfeindlicher Gewaltausbrüche festzustellen, und die dritte Welle einer darüber geführten politischen Debatte - und die dritte Welle von zeitlich kurz greifenden ‚Aktionsprogrammen‘. Wir fürchten, dass der konjunkturellen Förderung von Projekten und Programmen der Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit ihre zwingend erforderliche Verstetigung auch jetzt wieder versagt bleibt. Wir kritisieren, dass eine auf Dauer angelegte Stärkung präventiver Bildungs-, Jugend- und Sozialpolitik nicht erkennbar ist. Wir kritisieren, dass die Erfahrungen der Praxis und die Erkenntnisse der Wissenschaft fast nur zu politischen Programmansätzen geführt haben, aber kaum zu Haushaltsansätzen, die den Programmansätzen Glaubwürdigkeit verleihen könnten. Vor diesem Hintergrund sind heute in Bremen Ausländerbeauftragte und Experten aus der Bildungsarbeit aus den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zusammen gekommen und richten nach den Beratungen mit unserer Bremer Erklärung folgende Forderungen an die Politik des Bundes und der Länder: 1. Die Konzepte zur interkulturellen Erziehung in Kindergärten müssen flächendeckend angewendet werden. Der Kindergarten ist lernbiografisch der erste Ort, in dem Kinder Erfahrungen mit sozialen und kulturellen Unterschieden machen. Diese Erfahrungen müssen pädagogisch gestaltet und verdichtet werden. Die Eltern sind einzubeziehen. Dazu liegen erprobte und leistungsfähige Konzepte vor. 2. Interkulturelle Erziehung muss in den Schulen institutionell verankert werden. Die Schule ist der einzige Ort, an dem eine gesamte Generation in all ihrer sozialen und kulturellen Pluralität präsent ist. Die Schule trägt deshalb eine besondere Verantwortung, Kinder darin zu unterrichten, dass Differenz normal ist. Programme zur Demokratie– und Toleranzerziehung müssen zu einem verpflichtenden Bestandteil der Lehrpläne werden. Pädagogische Präventions- und Interventionskonzepte müssen im Unterricht verpflichtend sein und ihnen müssen genug Zeit und Mittel gewidmet werden. Die Eltern sind einzubeziehen. 3. Wer in Kindergärten, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen erfolgreich interkulturelle Erziehungsarbeit leisten will, bedarf einer Qualifizierung. Entscheidender Schlüssel zur wirksamen Verankerung von Antirassismusprogrammen ( wie z.B. „Eine Welt der Vielfalt“. „Schule ohne Rassismus“ oder „Interkulturelles Konfliktmanagement“ ) ist die Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals - und zwar aller Fachrichtungen und nicht nur des Gemeinschaftskunde- oder Politikunterrichts. 4. Mit einer Offensive der Jugendarbeit muss die außerschulische Jugendarbeit bestmöglich in die Lage versetzt werden, die Entwicklung von fremdenfeindlichen – und das heißt: menschenfeindlichen - Einstellungen anzuhalten und umzukehren. Wiederum gilt: Es mangelt nicht an Konzepten, sondern an deren Umsetzung. Es mangelt an der Standardisierung erfolgreich erprobter Modelle, es mangelt an Kontinuität, an Personal- und Mittelausstattung und an Professionalität. Offene Jugendarbeit, niedrigschwellige Arbeitsformen, beziehungs- und erfahrungsorientierte Jugendarbeit, cliquenorientierte Arbeit, sozialräumlich ausgerichtete Arbeit, und - gerade auch mit rechtsorientierten Jugendlichen müssen finanziell abgesichert, in der Qualität verbessert und ausgebaut werden. Auch hier spielt die interkulturelle Ausbildung und Fortbildung bei Sozialarbeitern und Sozialpädagogen sowie die Einstellung fachlich ausgebildeter Migrantinnen und Migranten eine Schlüsselrolle. 5. Schule und außerschulische Jugendarbeit müssen im Kampf gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit institutionell stärker kooperieren und die Projekte miteinander vernetzen. Sie müssen dabei auch die Institutionen und Projekte miteinbeziehen, die im Rahmen zivilgesellschaftlicher Aktivitäten entstanden sind und entstehen. Dies gilt besonders auch für die ( kleinräumige ) Stadtteilebene, betrifft hier z.B. das Einbeziehen von Sportvereinen, kirchlichen Einrichtungen, Kindertagesstätten, Bürgerhäusern, Polizei, Migrantenvereinen, aber auch von örtlich zuständigen Mitbestimmungsgremien. 6. Bestehende Programme zur Förderung von Zweisprachigkeit für die Migrantenbevölkerung ( wie z. B. das „Hippy-Programm“ für Vorschulkinder, Deutsch als Zweitsprache, Förder- und Stützkurse in den Schulen, muttersprachlicher Unterricht oder das Programm „Mama lernt Deutsch“ für Mütter von Grundschulkindern ) dürfen nicht ‚Sparmaßnahmen‘ zum Opfer fallen, sondern müssen ausgebaut und finanziell abgesichert werden. Auch Flüchtlinge sollen an Deutschkursen teilnehmen dürfen. Der Erwerb von Kenntnissen der deutschen Sprache ist eine wichtige Voraussetzung für die gesellschaftliche Integration der Migrantenbevölkerung, schafft auch die Voraussetzung dafür, dass nicht nur über ‚die Ausländer‘ geredet werden kann, sondern mit ihnen, ist auch schon insofern ein Beitrag zur Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit. Durch die Akzeptanz und Förderung von Mehrsprachigkeit in Kindergarten und Schule lernen auch die einsprachigen deutschen Kinder den Umgang mit mehrsprachigen Situationen und entwickeln keine Angst davor. 7. Die Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung müssen so interkulturell und mehrsprachig sein wie unsere Gesellschaft. In privatwirtschaftlichen Unternehmen ist teilweise viel früher als von der Bildungs- und Sozialpolitik erkannt worden, welche Bedeutung interkulturelles Lernen und Zweisprachigkeit im Rahmen der Ausbildung haben muss, und welche Synergieeffekte im Zusammenspiel unterschiedlicher Kulturen entstehen können. Die Politik und die von ihr zu verantwortenden öffentlichen Verwaltungen hinken dem hinterher. Das erfordert zum Einen die vermehrte Einstellung von Migrantinnen und Migranten in den öffentlichen Dienst; hier besteht bis heute eine geradezu skandalöse Unterrepräsentation, eine faktische Ausgrenzung von Migranten aus dem öffentlichen Dienst. Das erfordert zum Anderen die interkulturelle Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die öffentlichen Dienste haben Vorbildfunktion wahrzunehmen. 8. Strategien einer erfolgreichen Antidiskriminierungsarbeit erfordern eine politisch verantwortete und gesellschaftlich vorbild- und richtungweisende Kontinuität. Diese Kontinuität ist die zwingende Voraussetzung dafür, dass sich das immer wieder beschworene zivilgesellschaftliche Engagement von Einzelpersonen und Gruppen überhaupt weiter entwickeln kann. Aber es gibt noch eine zweite Voraussetzung: Zivilgesellschaftliches Engagement, das auf Dauer wirksam sein soll, bedarf einer offensiven finanziellen Unterstützung jener Vereine, Initiativen und Gruppen, die sich mit Projekten gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit engagieren. 9. Investitionen in die soziale und berufliche Perspektive von Menschen sind auch Investitionen in die Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit. Wissenschaftliche Studien haben noch einmal den Zusammenhang zwischen dem sozialen, bildungsmäßigen und arbeitsmarktlichen Status von Menschen und ihrer Anfälligkeit für fremdenfeindliche Einstellungen deutlich gemacht. Der gesellschaftliche Schaden, der mit Einsparungen z.B. bei der Schulförderpoltik oder Ausbildungsförderpolitik angerichtet wird, kann von der Bundes- oder Landespolitik nicht preiswert durch die Schaltung von Plakaten gegen Fremdenfeindlichkeit ausgeglichen werden, sondern setzt diese Plakate dem Verdacht einer moralischen Selbstinszenierung aus. 10. Die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Diskriminierung in nationales Recht sollte in Form einer Antidiskriminierungsgesetzgebung erfolgen, um die Basis für ein wirksames Vorgehen gegen Diskriminierung zu schaffen. Bremen, 23. November 2000