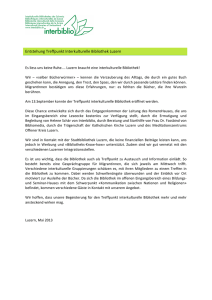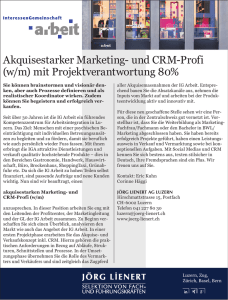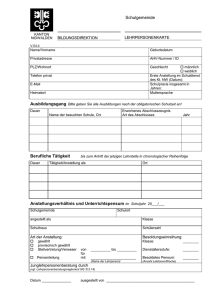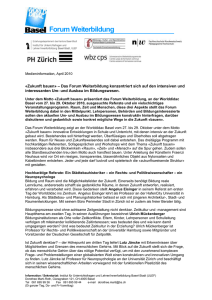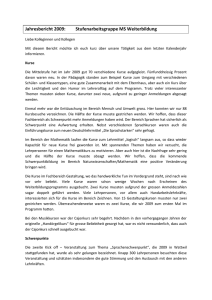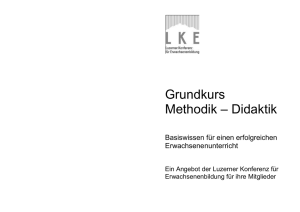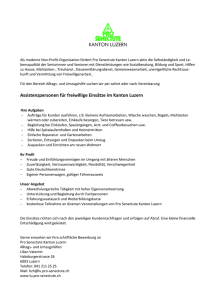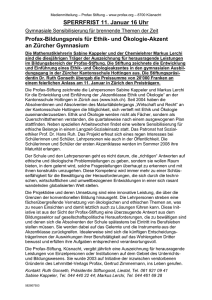Einander Verstehen – Interkulturelle Kommunikation
Werbung

Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen Erfahrungsaustauschtreffen vom 8. September 2004 in Luzern Einander Verstehen – Interkulturelle Kommunikation Kurzfassung des Vortrags von Stefan Lüönd Professionelle pädagogische Kommunikation ist anspruchsvoll, dafür spricht schon die Menge an Ratgeberliteratur und die unzähligen Vorlesungen und Seminare zu den verschiedensten Kommunikationsmodellen. Bei der interkulturellen Kommunikation stellen sich dort, wo Angehörige zweier oder mehrerer Kulturen Interaktionssituationen unterschiedlich, ja sogar widersprüchlich interpretieren und entsprechend handeln, zusätzliche Verstehenshindernisse in den Weg. Um überhaupt von Verständigungsschwierigkeiten zu sprechen, muss man annehmen, dass jenseits der Akteure dieser Kulturen jeweils eine eigene Lebenswelt, d.h. ein gemeinsames Hintergrundwissen besteht, dass von der eigenen Gruppe als unproblematisch bzw. selbstverständlich anerkannt wird. Sofern von ‚kultureller Grammatik’ gesprochen wird, ist genau dieses spezifische ‚wechselseitige Wissen’ der Mitglieder einer Kultur gemeint, das als Basis für kommunikative Handlungen betrachtet werden kann (vgl. Giordano, 1994). Von Menschen aus anderen Kulturen erwarten wir oft einseitig, dass sie unsere ‚kulturelle Grammatik’ möglichst schnell erlernen und verstehen. Während die Schule dies durch das Zusammenführen und das Zusammenleben über Zeit für die Schüler und Schülerinnen Schritt für Schritt ermöglicht, verfügen besonders Mütter, die nicht in entsprechende interkulturelle Lern- und Lebenssituationen eingebunden sind, nicht über genügend Erfahrungsmöglichkeiten mit ‚unserer’ kulturellen Grammatik. Folgerichtig zielen viele Integrationsprojekte auf diese Gruppe von Frauen (siehe beispielsweise die verschiedensten Projekte zu Deutsch für Mütter). Auf die Schule bezogen kann gesagt werden, dass kultureller Bi- und Plurilinguismus in den Schweizer Schulen mehr und mehr verbreitet sind. Nur sind sie – so kann man argumentieren – bei den Rollenträgerinnen und -träger einseitig verteilt. Während Schüler und Schülerinnen aus immigrierten Familien alle zwei bzw. mehrsprachig aufwachsen und zu mindest mündlich spielerisch lustvoll zwischen den verschiedenen Sprachen hin und her wechseln, sind die Rahmenbedingungen für das schulische Lehren und Lernen immer noch vorwiegend monolingual und monokultural (vgl. Gogoglin, 1999) eingefärbt. Die allermeisten Schweizer Lehrpersonen oder Anwärterinnen und Anwärter darauf, sind - genau so wie ihre Eltern - einsprachig aufgewachsen. Einem kulturell homogenen Lehrkörper steht eine multikulturelle Schülerschaft gegenüber, die zwei- oder mehrsprachig aufgewachsen ist und zumindest einen Teil ihres Lebens in einer anderen Gegend der Welt verbracht hat. ‚Man muss zwar nicht Cäsar sein, um Cäsar zu verstehen’ (Giordano, 1994), aber es braucht ein paar zusätzliche Kompetenzen, um die blinden Flecken zu erkennen, die einem das monolinguale und monokulturelle Aufwachsen beschert haben, um bei den Schülerinnen und Schülern Differenzen und Gemeinsamkeiten zu erkennen und diese für das schulischen Lernen und soziale Zusammenleben produktiv zu machen, um strukturelle Bedingungen zu hinterfragen, die einer adäquaten Förderung aller Kinder immer noch im Wege stehen. Einander Verstehen ist voraussetzungsvoll, weil gerade in der Schule ein Verstehen wollen und ein Verstehen können Hand in Hand gehen müssen. Die Schule ist nicht ein Ort unschuldiger Kommunikationen, denn unaufhörlich werden Erziehungsabsichten kommuniziert, die unter Sanktionsandrohung befolgt werden können oder auch nicht. Die Schule ist kein Ort unschuldiger Kommunikationen, weil sie soziale und kulturelle Herkunft in Lebenschancen verwandelt und die Selektionsfunktion ihr gebietet, diese mit erheblichen Konsequenzen für die Betroffenen möglichst ‚gerecht’ zu verteilen. Die Schule ist kein Ort unschuldiger Kommunikationen, weil man heute weiss, dass sie dies nicht chancengleich tut, sondern gewisse Gruppe bevorzugt, andere benachteiligt. Verstehen Wollen setzt Verstehen Können voraus, Verstehen Können ein Verstehen Wollen. In dem Sinn ist Verstehen ein zirkulärer Prozess. Ein Prozess, der nie abschliessbar ist, weil Verstehen können mit Wissen zu tun hat, das immer nur vorläufig sein kann. Die Interkulturelle Kommunikation stellt also nicht nur eine sprachliche Herausforderung dar, auf die sich die Schule noch nicht in aller Konsequenz eingestellt hat. Das Verstehen wollen setzt auch hohe Kompetenzen der Perspektivenübernahme voraus, um den oben angesprochenen blinden Fleck bewusst zu machen und zu überwinden. Lehrpersonen aber auch Schülerinnen und Schüler müssen diese kognitiven Möglichkeiten (weiter-)entwickeln, um auf einer komplexen Stufe sich in die Lage des Andern/der Andern zu versetzen. Dabei geht es darum, Schul- und Familiensituationen, gelebte biografische Erfahrungen immer wieder aus der Perspektive des Andern / der Andern zu sehen und diese im eigenen Planen und Handeln zu berücksichtigen. Selman (1984) beschreibt eine Stufenfolge von immer anspruchsvoller, aber auch umfassender werdenden Perspektivenübernahmen. Es ist relativ gut belegt, dass jene Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler, welche in der Lage sind, auf der komplexesten Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen / Erfahrungsaustauschtreffen vom 8. September 2004 in Luzern 2 Stufe diese Perspektivenübernahme zu gestalten, auch am ehesten in der Lage sind, sich und andere als Teil eines Systems zu sehen und sich und andere dazu in Beziehung zu setzen. Selman zeigt, dass sich die Stufenabfolge auch auf das Freundschaftsverständnis von Kindern anwenden lässt. Entsprechende Förderung der sozialen Kompetenz in der Schule ist möglich. Der Philosoph Rawls radikalisierte den Gedanken der Perspektivenübernahme noch, wenn er fordert, sich in einen Schleier der Unwissenheit zu versetzten, wenn es darum geht, herauszufinden, was eine gerechte Gesellschaft sein könnte. Zu den wesentlichen Eigenschaften dieser Situation gehört, dass niemand seine Stellung in der Gesellschaft kennt, nicht seine soziale Klasse oder Status, nicht sein Los bei der Verteilung natürlicher Gaben wie Intelligenz oder Körperschaft. Niemand kann sich also Grundsätze ausdenken, die ihn aufgrund seiner besonderen Verhältnisse bevorzugen. Der Schleier der Unwissenheit ist so dicht, dass nicht für ein Verteilungsprinzip argumentiert werden kann, das den eigenen Vorteil zu Lasten anderer sichert (vgl. Rawls, 1975). Wer darüber nachdenkt, wie eine Schule aussehen könnte, d.h. welche Rahmenbedingungen sie braucht, um eine erfolgreiche multikulturelle Schule zu werden, bei der gegenseitiges Verstehen und gegenseitig Achtung eine Grundvoraussetzung sind, muss zum Perspektivenwechsel fähig sein, muss die Schule wie sie ist, radikal hinterfragen und sich ab und zu in den Unwissenheitsschleier hüllen können, um auf der Grundlage bestmöglichen Wissens auf eine gerechtere, bessere, gesundheitsfördernde Schule zu kommen, ohne zu vorher zu wissen, welche Rolle er oder sie in dieser neuen Schule auszugestalten haben wird. Wenn unter einem Schleier der Unwissenheit eine Utopie von einer gerechten Schule entwickelt wird, muss sie die Bedürfnisse und Ressourcen aller Beteiligten berücksichtigen. Damit ein gegenseitiges Verstehen möglich ist, braucht es also spezifische Rahmenbedingungen, die ermöglichen, dass Kompetenzen auch umgesetzt werden können. Von meiner Tätigkeit als Schulbegleiter von QUIMS-Schulen im Kanton Zürich weiss ich, dass gerade unter den Steuergruppenmitglieder Lehr- und Fachpersonen zu diesem komplexen Perspektivenwechsel fähig waren und das einlösen konnten, was Lanfranchi (2002) von Lehrpersonen in multikulturellen Schulen fordert, nämlich: „Wenn es Lehrerinnen und Lehrern als Fachleute für Lernen gelingt, zusätzlich Fachleute für die Gestaltung von Beziehungen zu werden, wird es unter anderem durch gute Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen / Erfahrungsaustauschtreffen vom 8. September 2004 in Luzern 3 Kommunikation möglich sein, aus Ohnmacht Kompetenz zu entwickeln, in Problemlagen Ressourcen zu erkennen und aus überforderten Schulen mit monolingualem und monokulturellem Habitus wirksame multikulturelle Schulen zu machen.“ Wenn ich spontan an eine solche Lehrperson denke, kommt mir Frau Nurina* in den Sinn, die für mich die Verkörperung einer reflektierenden und reflektierten Praxisperson darstellte. Sie strebte über hohe Erwartungen an alle ihre Schüler und Schülerinnen konsequent deren Lernerfolg an; sie war bereit, sich für ihren Sprachunterricht bereits im ersten Jahr als Lehrperson professionelle Unterstützung zu holen, als sie merkte, dass sie über zuwenig Wissen verfügte, um ihren eigenen hohen Erwartungen und den Ansprüchen der anwesenden Schülerschaft gerecht zu werden. Und sie vertrat mit grosser Vehemenz in ihrem Team ihre universalistische Position: Egal woher die Schüler und Schülerinnen kommen und wessen Sprache sie sprechen, sie haben dasselbe Recht auf optimale Lernbedingungen, und ich die Pflicht, diese zu ermöglichen. Dass dabei die Förderung der Sprachfähigkeit in den verschiedenen Sprachen, die Zusammenarbeit mit den Eltern und die Entwicklung einer entsprechenden Lehr- und Lernkultur im Schulhaus im Zentrum ihrer Überlegungen standen, war nur konsequent. Konsequent war auch – dass sie es nach ein paar Jahren erfolglosem Versuchen – eine entsprechende Lehr- und Lernkultur im Schulhaus zu etablieren und entsprechende Schulentwicklung voranzutreiben, ihre Stelle aufgab und sich eine Schule suchte, wo eine entsprechende Kultur und eine entsprechende Bereitschaft vorhanden war. Nurina ist, wie sie unschwer erraten haben, ein italienischer Name. Sie hatte – was die meisten von uns nicht haben, zum Teil schmerzhafte Erfahrungen mit unserem Schulsystem, das Wissen, was es heisst, zwei- oder dreisprachig aufzuwachsen und zwischen verschiedenen Kulturen hin und herzupendeln. Sie hat auch viele der ihren scheitern gesehen, begabte und weniger begabte als sie. Im Lehrberuf fühlte sich verpflichtet, ihren Teil dazu beizutragen, dass die heutigen Kinder und Jugendlichen zukünftig als Schüler und Schülerinnen nicht Schiffbruch erleiden müssen. Die Andere, dass war in ihrem Fall sie selbst. Die täglichen Erfahrungen, jene Andere zu sein, die so schwierig in unsere Schule passt und es doch geschafft hat, dank ihren Fähigkeiten ganz sicher, vielleicht auch wegen einzelnen Lehrpersonen, die sie förderten und motivieren konnten, machte sie sensibel für deren Anliegen und Bedürfnisse. Wie gesagt, man braucht nicht unbedingt bi- oder plurikulturell aufgewachsen zu sein, um Menschen anderer Herkunft zu verstehen. Obwohl es sehr wünschenswert wäre, wenn mehr Frauen und Männer mit entsprechendem soziokulturellen Hintergrund den Lehrberuf ergreifen und so den Druck auf die monolingualen Strukturen etwas erhöhen würden. Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen / Erfahrungsaustauschtreffen vom 8. September 2004 in Luzern 4 Denn es braucht unterstützende Rahmenbedingungen, die so aussehen könnten, wie Auernheimer (vgl. 2002) sie aus Elementen skandinavischer Schulsysteme entworfen hat: Wenn die Kinder als Schulanfänger in diese Schule kommen, sind ihre Startbedingungen angeglichen. Sie haben fast alle seit dem zweiten Lebensjahr eine Vorschule besucht. Kinder mit anderer Familiensprache haben also schon Gelegenheit gehabt, die Landessprache zu lernen. Alle haben soziales Verhalten eingeübt und sind mit kulturellen Praktiken und Medien wie Mal- und Bilderbüchern vertraut. Wer dennoch Schwierigkeiten hat, für den gibt es ein individuelles Förderprogramm. Sitzenbleiben droht ohnehin nicht; denn das ist abgeschafft. Es gibt ja bis zum 8. Schuljahr nicht einmal Noten, stattdessen individuelle Lernberichte über den jeweiligen Lernfortschritt. Zweisprachig aufwachsende Kinder werden zweisprachig alphabetisiert. Der zweisprachige Schreib- und Leselehrgang ist gesetzlich vorgeschrieben. Sobald vier Kinder einer Minderheitensprache in einer Gemeinde sind, haben die Eltern Anspruch auf Unterricht in ihrer Sprache. Wenn die Primarschulzeit endet, werden die Schüler und Schülerinnen nicht nach Schularten getrennt; denn eine Aufteilung nach verschiedenen Bildungsgängen findet erst nach dem 9. Schuljahr statt. Es entwickelt sich also nicht schon in der Primarschulzeit ein Leistungs- und Konkurrenzdruck. Schüler mit ungünstigeren Voraussetzungen haben eine Chance, im Lauf der neun Jahre aufzuholen. Im Übrigen sind alle Schulen der obligatorischen Schulzeit Ganztagsschulen. Schüler und Schülerinnen von heute verkörpern alle Multi- oder Transkulturalität, nicht alle im gleichen Ausmass, nicht alle mit denselben Spannungen, nicht alle mit denselben Konsequenzen. Meine Schlussthese wäre: Auch Sie, geschätzte Lehrpersonen, sind multioder transkultureller als Sie selber denken, weil Kultur als homogenes Ganzes nicht existiert. Lassen sich nicht beirren durch all die Diskurse zur Differenz, zum Kampf der Kulturen etc. Das Gemeinsame zu thematisieren, von universellen Prinzipien und Werten her unser Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen / Erfahrungsaustauschtreffen vom 8. September 2004 in Luzern 5 Menschsein zu denken, lässt Ihnen auch als Lehrpersonen alle Wege offen, individuelle Wege zu finden, die zu Ihnen und den Ihnen anvertrauten Schüler- und Schülerinnen passen. Haben Sie eine universelle Landkarte mit dabei, können Sie sich zwar verirren und müssen ab und zu Umwege in Kauf nehmen, aber Sie können nicht von der Karte fallen. Das sollte Ihnen Mut geben, Ihren eingeschlagenen Weg bewusst weiterzugehen oder sich gegebenenfalls neuen Erfahrungen zu öffnen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! * Name geändert Verwendete Literatur: Auernheimer Georg (Hrsg.) 2002. Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität. Opladen: Leske + Budrich Giordano Christian. 1994. Transkulturelle Kommunikation, Missverständnisse und Mehrsprachigkeit. Internetversion www.unifr.ch/spc/UF/94juin/giordano.htm Gogolin Ingrid. Mehrsprachigkeit als Kapital bei der Berufseinmündung. Internetversion: http://www.ingrid-gogolin.de/print/Ringvorlesung.htm Lanfranchi Andrea in. G. Auernheimer (Hrsg.) 2002. Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität. Opladen: Leske + Budrich (S.206-233) siehe: Internetversion für www.schulsozialarbeit.ch Rawls John. 1975. Eine Theorie der Gerechtigkeit. Suhrkamp, Frankfurt Selman, R. (1984): Die Entwicklung des sozialen Verstehens. – Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen / Erfahrungsaustauschtreffen vom 8. September 2004 in Luzern 6