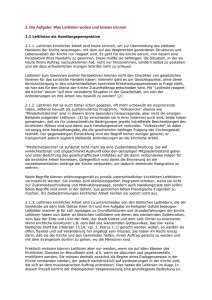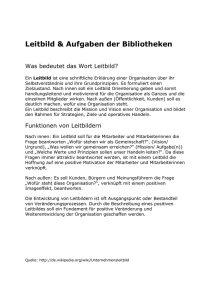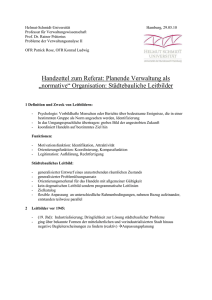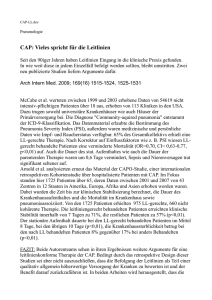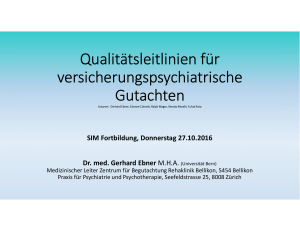Leitbilder und Leitlinien in Universitäten
Werbung

Plenarbeitrag zur Leitbilddiskussion am 16. März 2000 von Prof. Dr. Dieter Wagner Leitbilder und Leitlinien in Universitäten 1. Für einen Betriebswirtschaftler, der den Schwerpunkt Organisation und Personalwesen vertritt, ist es eigentlich banal, was zunehmend im Zuge der aktuellen Diskussion um Hochschulreformen erkannt wird: Universitäten sind große Organisationen. Organisationen haben Ziele, sie sind dauerhaft strukturiert und sie verfügen über gewachsene Traditionen und Hierarchien. Neben dem Aufbau werden die Prozesse immer wichtiger. Universitäten bilden Studenten aus und erbringen Forschungsleistungen. Die wertvollste Ressource sind insofern die Forscher und die Lehrer (nach Möglichkeit in Personalunion), aber auch die vielen einzelnen Mitarbeiter auf allen Ebenen; häufig läuft ohne sie gar nichts. Nicht zu vergessen ist aber auch ein Mindestmaß an finanziellen Ressourcen, um die Kreativität und die Arbeitsbereitschaft des Personals und der Studenten produktiv nutzen zu können. 2. Es gibt eine bis in die Fünfziger Jahre zurückgehende Diskussion über den Sinn und den Unsinn von Leitbildern. Ursprünglich sprach man übrigens von Richtlinien (50er/60er) und Grundsätzen (60er/70er) bis eben hin zu Leitlinien und Leitbildern. 3. Insgesamt handelt es sich um Aspekte des Normativen Managements: Leitbilder geben nämlich eine Orientierung vor dem Hintergrund der grundlegenden Politik einer Universität (Abb.1), die wiederum aus der externen und der internen Hochschulverfassung abgeleitet ist. Nicht zuletzt sind sie ein Element der Organisationskultur mit einer unterschiedlichen, z.B. rigiden und strengen, oder einer flexiblen, offenen und toleranten Ausprägung. Prof. Dr. Dieter Wagner Leitlinien und Leitbilder in großen Organisationen Definition Leitbild: Ein Leitbild beschreibt insbesondere Ziele und Wertvorstellungen der Organisation und formuliert Prinzipien für die Bestimmung der Aufgabenfelder, für die Gestaltung der Organisation und für den Umgang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte sowohl miteinander als auch mit ihren Kunden. Damit bringt ein Leitbild zum einen die Erwartungen an die Mitglieder der Organisation zum Ausdruck, zum anderen wird das Selbstverständnis der Organisation nach außen dokumentiert. Abb. 1 4. Die bislang bekannt gewordenen widersprüchlich (Abb. 2 und 3). Erfahrungen mit Leitlinien sind durchaus 2 Prof. Dr. Dieter Wagner Leitlinien und Leitbilder in großen Organisationen Die schriftliche Fixierung von Leitbildern weist Vor- und Nachteile auf : Vorteile : Sie schafft einen • Zwang zu genauerem, präzisen Denken • das Problembewußtsein wird aktiviert • eine höhere Verbindlichkeit und Beständigkeit wird durch das Niederlegen von Normen erreicht • die Kommunikation wird erleichtert Nachteile : Die nicht unbegründete Meinung, daß • persönliches Vorbild genügt • die inhärente Tendenz zur Formalisierung • Verlust an Flexibilität gegenüber abweichenden Entwicklungen • Formulierungsprobleme beschäftigen häufig mehr als Inhalte • die Preisgabe von Firmengeheimnissen manche Formulierungen als banale Selbstverständlichkeiten erscheinen Abb. 2 Prof. Dr. Dieter Wagner Leitlinien und Leitbilder in großen Organisationen Funktionen von Leitbildern • Entwurf eines Zukunftsfits von Umwelt- und Unternehmensentwicklung • Orientierungs- und Stabilisierungsfunktion • Beitrag zur Sinnfindung • Verhaltensentwicklung • Motivation und Kohäsion • Erleichterung der Koordination • Imagebildung • Unternehmenskulturelle Transformationsfunktion Mögliche Dysfunktionalitäten • Irreale Wunschbilder vermitteln Gefühl trügerischer Sicherheit • Notwendiger Wandel wird blockiert • Kosmetische Schönfärberei von Stäben; unglaubwürdige Leerformeln • „Kulturtechnokratie“ mit kontraproduktiven Wirkungen Abb.: Funktionen und Dysfunktionalitäten von Leitbildern. Abb. 3 Wichtig ist, welche Diskussionsprozesse angestoßen werden und was man auch programmatisch aus ihnen macht. Entscheidend ist also der Einführungsprozeß. Insofern ist dieser Prozeß auch das eigentliche Ziel. Der Text eines Leitbildes und erst recht seine genaue Formulierung ist zunächst einmal überhaupt nicht wichtig. Um so mehr kommt es darauf an, daß möglichst viele Universitätsmitglieder sich „ein Bild“ machen und daraus Schlüsse ziehen, über die man sich verständigt hat. Insofern ist die Beziehungsebene mindestens so wichtig wie die Sachebene. Sonst gibt das Leitbild primär die Vorstellungen von wenigen Experten wider, die sich in ihrem kleinen Kreis mit dieser Thematik beschäftigen und deshalb genau wissen, was sie wollen. Nur: was ist mit den vielen anderen Organisationsmitgliedern? Die Einführung von Leitlinien umschließt einen schwierigen, konfliktvollen, längeren Prozeß. Es ist nicht damit getan, wenn auch nachvollziehbar und zumindest auf den ersten Blick sehr verständlich, wenn z.B. in einem sehr frühen Stadium mit vorgefertigten Texten gearbeitet wird. In späteren Stadien können sie allerdings sehr wohl sehr nützlich sein. Vielmehr ist zunächst auf geeignete Weise zu ermitteln, wie ein einigermaßen repräsentatives Meinungsbild bei den einzelnen Universitätsgruppierungen über den aktuellen Stand, 2 3 insbesondere die Stärken und die Schwächen der Universität aussieht. Erst dann kann man über Veränderungen reden. Hinzu kommt, dass durch ein partizipativ entwickeltes Leitbild auch die Kooperation zwischen den Disziplinen erleichtert wird. 2. Meine Vision einer modernen Universität - einige persönliche Vorbemerkungen Mein persönliches Bild einer modernen Universität ist natürlich nicht von meinem Werdegang und meiner persönlichen Situation zu trennen: kaufmännische Lehre, Zweiter Bildungsweg, Integriertes Studium der Wirtschaftswissenschaften und auch der Soziologie, Führungspraxis in einem Wirtschaftsunternehmen, aber auch Leitung mehrerer Drittmitelbzw. DFG-Projekte, Mitglied in mehreren Beiräten und Studienleiter der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Potsdam, bislang tätig in eher überschaubaren, reformorientierten Universitäten (Gießen, Bundeswehr-Universität Hamburg), drei Kinder, zur Zeit im Grundstudium sehr unterschiedlicher Fächer (jedenfalls nicht Wirtschaftswissenschaften!) Ich finde, dass (nicht nur) ein BWL-Professor zunächst eine vielseitige Lehre anbieten sollte, die sowohl auf sauberen theoretischen Grundlagen aufbaut, aber auch die Brücke zur Praxis bildet und (eine entsprechende Hochschulreife vorausgesetzt) verständlich ist. Wenn sie gut systematisiert und didaktisch gut strukturiert ist, kann sie sich m.E. ruhig mit dem Vorwurf der „Verschulung“ und des „Fachhochschulniveaus“ auseinandersetzen. Ich glaube nämlich, dass es alleine mit scharfen Prüfungsbedingungen und mathematischen Formeln auch nicht getan ist, um Universitätsniveau zu repräsentieren. Auch die Fähigkeit zum analytischen und zum kreativen Denken ist gefragt und denkbarer Bestandteil eines entsprechenden Unterrichts. Ein Universitäts-Professor oder eine Universitätsprofessorin sollte natürlich auch ein guter Forscher sein. Drittmittel-Einwerbung spielt dabei auch eine wichtige Rolle, aber auch die externe Vermittlung der Ergebnisse sowie ihre interne Einbeziehung in die Lehre. Auch der Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung sollte man sich nicht verschließen. Arbeit gibt es hier genug. Wirklich engagierte Kollegen sind eher selten, und auf Dauer brauchen sich die Kollegen Hochschullehrer nicht zu wundern, wenn sogenannte „Profis“ aus den Hochschul-Organisationen die akademischen Schlüsselfunktionen übernehmen werden. Nicht zuletzt ist in unserem Fach, wie auch in manchen anderen Fächern, der Bezug zur Praxis wichtig. Durch Vortrags- und gelegentliche Beratungstätigkeiten kann dabei ein wechselseitiger Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis erfolgen. - Wie sieht nun meine Universität der Zukunft aus? 1. Per Hochschulgesetz ist eine Stiftungslösung ermöglicht worden. Der Stiftungsrat besteht aus unabhängigen Personen, aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung, gewählt von den Abgeordneten des Landtags. Die Universität hat einen Globalhaushalt: die Kameralistik ist abgeschafft. Hinzu kommt die Transfer-GmbH, deren Einnahmen aus der Verwertung von Patenten und Lizenzen sowie aus mehreren Summer-Schools und Aufbaustudiengängen langsam, aber stetig gestiegen sind. Auch die Anzahl der 3 4 Stiftungsprofessuren hat sich inzwischen erhöht, nachdem das Beispiel von Hasso Plattner sich als erfolgreich und nachahmenswert erwiesen hat. Die ersten Alumnis helfen der Universität in finanzieller und in ideeller Hinsicht. Die Mitglieder der Universität sind grundsätzlich auf Zeit angestellt. Bei langjähriger Bewährung sind Daueranstellungen gleichwohl die Regel. Allerdings hat in letzter Zeit der Wechsel zwischen Wissenschaft einerseits, Wirtschaft, Verwaltung, Kunst, Kultur andererseits zugenommen, nachdem der Beamtenstatus erstens für viele neue Mitglieder nicht mehr gilt und andererseits viele Angleichungen in der Kranken- und in der Rentenversicherung stattgefunden haben. „Ossis“ und Wessis“ erhalten dieselben Bezüge. So kann man Pensionsansprüche seit dem 01.07.2009 in andere Organisationen „mitnehmen“. 2. Die meisten Mitglieder der Universität arbeiten viel offener und fairer miteinander als früher. Auch die einfachen Mitarbeiter werden als wertvoll und wichtig anerkannt. Der Umgang auf den verschiedenen Hierarchieebenen und mit den Studierenden ist wesentlich verbindlicher geworden. Man hat sich an eine neue Streitkultur gewöhnt und eingesehen, dass gerade bei programmatischen Fragen viel Zeit für Diskussionen erforderlich ist. Serviceorientierung wird großgeschrieben. Was kann ich für die Universität tun, und das ist wichtiger als umgekehrt. Externe Kooperation gilt als genau so wichtig wie die interne. Was erbringen andere Fakultäten und Institute für uns, und was erbringen wir für sie? 3. Meine Universität der Zukunft hat ein markantes Profil. Das Profil hat sich immer stärker an den Besonderheiten der jeweiligen Region, den Stärken herausragender Wissenschaftler und den vorhandenen Ressourcen orientiert. Insofern haben die verschiedenen außeruniversitären Einrichtungen schon seit längerem eine wichtige Bedeutung erlangt. Aber auch die geografische Situation Potsdams als Verwaltungs- und Dienstleistungsmetropole und als Medienstandort, als Anziehungspunkt für Sport, Freizeit und Kultur haben dazu beigetragen, dass entsprechende Forschungs- und Lehrzusammenhänge entstanden sind, die auch international einen guten Ruf genießen. 4. Eine herausragende Grundlagenforschung hat in dem beschriebenen Kontext ebenso ihren Platz gefunden, wie eine gute anwendungsorientierte Forschung. Hier haben sich sowohl in als auch zwischen den Fächern unterschiedliche Schwerpunkte entwickelt. Als wichtig haben sich immer mehr Forschungsverbünde herausgestellt, die z.B. in gemeinsamen Doktorandenseminaren, Drittmittelprojekten, Graduiertenkollegs etc. zum Ausdruck kommen. War dies vor einigen Jahren in mehreren Fächern eher selten, hat sich hier in den letzten Jahren ein deutlicher Wandel ergeben. 5. Die Lehre hat einen stärkeren Stellenwert bekommen als früher. Sie ist didaktisch besser aufbereitet und wird durch moderne Medien in geeigneter Form unterstützt. Obwohl der Gebrauch moderner Informations- und Kommunikationstechnologien selbstverständlich geworden ist (Multimedia, Internet, E-Mails, On-line-Learning etc.), hat man mittlerweile auch die Grenzen dieser Techniken erkannt und eingesehen, dass „soft skills“ nicht nur in entsprechenden Lehrveranstaltungen, die aus dem Hochschuletat finanziert werden, vermittelt werden, sondern auch in Lehre, Forschergruppe und akademischer Selbstverwaltung wie selbstverständlich eingesetzt werden. Leider gibt es im Massenstudium nur begrenzte Möglichkeiten, aktivierende Lehr- und Lernmethoden umfassend zu praktizieren. Deshalb wurden die Studienberatung 4 5 intensiviert, die Auswahlmechanismen verstärkt und maßvolle Studiengebühren eingeführt. Die Zusammenarbeit zwischen Akademien, Fachhochschulen und Universitäten wurde auch hier intensiviert, um „die richtigen Studierenden“ an den „richtigen“ Platz zu bringen. In einigen Fächern haben sich Bachelor- und Master-Degrees durchgesetzt. Deshalb wurden viele Lehrpläne entrümpelt und umgestellt. Speziell in der Betriebswirtschaftslehre gibt es sowohl einen anwendungsorientierten Bachelor-Abschluß als auch einen Abschluß, der wegen der nachgewiesenen wissenschaftlichen Qualifikation den unmittelbaren Zugang zu entsprechenden Masterstudiengängen erlaubt. Masterstudiengänge werden sowohl für Bewerber mit mehrjähriger Berufspraxis angeboten als auch im Hinblick auf einen „Master of Science“, der inhaltlich an den in der Fakultät vorhandenen Forschungsschwerpunkten anknüpft. Werden ausreichend viele Credits erzielt, wird auch noch der altbewährte Begriff „Diplom-Kaufmann“ verliehen. Dies erfolgt häufig nach dem erfolgreichen Abschluß eines mehrwöchigen ManagementSeminars. Die Wirtschaft hat sich inzwischen an die neuen „Grade“ gewöhnt. Der Bachelor ist für sie fast zum Äquivalent einer etwas längeren, teilweise damit kombinierbaren Berufsausbildung geworden, nachdem das Abitur ohnehin immer weniger als Allgemeine Hochschulreife anzusehen ist. Und die „Master of Business Administration“ hatte ja schon immer ein recht gutes Image in der Praxis. Manche Programme finden auch abends statt und gute bis sehr gute Absolventen von Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien können nach entsprechender Erbringung der Voraussetzungen an der Universität mit dem anwendungsorientierten Bachelor abschließen und/oder sich um einen Studienplatz für den anwendungsorientierten Masterstudiengang bewerben. Jedenfalls gehört die klassische Unterscheidung zwischen „Volkswirt“ und „Betriebswirt“ der Vergangenheit an. Gerade die nationale und die internationale Verbindung bzw. Verflechtung zwischen Recht, Wirtschaft und gesellschaftlichen Institutionen wurde von allen Ökonomen aufgegriffen, um innovative Studienkonzepte und internationale Forschungsverbünde zu schaffen. Nach mehreren Jahren wurde es auch geschafft, die Juristen stärker in gemeinsame Studiengänge zu integrieren. Seit einigen Jahren ist die Nachwuchsförderung in der „Uni 2010“ als Schlüsselaufgabe anerkannt. Sie gilt für das gewerbliche, das kaufmännische und das technische ebenso wie für das wissenschaftliche Personal. Große Defizite sind in der Vergangenheit aufgearbeitet worden, wo sich viele in Wissenschaft und Verwaltung wie Autisten verhielten und glaubten, dass der Austausch von schriftlichen, tendenziell unverständlichen Texten den geduldigen Diskurs mit anderen ersetze. Damals war „Interdisziplinarität“ vielfach nicht mehr als ein modisches Feigenblatt, manchmal aber auch ein Beispiel für die exzellente Zusammenarbeit von wenigen. Inzwischen ist auch die Einsicht in „fremde, andere“ Wissenschaftskulturen gestiegen und auch der „einfache“ Mitarbeiter beklagt sich nicht mehr beim Personalrat über seinen arroganten Institutsdirektor. In meiner Universität der Zukunft sind auch mehrere neue Aufbaustudiengänge eingeführt worden. Abendstudium ist ebenso selbstverständlich wie Fernstudium. Der Wissens- und 5 6 Technologietransfer wird mittlerweile als selbstverständlich angesehen. Maßgeblich hat hierzu die Stiftungsprofessur für Existenzgründungsforschung beigetragen, wo die Stelleninhaberin eng mit den anderen Kollegen in den Regionalwissenschaften zusammenarbeitet. Ach, nun klingelt der Wecker! War es nur ein Traum? Hoffentlich nicht. 6