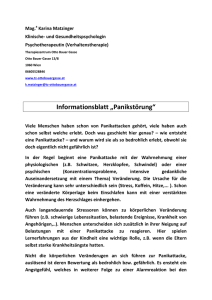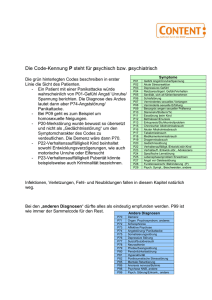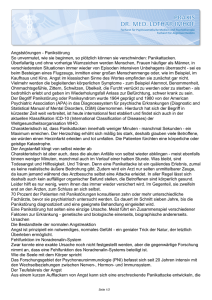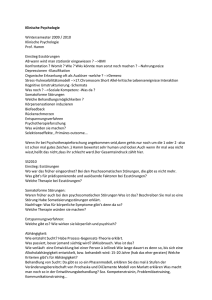Studiengang: Psychologie B.Sc. Studiensemester: 2. Fachsemester
Werbung

Studiengang: Psychologie B.Sc. Studiensemester: 2. Fachsemester Modul 3: Allgemeine Psychologie Seminar: Emotion, Motivation Semester: SoSe 2008 Gruppe: B VAK-Nummer: 11-58-2-M3-08 Name: Moritz Zimmermann Matrikelnummer: 2274130 E-Mail: [email protected] Seminarleiterin: Dr. Birgit Mathes Bremen, 11.07.2008 Abstract In dieser schriftlichen Ausarbeitung geht es um den Bereich der Emotionsforschung „Angst und Angststörungen“. Es wird auf die Definition kognitiver Angst, die Panikstörungen sowie auf das Phänomen Angstlust eingegangen. Angst unterteilt sich in „Zustandsangst“ und „Ängstlichkeit“, außerdem wird auf die Symptome, Bewältigungsmöglichkeiten und die Entstehung von Emotionen eingegangen. Bei einer Panikstörung treten Panikepisoden unterschiedlicher Dauer auf während denen eine enorme Angst vor einer für den Betroffenen nicht näher definierbaren Gefahr herrscht. Es werden sowohl Ursprung der Krankheit als auch Ablauf einer Panikattacke und vielfältige Therapiemöglichkeiten aufgeführt. Angstlust tritt unter anderem beim konsumieren von gewaltorientierten Filmen auf. Weshalb nun gerade ein Jugendliches Publikum sich dieser Art von Beschäftigung hingibt wird anhand Gesellschaftlicher und Historischer Belege aufgearbeitet und zudem der Verlauf, wie Angstlust erlebt wird, beschrieben. Angstlust scheint demnach ein Ersatz für die menschliche Neugier nach Gewalt und Alltagsfremden Inhalten zu sein, die über die Medien befriedigt wird. 1. Einleitung Angst ist ein sehr komplexes wie auch vielschichtiges Thema und außerdem die am meisten erforschte Emotion. Trotzdem ist das Thema Angst unglaublich weitläufig und längst nicht komplett erklärt, weswegen es im Folgenden auch nur um einige Teilaspekte geht. Zuerst soll der kognitive Teil der Angst beschäftigen, die Ursachen und Bewältigungsmöglichkeiten, um die darauf aufbauenden weiteren Aspekte der Angst besser zu verstehen, im Falle dieser Ausarbeitung die Panikstörungen und die Angstlust. Ist nun die normale Funktion von Angst gestört, nämlich eine Art Frühwarnsystem zu bilden und kommt es zu Panikattacken ohne erkennbare Gefahr so spricht man von einer Panikstörung. Diese ist nicht nur für die Betroffenen äußerst hinderlich, sondern mitunter auch für die Angehörigen und das restliche Umfeld eine Last. Formen der Therapie, Selbsthilfe wie auch Symptome und Folgen im Alltag werden ausführlich abgehandelt. Doch kann andererseits der Angst eine erregende und damit interessant machende Komponente nicht abgesprochen werden, weswegen es auch durchaus Menschen gibt die sich bewusst in gefährliche Situationen begeben oder sich über Filme in solche hineinversetzen und die Angst gezielt suchen. Angstlust ist ein relativ neues Phänomen, denn um Angstlust zu erleben, wurden erst in den letzten Jahrzehnten die geeigneten Voraussetzungen in Form von Filmen, Extremsport oder Jahrmarktsfahrgeschäften geschaffen. Es wird vor allem versucht aufzuklären, was die Faszination des Angsterlebens ausmacht, hierfür werden sowohl gesellschaftliche als auch historische Gründe herangezogen. Zudem ist der Ablauf des Erlebens sowie das, was nötig erscheint für das lustvolle Erleben von Angst näher zu beleuchten. 2. Angst Bevor näher auf die Emotion Angst eingegangen wird, sollte das Wort Angst definiert werden. Angst ist ein „affektiver Zustand des Organismus, der durch erhöhte Aktivität des autonomen Nervensystems sowie durch die Selbstwahrnehmung von Erregung, das Gefühl des Angespanntseins, ein Erlebnis des Bedrohtwerdens und verstärkte Besorgnis gekennzeichnet ist.“ (Krohne, 1996). Angst kann sowohl auf einer physischen Ebene erlebt werden, wo es zum subjektiven Empfinden der typischen Angstsymptome, wie zum Beispiel Schwitzen, Zittern, Herzklopfen oder einem flauen Gefühl im Magen kommt, dies wird allgemein als “Aufgeregtheit” bezeichnet. Unter “Besorgnis” versteht man jedoch eher psychische Angstsymptome wie auftretende Sorgegedanken, Misserfolgserwartungen und eine negative Selbstbewertung (Liebert & Morris, 1967). Um das Entstehen von Angst und ganz allgemein Emotionen aufzuklären, gibt es die von Lazarus (1966,1991) entwickelte kognitiv-transaktionale Theorie von Stress und Emotionen, welche besagt, dass verschiedene Emotionen dann entstehen, wenn über eine Einschätzung einer spezifischen Situation eine Entscheidung getroffen wird, wie zu reagieren ist. Hierbei werden zwei kognitive Einschätzungen komplett unbewusst und gleichzeitig vorgenommen, zum einen die Ereigniseinschätzung (primary appraisal) und zum anderen die Ressourceneinschätzung (secondary appraisal). Anschließend kommt es zum Verschieben der Situation in eine gewisse Kategorie, beispielsweise Herausforderung, Bedrohung, Schaden, Verlust oder Genuss. Je nach Kategorie wird im Folgenden eine andere Emotion ausgelöst, folglich resultiert aus der Kategorie “Bedrohung” die Emotion Angst (Lazarus, 1991; Schwarzer, 1993). Die Hauptfunktion von Angst ist das frühzeitige Entdecken von Bedrohungen, damit der Körper schnell genug reagieren und in Sicherheit gebracht werden kann. Wichtig ist außerdem die Unterscheidung zwischen Angst und Ängstlichkeit, die zwei unterschiedliche Zustände darstellen. Zum einen gibt es die “Angst als Zustand”, welche auch als “state anxiety” bezeichnet wird, sie stellt die emotionale Reaktion auf eine Situation dar. Die “Ängstlichkeit” (trait anxiety) hingegen bezeichnet die Eigenschaft einer Person, in verschiedenen Situation ängstlich zu reagieren. Diese beiden Konzepte wurden von Spielberger (1972) zum “Trait-State-Angstmodell” zusammengeführt. Das Modell besagt, dass Personen, die eine hohe Grundangst haben (Hochängstliche), demnach Situationen mit hoher Selbstwertbedrohung als viel bedrohlicher wahrnehmen als Personen, die eine eher niedrige Ängstlichkeit aufweisen (Niedrigängstliche). Hochängstliche erfahren deswegen einen größeren Anstieg der „state anxiety“ in bedrohlichen Situationen als Niedrigängstliche. Das Modell erlaubt, wenn es auch mittlerweile veraltet ist, Angst und Ängstlichkeit getrennt zu erheben. Evolutionstechnisch gesehen ist eine völlige Angstlosigkeit jedoch nicht vorteilhaft, auch wenn gesellschaftlich das Bild des furchtlosen starken Mannes bevorzugt wird, denn für das Überleben ist es meist sinnvoller zu fliehen, als sich einer zu großen Gefahr zu stellen (Eysenck, 1992). Die Art der Bedrohungen, von denen die Angst ausgeht, lässt sich, trotz theoretisch unendlicher Menge an Ängsten, in 2 Kategorien unterteilen. Auf der einen Seite gibt es die körperlichen Bedrohungen, bei denen es sich um konkrete Gefahren handelt, wie zum Beispiel Feuer, ein wildes Tier, oder einen anderen Menschen, der Bedrohung ausstrahlt. Die Selbstwertbedrohungen bilden die andere Seite, diese lassen sich zusätzlich in die Sozialangst und die Leistungsangst unterteilen. Sozialangst bezeichnet die Angst vor öffentlichen Auftritten oder ähnlichem, wohingegen die Leistungsangst die Furcht vor Prüfungen in verschiedenen Bereichen wie Sport, Mathematik oder auch Bewerbungsgesprächen darstellt (Buss, 1980). Will man Angst nun untersuchen, gibt es vier Möglichkeiten, Daten zu erheben, diese werden Angstindikatoren genannt. Bei der Verhaltensbeobachtung wird auf sichtbare Indizien wie verzerrte Mimik oder motorische Abwehrbewegungen geachtet und diese bewertet. Physiologische Messungen erfassen die klassischen Angstsymptome, unter anderem Schwitzen, Zittern, erhöhten Herzschlag und beschleunigte Atmung. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, die Probanden per Selbstbericht über einen Fragebogen nach dem momentanen Angstniveau und ihren Erfahrungen zu befragen. Diese Möglichkeit wird gemeinhin als die zuverlässigste angesehen, da zwar leicht falsche Angaben gemacht werden können, jedoch die Chance auf einen Fehler beim Beobachten von Gesichtsausdrücken und Messen von physiologischen Symptomen weit höher ist, weil jeder Mensch unterschiedlich stark ausgeprägte Mimik und Angstsymptome aufweist (Glanzmann, 1989). (Neuronale Korrelate). Um sich der Angst zu stellen und diese zu bewältigen, gibt es mehrere Methoden, eine davon stellt das mehrdimensionale Modell von Billings (1984) dar, die so genannt wird, weil es bei dieser Methode drei verschiedene Möglichkeiten der Angstbewältigung gibt, nämlich die bewertungszentrierte-, die problemzentrierte- und die emotionszentrierte Bewältigung. Jede dieser Möglichkeiten zeigt eine andere Herangehensweise, wie das Problem der Angst zu regulieren ist. Die bewertungszentrierte Bewältigung versucht, die Angstquelle durch eine logische Analyse und Neubewertung der Situation zu entschärfen. Als Beispiel sei zu nennen, dass ein anstehendes Bewerbungsgespräch anstatt als Bedrohung nun als eine Herausforderung angesehen wird, die es zu meistern gilt. Beim Prinzip der problemzentrierten Bewältigung wird durch Gegenarbeiten die Bedrohung beseitigt, man sichert sich nach Möglichkeit die Unterstützung anderer, bei dem Problem behilflich zu sein, und greift somit auf das soziale Netzwerk zurück, um die empfundene Gefahr zu vermindern. Beispielsweise werden vor einer Prüfungssituation Informationen gesammelt über den in der Vergangenheit abgefragten Stoff, um sich daraufhin gut vorzubereiten und schlussendlich die Bedrohlichkeit der Situation, die durch Unwissen über den abgefragten Stoff entstanden ist, zu senken. Zuletzt wird bei der emotionszentrierten Bewältigung versucht, die Angst durch tiefes Durchatmen und Entspannen des Körpers zu kontrollieren. 3. Panikstörungen Was bei Angst nun als sinnvoll angesehen werden kann, nämlich durch einen angespannten Körper und optimale Wachsamkeit einen erhöhten Selbstschutz zu gewährleisten, ist bei den Panikstörungen geschädigt. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, was Menschen, die von Panikstörungen betroffen sind, durchstehen müssen, wenn sie eine Panikattacke überfällt, ist es sinnvoll, eine Definition von Panik aufzustellen. Panik tritt dann ein, wenn in einer furchtauslösenden Situation die übliche Fluchtreaktion blockiert ist, beziehungsweise der Betroffene glaubt sie sei blockiert. Kommt es beispielsweise in einem Kino zum Ausbruch eines Feuers, passieren Dinge wie zum Beispiel, dass Leute einfach überrannt oder zu Tode getrampelt werden und Mütter ihre Kinder hilflos stehen lassen, nur um sich selbst zu retten, der Selbsterhaltungstrieb übertrifft in solcher Art von Paniksituationen alle anderen Gefühle und Gedanken. Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen normaler Panik und Panikattacken, um die es im Folgenden gehen soll; bei der Panik liegt eine reale lebensbedrohliche Gefahr vor, wohingegen bei Panikattacken die Gefahr nur eingebildet wird (Breton, 1986). Die erste Panikattacke tritt häufig im frühen Erwachsenenalter auf, wobei eine von 75 Personen überhaupt von Panikstörungen betroffen ist (Myers, 2005). Durch regelmäßiges Rauchen wird das Erkrankungsrisiko sogar um zwei- bis viermal höher als bei Nichtrauchern (Breslau & Klein, 1999; Goodwin & Hamilton 2002). Auslöser dieser ersten Panikattacke ist oftmals körperliches oder geistiges Unwohlsein zusammen mit Umweltfaktoren, die gemeinsam korrelieren und damit alles in Gang setzen; eine wirkliche Gefahr ist hingegen gar nicht vorhanden. Eine solche Panikattacke dauert meist mehrere Minuten, kann aber trotzdem variieren und länger oder kürzer erscheinen. Während der Episode herrscht beim Betroffenen eine intensive Angst, dass etwas Schlimmes passiert. Herzklopfen, Kurzatmigkeit, Erstickungsgefühl, Zittern und Übelkeit sind einige der Symptome, die auftreten können. Durch diese körperliche Beanspruchung kommt es in der Folge zu starker Erschöpfung und gipfelt, falls keine Rettung durch Flucht aus der Situation erfolgen kann, in Ohnmacht (Myers, 2005). Wie auch immer es ausgeht, die betroffene Person wird sich irgendwann wieder in einer ähnlichen Situation befinden wie zuvor und sich daran erinnern, was das letzte Mal passiert ist. Auf das Wiederaufrufen der Szene in Gedanken und Aufkommen der Angst reagiert auch der Körper mit Angstsymptomen. Die Symptome sind im Grunde vollkommen natürlich und haben nichts mit der Panikattacke zu tun, allerdings werden das Zittern, der erhöhte Puls, oder was der Betroffene sonst erlebt, falsch interpretiert; es wird vom Beginn einer neuen Panikattacke ausgegangen, wodurch sich ein Gefühl des Gefangenseins breit macht. Die Angst- wie auch die Paniksymptome werden immer stärker während der Betroffene sich mehr und mehr in seine Panik hineinsteigert. Wie bereits erwähnt, endet die Attacke mit Ohnmacht oder aber der Flucht und dem langsamen Abklingen der Symptome. Bei Panikstörungen suchen die Betroffenen zwar konkret benennbare Objekte als Auslöser ihrer Panik, zum Beispiel den Bus, in dem sie eine Panikattacke erlitten haben, das Objekt ist allerdings schuldlos, denn es handelt sich um die Angst vor der Angst und nicht vor dem Bus, also die Angst davor, im Bus eine Panikattacke zu erleiden (Breton, 1986). Ein bestimmtes Objekt als Grund der Angst wäre zudem ein Indiz für eine Phobie, es gibt jedoch auch Phobien, die sich nicht auf Objekte sondern auf Situationen beziehen, sie werden unspezifische Phobien genannt, da sie keinen greifbaren Bezug haben. Unspezifische Phobien treten relativ häufig in Kombination mit einer Panikstörung auf, zu nennen sind hierbei die Agoraphobie und die Soziale Phobie. Bei der Agoraphobie kommt es unter anderem zu einer Angst vor dem Alleinsein, dem Einkaufen, Anstehen in Schlangen, vor öffentlichen Auftritten, oder auch Busfahrten. Die Betroffenen entwickeln ein Vermeidungsverhalten, und da sich die Angst meistens nicht ausschließlich auf eine Situation beschränkt, kommt es teilweise zu einem regelrechten Einschließen der Personen in ihrem Haus. Die Kombination aus der Angst vor dem Auftreten einer Panikattacke an bestimmten Orten, beziehungsweise in einer bestimmten Situation und dass es keine, oder nur als peinlich empfundene Fluchtmöglichkeiten gibt, ist die Folge des Zusammenspiels von Agoraphobie und einer Panikstörung. Eine soziale Phobie beschreibt die Angst vor dem Umgang mit Fremden und auch Freunden, denn die Betroffenen halten sich für uninteressant und haben Angst, als wertlos, langweilig oder auf andere Weise des Kontaktes unwürdig abgetan zu werden, dies kann ebenso wie die Agoraphobie zu starkem Vermeidungsverhalten führen. Hinzu kommen sogenannte „helfende Mittel“ im Verlauf der Erkrankung, die jedoch nicht die Hilfe versprechen, die ihr Name vermuten lässt. Ein „helfendes Mittel“ ist meist ein Gegenstand zu dem sich der Betroffene einredet, er würde ihm im Falle von Panikattacke helfen. Für gewöhnlich sind es Dinge wie ein Schluck Alkohol oder Wasser, der einem einmalig geholfen hat und nun als ein Allheilmittel angesehen wird. Das geschieht so lange, bis das „helfende Mittel“ die Panikattacke einmal nicht mehr zu unterdrücken vermag. Ist dieser Punkt erreicht, wird der Zustand des Erkrankten meist noch schlimmer als er ohnehin schon ist, denn das vormals so zuverlässig die Panikattacke bekämpfende Mittel ist plötzlich nutzlos (Breton, 1986). Verständlicherweise gibt es für Menschen mit Panikstörungen, je nach Ausprägung, zum Teil immense, vor allem die Freiheit einschränkende Folgen. Die Betroffenen führen meist ein sehr zurückgezogenes Leben, um den für sie angstauslösenden Situationen zu entgehen. Dadurch gerät oft auch die Arbeitsstelle in Gefahr. Angestellte, die wegen ihrer Angst vor Panikstörungen auf dem Weg zur Arbeit diesen gar nicht erst antreten, verlieren schnell ihren Arbeitsplatz, falls sie keinen Grund für ihr Fehlen nennen können, was vielen wegen der fehlenden Diagnose "Panikstörung" nicht möglich ist. Die Lebensqualität sinkt aufgrund all dieser Umstände rapide ab und wenn dann auch das nähere Umfeld des Betroffenen beginnt, diesen zu meiden, verschlimmert sich dessen Zustand immer weiter (Breton, 1986). Freunde und Familie können sich aber ebenfalls als helfende Hand herausstellen, beispielsweise indem sie mit dem Erkrankten gemeinsam einkaufen gehen oder ihn zu anderen Orten begleiten, wenn das Besserung verspricht. Es sollte außerdem darauf geachtet werden, nicht zu voreilig mit Vorwürfen zu sein. Angebote zur Begleitung an angstauslösende Orte sollten gemacht werden, jedoch dabei der Betroffene keinesfalls gezwungen werden, diese aufzusuchen wenn er das nicht möchte. Die Lebensqualität zusätzlich steigern können selbst alltägliche Dinge wie ein gelegentliches Aussprechen von Lob oder Deutlichmachen, dass man den Betroffenen trotz allem gern hat (Breton, 1986). Interventionen des Umfelds reichen jedoch erfahrungsgemäß nicht aus, um die Panikstörungen erfolgreich zu behandeln, deshalb gibt es zum einen Ansätze zur Selbsthilfetherapie und zum anderen die psychotherapeutische Therapie. Die Selbsthilfetherapie ist zu aller erst einmal lediglich als Unterstützung der Psychotherapie zu sehen. Es handelt sich hierbei um Maßnahmen, mit denen sich die Angst entweder kontrollieren oder vorrübergehend vertreiben lässt. Ganz allgemein hilft es, wenn der Erkrankte sich ablenkt, zum Beispiel verliebt ist und die Liebe auch auf Gegenseitigkeit beruht. Die durch das Verliebtsein einsetzende Euphorie und Ablenkung helfen sehr dabei die Panikattacken in den Hintergrund zu drängen. Positives Denken ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der Besserung verschafft, denn der Gedanke, „Was wäre wenn ich jetzt in diesem Moment eine Panikattacke hätte?“, der die Angstspirale in Gang setzt, kommt durch die positiv gerichtete Einstellung gar nicht erst auf. Hinsichtlich dieses Gedankens ist es ohnehin wichtig, dass der Betroffene sein Denken beobachtet, um früh genug zu erkennen und sich gegebenfalls selbst klar zu machen, dass ein bestimmter Einfall unsinnig ist. Dadurch wird dem Betroffenen idealerweise auch klar, dass er selbst der Auslöser für die Panikattacken ist, nicht der Bus oder der Supermarkt; dies stellt einen weiteren wichtigen Schritt dar. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, sich anderweitig aktiv abzulenken. Kleine Gedankenspiele, zum Beispiel das Zählen von Gegenständen, der Versuch, hypothetische Fragen zu klären, wie „Ich frage mich was die Frau dort vorne in ihren Einkaufstüten mit sich trägt“, oder auch das aufmerksame Beobachten der Umgebung, helfen das Risiko einer Panikattacke zu mindern, denn ähnlich wie beim Verliebtsein werden weniger Gedanken an eine Panikattacke verschwendet. Abschließend gibt es zwei unterschiedliche Methoden des Rückzugs, den möglichen- und den tatsächlichen Rückzug, die als zusätzliche Hilfsmittel angesehen werden können. Der Betroffene sollte beim „möglichen Rückzug“ sich von vornherein überlegen, wie im Fall von ausbrechender Panik der Raum oder der Ort verlassen werden kann. Dies gibt zusätzliche Sicherheit im Umgang mit den für den Erkrankten schwierigen Situationen. Außerdem kann man sich kleine Ziele setzen, wie zum Beispiel noch zehn Minuten länger durchzuhalten, anstatt jetzt sofort den Ort zu verlassen. Merkt man, dass sich trotzdem eine Panikattacke anbahnt, sollte früh genug die Flucht ergriffen werden. Dadurch, dass schon im vornherein beim „möglichen Rückzug“ über Fluchtstrategien nachgedacht wurde, kann man nun beim „tatsächlichen Rückzug“ diese Strategien in die Tat umsetzen und den Gang zur Toilette oder ins Auto antreten. Wichtig ist hierbei nur, die Panikattacke früh genug zu erkennen, damit sich die Strategie auch in die Tat umsetzen lässt (Breton, 1986). Auch wenn es sich hierbei um Selbsthilfestrategien handelt, werden diese selbstverständlich meist nicht vom Erkrankten selbst erarbeitet, sondern von einem Therapeuten eingeführt. Es gibt daneben aber auch Therapiemöglichkeiten, die nur mit dem Therapeuten durchführbar sind, eine davon ist die Desensibilisierung. Unter Desensibilisierung versteht man das langsame Herantasten und Bekämpfen der Angst indem man sich, der angstauslösenden Situation bewusst aussetzt. Der Therapeut erstellt hierbei, zusammen mit dem Betroffenen, z. B. eine Liste der Orte, die als Auslöser für die Panikattacken gelten und sortiert sie nach dem Grad der Angst, die dort empfunden wird. Daraufhin wird diese Liste nach und nach abgearbeitet und die Orte aufgesucht. Vor jedem Betreten des Ortes wird jedoch die Methode der aktiven Muskelentspannung durchgeführt: Der Körper wird dabei praktisch von einem auf den anderen Moment, sobald man es möchte, entspannt. Hat man diese Methode erst einmal erlernt, erleichtert sie die Desensibilisierung ungemein. Stetiges Herantasten an die Situation und immer längere Konfrontation ermöglichen es nach und nach, sich einer solchen wieder ungefährdet von einer Panikattacke auszusetzen. Kritisiert wird an der Desensibilisierung allerdings, dass sie als sehr zeitaufwändig für Patient und Therapeut angesehen werden muss, denn es dauert länger, Orte zu besuchen als, wie bei spezifischen Phobien, ein Objekt an den Patienten heranzuführen. Außerdem ist die Rückfallrate relativ hoch, wahrscheinlich deshalb, weil viele Patienten den Therapeuten als ein „helfendes Mittel“ sehen könnten und nach der Therapie schnell wieder rückfällig werden und Panikattacken erleiden (Breton, 1986). 4. Angstlust Angst wurde von der Natur, wie bereits erwähnt, eigentlich als Schutzmechanismus vorgesehen, damit der Mensch schneller auf Gefahren reagieren und überleben kann, Panik ist die Folge wenn die Fluchtreaktion, die durch Angst ausgelöst wird, nicht ausgeführt werden kann. Warum nun setzt man sich freiwillig der Angst aus, indem Filme oder andere Medien konsumiert werden? Zuerst einmal gilt es, den gemeinen Horrorfilm näher zu bestimmen, um den es im Folgenden gehen soll. Als Horrorfilm gelten diejenigen Filme in denen eine Atmosphäre des Entsetzens und Grauens typisch ist (Meyers Lexikon). Populäre Horrorfiguren stellen Geister, Vampire oder Zombies dar, es gibt aber trotzdem eine Fülle von weiteren Kreaturen und auch der Mensch kann in einem Horrorfilm den Platz des Monsters einnehmen. Allerdings ermöglichen nicht nur Horrorfilme das Erleben von Angstlust sondern auch eine Fülle weiterer Genres, unter anderem der Psychothriller, Splatter-, Gangster-, Detektiv-, Actionund Science-Fictionfilme (Wierth-Heining, 2000). Solcherlei Filme haben auch oft einen Bezug zum aktuellen Weltgeschehen, beispielsweise war der Film „Jurassic Park“ von Stephen Spielberg in Zeiten der aufkeimenden Debatten über Genmanipulation sehr aktuell. Heutzutage dominieren Terroristen und Naturkatastrophen die Leinwand (Mayer). An jedes der Filmgenres wird außerdem mit einer gewissen Erwartung herangegangen. Hat man etwa Lust, sich einen Film anzusehen, in dem es eher spannend zugehen soll, anstatt dass der Horror durch übertriebene Gewalt dargestellt wird, schaut man sich wohl eher einen Psychothriller als einen Splatterfilm an (Wierth-Heining, 2000). Doch es interessiert vorerst nur das Horrorgenre, dieses rekrutiert seine Zuschauer zu einem großen Teil aus Jugendlichen, weswegen Erwachsene auf eine gewisse Weise ausgegrenzt werden; denn die meisten Erwachsenen lehnen das schockierende Geschehen ab (Rogge, 2000). Es werden oftmals Filmabende geplant bei denen mit einer Gruppe Gleichaltriger einer oder gleich mehrere Filme konsumiert werden. Man kann also von einem Gruppenereignis sprechen, welches die Bindung untereinander fördert (Mayer). Diese Filmabende sind außerdem eine Art von Mutprobe, denn die Jugendlichen sind häufig noch nicht volljährig und schauen sich trotzdem einen Film an, der erst ab 18 Jahren freigegeben ist, und auch explizite Gewaltdarstellungen wie verstümmelte Körper erträgt nicht jeder. Beim Horrorfilm schwingt dadurch die Faszination des Verbotenen mit (Mayer). Dies und die Tatsache, dass Horrorfilme nicht als gesellschaftsfähig angesehen gelten und man sich durch das Anschauen eines solchen gegensätzlich zur Allgemeinheit verhält, stellt einen Affront gegen die öffentliche Ordnung dar, unnötig zu erwähnen, dass Jugendliche solch ein Verhalten teils mit Freuden an den Tag legen (Mayer). Die Opfer in Horror- beziehungsweise Splatterfilmen werden gefoltert, verbrannt, zerfetzt, zerstückelt gefressen oder sonstwie von den Tätern getötet. Was macht nun die Anziehungskraft solcher Bilder aus? Um diese Frage zu beantworten macht es Sinn, einen Blick zurückzuwerfen in die menschliche Geschichte. Schon vor 2000 Jahren gab es Gladiatorenkämpfe, bei denen es um Leben und Tod ging, und diesem Schauspiel wohnten Tausende von Menschen bei, zudem gab es auch in späteren Jahren noch öffentliche Hinrichtungen, die ebenfalls ein Massenspektakel darstellten. Statt der Guillotine gibt es heutzutage Unfälle, die von Schaulustigen umringt sind, und schaltet man den Fernseher an, gibt es gerade in Kriegszeiten viele brutale Szenen ganz nah am Geschehen zu sehen, ohne dass sich irgendjemand daran stört. Man sieht also, selbst heutzutage kann anscheinend nicht ohne schreckliche Bilder ausgekommen werden, obwohl sich unsere Gesellschaft im Gegensatz zu früher doch um einiges weiterentwickelt hat. Diese Neugier am Schrecklichen wird von Stephen King als das „Lasst uns den Unfall genauer ansehen“-Syndrom bezeichnet. Er nennt einerseits das beruhigende Gefühl, dass es einen selbst bei diesem Unfall nicht erwischt hat und auf der anderen Seite erhält man „den Genuss der Ordnung in Anschauung der Möglichkeit des Chaos“, also die Erkenntnis was einem hätte passieren können. Es ist demnach nicht möglich, eine spezifische Generation oder ein bestimmtes Alter als besonders „gewaltverliebt“ hervorzutun. Das Verlangen danach scheint tief verwurzelt zu sein, denn es gibt diese Anziehungskraft schon lange, daher kommt mit Sicherheit auch die Affinität Horrofilmen gegenüber, denn sie bieten einen Ersatz für etwas, das man im Alltag nicht mehr erleben kann. Beim Konsumieren von Horrorfilmen gibt es unterschiedliche Gründe, warum zwar die Angst vorhanden ist, aber diese Angst gleichzeitig als lustvoll erlebt werden kann. Als erstes wäre zu nennen, dass ähnlich wie bei Gladiatorenkämpfen und ähnlichen zuvor genannten Ereignissen man sich nicht selbst am Geschehen beteiligt. Für den Zuschauer ist es also möglich, in einem ungefährlichen Rahmen etwas zu erleben und neue Erfahrungen zu machen und Emotionen zu erleben, ohne dass eine ernsthafte Bedrohlichkeit besteht (Mayer). Weiterhin kann man seine aggressive Seite ausleben oder sich Handlungen hingeben, die gesellschaftlich verpönt sind, ohne, wie im realen Leben, deshalb irgendwelche Konsequenzen fürchten oder Verantwortung übernehmen zu müssen (Mayer). Hinzu kommt, dass das, was dem Opfer im Film zustößt, theoretisch auch den Zuschauer treffen könnte, deswegen gibt es eine „als ob“ Situation bei der man sich ausmalt wie man selbst wohl in solcherlei Umgebung handeln würde, gleichzeitig bleibt man trotz dieses Hineinfühlens in den Charakter natürlich vollkommen unbehelligt und somit entspannt (Mayer). Tritt Schrecken in gemäßigter Form auf, ist dies oft mit einem anschließenden Hochgefühl verbunden, ähnlich wie nach einer Achterbahnfahrt (Heidtmann, 2003). Wie bereits angedeutet, ist das Geschehen auf der Leinwand für die meisten Menschen, trotz dem Versuch größtmöglicher realistischer Darstellung, noch als fiktiv auszuweisen. Dieses Wissen macht es auch für den Zuschauer einfacher, sich mit dem Opfer oder auch dem Täter zu identifizieren. Eine Verwechslung von Fiktion und Realität findet nur äußerst selten statt, zwar gehen aufgrund von Realitätsverlust durchgeführte Amokläufe durch alle Medien, aber verglichen mit der Gesamtanzahl an Film- beziehungsweise Computerspielkonsumenten ist die Zahl derer, die sich derart abweichend verhalten, extrem gering (Kepplinger & Tullius, 1995). Das Bewusstsein um Fiktion ist zudem enorm wichtig für eine lustvolle Auseinandersetzung mit dieser Art gewaltorientierter Beschäftigung. Bei einer zu distanzierten Haltung zum Geschehen kann meistens kein Spannungsmoment aufgebaut werden. Lässt man sich hingegen auf den Film ein und versucht, in die Geschichte einzutauchen, bezeichnet man dies als „involvierte Rezeption“. Filme die man involviert statt distanziert angeschaut hat, werden demzufolge im Nachhinein meist als besser empfunden als Filme die man von vornherein skeptisch angeht und ablehnt (Wierth-Heining, 2000). Die Spannung und der Schrecken werden gesteigert, wenn einer oder mehrere der Protagonisten im Film dem Zuschauer sehr sympathisch sind und man möchte, dass dieser Charakter den Film auch übersteht und nicht vorzeitig sein Ableben besiegelt ist (Wierth-Heining, 2000). Je glaubhafter sich die Opfer im Film fürchten und erschrecken, desto intensiver wird das Erlebnis auch für den Zuschauer. Filme mit schlechter schauspielerischer Leistung der Darsteller werden aus diesem Grund oft eher als lustig statt gruselig empfunden, trotz des Versuchs einen ernsthaften Film zu drehen (Heidtmann, 2003). Der Verlauf der Angstlust lässt sich gut in drei Phasen wiedergeben. Zuerst findet ein stetiger Erregungsaufbau statt, dies ist die erste Phase. Darauf folgend kommt es in der zweiten Phase dazu, dass der Zuschauer immer mehr in den Bann des Filmes gezogen wird. Zuletzt kommt der Film in einem oder mehreren Erregungsgipfeln, in der dritten Phase, zum Ende (Rogge, 2000). Ein abschließender Erregungsabbau ist laut Emotionsforschung unbedingt notwendig, da der Spannungsabbau nach einem intensiv erlebten Film als besonders angenehm empfunden wird (Rogge, 2000). Was dem Ganzen ein wenig entgegentritt ist die Tatsache, dass viele Horrorfilme heutzutage auf dem Prinzip der „Rettung in letzter“ Sekunde basieren, wodurch ein gemäßigter Spannungsabbau nicht gegeben ist. Ein Besprechen des Films unter Freunden ist im nachhinein deswegen so wichtig, weil es den Ersatz für den Erregungsabbau bildet (Rogge, 2000). Die Bestandteile, die nötig sind, Angstlust zu erleben, lassen sich ganz allgemein wie folgt zusammenfassen: Am Anfang muss der Zuschauer bereit sein, sich freiwillig der auf dem Bildschirm dargebotenen Gefahr auszusetzen, sonst kommt es zu der vormals angemerkten Distanzierung. Im Folgenden muss für den Zuschauer das Gefühl einer objektiven Gefahr vorhanden sein, zum Beispiel durch Identifikation mit dem Helden. Schließlich muss es das befriedigende Ende geben, entweder durch geregelten Spannungsabbau, Besiegen des Bösen oder auch durch das schlichte Überleben des Helden, der sich retten kann (Rogge, 2000). 5. Diskussion Aufgrund der unglaublichen Komplexität des Themas Angst, ist es schwer in einer so kurzen Ausarbeitung auf alle Aspekte einzugehen. Vernachlässigt wurden deshalb weitere Ansätze zur Angstentstehung, unter anderem die Reiz-Reaktion-Theorie und der psychoanalytische Ansatz von Freud. Die unterschiedlichen Theorien zeigen vor allem recht deutlich, dass man zwar Fortschritte gemacht hat, seit der Untersuchung von Angst als Emotion, jedoch zunächst noch zu keiner klaren Lösung gelangt ist. Bei einem gestörten Angstempfinden bei hochängstlichen Personen und auch bei Panikstörungen lassen sich zusätzlich zu einer Psychotherapie auch Neuroleptika einsetzen. Diese sind jedoch keinesfalls als komplett Angsteliminierend anzusehen, sondern setzen lediglich die Angstschwelle herab, gerade bei der Desensibilisierung kann dies aber enorm nützlich sein. Zwar wurde in der Ausarbeitung Angstlust als ein Phänomen dargestellt, welches durch gesellschaftliche Abgrenzung jugendlicher entsteht und auf die blutige menschliche Vergangenheit zurückzuführen ist, aber auch die hormonale Entwicklung der Jugendlichen scheint einen großen Einfluss auf die Faszination zu haben. Mayer geht davon aus, dass gerade pubertäre Allmachtsfantasien durch Charaktere im Film mit außergewöhnlichen Fertigkeiten angesprochen werden und auch die Ohnmacht des überall lauernden Bösen auf das Leben der Jugendlichen übertragen wird. Auch in der Darstellung von Sexualität und sozialem Zusammenleben erkennen sich Jugendliche wieder, da Horrorfilme dies meist unnatürlich oder überdreht visualisieren. Hartwig Hartwig (1986) bezeichnet die Filme als einen Spiegel der jugendlichen Innenwelt, was die große Faszination erklären würde. Interessant zu erfahren wäre schlussendlich noch wie sich das wiedereinführen von öffentlichen Hinrichtungen oder statt Fussball der Kampf auf Leben und Tod in den Stadien behaupten würde. Schließlich hat sich unsere Gesellschaft im Gegensatz zu früher doch um einiges weiterentwickelt, die Indizien für Lust an Gewaltdarstellungen sind aber nicht völlig abgeklungen, wie sich anhand der vielen Schaulustigen und dem hohen Interesse an Horrorfilmen beweisen lässt. Mit der Frage nach der Schädlichkeit von zu intensivem Gewaltmedienkonsum, die in letzter Zeit oft in den Medien aufgeworfen wurde, ließe sich allein eine ganze Arbeit füllen. Aufgrund der niedrigen Anzahl von Menschen die einen Realitätsverlust erleiden, wie bereits geschildert, scheint diese Annahme aber trotz aller Aktualität des Themas und immer neueren Studien die dies belegen und widerlegen aber unwahrscheinlich. 6. Fazit Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Angst vor allem eine Schutzfunktion einnimmt, die den Körper Handlungsbereit hält um auf Gefahren zu reagieren. Sollte das Angstempfinden geschädigt sein, spricht man von Angststörungen, die jedoch trotz des eigentlichen Vorteils, den Angst dem Körper verschafft, keinesfalls als vorteilhaft anzusehen sind. Panikstörungen sind eine Form der Angststörung bei der unerwartet intensive Angstgefühle in spezifischen Situationen auftreten und somit einen geregelten Alltag verhindern. Angstlust stellt das freiwillige Erleben von Angst auf einer genussvollen Ebene dar. Zwar halte ich den dargebotenen Ansatz, die Entwicklung Jugendlicher spiele ebenfalls in die von Horrorfilmen ausgehende Faszination mit hinein für äußerst spannend, aber um wirklich von einem belegbaren Grund zu sprechen ist mir die Theorie noch zu lückenhaft. Die von mir dargestellten Gründe für lustvolles Ansgterleben halte ich aber für durchweg nachvollziehbar. Zur weiteren Forschung stellt dieser Punkt aber einen Schritt in die richtige Richtung dar und sollte weiter verfolgt werden. Die Vorstellung von blutigen Wettkämpfen als völlig alltägliche Unterhaltung lässt mich schaudern, ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass so etwas sich etablieren würde, wenn auch meine Hoffnung auf die Vernunft größer ist. Von heute auf morgen würden solche einschneidenden Veränderungen aber sicher nicht akzeptiert werden. Abschließend sei zu sagen, dass ich der Behauptung Gewaltspiele sowie Filme führen zu Kontrollverlust und sind schädlich nur in sehr geringem Ausmaß zustimmen kann. Zwar bin ich nicht der Meinung, der Konsum führe zu einem drastischen Realitätsverlust, wohl aber kann ich dem ganzen nicht absprechen, dass man droht abzustumpfen. Das alleine ist natürlich absolut kein Grund Amok zu laufen sondern hat wohl eher andere, den Umfang sprengende, Gründe. In den nächsten Jahren wird zum Thema Angst bestimmt noch einiges klargestellt werden, aber ebenso neue Fragen aufgedeckt, es bleibt also auch in Zukunft ein spannendes und interessantes Thema. 7. Literaturverzeichnis Breton, S. (1989). Angst als Krankheit. Stuttgart: TRIAS – Thieme Hippokrates Enke. Myers, D.G. (2005). Psychologie (7. Aufl. , S. 726-732). Berlin: Springer. Otto, J.H., Euler, H.A. & Mandl, H. (2000). Emotionspsychologie (S. 189-198). Weinheim: PVU. http://www.igpp.de/german/eks/faszination.pdf http://www.hdm-stuttgart.de/ifak/ifak/pdfs/Gewalt.pdf http://www.mediaculture-online.de/fileadmin/bibliothek/wirth_heining_gewalt/wierthheining_gewalt.html http://www.sgbviii.de/S90.html