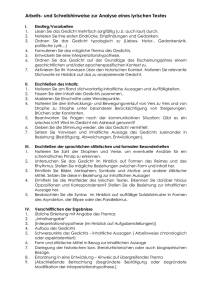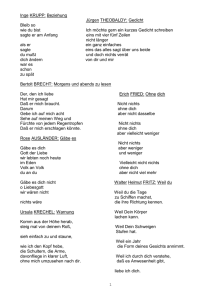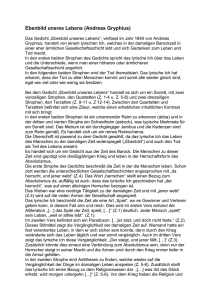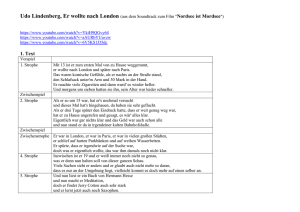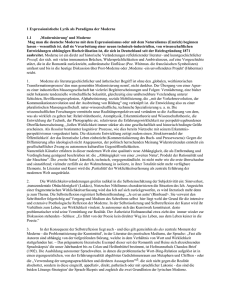Mutter Natur
Werbung
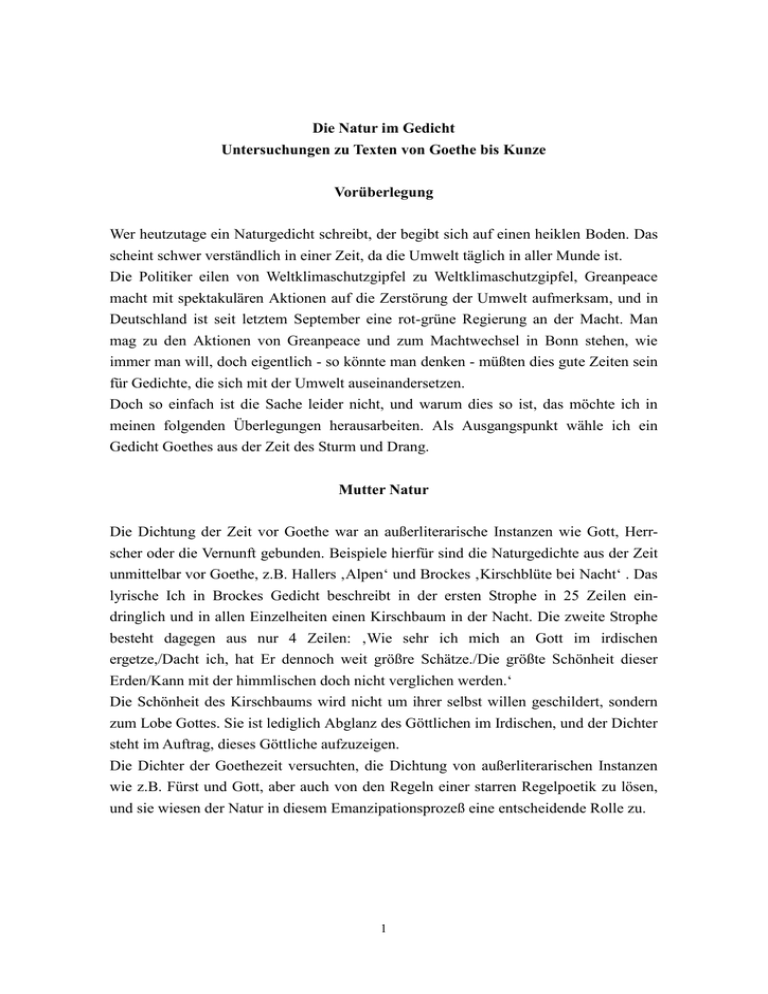
Die Natur im Gedicht Untersuchungen zu Texten von Goethe bis Kunze Vorüberlegung Wer heutzutage ein Naturgedicht schreibt, der begibt sich auf einen heiklen Boden. Das scheint schwer verständlich in einer Zeit, da die Umwelt täglich in aller Munde ist. Die Politiker eilen von Weltklimaschutzgipfel zu Weltklimaschutzgipfel, Greanpeace macht mit spektakulären Aktionen auf die Zerstörung der Umwelt aufmerksam, und in Deutschland ist seit letztem September eine rot-grüne Regierung an der Macht. Man mag zu den Aktionen von Greanpeace und zum Machtwechsel in Bonn stehen, wie immer man will, doch eigentlich - so könnte man denken - müßten dies gute Zeiten sein für Gedichte, die sich mit der Umwelt auseinandersetzen. Doch so einfach ist die Sache leider nicht, und warum dies so ist, das möchte ich in meinen folgenden Überlegungen herausarbeiten. Als Ausgangspunkt wähle ich ein Gedicht Goethes aus der Zeit des Sturm und Drang. Mutter Natur Die Dichtung der Zeit vor Goethe war an außerliterarische Instanzen wie Gott, Herrscher oder die Vernunft gebunden. Beispiele hierfür sind die Naturgedichte aus der Zeit unmittelbar vor Goethe, z.B. Hallers ‚Alpen‘ und Brockes ‚Kirschblüte bei Nacht‘ . Das lyrische Ich in Brockes Gedicht beschreibt in der ersten Strophe in 25 Zeilen eindringlich und in allen Einzelheiten einen Kirschbaum in der Nacht. Die zweite Strophe besteht dagegen aus nur 4 Zeilen: ‚Wie sehr ich mich an Gott im irdischen ergetze,/Dacht ich, hat Er dennoch weit größre Schätze./Die größte Schönheit dieser Erden/Kann mit der himmlischen doch nicht verglichen werden.‘ Die Schönheit des Kirschbaums wird nicht um ihrer selbst willen geschildert, sondern zum Lobe Gottes. Sie ist lediglich Abglanz des Göttlichen im Irdischen, und der Dichter steht im Auftrag, dieses Göttliche aufzuzeigen. Die Dichter der Goethezeit versuchten, die Dichtung von außerliterarischen Instanzen wie z.B. Fürst und Gott, aber auch von den Regeln einer starren Regelpoetik zu lösen, und sie wiesen der Natur in diesem Emanzipationsprozeß eine entscheidende Rolle zu. 1 J. W. von Goethe Auf dem See, 1. Fassung 1 Ich saug‘ an meiner Nabelschnur Nun Nahrung aus der Welt. Und herrlich rings ist die Natur, Die mich am Busen hält. 5 Die Welle wieget unsern Kahn Im Rudertakt hinauf, Und Berge wolkenangetan Entgegnen unserm Lauf. Aug mein Aug, was sinkst du nieder? 10 Goldne Träume, kommt ihr wieder? Weg, du Traum, so gold du bist, Hier auch Lieb und Leben ist. Auf der Welle blinken Tausend schwebende Sterne, 15 Liebe Nebel trinken Rings die türmende Ferne, Morgenwind umflügelt Die beschattete Bucht, Und im See bespiegelt 20 Sich die reifende Frucht. (Goethes Werke, Bd. 1, hrsg. von Erich Trunz, München 1981) Ich folge in meiner Interpretation der 1. Fassung des Gedichtes von 1775. Es besteht danach aus zwei Strophen, in einigen Handschriften ist es aber in drei Strophen überliefert. Die dritte Strophe beginnt nach diesen Handschriften mit den Zeilen ‚Auf der Welle blinken tausend schwebende Sterne‘ (13/14). Die erste Strophe des Gedichtes besteht aus drei Sätzen, wobei die ersten beiden Sätze durch ihre Reimwörter ‚Nabelschnur‘ – ‚Natur‘ und ‚Welt‘ – ‚hält‘ zu einer Einheit verbunden sind. Im ersten Satz ist das Ich Subjekt eines Aktivsatzes, es ‚saugt‘ Nahrung an seiner Nabelschnur aus der Welt. Im zweiten Satz ist die Natur aktives Subjekt, sie ‚hält‘ das Ich an ihrem Busen (4). Der erste Satz sieht das Ich in der pränatalen Phase, 2 der zweite schildert eine Situation nach der Geburt; die Mutter stillt ihren Säugling. In der pränatalen Phase ist das Kind in einer Innenwelt aufgehoben, am Busen ist es in der Außenwelt mit der Natur verbunden. In der zweiten Hälfte der Strophe fährt ein Kahn den See ‚hinauf‘ (6), und Berge ‚entgegnen‘ (8) dem Weg des Kahns - sie vollziehen damit eine Bewegung von oben nach unten. Das lyrische Ich als Insasse des Kahns ist in der 1. Strophe somit Teil von ‚Mutter Natur‘1 dadurch, daß die Bereiche Innen, Außen, Oben und Unten zu einer allumfassenden Einheit miteinander verschmolzen werden. Die zweite Strophe besteht aus zwei Fragesätzen und zwei Aussagesätzen. Durch einen Paarreim sind die beiden Fragesätze miteinander verbunden und zugleich mit dem ersten Aussagesatz zu einer binären Opposition verbunden, da der Aussagesatz aus zwei Verszeilen besteht, die ebenfalls mit Paareim enden. Die zweite Hälfte der Strophe besteht aus einem einzigen Satz, der nach der vierten Zeile durch ein Komma eine Zäsur enthält. Verstärkt wird diese Zäsur noch einmal dadurch, daß die ersten vier und die letzten vier Zeilen jeweils durch einen Kreuzreim miteinander verbunden sind. Die beiden Fragen sprengen die in der ersten Strophe geschilderte Einheit des Ich mit der Welt auf, denn dieses Ich sieht (‚Aug mein Auge‘, 9) und denkt ( Tag -‚Träume‘, 10). Die Einheit des Ich mit der Natur ist durch den Sündenfall des Bewußtseins zerstört worden: Es steht ihr als reflekierendes Subjekt gegenüber. Ein Weg, den paradiesischen Glückszustand wieder herzustellen, wäre, ins Wasser zu gehen und die Einheit mit der Natur im Tod zu suchen; das Wasser des Sees wird also als Äquivalent zum Fruchtwasser im Leib der Mutter angesehen. Pränatale Phase und Tod bilden nämlich gleichermaßen eine Einheit mit der Natur in Reflexionslosigkeit .2 Doch das Ich weist diesen Traum im folgenden Imperativsatz kategorisch ab: ,Weg du Traum, so gold du bist/ Hier auch Lieb und Leben ist‘ (11/12) – es gibt umfassende Existenz auch jenseits dieser Möglichkeit, doch der ursprüngliche Zustand der ersten Strophe ist im Leben unerreichbar. Die einzige Alternative ist, eine neue Einheit durch einen produktiven Akt zu erstellen. Und tatsächlich stellen die abschließenden acht Zeilen die Einheit der ersten Strophe wieder her, denn in den beiden folgenden Verszeilen (13/14) spiegeln sich die ‚Sterne‘ (oben) auf der ‚Welle‘ (unten). Nah und Fern gehen ineinander über, da Nebel Zum Begriff ‚Mutter Natur‘ vergl. G. Kaiser, `Geschichte der deutschen Lyrik vom jungen Goethe bis Heinrich Heine`, Hagen 1986, S. 24: ‚Viele Jahrhunderte christlicher Traditon haben die Natur als Schöpfung Gottvaters gesehen. Die Aufklärung deutet die Natur als Zeugnis der Weltvernunft. Bei Klopstock beginnt der Kult von ‚Mutter Natur‘. 2 Vergl. hierzu auch Goethes Ballade ‚Der Fischer‘ und C.F. Meyers Gedicht ‚Der schöne Tag‘ , in denen jeweils ein ‚Er‘ einer Nixe in den Wassertod folgt. Das ‚Ich‘ in G. Kellers ‚Winternacht‘ widersteht dieser Verlockung zwar, doch es kann das Antlitz der Nixe nie wieder vergessen. 1 3 die Ferne trinken, und die Außenwelt wird zur Innenwelt, da Morgenwind die Bucht ‚umflügelt‘. Abschließend spiegelt sich das Ich als ‚reifende Frucht‘(20) im See.3 Zwei entscheidende Unterschiede bestehen jedoch im Verhältnis zum Einheitszustand der ersten Strophe: Das lyrische Ich tritt nicht mehr als Person, sondern nur noch symbolisiert in Erscheinung, und die Anklänge an die Embryonalphase sind auch weggefallen. Der Einheitszustand der dritten Strophe kann folglich nur der Imagination des Ich entspringen. Es spiegelt sich, wie gesagt, im Symbol der ‚reifenden Frucht‘ im See und steht damit in Opposition zur ‚Leibesfrucht‘ (dem Embryo) der ersten Strophe. Das Gedicht Goethes beschreibt die Genese des lyrischen Ich. Natur und Ich sind in diesem Prozeß wechselseitig aufeinander angewiesen.4 Man könnte den Vorgang auch wie folgt beschreiben: Die Natur schafft das Ich, damit das Ich die Natur (in Form des Gedichtes ‚Auf dem See) wieder erschafft, und daher spiegeln sich die erste und die dritte Strophe (die letzten acht Zeilen), und aus dem gleichen Grunde spiegelt sich das symbolisierte Ich in der dritten Strophe in der Natur. Es handelt sich bei ‚Auf dem See‘ um ein stark autoreflexives Gedicht, das die Bedingungen der Möglichkeit seiner Entstehung reflektiert. Da das Ich aber eine Schöpfung der Natur ist und spiegelbildlich zur Natur schafft, ist es keiner außerpoetischen weltlichen Instanz und keiner geregelten Poetik mehr verpflichtet. Mußte das lyrische Ich in Goethes Hymne Prometheus einige Jahre zuvor diese Autonomie noch wortwörtlich proklamieren (Hier sitz‘ ich, forme Menschen nach meinem Bilde), so vollzieht das Ich in ‚Auf dem See‘ den Schöpfungsakt schlichtweg, ohne sich dabei noch um irgendeine Instanz außer seiner selbst zu stören. Natur und Geist sind gleichwertig schaffende Instanzen: Dies ist auch typisch für die gesamte Naturphilosophie der deutschen Romantik, die Natur und Geist nicht als einen Gegensatz zwischen einem erkennenden und handelnden Mensche einerseits und einer erkannten und behandelten Natur andererseits auffaßte. Die romantische Naturphilosophie faßte den bildenden Geist selbst als eine Art von Natur auf, und ebenso gestand sie der Natur zu, daß etwas Geistiges in ihr stecke. Ich komme zu einem abschließenden Resümee der Funktionen des Paradigmas Natur in der Zeit der Romantik.5 Zum ersten läßt sich festhalten, daß durch die FunktionaG. Kaiser, a.a.O, S. 80 sieht in der ‚reifenden Frucht‘ das lyrische Ich symbolisiert: ‚Die kleine Vorsilbe ‚b e spiegelt‘ macht die Spiegelungssymbolik als Reflexionssymbolik erkennbar. Früchte können sich im Wasser spiegeln, bespiegeln kann sich nur der Mensch.‘ Vergl. ferner den grundlegenden Aufsatz von Jaques Lacan ‚Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion‘ in: J. Lacan, `Schriften Bd. 1`, hrsg. von N. Haas, Frankfurt 1975. 4 Vergl. Bernhard Sorg, `Das lyrische Ich – Untersuchungen zu deutschen Gedichten von Gryphius bis Benn`, Tübingen 1985, S. 78 – 82. 5 Ich sehe wie die französische und die englische Literaturwissenschaft die Zeit vom Sturm und Drang bis zur Romantik als eine Einheit an. Deutsche Wissenschaftler wie G.Kaiser, a.a.O. und neuerdings 3 4 lisierung dieses Paradigmas die Genese des lyrischen Ich einen entscheidenden Anschub erhielt. Außerdem setzte die Funktionalisierung der Natur die Literatur einer Art Binnendifferenzierung aus, denn wer wie die Natur schuf, der durfte die Regelpoetiken von Aristoteles bis Gottsched getrost im Regal stehen lassen. Dem Para-digma Natur kam somit in ästhetischer Hinsicht progressive Funktion zu, und das läßt verstehen, warum Naturgedichte die Zeit des Sturm und Drang, der Klassik und der Romantik dominierten. Auch nicht unterschätzt werden darf der Aspekt, daß ein Dichten spiegelbildlich zur Natur der Literatur zumindest theoretisch die Autonomie von außerliterarischen Instanzen bescherte (Herrscher, Kirche). Andererseits deutet sich damit zugleich die Gefahr an, daß ‚Mutter Natur‘ in Zukunft als Fluchtraum aus der Gesellschaft funktionalisiert werden kann. Zudem stellte sich die Dominanz der Naturdichtung in dieser Epoche als Belastung für die Dichter der folgenden Generationen heraus. Im Abseits ‚Unser ist das Reich der Epigonen‘, beklagt sich Gottfried Keller im Jahre 1847 in einem Gedicht. Form und Kanon der klassisch-romantischen Lyrik waren so übermächtig, daß ihm Dichten nur noch in abgegriffenen Formen möglich schien. Aber nicht nur durch die innerästhetische Tradition waren dem Dichter neue Grenzen gezogen, hinzu kamen die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen des 19. Jahrhunderts, sowie das Aufkommen der Naturwissenschaften, welche die Natur im Gegensatz zur romantischen Naturphilosophie als Objekt der Erkenntnis ansahen und der Natur damit ihr Telos nahmen. Damit einhergehend kam es zu einer vorher nie gekannten Technisierung der Welt, die es fragwürdig machen mußte, weiterhin nur die schöne Natur als Medium zur Formung zu verwenden. Theodor Storm scheint im Gegensatz zu Gottfried Keller weniger von Zweifeln geplagt worden zu sein: „Sein Selbstbewußtsein als Lyriker war ungebrochen, das Medium Lyrik funktionierte ohne jede Verunsicherung durch die Zeit oder die eigene ästhetische Reflexion“.6 Dies scheint mir für den zweiten Teil seiner Aussage zu stimmen, inwieweit dies für den ersten Teil der Aussage nicht ganz stimmt, darüber soll uns die folgende Untersuchung eines Storm – Gedichtes Auskunft geben. G.Plum-pe in ‚Epochen moderner Literatur‘, Opladen 1995, sehen dies auch so. 6 In: ‚Geschichte der deutschen Lyrik vom Mittelalter bis zur Gegenwart, hrsg. von W. Hinderer, Stuttgart 5 Theodor Storm Abseits Es ist so still; die Heide liegt Ein halbverfallen niedrig Haus Im warmen Mittagssonnenstrahle Steht einsam hier und sonnbeschienen; Ein rosenroter Schimmer fliegt 15 Der Kätner lehnt zur Tür hinaus, Um ihre alten Gräbermale; Behaglich blinzelnd nach den Bienen; 5 Die Kräuter blühn; der Heideduft Sein Junge auf dem Stein davor Steigt in die blaue Sommerluft Schnitzt Pfeifen sich aus Kälberrohr. Laufkäfer hasten durchs Gesträuch Kaum zittert durch die Mittagsruh In ihren Panzerröckchen, 20 Ein Schlag der Dorfuhr, der entfernten; 10 Die Bienen hängen Zweig um Zweig Dem Alten fällt die Wimper zu, Sich an der Edelheide Glöckchen, Er träumt von seinen Honigernten Die Vögel schwirren aus dem Kraut - - Kein Klang der aufgeregten Zeit. Die Luft ist voller Lerchenlaut. Drang noch in diese Einsamkeit Storms Gedicht ‚Abseits‘ besticht, wie viele seiner Gedichte, durch eine einzigartige Stimmung. Doch wie baut der diese auf? Formalästhetisch gesehen durch die Verwendung bekannter Elemente: Das Metrum der vierhebigen Jamben mit wechselnd männlichen und weiblichen Endungen gehört seit der Romantik zu den traditionellen Mitteln der Lyrik(Stichwort `Volkslied`) - und auch ein Teil des semantischen Materials erinnert an die Romantik, so etwa die `blaue Sommerluft` in der ersten Strophe, die an Eichendorffs Zeile ‚Laue Luft kommt blau geflossen‘ erinnert , der `Lerchenlaut‘ am Ende der zweiten Strophe und auch das Motiv der ‚Einsamkeit‘ zu Ende der vierten Strophe. Fragen wir danach, worin sich das Gedicht Storms vom vorher behandelten Gedichts Goethes unterscheidet, so fällt uns auf, daß das lyrische Ich bei Storm nicht Bestandteil des Geschehens in der Natur ist. Jemand scheint die Szene von außen zu beschreiben, ohne an ihr beteiligt zu sein. Das gibt dem Geschilderten einen Anschein von Objektivität und Authentizität – die Landschaft wirkt wie gefilmt. Dennoch ist dies keine Beschreibung der Realität, es ist die Erstellung einer eigenen 1983, S.350. 6 Realität, denn ‚‘Realität‘ gibt es nicht, sie ist immer das Ergebnis einer Konstruktion, einer Perspektive.‘7 Das Gedicht lokalisiert in der ersten Strophe diese Landschaft präzise: Es handelt sich um die Heide. Es ist ‚still‘ hier – und folglich harmonisch. Die ‚alten Gräbermale‘ (4) deuten eine lange Verbindung von Natur und Kultur an. Die zweite Strophe fokussiert den Blick, er geht vom Ganzen der Landschaft in ihre Ausschnitte: ‚Laufkäfer‘, ‘Bienen‘ und ‘Vögel‘ - ‘Gesträuch‘, ‘Zweig‘, ‘Kraut‘ (7/9/11). Die dritte Strophe lenkt den Blick auf die Menschen in der Heide: ein einsames und halbverfallenes Haus, vor dem ein Junge und ein Mann sitzen. Beide sind Subjekte je eines Satzes, der sie mit den Bereichen Tier und Pflanzen verbindet: der Kätner schaut zufrieden nach den ‚Bienen‘(16), der Junge schnitzt Pfeifen aus ‚Kälberrohr‘(18)8 - der Behaglichkeit der Natur in den ersten beiden Strophen entspricht in vollkommener Äquivalenz der Gemütszustand der Menschen in ihr. Die vierte Strophe geht durch die die Subjekte ‚Ein Schlag der Dorfuhr‘(20) und ‚Kein Klang der aufgeregten Zeit‘ (23) von der räumlichen auf die zeitliche Perspektive über. Doch die Dorfuhr ist ‚entfernt‘ (20) und ihre Glockenschläge, die das unnachgiebige Voranschreiten der Zeit anzeigen, dringen kaum bis in diese Einsamkeit vor. Der letzte Satz des Gedichtes - durch einen Gedankenstrich betont - sagt, daß kein Klang der ‚aufgeregten Zeit‘ in diese Einsamkeit vordrang. Die Zeitlichkeit ist aus der Heide verbannt. Auch das regelmäßige, mit keinem Bruch versehene Metrum unterstreicht dies: Es gibt kein Voranschreiten der Zeit, sie kehrt vielmehr in gleichmäßigen Kreisen immer wieder an den Ausgangspunkt zurück. Es handelt sich somit um die typische ‚Eliminierung von Zeit, die den größten Teil der Stormschen Lyrik kennzeichnet‘.9 Doch gerade indem Storm die ‚aufgeregte Zeit‘ zitiert, gibt er zu erkennen, daß es außerhalb seines Realitätskonstruktes noch eine andere Welt gibt, die ihn beunruhigt, die er also bewußt ausspart. Es handelt sich um die Welt der Eisenbahnen, der Großstädte und um die Welt der politischen Wirren. Und genau ihr setzt Storm unter Verwendung der Realien der Heidelandschaft eine Welt der Stille und Zufriedenheit entgegen. Die Heide ist ihm Medium zur Erstellung einer Form, die gegen die ausgesparten Tendenzen protestiert. Daß dies tatsächlich intendiert ist, dies bezeugt ein Wort des Dichters Storm über ein anderes seiner Gedichte, das Oktoberlied, dessen Entstehung er folgendermaßen beschreibt: „Dem Sinn für die Natur, und zwar in natür- 7 G. Plumpe, a.a.O., S.107. Eine Pflanze aus der Gruppe der Kerbelgewächse. 9 J. Fohrmann in Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhunder bis zur Gegenwart, Bd. 6, hrsg. von Edward Mc Innes und Gerhard Plumpe, München 1996, S. 446. 8 7 lichster Opposition gegen die Politik ist auch das Oktoberlied entsprungen“.10 Natur als Opposition gegen die Politik, unterstützt durch Formen und Wortmaterial, das der Tradition der Romantik entstammt. Storm verstand dies tatsächlich als Protest, doch wenn man sich einmal vergegenwärtigt, welche Zeitereignisse sein Leben (1817 bis 1888) begleiteten, dann kommt das Ambivalente seiner Intention zu Tage. Als erstes muß man wohl darauf hinweisen, daß Storms Gedicht 1847 entstanden ist, also ein Jahr vor der deutschen Revolution. Zum zweiten läßt das friedliche Leben des Kätners und seines Sohnes vergessen, daß es der Landbevölkerung Deutschlands gerade in diesen Jahren keineswegs gut ging, im Gegenteil: „Auch nach 1818 blieb der Hunger zunächst eine ganz gewöhnliche Erscheinung. Mit Schrecken dachte man in Preußen an das Hungerjahr 1817 zurück, dem in den nächsten Jahrzehnten weitere folgten. Ganz schlimm wurde es dann wieder 1846/47, da genügten einige Kartoffelmißernten. In manchen Elendsgebieten, im Erzgebirge, in Oberschlesien bespielsweise, führte die Not zu schierer Verwzeiflung, zu Hungerrevolution, Aufständen, wie dem der Weber“.11 All diese Dinge erwähnt Storm nicht, die Realität seines Gedichtes liegt ‚abseits‘ von den unangenehmen Realitäten der Zeitgeschichte. Das Paradigma Natur, dem in der romantischen Zeit im Kampf um die Autonomie der Literatur zu großen Teilen emanzipatorische Funktion zugekommen war, wird eindeutig als Medium der Weltflucht funktionalisiert. Die Nutzung der alten wohlbekannten Formen der Romantik geben der Intention Storms eine zusätzliche Absicherung durch die Tradition – aber auch dies ist in letzter Konsequenz ja eine Flucht aus der Zeit. Es geht hier nicht darum, den wahrscheinlich bedeutendsten Lyriker des Realismus zu verunglimpfen, dem Thomas Mann bescheinigt, daß sich in seinen Gedichten ‚Perle an Perle‘ reiht - es geht um die Funktion des Paradigmas Natur in diesem Gedicht und um typische Tendenzen in der Zeit des Realismus. Man kann Storms Gedicht zwar auch als einen Protest gegen die Ateleologisierung der Natur durch die aufkommenden Naturwissenschaften werten, doch andererseits darf man den Rückzug aus den politischen Widrigkeiten der Zeit und den damit einhergehenden Verzicht auf politische Ideale und den Verzicht auf politisches Handeln nicht übersehen: ‚Nicht Hoffnung, sondern Beruhigung gilt als erstrebenswertes Ziel, und zwar nicht nur in den politischen Verhältnissen nach 1848, sondern auch in weiten Teilen der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts‘. 12 So kann man das Gedicht Storms auch lesen, denn die Natur steht hier – wie in der Folgezeit leider sehr oft - für einen Rückzug in die Innerlichkeit, kurzum: für den Gang ins ‚Abseits‘. 10 11 H. Vincon, `Theodor Storm in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbeck 1972, S. 42. M. Salewski, `Deutschland, eine politische Geschichte` München 1993, Bd. 2, S. 37. 8 Semantische Verdrängung Werner Bergengruen Die Heile Welt Wisse, wenn in Schmerzensstunden Ewig eine strenge Güte dir das Blut vom Herzen spritzt: wirket unverbrüchlich fort. Niemand kann die Welt verwunden, Ewig wechselt Frucht und Blüte nur die Schale wird geritzt. Vogelzug nach Süd und Nord Tief im innersten der Ringe Felsen wachsen, Ströme gleiten, ruht ihr Kern getrost und heil. und der Tau fällt unverletzt. Und mit jedem Schöpfungsdinge Und dir ist von Ewigkeiten hast du immer an ihr teil. Rast und Wanderbahn gesetzt Neue Wolken glühn im Fernen, neue Gipfel stehn gehäuft, Bis von nie erblickten Sternen dir die süße Labung träuft. (zitiert nach Conrady, S. 801) Werner Bergengruen, ein beliebter Lyriker und Erzähler der Nachkriegszeit, veröffentlichte 1950 sein Gedicht mit dem Titel ‚Heile Welt‘. Fünf Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges mit all seinen Greueln und dem Massenmord an Millionen von Menschen in Konzentrationslagern empfand Bergengruen keine Gewissensbisse, ein Gedicht zu veröffentlichen, in dem sich Blut, das ‚spritzt‘ (2) auf eine Wunde reimt, die ritzt (4). Ist schon die Verwendung solcher Reime geschmacklos, so kommt noch hinzu, daß Bergengruen seine Flucht aus der Gegenwart mit Hilfe der uns hinlänglich bekannten romantischen Elemente betreibt: vierhebige Jamben mit abwechselnd weiblichem und männlichem Versausgang, über Kreuz gereimt – die Volksliedstrophe. 12 P. Pütz, `Theorie des Realismus Bd. IV`, Fernstudienbrief der Fernuniversität Hagen, 1983, S. 20. 9 Zwei Weltkriege, das faschistische Regime in Deutschland, die Ermordung von Millionen von Menschen, all dies hat für Bergengruen keine Folgen, es gibt immer noch ‚Die heile Welt‘ - und die liegt in der Natur! Hier herrschen noch unverändert die alten Gesetze: ‚Ewig wechselt Frucht und Blüte‘ (11). Der Kreislauf der Natur ist gleich geblieben, und der Mensch ist in ihn eingebunden. Der Dichter empfindet das als Trost in schweren Zeiten, als eine ‚süße Labung‘ (20). Das Gedicht ist in vieler Hinsicht schlecht: In formalästhetischer Hinsicht ist es absolut epigonal, und in seiner moralischen Intention so fragwürdig, daß man es eigentlich gar nicht zitieren sollte, wenn es nicht ein typisches Beispiel für ein Naturgedicht nach dem Kriege wäre. Kein Wort davon, daß sich seit Ende des zweiten Weltkrieges auf den Tannenwald zwangsläufig die Konnotation Buchenwald einstellt, und dies ist der Name eines Konzentrationslagers bei Weimar. Eine perfekte semantische Verdrängung. Doch sollten, - so sah es Adorno - nach Auschwitz Gedichte in Deutschland für immer unmöglich geworden sein? Speziell für Naturgedichte schien dieser Satz zu gelten, denn Brecht hatte schon in seinem Gedicht ‚An die Nachgeborenen‘ aus dem Jahre 1939 gemahnt: ‚Was sind das für Zeiten, wo/ ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist/Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt‘. Und genau dieses Verschweigen war signifikant für viele Naturgedichte der fünfziger Jahre: Etliche Lyriker traten die Flucht in den scheinbar unveränderten Naturraum mit seinen ewig waltenden Gesetzen an. Es gab zwar auch andere Stimmen (Huchel, Eich, Bachmann etc.), doch es ist signifikant, daß ein Dichter wie Johannes Bobrowski, der viele gute Naturgedichte geschrieben hat, sich `dagegen gewehrt [hat], als Naturlyriker eingeordnet zu werden`.13 Er vermißte in der von ihm sogenannten ‚Dorfteichlyrik‘ vor allem die Verbindung mit dem Geschichtlichen. Ich möchte das Gedicht von Bergengruen keiner weiteren Untersuchung unterziehen, sondern ihm als interpretierende Antwort mit Bedacht ein (Natur-) Gedicht von Brecht aus den ‚Buckower Elegien‘ zur Seite stellen: In der Frühe Sind die Tannen kupfern So sah ich sie Vor einem halben Jahrhundert Vor zwei Weltkriegen St. Reichert, `Das verschneite Wort – Untersuchungen zur Lyrik Johannes Bobrowskis`, Bonn 1989, S.187. Vergl. zum gleichen Thema auch die vorwiegend negative Bewertung der Naturlyrik der fünziger 13 10 Mit jungen Augen. Für Bergengruen schien sich dagegen gar nichts verändert zu haben, er sah die Welt noch immer mit dem Auge der Romantik. Neue Naturgedichte Aus den bisherigen Erörterungen müßte deutlich geworden sein, warum es kein unverfängliches Unterfangen mehr ist, heutzutage in Deutschland ein Naturgedicht zu schreiben. Doch seit ca. Anfang der siebziger Jahre wird immer deutlicher, daß sich etwas grundlegend geändert hat im Verhältnis von Mensch und Natur, denn erstmals in der Menschheitsgeschichte wäre es rein theoretisch möglich, daß der Mensch die Natur in ihrer Gesamtheit zerstört – das hatte es bisher noch nie gegeben, auch wenn die Kehrseite der Medaille wohl ist, daß durch eine fortschreitende Zerstörung der Natur sich der Mensch der eigenen Lebensgrundlagen beraubt. Die Natur wird damit in unserer Zeit zum Politikum. Die neue Situation verlangt angemessene literarische Bewältigung, doch wie kann dies in Deutschland aussehen, da Naturlyrik oft unter dem belastenden Verdacht der Innerlichkeit, des Traditionalismus und der unpolitischen Weltflucht steht? Natürlich gab und gibt es genug Versuche, der neuen Situation angemessene Gedichte zu schreiben, ‘seit rund 1960 als nostalgisches Produkt des neuen Umweltschutzbewußtseins‘.14 Über die Qualität vieler moderner Naturgedichte darf man sicher geteilter Meinung sein, doch vor allem macht dieses Zitat aus dem weitverbreiteten Literaturlexikon von Gero von Wilpert eins noch einmal deutlich: Wer Naturgedichte schreibt, der wird von literarischen Öffentlichkeit mit Recht höchst kritisch unter die Lupe genommen. Daß es dennoch auch heute noch möglich ist, gute Naturgedichte zu schreiben, dafür scheinen mir die folgenden Gedichte von Erich Fried und Rainer Kunze Beispiele zu sein: Erich Fried Neue Naturdichtung Er weiß daß es eintönig wäre Jahre von H. Korte, ‘Geschichte der deutschen Lyrik seit 1945‘, Stuttgart 1989, S. 17-44. 14 Vergl. hierzu den Artikel ‚Naturlyrik‘ in Wilperts Lexikon in der 7. Auflage von 1989. 11 nur immer Gedichte zu machen über die Widersprüche dieser Gesellschaft und daß er lieber über die Tannen am Morgen 5 schreiben sollte Daher fällt ihm bald ein Gedicht ein über den nötigen Themenwechsel und über seinen Vorsatz von den Tannen am Morgen zu schreiben 10 Aber sogar wenn er wirklich früh genug aufsteht und sich hinausfahren läßt zu den Tannen am Morgen fällt ihm dann etwas ein zu ihrem Anblick und Duft? Oder ertappt er sich auf der Fahrt bei dem Einfall: wenn wir hinauskommen 15 sind sie vielleicht schon gefällt und liegen astlos auf dem zerklüfteten Sandgrund zwischen Sägemehl und Spänen und abgefallenen Nadeln weil irgendein Spekulant den Boden gekauft hat Das wäre zwar traurig 20 doch der Harzgeruch wäre dann stärker und das Morgenlicht auf den gelben gesägten Stümpfen wäre dann heller weil keine Baumkrone mehr der Sonne im Weg stünde. Das wäre ein neuer Eindruck 25 selbsterlebt und sicher mehr als genug für ein Gedicht das diese Gesellschaft anklagt (zitiert nach Conrady, S.955) ‚Neue Naturdichtung‘, so nennt Erich Fried sein im Jahr 1972 entstandenes Gedicht. Die Wahl des Titels macht bereits klar, daß sich Fried der Probleme der alten Naturdichtung sehr bewußt war. Sein Gedicht befaßt sich in den ersten Zeilen jedoch gar nicht mit der Natur, sondern reflektiert die Möglichkeiten gesellschaftspolitischer Gedichte. In den frühen siebziger Jahren setzte in Deutschland nach der Studentenrevolution von 1968 langsam eine gewisse Politikmüdigkeit ein. Es wäre ‚ein- 12 tönig‘ noch ein weiteres gesellschaftskritisches Gedicht zu schreiben - es gab ja schon so viele davon. Die erste Zeile signalisiert, daß wir kein romantisches Naturgedicht vor uns haben, sondern eins, das die Möglichkeiten der Poesie erkunden will. Es handelt sich also um ein poetologisches Gedicht ganz im Sinne des 116. Athenäums Fragments von Friedrich Schlegel.15 Ob dies von Fried bewußt so intendiert war, oder nicht, das spielt meines Erachtens keine Rolle; durchaus möglich ist es aber, da Fried sich auch im weiteren romantischer Elemente bedient. Der folgende Vorsatz‚lieber ein Gedicht über die ‚Tannen am Morgen‘ zu schreiben, ist eine Remiszens an das oben zitiert Gedicht von Bert Brecht16, das besagt, daß man die Tannen nicht mehr so sehen kann, wie man sie früher gesehen hat. Schon bei der Untersuchung von Goethes Gedicht ‚Auf dem See‘ hatten wir erkannt, daß der direkte Zugang zur Natur verwehrt wird, je mehr man über sie nachdenkt und sie somit zu seinem Objekt macht. In Frieds Gedicht Gedicht ist dieser Zugang dadurch verwehrt, daß sich mehr Gedanken an die Tradition der deutschen Lyrik einstellen als über die Natur. Scheinbar resigniert beschließt das ‚lyrische ER‘ (schon das ist ein Zeichen der Distanz), nun ein Gedicht über den ‚nötigen Themenwechsel‘ statt über die Natur selbst zu schreiben. Die zweite Strophe führt den Dichter endlich in die Natur, doch im Gegensatz zu den Romantikern, die sich die Natur erwandert haben, läßt er sich mit dem Auto dorthin fahren – die Zeiten haben sich halt geändert, und was früher mühevoll zu Fuß gemacht werden mußte, das läßt sich heute dank moderner Technik schnell, mühelos und ohne Blasen an den Füßen erreichen. Selbst in solch ironischen Durchbrechungen schlägt die Tradition gnadenlos auf den Dichter ein, denn die Ironie ist, wie das Motiv des Wanderns auch, ein genuin romantisches Mittel. Ob dieser Lage scheint die Möglichkeit, heute ein Naturgedicht zu schreiben, noch hoffnungsloser. Das Ich ertappt sich bei dem Gedanken, daß ihm nichts mehr einfallen könnte zu den Tannen und ‚ihrem Anblick und Duft‘ (12). Jeder spontane Zugang scheint durch die geballte Tradition der deutschen Naturlyrik verbaut, alles scheint von Goethe bis Brecht schon gesagt, gedacht und geschrieben worden zu sein. Etwas Neues gibt es jedoch, die zerstörte Natur. Fried beschreibt sie in der zweiten Hälfte der zweiten Strophe. Die Vernichtung der Natur ermöglicht ihm einen neuen ‚Eindruck‘(24), ‘der Harzgeruch wäre dann stärker‘(20) und das Morgenlicht ‚helDie romantische Poesie ‚will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen‘. Zitiert nach ‚Die deutsche Literarur – Ein Abriß in Text und Darstellung‘ , hrsg. von H.J. Schmidt, Bd. 8, S. 23. Frieds Gedicht ist im Sinne Schlegels ein kritisches Prosa-Naturgedicht. 16 W. Große, Interpretation von Erich Fried, `Neue Naturdichtung` in `Deutsche Gegenwartslyrik`, hrsg. von P. Bekes, Stuttgart 1982, S. 87 ff. 15 13 ler‘(22). Das ist schon nicht mehr ironisch, sondern sarkastisch: Mit dem neuen Eindruck geht folgerichtig ein neuer Ton einher. Und an diesem neuen Eindruck setzt Fried den produktiven Hebel an, indem er sagt, daß er ‚mehr als genug‘ sei, ‚für ein Gedicht/das diese Gesellschaft anklagt‘(26/27). Es ist dem Dichter unmöglich geworden, ein Naturgedicht zu schreiben, der direkte Zugang zur Natur ist unmöglich geworden - der Weg zu den Bäumen ist durch einen Wald von Büchern verstellt. Erst die totale Zerstörung der Natur eröffnet paradoxerweise neue Wege zum Naturgedicht, denn die Tatsache, daß die Umwelt zerstört wird, macht es heutzutage notwendig, ein engagiertes und gesellschaftkritisches Gedicht in Form einer ‚Neue(n) Naturdichtung‘ zu schreiben. Indem sich Fried dieser Aufgabe in Form des romantischen Reflexionsgedichtes stellt, ist ihm genau das gelungen. Er hat sich der Tradition der deutschen Naturlyrik gestellt und etwas Neues mit den Elementen des Alten geschaffen: Ein Naturgedicht in der Tradition der Romantik, ein Gedicht im Sinne Schlegels (weil Fried die Gattungen miteinander vermischt) und einen engagierten Text in der Tradition Brechts. Der Gehalt des Gedichtes geht damit weit über das Niveau vieler kitschiger Ökogedichte hinaus, auch wenn man ihm anmerkt, daß es im Zeitalter des Postismus entstanden ist. Rainer Kunze Sensible Wege Sensibel ist die erde über den quellen: kein Baum darf gefällt, keine Wurzel gerodet werden Die quellen könnten versiegen Wie viele bäume werden gefällt, wie viele wurzeln gerodet in uns (zitiert nach Conrady, S. 1061) 14 Auf den ersten Blick scheint dies ein recht einfaches Gedicht zu sein, aber der erste Schein trügt gründlich. Der Text besteht aus vier Strophen (eigentlich Abschnitten) , von denen die ersten beiden, einer rein syntagmatischen Lektüre zufolge, einen Vorgang in der Natur beschreiben: Die Bäume dürfen nicht gefällt werden, weil sonst die Quellen versiegen könnten. Die beiden folgenden Strophen sind dem Menschen gewidmet. Sie beklagen, daß viele Bäume ‚in uns‘ gefällt werden. Kunze scheint nach dieser ersten Lektüre den Tod der Natur - auf eine bis hierhin aber noch ungeklärte Weise - mit dem Schicksal des Menschen in Verbindung zu setzen. Eine Antwort auf die genaueren Zusammenhänge ergibt bereits die Untersuchung der Überschrift. Sie besteht aus dem Adjektiv ‚sensibel‘ und dem Substantiv ‚Wege‘. Die Verschränkung der beiden Worte ist ungewöhnlich, denn das Adjektiv sensibel entstammt einem anderen semantischen Bereich als das Substantiv Wege. Das Adjektiv stammt aus dem semantischen Feld, das die inneren Werte des Menschen beschreibt: Ein ‚sensibler‘ Mensch ist ein feinfühliger Mensch. Das Substantiv Wege bezieht sich dagegen auf einen nichtmenschlichen, äußeren und sinnlich wahrnehmbaren Gegenstand in der Realität, der normalerweise keine Gefühle haben kann. Außen und Innen, Menschlisches und Nichtmenschlisches sind also in der Überschrift zu einer Einheit verbunden, und so ist es im ganzen Gedicht. Die ersten beiden Strophen stehen nicht in einem Kontrast zu den beiden letzten, der die Verhältnisse in der Natur mit den Befindlichkeiten des Menschen vergleicht. Es wäre ein Fehler, das Gedicht lediglich als Syntagma, als Nacheinander seiner Teile zu lesen. Ein bekannter Satz Roman Jakobsons besagt, daß die poetische Rede die paradigmatische Achse auf die syntagmatische projeziert: Das Gedicht ist auch parallel strukturiert, alle Teile sind paradigmatisch aufeinander bezogen, und grundsätzlich alle Elemente stehen miteinander in Verbindung. Lesen wir das Gedicht daher noch einmal - und zwar diesmal über kreuz - die erste und die dritte Strophe und die zweite und die vierte Strophe parallel, so ergibt sich folgende Lesart: Kein Baum darf gefällt werden (1.Strophe), aber viele Bäume werden gefällt (3.Strophe). Und nun die 2. und die 4. Strophe zusammen: ‚Die Quellen könnten versiegen‘ –‚in uns‘. Der Tod des vermeintlich Äußeren wäre somit untrennbar mit dem Versiegen der Quellen in uns v e r s c h r ä n k t. Die zweite Strophe, die nach der ersten syntagmatischen Lektüre einen Vorgang in der äußeren Natur beschrieb, bezieht sich jetzt auf das Innere des Menschen (und zugleich auf den Vorgang in der Natur). Noch einmal unterstrichen wird die Bedeutung dieses Vorgangs dadurch, daß die Zeilen ‚die quellen könnten versiegen‘ die Mittelachse des Gedichtes bilden. Und innerhalb 15 dieser Mittelachse wiederum steht das Wort ‚quellen‘ genau in der Mitte. Die Quellen bilden somit sowohl den Mittelpunkt des Gedichtes, als auch den Kreuzpunkt zwischen der Natur und dem Menschen: Wenn die Bäume gefällt werden, so versiegen die Quellen in der Natur und gleichzeitig die Quellen in uns. Natur und Mensch stehen nicht in lockerer Assoziation. Sie stehen auch nicht nur nebeneinander, sondern sie sind in einem unlösbaren Wechselverhältnis miteinander verbunden. Die Natur ist damit ihrer scheinbaren Objekthaftigkeit enthoben, sie ist gleichrangiges Subjekt, und man mag sich wohl zurecht an Goethe erinnert fühlen. Nun könnte man einwenden, daß dies eine weltfremde Wiederherstellung der Naturphilosophie der Goethezeit sei, doch große Teile der heutigen Naturwissenschaften sieht die Natur im Gegensatz zur klassischen Naturwissenschaft keineswegs mehr als Objekt an, der Natur wird hier wieder ein - wenn auch von der Metaphysik der Goethezeit befreiter - Subjektcharakter zugesprochen.17 Doch zurück zu dem Gedicht von Rainer Kunze, es fehlt nämlich noch eine letzte entscheidende Konnotation zum Wort Quelle. Schon seit der Antike gilt die Quelle (‚Castalischer Quell‘) als Ursprung der Dichtung. Von hier läßt sich eine Linie ziehen über Goethe (z.B. ‚Wandrers Sturmlied‘) bis hin zu dem Gedicht von Rainer Kunze, das wir nun im Ganzen zu überblicken vermögen. Wenn wir die Natur zerstören, das scheinbar Äußere also, zerstören wir nicht ein Objekt, sondern zugleich einen Teil unseres eigenen Inneren – und nehmen damit der Dichtung den Boden. Es mag, wie Gero von Wilpert meint, tatsächlich ein großer Teil der heutigen Naturgedichte ‚sentimentale Ökolyrik‘ sein, über deren Qualität man triftig streiten kann. Doch Rainer Kunze hält diesem Vorwurf ein unwiderlegbares Argument entgegen – ohne die Natur gäbe es keine Gedichte mehr! Und deshalb ist es auch heute noch notwendig, Gedichte über die Natur zu schreiben, man sollte nur ‚Sensible Wege‘ dafür finden. Vergl. hierzu die Artikel ‚Natur‘ und ‚Naturphilosophie‘ in den Lexika ‚Historisches Wörterbuch der Philosophie‘, hrsg. von J. Ritter und K. Gründer und ‚Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, hrsg. von J. Mittelstraß, sowie die einschlägigen Schriften des Kreises um F. v. Weizsäcker, z.B. ‚Die Geschichte der Natur‘, 1954 und ‚Die Einheit der Natur‘, 1971. 17 16