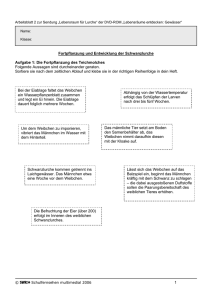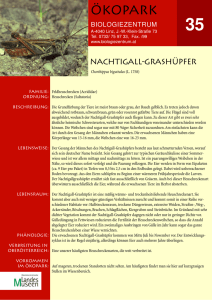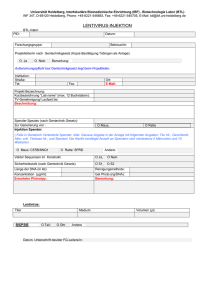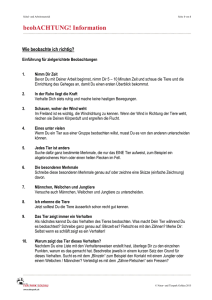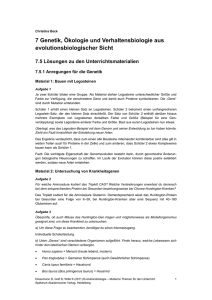Document
Werbung

1. Er untersuchte eine als klassische Konditionierung bezeichnete Form des assoziativen Lernens. 2. Habituation ist eine sehr einfache Form von Lernen: Das Abgewöhnen angeborener Reaktionen auf Reize, die nur wenig oder gar keine Information vermitteln. Beispiel: Der Süsswasserpolyp Hydra zieht sich zusammen, wenn er durch eine leichte Berührung gestört wird. Er hört jedoch auf, sich bei Störung zu kontrahieren, wenn diese zu oft erfolgt. 3. Der Tanz bei Honigbienen dient der Kommunikation. Der Rundtanz zeigt, dass sich in der Nähe eine Nahrungsquelle befindet, enthält aber wohl keine Genauigkeit über Richtung und Entfernung. Durch an ihrem Körper haftenden Blütenduft übermittelt die Tänzerin jedoch eine Information über die Blütenart. Der Schwänzeltanz wird ausgeführt, wenn sich die Nahrungsquelle in grösserer Entfernung befindet; enthält sowohl Informationen über die Richtung, die Entfernung und die Blütenart. 4. Rivalkämpfe zwischen Männchen enden selten tödlich, da die Gegner selten ihre Kräfte messen, sondern sich häufig nur auf Drohverhalten beschränken. Drohhaltung und Mimik lassen sich grösser und gefährlicher aussehen, oft werden ausserdem Drohlaute produziert. Schliesslich stellt einer der Gegner das Drohen ein und geht zu Demuts- oder Beschwichtigungsverhalten über, was einer Niederlage gleichkommt. Das Beschwichtigungsverhalten hemmt die Aggression des Gegners. Ein grosser Teil dieses Verhaltens ist ritualisiert, das heisst, es besteht aus symbolischen Handlungen, so dass die Gegner keine ernsthaften Verletzungen davontragen. Das Ausmass der Ritualisierung hängt von der Knappheit und der zukünftigen Verfügbarkeit der Ressource ab. Bei Arten, bei denen sich die Gegner Verletzungen zufügen, fördert die natürliche Auslese eine starke Tendenz, die Auseinandersetzung zu beenden, so bald der Sieger feststeht, denn bei einer Fortsetzung des Kampfes könnte er ebenfalls verletzt werden. 5. 1. Art: Transport von dünnen, langen Streifen im Schnabel 2. Art: Transport von kürzeren und mehreren Streifen durch Einstecken im Bürzelgefeder Kreuzung: Intermediäres Nestbauverhalten; mittlere Streifenlänge. Meist unternahmen sie einige Versuche, die Streifen in ihr Bürzelgefeder zu stecken, doch mitunter liessen sie diese nicht los, nachdem sie den Kopf nach hinten gewandt und ein Stückchen ins Gefieder geschoben hatten. In anderen Fällen wurden die Streifen nicht richtig gehandhabt, bzw. nicht richtig festgesteckt oder sie wurden einfach fallengelassen. Das Ergebnis war ein fast völliger Misserfolg des Versuchs, die Streifen auf diese Weise zu transportieren. Schliesslich lernten die Vögel, sie im Schnabel zu tragen. Auch dann machten sie aber vorher zu mindest andeutungsweise Einsteckversuche. Auch nach mehreren Jahren wandten die Vögel noch den Kopf nach hinten, bevor sie mit einem Streifen wegflogen. Wie diese Beobachtungen zeigen, basieren die phänotypischen Unterschiede im Verhalten der beiden Arten auf unterschiedliche Genotypen. Ausserdem kann angeborenes Verhalten durch Erfahrung modifiziert werden: Die Hybriden Individuen lernten schliesslich, die Streifen zu transportieren. 6. Ja, sollten sie. Beispiel: Männliche graue Ziesel bringen einander im Kampf um Weibchen oft ernsthafte, mitunter tödliche Verletzungen bei. Die Weibchen dieser Ziesel sind nur einige Stunden im Jahr empfängnisbereit und dem Werben der Männchen zugänglich. Aus diesem Grund hängt unter Umständen die gesamte reproduktive Fitness eines Männchens davon ab, ob es sich an diesem einen Tag gegen andere Männchen behaupten kann. 7. Ein Verhalten, das die Fitness eines Individuums verringert, dabei aber diejenige eines anderen Individuums erhöht. Beispiel: Warnruf beim Ziesel zieht die Aufmerksamkeit des Jägers auf sich. Schlussendlich hilft dieses Verhalten trotzdem, seine eigenen Gene an die nächste Generation weiterzugeben. Gesamtfitness ist das Entscheidende (=bezeichnet den Gesamteffekt, den ein Individuum auf die Vermehrung seiner eigenen Gene erzielt, indem es eigene Nachkommen produziert und indem es dazu beiträgt, dass andere nahe Verwandte ihre Nachkommenzahl steigern können). Rb>c R: Verwandtschaftskoeffizient b: Nutzen für den Begünstigten C: Kosten für den Altruisten 8. Altruistisches Verhalten unter Verwandten soll den Fortpflanzungserfolg von Verwandten erhöhen. Je näher die Individuen einander verwandt sind, desto ähnlicher sind ihre Gene Vorteil für Altruist, da die Nachkommen des nahen Verwandten mit grosser Wahrscheinlichkeit auch Gene des Altruisten besitzen: Gesamtfitness ist das, was zählt. 9. Der Elternaufwand (Zeit und Ressourcen, die ein Individuum aufbringen muss, um Nachkommen zu produzieren und aufzuziehen) ist bei einem Weibchen meist grösser. Eier sind in der Regel sehr viel grösser als Spermien und energetisch aufwändiger zu produzieren. Die Mütter investieren sehr viel Zeit und Ressourcen in das Austragen der Jungen und deren Ernährung vor der Geburt. Bei den meisten Arten bedeutet die verhältnismässig geringere Investition eines Männchens pro Nachkommen im Vergleich zu der eines Weibchens, dass das Männchen seinen Fortpflanzungserfolg maximieren kann, indem es die Eier vieler Weibchen befruchtet (Fortpflanzungserfolg proportional zu Anzahl Partnerinnen Erklärt Konkurrenzverhalten zwischen Männchen). Im Gegensatz dazu, hängt der Fortpflanzungserfolg vom Weibchen weniger von der Anzahl der Partner ab, als viel mehr von der Lebensfähigkeit der begrenzten Zahl von Nachkommen, die es produzieren kann Weibchen sind wählerisch bei Partnersuche, gesunde Partner bedeuten die besten Möglichkeiten, gesunde Nachkommen hervorzubringen. 10. Müllersche Mimikry 11. Die Menschen; bestimmte Verhaltensmerkmale existieren, weil sie Ausdruck von Genen sind. Die Umwelt greift aber in den Weg vom Genotyp zum Phänotyp der körperlichen Eigenschaft ein und noch stärker gilt dies für Verhaltensmerkmale. Darüber hinaus ist das menschliche Verhalten aufgrund unserer Lernfähigkeit und Wandelbarkeit vermutlich formbarer als das jeder anderen Spezies. Im Laufe unserer jüngsten Evolutionsgeschichte haben wir strukturierte Gesellschaften mit Regierungen, Gesetzen, kulturellen Werten und Religionen aufgebaut, die definieren, was akzeptables Verhalten ist und was nicht, selbst wenn inakzeptables Verhalten unter Umständen die Darwinfitness eines Individuums steigert. 12. Tarnung (Mimese) durch sie verschmilzt die Beute optisch mit dem Hintergrund 13. Batesschen Mimikry eine harmlose Art ahmt ein ungenießbares oder wehrhaftes Modell nach 14. operante Konditionierung „ Lernen durch Versuch und Irrtum“ Eine Ratte oder ein anderes Tier, das man in eine Skinner –Box sperrt, findet und betätigt - in der Regel durch Zufall- einen Hebel in der Box und wird durch eine Futtergabe belohnt. Das Tier lernt schnell, die Betätigung des Hebels mit der Futtergabe zu assoziieren 15. Lernen durch Einsicht kann die Situation ohne Herumprobieren erfassen und die Kisten aufeinanderstapeln, wodurch der Schimpanse die Banane erreicht 16. Ein Phänomen der Gesamtfitness, das altruistisches Verhalten zwischen verwandten Individuen erklärt; auch Familien- oder Sippenselektion genannt 17. Der Verwandtschaftskoeffizient bei Hymenopteren ist grösser als bei Säugetieren. ¾ : ½ siehe Folien 18. bei Schimpansen: r = ½ * ½ + ½ * ½ = 0.5 bei Bienen: r = ½ * ½ +1 * ½ = 0.75 20. angeborenes Verhalten ein Verhalten, dass in der Entwicklung fixiert ist; alle Individuen zeigen praktisch das gleiche Verhalten, trotz unvermeidlicher Unterschiede der internen Umwelt( in ihrem Körper) & der externen Umwelt während der Entwicklung und der gesamten Lebensdauer. Erbkoordinationen werden durch externe Sinnesreize ausgelöst, sog. Schlüsselreize oder Auslöser. Oder operante Konditionierung? 21. Von G. spricht man, wenn zwischen den Geschlechtern einer Art deutliche Unterschiede bestehen, z. B. in bestimmten körperlichen Merkmalen und/oder im Verhalten. Der Sexualdimorphismus ist ein Produkt der natürlichen Selektion. Die Weibchen investieren mehr Zeit und Ressourcen in die Aufzucht der Jungen. Ihr Fortpflanzungserfolg hängt von der Lebensfähigkeit der begrenzten Anzahl von Nachkommen ab. Sie sind deshalb sehr wählerisch bei der Partnerauswahl. Männchen hingegen investieren viel weniger in die Nachkommen, ihr Fortpflanzungserfolg ist proportional zu seiner Anzahl Partnerinnen. So hat in einigen Fällen die Konkurrenz unter den Männchen wahrscheinlich zur Evolution von agonistischen Verhaltensweisen und auch zu sekundären Geschlechtsmerkmalen wie Geweihe bei männlichen Hirschen geführt. Das auffällige Balzverhalten von Pfauenhähnen und anderen männlichen Vögeln während der Paarungssaison hat sich wahrscheinlich weniger wegen der direkten Konkurrenz zwischen den Männchen entwickelt, als vielmehr wegen den wählerischen Weibchen und soll eine robuste Gesundheit aufzeigen. 22. Damit die natürliche Selektion ein altruistisches Verhalten begünstigt, muss der Nutzen für den Begünstigten (B) multipliziert mit dem Verwandtschaftskoeffizienten (r) größer sein als die Kosten (C) für den Altruisten. rB> C (Hamilton-Regel) 23. Bei geringer Beutedichte geht er nicht selektiv vor und frisst jeden Wasserfloh, den er fangen kann. Bei höherer Beutedichte lässt sich das Verhältnis von Energiegewinnung: Energieaufwand durch Konzentration auf grössere Beutetiere maximieren. 24. Viele Aspekte des Sozialverhaltnes haben eine evolutionäre Grundlage, also Ausdruck von Genen, die durch die natürliche Auslese erhalten blieben. 25. Viele Aspekte des Sozialverhaltnes haben eine evolutionäre Grundlage, also Ausdruck von Genen, die durch die natürliche Auslese erhalten blieben. Das genetische Potenzial mag dem Spektrum des menschlichen Verhaltens Grenzen setzten, aber man kann auch nicht behaupten, dass menschliches Verhalten starr von Genen gesteuert ist. Unser Nervensystem ist nicht „ fest verdrahtet“, auch wenn wir unseren Genotyp nicht ändern können. Die Umwelt greift in den Weg vom Genotypen zum Phänotypen ein, noch stärker gilt dies für Verhaltensmerkmale. Darüber hinaus ist das menschliche Verhalten aufgrund unsere Lernfähigkeit und Wandelbarkeit vermutlich formbarer als das jeder Spezies. Wir haben eine Moral entwickelt, die definiert, was akzeptables Verhalten ist und was nicht, selbst wenn inakzeptables Verhalten unter Umständen die Darwin-Fitness eines Individuums steigert. 26. Dieses Verhalten lässt sich durch die Steigerung der Gesamtfitness infolge vonVerwandtenselektion erklären; Murmeltiere verhalten sich nur so, wenn die Formel rb>c erfüllt ist. Dadurch, dass sie ihren Eltern bei der Aufzucht weiterer Nachkommen helfen, steigern sie auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihre eigenen Gene weitergegeben werden. Dieses Verhalten ist wahrscheinlich bei Mangel an Ressourcen ausgeprägter. Jedes Tier auf sich alleine gestellt, kann weniger Nachkommen erzeugen und somit seine Gene weitergeben als wenn sie in Kolonien zusammenleben. 27. Wenn Individuen nicht genügend Ressourcen haben, um sich fortzupflanzen, sinkt die Geburtenrate. Mangelt es ihnen an Energie um sich selbst zu ernähren, steigt die Sterberate. 28. 2…. 29. t= 0 N(0) t N(t) N(t) = N(0)* e^(rt)=2* N(0) E^(rt)=2 T=ln2/r 30. dN/dt= r(max)*N ((K-N)/K) 31. Das logistische Wachstumsmodell geht von einer max. Populationsgröße aus, welche durch die Umwelt versorgt werden kann - der Umweltkapazität K. Das logistische Modell des Populationswachstums führt, wenn N gegen die Zeit aufgetragen wird, zu einem sigmoiden (s-förmig) Kurvenverlauf. Die Individuenzahl nimmt bei mittlere Abundanz am schnellsten zu; in dieser Phase gibt es nicht nur eine beträchtliche Anzahl fortpflanzungsfähiger Individuen, sondern auch ausreichen Platz und Ressourcen. Wenn sich der N-Wert K nähert, verlangsamt sich die Zuwachsrate dramatisch. 32. Die Individuenzahl nimmt bei mittlere Abundanz am schnellsten zu; in dieser Phase gibt es nicht nur eine beträchtliche Anzahl fortpflanzungsfähiger Individuen, sondern auch ausreichen Platz und Ressourcen. 33. Sterberate sinkt Geburtenrate sinkt Populationswachstum = 0 34. Aus direkten Wechselbeziehungen zwischen einzelnen Populationsmitgliedern. 35. a) Netto-Reproduktionsrate Ro= S(Summenzeichen) l(x)*m(x) Ro=1*0 + 0.1*5 + 0.06*20 + 0.018*10 + 0*0 =1.88 b) Die Reproduktionsrate bezieht sich auf die brütenden Weibchen und ihren weiblichen Nachwuchs. In diesem Fall wächst also die Population. c) Malthus’sche Parameter: r=ln(Ro)/T r=ln(1.88)/1=0.63 36. N=(40*45)/(9)=200 N= ( Gesamtzahl der im ersten Fang markierter Tiere * Gesamtzahl der Tiere im 2 Fang)/ Anzahl der markierten Wiederfänge 37. Nach 6 Generationen sind 22.8 Tiere pro ursprünglichem Elternpaar vorhanden. Das Wachstum ist expotentiell. Diese Frage wurde in den Prüfungsbeispielen von Schmid-Hempel selbst beantwortet. 38. r=12%-8%-2%=2% dN/dt=r*N=1100*2%=22 39. Die Grösse einer Population wird beeinflusst durch ihre Geburtenrate, Sterberate, Immigration und Emigration. Reguliert wird sie durch k (=Umweltkapazität; maximale Populationsgrösse, die ein gegebener Lebensraum zu einem bestimmten Zeitpunkt ohne Zerstörung des Habitats unterhalten kann). Die Umweltkapazität ist nicht starr festgelegt, sondern variiert sowohl räumlich als auch zeitlich mit der Menge an verfügbaren Ressourcen. Obwohl eine Limitierung der Energieversorgung wahrscheinlich die häufigste Determinante für die Umweltkapazität darstellt, können auch andere Faktoren das ökologische Fassungsvermögen reduzieren, zum Beispiel die Verfügbarkeit von Unterschlüpfen und Verstecken vor möglichen Räubern, Bodennährstoffe, Wasser oder geeignete Nist- und Ruheplätze. dN/dt=rmax*N((k-N)/k) 40. Eine Gruppe gleichaltriger Individueen von der Geburt bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle gestorben sind. 41. Wenn Geburten – und Sterberate gleich sind. 42. 10Weibchen/50gesamt*40Männchen=8 Laut Formel gilt (im deutschen Buch auf S. 1472 zu finden): Ne = (4*Nf*Nm)/(Nf+Nm), wobei Ne = effektive Populationsgrösse Nf = Anzahl Weibchen Nm = Anzahl Männchen Für unser Beispiel erhält man also: Ne = (4*10*40)/(10+40)=32 43. Die Grösse einer Population wird beeinflusst durch ihre Geburtenrate, Sterberate, Immigration und Emigration. 44. r=12%-8%-2%=2% dN/dt=r*N=1100*2%=22 45. a) Zufällige Dispersion ergibt sich, wenn zwischen den einzelnen Individuen einer Population weder starke positive noch negative Wechselbeziehungen herrschen: Die räumliche Position eines einzelnen Organismus ist somit unabhängig vom anderen. Bsp.: Bäume im Wald b) Eine Verteilung, bei der sich Individuen an bestimmten Stellen lokal häufen. Pflanzen zum Beispiel können dort kumulieren, wo Bodenbedingungen und andere Umweltfaktoren Keimung und Wachstum begünstigen. c) Regelmässige Dispersion ergibt sich aus direkten Wechselbeziehungen zwischen einzelnen Populationsmitgliedern. Gegenseitige Beschattung und Konkurrenz um Wasser und Nährstoffe kann bei Pflanzen zu einer solch homogenen Dispersion führen. Manche Pflanzen scheiden auch chemische Substanzen aus, welche die Keimung und das Wachstum benachbarter potentieller Konkurrenten hemmen. 46. Iteroparitie würde selektiv bevorzugt. Dies ist eine Lebenszyklusform, bei der die Adulten über viele Jahre hinweg eine grosse Zahl von Nachkommen hervorbringen. Dies beeinflusst aber ihre Mortalität nicht. 47. Die zyklischen Fluktuationen in der Populationsgrösse von Schneehasen ist vor allem durch exzessive Prädation geprägt, aber auch durch die Nährstoffverfügbarkeit, die vor allem während der Wintermonate einen entscheidenden Einfluss hat. Möglicherweise können besser genährte Hasen den Räubern besser entkommen. Viele verschiedene Räuber tragen zu den Verlusten in der Hasenpopulation bei. Experimente haben gezeigt, dass wenn man die Nährstoffverfügbarkeit erhöht, zwar die Populationsgrösse zunimmt, doch die Fluktuationen bleiben. 48. Es liegt daran, dass die Mortalitätsraten ganz rapide sinken, während die Abnahme der Geburtenrate variiert. In Indien fiel zum Beispiel die Geburtenrate langsam und unregelmässig. Bei Ländern in der demographischen Transition sterben also weniger Leute bei hoher Geburtenrate Population wächst. Am Ende der Transition haben wir wieder ein Nullwachstum Niedrige Geburtenrat, Niedrige Sterberate 51. Es gibt dichteabhängige und dichteunabhängige Regulation. Beispiele für dichteabhängige Sterberate; Räuber als wichtige Ursache für dichteabhängige Mortalitätsraten. Wenn in der Beutepopulation die Verlustrate durch den Räuber grösser ist als die Zuwachsrate. Auswirkungen einer Krankheit, falls ihre Übertragungshäufigkeit von einer kritischen Populationsgrösse abhängt. Populationsdichte wegen mangelnden Ressourcen Beispiele für dichteunabhängige Mortalitätsraten; Kalte Winter Beispiele für dichteabhängige Fertilitätsabnahme; Bei der Singammer verringert sich die durchschnittliche Gelegegrösse mit zunehmender Populationsdichte, hervorgerufen durch Futtermangel. 52. Die reproduktive Phase ist im Alter von 15-45 Jahren. Aus diesem Grund wird Population a) am meisten wachsen, weil sie über eine lange Zeitspanne eine starke Altersgruppe im reproduktiven Alter ist. 53. a) Besiedlung eines neuen Habitats b) Migration ist regelmässige Wanderung von Tieren über relativ weite Entfernungen. Charakteristisch für Migrationsverhalten ist, dass die Tiere jedes Jahr zwischen zwei Gebieten hin und her ziehen. 54. Nach einem Ereignis, das die vorhandene Vegetation zerstört, z.B.: Brand oder Vulkanausbruch, können verschiedene Arten das zerstörte Gebiet neu besiedeln und werden nach und nach von anderen ersetzt. Eine solche Verschiebung der Artenzusammensetzung in einem ökologischen Zeitrahmen nennt man ökologische Sukzession. Beginnt dieser Prozess in einer unbelebten Region, spricht man von Primärsukzession. Häufig sind die einzigen Lebensformen, die zu Beginn vorhanden sind, autotrophe Bakterien; Flechten und Moose, deren Sporen durch den Wind verbreitet werden, sind die ersten makroskopisch erkennbaren, photosynthetisch aktiven Organismen, die ein solches Gebiet besiedeln. Mit der Zeit kommt es durch Gesteinsverwitterung und Anreicherung der organischen Zersetzungsprodukte der Erstbesiedler zur Bodenbildung, wodurch die Einwanderung anderer Pflanzen ermöglicht wird. Es etablieren sich Gräser, Sträucher und dann Bäume, deren Samen durch Wind oder durch Tiere aus umliegenden Gebieten eingetragen werden. Schliesslich werden sich einige Pflanzenarten durchsetzen und zur dominierenden Vegetationsform der Lebensgemeinschaft entwickeln. Der gesamte Prozess kann hunderte oder sogar tausende von Jahren dauern. Bei Primärsukzession kenn man also typische Pionierarten, die den Boden für nachfolgende Vegetationen bereiten. Eine Sekundärsukzession erfolgt, wenn eine bestehende Gemeinschaft durch eine Störung, die den Boden intakt lässt, eliminiert wurde. Häufig entwickelt sich das gestörte Gebiet wieder in Richtung seines ursprünglichen Zustands zurück. Die Sukzession auf solchen Böden verlauft typischerweise folgendermassen; zu Beginn entwickelt sich eine krautige Vegetation, die – falls nicht abgebrannt oder intensiv beweidet – im Laufe der Zeit durch Büsche und letztendlich durch Waldbäume ersetzt wird. Sukzession: Veränderung der Artenzusammensetzung einer Gemeinschaft nach einer massiven Störung; die Etablierung einer Lebensgemeinschaft in einem Gebiet, in dem vorher praktisch kein Leben vorhanden war. Die abiotische Umwelt und die Pflanzen beeinflussen sich gegenseitig, d.h. die Pflanzen können auch ihre Umwelt verändern (z.B. Versauerung des Bodens, Stickstoffanreicherung etc.) Flechten, Moose durch Gesteinsverwitterung und Zersetzungsprodukte der Pionierarten Bodenbildung; Einwanderung von Gräsern, Sträucher und Bäumen. Schlussendlich werden sich einige Pflanzenarten durchsetzen und dominieren. 55. Ausschliesslich wegen dem Konkurrenzverhalten; werden die Samen zu nahe gepflanzt, konkurrenzieren sie um Nährstoffe im Boden. Beim Wachsen könnte zudem ein Platzmangel entstehen, je nachdem wie gross das Gewächse wird. 56. siehe Kopie 57. a) Symbiose b)Prädation & Parasitismus c)Konkurrenz 58. Schlüsselräuber 59. siehe Kopie je höher Mortalität, desto mehr Nachkommen haben sie 61. Sie nimmt ab, da die Investition für die Nachkommen die eigenen Überlebenschancen senken. 62. Fitness im Sinne Darwins wird nicht daran gemessen, wie viele Nachkommen produziert werden, sondern wie viele von ihnen überleben und selbst zur Reproduktion gelangen. Ideal wäre ein Lebenszyklus, deren Mitglieder bereits sehr früh geschlechtsreif werden, viele Nachkommen erzeugen und sich häufig fortpflanzen. Die natürliche Selektion kann jedoch nicht alle diese Variabeln gleichzeitig optimieren, da Lebewesen nur über begrenzte Ressourcen verfügen Trade-offs Viele Lebenszyklen werden dadurch geprägt, dass der Nutzen, der aus einer gegenwärtigen Investition in die Nachkommenschaft resultiert, gegen den Aufwand abgewogen wird, der für Überleben und zukünftige Reproduktionsaussichten getrieben werden muss. Niedrige Mortalität im Jugendalter, wenige Jungtiere. Erfahrung und physische Grösse beeinflussen Fekundität positiv (Vorteile überwiegen). 63. Mit grosser Wahrscheinlichkeit spielen die evolutionäre Entwicklung und das Klima eine entscheidende Rolle. Im Verlaufe der Evolution kann die Diversität durch Speziation erfolgen. Da tropische Lebensgemeinschaften generell älter sind, hatten sie mehr Zeit neue Arten hervorzubringen, als solche in gemässigten oder polaren Ökosystemen. Der Altersunterschied resultiert zum Teil aus längeren Vegetationsphasen in den Tropen, welche die der Tundra um das etwa 5fache übersteigen. Dies führt dazu, dass die biologische Zeit und daher die Bildung neuer Arten in den Tropen 5mal so schnell ablaufen kann wie in Polargebieten. Dazu kommt, dass viele der polaren und gemässigten Lebensgemeinschaften durch Gletscherbildung und Vereisung massgeblich gestört wurden und sich einige Male wieder von neuem entwickeln mussten. Zudem spielt das Klima eine wichtige Rolle für den globalen Gradienten der Artenvielfalt, denn vor allem der Eintrag von Sonnenenergie und die Verfügbarkeit von Wasser ist für die Artenvielfalt von Bedeutung . 64. siehe Folie je höher Überlebenschance, desto später haben die Tiere Nachkommen 65. Nachdem die Pioniere den Boden für die nachfolgende Vegetation bereitet haben, wandern viele Arten ein, die Artendiversität erreicht ihr Maximum. Durch interspezifische Konkurrenz werden einige wieder ausgerottet, die Artendiversität nimmt ab, bis es zu einem Gleichgewicht kommt, bei dem verschiedene Arten nebeneinander existieren können. 66. Konkurrenz Konkurrenzausschlussprinzip; bei getrennt lebenden Populationen überlagert sich das Vorkommen vermutlich! Überprüfen: eine Art auf einem gewissen Areal ausrupfen und Entwicklung der anderen beobachten, oder aber getrennte Vorkommen, wo nur die eine Art vorkommt suchen, und dann dort messen und zählen & schlussendlich vergleichen. 67. Aufgrund der Verbrennung von Holz und fossilen Energieträgern hat der CO2 Gehalt der Atmosphäre seit der industriellen Revolution stetig zugenommen. 68. Sowohl die Kuckucksbiene wie auch die Faltenwespe besitzen einen Giftstachel. 69. Der Schlüsselräuber wurde ausgegrenzt. Dadurch konnte sich die dominante Art etablieren und so wurden 2 Arten aus Konkurrenzgründen verdrängt. 70. Mit den Moskitos ist auch die Vogelmalaria nach Hawaii gekommen. Die Moskitos haben die Vögel als Wirte benützt um sich zu vermehren. Da für die Vögel die Moskitos eine neue parasitische Art war, konnten sich die Vögel sich nicht verteidigen und deswegen hat die Vogelwelt sehr daran gelitten. Heute kommen nur noch einige der damals vorhandenen Vogelarten vor, und zwar in Arealen wo Temperatur und Höhe nicht für die Moskitos geeignet sind. 71. Wie viele Arten auf einer Insel vorkommen, wird durch zwei Faktoren bestimmt; die Häufigkeit, mit der neue Arten auf die Insel einwandern und die Rate, mit der sie eliminiert werden. Diese werden wiederum durch die Grösse der Insel und durch die Entfernung vom Festland bestimmt. Kleine, weit entfernte Inseln werden eine tiefere Immigrationsrate haben, da sie von Kolonisten seltener gefunden und aufgesucht werden. Kleine Inseln haben auch eine höhere Extinktionsrate, da sie weniger Ressourcen und unterschiedliche Habitate bieten. Inseln sind besonders gefährdet für das Aussterben von Arten aus folgenden Gründen: 1. Kleinere Immigrationsrate; 2. Höhere Extinktionsrate; 3. Je grösser der Abstand der Insel zum Land wird, desto kleiner wird die Immigrationsrate sein (und umgekehrt: desto kleiner der Abstand zwischen Insel und Land, desto grösser wird die Immigrationsrate). 4. Wenige unterschiedliche Ressourcen, was den Konkurrenzausschuss erhöht; 5. kleineres Gebiet, somit sowieso weniger Arten. Alternativ von Jürg: Inseln weisen endemische Arten auf, die sonst nirgends vorkommen; wenn neue Arten auf der Insel auftauchen, haben sich die endemischen Arten nicht auf das Auftauchen des neuen Feindes/Konkurrenten vorbereiten können 72. Die Artenzahl ist umso höher, je grösser das geographische Areal der untersuchten Biozönose ist. Funktion: logS=c+z*logA Siehe Blatt 73. a)die Artenzahl ist umso höher, je grösser das geograpische Areal der untersuchten Biozönose ist b)je grösser die Insel, desto grösser die Artenvielfalt c) Gerade siehe Blatt 74. Ihre ökologischen Nischen dürfen nicht identisch sein ( sich ausschliessende Verbreitung) oder sie müssen ein anderes Ressourcenspektrum nutzen ( Nischen-Differenzierung: Diät, Zeit, Morphologie, Raum). a) Falls a) nicht der Fall ist, muss wird eine Population durch natürliche Selektion evolvieren ( Ressourcenaufteilung und Merkmalsdivergenz) oder aussterben. 75. geographische Breite ( je näher am Äquator, desto mehr Arten) Höhe über Meer Niederschlags -und Temperaturregime 76. 200 Jahre; steady-state resp. Sukzession 77. Territorialität ein Territorium ist ein Gebiet, das von einem Individuum verteidigt wird, und zwar meist gegen Artgenossen. Territorien dienen der Nahrungssuche, der Paarung oder der Jungenaufzucht. Der Tiger duldet also keine weiteren Artgenossen, die Territorien werden durch antagonistisches Verhalten besetzt und verteidigt, und Individuen, die ein Territorium erobert haben, sind schwer daraus zu vertreiben. . Der Tiger nimmt wahrscheinlich die Position des Spitzenräubers ein; da der Energiefluss in einem Ökosystem von unten nach oben nicht sehr gross ist (nur etwa 10% wird an die nächste trophische Stufe weitergegeben), kann aus Ressourcenknappheit nur ein Individuum des Spitzenräubers ein grösseres Territorium bewohnen 78. Das Habitat ist der Lebensraum von Organismen einer Art, während die ökologische Nische alle biotischen und abiotischen Ressourcen eines Lebensraumes umfasst, welche von Organismen einer Art genutzt werden 79. Die Biodiversität einer Lebensgemeinschaft setzt sich aus 2 Komponenten zusammen, dem Artenreichtumg, d.h. der Gesamtzahl ihrer Mitgliedsarten und der relativen Abundanz (Häufigkeit, Anzahl, Dichte), in der die jeweiligen Arten vorkommen. Unter Umständen kann eine Lebensgemeinschaft mit weniger Arten aber höherer relativen Abundanz diverser sein, als eine Lebensgemeinschaft mit vielen Arten aber tiefer relativer Abundanz. 80. Wie viele Arten auf einer Insel vorkommen, wird durch zwei Faktoren bestimmt; die Häufigkeit, mit der neue Arten auf die Insel einwandern und die Rate, mit der sie eliminiert werden. Diese werden wiederum durch die Grösse der Insel und durch die Entfernung vom Festland bestimmt. Kleine, weit entfernte Inseln werden eine tiefere Immigrationsrate haben, da sie von Kolonisten seltener gefunden und aufgesucht werden. Kleine Inseln haben auch eine höhere Extinktionsrate, da sie weniger Ressourcen und unterschiedliche Habitate bieten. Auch die Entfernung vom Festland spielt eine Rolle. Je näher eine Insel am Festland ist, je höher wird ihre Immigrationsrate im Vergleich zu einer gleich grossen, aber weiter entfernter Insel sein. 81. Simpson’s Index gewichtet häufige Arten Shannon-Wiener Indesx gewichtet seltene Arten siehe Blatt 82. Wenn der Schlüsselräuber weg ist, wird diejenige Art, die am konkurrenzstärksten ist (Ressourcen am besten nutzen, am meisten fortpflanzungsfähige Nachkommen), sich durchsetzen und andere konkurrenzschwächere Arten verdrängen) 83 Neotropical und Ethiopian (beide liegen in Äquatornähe). siehe Folie 84. Assimilation von CO2 durch Pflanzen Respiration der Tiere Zersetzung von toten Organismen durch Destruenten 85. Denitrifikation anaerobe Bakterein gewinnen Sauerstoff aus Nitrat zu gewinnen. Dadurch wird ein Teil des Nitrats wieder in N2 verwandelt und an Atmosphäre abgegeben. 86. 100000= 10% 100%=1 000 000 10% der auf einer Trophiestufe verfügbaren Energie wird in neue Biomasse der nächst höheren Trophiestufe umgesetzt. 87. Sekundärer Konsument 88. Destruenten bauen totes organisches Material ab. Dabei wandeln sie organische Stickstoffverbindungen in Ammonium um Ammonifikation. Dadurch kehren riesige Mengen an gebundenem Stickstoff in den Boden zurück, wo er weiter zu Nitrit, Nitrat und über Denitifikation wieder zu atmosphärischem Stickstoff verarbeitet wird. Sie recyclen den Stickstoff aus abgestorbenen Organismen, sodass er wieder zur Verfügung steht. 89. 10% Lindeman's Koeffizient 90. chemoautotroph; anaerob 91. a) Tropischer Regenwald, Algenrasen b) Offene Meere, tropischer Regenwald 92. Durch das weltweit zunehmende Verbrennen von Kohle, Erdöl und Erdgas und durch das Brandroden von Waldflächen nimmt der Kohlendioxid-Gehalt in der Atmosphäre ständig zu. Kohlendioxid absorbiert einen Teil der Infrarotstrahlung, die von der Erde in das Weltall abgestrahlt wird, wodurch eine Erwärmung der Atmosphäre befürchtet wird. 93. Energiefluss: Nur ca. 10% (Lindeman’s Koeffizient) der auf einer Trophiestufe verfügbaren Energie wird in neue Biomasse der nächst höheren Trophiestufe umgesetzt. Primärproduzenten sogar nur ca. 1% der Sonnenenergie. Viel Energie geht z.B. via Respiration als Wärme ins All „verloren“. Energie kann nicht wieder recycelt werden, sie geht verloren (fliesst durch das System) und muss von der Sonne immer wieder neu ins System eingetragen werden. Fluss der Materie: Materie geht fast vollständig in Form von Nahrung von einer Trophiestufe zur nächsten. Nachdem die Destruenten in der letzten Stufe den/das Detritus (tote, organische Abfälle, wie Kot, abgefallenes Laub, Holz oder Kadaver abgebaut und die Materie wieder aufbereitet haben, stehen diese Nährstoffe wieder den Primärproduzenten zur Verfügung. Materie fliesst also nicht durch das System, sondern befindet sich – zumindest global gesehen – in einem Kreislauf. 94. Die Energietransformation und der Stoffumsatz innerhalb einesÖkosystemslassensichverfolgen, indem die Arten einer Lebensgemeinschaft aufgrund ihrer Hauptnahrungsquelle zu trophischen Stufen einer Nahrungsbeziehung zusammengefasst werden. (Destruenten) . . Tertiärkonsumenten (Carnivoren) Sekundärkonsument (Carnivoren) Primärkonsument (Herbivoren) Primärproduzent (Sonnenenergie) 95. 2 Hypothesen: Energiehypothese; Ineffizienz des Energietransfers entlang der Kette Nur 10% der gespeicherten Energie wird im nächsten Kettenglied umgesetzt. Dynamische Stabilitätshypothese; lange Nahrungsketten sind weniger stabil als kurze. Fluktuationen in tieferen Level wirken sich auf höhere Stufen verstärkend aus, was zum Aussterben der entsprechenden Art führen kann. Je länger die Nahrungskette,desto geringer ist die Erholungsrate für geschwächte Tiere. 96. Das Experiment hat gezeigt, dass die Menge an Nährstoffen, die ein intaktes Wald Ökosystem verlassen, von den Pflanzen kontrolliert wird. Sind keine Pflanzen vorhanden, die die Nährstoffe zurückhalten können, verliert das System diese. Wird Wald gerodet, werden die Nährstoffe (vor allem Ca2+) vom sauren Regen ausgeschwemmt der Wald wächst nicht mehr. 97. Offene Meere, Tundra, Wüste, Fels, Sand, Eis 98. Der Abbau von organischem Material und somit der Kreislauf wird von der Temperatur, Verfügbarkeit von Wasser und Sauerstoff beeinflusst. Ebenso tragen Feuer und Zusammensetzung des Bodens zu diesen Prozessen bei. Gewisse Schlüsselnährstoffe wie Phosphor kommen im tropischen Regenwald in geringen Mengen vor. Dies rührt daher, dass hier die Zersetzung infolge hoher Temperaturen viel schneller verläuft und die Niederschläge relativ häufig sind. Zusätzlich verlangt die grosse Artenvielfalt hohe Mengen an Nährstoffen, welche sofort absorbiert werden, nachdem sie produziert worden sind. Der Zyklus läuft also sehr schnell ab. Nur 10% der Nährstoffe befinden sich im Boden. 99. a) Das Treibhausgas, CO2 (Kohle/Erdöl) b) reciceltes Ammonium aus abgestorbenen Organismen wird nitrifiziert und als Nitrat von den Pflanzen wieder aufgenommen.