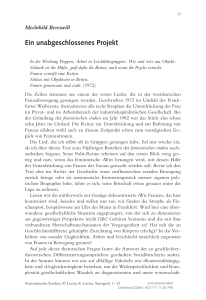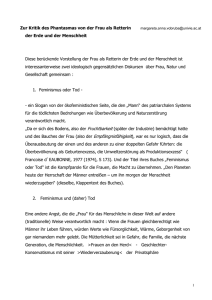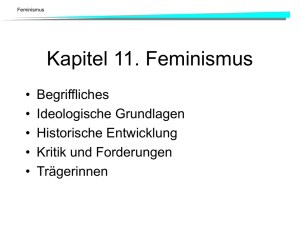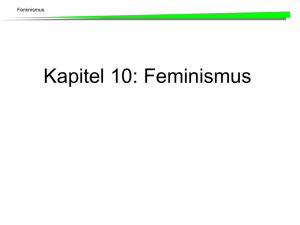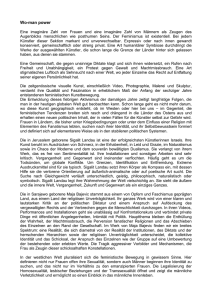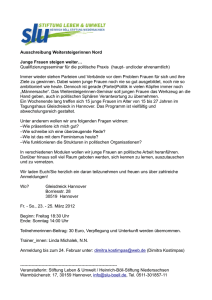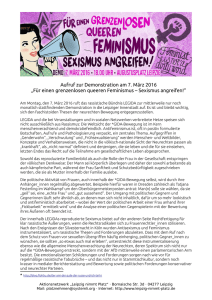Queer & Feminismus Debatte
Werbung
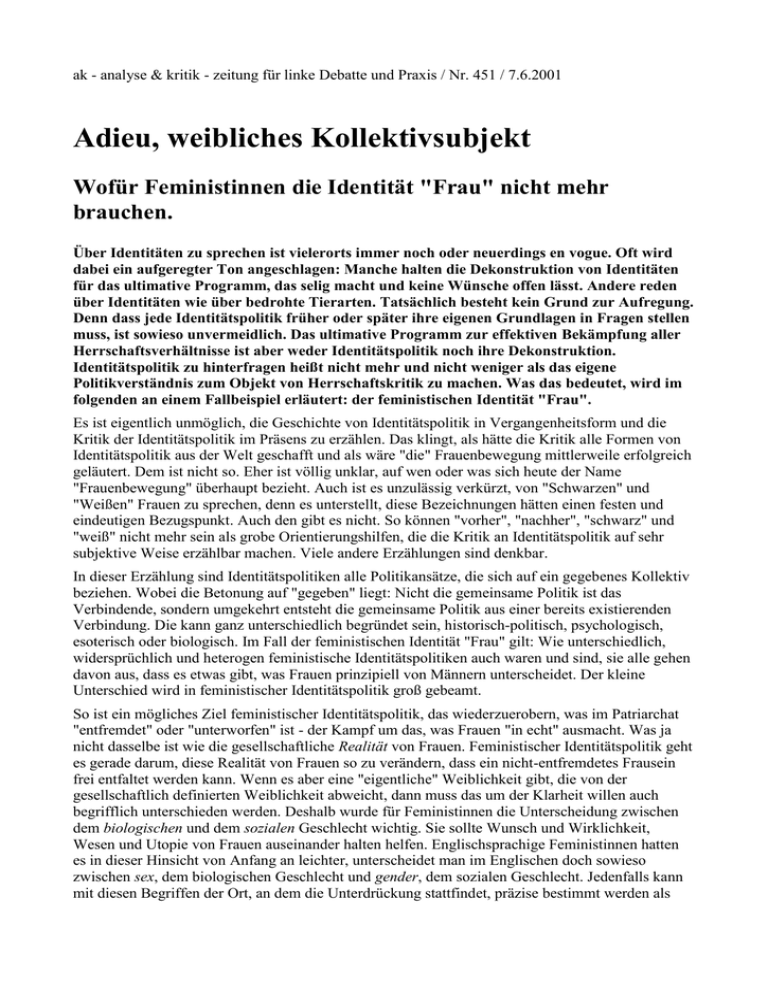
ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis / Nr. 451 / 7.6.2001 Adieu, weibliches Kollektivsubjekt Wofür Feministinnen die Identität "Frau" nicht mehr brauchen. Über Identitäten zu sprechen ist vielerorts immer noch oder neuerdings en vogue. Oft wird dabei ein aufgeregter Ton angeschlagen: Manche halten die Dekonstruktion von Identitäten für das ultimative Programm, das selig macht und keine Wünsche offen lässt. Andere reden über Identitäten wie über bedrohte Tierarten. Tatsächlich besteht kein Grund zur Aufregung. Denn dass jede Identitätspolitik früher oder später ihre eigenen Grundlagen in Fragen stellen muss, ist sowieso unvermeidlich. Das ultimative Programm zur effektiven Bekämpfung aller Herrschaftsverhältnisse ist aber weder Identitätspolitik noch ihre Dekonstruktion. Identitätspolitik zu hinterfragen heißt nicht mehr und nicht weniger als das eigene Politikverständnis zum Objekt von Herrschaftskritik zu machen. Was das bedeutet, wird im folgenden an einem Fallbeispiel erläutert: der feministischen Identität "Frau". Es ist eigentlich unmöglich, die Geschichte von Identitätspolitik in Vergangenheitsform und die Kritik der Identitätspolitik im Präsens zu erzählen. Das klingt, als hätte die Kritik alle Formen von Identitätspolitik aus der Welt geschafft und als wäre "die" Frauenbewegung mittlerweile erfolgreich geläutert. Dem ist nicht so. Eher ist völlig unklar, auf wen oder was sich heute der Name "Frauenbewegung" überhaupt bezieht. Auch ist es unzulässig verkürzt, von "Schwarzen" und "Weißen" Frauen zu sprechen, denn es unterstellt, diese Bezeichnungen hätten einen festen und eindeutigen Bezugspunkt. Auch den gibt es nicht. So können "vorher", "nachher", "schwarz" und "weiß" nicht mehr sein als grobe Orientierungshilfen, die die Kritik an Identitätspolitik auf sehr subjektive Weise erzählbar machen. Viele andere Erzählungen sind denkbar. In dieser Erzählung sind Identitätspolitiken alle Politikansätze, die sich auf ein gegebenes Kollektiv beziehen. Wobei die Betonung auf "gegeben" liegt: Nicht die gemeinsame Politik ist das Verbindende, sondern umgekehrt entsteht die gemeinsame Politik aus einer bereits existierenden Verbindung. Die kann ganz unterschiedlich begründet sein, historisch-politisch, psychologisch, esoterisch oder biologisch. Im Fall der feministischen Identität "Frau" gilt: Wie unterschiedlich, widersprüchlich und heterogen feministische Identitätspolitiken auch waren und sind, sie alle gehen davon aus, dass es etwas gibt, was Frauen prinzipiell von Männern unterscheidet. Der kleine Unterschied wird in feministischer Identitätspolitik groß gebeamt. So ist ein mögliches Ziel feministischer Identitätspolitik, das wiederzuerobern, was im Patriarchat "entfremdet" oder "unterworfen" ist - der Kampf um das, was Frauen "in echt" ausmacht. Was ja nicht dasselbe ist wie die gesellschaftliche Realität von Frauen. Feministischer Identitätspolitik geht es gerade darum, diese Realität von Frauen so zu verändern, dass ein nicht-entfremdetes Frausein frei entfaltet werden kann. Wenn es aber eine "eigentliche" Weiblichkeit gibt, die von der gesellschaftlich definierten Weiblichkeit abweicht, dann muss das um der Klarheit willen auch begrifflich unterschieden werden. Deshalb wurde für Feministinnen die Unterscheidung zwischen dem biologischen und dem sozialen Geschlecht wichtig. Sie sollte Wunsch und Wirklichkeit, Wesen und Utopie von Frauen auseinander halten helfen. Englischsprachige Feministinnen hatten es in dieser Hinsicht von Anfang an leichter, unterscheidet man im Englischen doch sowieso zwischen sex, dem biologischen Geschlecht und gender, dem sozialen Geschlecht. Jedenfalls kann mit diesen Begriffen der Ort, an dem die Unterdrückung stattfindet, präzise bestimmt werden als gender, als soziales Geschlecht. Das eigentliche Geschlecht, sex, bleibt entsprechend verschont von politischen Forderungen und feministischen Utopien - es bleibt Natur. Feministische Identitätspolitik zielte, anders formuliert, vor allem darauf ab, das soziale Geschlecht Frau von seinen patriarchalen Fesseln zu befreien, um es zur Wahrheit des natürlichen Geschlechtes zurückzuführen. Feministische Identitätspolitikerinnen kritisierten zwar die spezifische, patriarchale Bestimmung des sozialen Geschlechts. Die Unterscheidung zwischen sex und gender stellten sie aber nicht in Frage. Und das hieß auch, dass die naturgegebene Existenz zweier (und nur zweier) grundsätzlich verschiedener Geschlechter fraglos akzeptiert wurde. Feministische Identitätspolitik ging davon aus, dass es ein alle Frauen verbindendes Band gibt, und zwar unabhängig davon, in welcher Klasse, in welchem Land und zu welcher Zeit Frauen geboren werden. Stärker esoterisch eingefärbte Strömungen begaben sich zum Beispiel auf die Suche nach der eigentlichen Weiblichkeit, von der angenommen wurde, dass sie das Gegenteil traditioneller Charakterzuschreibungen verkörperte: weiblich sein sollte heißen, wild zu sein, unbeherrschbar, körperlich, lustbetont, stark und widerspenstig. Autonome linke feministische Strömungen definierten in Abgrenzung dazu als gemeinsame Grundlage für die Identität "Frau" weniger einen idealtypischen "Wesenskern" der Frau, als vielmehr die kollektive Erfahrung von patriarchaler Unterdrückung. Sie beschäftigten sich folglich mit sexueller Gewalt, ökonomischer Ausbeutung, repressiver weiblicher Sozialisation und struktureller Benachteiligung von Frauen. Diese Form von Identitätspolitik brachte in der Vergangenheit viele bis dahin ungehörte Erfahrungen in- und außerhalb der Linken ans Tageslicht; so etwa die Thematisierung alltäglicher sexualisierter Gewalt. Sie eröffnete für Frauen einen Raum, untereinander, aber auch öffentlich über ihre Erfahrungen zu sprechen. Deswegen war sie wichtig. Gleichwohl ist sie an zentralen Punkten problematisch geworden. Widerspruch dem Hauptwiderspruch So unterschiedlich die einzelnen Strömungen waren, eines verband sie auf jeden Fall bis ungefähr Ende der 80er Jahre: die Annahme einer universalen Unterdrückungsstruktur, die materiell und ideologisch Leben, Arbeit, Reproduktionsarbeit und Körper von allen Frauen weltweit unterwirft und ausbeutet. Eben das Patriarchat. Aber irgendwann geriet das Statut vom universellen Patriarchat ins Wanken. Wobei das innerhalb der Frauenbewegung kein Selbstgänger war, sondern das Ergebnis zäher, harter und - für diejenigen, die die Kritik vorgebracht hatten -, auch frustrierender Kämpfe. Die Kritik an einem Patriarchatsbegriff, der auf der Annahme eines universalen feministischen Kollektivs basiert, wurde von Schwarzen Frauen in den USA und in der Bundesrepublik von Migrantinnen und Schwarzen deutschen Frauen artikuliert. Sie wies nach, dass die Unterstellung "das Patriarchat ist universal" oder, positiv gewendet, "Frauen weltweit sind Schwestern" nichts anderes war als der Reflex eines Emanzipationsbegriffes, der von und für weiße, europäische Mittelklasse-Frauen gedacht war. Den Anspruch, für alle Frauen dieser Welt sprechen zu können, konfrontierten Schwarze Frauen mit dem faktischen Ausschluss von Frauen. Dabei beschränkten sie sich nicht darauf, die Ausschlussmechanismen der bürgerlichen, patriarchalen Gesellschaft zu kritisieren. Sie skandalisierten gerade die üblicherweise unsichtbar arbeitenden Verfahren der Ausgrenzung innerhalb der Frauenbewegung und anderen sozialen, linken Bewegungen. Denn die Ausblendung von konkreten Erfahrungen von Frauen, die von der weißen, europäischen Mittelschichtsnorm abweichen, war vielerorts unhinterfragte Basis auch feministischer Theorie und Praxis. Diese Ausblendung und die These vom universellen Patriarchat gehörten zusammen, stützten und bedingten einander. Damit wurde die Frage nach den Unterschieden zwischen rassistischer und sexistischer Unterdrückung zweitrangig. Frauen galten nicht wenigen weißen Feministinnen als "Neger der Welt" und damit erschöpfte sich ihr Beitrag zum Thema Rassismus. Die rassistische Verteilung von Ressourcen und Macht unter Frauen zu thematisieren, stand nicht auf der Tagesordnung. Welche Frauen die Möglichkeit haben, an akademischen und/oder politischen Diskursproduktionen teilzuhaben, wurde nicht systematisch hinterfragt und so, ob gewollt oder ungewollt, stabilisierte feministische Identitätspolitik rassistische und Klassen-Hierarchien. Konsequenterweise wurden Schwarze Frauen in einer solchen Logik dann häufig entweder als pädagogische Objekte konstruiert nach dem Motto "weiße Akademikerinnen wissen, was (schwarze) Frauen wünschen", womit sich der bürgerliche weiße Feminismus wiederum als Maßstab etablierte. Oder umgekehrt wurden Schwarze Frauen zu Expertinnen für Rassismus erklärt, womit sich Weiße Frauen ihrer Zuständigkeit und Verantwortung entledigten. Fallstricke der Identitätspolitik Dem Mythos der "großen feministischen Familie" entgegneten Schwarze Feministinnen, dass es eben kein universelles Subjekt Frau gibt, sondern vielfältige unterschiedliche Positionen von Frauen, die aus der Überschneidung von Geschlecht, "Rasse" und Klasse entstehen. Macht werde eben nicht nur von Männern über Frauen ausgeübt, sondern auch von Weißen über Schwarze. Unterdrückung entstehe nicht aus einem grundlegenden Hauptwiderspruch, sondern aus der Verflechtung verschiedener ineinander greifender Unterdrückungsstrukturen. Und diese Kritik ist konsequent feministisch. Denn der Feminismus und die Neue Frauenbewegung waren gerade auch als Reaktion auf eine Linke angetreten, die immer wieder die Produktionsverhältnisse als Hauptwiderspruch und das Proletariat als revolutionäres Subjekt konstruiert hatte. Eine Linke, die davon ausging, dass sich die Frage der Ungleichheit der Geschlechter nach der Revolution schon von selbst erledigen würde. Insofern war es historisch nur folgerichtig, dass der Feminismus von innen heraus genau da in Frage gestellt werden musste, wo er seinerseits einen Hauptwiderspruch konstruierte. Die Diskussion um Rassismus ist sicherlich das bekannteste Beispiel für die innerfeministische Kritik an Identitätspolitik. Etwas weniger populär sind die folgenden zwei Fälle: erstens die Diskussion um den Mythos vom "Faschismus als höchste Form des Patriarchats", in dem dann Frauen logischerweise vor allem Opfer gewesen sein sollen - inklusive KZ-Aufseherinnen und SS-Ehefrauen. Die sogenannte Debatte um Mittäterschaft - wobei der Begriff auch bereits problematisch ist, da er eine originäre Täterschaft von Frauen ausschließt - stellte diesen Mythos von "der Frau" als Opfer des NS und als allgemeines Opfer des Patriarchats in Frage. Zugleich wurde, auf die Gegenwart bezogen, die Frage nach der Beteiligung von Frauen an Verhältnissen materieller und auch sexueller Gewalt und Ausbeutung gestellt. Die Rolle von Frauen/Müttern im Zusammenhang mit sexueller Gewalt in der Familie wurde hinterfragt, die Debatte um "Täterschutz", auch in der Linken, begann. Hier wurde gleichzeitig versucht, die Mittäterinnenschaft von Frauen zwar abstrakt zu denken, allerdings ohne die gemeinsame Identität als Opfer aufzugeben, nach folgendem Muster: Frauen werden durch Sozialisation von sich selbst so entfremdet, dass sie darauf getrimmt werden, sich schützend vor gewalttätige Männer zu stellen; andererseits sagen Frauen, sobald es um sexuelle Gewalt geht, immer die Wahrheit. Diese widersprüchliche Identitätskonstruktion in praktische Politik umzusetzen, erwies sich häufig als sehr schwierig; und nicht wenige linke Männer nutzten diese "konzeptionelle Schwäche" der autonomen Frauenbewegung in äußerst unangenehmer Weise, um sich mit Nachdruck entweder als "Opfer des Feminismus" oder als "gute Männer" zu konstruieren. Verhandelt wurde weniger die Frage der Gewalt als vielmehr die Frage des Geschlechts, und genau das machte es so schwierig, effektive Strategien gegen Gewalt zu entwickeln. Unvermeidliche Provokationen Zweiter Fall: Im Zusammenhang mit vorgeburtlicher Diagnostik und künstlicher Befruchtung wurde der für die Neue Frauenbewegung so grundlegende Begriff der individuellen Selbstbestimmung mehr als heikel. Auf einmal stellte sich heraus, dass die scheinbar selbstverständliche Forderung nach dem Recht auf Kontrolle über den eigenen Körper eugenische Phantasmen von Auslese nähren. Denn die Pränataldiagnostik verspricht ja die Möglichkeit der vorgeburtlichen Selektion "abweichender", also behinderter Föten. Weil damit plötzlich auch die Reproduktion maßgeschneiderten Nachwuchses um jeden Preis gemeint sein konnte, bekam das trotzige "mein Bauch gehört mir" einen ganz anderen Ton: nicht mehr Kampfparole gegen patriarchalen Staat und Gebärzwang, sondern beruhigende Antwort auf ein angebliches moralisches Dilemma. Behinderte Feministinnen stellten die Frage, inwieweit ein Selbstbestimmungsbegriff als feministische Kampfparole taugt, der die Verantwortung für das Existenzrecht behinderter Menschen zurückweist. Die Antwort blieb aus. Das konkrete Entscheidungs-Problem lösen die meisten betroffenen Frauen inzwischen privat oder mit Hilfe staatlich oder kirchlich geförderter, auch "feministischer" Beratungsstellen. Die einen nehmen Pränataldiagnostik in Anspruch, die anderen nicht - politisiert wird dieses Thema kaum noch. Dieser Rückzug ins Private schließt in gewisser Weise logisch an Identitätspolitik an. Wenn die Möglichkeit eugenischer Selektion, je nachdem, als Herausforderung, Gefährdung oder Schutz weiblicher Identität verhandelt wird und nicht als Herrschaftsstrategie, die ganz bestimmte Konstruktionen von Weiblichkeit erst auf den Markt wirft, dann kann kaum ein politischer Umgang mit diesem Thema entwickelt werden. Für die Frage nach feministischer Identitätspolitik bedeuteten diese unterschiedlichen Verwerfungen vor allem eins: Verunsicherung. Und in Phasen politischer Verunsicherung wird Theorie wichtiger. So traf es sich gut und keinesfalls zufällig, dass Anfang der 90er Judith Butlers "Gender Trouble" auf deutsch ("Das Unbehagen der Geschlechter") erschien. Einige fühlten sich allerdings durch Butlers Thesen regelrecht provoziert, manche sogar bis heute. Dabei war Butlers theoretische Intervention vor allem klärend und deshalb notwendig. Denn Butler, US-amerikanische, lesbische Philosophin und akademische Kultfigur der 90er, geht davon aus, dass nicht nur gender Produkt gesellschaftlicher Machtverhältnisse ist. Das hatten Feministinnen schon lange vor ihr gedacht, etwa Simone de Beauvoir - wir werden nicht als Frauen geboren, wir werden dazu gemacht. Butler denkt, dass die Differenz zwischen sex und gender selbst Produkt eben dieser Herrschaftsverhältnisse ist. Für sie gehört es zu den effektivsten Strategien "patriarchaler" Macht, dass sie nicht nur in den Köpfen, sondern bis in jeden Winkel der Erfahrung, der Empfindungen, Ängste, Sehnsüchte und Vorstellungen die Fiktion verankern konnte, dass Menschen in zwei und nur in zwei Geschlechtern zu denken sind und dass diese zwei Geschlechter in ganz bestimmter Weise aufeinander bezogen sind: nämlich gegensätzlich oder ergänzend, auf jeden Fall aber hierarchisch. Das Adjektiv "patriarchal" muss man aus dieser Sicht deshalb in Anführungsstriche setzen, weil Patriarchat für Herrschaft von Männern über Frauen steht. Butler behauptet aber, dass eine viel grundlegendere Herrschaftsstruktur dafür verantwortlich ist, dass Männer als Männer und Frauen als Frauen überhaupt erst denkbar werden. Dafür sei eine ständige Aussonderung des "Abweichenden" erforderlich. So sei Heterosexualität kein Naturphänomen, sondern eine rigide Norm, die auch unserer Vorstellung von der Natürlichkeit zweier Geschlechter zugrundeliegt. Für die Durchsetzung dieser heterosexuellen Norm sei beispielsweise die Verwerfung von Homosexualität Voraussetzung; z.B. indem sie als krank oder pervers konstruiert wird. Dass das Geschlecht sozial konstruiert ist, heißt für Butler nicht, dass Menschen ihr Geschlecht wählen und wechseln können wie Jacke oder Hose. Aber es wird eben nicht als Effekt von Natur, sondern als Effekt von Herrschaft gedacht. Notwendig, aber nicht hinreichend Kritik von Identitätspolitik ist aus dieser Sicht Herrschaftskritik. Denn die "Verwerfungslogik" ist nicht nur für die heterosexuelle, sondern für jede Identitätsbildung Bedingung. Und jede als unumstößlich behauptete Identität bildet sich demnach vor einem unsichtbaren Schatten ab, der für die Identität bedrohlich wird, sobald er sein Schattendasein verlässt. Die schwarze, die behinderte, die lesbische, die bisexuelle, die transsexuelle, die nicht-westliche Frau, aber auch die weiße Mittelschichtsfrau, die vom Kapitalismus, vom Klassensystem, vom institutionalisierten Rassismus usw. profitiert - und viele mehr bevölkerten und bevölkern den Schatten der universalen feministischen Identität "Frau". Deshalb ist Kritik an Identitätspolitik vor allem eine Kritik an Ausschließungsverfahren und zwar gerade an solchen, die nicht auf den ersten Blick offensichtlich sind. Kritik an Identitätspolitik bedeutet den Abschied von der Idee, es gäbe ein einziges Unterdrückungssystem, das alle anderen dominiert und Kritik an Identitätspolitik bedeutet, sich zu weigern, gesellschaftliche Positionierungen, egal welcher Art, als irgendwie "natürlich" zu denken. Es bedeutet, den Grund für gemeinsames politisches Handeln nicht primär in der Vergangenheit, dem gegebenen, "natürlichen" Band zu suchen, das die einzelnen verbindet, sondern in der Zukunft, in den gemeinsamen politischen Zielen. Aber umgekehrt ist Kritik an Identitätspolitik alleine noch kein Programm. Sie ist kein Garant für besonders progressive Politik. Und auch das ist logisch. Denn Kritik von Identitätspolitik ist Kritik an totalisierenden Denk- und Praxisformen. Deswegen kann sie umgekehrt nicht dazuführen, prinzipiell jede Form von Identitätspolitik für unmöglich zu erklären. Bestimmte historische Situationen erfordern gerade das Sprechen über Identität als Bedingung für politische Artikulation. Doch dieses Sprechen sollte offen bleiben dafür, von innen heraus in Frage gestellt zu werden. Es sollte sein eigenes Verschwinden als klares Ziel vor Augen haben. Identitätspolitik wäre dann nie mehr als der bewusst einkalkulierte, vorübergehende Effekt strategischer Entscheidungen, die unter absolutem Verzicht auf absolute Wahrheiten gefällt werden. Alle hier behandelten Probleme hatte und hat die gemischte Linke selbstverständlich auch. Während die Debatte in der Frauenbewegung schließlich auch intensiv geführt wurde, konnten sich ihr viele männliche Linke bis heute erfolgreich entziehen. Und das ist ein Grund, auf feministische Organisierung nicht zu verzichten, ebenso wie die Erkenntnis, dass Männer für die Abschaffung materieller Ungleichheit entlang der Geschlechtergrenze in der Regel wenig Einsatz an den Tag legen. Oder, wie Judith Butler sagt, der Feminismus braucht die Frauen, aber er muss nicht wissen, wer sie sind. Stefanie Gräfe ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis / Nr. 531 / 19.9.2008 Neoliberaler Feminismus und konservative Weiblichkeit Über die neuen Erbinnen der Frauenbewegung Der Begriff des Feminismus war in Deutschland in den letzten 15 Jahren zunehmend zum Schimpfwort geworden. Im Zuge der Debatten um eine neue Familienpolitik hat sich diese diskursive Großwetterlage verändert. Der Ruf nach einem "neuen" Feminismus erschallt aus der gesellschaftlichen Mitte. Damit verändert sich auch seine Bedeutung: Mit der zweiten Frauenbewegung war seit den 1970er Jahren eine Verknüpfung des westdeutschen Feminismus mit der politischen Linken hegemonial geworden. Zurzeit reetabliert sich ein liberaler Feminismus, der sich als "neuer" gegen dieses Verständnis von Feminismus abgrenzt. Eine linke Hegemonie innerhalb des deutschen Feminismus rückt in weite Ferne. Die von Renate Schmidt angestoßene und von Ursula von der Leyen fortgeführte Wende in der deutschen Familienpolitik wird weithin als Bruch mit den bisherigen Geschlechterleitbildern wahrgenommen. Die Kämpfe um neue Geschlechterleitbilder und Ernährermodelle beschränken sich nicht auf Diskussionen um die konkret verabschiedeten und geplanten Maßnahmen, sondern finden ebenso im Bereich der populären politischen Literatur statt. Dort wird vor allem um die Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit sowie damit einhergehende Modelle gesellschaftlicher Arbeitsteilung gestritten. Die diskursiven und institutionellen Brüche in der deutschen Familienpolitik haben ein gewaltiges Echo in der öffentlichen Diskussion. Fast wöchentlich erscheinen Publikationen, die jeweils einen neuen Vorschlag für die Neuverteilung der Arbeit zwischen den Geschlechtern präsentieren. Dabei haben sich zwei Hauptgruppen herausgebildet: (1) Die erste Gruppierung thematisiert als Antwort auf die neue Familienpolitik die Doppelbelastung von Frauen aus konservativer Perspektive. Gründungsmanifest ist der Bestseller der ehemaligen Fernsehmoderatorin Eva Herman, Das Eva-Prinzip. (2) Die Protagonistinnen der neuen F-Klasse (nach dem gleichnamigen Buch von Thea Dorn) unterstützen im Wesentlichen die Familienpolitik von von der Leyen und sehen mit der Kanzlerschaft von Angela Merkel ein Signal für einen neuen Feminismus, der sich gegen Tendenzen zu einem geschlechterpolitischen Rollback zur Wehr setzen muss. Sie reagieren zugleich auf die von der Gruppierung um Eva Herman vorgebrachten Positionen. Im Folgenden sollen die Positionen dieser beiden Gruppierungen kurz vorgestellt und die damit einhergehende Positionsverteilung beschrieben werden. Eva Herman sieht die Feministinnen als kinderlose und tendenziell homosexuelle Verführerinnen der Mehrheit der Frauen, die sie ins Unglück und zum Verlust ihrer Weiblichkeit führen. Dies geschehe durch eine Angleichung an die Männer und die Teilnahme am Erwerbsleben. Dieselbe Entwicklung sei verantwortlich dafür, dass immer weniger Frauen Kinder bekommen. Herman kritisiert den Zwang zur Erwerbsarbeit (für Frauen); die "natürliche" Weiblichkeit werde dem Streben nach Gewinn geopfert. Als Ausweg aus der Doppelbelastung propagiert sie eine Rückkehr zu den traditionellen Geschlechterrollen, die sie religiös - "wir wurden vom Schöpfer mit unterschiedlichen Aufträgen in diese Welt geschickt" (2005, 46) - und biologistisch begründet: "Die Weigerung, ein Leben als Hausmann zu führen, ist nicht etwa ein Zeichen für mangelnde Vaterliebe, sondern sie entspricht einfach dem natürlichen Rollenverhalten." (82) Eva-Prinzip versus neue F-Klasse Hermans "Gegenentwurf zur Ich-Gesellschaft" (55) kombiniert eine romantische Kritik des Kapitalismus mit einem Differenzdenken, in dem Frauen für Familie und menschliche Werte zuständig sind. Werden Frauen in den Beruf integriert und dadurch "vermännlicht", so müssten notwendigerweise auch die menschlichen Werte verschwinden. Durch die Gleichsetzung von Ökonomie und Konkurrenzdenken erübrigt sich dann auch die Frage, wie ökonomische Verhältnisse demokratisiert und "vermenschlicht" werden könnten. Herman teilt mit Christa Müller den Befund, dass das Ansehen der Hausfrauentätigkeit systematisch entwertet wurde und wieder aufgewertet werden müsse. Müller ist familienpolitische Sprecherin der Linkspartei im Saarland, kooperiert aber ebenso wie Herman mit dem rechtskonservativen Familiennetzwerk. Konsequenterweise ist ihr Buch "Dein Kind will dich" (2007) im St. Ulrich Verlag des Augsburger Bischofs Walter Mixa erschienen. Ihrem Anspruch nach vertritt Müller aber linke Positionen. Sie wendet sich gegen die öffentliche Betreuung von unter dreijährigen Kindern. Zum anderen wendet sie jedoch ein, dass die höhere Erwerbsquote von Frauen für die Senkung der durchschnittlich gezahlten Löhne instrumentalisiert wird und dass die bestehende Arbeitsteilung bei nicht entlohnter Arbeit Frauen ausbeutet. Müller begrüßt die von der Frauenbewegung in den 1980er Jahren geforderte Einführung des Sechs-Stunden-Tags, die eine gleiche Beteiligung von Männern und Frauen an allen Arbeiten ermöglichen kann. Da der Sechs-Stunden-Tag jedoch nicht durchgesetzt werden konnte, sind die Frauen in den Gebärstreik getreten: "Der Gebärstreik in Deutschland ist ein Anzeichen dafür, dass Frauen immer weniger bereit sind, unentgeltlich Fürsorge- und Erziehungsarbeit zu leisten." (140) Müller steht anders als Herman dem Feminismus nicht feindlich gegenüber, sieht es aber als "Fehler der Frauenbewegung, die Befreiung der Frau vor allem durch die Gleichstellung im Erwerbsleben herstellen zu wollen." (136) Sie plädiert einerseits für die Gleichstellung der Frauen innerhalb der Erwerbsarbeit, aber zugleich für eine Gleichstellung von Erwerbsarbeit und "Arbeit der Frauen in den Privathaushalten" (ebd.). Daraus resultiert ihre Forderung danach, Hausarbeit durch ein "Erziehungsgehalt" (178) wie Erwerbsarbeit zu entlohnen und sozial abzusichern. Müllers Anliegen ist es, das "Wohl der Kinder" und "die Familie" angesichts von längeren Arbeitszeiten und unsicheren Arbeitsverhältnissen zu retten. Die durch von der Leyen vertretene Strategie wird Müllers Meinung nach nicht aufgehen, da sie die Doppelbelastung verstärkt. "Dass Frauen in einem Vollzeitberuf ihr eigenes Geld aus Gründen der Existenzsicherung verdienen müssen oder aus Gründen der Unabhängigkeit verdienen wollen und darüber hinaus als Mutter ganz überwiegend die unbezahlte Haus- und Erziehungsarbeit leisten und erstens zuwenig Zeit für ihre Kinder haben und zweitens kaum noch über Freizeit und Erholungszeit verfügen: für diesen Lebensentwurf kann man sich doch nicht allen Ernstes einsetzen." (125) Ihrer Ansicht nach werden sich die Frauen dagegen wehren: "Der Gebärstreik wird sich fortsetzen." (180) Die in vielen Aspekten divergenten Ansätze von Herman und Müller teilen das Anliegen, die bestehende oder drohende Doppelbelastung von Frauen durch mehr Zeit für Kindererziehung im häuslichen Rahmen abwenden zu wollen. Mit einem konservativen Fokus auf Familie als Selbstzweck wird die Verknüpfung der etablierten Gleichstellungspolitik mit Klassenherrschaft thematisiert, die sich darin auswirkt, dass Freizeit immer knapper wird und die kommerzielle und die nicht entlohnte Pflegearbeit für Kinder und SeniorInnen unter immer prekäreren Bedingungen verrichtet wird. Mit dieser Positionierung stellen sich Herman und Müller tendenziell gegen den überfälligen Ausbau der Kinderbetreuung und eine gerechtere Aufteilung der Geschlechterrollen, da sie die im Familienernährermodell vorgesehene größere Absicherung, was Wohlstand und Freizeit angeht, der Flexibilisierung der mit diesem Kompromiss verbundenen Geschlechterhierarchie vorziehen. Als Verteidigerinnen der neuen Familienpolitik treten die Krimiautorin Thea Dorn und die Unternehmensberaterin und FDP-Politikerin Silvana Koch-Mehrin auf. Beide richten sich gegen die geschlechtsspezifischen Hierarchien in allen Bereichen der Gesellschaft, vor allem in der Erwerbsarbeit. Sie haben als erfolgreiche Frauen die berühmte "gläserne Decke" selber kennen gelernt und plädieren für einen Aufbruch starker Frauen. Dorn betont, dass der Geschlechterkampf keineswegs vorbei ist und dass nach den Kämpfen um rechtliche Gleichstellung eine neue Form des Feminismus geschaffen werden muss. "Ein neuer Begriff muss gefunden werden für Frauen, die neue Wege zwischen Feminismus und Karriere gehen [...] Warum nicht zugeben, dass es in diesem Buch nicht um Frauensolidarität um jeden Preis geht, sondern um eine bestimmte Klasse von Frauen, die sich allerdings nicht durch ihre privilegierte Herkunft definiert, sondern einzig und allein durch das individuell von ihr Erreichte und Gelebte?" (37) Dorn richtet sich gegen die "öffentlichen Gebäraufrufe" (311) wie gegen die Vorstellung, dass sich Kindererziehung und Berufskarriere nicht vereinbaren lassen. Der Kampf um Emanzipation wird bei ihr individuell geführt und stellt keine Forderungen an Politik und Gesellschaft. Es geht um die Emanzipation und Gleichstellung der Frauen und Männer, die sie sich "leisten" können - im durchaus doppelten Sinn des Wortes. Die strukturellen Zwänge sollen durch eine kollektive Willensanstrengung durchbrochen werden, da es nach Dorn dumme und böswillige Personen beiderlei Geschlechts sind, die diese Zwänge aufrechterhalten - und nicht Strukturen, die politisch verändert werden können. Betreutes Wohnen für männliche Erwachsene Silvana Koch-Mehrin, Unternehmensberaterin und FDP-Abgeordnete im Europaparlament, plädiert für einen neuen "Feminismus mit den Männern" (16), der sich gegen die "Retro-Sehnsucht" und die "Rückbesinnung auf die guten alten Zeiten" wendet, "als Muttern noch fürs traute Heim und Vater für das nötige Kleingeld sorgte." (12) Sie arbeitet heraus, wie rückständig die Geschlechterbilder in Deutschland im europäischen Vergleich sind und lastet dies den "politischen Strukturen" und der "deutschen Muttertümelei" (19) an. Die Unterstützung des männlichen Ernährermodells durch das Ehegattensplitting findet sie grotesk und die Hausfrauenehe ist für sie "eine gediegene Form des betreuten Wohnens für männliche Erwachsene" (23). Für genauso absurd hält sie den Vorschlag, Hausarbeit staatlich zu entlohnen, da die Arbeitsteilung im Haushalt von jedem Paar eigenständig verabredet werden könne. Koch-Mehrin führt die verschiedenen Hindernisse für eine gleichberechtigte Partizipation von Frauen an: den segregierten Arbeitsmarkt, die geschlechtsspezifische Berufswahl, die Lohndifferenz zwischen Frauen und Männern sowie die Rituale und Verhaltensweisen von Männerbünden. Um dagegen anzugehen, erklärt sie die Volkswirtschaft zur Verbündeten im feministischen Kampf: "Denn die Ökonomie ist eine Schwester! [...] Es ist nicht nur für die Beziehung, sondern in der Tat für die ganze Volkswirtschaft besser, wenn qualifiziertere Frauen Karriere machen und weniger qualifizierte Männer zu Hause anpacken." (161) Koch-Mehrin fordert dementsprechend "eine weibliche Kaderschmiede" (193), mehr Frauennetzwerke und Frauenquoten in der Politik. Geschlechterpolitisch gehen ihre Forderungen weit über die konkreten Projekte des Familienministeriums hinaus. Dennoch fällt auf, dass die bessere Integration von Frauen in Erwerbsarbeit im Zentrum steht. Die Arbeitsteilung im Haushalt bleibt weitgehend ein "privates" Thema, das der politischen Regulierung entzogen bleibt und die Geschlechterdifferenzen auf dem Arbeitsmarkt werden nicht im Zusammenhang mit dem dominanten Arbeitszeitmodell gesehen. Die hier vorgestellten vier Autorinnen ordne ich im Folgenden zwei Richtungen zu: Herman und Müller bilden das Lager der konservativen RomantikerInnen und Dorn und Koch-Mehrin ordne ich dem liberalen Feminismus zu, den auch von der Leyen vertritt. Die konservativen RomantikerInnen zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Doppelbelastung von Frauen und die Ausdehnung der in Familien geleisteten Erwerbsarbeit im Namen einer von diesen Zwängen relativ abgeschotteten Familienwelt kritisch betrachten. Der liberale Feminismus wendet sich gegen geschlechterhierarchische Strukturen und den nostalgischen Blick zurück auf die Hausfrauenehe. Die Emanzipation soll in neuer Form weitergeführt werden, beschränkt sich jedoch wie die herrschende Familienpolitik auf Maßnahmen, in deren vollen Genuss nur die relativ Privilegierten kommen würden. Mit der Herausbildung dieser zwei (die Diskussion um Familienpolitik dominierenden) Richtungen ergibt sich die Situation, dass Gleichstellung mit Neoliberalismus und Elitenorientierung, tradierte Geschlechterhierarchien dagegen mit einem Widerstand gegen die zunehmenden Marktzwänge artikuliert sind. Bezeichnenderweise ist es dem "alten", linken und herrschaftskritischen Feminismus nicht gelungen, innerhalb dieser Debatte massenwirksam Position zu beziehen. (1) Dessen Bastionen wurden in zweifacher Weise geschleift: Die liberalen Feministinnen haben erfolgreich die Position des Feminismus und die damit verbundene Forderung nach Gleichstellung besetzt, die konservativen RomantikerInnen die Klage über die Doppelbelastung von Frauen und die zunehmenden Marktzwänge. Damit ist die Kritik der Herrschaftsstrukturen, die in den gesellschaftlichen Arbeitsteilungen zur Geltung kommen, auf zwei Positionen innerhalb des etablierten Herrschaftsgefüges aufgespalten. Ein linker Feminismus steht vor der doppelten Aufgabe einer Verteidigung der begrenzten Fortschritte, die mit der neuen Familienpolitik verbunden sind, gegen die konservativen RomantikerInnen sowie einer offensiven Kritik des klassenselektiven Charakters des liberalen Feminismus und der neuen Familienpolitik. Die neue Familienpolitik ist in die klassenpolititische Strategie der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik und den damit verbundenen Abschied vom bundesdeutschen Korporatismus eingebettet. Die mit dieser Mischung aus Zwängen und Anreizen verbundene ökonomische Strategie hat die politische Funktion, Konsensbasen in der Bevölkerung auszubauen. Über die gezielte materielle Förderung bestimmter Gruppen hinaus hat die neue Familienpolitik die Wirkung, dass Anliegen von erwerbstätigen Frauen und ein modernisiertes Geschlechterbild symbolisch durch die Regierungspolitik vertreten werden. Familienministerin von der Leyen spricht dementsprechend im Namen aller Frauen und ihrem Anspruch auf eigenständige Erwerbstätigkeit und verbindet diese Anrufung mit dem Idealbild des heterosexuellen Paares, das Kinder aufzieht (von der Leyen/von Welser 2007). Die hegemoniale Familienpolitik tritt symbolisch als Schutzmacht aller Frauen auf, verwirklicht aber faktisch einen "Feminismus der Besserverdienenden". Getrennte Kritiken zusammenführen An der aktuellen Artikulation von Gleichstellungspolitik und Klassenherrschaft wird deutlich, dass jedes politische Projekt, auch das des Feminismus und der Gleichstellungspolitik, umkämpft ist: Es wird sowohl von den Herrschenden wie von den Subalternen reklamiert. Und es gibt keine notwendige Verbindung zwischen den neuen sozialen Bewegungen der 1970er Jahre (Feminismus, Ökologie, Antikolonialismus) und linken, progressiven Bewegungen. Im Deutschland des 21. Jahrhunderts zeichnet sich ab, dass das in den 1990er Jahren erneuerte, aber bereits in Bezug auf Einfluss und Massenbasis geschwächte Projekt des Feminismus innerhalb weniger Jahre durch neoliberale Kräfte innerhalb und außerhalb der Regierung hegemonial artikuliert wurde. Eine herrschaftskritische, mit dem Feminismus einstmals verbundene linke Position ist damit so weit marginalisiert, dass Gleichstellungspolitik als neoliberales Projekt der Flexibilisierung der Familien- und Erwerbsarbeitsstrukturen identifiziert wird. Diese Tendenz wird dadurch verstärkt, dass die öffentlich wahrnehmbare Kritik der sozialen Selektivität der neuen Familienpolitik durch antifeministische und/oder am Familienernährermodell orientierte Akteure vertreten wird. Nicos Poulantzas hat in seiner Analyse der neuen sozialen Bewegungen die These vertreten, dass diese Bewegungen universalistische, d.h. hegemoniale Perspektiven entwickeln müssen, wenn sie der Gefahr entgehen wollen, als partikularistische Ein-Punkt-Bewegungen in die neu entstehende Staatsform nach der Krise des Wohlfahrtsstaates integriert zu werden (1979a, 135; 1980a, 61). Knapp 30 Jahre später ist dieser Prozess im Fall der Frauenbewegung abgeschlossen, da - auch aufgrund mangelnder Bündnispartner und einem Niedergang der sozialen Bewegungen in Westeuropa - eine hegemoniale Artikulation mit anderen progressiven Bewegungen nicht möglich und/oder von einer oder von beiden Seiten nicht gewollt war. An die Stelle einer Bündelung verschiedener Anliegen, einer in den 1970er und 1980er Jahren diskutierten "transversalen" Politik ist die Professionalisierung und Filterung der je einzelnen Anliegen sozialer Bewegungen in den NGOs getreten. Die Ausarbeitung alternativer hegemonialer Ansprüche in den oppositionellen Bewegungen kann ein Gegenmittel gegen die korporatistische Tendenz sein, soziale Bewegungen in das System zu integrieren. In der aktuellen Situation, in der es nur sehr schwache und relativ fragmentierte linke soziale Bewegungen in Deutschland gibt und daher die Rekonstruktion eines gegenhegemonialen Blocks zu den langfristigen politischen Aufgaben gehört, stellt sich für einen linken Feminismus die Aufgabe (sofern er nicht als Teil des neoliberalen Machtblocks wahrgenommen werden will und weitergehende politische Ansprüche hat), sich als politisches Projekt gegen den liberalen Feminismus zu konstituieren, indem die in der aktuellen Konstellation getrennten Kritiken der beiden wichtigsten Modi von gesellschaftlicher Arbeitsteilung neu zusammen geführt werden. Das durch den liberalen Feminismus und die konservativen RomantikerInnen besetzte Terrain kann nur durch eine Kritik zurückerobert werden, die gleichermaßen geschlechtsspezifische und klassenbezogene Hierarchien thematisiert. Jörg Nowak Anmerkungen: 1) Im aktuellen Buch der von den herrschenden Gruppen kooptierten Alice Schwarzer ist in etwa soviel Kritik am neoliberalen Charakter der neuen Familienpolitik zu finden wie in dem von Silvana Koch-Mehrin. Schwarzer erwähnt zwar ähnlich wie Müller, dass eine 30-Stunden-Woche die einzige Lösung für Eltern sei (2007, 92), insgesamt bleibt dies jedoch ein Randthema. In der Print-Ausgabe der analyse & kritik ist eine gekürzte und leicht überarbeitete Fassung dieses Artikel erschienen. Literatur Dietrich, Anette: Weiße Weiblichkeiten. Konstruktionen von "Rasse" und Geschlecht im deutschen Kolonialismus, Bielefeld 2007 Dorn, Thea: Die neue F-Klasse. Wie die Zukunft von Frauen gemacht wird, München-Zürich 2006 Herman, Eva: Das Eva-Prinzip. Für eine neue Weiblichkeit, unter Mitarbeit von Christine Eichel, München 2006 Koch-Mehrin, Silvana: Schwestern. Streitschrift für einen neuen Feminismus, Düsseldorf 2007 Müller, Christa: Dein Kind will dich. Echte Wahlfreiheit durch Erziehungsgehalt, Augsburg 2007 Poulantzas, Nicos: ",Es geht darum, mit der stalinistischen Tradition zu brechen!'", in: Prokla 37, 1979, 9. Jg, H. 4, 127-140 ders.: "Marxismus zwischen Sozialdemokratie und ,realem Sozialismus'", in: J. Bischoff, J. Kreimer (Hg.): Annäherungen an den Sozialismus, Hamburg 1980, 55-74 Schwarzer, Alice: Die Antwort, Köln 2007 Von der Leyen, Ursula/ Von Welser, Maria: Wir müssen unser Land für die Frauen verändern, München 2007 ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis / Nr. 558 / 18.2.2011 Queer, flexibel, erfolgreich Haben dekonstruktive Ansätze den Feminismus entwaffnet? Der Feminismus - verpoppt, verflacht, verwässert? Die dekonstruktiven Gender Studies klagen zu Unrecht über die Transformation des Feminismus in ein popkompatibles Lifestyle-Projekt, meint Tove Soiland. Denn sie haben die Frage nach der Position der Frau in der kapitalistischen Ausbeutung selbst durch die Kritik an rigiden Geschlechternormen ersetzt und damit ökonomische Verhältnisse in kulturelle Zuschreibungen umgedeutet. Die dabei propagierten queeren Lebensweisen entsprächen perfekt den Bedürfnissen des flexiblen Kapitalismus. Dass sich die Verwendung von Begriffen nicht reglementieren lässt, wissen wir spätestens seit den Lektionen der Dekonstruktion. Ein Begriff, der das gewissermaßen am eigenen Leibe erfahren muss, ist sinnigerweise der Feminismus selbst. Er taucht heute an vielen verschiedenen Orten auf, an zu vielen, wie manche meinen. Feminismus ist sexy, macht das Leben schöner, will sich dem in der Pharmaindustrie tätigen Globalplayer ebenso andienen wie der selbstbewussten Karrierefrau. Er hat Bravo in Missy Magazine verwandelt und dient Ladies Drive, dem "weltweit ersten Frauenmagazin für Business and Cars", als ultimativer Kick. Und nicht zuletzt ist er für die Wohlfahrtsstaatsreformer zur Leitdisziplin ersten Ranges aufgestiegen: Frauen auf den Arbeitsmarkt! Was also will eine altgestandene Feministin mehr? Gender Studies beklagen Postfeminismus - warum? Beim neuen oder "Postfeminismus" handle es sich, so lassen die Gender Studies verlauten, mindestens um eine Verflachung oder Verwässerung der ursprünglichen Anliegen, wenn nicht gar um ihre Entwendung. Zwar würden durchaus einzelne Elemente des Feminismus aufgenommen, doch nur, um den Feminismus als solidarisches Projekt umso nachhaltiger abzuwickeln. Mit Erstaunen nimmt man zur Kenntnis, wer hier nun plötzlich den Feminismus verteidigt. Erstaunlich ist das deshalb, weil bis vor kurzem, sagen wir bis vor ca. fünf Jahren, Feminismus an den universitären Gender Studies das Buhwort schlechthin war. Eine Gedächtnislücke? Ein Missverständnis? Um welchen Feminismus handelt es sich? Nehmen wir ein viel beachtetes Buch zur Hand: Angela McRobbies "Top Girls", das im letzten Jahr auf deutsch übersetzt wurde. Ohne McRobbies empirische Leistungen auch nur im Geringsten schmälern zu wollen, verblüfft das Buch durch eine eindrückliche theoretische Ungereimtheit. Es durchstöbert akribisch die mannigfaltigen postfeministischen Phänomene, die sich in Regierungsprogrammen und in der Popkultur finden. Seine theoretische Bezugsgröße bleibt dabei ganz arglos: Judith Butler. Kein Wort dazu, dass ihre frühen Schriften als die ersten theoretischen Manifeste des Postfeminismus galten. Zwar wird an zwei Stellen die theoretische Selbstabschaffung des Feminismus an den Universitäten erwähnt, doch es folgt keine Reflexion darüber, was diese beiden Dinge miteinander zu tun haben könnten oder ob nicht möglicherweise das Eine dem Andern Vorschub leistete. Stattdessen stoßen wir auf die etwas gewagte These, die symbolische Ordnung fühle sich von Judith Butlers Schriften herausgefordert und integriere Teile ihrer Heterosexualitätskritik, um sie so zu entschärfen. Mit dieser Deutung reagiert McRobbie auf den für jeden queerfeministischen Standpunkt schwierigen Umstand, dass sich Judith Butlers These von der heterosexuellen Matrix als unserem Unterdrücker Nummer eins angesichts der weit reichenden Liberalisierung sexueller Verhaltenweisen heute kaum mehr aufrechterhalten lässt. Die Argumentation wirkt hilflos, und sie ist symptomatisch. Denn sie verweist auf eine große theoretische Leerstelle in der ganzen gegenwärtigen Debatte und führt ins Zentrum einer brisanten Frage, die bereits eine Rezensentin in dieser Zeitung aufgeworfen hat. Die Frage nämlich, "wie es dazu kam, dass sich herrschaftskonforme geschlechterpolitische Stimmen heute in verschiedenster Weise als Erben der Frauenbewegung darstellen können" (ak 553). Blickt man auf die Theoriegeschichte des hier implizit als einzig möglich gesetzten Feminismus, dessen Hauptgegenstand die Kritik an der heterosexuellen Matrix und dessen wichtigstes Anliegen die Überwindung der Zweigeschlechtlichkeit ist, so wird man vielleicht eine Antwort auf genau diese Frage finden. Die Elemente, die hier als postfeministisch gebrandmarkt werden, entstammen im Wesentlichen ebendieser Theorie. Die Unterscheidung in einen guten theoretischen Postfeminismus und einen schlechten popkulturellen ist damit kaum haltbar. Werfen wir also einen Blick zurück. Das hier zur Diskussion stehende Verständnis des Feminismus ist im Rahmen der Cultural Studies in den USA entstanden, die sich seit den 1980er Jahren - in Absetzung von ihren eigenen Wurzeln - zunehmend in Distanz zu den gesellschaftstheoretischen Ansätzen des Marxismus brachten. Nicht die Analyse kapitalistischer Ausbeutungsverhältnisse und die spezifische Position von Frauen darin standen nun im Zentrum der Aufmerksamkeit, sondern die Befragung dieser Kategorien selbst. Leitend hierfür war eine Vorstellung von Herrschaftsverhältnissen, die die in ihnen wirksame Macht vor allem als Disziplinierung verstand oder, noch grundlegender: als Mechanismen, die bestimmte Subjektpositionen hervorbringt. Diese seien selbst noch in ihrer Physis als Effekt bestimmter normativer Anforderungen zu begreifen. Was so entstand, kann man mit Rosemary Hennessy als cultural materialism, als einen kulturellen Materialismus bezeichnen, der den historischen Materialismus des Marxismus ersetzte. In diesem Kontext waren es denn auch vor allem die Themen der sexuellen Unterdrückung, die in eine besondere Konkurrenz zum Marxismus traten; insbesondere die Vergeschlechtlichung von Subjektpositionen wurde als ein solch machtgeleiteter Prozess der Materialisierung aufgefasst. In der Folge wurden nicht nur Fragen der sexual politics, also der sexuellen Verhaltensweisen, Begehrensformen und Geschlechtsidentitäten, in der Tendenz wichtiger als Fragen der Ausbeutung. Sexuelle Verhältnisse wurden nun zunehmend nicht mehr in ihrer Wechselwirkung mit den Produktionsverhältnissen gesehen. Stattdessen fand eine Art Umschrift statt, die auch ökonomische Verhältnisse als Identitätszuweisungen umdeutete. Das geschlechtsspezfische Rollenverhalten, nicht die ökonomischen Verhältnisse, war nun plötzlich für die Ausbeutung verantwortlich. Dass Feminismus heute vor allem dies meint: sexual politics, und damit allzu selbstverständlich als Identitätspolitik erscheint, hat darin seinen Grund. Kulturelle Wende in der feministischen Theoriebildung Diese Verknüpfung von Feminismus mit sexual politics, um nicht zu sagen: die einseitige Verpflichtung des Feminismus auf dieses Projekt ließ erst die Frage des Subjekts des Feminismus und damit das solidarische Projekt - prekär werden. Dass die Dekonstruktion des feministischen Subjekts wichtiger wurde als die Artikulation einer nach wie vor bestehenden kollektiven Betroffenheitslage, ist nur im Kontext dieser spezifischen theoretischen Entwicklung an den Universitäten zu verstehen. Es war die explizite Frontstellung gegenüber dem Marxismus und seiner Analysen der Produktionsverhältnisse, die jene Betonung der Differenzen - plurale Identitätsformen und das Recht auf ihre Anerkennung - in den Mittelpunkt stellte. Die Analyse der Kapitalverhältnisse, die diese Lebensformen vielleicht erst ermöglichten, wurde darüber in den Hintergrund gedrängt. Dies beförderte jene Haltung, die wir nun als popkulturellen Lifestyle vor uns haben: eine etwas merkwürdig anmutende Feier sexueller Freiheiten, die sich auf das dem liberalen Gedankengut eigentümliche Recht auf Andersheit zu berufen scheint, das sich - infolge der strikten Abstinenz hinsichtlich kollektiver Forderungen - gleichwohl nicht um die materiellen Bedingungen kümmert, unter denen diese Andersheit verwirklicht werden kann. Queere Lebensweise passt perfekt zum Postfordismus Kommen wir auf die Frage zurück: Wie kam es dazu, dass sich Teile des Feminismus, etwa die gegen rigide Geschlechternormen gerichteten Strömungen, in die nach der Fordismuskrise begonnene Erneuerung des Kapitalismus so problemlos eingliedern ließen? Die Antwort ist: Weil sich die Analyse der Subjektivierungsweisen explizit davon löste, diese auf die Produktionsverhältnisse - und damit auf mögliche historische Veränderungen in ihnen rückzubeziehen. Im Rahmen dieser theoretischen Prämissen kann nämlich nicht mehr gefragt werden, ob das Instabilwerden von Identitäten, das in diesem Kontext als Errungenschaft der sexual politics und damit als Effekt politischer Kämpfe verstanden wird, nicht ganz einfach auf die veränderten Bedürfnisse des postfordistischen Akkumulationsregimes zurückzuführen ist. Nicht der Umstand, dass Subjektivierungsweisen thematisiert und politisiert werden, ist das Problem. Aber dass sich die theoretischen Konzepte, mit denen dies geschieht, explizit von der Analyse der Produktionsverhältnisse fern hielten - und damit deren postfordistischen Wandel nicht verstehen -, erklärt die postfeministische Passfähigkeit. Es kann sein, dass die heterosexuelle Norm dem sich herausbildenden Kapitalismus extrem behilflich war. Das Geschlechterregime des Postfordismus verlangt aber kaum mehr nach normierten Geschlechtsidentitäten, sondern fordert gerade deren Flexibilisierung ein. So betrachtet wäre die Popularität queerer Lebensweisen und deren Verankerung an den Universitäten selbst das Phänomen, das soziologisch zu untersuchen und zeitgeschichtlich zu verorten wäre. Überspitzt könnte man sagen: Die Vorstellung von der Dekonstruierbarkeit geschlechtlicher Positionen und damit von der Verhandelbarkeit des eigenen geschlechtlichen Seins ist selbst zu einer Subjektivierungsweise geworden, die, weit davon entfernt, subversiv zu sein, sich bestens in die Erfordernisse spätkapitalistischer Produktion einpasst, ja dieser am ehesten entspricht. Dies macht auch deutlich, warum es hier nicht einfach um die Synthese zweier Ansätze, sagen wir der Dekonstruktion und des historischen Materialismus, gehen kann. Festzustellen, dass diese Ansätze inkompatibel sind, ist deshalb nicht Dogmatismus. Man müsste vielmehr fragen, ob die stillschweigende Umdeutung ökonomischer Verhältnisse in kulturelle Zuschreibungen nicht ihrerseits dogmatisch ist. In gewisser Weise beansprucht sie, alles in sich integriert zu haben, weil sie, vermeintlich, immer schon eine Stufe tiefer ansetzt. Damit aber macht sie einen Fundierungsanspruch geltend. Eine merkwürdige theoretische Schlaufe, in die sich da das dekonstruktive Projekt verwickelt hat, ist es doch einmal ausgezogen, die Ausschlüsse der andern zu skandalisieren. Hegemonial ist dieses Projekt jedenfalls, denn neben ihm scheint nichts anderes mehr Platz zu haben. Außer eben die wilden und so betrachtet auch neckischen Blüten der postfeministischen Popkultur. Tove Soiland Tove Soiland ist Lehrbeauftragte an verschiedenen Universitäten und dankt den Studierenden des Seminars Postfeminismus an der Universität Hannover für die zahlreichen Diskussionen. ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis / Nr. 559 / 18.3.2011 Die Sehnsucht nach dem feministischen Hauptwiderspruch Eine Antwort auf Tove Soiland "Dekonstruktive Ansätze haben den Feminismus entwaffnet." Statt die Stellung der Frauen in der kapitalistischen Ausbeutung zu kritisieren, hätten sich die Gender Studies auf die Kritik geschlechtlicher Identitäten zurückgezogen, schrieb Tove Soiland in ak 558. Die queeren Konzepte passten perfekt zu den Markterfordernissen im flexiblen Postfordismus. Dieser These widerspricht Tim Stüttgen. Queere Lebensweisen seien nicht besonders erfolgreich, sondern besonders prekär. Und die Geschichte des Feminismus zeige: Anstatt vermeintliche Vereinheitlichungen anzustreben, sollten antisexistische Kämpfe aus einer Position vielfältiger Gender-Identitäten sprechen. Ich muss zugeben, ich habe Tove Soilands Artikel "Queer, flexibel, erfolgreich" in der letzten Ausgabe von ak mit einer Mischung aus Faszination und Enttäuschung gelesen. Grundsätzlich ist es sicher sinnvoll, die jüngeren Entwicklungen der Gender und Queer Studies mit marxistisch-feministischen Grundfragen zu konfrontieren. Das fade Ergebnis dieser an sich spannenden Konfrontation besteht darin, dass queere Politiken den Feminismus zersetzt hätten und ein neoliberales Erfolgprojekt seien. Diese Brandmarkung ist jedoch ebenso langweilig wie kurzsichtig. Soilands Kritik an queeren Konzepten ist altbacken Es gibt eine etwas zynische Anekdote zu einem Text des marxistischen Kulturkritikers Frederic Jameson. Um zwischen einer gehaltvollen und kritischen Moderne und einer angeblichen affirmativen und warenförmig geblendeten Postmoderne zu unterscheiden, betrachtet Jameson zwei Gemälde. Das erste Bild ist von Vincent Van Gogh, es zeigt zwei geschundene Arbeiterstiefel, die sofort auf den Zusammenhang von Kapitalismus, Arbeit und Alltag verweisen. Diesem Bild stellt James - als dialektisches Negativ und Zeugnis postmoderner Verblendung - eines von Andy Warhol gegenüber, das neonfarbene High Heels abbildet. Jamesons Urteil: Andy Warhols Bild sei oberflächlich und sensationsheischend wie die angeblich apolitische Postmoderne. Es dauerte nicht lange, bis queere Theoretikerinnen darauf hinwiesen, dass Warhols Bild die High Heels einer transsexuellen Sexarbeiterin abbildete. Ich würde diese Anekdote von der transsexuellen Sexarbeiterin gerne im Hinterkopf behalten, wenn ich Soilands Argumentation betrachte. Tove Soiland meint, die performative Wende der Gender Studies habe die materiellen Grundlagen des Feminismus untergraben. Durch Akademisierung und popkulturellen Hype habe sie die Subjekte feministischer Kämpfe in eine Vielzahl sozialer Positionen aufgesplittert; die feministische Kollektivität ist versaut. Schuld an dieser Fragmentierung sei die Dekonstruktion. Sie habe die Geschlechtskategorien und das System der Zweigeschlechtlichkeit dermaßen dekonstruiert, dass die gemeinsame Basis für feministische Kämpfe verschwunden sei. Alles, was übrig bleibe, seien selbstbezogene Individualismen: Popfeminismus und queerer Maskenball. Diese Diagnose ist falsch. Sicher kann die Vulgärnormalisierung der Theorien von Judith Butler, die in deutschsprachigen Kontexten zu beobachten ist, auch an ihre Grenzen kommen. Eine Theorie von Macht auf soziale Positionen und Geschlechter-Performanzen zu begrenzen, führt nicht immer weit genug. Ich gebe auch gerne zu, dass der akademische Alltag Disziplinen mit politischem Anspruch auf die Dauer selten gut tut. Doch die Dekonstruktion mit der Begründung zu verabschieden, dass sie die Formierung der Frauen zum kollektiven Subjekt verhindere, ist ungefähr so sinnvoll wie zu behaupten, dass die Dekonstruktion des Warenfetischs die Arbeiterklasse zerstöre. Ideologie- und diskurskritische Ansätze sollten eigentlich ohne Probleme mit kapitalismuskritischen und marxistischen Ansätzen Hand in Hand gehen. Wenn wir noch einmal an die transsexuelle Sexarbeiterin in Andy Warhols Kunstwerk denken, dann ist eines eindeutig: Die Transgender-Person gehört trotz glamouröser Farben und Oberflächen - ihrer High Heels oder anderer Teile ihres Körpers - nicht zu den GewinnerInnen des derzeitigen Systems. Weder geht es der Transgender-Person um einen Maskenball, wie es Soiland nahe legt, noch performt sie ihren Gender mit dem Ziel, subversiv zu wirken. Queere Lebensentwürfe sind prekär, nicht erfolgreich Der erste Teil von Soilands These, dass Befreiungskämpfe von 1968 für andere Lebens- und Arbeitswelten im Laufe der Zeit zu Bausteinen im Programm des Neoliberalismus wurden oder gar sein Erscheinungsbild prägten, ist noch nachvollziehbar. Dass jedoch gerade minoritäre und vormals ausgegrenzte Subjekte heute als angeblich flexible Markt-Gewinner auf der Bühne stehen, ist falsch. Transgender-Frauen, um bei dem Beispiel zu bleiben, sind nämlich nicht nur sehr häufig arbeitslos und in größeren Gruppen einzig in der Sex-Industrie anzutreffen. Sie sind offensichtlich prekär - sowohl in ihrer Geschlechterposition als auch in ihren Arbeitsverhältnissen. Diese Prekarität wegen einer Handvoll dekonstruktiver Phrasen zu einem neoliberalen Projekt zu erklären, ist vielleicht das brutalste Manöver Tove Soilands. Hier setzt sie gesellschaftliche Kämpfe mit den Folgen ihres Scheiterns gleich und erklärt darüber hinaus gleich noch VerliererInnen der gesellschaftlichen Ordnung zu ihren GewinnerInnen. Ebenso gut könnte man aus Gangster-Rap-Videos schließen, dass alle MigrantInnen schnelle Autos fahren und goldene Ketten tragen. Etienne Balibar hat einmal beschrieben, wie im Spätkapitalismus das widersprüchliche Gezerre um Identität doppelt gewaltvoll gestaltet wird. Einerseits fordert der Markt immer mehr Flexibilität. Andererseits verlangen der Staat und seine Institutionen von seinen BürgerInnen identitäre Vereindeutigung. Neue Formen der Überwachung der BürgerInnen als Konsum- wie als Staats-Subjekte entstehen synchron zu angeblich neuen Freiräumen der Handlungsfähigkeit. Wenn die entgrenzenden Kräfte des Neoliberalismus alte Geschlechterregime in Teilen wegspülen, kann das den meist unter Repression - nicht unter Erfolg - leidenden und lebenden Queers nur recht sein. Trotzdem ist es unwahr, den Neoliberalismus als endlose Welle polysexuellen Glücks zu beschreiben, von dem gerade Queers am meisten profitieren würden. Feminismus braucht Vielheit, keine falsche Einheit Leider wiederholt Tove Soiland mit ihren Thesen eine alte, ressentimentgeladene Argumentationsstruktur, die gerade die dogmatischeren Teile der Linke anfangs gegen feministische Positionen vorbrachten: Es ist die so altbekannte wie altbackene Aufteilung der Welt in Haupt- und Nebenwidersprüche, die sich in dem Artikel findet. Für Soiland scheint eine fast existenzialistisch gesetzte "Frage der Frauen" näher an der Realität zu liegen als queer-feministische Bündnispolitiken, die auf der Dekonstruktion der gegenwärtigen Zustände aufbauen und das Ziel verfolgen, aus einer Vielheit, nicht einer reduktiven Einheit von Positionen zu sprechen. Doch wieso sollten sich nur Frauen um die Abschaffung gesellschaftlicher Sexismen kümmern müssen? Gerade die Vielheit der Stimmen teilt der Feminismus mit dem Queerismus. Den Feminismus als eindeutig marxistisch und in Übereinstimmung mit der Kategorie einer weiblichen Arbeiterklasse zu erinnern, ist historisch falsch und wird seiner eigenen Mannigfaltigkeit nicht gerecht. Tim Stüttgen ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis / Nr. 560 / 15.4.2011 Die Care-Seite der Medaille Queer-feministische Perspektiven auf Kämpfe um Reproduktion Welchen Feminismus brauchen wir? Die Debatte um das Verhältnis queerer und feministischer Kämpfe begann mit Tove Soilands Kritik an dekonstruktiven Ansätzen. Tim Stüttgen widersprach. (siehe Kasten) Im dritten Beitrag schlagen die Autorinnen nun vor, das "entweder Queer oder Feminismus" in ein Sowohl-als-auch und Weder-noch zu verwandeln. Sie meinen: Linke Feministinnen sollten sich in die Kämpfe um die Organisation der Pflege- und Sorge-Arbeit einschalten - und zwar mit queer-feministischer Brille auf der Nase. Queer versus Feminismus? Die emanzipatorisch-feministische Bewegung befindet sich in der Krise, und das nicht erst seit gestern. Neoliberale Logiken haben feministische Forderungen in eine individualisierte "Chancengleichheit für alle" verwandelt, kritisiert Tove Soiland. Die Emanzipationsziele der Frauenbewegung sind kapitalistisch instrumentalisiert worden. Doch bei der Verteidigung materialistischer feministischer Ansätze gegen ihre neoliberale Umformulierung stellt Tove Soiland ausgerechnet "Queer" als eine Gefahr für feministische Kämpfe dar. Das ist historisch falsch, bewegungspolitisch rückschrittlich und irreführend. Wenn wir "Queer" also in den Mittelpunkt einer Diskussion um Feminismus, neoliberale Verwertungsmechanismen und Transformationsprozesse stellen, müssen auch die Entstehungszusammenhänge queerer Bewegungen ins Blickfeld rücken. Die Entstehung der Queer-Bewegung in den 1980ern Volker Woltersdorff hat im Jahr 2003 in der Zeitschrift Utopie kreativ die Entstehung der Queerbewegung im Kontext vielfältiger politischer Ansprüche und theoretischer Denkansätze beschrieben. Als sich die Bewegung in den 1980er Jahren in den USA formierte, war sie höchst widersprüchlich und eine gesellschaftliche Randerscheinung - und sie ist es heute noch. "Queer" war Ausdruck bewegungspolitischer Krisen, neuer Allianzen und der Radikalisierung von Teilen der Schwulen-, Lesben-, Trans- und Frauenbewegung. Die fortschreitende Institutionalisierung der Frauen-, Lesben- und Schwulenbewegung hatte eine Politik zur Folge, die vor allem auf Anerkennung durch den Mainstream zielte. Diese verbreitete Orientierung wurde von Teilen der Bewegung in Frage gestellt. Auch die homogenisierte Darstellung nicht-heterosexueller Lebensformen, die stillschweigend ihre weißen, mittelständischen und männlichen Vertreter zur Norm machte, rief Widerspruch hervor. Parallel entwickelten sich in organisierten feministischen Zusammenhängen heftige Auseinandersetzungen um Pornografie, Bisexualität, Promiskuität, Penetration, Sadomasochismus, Transphobie und normierte Verhaltenscodices. Viele Frauen, Lesben und Schwule, schreibt Volker Woltersdorff, sahen sich in den Bewegungen nicht mehr repräsentiert. Ein weiterer zentraler Grund für die Entstehung von Queer waren die sozialen Folgen der Aids-Epidemie: Das Stereotyp von der angeblichen Verbindung von Homosexualität und Krankheit wurde in den 1980ern wiederbelebt, Lesben und Schwule waren mit massiven homophoben Vorurteilen konfrontiert. Schwarze, Schwule, Prostituierte und Junkies wurden auf Grund ihres Lebensstils zu sogenannte Risikogruppen erklärt - und damit selbst für ihre Erkrankung verantwortlich gemacht. Queer ist eine Form der Bündnispolitik der Randständigen und AußenseiterInnen mit dem Wunsch, auf gesellschaftliche Normierungprozesse und Identitätspolitiken hinzuweisen. Als Instrumente der Politik bevorzugt Queer schrilles Auftreten und theatralische Performances wie Kiss-ins an öffentlichen Orten. Und auch heute gilt es, die emanzipativen Elemente einer Pluralisierung von Lebensformen (subversiv) zu nutzen. Wenn wir uns also neue Orte und Orientierungen feministischer Kämpfe erstreiten, dann mit der queeren Methode im Gepäck, "Frauen" nicht als homogene Gruppe zu verstehen, die heteronormative Matrix als gesellschaftlich konstruiert zu reflektieren sowie immer wieder temporäre Bündnisse für politische Projekte zu suchen. Schauen wir uns die aktuellen Kämpfe und Debatten um Reproduktionsarbeit und geschlechtsspezifische Arbeitsteilung an, dann mit einer queer-feministischen Brille, die die unterschiedlichen und komplexen Lebensbedingungen von Frauen in Reproduktionsverhältnissen in den Blick nimmt. Noch bis zum 25. April ist im Berliner Kunsthaus Bethanien die Ausstellung "Beyond Re/Production. Mothering" von Felicita Reuschling zu sehen. Die Ausstellung thematisiert das schwierige Verhältnis von Berufstätigkeit und Familie und zeigt deutlich, dass von einer Gleichstellung der Geschlechter auch im Postfordismus kaum die Rede sein kann. Reawyn Connell beschreibt das Zusammenspiel von Gender-Bewusstsein und neoliberaler Verwertung im Katalog zur Ausstellung: "Der Neoliberalismus weist eine Genderdynamik auf: die Fähigkeit, Geschlechterordnung zu konstruieren und zu rekonstruieren." Die scheinbare Ausdifferenzierung von Männlichkeits- und Weiblichkeitsbildern schafft neue Wege für Frauen auf dem Arbeitsmarkt, zieht aber zugleich die trügerische Annahme nach sich, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung sei aufgehoben. Im Bereich der Pflege-, Sorge- und Hausarbeit wird klar, dass Frauen auch im Postfordismus automatisch mit dem Arbeitsfeld der Mutter und Hausfrau in Verbindung gebracht werden. Dies geschieht klassenbedingt in unterschiedlicher Weise. Während Frauen aus den privilegierten Klassen sich für Haushalt und Kindererziehung eine ArbeitsmigrantIn einstellen, müssen Frauen aus den subalternen Klassen die eigene Arbeitskraft unter prekären Bedingungen vermarkten und gleichzeitig komplexe Reproduktionsanforderungen bewältigen. Die Situation von Angehörigen der mittleren Klassen ist ambivalenter, ein Balanceakt zwischen Reproduktionsanforderungen und Beschäftigungsverhältnissen. Glaubt man postoperaistischen TheoretikerInnen, so befinden wir uns im Zeitalter post-geschlechtlicher Arbeitsteilung. "Affektive Arbeit" dominiere den neoliberalen Kapitalismus. Ehemals war sie "Frauenarbeit", nun sei sie die neue Form der Lohnarbeit schlechthin. Sie trage zwar noch vermeintlich weibliche Züge in sich, sei jedoch theoretisch als modernisierte Fabrikarbeit zu begreifen. Probleme der aktuellen Prekarisierung und Vermarktlichung von Reproduktionsarbeit lassen sich auf diese Weise nicht in den Blick nehmen. Bilder über die Widersprüche der Sorge-Arbeit Wie Silvia Federici im Rahmen der Ausstellung "Beyond Re/Production" zutreffend feststellt, verschleiert eine solche Betrachtung die Tatsache, dass zwischen den Metropolen und der Peripherie eine hierarchische Arbeitsteilung besteht und dass sich diese Arbeitsteilung mittlerweile auch auf die Reproduktionsarbeit erstreckt. Warum sind es immer öfter Care-ArbeiterInnen aus Osteuropa, Lateinamerika, dem globalen Süden, die hier unsere Reproduktionsarbeiten unter schlechten Bedingungen verrichten? Diese international ungleiche Verteilung und Prekarisierung von Versorgearbeit tritt derzeit immer deutlicher als "Care-Krise" hervor. Der neoliberale Kapitalismus stößt mit seinem Flexibilisierungsund Vermarktlichungsdrang bei dieser Form der Arbeit an Grenzen. Vor allem die emotionalen Anteile dieser Arbeit lassen sich nur bedingt rationalisieren: Ein pflegebedürftiger Mensch muss um eine bestimmte Uhrzeit essen und braucht dabei auch soziale Zuwendung. Durch die vermehrte Erwerbstätigkeit von Frauen, die Pluralisierung von Familienformen und den demographischen Wandel ist eine Lücke bei der Erledigung von Reproduktionsaufgaben aufgetreten. Diese Lücke wird durch prekäre und migrantische Arbeit überbrückt. In diesem Widerspruch bewegt sich auch die Queer-Bewegung. Doch bedeutet der Umstand, dass sowohl die Frauen- als auch die Queer-Bewegung diesen neoliberalen Dynamiken unterworfen ist, nicht, dass ihre Anliegen falsch sind. Wir denken, dass eine queer-feministische Kritikperspektive dann emanzipatorisch intervenieren kann, wenn sie das verbindet, was Queer und Feminismus aus einer linken Bewegungsperspektive ausmacht: wenn sie analysiert, wie bei Reproduktionsarbeit auf Grund zugeschriebenen Geschlechtsidentitäten unbezahlte oder schlecht bezahlte Arbeit verrichtet werden muss; und wenn sie Versorgungsarbeit als intersektionale Schnittstelle der Ungleichheit in den Blick nimmt, wie es einige aktuelle feministische Diskurse tun. Nein zur neoliberalen Ordnung der Reproduktion Wir möchten die Frage aufwerfen, ob nicht Debatten um Gerechtigkeit der Verteilung, Anerkennung und Teilhabe von, durch und an Versorgungsarbeit Gewinn bringend für eine queer-feministische sozialrevolutionäre Perspektive sein könnte. Ausgangspunkt einer solchen Debatte könnte ein fragender Prozess sein, der sowohl die auf der Vorderbühne agierenden Subjekte als auch die Hinterbühne der Institutionen und Kapitalverhältnisse betrachtet: Wer verrichtet wie welche Reproduktionsarbeiten, und welche Kategorien oder Ungleichheiten werden darin reproduziert? Wem wird dabei wie Anerkennung zu- und abgesprochen? Welche Möglichkeiten der Teilhabe können sich eröffnen und für wen? Wo könnte eine linke Bewegung ansetzen? Wir schlagen vor, auf dem Feld der Reproduktionsverhältnisse soziale Kämpfe (z. B. die internationalen MigrantInnenstreiks) von partikularistischen (z. B. wenn ver.di einen Mindestlohn für Pflegedienste verhandelt) zu unterscheiden und vor allem in erstere zu intervenieren. Trotzdem sollten partikularistische Kämpfe nicht völlig aus dem Blick geraten, da auch aus ihnen soziale Kämpfe um alternative Reproduktionsweisen entstehen können. Wichtig ist ein kollektives, öffentliches Nein zur neoliberal-kapitalistischen Ordnung der Reproduktion. Hierbei können queere Bündnispolitiken und durch sie eröffnete Vielfältigkeiten eine wichtige Inspirationsquelle sein, sind doch das Anzweifeln heteronormativer Herrschaft, die Verunsicherung von Geschlechter-, Macht-, und Herrschaftsverhältnissen und das Streben nach Souveränität über das eigene Leben ihnen zentrale Anliegen. In Anlehnung an Silvia Federici sehen wir es als wichtig an, Reproduktionsverhältnisse weltweit zu entprivatisieren und zu kollektivieren. Dabei ist zentral, auf welche Ressourcen ein solches Projekt zurückgreift. Wir stellen uns keine "kommunistischen Inseln im kapitalistischen Gesamtwahnsinn" vor (wie es etwa Konzepte des community gardening und andere tun), sondern neue Reproduktionsräume, die sich aktiv die Ressourcen des Staates und des Marktes zurück erobern. Wie es an diesem Punkt weitergehen könnte, hat Silvia Frederici offen gelassen. Damit hat sie den Raum für eine spannende Diskussion um die sozialrevolutionäre Vergesellschaftung von Versorgungsarbeit geschaffen. Eine solche könnte z. B. mit dem Aufbau von stadtteilübergreifenden sozialen Reproduktionszentren, vergleichbar den selbstorganisierten communities of care, beginnen. Lea Steinert, Kristin Ideler ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis / Nr. 561 / 20.5.2011 Die Befreiung einiger auf Kosten vieler Queer-Feminismus kommt ohne Kritik an Rassismus und Postkolonialismus nicht aus Die Debatte um Feminismus und Dekonstruktivismus läuft weiter. Begonnen hatte diese in ak 558 mit einer Kritik dekonstruktivistischer Ansätze durch Tove Soiland, weitere Beiträge folgten. (siehe Kasten) Feministische Gesellschaftskritik braucht jedoch auch queere, postkoloniale und rassismuskritische Blickwinkel, meint Nadine Lantzsch. Sie räumt mit dem Missverständnis auf, bei der Dekonstruktion von Kategorien gehe es um deren Abschaffung. Hat sich Feminismus mit der Etablierung postmodernen Denkens sein gesellschaftskritisches Moment genommen? Tragen Queer Theory und das Streben nach Dekonstruktion von Geschlecht zur Dethematisierung patriarchaler Gewaltverhältnisse innerhalb neoliberal-kapitalistischer Gesellschaften bei? Tove Soiland beantwortet diese Fragen in ak 558 positiv. Sie fordert die Rückbesinnung auf radikale Ökonomiekritik samt Wiedereinführung des Kollektivsubjektes "Frau". Dabei bedient sich Soiland in ihrer Argumentation gegen Queer nicht nur einer dominanten Geschichtsschreibung über Feminismus. Sie unterliegt wie viele vor ihr dem Fehlschluss, bei der Dekonstruktion von Kategorien ginge es in der Konsequenz um deren Abschaffung. Soiland entzieht so dekonstruktivistischen Ansätzen die Legitimationsgrundlage für Kritik an sozioökonomischen Verhältnissen. Gleichzeitig stilisiert sie das Kollektivsubjekt "Frau" zum Drehund Angelpunkt feministischer Gesellschaftskritik. Schafft Geschlecht mehr Ungleichheit als Herkunft? Was Tim Stüttgen in ak 559 als "Sehnsucht nach dem feministischen Hauptwiderspruch" benennt, ist der Versuch Soilands, marxistische Theoriestränge (erneut) in den Fokus feministischen Interesses zu rücken. Das ist legitim, da das Geschlechterverhältnis stets in Bezug zu ökonomischen Verhältnissen gesetzt werden muss: Die aktuelle neoliberale Ausformung kapitalistischer Akkumulationslogik konstituiert nicht nur prekäre und flexibilisierte Subjekte, sondern vergeschlechtlicht diese zugleich. Die gegenwärtigen Produktionsverhältnisse affirmieren also nicht nur Geschlecht auf unterschiedliche Weise, sie schreiben zudem ein hierarchisch gegliedertes Geschlechterverhältnisses fort. Somit muss Geschlecht eine zentrale Analysekategorie feministischer Gesellschafts- und Ökonomiekritik bleiben. Doch es gibt berechtigte Einwände gegen dieses Vorgehen. Und die lassen sich nicht einfach mit der Begründung wegwischen, es handele sich vorrangig um eine gesellschaftstheoretische Perspektive: 1. Eine Analyse kapitalistischer Ausbeutungsverhältnisse, die sich auf ein binäres Verständnis von Geschlecht einigt, missachtet die Prekarisierung und Zurichtung von Nicht-Frauen und allen, die sich nicht innerhalb der zweigeschlechtlichen Ordnung verorten können oder wollen. Damit wird das Gewalt- und Ausschlusspotenzial einer heteronormativen Zwangslogik reproduziert. 2. Steht Geschlecht als hauptsächlich gesellschaftsstrukturierend im Mittelpunkt, aktualisiert dies die Hierarchisierung von Differenzkategorien und Herrschaftsverhältnissen zugunsten weißer Subjekte. Ist Sexismus "schwerwiegender" als Rassismus? Schafft Geschlecht mehr Ungleichheit als beispielsweise Hautfarbe oder Herkunft? Ein "Ja" als Antwort auf diese Fragen würde bedeuten, die jahrzehntelangen Kämpfe von Women of Color, MigrantInnen und Flüchtlingen sowie deren Bedeutung für feministische Theoriebildung und Entwicklungen innerhalb der Gender Studies auszublenden. Mit einem solch verkürzten Blick können sozialökonomische Phänomene wie ethnische Unterschichtung und Prekarisierung von rassifizierten Gruppen nicht erklärt, geschweige denn überhaupt sichtbar gemacht werden. 3. Werden die Produktionsverhältnisse als Hauptnarrativ in der Vergesellschaftung von Individuen angesehen und dabei nicht geopolitisch kontextualisiert, reproduziert dies ein eurozentristisches Denken: Kapitalistische Ausbeutungsformen werden ohne rassistische und postkoloniale Konstituenten und Kontinuitäten universalisierend für alle Individuen gleich gewaltförmig gesetzt. Ein neoliberaler Kapitalismus agiert stets global. Er kann sich auf ein postkoloniales Machtgefälle zwischen Metropole und Peripherie "verlassen" und daraus schöpfen. Daher ist es dringend notwendig ist, Ökonomiekritik mit Rassismuskritik und Erkenntnissen aus den Postcolonial Studies zu verbinden. Die skizzierten Einwände machen vor allem eines deutlich: Feministische Gesellschaftskritik darf sich nicht darauf beschränken, allgemein gültige Aussagen zu produzieren und daraus politische Forderungen abzuleiten. Feministische Gesellschaftskritik braucht queere, postkoloniale und rassismuskritische Blickwinkel und muss sich von der Zielsetzung lösen, einzig die Emanzipation von "Frauen" aus unterdrückerischen Strukturen zu wollen. Dekonstruktivismus, der als Denkrichtung und Herangehensweise in Queer-, Rassismus- und postkoloniale Theorie eingeflossen ist, kann hierbei behilflich sein. Denn es geht bei Dekonstruktivismus wie gesagt nicht um die Abschaffung begrifflicher Grundlagen. Vielmehr geht es um die Untersuchung, wie sich Wissen und Macht zueinander verhalten und wie Subjekte in dieses Geflecht eingebunden sind. Wie werden Ausschlüsse produziert, was bleibt in der Formulierung von Gesellschaftskritik ungesagt und intransparent? Dekonstruktivismus ermöglicht eine kritische Relektüre des bereits Gedachten und Gesagten und macht so in der Konsequenz die Widersprüchlichkeit, die Heterogenität und Komplexität gesellschaftlicher Phänomene sichtbar. Für queere Politiken bedeutet dies ferner, Heterosexualität und die Norm der Zweigeschlechtlichkeit als Zwang und Herrschaftsprinzip zu entlarven sowie gewaltförmige gesellschaftliche Normalisierungen entlang von sexuellen Identitäten und Körpern zu kritisieren. Diese Kritik ist immer im jeweiligen ökonomischen wie politischen Kontext zu betrachten, in dem sie geäußert wird. Es muss also hinterfragt werden, warum es vorwiegend weiße homosexuelle Frauen und Männer aus der Mittelschicht sind, die ihr Recht auf Eheschließung einfordern. Genauso, wie es nachdenklich stimmen muss, wenn diese sich mit konservativen Kräften die Hände reichen im Kampf gegen Homophobie, die wiederum nicht mehr als gesamtgesellschaftliches Problem kritisiert, sondern als "kulturelle" Eigenschaft den rassifizierten Anderen zugeschrieben wird - dieselben konservativen Kräfte, die sich gegen Affirmative Action Programme in der Privatwirtschaft aussprechen und vehement die Privatautonomie und Liberalisierung der Märkte verteidigen. Die kritische Reflexion aller Machtmechanismen Nicht nur queere AktivistInnen intervenieren dort, wo die Forderung nach Gleichberechtigung sich in eine Privilegienvergabe für Einzelne zu verwandeln droht. Vor allem People of Color und MigrantInnen äußern immer wieder Kritik an der Unsichtbarmachung oder Aneignung ihrer Perspektiven durch weiße FeministInnen. Bereits vor 40 Jahren hat der feministische Universalgedanke, alle Frauen aus der Herrschaft des Patriarchats zu befreien oder eine fundamentale Angleichung an das männliche Ideal einzufordern, zu Entsolidarisierung und Spaltung geführt. Obwohl seitdem postkoloniale und rassismuskritische Perspektiven einbezogen werden, bleiben Machtmechanismen fernab von Sexismus und vielfältige soziale Positionierungen, die eine Person auf sich vereinen kann, häufig unterreflektiert. Die Belange von People of Color, MigrantInnen und Flüchtlingen werden als Partikularprobleme der feministischen Bewegung deklariert, als solche, die besser unter dem Label Antirassismus zu führen seien, Probleme, die der Feminismus nicht auch noch bearbeiten könne. Oder sie werden dafür instrumentalisiert, vermeintlich westliche Errungenschaften hervorzuheben. Aktuelles Beispiel: die Burka-Debatte. Hier müsste nach dekonstruktiver Devise eigentlich zunächst geklärt werden, wer sich anmaßt, für wen zu sprechen, und was mit der "Befreiung der muslimischen Frau" eigentlich gemeint ist und bezweckt wird. Tatsächlich aber koalieren reaktionäre und feministische VertreterInnen, entwerfen Schreckensszenarien über den "gefährlichen" Islam und rechtfertigen damit eine rassistische Integrations- und Flüchtlingspolitik in Europa - eine Politik, die selektiv Menschenrechte zugesteht oder aberkennt und MigrantInnen nach ihrer ökonomischen Verwertbarkeit einteilt. Nicht zuletzt müssen sich die KritikerInnen postmoderner Feminismen fragen lassen, ob sie nicht die eine oder andere feministische Forderung aus den Augen verloren haben, die lange vor der Einführung dekonstruktivistischen Denkens aufgestellt wurde: Wir erinnern uns an die Vorschläge zur Aufwertung von Weiblichkeit im Bereich der (zum Teil unbezahlten) Reproduktionsarbeit (Stichwort: Ethik der Fürsorge). Diese erschwerten oder verunmöglichten gar eine umfassende Ökonomiekritik: Die Geschlechterdifferenz und ihre ökonomische Verwobenheit wurden als gegeben hingenommen. Es wurde sogar versucht, diese positiv zu besetzen. Hier gerieten strukturelle Verhältnisse aus dem Fokus feministischer Kritik, obwohl gesellschaftstheoretische Überlegungen bereits zur Analyse zur Verfügung standen. Die essenzialisierenden Sichtweisen auf Geschlecht führten zu einer identitären feministischen Praxis. Sie konnte sich nicht vom kritisierten patriarchalen Vorgang der Aufspaltung und Erklärung von Welt und Sein in dichotome und ausschließliche/ausschließende Entitäten lösen. Das Kritisierte wurde reproduziert. Darüber hinaus wurde ausgeblendet, dass auch Frauen an Gewalt und Herrschaft beteiligt sind. Es spricht also viel dagegen, Gruppen für widerständige Politiken und Kritik an sozialen Ungleichheiten zu vereinheitlichen. Dekonstruktivistische Perspektiven im feministischen Denken und Handeln einzunehmen heißt, die Gleichzeitigkeit, Verwobenheit und Überlagerung von Unterdrückungs- und Dominanzverhältnissen mitzudenken und kritisch gegen sich selbst zu wenden, um diese konsequent zu kritisieren. Das Ziel: Destabilisierung der unterdrückenden Strukturen Wenn das Ziel feministischen Denkens und Handelns die Selbstbestimmung und Emanzipation von Individuen und die Destabilisierung von unterdrückenden Strukturen und Dominanzen ist, muss Feminismus immer ein Ort sein, wo selbstreflektierend und selbstkritisch nach Ausschlüssen und Unsichtbarem gefragt wird. Denn Wissensproduktion und die Erarbeitung von widerständigen Politiken sind stets auch Spiegelbild gesellschaftlicher Verhältnisse. Eine von globalen Machtverhältnissen losgelöste feministische Ökonomiekritik, die Zweigeschlechtlichkeit und Geschlecht als soziale Kategorie unkritisch wie priorisierend zum Gegenstand der Analyse macht, reifiziert und reproduziert hegemoniale Wissensvorräte und Herrschaftsformen. Wer die Produktionsverhältnisse nicht an ihre historischen Ermöglichungsbedingungen rückkoppelt und mit anderen Unterdrückungsmechanismen verknüpft, will die Befreiung einiger auf Kosten der Unfreiheit vieler. Feministische Gesellschaftskritik muss Rassismus- und postkoloniale Kritik sowie neuere Erkenntnisse feministischer, Gender- und Queertheorie anerkennen und einbeziehen. Schon allein deshalb, weil sich ein neoliberaler Kapitalismus herrschaftlicher Ideologien und Prinzipien bedient, um sich unter ihrem Deckmantel einzurichten. Nadine Lantzsch Queer vs. Feminismus? Die Debatte bisher: In ak 558 kritisierte Tove Soiland, die dekonstruktivistischen Ansätze hätten sich auf die Kritik geschlechtlicher Identitäten zurückgezogen, statt die Stellung der Frau in der kapitalistischen Ausbeutung zu analysieren. Mit ihren flexiblen Identitätskonzepten passten queere Praktiken perfekt in den neoliberalen Kapitalismus. Tim Stüttgen widersprach in ak 559. Queere Lebensweisen seien nicht erfolgreich, sondern prekär. Feministische Kämpfe sollten nicht nach falscher Einheit streben, sondern die vielfältigen Gender-Identitäten zum Ausgangspunkt nehmen. In ak 560 forderten Lea Steinert und Kristin Ideler, sich den Auseinandersetzungen um Reproduktions- und Sorge-Arbeit zuzuwenden - und zwar mit queer-feministischen Methoden im Gepäck. Feministische Gesellschaftskritik braucht queere, postkoloniale und rassismuskritische Blickwinkel, meint nun Nadine Lantzsch. Dekonstrukivismus kann dabei durchaus helfen, die Komplexivität gesellschaftlicher Probleme sichtbar zu machen. ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis / Nr. 562 / 17.6.2011 Raus aus dem Elfenbeinturm! Der Feminismus muss neu über politische Utopien diskutieren Die Frauenbewegung der 1970er Jahre hat nicht nur die Geschlechterverhältnisse kritisiert, sondern ein umfassendes Emanzipationsprojekt verfolgt. Doch parallel zum Aufstieg neoliberaler Konzepte ging die kapitalismuskritische feministische Vision verloren. Wenn Feminismus mehr sein soll als eine Stichwortsammlung für moderne Unternehmensführung oder eine Nische an den Universitäten, ist eine neue Diskussion über feministische Utopien nötig. Dabei geht es auch um die Frage, wie unterschiedliche Identitätskonzepte in ein aktuelles feministisches Projekt einfließen können. Mit dem Text setzen wir die Debatte über das Verhältnis von feministischen und dekonstruktiven Ansätzen fort. Feminismus ist politische Theorie und soziale Bewegung. Feminismus ist kein in Stein gemeißelter Begriff, sondern ein Ensemble von Diskussionen, kritischen Erkenntnissen und emanzipatorischen Kämpfen. Historisch hat er unterschiedliche theoretische Konzepte und Ansätze politischen Handelns hervorgebracht. Auch im 21. Jahrhundert sind mit "Feminismus" unterschiedliche Erwartungen verbunden. Diese variieren abhängig vom eigenen (theoretischen, praktischen oder geographischen) Standort: Im Laufe der Geschichte wurde Feminismus mal als Kampfbegriff, mal als Diffamierung und mal als Modebezeichnung verwendet. Die verlorene feministische Kritik am Kapitalismus Gisela Notz hat in einem Text über die zweite Frauenbewegung der 1970er Jahre in den westlichen Industrieländern geschrieben, dass diese den Anspruch verfolgte, die "kapitalistisch-patriarchalisch geprägte Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft, die alle Menschen beschädigt und die patriarchalen Geschlechterverhältnisse" zu überwinden. Was damals existierte und heute fehlt, ist ein breit angelegtes Emanzipationsprojekt. Ein Blick zurück ist deshalb essenziell, um eine Zukunftsperspektive zu eröffnen, die sich den aktuellen Herausforderungen des Kapitalismus stellt. Nancy Fraser hat in ihrem Aufsatz "Feminismus, Kapitalismus und die List der Geschichte" eine detaillierte historische Analyse der zweiten Frauenbewegung unternommen. (1) Sie versteht Feminismus als einen historischen Prozess, der in gesellschaftliche Gesamtverhältnisse eingebettet ist und somit nicht isoliert betrachtet werden kann. Die Ausbreitung der mit der zweiten Frauenbewegung verbundenen kulturellen Ideen sei Teil eines Prozesses gewesen, der die Organisation des Kapitalismus der Nachkriegszeit insgesamt verändert hat. Die Kritik, die die feministische Bewegung formulierte, zeichnete sich dadurch aus, dass sie ökonomische, kulturelle und politische Dimensionen verknüpfte. In den folgenden Jahrzehnten seien diese drei Dimensionen jedoch nicht mehr in einen Zusammenhang gestellt worden; sie hätten sich auch von einer radikalen Kritik am Kapitalismus gelöst. Diese Fragmentierung der feministischen Kritik erlaubte die selektive Einverleibung und Umformulierung einzelner Elemente. Ist diese Aneignung auf eine "Wahlverwandtschaft zwischen Neoliberalismus und Feminismus" zurückzuführen, oder ist es eher dem Zufall geschuldet, dass die zweite Frauenbewegung und der Neoliberalismus gleichzeitig in Erscheinung traten? Auf diese Frage antwortet Frigga Haug in ihrem Aufsatz "Feministische Initiative zurückgewinnen - eine Diskussion mit Nancy Fraser" mit dem Hinweis auf die Produktionsverhältnisse. (2) Die Forderungen der zweiten Frauenbewegung hätten im Zeitgeist gelegen. Das fordistische Modell der Produktion befand sich bereits in der Krise, als die Frauenbewegung auf den Plan trat. Die Krise des Fordismus habe, so Haug, paradoxerweise auch den linken Feminismus begraben. Mit Blick auf den marxistischen Theoretiker Antonio Gramsci beschreibt Frigga Haug diesen Prozess als "passive Revolution". Die politische Obrigkeit habe politische Forderungen von "unten" aufgenommen und in einem anderen Kontext umgesetzt. Der Neoliberalismus veränderte das Feld, auf dem sich feministische Forderungen bewegten, indem er die Lebensverhältnisse und -bedingungen der Menschen transformierte. Allerdings wirken nicht nur wirtschaftliche Prozesse auf die Gesellschaft ein, sondern auch sozial und politisch handelnde Akteure. Die dekonstruktivistische Kritik hat die Bedeutung der Akteure feministischer Politik ins Blickfeld gerückt. Insbesondere der feministische Postkolonialismus, die Queer-Theory und die Intersektionalitätsforschung hinterfragen das kollektive Subjekt "Frau", das für die Frauenbewegung der 1970er zentral war. Alle drei Perspektiven betrachten Geschlecht nicht als etwas wesensmäßig Vorgegebenes und wehren essentialistische Subjekt-Konstruktionen ab. Der Queer-Theory beispielsweise thematisiert die Art und Weise, wie "Normalität" konstruiert wird, und Mechanismen und Prozesse gesellschaftlicher Normierungen. Welche Ausschlüsse produziert Politik für Frauen? Für die zweite Frauenbewegung bedeutet diese Kritik, dass sie ihre eigenen Normalitätskonstruktionen hinterfragen muss: Reproduziert der Feminismus in Theorie und Praxis selbst normierende Geschlechtskonstruktionen, beispielsweise in Maßnahmen wie Gender Mainstreaming, die sich auf die Subjektkonstruktion "Frau" beziehen? Die Forderung nach einer Frauenquote oder Frauen fördernden Maßnahmen in männlich dominierten Berufszweigen sind vor dem Hintergrund aktueller Zahlen einleuchtend: Laut Mikrozensus von 2009 liegt in Krankenpflegeberufen der Frauenanteil bei 91,3 Prozent, in Metallund Anlageberufen aber nur bei 1,6 Prozent. Allerdings sind solche Forderungen höchst widersprüchlich, wenn sie zugleich von ManagerInnen als Bausteine zur Unternehmensphilosophie entwendet werden, etwa indem die "emotionale Intelligenz" von Frauen als Ressource zur Steigerung der Produktivität gefeiert wird. Oder wenn Unternehmen wie Daimler Diversity-Konzepte implementieren, um Frauen in Führungspositionen zu fördern. Das klingt gut, allerdings zielen diese Maßnahmen auf Profitsteigerung durch "Vielfalt" und "Flexibilität". Eine Frauenförderung dieser Art dient vor allem dem Unternehmensinteresse. Doch auch die dekonstruktivistische Kritik, die die Vorstellung eines einheitlichen Subjekts verwirft, stellt den Feminismus vor Schwierigkeiten. Zum Beispiel, wenn es um die Lohn-Ungleichheit zwischen den Geschlechtern geht. Die strategische Formulierung eines Subjekts ist notwendig, damit Frauen ihren eigenen Standpunkt geltend machen und für gerechte Entlohnung kämpfen können. Doch dadurch werden andere Personen ausgegrenzt, nämlich jene, die sich nicht als "Frau" wahrnehmen, oder jene, die nicht arbeiten (wollen). Wie dieser Widerspruch aufgelöst werden kann, ist offen. Seien wir realistisch und versuchen wir das Unmögliche! - und besinnen uns auf die feministischen Ideale zurück. Die Rückbesinnung kann Folgendes bedeuten: die Analyse der Tiefenstrukturen der Gesellschaft, wie Nancy Fraser sie fordert; die Forderung nach der Rückeroberung der feministischen Initiative in Anlehnung an den Vorschlag von Frigga Haug; und das Entwerfen feministischer Utopien sowie die Verknüpfung der Demokratie- und Ökologiefrage. Einen solchen Vorschlag hat kürzlich Barbara Holland-Cunz in ihrem Aufsatz "Krisen und Utopien: Eine Rückbesinnung auf den Feminismus als visionäres Projekt" formuliert. Elemente einer neuen feministischen Utopie Diese drei Ideale der feministischen Diskussion bieten genügend Stoff, um eigene Gedanken über das Utopische zu entwickeln. Nancy Fraser stellt die Forderungen nach Umverteilung, Anerkennung und Repräsentation in den Mittelpunkt und verlangt, dass diese Forderungen aufeinander bezogen werden müssen. Mit ihnen sind die Sphären der Ökonomie, der gesellschaftspolitischen Kultur und der Demokratie und Organisation des Staates angesprochen. Frigga Haug findet in dem Programm Frasers in abgeschwächter Form ihren eigenen Ansatz der "Vier-in-einem-Perspektive" wieder. Darin geht es Haug um Gerechtigkeit bei der Verteilung von Erwerbsarbeit, Familienarbeit, Gemeinwesen und Entwicklungschancen. Mit dieser Perspektive verfolgt Haug den Anspruch, Prämissen für eine eingreifende feministische Politik und zugleich eine Utopie zu entwerfen. Verbesserungen im Diesseits seien nicht ausreichend, um das Patriarchat und den Kapitalismus zu überwinden. Erfrischend an dieser Perspektive ist, dass hier ein Anfang für eine langfristige und nachhaltige Debatte über feministische Utopien gemacht sein könnte. Diese notwendigen Diskussionen sollten indes nicht dazu verleiten zu vergessen, wo "wir" selbst stehen. Für die feministische Debatte betrifft das vor allem den Rückzug an die Hochschulen, in den Berufsfeminismus. Dieser in der Bundesrepublik zunehmend akademisch gewordene Feminismus hat sich mehr und mehr von alltäglichen Problemen vieler Frauen entfernt. Er muss sich fragen lassen, wer von seinen Ideen und Erkenntnissen überhaupt noch angesprochen wird, will er nicht zu einem Projekt von und für Privilegierte werden. Um den Feminismus aus dem Elfenbeinturm Hochschule herauszuholen und die feministischen Diskussionen wieder zu beleben, sind Auseinandersetzungen über utopische Ideen jenseits des Kapitalismus nötig. Die feministische Debatte braucht Räume, in denen das Streiten und Ringen um unterschiedliche Positionierungen frei von Homogenisierungen möglich ist. Was ihr derzeit fehlt, ist der Mut sich wieder politisch zu justieren, ist eine Provokation. Wir brauchen politische Strömungen, die über eine gerechte Gesellschaft streiten, in der die Emanzipation aller Menschen möglich wird. Denn noch immer gilt der von dem Frühsozialisten Charles Fourier formulierte Satz: Der Grad der Befreiung der Frau ist gleichzeitig der Prüfstein einer Gesellschaft und der Maßstab für die menschliche Entwicklung. Katharina Volk Anmerkungen: 1) Der Aufsatz ist auf deutsch erschienen in den Blättern für deutsche und internationale Politik Nr. 8/2009. 2) Der Text von Frigga Haug erschien in der Zeitschrift Das Argument Nr. 3/2009. 3) 2008 lag der Anteil weiblicher Führungskräfte bei Daimler bei 8 Prozent. ak - analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis / Nr. 563 / 19.8.2011 Reden wie der Mainstream Für eine feministische Kritik an queerer Politik Frauen werden von Männern unterdrückt und ausgebeutet. In der Queer-Szene gelte eine solche Aussage als unpassend, meint Detlef Georgia Schulze. Der queere Wunsch nach Repräsentation habe die Kritik an gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen ersetzt. Daran ändere auch eine queerfeministische Ökonomiekritik nichts, die sich der seichten Forderungen nach Gerechtigkeit und Gleichheit bediene. Ein Beitrag zur Debatte über das Verhältnis von feministischer und dekonstruktiver Politik. (Siehe Kasten) Tove Soiland hatte mit ihrem Text in ak 558 ihren nachfolgenden KritikerInnen eine gute Vorlage geliefert, um sie als fade und altbacken (Tim Stüttgen in ak 559) abzukanzeln. Aber so richtig ist den KritikerInnen diese Vorlage gar nicht aufgefallen. Tove Soiland kritisierte die Abwendung der Cultural Studies von ihren marxistischen Ursprüngen und schrieb unmittelbar daran anschließend: Nicht die Analyse kapitalistischer Ausbeutungsverhältnisse und die spezifische Position von Frauen darin standen nun im Zentrum der Aufmerksamkeit, sondern die Befragung dieser Kategorien selbst. Vom Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnis zwischen Männern und Frauen war also auch bei Tove Soiland nicht die Rede, sondern von kapitalistischen Ausbeutungsverhältnissen. Und mehr noch, die These von der heterosexuellen Matrix (Judith Butler) lasse sich kaum mehr aufrechterhalten; auch Geschlechternormen seien flexibilisiert worden. Queer ist aufregend und bunt, aber nicht feministisch Die Überschrift des Artikels lautete zwar Haben dekonstruktive Ansätze den Feminismus entwaffnet? An den zitierten Stellen entsteht aber der Eindruck, dass Tove Soilands Antwort gar nicht Ja ist (so haben es aber die nachfolgenden KritikerInnen verstanden), sondern als habe der Neoliberalismus mit seiner Flexibilisierung der Geschlechternormen den Feminismus tatsächlich überflüssig gemacht und als sei das Problem nicht die Entwaffnung des Feminismus, sondern vielmehr die Entwaffnung des Marxismus. In genderpolitikonline schrieb sie allerdings 2009, dass trotz weitreichendem sozialem Wandel in den Geschlechterleitbildern spätkapitalistischer Gesellschaften das einzig Stabile ihre nach wie vor bestehende Hierarchisierung ist. Angesichts eines gegenwärtig zu beobachtenden Trends zurück zur marxistischen These vom Klassenwiderspruch als Hauptwiderspruch, wie er sich zum Beispiel in einer Broschüre linker Gruppen zum 8. März 2011 zeigt (1), scheint es mir aber zentral zu sein, die in der Tat notwendige feministische Kritik daran, was Queer in der Bundesrepublik bedeutet, scharf von jedem Klassenreduktionismus abzugrenzen. Da sich Queer vor allem um sex, gender und sexuality dreht, scheint mir das vorrangige Problem zu sein, dass Queer nicht feministisch ist. Denn nichts gilt heute in der queer-feministischen Szene als unpassender, als zu sagen, dass Frauen von Männern beherrscht und ausgebeutet werden. Dagegen wird kein Anlass ausgelassen, um die Lage von Trans-Wesen, die angeblich von Massen separatistischer Feministinnen ausgegrenzt und schikaniert werden, zu beklagen. Damit ist eine bemerkenswerte Bedeutungsverschiebung von Queer eingetreten: Ging es anfangs auch um lesbische Sichtbarkeit in bzw. gegenüber einer heterosexuell dominierten Frauenbewegung, so wurde Queer bald zu einem Euphemismus, der das politisch aufgeladene Wort Lesbe (und entsprechend Schwuler) vermeidet. Wer sagt, er/sie gehe zu einer queer-Party, outet sich nicht als nicht-heterosexuell, sondern macht sich auf zu einem Event, das als schrill oder aufregend oder kunterbunt gilt. Angesichts dieser Entwicklung hilft es auch nichts, sich auf die Ursprünge von Queer in den USA zu berufen, wie dies Lea Steinert und Kristin Ideler in ak 560 taten. Ja, die gab es wohl. Aber diese funktionierten auf der Grundlage der englisch-amerikanischen Wortgeschichte von Queer, die diesseits des Atlantiks nur SpezialistInnen bekannt ist. Queer ist genauso ein angeeignetes und umgedeutetes Schimpfwort wie schwul als Begriff der Politisierung männlich-homosexueller Identitäten, Nigger im Rap oder Kanake in der Sprache von Teilen der hiesigen MigrantInnen-Kinder und -Enkel. So konnte queer aber in Deutschland nicht funktionieren. Wer kennt hier schon die englisch-amerikanische Wortgeschichte? Auch die ursprüngliche amerikanische Radikalität von Queer muss sich kritisch befragen lassen. Lea Steinert und Kristin Ideler schreiben: Auch die homogenisierte Darstellung nicht-heterosexueller Lebensformen, die stillschweigend ihre weißen, mittelständischen und männlichen Vertreter zur Norm machte, rief Widerspruch hervor. Parallel entwickelten sich in organisierten feministischen Zusammenhängen heftige Auseinandersetzungen um Pornografie, Bisexualität, Promiskuität, Penetration, Sadomasochismus, Transphobie und normierte Verhaltenscodices. Der zweite Satz ist nicht mehr als eine Reihe von teils positiv, teils negativ bewerteten Schlagwörtern; wobei die beiden Autorinnen die Argumente für ihre Wertungen schuldig bleiben. So bleibt denn als Kernargument für die queere Radikalität: die Ablehnung normierter Verhaltenscodices, ohne jede weitere Bestimmung, was damit gemeint ist. Die Aussagekraft dieser Definition löst sich angesichts ihrer Allgemeinheit in Luft auf. Denn auch die Sätze Vergewaltige nicht oder Drücke dich nicht um deinen Anteil an der Hausarbeit sind Verhaltensnormen. Aber sind es Normen, gegen die sich die queere Kritik richtet? Von politischem Bewusstsein ist nicht viel übrig Von politischem Bewusstsein ist nichts übrig geblieben als philosophische Phrasen über Gerechtigkeit der Verteilung, Anerkennung und Teilhabe (Steinert/Ideler). Queer redet heute genauso, wie es Queer einmal dem schwul-lesbischen Mainstream vorwarf. Wenn es dagegen mal eine radikale Botschaft von Queer gab, dann hat sie in etwa so geklungen: Nein, wir wollen kein Stück von eurem Kuchen abhaben. Wir pfeifen auf eure Anerkennung, denn wir bekämpfen Heterosexismus und Patriarchat dafür könnt ihr uns nicht anerkennen. Und gerecht ist, wie Karl Marx, ein Queer avant la lettre, sagte, das, was den jeweils herrschenden Standards von Gerechtigkeit entspricht. Es ist das, was wir umstürzen wollen, nicht das, was wir fordern. Heutige queere Praxis in der Bundesrepublik ersetzt die frühe queere Kritik an der Forderung nach Anerkennung durch die Forderung nach eben dieser Anerkennung. Sie ersetzt, mit Cornelia Klinger gesprochen, De-Konstruktion durch Multikulturalismus. Letzterem geht es in erster Linie um den Anspruch auf Hörbarkeit und Sichtbarkeit, also darum, eine adäquate Repräsentation der Marginalisierten bzw. die Anerkennung ihrer eigenen Identität einzuklagen. Demgegenüber formuliert der Dekonstruktivismus prinzipielle Zweifel an der Einlösbarkeit ebendieser Ansprüche, wie Cornelia Klinger bereits 1995 schrieb. Und weiter: Aus einer feministischen Perspektive wird nicht nur beargwöhnt, dass Identitäten festgeschrieben werden, sondern darüber hinaus, welche Identitäten damit zu Ehren kommen. Denn aus einer feministischen Perspektive sind keineswegs alle Kulturen gleichwertig und ihre Gleichrangigkeit gleich anerkennenswert. (2) Auch Kritik an (sexueller) Unterdrückung ist nicht dasselbe wie Foucaults Kritik der Repressionshypothese, sondern erinnert eher an Schriften aus dem Hause Wilhelm Reich/Herbert Marcuse. Reich und Marcuse meinten, die herrschenden Verhältnisse bedeuteten sexuelle Unterdrückung (was Foucault spöttisch Repressionshypothese nannte), sie unterdrückten Sex, es gäbe ein Sex-Tabu. Foucault zeigte demgegenüber, dass die Artikulation bestimmter Praktiken als Sexualität und damit die Herausbildung sexueller Identitäten (z.B. heterosexuell, homosexuell) gerade ein Produkt der von ihm kritisierten modernen Verhältnisse ist. Nadine Lantzsch schreibt in ak 561: Es geht bei Dekonstruktivismus nicht um die Abschaffung begrifflicher Grundlagen. Recht hat sie! Nadine Lantzsch spricht halbwegs deutlich aus, dass wir es nicht mit der Einschränkung von Individuen bei der freien Entfaltung ihrer sexuellen usw. Persönlichkeit zu tun haben, sondern mit Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen zwischen gesellschaftlichen Gruppen. Sie schreibt: Die gegenwärtigen Produktionsverhältnisse affirmieren also nicht nur Geschlecht auf unterschiedliche Weise, sie schreiben zudem ein hierarchisch gegliedertes Geschlechterverhältnis fort. Somit muss Geschlecht eine zentrale Analysekategorie feministischer Gesellschafts- und Ökonomiekritik bleiben. Und: Er (der neoliberale Kapitalismus) kann sich auf ein postkoloniales Machtgefälle zwischen Metropole und Peripherie verlassen und daraus schöpfen. Wunsch nach Anerkennung ersetzt politische Kritik Aber auch Nadine Lantzsch macht sich die lose Rede über Menschenrechte, Ungleichheit und Ökonomiekritik zu eigen. Es geht aber nicht um Menschenrechte, denn die kapitalistische Produktionsweise, die freie und gleiche Rechtssubjekte und WarenbesitzerInnen, die freiwillig Verträge abschließen, voraussetzt, ist ein wahrer Garten Eden der Menschenrechte, wie Karl Marx sagte. Und es geht auch nicht um Gleichheit und Ungleichheit. Auch Äpfel und Birnen sind ungleich und trotzdem besteht zwischen ihnen kein gesellschaftliches Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnis. Des weiteren: Eine herrschende und ausbeutende Klasse, ein herrschendes und ausbeutendes Geschlecht und eine herrschende und ausbeutende Rasse können dem jeweiligen beherrschten und ausgebeuteten Gegenstück nicht gleich werden; die Differenz zwischen ihnen konstituiert diese gesellschaftlichen Gruppen. Es gilt daher nicht deren illusorische Gleichheit, Gleichberechtigung oder Gleichstellung, sondern deren Überwindung zu fordern und zu erkämpfen. Dazu gehört aber zu allererst, deren gegenwärtiges Fortbestehen zur Kenntnis zu nehmen und uns nicht der Begriffe, die es ermöglichen, dieses Fortbestehen zu denken, zu berauben. Genau dies tut leider auch die lose Rede über Ökonomiekritik. Karl Marx schrieb eine Kritik der Politischen Ökonomie; er kritisierte damit eine wenn auch in sich differenzierte bestimmte ökonomische Doktrin, die Politische Ökonomie, und eröffnete damit zugleich die Möglichkeit, sein Untersuchungsobjekt, die kapitalistische Produktionsweise zu analysieren. Damit stellte er Wissen bereit, das notwendig ist, um sie effektiv zu bekämpfen. Ökonomiekritik scheint dagegen keine spezifische ökonomische Schule zu kritisieren, sondern eher faktische ökonomische Phänomene. Aber wieso, weshalb, warum wir diese kritisieren sollen, weiß Ökonomiekritik nicht zu sagen. Vielmehr warnt Ökonomiekritik überhaupt, anderes zu sagen als heiße Luft: Wir wollten weder begrifflich noch analytisch vorlegen / ist ganz stark offen / in den Raum werfen und einladen / Fragen sind beliebte Formulierungen ihrer VertreterInnen. (3) Wer derart fragend auf der Stelle tritt und keine These wagt, nimmt in der Tat Abschied Abschied vom Marxismus und vom Feminismus. Detlef Georgia Schulze Anmerkungen: 1) Die Broschüre Zusammen kämpfen gegen Patriarchat, Ausbeutung und Unterdrückung erschien anlässlich des hundertsten Jubiläums des Frauentags und kann von der Webseite 8maerz.blogsport.de heruntergeladen werden. 2) Cornelia Klinger, Über neuere Tendenzen in der Theorie der Geschlechterdifferenz, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 5/1995, 801-813. 3) http://maedchenblog.blogsport.de.