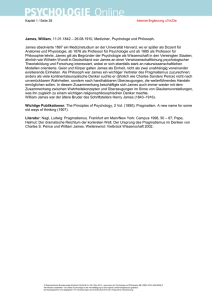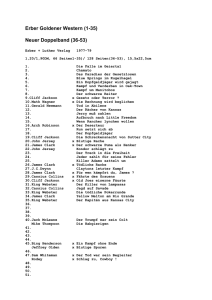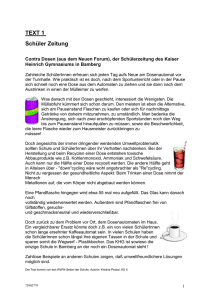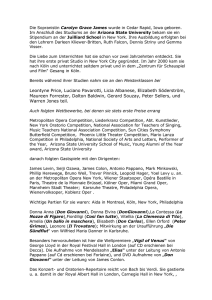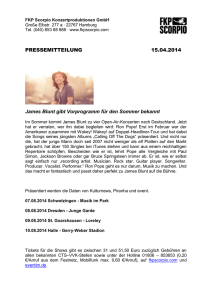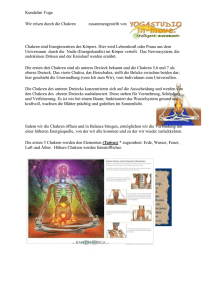Greetings Leo Hoeninger
Werbung

Greetings Leo Hoeninger Leseprobe: Die Wasser des Styx. _________ Helene hatte Geburtstag. Ich war von Spanien her, Löcher in meinen Schuhsohlen und völlig arm, über Nizza in dieses Flußtal gekommen, nach Sospel an der Bevera. Das lag nur eine Bergstaffel, einen Paß weit ins Gebirge hinein. Ich meinte, die Landstraße müßte irgendwie nach Turin gehen. Dort wollte ich hin. Auf der Straße war wirklich nicht viel Verkehr, ein Auto vielleicht alle paar Minuten. Am Weg lag eine kleine, tote Schlange, wie sie hier öfter unter die Räder geraten. Ich hob sie auf, mittels Zweigen, zog ihr die Haut ab, steckte Ginsterspieken da hindurch, sie längs zu spannen. Dabei achtete ich nicht weiter auf die Straße. Unversehens aber hielt ein Autochen neben mir, darin saßen ein junger Typ, eine braunhaarige junge Frau und, hinten, ein vielleicht zweijähriges Mädchen im Hemdchen, mit nacktem Unterleib. Die beiden vorne luden mich ein, sie wüßten etwas für mich, sie würden mich mit in ihr Dorf nehmen. Ihre Namen waren James, Helene und Melina. Die beiden Erwachsenen sprachen beide Englisch und Helene sogar ein wenig deutsch. Melina lernte gerade ihre Muttersprache. Ich erfuhr bald, daß Helene gerade an diesem Tag Geburtstag hatte, sie würden eine kleine Fete machen und wünschten mich als Gast. Das war mir recht, auf so etwas hatte ich immer gewartet. Wir kamen zu dem Dorf, wo die bergauf-Serpentinenstraße endete – ein winziges Nest auf einer Klippe hoch über weiten Talklüften. Der Ort hieß Piene, verrieten sie mir, und außer einer Kirche hatte er auch ein „Chateau“ genanntes Gemäuer, das am oberen Ende des Klippensattels über dem Dorf stand. Dort konnte man telefonieren, sonst hatte man nur eine Wasserstelle auf dem Dorfplätzchen, und elektrisches Licht. Wir trugen ein paar Dinge in ihre winzige Wohnung, unterhielten uns dabei. Ich hatte die Schlangenhaut noch dabei. Sie zeigten auf ein Weckglas, worin in Wasser eine grüne, größere Haut schwamm: eine Grasnatter, die sie erwischt hatten. Helene hatte also Geburtstag. Es würde ein Kuchen gebacken werden und Essen gekocht. Eine starke, schwarze Katze gehörte zum Haushalt, Minou genannt, und Melina trieb sie sofort auf, rief „Minou, Minou“, grabschte nach ihr. Vor dem Dorf wurde der Fischhändlerwagen sichtbar. Helene ging hin und kaufte ein paar Fische, solche wie große Sardinen, schöne, bläuliche und grünliche Schuppen, mit feinen Mustern. Wir taten und redeten. Auf dem Küchenbord stand ein stark bunter Dahlienstrauß. Der Kuchenteig wurde angemacht. Schokoladenkuchen, zu dem sie allerdings die Eier vergessen hatten. Ich sorgte um die Fische, alles lag einfach recht, eins fand zum anderen ohne Mühe, ohne Denken. Es war Anfang September, ein klar sonniger Tag. James erzählte ein wenig über die Gegend: man hatte hier nie genau gewußt, ob man zu Italien oder Frankreich gehöre. Man entsinne sich hier noch gut der Mauren. Im Krieg war die Gegend deutsch besetzt, wurde von den Amerikanern befreit. Zum Gedenken dessen hieß das Dorf gegenüber auf dem Berg Libre. James’ Vater war einer der Amerikaner, die damit nach Frankreich gekommen waren, und daher sprach er Englisch. Helene kam aus Montmorency bei Paris. Dort waren ihre Eltern Lehrer für Deutsch, somit kannte sie die Sprache. James verstand sich aufs Tischlern, hatte eine kleine Werkstatt. Beide verdienten auch etwas, indem sie in der Sospeler Schule Sprachunterricht gaben. Sie hatten einen Plattenspieler und etliche Platten, vor allem aber hatte James eine blinkende, scharf getrimmte Yamaha-Gitarre, auf der er gelegentlich sehr gekonnt etwas vorimprovisierte. Dabei schwätzten seine Fingerkuppen auf den Saiten einen ziemlichen Jazz. Das Essen und der Kuchen wurden fertig. Wir fanden uns an den kleinen Tisch, worüber eine krude Lampe aus einem verzweigten Geäst hing. Helene saß auf der Mittseite, Melina auf dem Schoß. Ich an der Fensterseite rechts ihrer, die Katze auf dem rechten Schenkel. James mir gegenüber. Die Fische in der Pfanne rührte ich, mit einer Art Respekt, nicht an, dippte nur einmal mein Brot in ihre Brühe. Helene fütterte Melina, sie und James sprachen dabei zu ihr. Melina war ein bißchen was von einem Putto, gelbblonde Haare, rosige Pausbäckchen, ein roter, schon gesprächiger und zusprechender kleiner Mund. Zähnchen. Es wurde nie ganz klar, wie Helene, James und das Kind sich miteinander befanden. Ich verstand das so weit, daß Helene das Kind für ihre wohlgestellte Mutter hier hütete in diesem Wunderdorf, und James war eben ihr Bube. Alles prima. Unversehens gab die Katze mir gezielt einen schnellen Kuß, mitten auf den Mund. Alle aßen, mehr oder weniger, schließlich auch vom Kuchen. Minou stellte die Vorderpfoten auf den Tisch und begann, ausgiebig einen Riß in der Kuchenkante zu lecken. Aha, dachte ich, macht die Glasur. Als es allen gemundet hatte, kam James mit Tabak und ein wenig Dope hervor, drehte bedacht einen Joint. Außerdem, sagte er, hätten sie noch einen ¾ LSD-Trip. Wenn man den in drei schnitt, wäre das was für jeden. Oh ja, nichts dagegen. Wir rauchten. James schnitt das kleine, buntbedruckte Blättchen, wo schon ein Viertel heraus war, mit der Schere zurecht, und jeder nahm ein Viertelchen. Helene ließ Minou und auch die kleine Melina ein wenig vor die Tür. Dort kam die kieselgepflasterte Gasse vom Dorf-Plätzchen herbei, bog an der Tür ab nach rechts, hinauf zur Kirche, kleinste Wege. Gar nicht zu sagen, wie winzig das Dorf ist – gerade, daß man von seinem einen Ende das andere nicht sieht. Wie ein Wespennest. James spielte noch ein wenig auf der tollen Gitarre. Er konnte wirklich etwas damit. Helene spülte ab. Dann kamen sie herbei, sie stellte den Plattenspieler an, Stevie Wonder oder Paco de Lucia, und wir rauchten noch eins. Melina kam wieder herein, die Katze blieb draußen, hatte da was (im Dorf waren mehrere Katzen). Ich ging, mal zu schauen, hinauf an die Kirche, neben der vorne links eine kleine Estrade, davon ist weit in ein Nebental zu blicken. Im Grün vor dem Geländer lag eine Artilleriekartusche. Beim Weg wieder hinab begegnete mir ein kräftig gebauter älterer Mann, der trug eine Hucke voll Holz und stieß die Worte aus: il vive encore. Von der Wohnungstür sieht man, im Ganzen westwärts, über die nächstesten Häuser hinweg zu einer nahen Höhe gleich vor dem Dorf, darauf wächst Koniferenholz in so verwobenen Formen, daß es wirkt wie ein chinesisches Schriftzeichen. Von der Zimmerseite nach Osten, über das gewaltige Tal hin, ein Balkon. Von dort läßt sich recht steil direkt bis in den Talgrund sehen, wo eine Straße neben dem Fluß verläuft. Das, hörte ich, ist die Roya, welche der ganzen Gegend den Namen gibt. Nach dem Kriegsende war ein Referendum, und die Leute optierten für Frankreich. Die Grenze ist aber trickreich. Man kann zum Beispiel auf der Talstraße nicht von Frankreich nach Frankreich, ohne Italien zu durchqueren. Vom Talboden herauf klang Signalhorntuten. Das, erklärte James, sind die Zementtransporter, 40-Tonner, die von einer Fabrik hinab an die Küste fahren. Es dämmerte. Die kleine Musik spielte, manchmal war’s still. Melina wurde ins Bett gebracht. Das LSD begann zu wirken, meine Augen fühlten sich gut an, von innen her, von innen der Welt. James und Helene wußten sich was, sie würden hinaus in die Gärten gehen. War mir recht, ich mochte in der kleinen, kälkenen Wohnung bleiben, mir war grad so gut. Die Katz war wieder drinnen. Mir war sehr still, zeitstill, innerlich, dabei sehr dicht. Ich war vollkommen da, alle Tendenzen aufgelöst, mein Atem schmeckte mir bis in die Augen. Die Räume in dem Domizilchen waren gegeneinander gestuft. Vom Eßzimmerchen, wo der Balkon war, ging es, von Küche und Eingang her kommend, zwei Türstufen wieder hoch zu Melinas Kämmerchen, dann, geradeaus drei Stufen ins gute Zimmer hinab. Dort war bunter indische Kattun aufgespannt, eine Art Diwanlager, der Plattenspieler, ein Spiegel mit schönem, mattblau lackiertem Rahmen, daneben eine chinoise Etalage, aus gutem rotem Holz geschnitzt, auf deren Etagen mancherlei Kleinigkeiten lagen. Mir fielen vor allem die sattschweren, bronzenen 10-F-Stücke auf, dieses Louis-d’Or-Geld der damaligen Republik. Hinter diesem Zimmer noch eines, mit dem Schlaflager der beiden Großen. Ich ging umher, schön fassungslos, alle Absichtlichkeit vergessen habend, an die große, endlose Zeit gegeben. Über Libre am Berg ging ein ziemlich voller Mond auf. Es schien, als liefen die Berglinien der Erde nahtlos in jene des Mondes über. Das LSD war wirklich gut, genau bemessen, ich schwamm in reinem Äther, wandelte nach endlosen Gefühlen die wenigen Schritte, mal da, mal dort hin in der kleinen Wohnung. Die Dahlien, knallbunt, und einige Gräser um sie her drapiert, schienen mir endlos tief in die Seele. Im Zimmer stand James’ Gitarre aufrecht auf einem Stuhl. Wie es mich grad aus den Sphären ergriff, ging ich zu ihr, ließ nur meine Finger durch ihre Saiten fahren, lauschte verzückt dem Nachklang, metallen. Die Katze war da. Ich nahm sie auf meine Schulter und begann, mit ihr zu schmusen, intensiv und ausdauernd, hingegeben. Das Tier schnurrte und schnurrte, wie verrückt. Nebenan schlief Melina. Ich griff weiter gelegentlich in die Saiten, das Tier schnurrte, dann sprang es, mit einem Überschlag rückwärts, von meinem Arm auf den Boden. Ich staunte die Dinge auf der Etalage an, die Münzen. Sie erschienen mir wie Offenbarungen eines tiefen Sinnes, so gewichtig wie das dichte Metall. Mein Blick fand die Wand, die anscheinend von Hand so geschlämmt war. Das Weiß glitzerte astral, und die Schlieren in ihm erschienen als ineinander übergehende Bilder von Bauten und lebenden Szenen. Eine ganze Zeit lang las ich diesen Kalender, war wirklich weg. Dann ging wieder zur Gitarre, machte die Saiten klingen. Die Katze hatte das wohl verstanden, steckte die rechte Vorderpfote aus, tupfte an die Saiten, und ein Laut erklang. Bravo! So ging die Nacht herum. James kam vielleicht noch einmal kurz in die Küche. Sonst war ich da mit der Katze und der schlummernden Melina allein. Als es Morgen wurde, ging in ihr Zimmer, fand sie schlafend, gut eingepackt. Nur ihr rechter kleiner Fuß ragte aus dem Paket. Ich umfaßte ihn sacht, schmiegte meine Hand seiner Sohle an und fühlte so ein wenig an ihr. Dann ging ich wieder, tat ihr ein wenig Frühnahrung in eine Schale, die ich auf die Türstufe ihres Zimmers stellte. Sonst fand ich nach und nach das gewöhnliche Zeitgefühl zurück. Irgendwann, als es schon hell war, saß ich, trocken schluchzend, vor dem Spiegel im Zimmer, betrachtete meine löcherigen Schuh und wußte, daß etwas Nie-wieder war. Helene und James waren guter Laune, es war sehr angenehm gewesen im Garten bei Mondschein. Irgendwann sammelte ich mich, zu gehen. Der Holzträger war wieder die Gasse heraufgekommen, wieder hatte er hervorgestoßen: il vive encore. Melina war draußen gewesen, unversehens über ihren Fuß gestolpert, hingefallen zu vielem Geschrei. In der Nacht hatte ich Motten mit daumengroßen Leibern gesehen. Davon lag nun leblos eine auf einem Mauerabsatz. Helene zeigte zu einer festen, schlichten Frau, die in der Gasse mit Melina sprach, meinte, die sei besonders, so etwas wie eine gute Zauberin, eine Geisterin. Was ich mir merkte. James meinte, die Leute im Dorf hätten aber gemerkt, daß etwas Besonderes losgewesen sei. Als ich gehen wollte – ich wollte nicht, ich mußte - zeigte er mir den Seitenpfad am Berg aus dem Dorf hinab dahin, wo ich mit Bahn oder Auto weiter nach Turin könnte. Fragte: Du brauchst doch Geld, nicht? Steckte mir einen großen, glatten 100F-Schein zu, den ich mir in den Ärmel steckte. Dann schied ich, machte mich auf meinen löchrigen Sohlen davon, ein Stück Italien zu gewinnen. _________ Das war der Beginn. Natürlich kehrte ich an diesen holden Ort zurück, doch ich mußte erst einmal finden, wie das geht. Einmal expropriierte ich sogar ein Auto in l’Escarène, weil ich dort nicht weiterkam. Das tat es dann nicht mehr oben beim Dorf, als ich damit wieder wegwollte, und so wurde meine Missetat offenbar. Ich mußte erst lernen, mich mit der Eisenbahn zu bewegen, um in die Gegend zu finden. Helene, James und Melina traf ich noch mehrmals an, auch Minou, was ein Kater war. Auf die Dauer fanden die beiden aber keine lohnende Arbeit mehr, der Besitzer der Wohnung wollte diese wieder für sich selber, und so zog die kleine Quasifamilie fort. James ging nach England, von Helene hörte ich, sie sei sogar nach Amerika gegangen. Was aus Melina geworden ist, war nicht zu hören – das Mädchen ist nun bald 30 Jahre alt. Ich fand die Adresse von Helenes Eltern heraus, eine Siedlung in einem Kastanienbusch nahe einer Festung auf dem Berg. Helenes Mutter gab ich das kurioseste Buch aus dem Chateau, ein Kochbuch aus der Hand des Leibkochs Louis’ XV, von ihm selbst gewidmet. Vor allem aber lernte ich die Eisenbahn kennen, die konnte mir nützen. Ich mußte erst lernen, mit dem Nachtzug von Köln nach Paris und von dort weiter nach Nizza zu kommen. Von dort gibt es eine Nebenstrecke nach Turin. Die Züge da fahren aber meist nur bis zur Grenze im Gebirge. Und die werden wenig kontrolliert, daher benutzte ich sie oft, um in die Berge zu kommen. Da kann man dann fahren bis Sospel, um dort die Straße hinauf nach Piene zu gehen, oder ein Tal weiter nach Breil an der Roya. Das ist die Grenzstation, weil hier auch, auf einer anderen Linie, Züge aus Ventimiglia an der Rivieragrenze passieren. In Breil wird die Roya, die vom nördlichen Grenzgebirge, dem Tende-Massiv, herrührt, zu einem klaren, grün-bläulichen See gestaut. Auf dem gefällt es einigen Schwänen, die da wild leben und bis hinab ans Meer ziehen. Um nach Piene zu kommen, kann ich zunächst einmal 3 km dem Royatal abwärts folgen, um dann von Piene basse, einigen Häusern im Talgrund, auf jenem Pfad direkt die 300 m hinanzusteigen, den mir James damals von oben her gezeigt hatte. Oder ich ging vom Bahnhof aus eine Steige hinan weit am rechten Berg über der Roya hinauf, um ein voluminöses Seitental, an dem Piene sehr schön gegenüber zu sehen ist, durch die Gärten ins Dorf. Dortselbst schaute ich meistens eigentlich nur, wie’s aussieht, schlief vielleicht eine Nacht dort, ging noch ein wenig ins Land und kehrte dann bald zurück an die Küste, weil ich nicht viel Proviant hatte. Konnte einmal ein paar Worte mit der guten Zauberin wechseln, die mir sagte, sie sei Linkshänderin und deswegen in der winzigen Dorfschule viel geschlagen worden. Das Gespräch fand vor dieser statt, die nur noch eine Ruine war. Ich schlief manchmal darin, denn da stand ein eisernes Bett, und bei dem Gespräch brach ich gerade eine baufällige Mauer weg, die auf den Weg stürzen könnte. Bei anderer Gelegenheit kamen Leute aus dem Dorf zu mir, der da in einer Grotte hauste, was vielleicht einmal ein Ziegenstall gewesen ist – die Leute brachten mir eine Matratze und ein wenig Geld. Die waren gut zu mir. Vor allem aber lernte ich nun bei meinen Touren die Bevera kennen, das andere Flüßchen, welches kurz vor der Küste in die Roya mündet. Ich schaute zunächst immer, wenn ich nach Piene wollte, nach Breil zu kommen mit der Bahn, ging von da die Straße (SS 20) bis unter den Piener Berg hinab, stieg dann dort hinan. Von Piene aus war deutlich zu erkennen, wo das Meer lag, und am Beginn wanderte ich einfach los, einer Vorberghöhe folgend, in der Richtung. Der Vorberg führte recht weit, doch einmal endete er, und von diesem Ende herab sah ich in das winklige Karsttal dieses anderen Flüßchens, das nahe bei, doch erkennbar höher als die parallele Roya verläuft, in vielen kurzen Zickzackbögen zwischen einander durchschränkenden Vorbergen, diese bewachsen mit Pinien und Oliven in verwilderten Stufengärten. Oho, richtiges Granatwerfer-Guerilla-Land, dachte ich beim ersten Blick von der Vorhöhe da hinab. Interessant. Ich würde das kennenlernen wollen auf seinen Wegen. Hier nun wollte ich zunächst einmal hinab ans Wasser, mich dürstete. Ich sprang oder stieg die Terrassenmauern des Gartens hinab, wo ich mich befand. Die Menschen müssen jahrhundertelang an diesen Gärten gearbeitet haben. Die Gartenmauern enthielten manchmal Treppensteine, auf zweierlei Weise: einmal konnten längere, schmale Flachsteine treppenweise übereinander herausragend in eine flache Mauer eingesetzt sein, oder die Mauer wurde kantweise um etwa einen Fuß Breite versetzt, und diese Kante war treppenförmig gefügt. Viele Mauern, die nicht so hoch waren, hatten aber keine Treppensteine. Die sprang ich dann beispielsweise hinab. Endete schließlich auf einem schmalen Plateau aus gelber und rotorangener Erde (dachte: wie Afrika), das nun bei einer ca. 4 m hohen, so kruden Mauer über dem Felsboden des klüftigen Flüßchens stand. Ich hörte das nahe Rauschen, konnte über den Mauerrand hinab das nach links fließende Wasser sehen, doch da hinab, das ging nicht, da wäre nicht wieder hinaufzukommen. Naja. Ich merkte mir das, mußte für nun zurück, all die Mauer-Gartenriemchen wieder hinan, bis ich den Pfad wiederfand, folgte ihm um die Bergkrone linksherum, bis daß ich wieder ins Roya-Tal kam, dort wohl dann die 18 km bis hinab nach Ventimiglia am Meer zu gehen, wo ich die Eisenbahn erreichte. Ich fand mir andere Zugänge zu diesem vielgestalten kleinen Flüßchen, das einem zu jeder seiner Bergkurven etwas anderes erzählen kann. Der erste Weg führte von Piene hinab auf einen Vorbergsattel, durch Gärten. Dort steht das kleine italienische Dorf Olivetta. Von dort linksherab kurvte eine Straße, die dann von hier weiter hin nach Frankreich, über den Paß bei Piene, führte, einige Längen hinab in das deutlich tiefer gelegene, zyklopisch geformte Royatal, zur Bahnstation Olivetta-San Michele. Das ist nur ein kleiner Bahnsteig, mit Bahnhaus aber, vor einer Tunnelöffnung, und gegenüber ist ein Ristoro, wo’s auch Kaffee gibt, natürlich. Und Telefon. Das ist also im italienischen Teil des Royatales. In Olivetta droben aber, folgte man dem Verzug des Ortes, war es nicht weit zu einer Tallage, wo vielleicht nur 10 m tiefer die Bevera vorbeifloß. „Floß“ ist dabei ein relatives Wort, denn die Bevera konnte alle in einem Gebirge möglichen Formen annehmen, und dementsprechend wechselte ihr Lauf. In rein felsigen Partien ergoß sie sich in flachen Rinnen, schnitt sich da aber auch manchmal in unergründlich tiefen, schmalen Canyons ein, die sie anfüllte mit tiefschwarzblauem Wasser, das sich scheinbar gar nie mehr bewegte. Dann wieder floß das Gewässer, laut rieselnd, über flache Kiesstrecken ab, oder es stürzte in heiteren kleinen Wasserfällen von einem Findlings-Wasserbecken in ein tieferes. Überall im Tal der Bevera rauscht es, der Fluß ist unüberhörbar. Die Roya ist ruhiger, schäumt nur manchmal ein wenig vor. Da machen sonst den Lärm die Autos. Die Bevera, ihr Tal, ist ein italienisches Naturschutzgebiet. Die Gartenlagen sind längst menschenverlassen. Man soll kein Feuer machen in der Gegend. Nur Tier- und Menschenpfade führen dort entlang. Die Wege nach und von Olivetta wollen erst einmal gefunden sein. Kam ich von Piene, nahm den Gartenweg, der irgendwo sehr informell wurde (da lag eine verrostete Granate), direkt nach Olivetta, oder ich folgte der Straße, die vom einen Dorf kurvig zum anderen führte, damals mit einer kleinsten Grenzkontrollstelle. Bevor man, von Piene die Straße herabkommend, diese Grenzstelle erreichte, konnte sich rechts weit durch Buschgarten hinab einen Vorberg hinablassen, kam schließlich unten am Beveraboden an, da ergoß sie sich breit 2 m tief in ein grünleuchtendes Unterbecken. Der Platz ist sehr chic. Links am Erdrand vom Garten zum Flüßchen hin verläuft eine noch in Gebrauch befindliche Wasserrinne, wie sie von den alten Leuten dort öfter parallel zu dem Fluß angelegt worden waren. Der Querschnitt dieser Rinne war 30 x 30 cm, darin (in strömendem Wasser) oder auf dem Bordrand konnte man als einzigem der Bevera folgen. Diese sank bald unter das Niveau der Rinne hinab, dann führte diese als ein kruder kleiner Aquaedukt nach rechts über den Fluß hinweg – das ist der einzige Fußweg dort, wie die Ziegen tanzen – und folgt ihm dann rechterhand durch bewirtschaftete Olivengärten, in denen irgendwo, schon nahe vor Olivetta, ein Grenzstein steht. So kommt man, an sehenswerten Seitenschauen vorbei, zu dem Ort, auf Wasserhöhe, und findet da zunächst diese Grotte, zwei gemauerte Rundbögen nebeneinander, vielleicht 4 m hoch. Das Wasser wallt flach hinein, und Licht und Schatten sind ein wenig neckisch. Links davon eine Eselspfadbrücke ins Dorf, rechts neben dem Weg hinein ein Canaletto, von dem ich nun nicht mit Gewißheit sagen kann, in welcher Richtung das Wasser lief, wahrscheinlich aber von der Bevera weg, durchs Dorf, dann durch das Paß-Nebental zur Roya hinab. Das mit den Wasserkanälen dort ist schon eine kleine Kunst. So haben die das in Olivetta. Die in Piene oben haben ihren eigenen kleinen Bach, der vom Mangiabou-Gebirge herab durch ihre Gärten fließt und dann durch ein Nebental hinab tief zur Roya, unter Kirche und Chateau auf der Klippe. Die Bevera, wie man sie dort beim Ort findet, kommt von weit genug her. Irgendwo in einem meerwärtigen Randtal des Mangiabou-Massivs entspringt sie, fließt dort zunächst nach Osten, biegt bei Sospel nach etwa Nordosten und durchströmt den kleinen Ort. Folgt ein Stück Weg, etwa parallel zu der Straße, auf der Helene & James mich damals aufgelesen. Ich fuhr später oft mit der Bahn bis Sospel, folgte von da zu Fuß den Schienen für vielleicht 2½ km. Linkerhand hat man da die Flußweiden und Gärten des Ortes, den Fluß selber, dann ein umfängliches, hohes Vorgebirge zum Mangiabou-Massiv. Rechts der Gleise geht es hinan auf die Höhen des Grammond, was ein anderes Massiv ist, zwischen der Bevera und dem Meer. Darüber hinweg kommt man direkt nach Menton, wo die Grenze ist zwischen Italien und Frankreich, an der hohen, letzten Klippe der Alpen, nur 20 m Uferbreite lassend. Das war schon immer die Grenze der beiden Gallien. Die Bevera aber, landeinwärts: am Ende des Weges mit den Schienen geht es über einen Viadukt. Felsige Klüfte ca. 20 m über den grünschattenkühlen Wassern der Bevera. Hier schon zeigt sich das interessante Gefälle des Flusses und das Prinzip, parallel von ihm wegfließend Niveau abzuleiten (vielleicht steigt die Eisenbahn auf dem Weg auch ein Stückchen an – wenn aber, dann sicher unmerklich). Nach dem Viadukt findet sich eine Passage nach rechts, Pfad hinab bis an Wasserhöhe, ein paar Häuser dort, weil da auch die Straße nach Piene nahe vorbei in den Berg zu steigen beginnt. Später hielt man weiße, große Ziegen drunten, wo der Pfad am Wasser ankommt, bei einer graufelsigen Rinne. Die Bevera schneidet sich gleich danach sehr schmalklüftig, tief und eindrücklich in den Fels ein, wird blauschwarz und ganz still, dabei voller Kraft. Der Pfad führt derweil links wieder am Berg hinan, an Ruinen vorbei, in ziemliche Höhe. Gegenüber eine andere, lang und hohe, immer zwielichtige Flankenseite des Grammond. Der Pfad biegt bei einem alten Schild, auf das wiederholt geschossen worden ist, links über eine feine Klippe, durch Olivengärten zur Straße von Piene herab. Rechts unten vor dieser Klippenecke ist tief der breite Wasserfall zu sehen. Am Weg zur Straße hin links in einer Erdecke ein leis berieselter Born, mit grad eben bläulichem Wasser. Dort wiederholt hab ich getrunken. Man kann der Grenzkontrolle auch ausweichen, zu Fuß, indem man da, wo der Pfad auf die Straße trifft, nach rechts über diese durch den Oberhügel von Olivetta hinabgeht, Pinienhänge aus splittrigem Gestein. Zu Zeiten machen Einheimische sich dort zu tun, Pinienzapfen zu ernten, der Kerne wegen. Dann ist man wieder in Olivetta, den Beveragrund nahe vor sich. Der Fluß läuft vom Dorf aus weiter durch etwas geräumigere Gartenböden. Auch hier wieder der schmale Wasserkanal, vielleicht 3 m über dem Fluß. Ich muß doch annehmen, daß Olivetta mindestens einen eigenen Bach hat. Das Gebirge ist da nämlich lieb, es läßt keinen verdursten. Auf den höchsten Höhen des Mangiabou leben Hirschen, deren Dungspuren die Wasserstellen markieren, zu denen sie immer hinabpilgern. Den Gärten und dem Flüßchen folgend kommt man dann an den Flecken Bussare, in einem topfförmigen Nebental. Dort ist ein Wasserhahn, aus einer Leitung vom Berge herab befüllt, man riet aber vom Genusse ab, da seien Keime im Born. Von Bussare aus führt ein deutlicher Bergpfad direkt auf die Höhe des Grammond, an einer Quellenfassung vorbei und einer anderen Wasserleitung, über einen etwas titanischen Schotterhang, wieder nach Menton, durch interessante Anlagen im Berg, einen Laufgarten z.B., da führt der Pfad immer gerade so von einer Gartenstufe zur anderen hinab, daß die Füße darauf von selbst zu laufen beginnen. Auch ist da irgendwo ein recht eminenter Wasserfall, bei Blick über die Stadt hinweg aufs Meer. Der Pfad (hier aber) läuft rechts der Bevera, passiert bei einer sehenswerten Zypresse wieder eine Brücke, und nun wird’s wild. An der Brücke sieht das Wasser aus wie jede Ache irgendwo in den Alpen. Aber nun geht man ein ganzes Stück weit auf einer Art Indianerpfad durch Bruchwald in der linken Flanke des Flusses, Hand und Fuß, Sonne, Fels, Schatten und Wasser. Da beginnen die Flußwendungen hin und her, man gewöhnt sich dran, mitzugehen. Doch irgendwann endet der Pfad, mitten im Wald. Man kann da eine Böschung hinab, und dann steht man vor dem Fluß, hier ebenmäßig knietief, muß und kann ihn queren. Ich zog hier immer meine Schuhe aus, krempelte die Hosenbeine hoch, lud all mein Zeug auf die Schulter, fand mir möglichst einen Stock als Stütze und tappte über die ein wenig rutschigen Grundsteine hinüber. Dort auch Reste einer alten Wasserleitung, nahe über dem Fluß. Man muß sich ein wenig durch Unterholz winden, der Fluß wird mittels einer Holzbarre flach gestaut und stürzt 30 cm tief in seiner Breite hinab. Dann gibt das Ufer, steinig genug, etwas Raum. Da wachsen zwei Nußbäume. Der Fluß formt ein nicht breites, gerade mannstiefes Schwemmbecken, mäßig bewegt. Ein idealer Badeplatz. Die Gärten auf dieser Seite beginnen über einem Ufersturz von vielleicht 3 Metern, der leicht zu erklimmen ist. Dann findet man sich in einem Stück Wildgarten, ebener, harter Boden, etwas borstiges, hohes Gras, und Bäume. Dort blieb ich gerne, wenn ich den Weg von Sospel hergefunden hatte, das war meine Etappe. Ein Stück weiter begann Wald (dies war die Grammond-Seite des Flusses), darin Kastanienbäume, unter denen im Herbst Pfifferlinge wuchsen. Eine Wildschweinbande kam dann regelmäßig her, fraß die Kastanien und die Pilze. Einmal aber kam ich ihnen zuvor, hatte selber Hunger und gar keinen Proviant mehr, nährte mich einen Tag lang von den Früchten und den Pilzen. Hier also übernachtete ich meist. Man ist wie trichterförmig rings von Bergen umgeben in schöner Skulptur. Gerade gegenüber hoch ist eine Felsklippe im Vorgebirge, dort sah ich einst Adler nah kreisen, wie wenn sie dort einen Horst hätten. Einmal erschreckte mich abends ein Fuchs (von denen hatte ich schon einen selbst gesehen, unten an der Roya), der nur zwei Armlängen links von mir auf dem Pfad um den Busch kam und, selber erschreckt, mich perlig anknurrte. Am folgenden Tag ging ich gewöhnlich weiter. Da flußab sind Ruinen von alten Anwesen auf flachen Vorbergausläufern. Die Leute hatten hier schon immer in allen Lagen Oliven angebaut. Deswegen heißt Olivetta ja so. An einem dieser Ruinenplätze blieb ich manchmal. Davor, 6 m tiefer, hat der Fluß eine reizende Stelle, strömt schmal und kräftig herbei und boldert da 1½ m hinab in ein Unterbecken. Schöne, starke Schau. Zu sagen, daß der Fluß immer laut ist, man hört ihn bis in die Paßhöhen, er ist immer bei Laune, ein gemäßigtes, ebenes Rauschen, bei dem gut zu erkennen ist, woher es kommt. Unter dem Wassersturz dort wächst Tanggras im Wasserboden, und in diesem wogenden Gras verbergen sich gern Schlangen, die mitwogen – die Undinen. Überhaupt zu sagen, wie still sehr lebendig das Land und der Fluß sind. Schlangen sind da überall, Land- und Wasserschlangen. Das ist ein liebes Völkchen, bei denen ist immer was los. Libellen und Crickets. Kröten. Wo immer das Wasser etwas Raum gab, Forellen, die gern ein wenig zurückguckten, wenn man sie ansah. Nicht wenige hatten rosige Male an den Seiten – da waren sie wohl über Wasserstürze an Stein gescheuert und die Schuppen waren weg. Einmal sah ich zwei Welse ihre Steinchen wenden. Die Adler konnten immer erscheinen und der Eichelhäher. Eines Tages, da war ich schon oben auf dem Paßpfad über der linken Talseite, sah ich einen Kranich das Tal hinauffliegen. Im Wasserboden selber kam alle zwei Tage vielleicht mal ein einzelner Forellenangler hindurch. Sonst waren da sicher keine Menschen. Zu Beginn, als ich den Platz mit den Nußbäumen gefunden hatte, räumte erst einmal auf. Der kleine Fluß hat erkennbar Hochwasserzeiten, meist im Frühjahr, da ist er bis zu 2 m höher. Trägt dann, etwa von Sospel her, allerhand Debris umher. Plastiktütenreste, Schrott, nicht wenig. Weiter oben, wo der Pfad einmal ganz hinab ans Wasser geht, fand ich Fetzen eines schönen, schlanken, rosenfarbenen Seidenkleids. Daß Menschen in der Nähe sind, ist also immer zu sehen. Ich räumte Schrott weg, so weit er sich bewegen ließ, sammelte brennbare Abfälle, türmte sie auf zusammen mit Treibholz und zündete den ziemlichen Haufen an, auf einer Kiesinsel im Wasser. Es war ein klar sonniger Nachmittag, wie dort meist. Als der Scheiterhaufen so richtig lohte, sah ich auf einmal am Ufer eine sicher drei Fäuste große Unke vor mir hocken, die hatte glutrote Augen. Sie saß nur da, in ruhiger Spannung, sah mich und das Feuer. Sonst nichts. Als das Feuer herabgebrannt war, fand ich sie nicht wieder. Auch der Skorpion scheint Feuer zu mögen. Weiter oben in einer Ruine zündete ich einst ein Holzfeuer an, da kam ein Skorpion zwischen den Steinen hervor und sah sich das für eine Weile mit an. Feuerzeichen werden dort vielleicht recht ernst genommen. In den folgenden drei Jahren gab es jedenfalls drei große Bergbrände im nahen Gebirge. Einer lohte hinab bis an die Küste, bis in die Felsen über Monaco. Ein Gartenhalter bei Nizza aber später zeigte: es ist gute Sitte, mit mäßigem Feuer seinen Garten klar zu halten, das ist, so oder in der rasenden Bergfeuerei, allemal Hygiene. Folgte man der Bevera also weiter hinab, kam man an eine Eselbrücke, unter der in bewegt tiefem Wasser gerne Forellen spielten. Links des Flusses, also wieder auf Mangiabou-Gefüß, führt ein steiniger Fußpfad vielleicht 150 m weit hinauf zu einem Paß. Dort kreuzen sich zwei Pfade. Der eine kommt aus dem Bevera-Boden herauf und geht auf der anderen Seite der Schneide hinab nach dem unten gut sichtbaren Ort Airole, auf einem Kegel in einer Kurve der Roya gelegen. Hier ist zu sehen, daß nicht mehr viel Niveauunterschied zwischen den beiden Wassern ist. Auf dem Paßgrad selbst aber zieht sich ein Querpfad hin, links hinauf über den Vorberg wieder nach Olivetta hin, an dessen Friedhof vorbei; nach rechts, eben verlaufend, zu dem Dörfchen Collabassa, das wieder vor einem sich verdickenden Vorbergmassiv, auf einem Sattel zwischen Roya- und Beveratal liegt. Dort führt eine Serpentinenstraße nach Airole hinab ins Royatal, doch die Kinder steigen den Eselpfad auf der anderen Seite hinab, um in der Bevera zu baden. Die Kinder in Airole drunten haben am Platz eine breite Kiesschwemme, wo sie spielen (wichtig für das Sittenbild jeder Gegend: sieh, wo sie ihre Kinder baden lassen, und Du siehst die Bornen, woran sie sich jung halten – in Piene droben dürfen die Kinder in der Trinkwasserzisterne baden, und von ihren jungen Häuten her trinkt sodann das Dorf...). _________ Auf dem Gartenabsatz in der Wildnis liegend, wenn ich meinen Frieden gefunden hatte, lauschte dem nahen Rauschen des Flusses, fand, es höre sich an wie hoch trillernde Singstimmen aus barbarischen Landschaften. Ah, hör an, die kilikischen Chöre, dachte ich, meinte: der Fluß, bei all seinen Verschiedenheiten, ist doch ein zusammenhängender Schwingkörper, eine Saite. Es war wohl nicht ganz unwahrscheinlich, daß Frequenzen dort hindurchklangen, die noch im Meer zu finden waren und dort weit fortschwangen. Erst viel später las ich, Kilikien, das sei die Mark im Südosten der Türkei, in deren Nähe der Fluß Saleph fließt und mündet, worin Barbarossa damals ertrunken. Dann fand ich natürlich weitere Vergleichbarkeiten. Einmal, als ich in dem Wasserbogen bei den Nußbäumen gebadet hatte, hob Steine auf, warf sie in die steile, etwas unfeste Bergseite hinüber, nur so aus einer Laune, fest genug, daß es Impuls übertrug da, wo es auftraf. Abends dann, als ich ruhig lag, lauschte der Welt und meinen Gedanken, hörte flußab einen Eklat: etwas bewegte sich, ein ziemlicher Stein rutschte herab und fiel laut plumpsend ins Wasser. Aha, dachte ich, der Berg macht etwas aus meiner Anregung. Der reizvolle kleine Fluß rief natürlich danach, etwas mit ihm zu tun. Zunächst dachte ich mir eine Wanderschaft aus, brachte von der Eisenbahn wasserdichte Säcke mit, verpackte darin mein Zeug und meine Kleider, versuchte nun, mit dem Paket, indem ich es vorauswarf oder hinterherzog, einen Weg durch die Wässer zu machen. Doch das ging nicht gut, das Paket war undicht, und ich mußte die Tour abbrechen. Aber die Idee, laufend und schwimmend, möglichst nackt, den Fluß entlangzuziehen und zu erforschen, war einmal da. Bei anderer Gelegenheit nahm ich das so: ich ließ meine Sachen und Kleider im Garten zurück, zog mir die Badehose über die rechte Schulter, damit ich sie dabei hatte. Angler könnten ja immer auftauchen, und bei Collabassa war man vom Berg her sichtbar. Außerdem mochten da ja die badenden Kinder sein. Denen wollte ich züchtig erscheinen. Sonst genoß ich meine Bloßheit, wanderte, über gewachsenen Fels gehend oder im Wasser stapfend und schwimmend, zunächst einmal flußauf, um die paar Windungen. Kam bei der Zypresse aus, welche die Grenze zwischen den Gärten und der Wildnis markiert. Dort in dem vielleicht sechs Meter breiten Wasser fand sich inmitten ein flacher, skulptischer Stein, der glich in Form und Größe dem Leib einer Frau, die mit aufgespannten Schenkeln auf dem Rücken liegt, vom wellenden Wasser umspült. Das kam mir recht, ich legte mich bäuchlings auf den Stein, wie ich mich auf eine so gebreitete Frau legen würde, fühlte ein wenig, wie das ist. Dann stand ich auf, kehrte um, denn in die Scham des Menschenlandes wollte ich nicht laufen. Außerdem wird der Fluß in dem breiteren Talboden dort uninteressant, nur flach zwischen lauter Steinen. Zurück zum Ausgangspunkt also, und dann dort weiter flußab. Das ist eine merkbar längere Strecke. Der Fluß ist anders hinter jeder Ecke und hat allerhand Spielplatz. An einer Stelle beispielsweise kann man über festen, gewachsenen Fels neben ihm hoch hergehen. An einer anderen formt er eine karrenbreite Rinne, in welcher das Wasser eben gleichmäßig fest fließt – dort läßt sich gegen den Strom anschwimmen, und man bleibt dabei immer an derselben Stelle. Noch weiter abwärts, wo wahrscheinlich nicht einmal mehr die Angler hingehen, hat ein Genosse eines anderen Zeitalters sich einen Waschund Badeplatz angerichtet, regelrecht aus dem Bodenfels ein circa viereckiges Becken herausgemeißelt, mit Stufen, die unter Wasser da von der rechten Seite hineinführen. Das Wasser wird vor der vorderen Felsenmauer in einen schmalen Kanalgang geführt, gerade weit und tief genug, daß ich darin stehen konnte, den Kopf über Wasser. Dieses kommt also daher, läuft vor dieser Mauer, in diesen mannsbreiten Kanal, von rechts her davor, und da ist nun eine Lücke ausgehauen, durch die es in kopfdickem Strahl eine Elle tief in das Becken fällt. Ich hatte einmal eine Taucherbrille dabei, stellte mich in den Kanal, der mir gerade eben Raum gibt, versenkte mich und blickte von unterwasser mit diesem stark fließenden Wasserbogen. Könnte mir vorstellen, daß diese Stelle den Forellen gefällt. In dem Becken selber badete ich nicht, denn da ragte eine Baumleiche bis unter die Oberfläche. Das war mir zu ungeheuer. Überhaupt wird der Fluß gegen Ende seines Zickzackweges durch den Berg merkbar schattiger, lebloser, sonderbar. Nach einer lauten, flachen Stelle, wo’s den Schlangen zu gefallen scheint, kommt dann das Ende dieses Weges durch den Berg, eine etwa 6 m breite, vielleicht 150 m lange Klamm, mit nicht hohen, aber senkrechten Felswänden. Auch dort tote Bäume unter der Oberfläche, das Wasser ganz still. Die Klamm ist so geknickt, daß von innen her nicht durch sie hinauszusehen ist. Ein vages Graulen fiel mich da an, ich schaute, doch ging nicht in dieses unheimlich stille, unbestimmt tiefe Wasser, an dessen Seiten nicht hinauszusteigen war. Bei anderer Gelegenheit war ich über einen Bergpfad gegangen, der diese Stelle weit unter sich sieht. Da ist dann zu erkennen, wie nach den Felsen der Klamm das Wasser über einen breiten und langen Kiesgrund ins offene Tal davor ausfließt. Gleich daneben stehen die paar Häuser des Fleckens Torri, und die Kinder von dort baden und spielen in dem Flachwasser am Ausgang der Klamm. Schönstes Sonnenlicht mit feinen Schatten, nichts, das normaler sein könnte. Doch von drinnen her das kleine Stück durch die Klamm bis da zu schwimmen, könnte mir nicht einfallen. Ein andermal wanderte ich in Kleidern dorthin, wollte partout nicht mehr umkehren und kämpfte mich durch vertrockneten Brombeerdornicht da rechts eine steile Böschung hinan. Mußte einen Schuh ausziehen, damit die trockenen Ranken, drunter herkriechend, zu zerschlagen. Gedanken an die Königskinder, die in Wildnis und Dornenranken bestehen müssen, und an Chrustchev mit seinem ausgezogenen Schuh damals in der UNO. Direkt über den Felsen der Klamm ist da sofort ein Pfad, der nach Torri führt. Mit diesem Ort beginnt der weit offene Talboden, worin die Bevera fließt linksherum um einen Vorberg, tändelt noch ein wenig flach und mündet dann bei einem Ort Bevera, der eine Bahnstation hat, in die da auch nur noch weit flache Roya. Nach Süden hin ist das letzte Tal der Bevera von einem Bergkegel begrenzt, der zur Zementherstellung in Stufen abgebaut wird, bis zum Gipfel. Hinter diesem sofort die Küste. Die vereinigten Gewässer der Roya und der Bevera filtern durch eine Schotterebene zum nahen Ventimiglia am Meer. Dort sammelt sich all das Wasser in einem Kanal und fließt, sehr kräftig ziehend, eishellblau-grünlicher Guß, in einem vielleicht metertiefen, drei Meter breiten und sechzig Meter langen Auslaß ins Meer. Das war die Herrlichkeit, die hier endet. Das sind die beiden Flüsse am Mangiabou-Vorgebirge. Von Piene auf dem Berg ist zu sehen, daß die Roya der unterirdischere von beiden ist, tiefer gelegen, in einem titanischen Tal, das sich bis zum Tende-Massiv an der Grenze nach Piemont hinzieht. Einmal hatte ich Gelegenheit, von dieser Höhe her einem nächtlichen Gewitter zu lauschen. Da rollt dann der Donner endlos und stark das weite, vielgestalte und tiefe Tal hinan, von den großen, steinigen Bergseiten wieder und wieder umhergeworfen. Durch das Royatal führt die vielbefahrene Staatsstraße, ein Neubau schon, der während meiner Zeit dort noch weiter ausgebaut wurde, neue Tunnel angelegt usw. Links der Roya führt die ältere Straße entlang, die nicht mehr benutzt ist und schon weitgehend verschüttet, denn der Berg arbeitet immer. Im Stausee von Breil sind keine Fische – auch im ganzen Fluß habe ich nie welche gesehen, nur einmal eine von den kleinen Schlangen gefunden, die da gern die Luft anhalten und sich in Tümpeln zusammenrollen, um zu ruhen, und vielleicht zu lauern. Die Roya, das ist ein großes Tal ganz nach der Art des großen Gebirges, der Alpen. Dort ahnen sich immer Fernen in den Tallagen. Die Bevera ist der Spiel- und Liebesgarten des Mangiabou-Gebirges, das angenehm aussieht, eine grasige Höhe wie ein Zeltdach, und gut zu seinen Menschen und Tieren ist. Einmal in einem Spätwinter kam ich zu einem Blickpunkt in diesem Gebirge, da wirkte der Hauptstock, aus mittlerer Höhe betrachtet, weitgehend schneebedeckt, wie ein umgekippter Tisch, vielleicht von einem zornlachenden Gott so gestürzt. Von der ganzen Höhe her, bei passend Licht und Schatten, bestätigt sich dieses Bild: die gestaltreichen Vorberge tief unten wirken wie Töpfe, Geschirre, Materialien, die so vor den Tisch gestürzt sind. Die Bergstöcke da wirken auch allgemein sehr bildhaft. Die Tete d’Alpe, das Massiv links der Roya, über das hoch auch ein anderer Grenzpfad verläuft, sieht von den Gärten Pienes her aus wie die gigantische Pranke einer Sphynx. Unten bei Sospel steht ein nicht hoher Einzelberg, der gleicht einer großen Motte. Besonders große Motten gibt es da ja, das hatte ich zu der ersten Nacht in Piene schon gesehen. Ein anderer Vorberg, auch an der Bevera, wirkt mit seiner Höhe wie eine Schleiche oder Schlange. Auf einer anderen Höhe, vielleicht am Grammond, fand ich bei beginnendem Sternenschein einen Bergstock, der wirkte wie eine elegante Frau in einem kostbar mit Edelsteinen bestickten Jäckchen. Bei all diesen Phänomenen ist ein wenig wichtig, daß man sie im richtigen Moment erblickt. Das Gebirge erzählt nämlich eine Geschichte, die zu verstehen lohnt. In den Gärten Pienes, zum Mangiabou hin, gelegentliche Zisternen, aus kleinsten Quellen genährt. Neben einer, viereckigen, wächst ein Nußbaum, das heißt: ich sah ihn wachsen, doch im Jahr drauf wollte er nicht mehr. Neben der Zisterne auch zwei junge Obstbäumchen, die schon blühen, weiß. Wenn ich dort vorbeikomme, trinke immer von dem Wasser und nenne den Platz den Brautbrunnen. Wenn ich vom Gebirge erzähle, komme ich natürlich nicht daran vorbei, von Menton zu berichten, der kleinen, lieblichen Gartenstadt am Meer, in den dortigen Ausläufern des Grammond-Gebirges gelegen, nächst bei der letzten Klippe der Alpen am Meere, wo die alte Grenze ist. Zum ersten Mal habe ich Menton gesehen, als ich damals nach der zu komischen Geschichte in Belgrad wiederkehrte, nahm da mit dem flotten weißen Caravan den Weg durch Norditalien, via Genua die Küste entlang, und passierte hier die Grenze nach Frankreich. Was, dachte ich im Abend, ein Nymphengarten? Später kam ich per Anhalter wieder dort vorbei, traf ein paar flippige junge Leute, die mich einluden, mit ihnen zu kiffen und eine geklaute Flasche Champagner mitleerzumachen. Übrig blieb dabei die Bekanntschaft mit Danilo und Catherine, die ich wiederholt in einer kleinen Wohnung besuchte. Ich mußte da erst fußfassen, war auch erst dabei, mir das Reisen mit der Eisenbahn anzugewöhnen. Dann verlor sich das gewissermaßen. Dafür machte ich eine Entdeckung: am Ende der Stadt, vor der Grenze, fand ich eine aufgelassene Pension, in die leicht ein- zudringen war. Dort nistete ich mich ein, sah, da müssen früher vor allem Belgier gewohnt haben – Menton gehört zu den Plätzen an der Riviera, wo die Gallier, und auch Völker wie Holländer und Schweden, neuerdings auch Russen, gerne ihren Lebensabend verbringen. Die Engländer waren auch lange da, haben eminente Hotelbauten hinterlassen, ziehen aber anscheinend nun Spanien vor. In diesem Hotelchen hatten also Belgier gelebt, die eine kleine Bibliothek dagelassen hatten, in der ich die fleurs du mal zu lesen fand. Die Elektrik ließ sich kurzschließen, und ich konnte daher ein wenig fernsehen. Aber es war kein Wasser im Haus. Die nutzlose Wasserleitung war aus Blei, daher brach ich Stücke davon ab, schmolz es, goß ein Strukturmodell davon, wie es mich da grad beschäftigte. Wasser also holte ich mit Eimern von einem kleinen Brunnen gleich bei der Grenze, da zweigt sich die Straße, und in dieser Zweigung steht der Born, wo ein bronzener Putto speit reinstes Bergwasser in eine Schale. Ich trank gern direkt von dem Wasser und vergaß nie, den Putto dabei auf den Mund zu küssen. Wisse Dein Glück! Später, als ich manchmal auf Durchreisen dahinkam, wusch mir da die Füße, in der Pforte Frankreichs. Ich weiß von Sitten, aus katholischer Jugend. Von der Pension aus war es ein gutes Stück, eine Promenade entlang, an den Rand der Innenstadt. Die Straße dringt da getunnelt durch einen Felsen, auf dem darüber der Stadtfriedhof, und vor dem Tunnel ein anderer Brunnen, zum Gedenken an Queen Victoria, Abbild, Wappen und alles, obendrauf die Figuren des Löwen und des Einhorns, welchem das halbe Horn abgebrochen ist. Nach dem Tunnel kommt man bald in die Stadtmitte, wo ein lauschiger kleiner Platz ist, neben dem Fischmarkt, auf diesem wieder ein Brunnen, von dem ich oft trank, wenn ich mich nachts dort umhertrieb. Menton ist ein sehr menschliches, heiteres Städtchen, ein ganz klein wenig provinzieller als das nahe, mondäne Monaco. Die Menschen in Menton wissen, wie gut sie’s haben. Vom Berg her ziehen vier, fünf längere Vorhügel in den Ort hinab, und zwischen diesen gartenbebauten Hügelzügen jeweils ein kleines Gewässer. Auch der Grammond, der von der Gebirgsseite her gesehen immer eher wie ein Totenberg aussieht, ist gut zu seinen Kindern. Diesem oder jenem Bach bin ich gelegentlich ein wenig hinangefolgt, Gärten zu den Seiten, schattiges Laub. Das Gebirge weiter oben hat, außer im Sommer, eher ein Klima wie ein deutsches Mittelgebirge, doch direkt am Ufer ist oft dichte Wärme. Man unterhält hier gerne botanische Gärten, und manche Privatgärtner halten sich Bananenstauden. Das Wasser lispelt also in Menton überall dazwischen, das ist sehr angenehm, kommt man vom Gebirge herab und findet die warme Uferluft etwas dicht. Zu bedenken, wie der Ritus des Taufens eigentlich erst Sinn macht, wo ein Menschenort solche freien, guten Bornen hat. So gesehen, ist Menton einer der christenmöglichsten Orte, die ich kenne. Und dann, wie es auch nicht-sein kann, gleich nebenan in Monaco. Dieses ist ja deutlich um den Hafen gebaut, rechts der Felsen Monaco mit Palast, Festung und Staatsbauten, links auf einer Höhe das moderne, mondäne Monte Carlo, große Hotels, das Casino, die hochgebauten Wohnanlagen. Die Grenze zwischen beiden Ortsteilen ist genau zu erkennen: am linken Eck des Hafens führt eine hohe, aber kurze Schlucht in den Berg. In deren Eingang steht die kleine, romantische Kirche der Ste. Devote, der Dorfheiligen von Monaco. Devote war die christliche Frau eines römischen Offiziers. Während einer Seefahrt starb sie hier vor der Küste. Man brachte ihren Leichnam an Land, bahrte ihn auf, doch Briganten erschienen und raubten ihn. Die Leute von Monaco setzten ihnen nach, holten sie auf dem Meere ein und brachten Devotes Leichnam wieder heim. Zum Gedenken daran wird von den Fürsten jedes Frühjahr ein Bötchen vor der Kirche verbrannt. Soweit die Geschichte. Die Schlucht hat hoch oben einen Absatz, und in dessen Höhe führt eine Straßenbrücke von hie Monaco nach da Monte Carlo. Der Absatz ist der Boden eines ehemaligen Gewässers, das da früher herabkam, stürzte als Wasserfall in die Schlucht und mündete in den Hafen. Ich meine, das muß der Platz einer guten Nymphe gewesen sein, die hier mit ihren Ziegen lebte. In dem Boden auf dem Absatz, gleich neben der Brücke, steht eine alte Autowerkstatt. Das Wasser rinnt also sicher seit langem nicht mehr. Eine seiner Wirkungen wird gewesen sein, einen kühlen, kräftigen Luftzug zu erzeugen, der, durch die Schlucht gerichtet, als Wind ein Stück weit auf das Meer hinauswehte. So wird alte Zeit das gekannt haben, als die Ziegen auf diesen Klippen noch unter sich waren. Andere wichtige Wasserstellen sind an dem Ort sonst nicht zu finden. Die Zivilisation ist natürlich unnachgiebig. Wenn sie einen Ort erst einmal hat, arbeitet sich um so mehr hinein. Während der Zeit also, die ich dort schauend verbrachte und kam darauf, wie sich das alther mit der Devote-Schlucht verhält, wurde die linke Seite des Platzes aufgerissen, da ein großes Reservoir des Wasserwerks eingebaut (alles Beton). Dann wurde, links im Gefels, die Tunnelhöhle des neuen Bahnhofs angelegt, die da hervor, über eine Brücke nun, eine Fortsetzung des Tunnels unter Monte Carlo hindurch findet. Der Fürst selber hat mit seinem Leib für diese Dinge gebüßt, doch davon wird natürlich die Devote-Schlucht nicht mehr, was sie einmal war. Die Götter schweigen, das Wasser ist fort. Es ist immerhin möglich, sich in den alten Ortsteilen gegenüber dem Felsen nach den Menschen umzuschauen, die da an alten Bornen sitzen. Solche Sitte möchte ich immer kennen. Noch einmal zurück ins Gebirge, nach Breil an der Roya. Auf deren Stausee jene lieben Schwänchen, die für Blicke und Gesten antworten. Kein Fisch im Gewässer, wie gesagt. Eines der Schwänchen aber wies mich auf einen Weg, der dann gleich vor dem Ort links des Flusses in die Felsen steigt. Dort hochgehend, kam ich an einen Punkt, da ist rechts unten, direkt am Wasser, eine Grotte zu sehen, schattig tief und ziemlich groß. Im Vordergrund dieser Höhle Steinformen, verschiedene. Ein vorne quer liegender Stein wirkt wie ein liegendes Kleinkind, ein anderer, rechts, etwas einwärtiger, wie eine knieende Frauengestalt. Was immer andere Welt sich extra machen muß – dieses Gebirge hat es als Naturspiel, und Tier und Mensch wissen darum. Weiter aufwärts an dieser Steige ist auch ein klar bewässertes Becken, von derlei träumen italienische Brunnenbauer. In einem kleinen Sturz fällt da Wasser aus einem Bergquell in ein Steinbassin, gerade groß genug für einen Menschen, sich da badend auszubreiten. Dann fließt das Naß weiter, kurz hinab in die Roya. Natürlich habe ich dort gebadet, als ich den Platz fand. Das Wasser ist kühl, sehr klar, und es schmeckt! _________ feedback to: [email protected] Ciao.