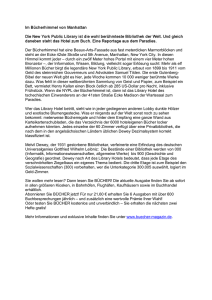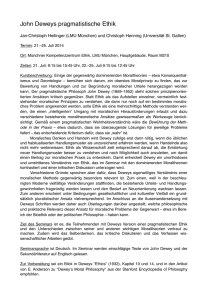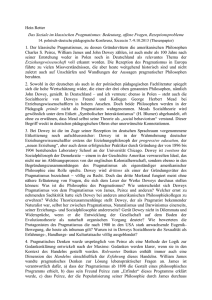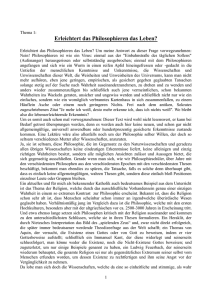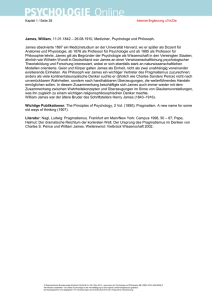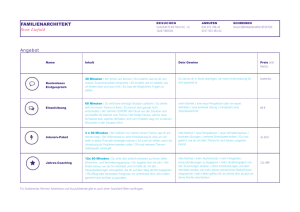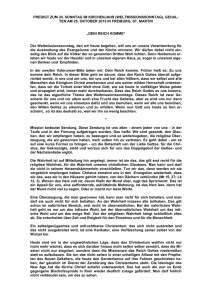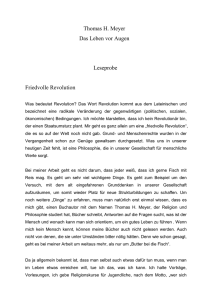Manuskript Wissenschaft und Weisheit vom 4.10
Werbung
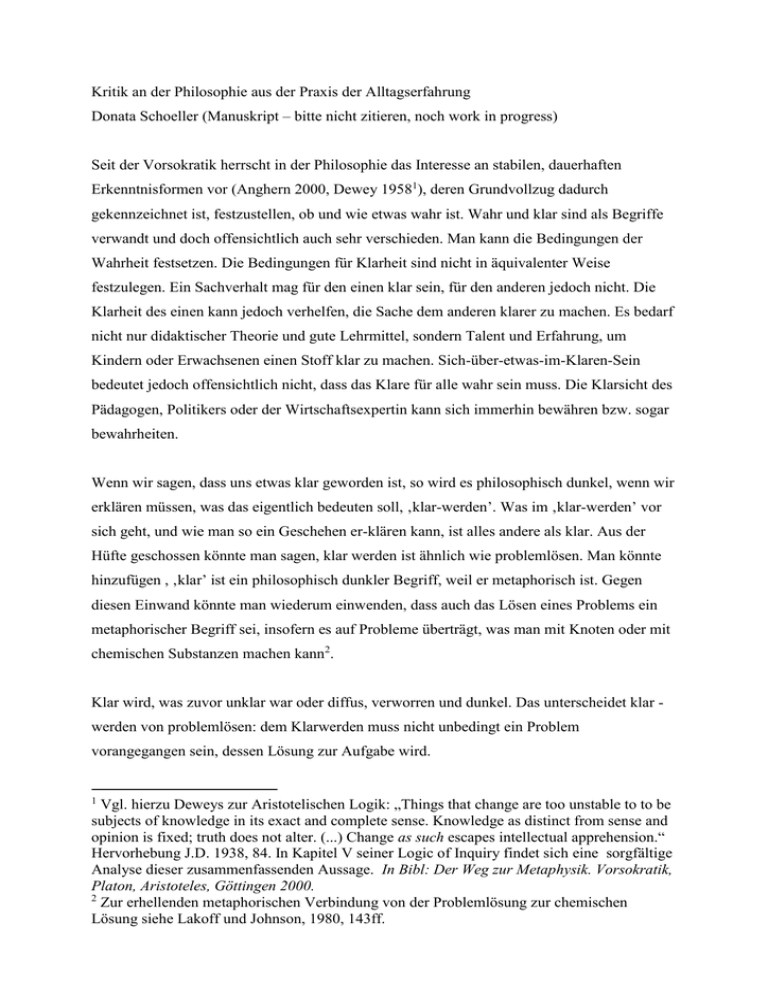
Kritik an der Philosophie aus der Praxis der Alltagserfahrung Donata Schoeller (Manuskript – bitte nicht zitieren, noch work in progress) Seit der Vorsokratik herrscht in der Philosophie das Interesse an stabilen, dauerhaften Erkenntnisformen vor (Anghern 2000, Dewey 19581), deren Grundvollzug dadurch gekennzeichnet ist, festzustellen, ob und wie etwas wahr ist. Wahr und klar sind als Begriffe verwandt und doch offensichtlich auch sehr verschieden. Man kann die Bedingungen der Wahrheit festsetzen. Die Bedingungen für Klarheit sind nicht in äquivalenter Weise festzulegen. Ein Sachverhalt mag für den einen klar sein, für den anderen jedoch nicht. Die Klarheit des einen kann jedoch verhelfen, die Sache dem anderen klarer zu machen. Es bedarf nicht nur didaktischer Theorie und gute Lehrmittel, sondern Talent und Erfahrung, um Kindern oder Erwachsenen einen Stoff klar zu machen. Sich-über-etwas-im-Klaren-Sein bedeutet jedoch offensichtlich nicht, dass das Klare für alle wahr sein muss. Die Klarsicht des Pädagogen, Politikers oder der Wirtschaftsexpertin kann sich immerhin bewähren bzw. sogar bewahrheiten. Wenn wir sagen, dass uns etwas klar geworden ist, so wird es philosophisch dunkel, wenn wir erklären müssen, was das eigentlich bedeuten soll, ‚klar-werden’. Was im ‚klar-werden’ vor sich geht, und wie man so ein Geschehen er-klären kann, ist alles andere als klar. Aus der Hüfte geschossen könnte man sagen, klar werden ist ähnlich wie problemlösen. Man könnte hinzufügen , ‚klar’ ist ein philosophisch dunkler Begriff, weil er metaphorisch ist. Gegen diesen Einwand könnte man wiederum einwenden, dass auch das Lösen eines Problems ein metaphorischer Begriff sei, insofern es auf Probleme überträgt, was man mit Knoten oder mit chemischen Substanzen machen kann2. Klar wird, was zuvor unklar war oder diffus, verworren und dunkel. Das unterscheidet klar werden von problemlösen: dem Klarwerden muss nicht unbedingt ein Problem vorangegangen sein, dessen Lösung zur Aufgabe wird. Vgl. hierzu Deweys zur Aristotelischen Logik: „Things that change are too unstable to to be subjects of knowledge in its exact and complete sense. Knowledge as distinct from sense and opinion is fixed; truth does not alter. (...) Change as such escapes intellectual apprehension.“ Hervorhebung J.D. 1938, 84. In Kapitel V seiner Logic of Inquiry findet sich eine sorgfältige Analyse dieser zusammenfassenden Aussage. In Bibl: Der Weg zur Metaphysik. Vorsokratik, Platon, Aristoteles, Göttingen 2000. 2 Zur erhellenden metaphorischen Verbindung von der Problemlösung zur chemischen Lösung siehe Lakoff und Johnson, 1980, 143ff. 1 Das Phänomen des Klarwerdens tritt deutlicher hervor, wenn man das Wortfeld ‚klar’ betrachtet. Es klärt sich auf, sagen wir, wenn Nebelschwaden abziehen3. Wir sagen auch, es klärt sich auf, wenn ein komplexer, verwickelter Sachverhalt, z.B. ein Kriminalfall durchsichtig wird. Wir sagen auch, etwas ist klar geworden, z.B. ein Messingkrug, nachdem man ihn poliert hat und er nicht mehr dunkel und matt aussieht. Was allen drei Fällen gemeinsam ist: die erreichte Klarheit ist kein Dauerzustand. Das aufgeklärte Wetter kann sich wieder zuziehen und dem aufgeklärten Fall folgt bald der nächste Fall – der wieder vor eine neue Herausforderung stellt. Ob man aus dem ersten Fall etwas für den nächsten gelernt hat, ist nicht gesagt und auch nicht leicht zu sagen, wie man davon lernt. Und auch der polierte Krug muss bald wieder weiter poliert werden, damit seine Klarheit aufrechzuerhalten ist. Im Glas scheint die Klarheit festgeblasen, aber auch das Glas muss immer wieder gewaschen oder gewischt werden, dass es glasklar bleibt. Auch dieser Umstand unterscheidet aufklären bzw. klar werden von problemlösen. Hat man einmal ein Problem gelöst, ist es gelöst und seine Lösungswege stehen fest. Die Vergänglichkeit von Klarheit mag der Grund sein, warum die Kategorie der Klarheit in der Philosophie, trotz Descartes, keine grosse Karriere gemacht hat und warum sich im philosophischen Wörterbuch unter „klar und deutlich“ nur zwei spalten finden und im Handbuch philosophischer Grundbegriffe4 beide Begriffe nicht einmal vorkommen. Auf die Nähe des Klaren zum Deutlichen machen die Gebrüder Grimm aufmerksam wie das Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe von Eisler, dessen kleine Sammlung an unterschiedlichen Definitionsversuche über die Jahrhunderte hinweg ein Merkmal hervorstreicht, dass mit Kant harmoniert5, insofern ‚klar’ darauf hinauszulaufen scheint, dass ein Gedanke, Gegenstand bzw. eine Vorstellung von einem Gegenstand oder ein Begriff von anderen gut zu unterscheiden ist. Was mit dieser Definition bereits verstellt ist, ist worum es in dieser Untersuchung geht: wie es dazu kommt, dass Unterscheidungen klar werden bzw. prädizierend Klarheit schaffen können. Dafür muss hinter diese Definition zurückgegangen „Wir dagegen heutzutage fühlen dieses klar mehr als gegensatz zu trübe (...). Ein klarer tag oder himmel ist uns nicht mehr schlechthin ein glanzvoller, sonder mehr der, dessen helle durch keine dünste, wolken, nebel gestört ist. Eine helle nacht nennen wir eine mondnacht, eine klare nacht mehr die, welche frei von dunst und nebel ist, klare luft hat.“ (Grimmsches Wörterbuch) 4 Hg. von Hermann Krings et al. 5 „Das Bewusstsein seiner Vorstellungen, welches zur Unterscheidung eines Gegenstandes von anderen zureicht, ist Klahrheit.“ Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, I § 6. 3 werden. Denn Gedanken oder Vorstellungen, die von anderen gut zu unterscheiden sind, liegen nicht schon vor wie fertige Muscheln am Strand, sie müssen vielmehr entstehen – so wie Muscheln auch. Damit sie dazu beitragen, dass etwas klar werden kann, muss ein Prozess in Betracht gezogen werden, indem die fertige Unterscheidung erst ein Endresultat ist und einiges zusammenkommen muss, dass sie Klarheit schafft. Beginnt man mit klaren Begriffen, wird häufig übersehen, wie Dewey sagt, dass diese „a happy outcome of a complex history“ sind, die aus aus vielen Faktoren bestehen. In üblichen Narrationen der Ideengeschichte als Abfolge, Entwicklung und Reaktion einer klaren Idee auf die nächste, wird die Rolle der unklaren Übergängen, der sozialen Interaktionen, der gegenseitigen Hilfe und Ausrichtung, des gemeinsamen Arbeitens oder Kämpfens, der konzertierten Aktion meistens völlig ausgeblendet, wie Dewey bemerkt6. Klarheit, so könnte man pointiert sagt, hat als Vorbedingung grösserer Komplexität als Wahrheit. Entsprechend gibt Kant zu bedenken, dass klare und deutliche Vorstellungen als Ursache „verworrene“ und „vielhaltige (percpetio complexa)“ Vorstellungen haben, „denn im Einfachen gibt es weder Ordnung noch Verwirrung“7. (Leibnitz hier) Wahrheit bedarf als Bedingung, dass etwas Behauptetes auch der Fall ist und sich nicht widerspricht. Ein Sachverhalt ist mit einem Blick als wahr auszuzeichnen (ja – der Schnee ist weiss). Die Beurteilung kennt keine graduellen Übergänge, sondern folgt einer eindeutigen, dualen Struktur: es ist entweder wahr oder falsch. Die Perfekt-Konjugation ist in diesen Beurteilungsformen eher unüblich (ausser bei Prophezeiungen und Prognosen). Dagegen ist es sehr üblich zu sagen, dass etwas klarer geworden ist. Dass etwas klarer werden kann oder geworden ist, bedarf verschiedener Phasen und Schritte – beispielsweise des graduellen, schrittweisen aufklärens. Das Prozesshafte unterscheidet Klarheit z.B. auch von Eindeutigkeit, ein Begriff, der auch bedeutungsmässig verwandt scheint. Man kann z.B. in einem emotional eindeutigen Zustand sein, z.B. eindeutig ärgerlich, eifersüchtig oder verliebt. Schon die Ausdrucksweisen ‚blind verliebt’ oder ‚blind vor Wut’ zeigen an, dass man sich zwar in einem sehr eindeutigen, aber eindeutig unklaren Zustand befindet. Es bedürfte eines Prozesses, z.B. Distanznahme, zusätzliche Blickwinkel, vielleicht etwas Zeit, um klar zu sehen, was es mit der Wut auf sich hatte oder warum die Verliebtheit blind war. 6 7 Dewey, Experience and Nature, 171 Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, I § 6, 138 In der Nikomachischen Ethik macht sich Aristoteles Gedanken darüber, was Menschen tun, die „mit sich zu Rate gehen“. Sie reflektieren in abwägender Weise, sie überlegen, was das „Richtige“ in einer gewissen Situation sein mag. Diese Reflexionsweise differenziert er in mehrfacher Hinsicht: er unterscheidet sie von der spekulativen Denkbewegung, die auf wahr und falsch aus ist, von wissenschaftlichem Erkennen, die auf „zwingenden Schlussverfahren“ beruht, vom praktischen Können, weil dieses ein Endziel „ausserhalb“ seiner selbst hat. Während das wissenschaftliche Erkennen mit Dingen befasst ist, „die keine Veränderung“ zulassen, ist die abwägende Reflexion gerade nötig aufgrund von veränderlichen Grundvoraussetzungen. Die Richtigkeit, auf die diese Reflexionsweise aus ist, hat damit zu tun, was dem Menschen „wertvoll“ ist. Darum ist das Ziel der Reflexion nicht ausserhalb ihrer selbst, sondern ist Bestandteil eines selbstzweckhaften, richtigen Handeln. Die Richtigkeit der reflektierenden „Denkbewegung“ zeigt sich also nicht erst an ihrem Resultat, sondern sie besteht als „Richtigkeit der Denkbewegung“, dass sie überhaupt und immer wieder vollzogen wird. Sie ist richtig als ein reflexiver Bezug, der nicht auf Allgemeines gerichtet ist, sondern in dem es darum geht, „vielmehr auch in den Einzefällen klar (zu) sehen.“8 (Hervorhebung D.S.) Hier soll es nicht um eine systematische oder historische Begriffsaufarbeitung von Klarheit gehen. Diese wenigen Andeutungen dienen dazu eine Frage zu öffnen, die bei Aristoteles in der Ethik beheimatet war, die aufgrund der historischen Vorrangstellung der Interesses an – wie Aristoteles sie nennt – ‚wissenschaftlicher’ oder ‚spekulativer’ Erkenntnis in den Hintergrund geraten ist. Dass das Phänomen des Sich-Klarwerdens wenig im Rampenlicht philosophischer Untersuchungen stand, mag eben damit zu tun haben, dass das Interesse an wissenschaftlicher Erkenntnis sich orientiert an einem Erfahrungsbegriff, der den Prozess des Klarwerdens gar nicht in den Blick geraten lässt. Dieser Erfahrungsbegriff macht die Frage nach der Möglichkeit, sich klar zu werden, überflüssig, insofern epistemologische untersuchte Erfahrung sich zumeist schon im Klaren darüber ist, auf was sie aus ist. Zum Zwecke ihrer Untersuchbarkeit ist sie auf ein einfaches Gerüst reduziert (Sinneseindrücke und Verstandeskategorien). Die Verworrenheit (bzw. der Reichtum) alltäglicher Erfahrungen und die Verworrenheit (bzw. der Reichtum) jenes Denkens, das noch nicht in Erkenntnis übergegangen ist, ist traditionellerweise vom philosophischen Begriff der Erfahrung und einem damit verbundenen Urteilsvermögen unberücksichtigt. Gerade solche 8 Nikomachische Ethik, Buch VI, 1141b 3-22 unberücksichtigen Erfahrungsformen jedoch machen die Aufgabe bzw. der Prozess des Klarwerdens relevant9. Seit den Experimenten von Galileo und Torricelli, so Kants durchschlagende Analyse, sei ersichtlich geworden, dass die Vernunft nur „das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt, dass sie mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Gesetzen vorangehen und die Natur nötigen müsse, auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr allein gleichsam am Leitbande gängeln lassen müssen; denn sonst hängen zufällige, nach keinem vorher entw orfenen Plane gemachte Beobachtungen gar nicht in einem notwendigen Gesetze zusammen, welches doch die Vernunft sucht und bedarf.“ (Kr.d.r.V, Vorrede 25). Obwohl Kant mit diesem Vorstoss kraftvoll für den Stellenwert von Erfahrung für fortschreitende Erkenntnis plädiert und damit einen philosophiegeschichtlich Wende einläutet, die die metaphysische Erhebung über „Erfahrungsbelehrung“ (26) als Leerlauf markiert, so ist mit seiner Aufwertung der Erfahrung alltägliche Erfahrung, als Zustand, indem man sich momentan tatsächlich befindet, als philosophischer Reflexionsgegenstand weiterhin auf einem philosophischen Abstellgleis geblieben. Kants kritischer Bestimmung von Erfahrung, von der aus sich „empirische Erkenntnis“ gewinnen lässt, riegelt diese hermetisch von alltäglichen Erfahrungen ab10 und damit auch von der ‚Vielhaltigkeit’, Verworrenheit und Ungewissheit, die diese häufig kennzeichnet. In dieser Hinsicht verstärkt Kant eine bis auf Aristoteles zurückgehende Begriffstradition11, wobei das philosophische Desinteresse an den 9 Man könnte auch formulieren, dass Relevanz nur dort entsteht, wo man sich über etwas (oder sich) klar werden kann bzw. muss. Es besteht deshalb eine enge Verwandtschaft zwischen dem, was wir als klar und dem, was wir als relevant empfinden. Wie auch Klarheit kein Dauerzustand ist, so kann etwas jetzt von Relevanz sein, was gestern noch, oder sogar vor einer Stunde noch unrelevant war und morgen auch wieder unrelevant sein wird. Angesichts dieser – in einen sich wandelnden und nicht festzulegenden Prozess – eingebetteten Kurzlebigkeit, scheint es deshalb auch kein Zufall zu sein, dass so knapp „klar und deutlich“ im historischen Wörterbuch vorkommt, von „Relevanz“ dort keine Spur zu finden ist. 10 Vgl. Holzhey, 1970, 202ff. „Für diese (Kants D.S.) gross angelegte Rehabilitierung der Erfahrung war aber ein hoher Preis zu zahlen: Es musste der Erfahrung alles abgesprochen werden, was sich mit dem nun einmal über den Fluss sich wandelnder Erfahrungen erhobenen Sinn der Wahrheit nicht vertrug und daher die Wahrheitsfähigkeit der Erfahrung in Frage stellte.“ (Tengelyi, 2007, 23) 11 „Mit dem von Aristoteles geprägten Begriff ist drittens fortan festgelegt, wann man es mit „Erfahrung“ zu tun hat und wann nicht. Auch wo sich dieser Grundansatz – in seiner wissenschaftlichen Bedeutung – noch klärt, verlässt das Erfahrungsverständnis nicht ie an den Terminus „Erfahrung“ gebundene aristotelische Auslegung, die das von der Erfahrung mit dem Wort „Erfahrung“ Ausgesagte in den Problemkreis der Frage nach der Wissenschaft rückt und darin aufhebt. Es gibt kein grundsätzlich neues Sichaussprechen der erfahrenden Herausforderungen, vor die uns das alltägliche Leben stellt, auf ein ähnliches erkenntnistheoretisches Niemandsland gerät wie die Metaphysik. Die Diffusität alltäglicher Anforderungen und Aufgaben, die uns zwingen, Klarheit zu gewinnen, um einen Entscheid treffen zu können, um den nächsten Schritt zu tun, um zu wissen, wie wir uns in einer Situation verhalten sollen, aber auch die Diffusität des Denkens vor der Erkenntnis, gelten traditionell nicht als untersuchenswerte Gegenstände für möglichen Erkenntnisgewinn. Gerade in alltäglicher Erfahrung, so Laszlo Tengelyi treffend, kann uns jeglicher Masstab für den Wahrheitsgehalt von Erfahrungen verlustig gehen12. Statt unser Wissen geordnet zu erweitern, scheint im Alltag oder im noch ungeordneten Denken Vernunft eben gerade an einem willkürlichen Leitbande gegängelt zu werden. Wir werden mit ‚zufälligen, nach keinem vorher entworfenen Plan’ gemachten Beobachtungen und Eindrücken konfrontiert, nach denen wir nicht gefragt haben. Aus solchen Erfahrungen ist, gemäss obigem Kernargument Kants, deshalb nichts zu lernen. Sie bestätigt kein Gesetz, das wir ihr vorgeben. Wir versuchen sie zwar gemäss sozialen, gesellschaftlichen, politischen Gesetzen in Schach zu halten, aber nicht, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, sondern eher um die ständige Bedrohung des schwer Einzuordnenden, des chaotisch Überraschenden einzudämmen. Der Weg von der Erfahrung zu gesichertem Wissen, er führt mit Kant, zuvor bereits durch Bacons Misstrauen gegenüber einer „planlose(n) und sich selbst überlassene(n) Erfahrung“ als „ein blosses Umhertappen im Dunklen, das die Menschen eher verdummt als belehrt“13 an der Alltagserfahrung vorbei. In Anlehnung an Kierkegaard könnte man sagen, dass der Philosoph im klassischen Selbstverständnis sich im aufgeräumten, hellen Palast-Raum der philosophischen Erfahrung aufhält, um nach getanem Tageswerk in den ungeordneten, unübersichtlichen Schuppen der Alltags-Erfahrungen zurückzukehren. Sie geht den Philosophen als Philosophen nicht mehr an. In diesem Gewimmel übergibt der Philosoph die Staffel dem Psychologen. Die an Menschen über sein Erfahren, jedenfalls nicht in Wort und Begriff „Erfahrung“. Indem dieser seiner relevante Auslegung im Begriff des Experiments findet, das auf Grund vorhergehender Überlegung (...) eigens angestellt wird, schliesst sich der Prozess der Auslegung von Erfahrung in unbedingtem Herrsein über Erfahrung ab.“ ( Kursivsetzung H.H., Helmut Holzhey, 1970, 36). 12 Tengelyi 2007, 22 13 F. Bacon, Novum Organum, übers. v. R. Hoffmann, hg. v. W. Krohn, Hamburg 1990, Bd. 1, §100, 219. Zum Unterschied von Alltagserfahrung und wissenschaftlicher Erfahrung siehe auch: „Die Erfahrungen, die wir machen, sprechen gegen die Erfahrungen, die wir haben“ Über Formen der Erfahrung in den Wissenschaften. Hg. von M. Hampe und Maria-Sibylla Lotter. Erfahrung und Denken. Schriften zur Förderung der Beziehungen zwischen Philosophie und Einzelwissenschaften, Bd. 86, Berlin, 2000, insbesondere die Einleitung. Kierkegaard angelehnte Metapher von Palastraum vs. Schuppen findet ein Analogon in der wissenssoziologischen Betrachtung von Dewey, der im Rückgang auf die Antike auf den Dualimus eines klassenspezifisches „höheren“ Wissen (der freien Bürger) im Unterschied zu einem „niederen“ Wissen (der Arbeiter) hinweist: „Science and philosophy (which were still one) constituted the higher form of knowledge and activity. It alone was „rational“ and alone deserved the names of knowledge and of activity that was „pure“ because liberated from the constraints of practice. Experiential knowledge was confined to the artisan and the trader, and their activity was „practical“ because it was concernced with satisfaction of needs and desires – most of the latter, as in the case of the trader, being base and unworthy anyway.“14 Gemäss dieser Hierarchisierung muss man für Plattformen, die sich der Herausforderungen und Problemen stellen, die Alltagserfahrungen für das Denken bedeuten, die Philosophiegeschichte mit der Lupe absuchen. Denn Alltagserfahrungen sind nicht einmal den ‚niedere’ Wissensformen, die in obigen Hierarchisierung erwähnt werden, unterzuordnen. Häufig jedoch scheint aus den Alltagserfahrungen, wie Aristoteles Unterscheidungen noch deutlich machen, kein praktisches Wissen hervorzugehen. Sie bringen entweder so unscheinbares Wissen mit sich, das kaum der redewert zu sein scheint, weil es uns lediglich ermöglicht, unseren Alltag zu leben oder sie können derartig ambivalent und veränderlich sein, dass sie den einzigen Bereich markieren, wo man mit Sicherheit so gut wie nichts sicher weiss und wissen kann: weder kann man mit Sicherheit wissen, wie das Leben weitergehen wird, noch, wie die schwierige Situationen zu verändern ist, und häufig weiss man nicht einmal genau zu sagen ‚was’ daran eigentlich so schwierig ist... (Vgl. Kap. 3). So sind es auch die Psychologen, die Literaten oder die Soziologen, und nicht die Philosophen, bei denen man nach Beschreibungen, Beispielen und Zeugnissen dieser Art von Erfahrung zu suchen hat. Der Soziologe Geertz nimmt zwar von dem Philosophen Ryle das Stichwort der „dichten Beschreibung“ auf, aber er macht es zu einem Schlagwort, das ein „kompliziertes intellektuelles Wagnis“ zum Ausdruck bringt15, das darin besteht, „nicht abstrakte Regelmässigkeit festzuschreiben, sondern darin, dichte Beschreibung zu ermöglichen“16. Es ist die Unregelmässigkeit bis hin zur Widersprüchlichkeit der Alltagserfahrung, die diese durch philosophische Wahrheitskritierien durchfallen lässt. Wenn Ingeborg Bachmann von einem „Zustand der Hilflosigkeit und der 14 Dewey, Logik, New York 1938, 75. Geertz, 1987, 10. 16 Ebenda 37 15 Schwäche“ spricht, den sie „ebenso wohltuend wie schrecklich (empfindet)“, und hinzufügt: „Aber auch das ist schlecht gesagt und trifft den Grund meiner Haltung nicht ganz.“17, so spricht sie treffend aus, in welchen widersprüchlichen, schwer ausdrückbaren Zuständen man sich alltäglich befindet, und gerade das macht – so könnte man salopp sagen – die Wahrheit dieser Erfahrungen aus, bzw. es wäre nicht zutreffend, sondern nur beschönigend, würde Bachmann ihren Zustand eindeutiger und klarer ausdrücken. Oder wenn Marcel Proust, bemüht um eine so realistische Darstellung von Erinnerung als nur möglich, sich die unfassbare Freude vergegenwärtigt, die ihn als Kind überkam, als seine Mutter eine Nacht in seinem Zimmer übernachtete und dann jedoch präzisieren muss, wobei sich ein ganzes reich subtiler Empfindlichkeiten und komplexer, damit verbundener Zusammenhänge zeigt:: „Ich hätte eigentlich glücklich sein müssen, aber ich war es nicht. Es kam mir so vor, als habe Mama mir ein Zugeständnis gemacht, das ihr schmerzlich sein müsste, als bedeute dies einen ersten Verzicht von ihrer Seite auf die Idealvorstellung, die sie von mir hatte, und als gebe sie, die Mutige, sich nun zum ersten Male geschlagen (...)“, so dass schliesslich, dieser unglaublich freudige Vorfall für den jungen Proust zugleich „ein schmerzliches Datum für alle Zeiten“ war18. Die Dichte und an Bedeutung gedrängte Widersprüchlichkeit, die in dieser einen Erinnerung enthalten ist, als Hof erfahrener Begleiterscheinungen eines Erlebnisses, das als Faktum schnell erzählt ist, sind von Proust meisterlich geschildert, aber wer kennt sie nicht? Wer kennt nicht, wie einfache und gewöhnliche Begebenheiten begleitet sein können von einer Gefühlsdichte, die undurchschaubar und unaussagbar wirken. Die Kunst die alltägliche Erfahrungsfülle in Worte zu fassen, macht u.a. die Kunst des Literaten aus. Erfahrungen zu schildern, wie sie erfahren sind und nicht, wie sie zurechtgelegt werden, gehört zum herausfordernsten Ausdrucksakt. Eine andere Meisterin dieser Kunst, die Schrifststellerin Lispector, beschreibt den momentanen Zustand ihrer Protagonistin, wenn diese an ihren Freund denkt, so: „Ach, und dass sie keinen Durst verspürte. Eine Hitze zusammen mit Durst wäre erträglich. Aber nein, überhaupt keinen Durst. Nichts ausser Mangel und Abwesenheit. Nicht einmal das Verlangen. Nur Stacheln ohne sichtbare Spitzen, an 17 Ingeborg Bachmann an Paul Celan, In: Ingeborg Bachmann, Paul Celan: Herzzeit, Briefwechsel, Frankfurt 2008, 52. 18 Proust, 2000, 54 denen man sie packen und herausziehen könnte. Nur ihre Zähne waren feucht.“19 Mangel ohne Durst, Stacheln ohne Spitzen, an denen man sie herausziehen könnte – diese Merkwürdigkeiten und Ambivalenzen machen das Erfahrene wegen der darin scheinbar enthaltenen Unlogik weder unwahr noch unmöglich– nein, diese Widersprüchlichkeit machen sie gegenteilig völlig normal sein bzw. macht das Wahrhafte der geschilderten Erfahrung aus. Entsprechen fasst auch Sara Ruddick das Hauptmerkmal der dicht und nicht normativ beschriebenen Mutterliebe, die sie selbst erfahren und in unzähligen Gesprächen bestätigt gefunden hat, im Stichwort der Ambivalenz, und sieht darin den Grund, dass mütterliche Praxis so wenig in Betracht gezogen wird, wenn Philosophen von Praxis sprechen20: „Was wir so gern „Mutterliebe“ nennen, ist vermischt mit Hass, Sorge, Ungeduld, Ablehnung und Verzweiflung: Ambivalenzen, die das Denken herausfordern, sind Kennzeichen der mütterlichen Praxis.“21 (Transkript Zitat hinzufügen!!) Eine gut hundertjährige pragmatistische Tradition, die einen Erfahrungsbegriff in die Philosophie einführte, die den klassischen epistemologischen radikal zu erweitern trachtete, war durch Dewey an der Universität in Chicago in den 40er bis 50er Jahren noch in voller Blüte. Es ist die ‚Luft’, die Gendlin atmet22. Zudem beschäftigt er sich intensiv mit der phänomenologischen Tradition (Fussnote). Dieser philosophische Hintergrund ist ausschlaggebend dafür, wie wir sehen werden, dass sich Gendlin dafür interessiert, was in der Therapie geschieht. (Vgl. nächstes Kapitel) Durch beide philosophische Schulen zeichnet sich eine gründliche und fundamentale Kritik an einer skeptisch gewachsenen, rationalistisch-empiristische Engführung des philosophischen Verständnisses von Erfahrung ab. Im Hinweis auf lebensnahe, praktische, alltägliche Erfahrungsweisen werden alternative Zugänge, Beschreibungsweisen und Begriffe kreiert, um auf vielfältige Verengungen und Unstimmigkeiten der traditionelle Einschätzung von Erfahrung und den damit einhergehende begrifflich festgelegte Unterscheidungsgewohnheiten (Hampe ETH – Vorlesung) aufzuzeigen. Ein tradierter, vornehmlich epistemologischer Erfahrungsbegriff erfährt im gleichen Zeitraum einen Stoss durch die sog. ‚dritte Kränkung’ des psychoanalytisch eingeführten Unbewussten, die der 19 Lispector, 1988, 18 Sara Ruddick, 1993, 15 21 Ruddick, 1993, 62 22 Aus den Gespräche am 10. August 2010. 20 Philosophie vorhält, im „Unrecht“ zu sein, wenn sie „daran festhält, dass ‚bewusst’ und ‚psychisch’ identische Begriffe sind.“23 Nicht nur Phänomenologen, Pragmatisten und die Tiefenpsychologie rütteln an den Grundfesten philosophisch-epistemologischer Vorstellungen dessen, wie Erfahrung zu denken und zu beschreiben ist. Auch in den Gebieten der Sprachphilosophie und Ontologie wird in kritischer Absicht zu traditionellen Denksystemen auf die Bedeutung des Gewöhnlichen, des Alltäglichen und der Praxis verwiesen, um alltägliche Sprechweisen wie alltägliches Dasein überhaupt verstehbar machen zu können. All diese Anstösse verschieben theoretische Grundlagen und fördern damit einen Ausgangspunkt zu Tage, der die Frage nach einer Ordnung, die Klarheit ermöglicht, an die Oberfläche bringt. Das gemeinsame Merkmal der erwähnten Anstösse, ist u.a., dass sie alltägliche Erfahrungsweisen und Sprachformen zum kritischen Masstab für philosophische Masstäbe und Methodiken herangezogen werden. Dieser Masstab kann einführend nicht definiert werden. Denn gerade die Methodik des Definierens überführt Erfahrung und Sprache in gewisse philosophische Begrifflichkeiten und Kategorien, und zieht ihr gerade dadurch den Stachel, wodurch mit ihr beispielsweise genau die Methodik des vorgängigen Definierens als Schaffung eines Ausgangspunktes kritisiert werden kann. 1. Beispiel: Pragmatismus ( am Beispiel James, Whitehead und Dewey): William James24 kritisiert einen Intellektualismus, der seine eigenen Grenzen nicht mehr sieht als ‚verderbten’. Er führt dessen Wurzeln auf die Antike zurück und vor allem auf eine Methodik, die zu dem intellektualistischen Selbstmissverständnis führt. „(..) Als Sokrates und Plato lehrten, dass das, was ein Ding wirklich ist, uns in seiner Definition vermittelt wird. Seit Sokrates ist uns immer wieder gelehrt worden, dass die Wirklichkeit aus Wesenheiten und nicht aus Erscheinungen besteht, dass das Sein der Dinge erkannt wird, wann immer wir seine Definition kennen. So setzen wir zuerst das Ding einem Begriffe gleich, und dann den Begriff 23 Freud, (1975) 1994, 29 Die thematische Nähe zwischen Dilthey und den Pragmatisten macht Jung schon in seiner Einführung zu Dilthey in einer Kapitelüberschrift kenntlich „Diltheys ‚Pragmatismus’“ (Jung, 1996) oder in Formulierungen wie Diltehy, der „protopragmatistische(n) Bewunderer naturwissenschaftlichen Denkens“ (2009, 131). Genaueres dazu siehe Jung, 1995 (From Dilthey to Mead and Heidegger. Systematic and Historical Relations, in Jounrla of the History of Philosophy, Heft 3, 1995.). 24 einer Definition, und dann erst, insoweit das Ding ist, was die Definition ausdrückt, sind wir sicher, sein wirkliches Sein, seine volle Wahrheit, zu erfassen.“25 James kritisiert nicht das Sokratische Motiv, das angesichts sophistischer Rhetorik revolutionär gewesen sein muss, in unkompromittierbarer Art und Weise Überzeugungen auf ihre Nachvollziehbarkeit zu überprüfen. Er kritisiert die Methodik, die hier ihren Anfang genommen hat, ein Ding einem Begriff und den Begriff einer Definition zu überführen. Aus ihr ist über Jahrhunderte eine unhinterfragte Einstellung gewachsen, die James in obiger Passage mit knappen Zügen expliziert. Es ist die Selbstverständlichkeit, mit der der Begriff und dann die Definition mit dem Wesen des Dinges ‚gleichgesetzt’ wird und dieses Wesen erst „volle Wahrheit“ desselben vermittelt. Wahrheit und Wirklichkeit der Dinge bestehen demgemäss in einem Wesenskern, der in der Definition gegeben ist. Damit geht die stillschweigende Annahme einher, die Definition sei fähig, die ‚Wirklichkeit’ des Dinges zu umfassen, zum anderen die Annahme, dass jenseits der Definition nichts ‚Wirkliches’ wie Wesentliches’ mehr an dem Ding zu finden sei. In Deweys Analyse des Syllogismus und der aristotelischer Logik nimmt er diesen Punkt auf und vertieft ihn, indem er zeigt, wie die Definition die ontologische Substanz von etwas erfasst, insofern die Essenz dasjenige einer Sache festlegt, das weder hervorgeht noch vergeht (zum Beispiel die Menschheit des einzelnen Menschen). In der Definition wird jene Essenz erfasst, die dem „eternal self-same character“26 der Sache entspricht. Alltägliche Erfahrungsweisen werden somit insgesamt vor-wesentlich und vor-wirklich, da ihre ununterbrochene, veränderlich-fliessende Kontinuität ein definierendes Verhältnis zu ihr verunmöglicht. „In dieser innigsten aller verbindenden Beziehungen – dem Übergang einer Erfahrung in eine andere, wenn beide zu dem gleichen Selbst gehören – gibt es kein anderes Wesen, keine andere Washeit als dieses Fehlen eines Bruchs und dieses Gefühl von Kontinuität“27. 25 William James: Das Pluralistische Universum. Vorlesungen über die Gegenwärtige Lage der Philosophie, Darmstadt 1994, 139 26 Dewey, Logic of Inquiry, 1958, 86 27 William James, Die Welt der reinen Erfahrung. In: Pragmatismus und radikaler Empirismus, Frankfurt 2006, 35. Entsprechend wählt James als passendste Metapher der Erfahrung den Strom aus: „ Such words as “chain” or “train” do not describe it fitly as it presents itself in the first instance. It is nothing jointed; it flows. A ‘river’ or a ‘stream’ are the metaphors by which it most naturally described. In talking of it hereafter, let us call it the stream of thought, of consciousness, or of subjective life.” (Works VIII, Principles, S. 233) Aus der philosophischen Fixierung auf Definitionen, Wesen, Entitäten, wird diese bruchlose Kontinuität, die nur gefühlt werden kann, unerfassbar und damit chronisch übersehen. Indem Erfahrungen auf Entitäten und Dinge auf Wesen zurückgeführt werden, die sie in Wahrheit sind, die wiederum als Definition gefasst werden kann, entsteht eine Verschweissung von Wahrheit, Wesen bzw. Definition und erfahrenes Ding. Die Folge davon ist, dass die Realität dessen, das in der Definition nicht enthalten ist oder ihr nicht entspricht, geleugnet wird28. Dewey weist als weitere Folge daraufhin, dass jede ‚Logik der Entdeckung, Erfindung, Lernen und Forschens’ von dieser Art des logischen Vorgehens ausgeschlossen ist, bzw. Lernen nur bedeuten kann, in Besitz dessen zu kommen, was schon gekannt ist, und Forschen ähnlich ist, wie ins Museum zu gehen, um schon vorhandene Objekte zu inspizieren29. So werden Aspekte menschlicher Wirklichkeit ignorierbar, die erfahrbar, aber undenkbar werden, weil sie kategoriell, begriffliche, definitorisch nicht aufzufassen sind. Damit ist angesprochen, was Whitehead den „Trugschluss der unzutreffenden Konkretheit“ bezeichnet. Weil man Abstraktionen, zum Beispiel Denkkategorien, als ebenso konkret auffasst, als die Dinge, die damit aufgefasst werden, und nicht bemerkt, welchem Prozess von vorgängiger Reflexion ihnen vorangegangen ist30, schliesst die Ebene des Kategoriellen aus, was wir tagtäglich im undiskreten Fluss der Erfahrungen erfahren31. Durch diese Trugschluss werden abstrakt gewonnene Kategorien sozusagen als naturgegebene Grenzen dessen betrachtet, was als Wirklichkeit gelten kann. Damit werden Erfahrungsweisen, so Whitehead, „einfach ignoriert, solange das Denken auf diese Kategorien beschränkt bleibt.“32 In dem erkenntnistheoretische Rahmenvorstellungen den Rückbezug auf ein aktual geschehendes Denkgeschehen weder nahelegen, noch notwendig erscheinen lassen, wird eine Prozessualität übersehen bzw. vergessen, die sowohl Denkkategorien als auch Denkobjekte und Gegenstände hervorbringt. Wie Kant Kategorien als eigenen Zutat des Denker erkannt hat, erkennen die Pragmatisten in einer Fortführung dieser Art von Kritik einen individuell als 28 William James, 1994 ebenda. Dewey, Logic of Inquiry, 1958, 87 30 So auch schreibt Dewey, dass üblicherweise übersehen wird, „that meanings as objects of thought are entitled to be called complete and ultimate only because they are not original but are a happy outcome of a complex history. They made them primitive and independent forms of things, intrinsically regualtive of processes of becoming. (...) They overlooked the fact that the import of logical and ratioanl essences is the consequence of social interactions, of companionships, mutual assistance, direction and concerted action in fighting, festivity, and work“ (Experience and Nature. 171) 31 Whitehead, Prozess und Realität 1979, 39 32 Whitehead, P u. R, 39 29 auch generationenübergreifenden Prozess, der im Rahmes eines theoretisch vorgegebenen reflexiven Selbstverständnisses ausgeblendet wird. Die vorstrukturierende Vorstellung, dass ein Subjekt gegeben ist, dem das Denken Bestimmungen hinzufügt oder welches durch das Denken klassifiziert wird, schliesst – so Dewey – „das Denken praktisch von jeder Teilhabe an der Besitmmung des Erkenntnissubstrats aus, da sie es darauf beschränken, die Resultate (ob attributiv oder klassifikatorisch) der schon gewonnenen Erkenntnis unabhängig von der Methode, durch die diese Erkenntnis gewonnen wurde, zu präsentieren.“33 Eine Erkenntnistheorie, die nicht die Aktivität des Denkens in der Zurichtung des bedachten Gegenstandes bemerkt, verhindert einen selbstreflexiven Bezug, der reich an Konsequenzen ist. So zum Beispiel bemerkt das Denken durch internalisierte, unhinterfragte Erkenntnistheorie nicht, dass es nicht von gesonderten Subjekten ausgeht, deren Eigenschaften es zu bestimmen und die es kategoriell und modal in Zusammenhang zu bringen hat, sondern dass es zunächst von Situationen als „komplexe Realtität“34 ausgeht, die Aufmerksamkeits- und Abstraktionsprozesse bedarf, um an das Grundgerüst zu gelangen, von dem Subjekt-Prädikat-Theorien der Aussagen ausgehen. Der Blick auf den situativen Ausgangspunkt des Denkens verschiebt grundsätzliche Vorstellungen dessen, was Denken heisst. zur Rolle des Impliziten, zu den Grenzen des Expliziten, zur Funktion des Gefühls, wobei dieses eine radikale Umwertung erfährt. Im Bemerken des situativen Ausgangspunktes des Denkens wird Unverständlich wird einem entsprechenden Philosophieverständnis zudem die Aufgabe, Erkenntnisse auf den (buchstäblich) un-wesentlichen alltäglichen Erfahrungsfluss zurück zu beziehen, insofern sich ihr diese Aufgabe als philosophische gar nicht mehr stellt. Das ‚intellektualistische’ Philosophieverstädnis setzt, so James, alles daran, in den Besitz wahrer Vorstellungen von Gegenständen zu kommen, wodurch die Denkaufgabe abgeschlossen ist. Gefragt wird nicht, „welcher konkrete Unterschied durch diese Wahrheit im wirklichen Leben eines Menschen bewirkt (wird)? Wie wird die Wahrheit erlebt werden? Welche Erfahrungen werden anders sein, als sie wären, wenn jenes Urteil falsch wäre“35. Das Fehlen dieses Bezugs ist nur konsequent. Denn wenn es um eine Wahrheitsform geht, deren Gültigkeit darin liegt, das sie definitionsgemäss und logisch festzumachen sind, dann erscheint es überflüssig sie 33 Dewey, Qualitatives Denken, in Philosophie und Zivilisation, 96. Dewey, Qualitatives Denken, 97 35 James, Der Wahrheitsbegriff des Pragmatismus In: Ausgewählte Text von Ch.S. Peirce, W. James, F.C.S. Schiller, J Dewey. Reclam, Stuttgart 1975, 2002, 163 34 zurückbuchstabieren und damit u.U. relativieren oder modifzieren zu müssen hinsichtlich eines Erfahrungsbereichs, der diese massgeblichen Festlegungs-Bedingungen unterläuft. Wahrheit kann durch das Verhältnis zu alltäglicher Erfahrung nichts gewinnen. Darum zeichnet die Beziehung zwischen Wahrheit und Erfahrung diesem Philosophieverständnis eine Einwegrichtung aus: aus der Erfahrung wird eine Wahrheit gewonnen. Wie sich die gewonnene Wahrheit wieder auf die Erfahrung auswirkt ist nicht relevant für die Wahrheitsfrage und steht buchstäblich ausserhalb der Logik dieser Denkbewegung. Es sollte jedoch, so deutet James eine von hier aus radikal wirkende Verschiebung des philosophischen Selbstverständnisses an, umgekehrt zu den Verdiensten einer Philosophie gehören, „unserem eigenen Leben in höherem Masse Wirklichkeit und Ernst zu verleihen“36. Dies kann nur geschehen, wenn die alltägliche Erfahrungsweisen als Ausgangspunkt nicht verlassen wird, aufgrund der Suche nach Wahrheit(en). Der Rückbezug auf alltägliches Erfahren würde gelingen durch eine weitere Reflexionsbewegung, die jedoch Konsequenzen für unser Wahrheits- und damit auch Rationalitätsverständnis hat, insofern Wahrheit (und damit auch Erkenntnis) nicht mehr nur als Produkt einer „statischen Beziehung“37 zu gelten hat (eine Aussage ist wahr, wenn etwas der Fall ist, oder wenn nichts Gegenteiliges vorliegt, oder wenn sie logisch eindeutig geschlossen werden). Um philosophisch überhaupt einsehen zu können, warum Wahrheit(en) auf alltägliche Erfahrung zurückzubeziehen sind, muss ihrer Rationalität eine andere Einschätzung von Veränderlichkeit gelingen. Die veränderte Rationalität muss bereit sein, sich auf die Frage einzulassen, ob im „Fluss“ gewöhnlicher Erfahrungsweisen „selbst eine Rationalität enthalten (sein kann), die übersehen worden ist?“38. Das impliziert allerdings, dass eine solche Rationalität den besagten Fluss nicht zuerst verändert, indem sie ihn aus diskreten (statischen) Einheit synthetisch zusammensetzt, um ihn rationalisierbar zu machen39. Das daraus entstehende Ergebnis, das die Welt aus Subjekt und Prädikat, Substanz und Qualität, Besonderem und Universalien zusammensetzt, so verstärkt Whitehead den von Jamesschen ausgehenden Impuls ,„tut immer der unmittelbaren Erfahrung Zwang an“, indem „orthodoxe Philosophie, in welcher Gestalt auch immer, uns nur zwischen einsame Substanzen stellen kann, die alle scheinhafte Erfahrungen machen.“40 36 James, 1994, 26 James, Wahrheitsbegriff des Pragmatismus, 2002, 163 38 James, 1994, 43 39 Es wird Gendlin sein, in der sich dieser Anstoss als treibendes Motiv realisiert. 40 Whitehead, 1979, 109 37 Dagegen ist Erfahrung, so fasst Dewey gleichsam zusammenfassend die Einzigkartigkeit dieses die Philosophie zu erneuern beanspruchenden, pragmatistischen Ausgangspunktes aus, so zu nehmen wie sie ist. Wie breit und alltagsnah sie angesetzt wird, macht Dewey deutlich, indem er zeigt, was in diesem Verständnis von Erfahrung alles enthalten ist: „what men do and suffer, what they strive for, love, believe and endure, and als how men act and are acted upon, the ways in which they do and suffer, desire and enjoy, see, believe, imagine – processes of experiencing.“41 Diese Erfahrungsweite fordert, wie Dewey die vorangehenden Impulse methodisch zu spezifizieren trachtet, einen Bezug von der Philosophie der ihre ungeteilten ‚Integrität’ als Ausgangspunkt unangetastet lässt. Weil tradierte Voreinteilungen und Trennungen wie Geist und Materie, Subjekt und Objekt an das Erfahrene, so wie es erfahren wird, gar nicht erst herankommen lässt, impliziert die neue empirische Methode, diese Einteilungen als Vorstrukturierung zu suspendieren. Dewey meint nicht, dass wir Erfahrung gleichsam vorsprachlich berühren können, was dann in ein Problemspektrum mündet, das Gendlin zusammenfasst42. Er meint, in Einklang mit James und Whiteheas, etwas spezifisch Philosophiekritisches: nämlich dass wir nicht ein tradiertes philosophisches Begriffsgerüst als gleichursprünglich mit den aufgezählten Erfahrungen setzen können. Die Erfahrung muss zunächst so genommen werden, wie sie erfahren wird, und an ihr ‚bemerkt’ werden, wie und warum das Ausgangsganze in die entsprechenden Unterscheidungen (wie Subjekt und Objekt, Natur und Geist etc.) überführt wird, und welchen Effekt die Unterscheidung macht43. Nur so ist es empirische Methode44. Als Kriterium des Bemerkenkönnens dient wiederum die Erfahrung bzw. die veränderte Erfahrung der Erfahrung: „Does ist end in conclusion, which, when they are referred back to ordinary life-experiences and their predicaments, render them more significant, more luminous to us, and make our dealings with them more fruitful? Or does it terminate in rendering the things of ordinary experience more opaque than they were before, and in depriving them of having in „reality“ even the significance they had previously seemed to have?“45 41 Dewey, Experience and Nature, 1958, 8. Experiencing and the Creation of Meaning, 1. Kapitel – genau wo? 43 Vgl. Dewey, Experience and Nature, 1958, 8f. 44 „Now empirical method ist he only method which can o jsutice to this inclusive intergrity of „experience.“ It alone takes this intergrated unity as the starting point of philosophic thought.“ (Experience and Nature, 1958, 9) 45 Vgl. Dewey, Experience and Nature, 7 42 Während rezeptionsgeschichtlich der Pragmatismus hinsichtlich seiner praktischen Nützlichkeitsmaxime kritisiert worden ist (z.B. Horkheimer 196746), spricht Dewey hier von anderen, subtileren Kriterien: nämlich ob der Reflexionsprozess die anfängliche Erfahrung ‚bedeutungsvoller’ und ‚klarer’ und unsere Beschäftigung damit ‚fruchtbarer’ gemacht hat, oder ob sie den erfahrenen Ausgangspunkt stattdessen ‚undurchsichtiger’ oder insignifkanter werden liess. Der pragmatistischen Verschiebung eines Ausgangspunktes geht einher mit einer Veränderung der Methode, des reflexiven Selbstverständnisses und der Fragen, die dadurch ausgelöst worden (Vgl. Putnam – Buch). Ausschlaggebend scheint nicht nur die Gewichtung der Nützlichkeit der Erkenntnis zu sein, sondern dieser zuvor geht die herausfordernde Ernstnahme der Erfahrung(squalität) als solcher, auf die pragmatistische Denker an einer sich als habituell eingespielten (und damit ihrerseits nützlichen) philosophischen Zugangsweise vorbei aufmerksam machen. Das kritische Anliegen, das hier zum Vorschein kommt, unterscheidet sich also von gewöhnlicher philosophischer Kritik, insofern sie sich nicht auf fehlerhafte philosophische Argumentation bezieht, Prämissen und Konklusionen anzweifelt, einen unendlichen Regress aufzeigt, oder die Widersprüchlichkeit und Unvollständigkeit der Positionen (Tetens, 2006 – genauer anschauen). Die unerbittliche Rückbindung philosophischer Reflexion an konkrete Erfahrung erinnert zwar an ein aufklärerisches Kritik-Projekt, aber die Engführung philosophischer Erfahrungsbegriffe auf den aufgeklärten macht hier gerade den Kritikpunkt aus. Man ist an den gesunden Menschenverstand erinnert, der sich an die Philosophie richtet mit der ihm von Hegel ironisch in den Mund gelegten Beschwerde, dass diese jegliche alltägliche Gewissheit auf den Kopf stelle. Es sind nun aber Philosophen selbst, die einige Jahrzehnte nach Hegels Tod den gesunden Menschenverstand in aller Ernsthaftigkeit ins Feld führen um Philosophie den Nebeneffekt anzukreiden, dass sie, statt alltägliche Erfahrung verständlicher zu machen, „sie weniger verständlicher“47 macht. Die sich damit abzeichnende Verschiebung des philosophischen Ausgangspunktes verträgt jedoch, mit Claus Langbehn gesprochen keine, „forsche Klassifikation“48. Das ist auch daran ersichtlich, dass sie nicht nur die Hermeneutik und den Pragmatismus betreffen, sondern wie Heidegger Weise deutlich gemacht auch, z.B. auch die Ontologie. 46 Quelle in Bibliographie James, 1994, 148 48 Langbehn, James-Buch, 175 47