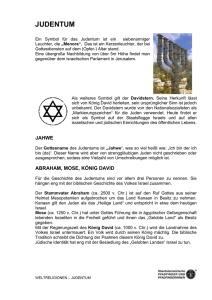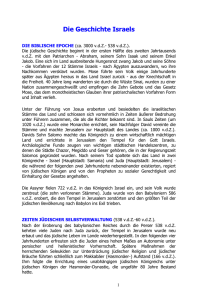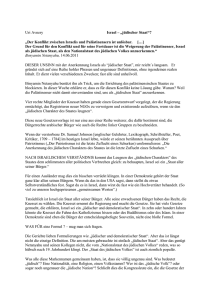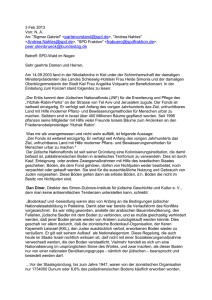vorwort
Werbung

Katalin Karcagi Wunde Wurzeln DANKSAGUNG Für ihre wertvolle Hilfe möchte ich Jürgen Ziergiebel, Gerhard Stübe, Ehrentraud Novotny und Ulla Fröhling danken INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Kurze Vorstellung der Interviewpartner Ronnie Golz: „Die Juden haben eine besondere Identität in der deutschen Gesellschaft, denn sie haben eine andere Geschichte in den Knochen” Shlomo Tichauer: „Ein Opfer denkt eben anders, als ein Verfolger und selbst die Nachkommen haben Schwierigkeiten” M. M.: „Ich denke, mit der Erinnerung geht man in Deutschland verkrampft um” Dorit Schnapp: „Ich fühle mich wohl hier, aber Deutschland ist nicht meine Heimat” Erica Fischer: „Ich habe nie Zugehörigkeit erlebt” Israela Jones: „Wenn ich den Satz: »Ich kann nichts dafür« höre, werde ich sehr traurig” Gabriel Heimler: „Ich wünschte, nach Deutschland zu kommen, um ein Mensch werden zu können, ich wollte nicht mehr Angst haben” Gaby Nonhoff: „Erst als ich mich endgültig dafür entschied, in Deutschland zu bleiben, fing ich an, die Traditionen richtig zu leben” Toby Axelrod: „Eine Normalisierung wird nur eintreten, wenn es nicht mehr wichtig ist, was man ist, Christ, Jude oder Moslem oder ganz was anderes” Ruth Fruchtman: „Alle Deutsche haben Probleme mit der Vergangenheit, denke ich” Heidi Stern: „Die Bemerkung, die ich oft höre: »Was erwartest du schon von Deutschen?« finde ich falsch” Andrew Roth: „Als Jude in Deutschland zu leben war und bleibt immer interessant und ein wenig bedenklich” Adriana Marin Grez: „Die dritte Generation lebt und arbeitet für ein lebendiges jüdisches Leben heute und in der Zukunft” Raymond Wolff: „Direkt wurde ich sehr selten mit dem Jüdischsein konfrontiert, aber Leute benehmen sich anders gegenüber jüdischen Menschen” A. S.: „Natürlich muss man gerade in Deutschland den Holocaust in die Betrachtung der gesellschaftlichen Entwicklung miteinbeziehen, aber Politik sollte damit nicht getrieben werden” A. B.: „Deutschland hat die demokratischen Institutionen fest verankert, trotzdem gibt es destabilisierende Elemente, die mich beunruhigen” Shelly Kupferberg: „Diese Einstellung, in einem Land zu leben, aber sich bewusst von der Umgebung abzugrenzen, fand ich schlecht...” Glossar VORWORT Was kann jemanden dazu bewegen, eine sichere Existenz aufzugeben und dorthin wiederzukehren, wo Familienmitglieder verfolgt oder in den sicheren Tod geschickt worden sind, so viel Jahre danach, fragte ich mich. Was zieht Kinder von Überlebenden nach Deutschland? Denn das muss etwas ganz anderes sein, als unmittelbar nach 1945 oder in den Fünfziger Jahren. Damals kehrten die Leute zurück, weil es doch ihre Heimat war. Weil sie sich, trotz allem was sie erlitten, zugehörig fühlten. Viele waren auch vom Idealismus getrieben, wollten im Osten am Aufbau eines antifaschistischen, sozialistischen Deutschland mitwirken. Ist es also bei den späteren Ankömmlingen Neugier, Suche nach den Wurzeln, ist es das Bestreben, sich selbst zu finden und zu verstehen, in der Kindheit erlittene Schmerzen zu erkunden und dem Verhalten der Eltern nachzugehen? Bringt man ein vorgefertigtes Bild, Vorurteile mit sich oder nimmt man sich vor, an Ort und Stelle eine Ansicht zu formen? Ist man bereit, die Menschen in der neuen Umgebung kennen zu lernen oder schließt man sich ein und sucht nur die Gesellschaft der seinesgleichen? Gibt es einen Unterschied dazwischen, wie sie auf die alte und die jüngere Generation von Deutschen zugehen? Wie nehmen die Rückkehrer die seit Jahren hier lebenden Juden wahr? Diese Fragen beschäftigten mich, seitdem ich in der englischsprachigen Presse darüber las, dass zum Neuerwachen des jüdischen Lebens in Deutschland, vor allem in Berlin, auch Zuwanderer aus dem Westen beitragen. Als sich die Möglichkeit bot, mit einem Fellowship des Europäischen Journalistenkollegs an der Freien Universität 10 Monate in Berlin zu verbringen, beschloss ich, längere Gespräche mit den Nachkommen von einstigen Verfolgten zu führen. Ich wollte ihre Motive herausfinden, warum sie sich in Deutschland niederließen oder wenn es nicht ihre Wahl war, sondern sie von den Eltern mitgenommen worden sind, warum sie als Erwachsene hier blieben. Ich hoffte herauszufinden, wie sie sich und ihre Umgebung sehen, ob sie die durch die Leidensgeschichten gemauerten Ängste weiter mit sich tragen oder sie loswerden konnten; ob sie sich als Außenseiter oder als integriert ansehen. Und wie beschreiben sie sich selbst, ist ihnen ihr Judentum wichtig? Was bedeutet ihnen Religion, Tradition, kulturelles Erbe? Bei letzteren Frage ahnte ich, dass ich selbst damit konfrontiert werde. Sei es, weil die Menschen, die ich interviewe, wissen wollen, mit wem sie es zu tun haben - das versteht sich von selbst, wenn man ganz persönliche Sachen einem anvertraut. Aber auch, weil ich durch diese Begegnungen dazu angespornt werde, mir selbst verbindlicher zu formulieren, was mir meine Herkunft bedeutet. Wo ich hingehöre, steht für mich außer Frage. Ich bin Ungarin. Aber in wieweit ist es wichtig für mich, dass ich Jüdin bin? In meiner Erziehung hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Meine Eltern waren überzeugte Kommunisten, die ihr Leben der Befreiung durch die Sowjetunion verdankten. Obwohl sie die Bräuche aus ihrer Kindheit kannten, und meiner Schwester und mir die auch erzählten, wäre es ihnen nie eingefallen, diese Sitten zu praktizieren. Sie verbanden diese Bräuche mit der Religion und sie waren ja Atheisten. Nicht, dass sie uns ihre Herkunft oder das Schicksal der Großeltern verschwiegen hätten. Wir wussten ganz genau was passierte, - dass unsere Mutter in Auschwitz war und ihre Eltern dort ermordet wurden - aber es wurde uns nie vermittelt, dass wir in Ungarn gefährdet sein könnten. Es war ein sozialistisches Land, das antisemitische Erscheinungen bis zur Wende, abgesehen von den turbulenten Tagen des 56-er Aufstandes, nicht kannte. Die jüdische Abstammung zählte einfach nicht, sie stellte eine Erinnerung an Familie, an ihre Kindheit für meine Eltern da, lag aber weit zurück. Als sie älter wurden, kam es schon mal vor, dass meine Mutter meinen Vater neckte: „Ich gehöre den Kohanim an und du bist nur Levit”. Aber das waren Spielereien. Mit dem sozialistischen Weltbild ließ es sich gut vereinbaren, dass wir immer Weihnachten feierten. Der religiöse Inhalt dieser Feier war für uns - wie wohl für die meisten Familien belanglos, es war eine Familienfeier, Freude für die Kinder. Wenn ich in Romanen auf jüdische Feiertage, Bräuche stieß, musste ich immer im Lexikon nachschlagen. Ich war schon an der Universität, als ich zum erstenmal - allein - an einem Freitagabend in die Synagoge ging. Vom Gottesdienst verstand ich kein Wort, aber der Gesang des Kantors packte mich. Dies war, glaube ich, das Moment, das mich veranlasste, Sachbücher über das Judentum zu lesen. Ich fing auch an, Hebräisch zu lernen, fand es aber zu schwer, und ließ es fallen. Was ich da verspürte, war eindeutig kulturelles Interesse, und vielleicht ganz tief versteckt, auch das Gefühl, ich gehöre ja auch zu diesem Volk. Wenn ich darüber las oder schrieb, was in den 30-er Jahren in Deutschland geschah oder was die ungarischen Faschisten anstellten, hatte ich meine Herkunft immer im Hinterkopf. Doch an Bedeutung gewann es erst nach 1989, als in Ungarn der - wie sich herausstellte, bei vielen tief verwurzelte - Antisemitismus offen hervortrat. In Zeitschriften erschienen gehässige Artikel und rassistische Gedanken wurden von einer Partei vertreten, die später auch ins Parlament kam. Da wurde mir bewusst, dass sich die Vergangenheit doch wiederholen kann. In diesem Sinne, dass sich nach 50 Jahren von neuem herausstellte, die Assimilierung der ungarischen Juden wird von einem Teil der Gesellschaft nicht als solche wahrgenommen. Die Assimilierung war ein einseitiger Prozess, ein Wunschtraum, denn die Juden werden in Ungarn im breiten Kreis weiterhin als nichtintegriert, von manchen sogar als Fremde betrachtet. Wenn es wieder zählt, wer, woher kommt, ist es wohl besser, keine Illusionen zu hegen, auf alles gefasst sein und sich nicht scheuen, sich nun gerade zu den Wurzeln zu bekennen, dachte ich. Das trug bestimmt mit dazu bei, dass ich erfahren wollte, wie andere zu ihrem Judentum stehen, wie sie sich in Deutschland zurechtfinden. Es war mir wichtig, solche Emigrantenkinder zu befragen, die nicht in Deutschland geboren sind und aus dem Westen kamen. Entgegen den Neuankömmlingen aus den GUS-Staaten konnte man bei ihnen annehmen, dass die wirtschaftlichen Überlegungen nicht maßgebend waren. Bewusst habe ich auch sowohl Vertreter der zweiten als auch der dritten Generation gewählt, weil ich vermutete, dass ihre Lebensauffassung, von zu Hause vorgegebene und verinnerlichte Richtlinien allein schon durch den Altersunterschied, aber auch durch die Erfahrungen verschieden sind. Bei der Auswahl meiner Interviewpartner stellte es ein Kriterium dar, dass sie entweder deutsche Wurzeln oder einen anderen Bezug zu Deutschland haben sollen, zum Beispiel die Vorliebe für die Sprache. Ich war bestrebt, Menschen zu finden, die schon seit längerer Zeit in Deutschland leben und auch solche, die sich von diesem Land aufgrund einer kürzeren Zeitspanne ihre Meinung bildeten. Meine eigenen Erfahrungen und die Logik sagten mir, dass Eltern, die den Verlust ihrer Familienmitglieder erleiden mussten, voller Hingabe zu ihren eigenen Kindern sind. Während ich die Interviews machte, erlebte ich den ersten Schock, als sich bei vielen herausstellte, dass sie dieser Zuwendung völlig entbehrten. Dass die psychischen Qualen der Eltern in der Verwehrung der Liebe ausarten könnten, hätte ich mir bis dahin nicht vorgestellt. Als mir sachlich geschildert wurde, wie durch diese Verweigerung von Emotionen in der Kindheit auch das spätere Leben vorbestimmt wurde, konnte ich diese Sachlichkeit kaum mit vollziehen. Wie kann man über diese Tragödien so nüchtern berichten, fragte ich mich. Nie hätte ich mich natürlich getraut, diese Frage laut zu stellen, denn es war mir klar, dass die selbstauferzwungene Distanz des Erzählenden auch eine Art Panzer ist. In diesem Fall wäre der Versuch, den Schutzschild zu durchbrechen ausgesprochen unangebracht gewesen. Zwei meiner Interviewpartner willigten in die Veröffentlichung der Manuskripte nicht ein. Die eine fand sich in dem geschriebenen Text nicht wieder, der anderen dünkten die Fragen im nachhinein zu persönlich. Letztendlich sind es 17 Interviews geworden. Sehr verschiedene Lebensgeschichten von Menschen, die aus Argentinien, England, Frankreich, Israel, Kanada, Österreich und den Vereinigten Staaten nach Deutschland kamen. Ich denke nicht, dass sich daraus ein soziologisch präzise auswertbares Bild entfaltet, dass es das Lebensgefühl der späteingewanderten, zurückgekehrten Zweite- und Dritte Generation-Juden insgesamt und in allen Facetten ausdrückt. Es ist eine Momentanaufnahme, der Versuch darzustellen, wie diese Menschen als Juden in Deutschland leben, wie es in ihren Köpfen aussieht, was sie von ihrer Umwelt wahrnehmen und wie sie das verarbeiten. Durch ihre Ansichten kann man auch vieles darüber erfahren, wie die Nachkommen von den Tätern sich mit ihrer Geschichte herumplagen und was sie daran hindert, ohne Beklemmungen mit den Nachkommen von Opfern aufeinander zuzugehen. Für ihre Empfindungen habe ich jetzt auch mehr Verständnis. Eventuell ist es wirklich noch zu früh dafür, eine gemeinsame Gesprächsbasis für alle zu finden. Nicht nur aneinander vorbeizureden und gegenseitig auch mehr Einfühlungsvermögen aufzuweisen. Vielleicht ist der innere Anreiz noch nicht gegeben, zu tief sind die Wunden auf der einen und zu gewaltig die Hemmungen auf der anderen Seite. Aber eines Tages könnte es so weit sein. Für mich habe ich auch noch nicht alle Antworten gefunden. Doch jetzt sehe ich schon viel mehr Schattierungen als zuvor und auch deshalb bin ich meinen Gesprächspartnern dankbar. KURZE VORSTELLUNG DER INTERVIEWPARTNER 1. Ronnie Golz, geboren 1947 in England, lebt seit 1960 in Deutschland. Er lehrte Wirtschaftswissenschaften an der Freien Universität Berlin. Experte für die Geschichte Berlins nach der Teilung und der Wiedervereinigung. Macht Stadtführungen in der Hauptstadt. Die Studentenbewegung bewog ihn dazu, in Deutschland zu bleiben. Er bezeichnet sich als Deutscher. 2. Shlomo Tichauer, geboren 1935 in Palästina. Maschinenbauingenieur, Sachverständiger für raumlufttechnische Anlagen, auch Religionslehrer. Er kam 1957 nach Berlin, um zu studieren. Seine Zurückhaltung den Deutschen gegenüber kann er immer noch nicht überwinden. 3. M. M., geboren 1965 in Kanada, ist Literaturwissenschaftlerin und lebt seit 1970 in Deutschland. Sie empfindet zum „Deutschsein” eine angenehme Distanz. 4. Dorit Schnapp, geboren 1958 in Israel, Erzieherin. Sie lebt seit 1968 in Deutschland. Eine Zugehörigkeit zu diesem Land fühlt sie nicht. 5. Erica Fischer, geboren 1943 in England, Autorin von „Aimée & Jaguar”. Lebt seit 1988 in Deutschland, fühlt sich immer noch als Ausländerin. 6. Israela Jones, geboren 1962 in Israel, Übersetzerin. Lebt seit 1986 in Berlin. Sie kam hierher, um zu studieren. „Wenn man als Jude in Deutschland lebt, soll man auch dazu stehen”, sagt sie. 7. Gabriel Heimler, geboren 1964 in Frankreich, Maler. Lebt seit 1987 in Berlin. Er besitzt die ungarische und französische Staatsbürgerschaft - einen deutschen Pass wollte er sich nicht besorgen. 8. Gaby Nonhoff, geboren 1948 in Österreich, macht Partyservice. Lebt seit 1968 in Berlin, sie blieb durch ihre Heirat hier. Ihre Wohnung ist ihre Heimat, dort fühlt sie sich sicher. 9. Toby Axelrod, geboren 1956 in den Vereinigten Staaten, Journalistin. Kam 1997 mit einem Fulbright-Stipendium nach Deutschland. Sie arbeitet für eine jüdische Organisation. Will wissen, wie die Kinder und Enkel der Täter und Mitläufer sich mit der Vergangenheit auseinander setzen. 10. Ruth Fruchtman geboren während des Krieges in England, Journalistin, Autorin. Lebt seit 1976 in Deutschland. Sie braucht Zerrissenheit zum Leben. 11. Heidi Stern, geboren 1957 in Kuba, Malerin. Sie kam 1984 nach Deutschland, „in das Land des Teufels”, um an der Hochschule der Künste in Berlin noch ein Studium zu absolvieren. 12. Andrew Roth, geboren 1958 in den Vereinigten Staaten, Autor des Stadtführers „Das jüdische Berlin heute”. Lebt seit 1992 in Berlin, wohin ihn die Liebe brachte. In ein paar Jahren will er in die USA zurückkehren. 13. Adriana Marin Grez, geboren 1969 in Argentinien, Redakteurin. Lebt seit 1978 in Deutschland. Sie liebt dieses Land nicht, aber ihr Beruf und die Sprache halten sie hier. 14. Raymond Wolff, geboren 1947 in den Vereinigten Staaten, Historiker, Musikwissenschaftler. Lebt seit 1970 in Deutschland. Er bezeichnet sich als deutschen Juden. 15. A. S., geboren 1953 in Israel, Psychotherapeutin. Lebt seit 1972 in Deutschland. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Beschäftigung mit Überlebenden des Holocaust und ihren Kindern und Enkelkindern. Sie ist froh, sowohl die israelische als auch die deutsche Staatsangehörigkeit zu haben. 16. A. B., geboren 1954 in den Vereinigten Staaten, Journalist. Lebt seit 11 Jahren in Deutschland, ist mit einer deutschen Ärztin verheiratet. In etwa 15 Jahren will er mit seiner Familie in seine Heimat zurückkehren, denn das ist das Land, das sein Wesen bestimmt hat. 17. Shelly Kupferberg, geboren 1975 in Israel, Radiojournalistin. Sie war nur einige Monate alt, als ihre Eltern sie nach Deutschland mitnahmen. Über sich sagt sie „Ich bin eine Berliner Jüdin”. Ronnie Golz „Die Juden haben eine besondere Identität in der deutschen Gesellschaft, denn sie haben eine andere Geschichte in den Knochen” „Wenn man mich fragt, wie ich zu den Deutschen stehe, ist es, als ob man mich fragt, wie ich zu mir selbst stehe. Denn ich bin Deutscher”, sagt Ronnie Golz, der 1947 in London geboren ist. Nicht immer hätte er diese Antwort gegeben. Obwohl er seit dem Alter von 13 Jahren in Deutschland lebt, hat ihn erst die Studentenbewegung dazu bewogen, sein tief verwurzeltes Befremden, oder mehr noch, seine Animosität den Deutschen gegenüber aufzugeben und aus seiner selbstauferlegten Abschottung herauszutreten. Ich sollte mit Deutschland nichts zu tun haben - das war die feste Überzeugung meines Vaters, auch als meine Eltern 1958 beschlossen, nach Deutschland zu gehen. Ich sollte in England im Internat bleiben. Damals ahnte ich ihre Herkunft nur. Mein Vater war Berliner, meine Mutter Tschechin. Sie redeten deutsch miteinander, und ich hatte deutsche Kindermädchen. Es waren vor allem finanzielle Überlegungen, die meinen Vater bewogen, nach Deutschland zurückzukehren. Es gab viel staatliche Hilfe für zurückgekehrte Juden, so genanntes Aufbaugeld. Außerdem hat es ihm in England nie gefallen, er mochte weder die Engländer noch ihre Sprache. Er, der in den 20-er Jahren der Geschäftsführer der „Literarischen Welt”, der namhaften bürgerlichen Literaturzeitschrift in Berlin war, stellte in England Wäscheklammer aus Plastik her, später handelte er mit Bürowaren. Meine Mutter hat in England als Schneiderin gearbeitet, in Deutschland fing sie an, in ihrem eigentlichen Beruf - sie war Apothekerin - tätig zu sein. Meine Eltern konnten die Deutschen auch nicht leiden, aber mein Vater war Deutscher, und meine Mutter ist im deutsch-tschechischen Kulturraum aufgewachsen. Sie also gingen zurück, ich aber blieb im Internat. Auch mein Bruder, der noch während des Krieges geboren wurde, blieb in England. Im Zusammenhang mit Deutschland hörte ich nur von den Verbrechen. Ich war antideutsch eingestellt, wie alle englischen Kinder der ersten Nachkriegsgeneration. Nicht wegen der Juden. Aber ich habe nur Schlechtes über Deutschland gehört und in meinen Comics gesehen. Dass meine Eltern Deutsche waren, bekümmerte mich nicht, denn als ich fragte, stellte sich heraus, dass sie jüdisch waren. Aber Fragen stellt man erst in der Pubertät. Über den Krieg habe ich zu Hause schon gehört, aber nicht über die Familiengeschichte. Das ist eine typische Erfahrung in jüdischen Familien, dass die Eltern nicht reden. Was mit meiner Familie geschehen ist, erfuhr ich in vollem Umfang erst in den letzten 15 Jahren, wo ich viel recherchierte. Jetzt kenne ich auch die Einzelheiten. Dass meine Großeltern jüdisch waren und ermordet wurden, habe ich in meinem Elternhaus erst nach und nach erfahren. Erst mit 15-16 Jahren fing ich an, Fragen zu stellen. Das Problem war, dass ich herauskriegen musste, wer ich bin und was mit unserer Familie wirklich geschehen ist. Bis ich 13-14 war, wusste ich gar nicht, dass ich jüdisch bin. Mein Vater war assimilierter Jude, der seinen Namen „Goldlust” in Berlin Ende der 20-er Jahre in „Golz” änderte. „Goldlust” war nicht nur ein jüdischer, sondern ein antisemitischer Name, den galizische Juden bekamen. Als assimilierter Jude wollte mein Vater mit dem Judentum eigentlich nichts mehr zu tun haben. Er war nie religiös. Jüdische Identität hatte er sicher, aber er führte kein jüdisches Leben, er ging auch nicht in die Synagoge. Seine erste Frau war nichtjüdisch, sie war eine bekannte Opernsängerin. Mein Vater ging 1934 nach Prag, er hat ja im Kulturleben gearbeitet und Prag war jüdischdeutsch-tschechisch. Als Journalist schrieb er gegen die Nazis. Aus Prag musste er dann beim Einmarsch der deutschen Truppen über Nacht flüchten, weil er auf der Suchliste der Gestapo stand und zum Verhör geladen war. Der polnische Journalistenverband hat ihm geholfen, damit er nach Danzig kommen konnte. 1939 ist er dann über Polen nach England geflüchtet. Seine erste Frau blieb in Prag. Sie verhalf Juden zur Flucht, wurde aber verraten, und die Nazis haben sie 1943 hingerichtet. Meine Mutter, die zweite Frau meines Vaters, ist in Südmähren, in der Nähe der Grenze zur Slowakei, in Straznice bei Hodonin geboren und aufgewachsen. Der jüdische Bevölkerungsanteil war dort recht groß. Sie ging auf die jüdische Grundschule, dann in das staatliche Gymnasium, aber sie ist in einer jüdischen Welt aufgewachsen. In Karlovy Vary (Karlsbad) hat sie Apothekerin studiert und kam dann gerade noch mit einem Visum heraus. Meine Eltern haben sich dann in London getroffen. Ich bin nach dem Krieg geboren. Auschwitz, Juden, jüdische Identität war überhaupt kein Thema zu Hause, nichts wurde erzählt. Ich denke, mein Vater hatte kein Interesse daran, Judentum irgendwie weiterzugeben. Vom Antisemitismus bekam er genug mit. Nicht umsonst hat er seinen Namen geändert. Im Dritten Reich wurden seine Eltern ermordet, auch andere Mitglieder der Familie. Die Eltern meines Vaters waren ab 1936 auch in Prag, wo mein Großvater dann Selbstmord beging. Meine Großmutter ist in Treblinka vergast worden. Eine Schwester meines Vaters hat überlebt. Deshalb wollte er nicht, dass seine Kinder jüdisch werden. Die Eltern meiner Mutter waren nach Theresienstadt deportiert, aber haben überlebt und sind nach Straznice zurückgekehrt. Ihre beiden anderen Kinder, mein Onkel und meine Tante sind ermordet worden, ein Bruder meiner Mutter hat überlebt. Als kleines Kind fragt man, wo ist die Oma, und man bekommt die Antwort, sie ist tot. Dann ist das kein Thema mehr. Oder man fragt, wo ist sie tot, aber mein Vater hat nie erzählt, dass sie ermordet wurden. Und meine Mutter hatte ja ihre Eltern. Allerdings habe ich sie nie gesehen. Sie lebten in der kommunistischen Tschechoslowakei. Meine Mutter besuchte sie zwar, aber nie mit uns. Meine Eltern arbeiteten beide. Sie kamen um 19 Uhr 30 von der Arbeit, aßen Abendbrot, da hatten mein Bruder und ich schon längst gegessen. Es gab mal an Wochenenden Kontakt zu unseren Eltern, aber der war nicht sehr ausgiebig. Das Verhältnis zwischen den Kindern und den Eltern war nicht sehr emotional. Wir waren ziemlich auf uns selbst gestellt. Anscheinend gibt es diese großbürgerliche Erziehungsmethode, wo die Kinder vom Au-pairMädchen versorgt werden, die Eltern ihrem Tagwerk nachgehen und sich mal mit ihren Kindern beschäftigen. Mein Vater hatte das bei sich zu Hause erlebt, er stammte aus recht wohlhabenden Verhältnissen. Er machte genau das mit uns, was er abgekriegt hat. Reflektiert hat er nicht, sondern genau dasselbe an seine Kinder weitergegeben, was ihm angetan worden ist. Die Schmerzen, die er erlitten hat, ist er nie durchgegangen, um sie zu verarbeiten. Er verschloss sie in sich und machte das gleiche weiter. Was ich überhaupt von seiner Kindheit weiß, weiß ich nicht von ihm, sondern aus einem Dokument, einem Gutachten. Als rassisch Verfolgter hat mein Vater die Bundesrepublik auf eine Rente verklagt. Die Bundesrepublik wollte ihm eine einmalige Summe, eine Entschädigung geben, er aber wollte eine Rente haben. Er hat diesen Prozess gewonnen, aber zuvor musste er von einem unabhängigen Sachverständigen ein Gutachten erstellen lassen. Das Einzige, was von ihm überliefert ist, ist dieses Gutachten. Der Gutachter gibt das Gespräch mit meinem Vater wieder. In diesen 20-30 Seiten beschreibt er seine Kindheit. Mein Bruder verhält sich zu seinen 5 Kindern genauso, wie mein Vater zu uns. Ich tue das nicht. Zwar bin ich nicht übertrieben kinderfreudig, auf jeden Fall bekommen meine Kinder aber mehr von mir, als ich je von meinem Vater erhielt. Als meine Eltern nach Köln gingen, und mich zurückließen, war ich im Internat sehr unglücklich. Nach 2 Jahren haben meine Eltern mich dann nach Deutschland geholt. So kam ich mit 13 Jahren nach Köln, besser gesagt, nach Bonn. Dorthin haben mich meine Eltern geschickt, weil es dort eine Schule gab, wo man Deutsch lernen konnte. Ich konnte Deutsch verstehen, aber nicht sprechen. Meine Eltern sprachen zwar miteinander, aber nie mit uns deutsch. An Wochenenden kam ich aus Bonn nach Köln zu meinen Eltern. Als ich dann Deutsch konnte, steckte mich mein Vater in ein Heidelberger Internat. Meine Mutter war sehr schweigsam, sie hat immer das gemacht, was mein Vater wollte. Und er sorgte immer dafür, dass er seinem Beruf nachgehen konnte und die Kinder nicht störten. Er verkaufte reichen Westdeutschen Wohnungen und Häuser am Mittelmeer und verdiente damit viel Geld. Mit 16 Jahren haben mich meine Eltern zu sich nach Köln geholt. Von nun an waren sie da, aber ich lebte mein Leben. Da der Kontakt nie eng war, habe ich auch nicht versucht, ihn enger zu knüpfen. Mein Vater war trotzdem der prägende Mensch in meinem Leben. Ich bin ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Als mein Vater älter wurde, versuchte er plötzlich, all das, was er nicht gemacht hat, nachzuholen. Er fing an, sich mir aufzudrängen, und das war unerträglich. Ich kriegte keine Luft mehr. Die Distanz zwischen mir und meinen Eltern hat mir sehr viele Probleme in meinen Beziehungen, auch später zu Frauen bereitet. Als es mir dann in Deutschland richtig bewusst wurde, dass ich Jude bin, war das sehr schwierig für mich. Bis dahin gab es für mich Juden, zu denen ich nicht gehörte. Ich war nur jüdischer Abstammung. So ähnlich war das in meinem Kopf. Aber dann fing der Konflikt an. Wenn man nichts weiß, und denkt, man ist wie jeder andere, und dann merkt, dass es nicht der Fall ist, ist das ein Schock. Ich bin ja in einer antisemitischen Gesellschaft aufgewachsen, aber ich gehörte nicht zu der Zielgruppe der Antisemiten. Das dachte ich jedenfalls. Ich habe gemerkt, dass Juden nicht gelitten sind, sowohl in England als auch in Deutschland. Es war immer ein latenter Antisemitismus da, an Judenwitzen und Bemerkungen wurde mir das schon bewusst. Das Problem, plötzlich ein Opfer geworden zu sein, zeigte sich nochmal verstärkt, als ich in die Studentenbewegung kam. Eigentlich wollte ich immer nach England zurück. Mit 13 Jahren hielt ich mich in Deutschland hauptsächlich nur bei englischsprachigen Menschen auf, hörte nur englisches Radio, und träumte davon, nach England zurückgehen zu können. Ich habe einen einzigen deutschen Freund gehabt, sonst nur englischsprachige Ausländer. Ich wollte einfach nicht in diesem Land sein. 1966 ging ich auch für ein Jahr nach England zurück. Vorher war ich schon seit einem Jahr an der Universität in Köln, wo ich Wirtschaftswissenschaft studierte, aber dann wollte ich nach England überwechseln. Doch in England war der Zugang zur Universität sehr eingeschränkt, und ich habe keinen Platz bekommen. Ich bin dann nach Deutschland zurückgekehrt mit dem Vorsatz, das Studium schnell zu Ende zu machen, und dann nach England zu gehen. Mein Diplom wird ja dort anerkannt, und ich kann da arbeiten. Dann aber kam 1967 die Studentenbewegung. Am 2. Juni wurde Benno Ohnesorg in Berlin erschossen. Die Studentenbewegung hat mein Leben verändert. Als ich mir diese Studenten anguckte, sah ich plötzlich ein ganz anderes Deutschland. Ich war beeindruckt, ich fand es spannend, und ich habe mich engagiert. Zuerst in Köln in der Studentenbewegung. Ich las Karl Marx, „Das Kapital”, das „Kommunistische Manifest”, die Feuerbach-Thesen. Auch György Lukács habe ich gelesen, seine Frühschriften, dann von Jürgen Kuczinski „Geschichte der Arbeiterklasse”, und ich war begeistert. In dem Augenblick wurde ich Teil der Deutschen, Teil Deutschlands. Da beginnt meine deutsche Identität. Deutschland wurde etwas Positives für mich, ich fing eine deutsche Identität an und wuchs in die deutsche Geschichte hinein. Neben meiner englischen Identität entstand eine deutsche. Mit dem israelischen Sechs-Tage-Krieg 1967 kam dann die dritte Identität. Ich, ein Jude von Abstammung, wusste nur, Israel verteidigt sich, und ich bin auf der Seite Israels. Und irgendwie hatte das Land etwas mit mir zu tun. Aber die Studenten um mich sagten, Israel wäre eine imperialistische Bastion der USA und die Araber hätten recht. Das war wieder eine Konfliktsituation: mit den Studenten verband mich etwas Positives, das, was wir zusammen gemacht haben. Aber plötzlich gab es wieder einen Unterschied zwischen ihnen und mir wegen Israel. Ich wusste nur, dass ich nicht akzeptieren kann, was sie sagen. Zuerst musste ich mich informieren, musste wissen, wie ich zu dem Krieg stand. Die Lebensfähigkeit Israels ist immer durch die USA garantiert worden. Für die Studenten, aufgebracht durch den Vietnamkrieg und antiamerikanisch eingestellt, war Israel eine amerikanische Marionette. Zu 10 Prozent war es vielleicht auch latenter Antisemitismus, der mitgespielt hat. Aber das war nicht der Hauptgrund. Auf jeden Fall stellte die USA ein Land für sie dar, das die Welt regieren und mit allen Mitteln seine eigenen Interessen durchsetzen wollte. Dieser Konflikt trieb mich dann, zu untersuchen, wie es um mein Judentum bestellt ist? Wie stehe ich zu mir selbst als Jude? Das Ergebnis war, dass mir nach 1-2 Jahren nach dem SechsTage-Krieg richtig klar wurde, ich bin Jude. Und ich will auch nicht mehr davor weglaufen. Ich stehe dazu, oder besser gesagt, ich habe den ersten Schritt getan, um dazu zu stehen. Aber überzeugter Jude war ich noch lange nicht. Zwischen Bewusstsein und Sein ist ein Riesenabstand, und das zieht sich durch mein Leben. Gerade weil das Jüdische für mich nicht aus dem Elternhaus vorgegeben war. Ich musste es „rekonstruieren” - ein gängiger Ausdruck in der Studentenbewegung. Man musste seine Identität rekonstruieren. Für mich war das ein langer Prozess. Zuerst musste ich noch meine Familiengeschichte entdecken und den Willen entwickeln, für die jüdische Gemeinschaft auch etwas zu tun. 1970 war ich mit dem Studium fertig. Ich kam nach Westberlin. Ich war voll in der Studentenbewegung und beschloss, doch nicht nach London zurückzugehen. Die Studenten sagten mir, du hast Marx gelesen, dich brauchen wir. Ich sollte marxistische Vorlesungen halten. Man sagte mir, ich würde im Fachbereich Wirtschaftwissenschaften als wissenschaftlicher Assistent gebraucht. So fing ich an der Freien Universität an. Ein Seminar habe ich über ein Buch gemacht, das damals erschienen ist, „Die Konzentration des Kapitals. Über die Entstehung von Monopolen”. Der Autor war ein Doktorand an der FU, heute ist er Professor in Bremen. Mit den Studenten habe ich das Buch durchgearbeitet und auch „Das Kapital”. Kurse hielt ich auch über Entfremdung und Dialektik. Nach drei Jahren ging es nicht mehr. Ich wollte keine theoretischen Aufsätze darüber schreiben, was Marx meinte. Die Universität wurde von der bürgerlichen Gesellschaft zurückerobert und zurückgekrempelt. Ich bekam vorbestimmt, was ich zu machen habe. So ging ich weg. Es ergab sich die Möglichkeit, an der Fachschule für Wirtschaft zu lehren. Das war damals eine Art Akademie für Leute, die kein Abitur hatten, nach der 10. Klasse aber eine Lehre machten, und danach studieren konnten. Heute hat diese Schule den gleichen Status wie eine Universität, sie heißt Fachhochschule für Wirtschaft. Dort war ich von 1973-78, ich konnte wieder marxistische Geschichte, philosophische Fragen, aber auch bürgerliche Wirtschaftswissenschaften im System einer marxistischen Erkenntnis behandeln. In Westberlin entstand in der Zwischenzeit neben der SPD die SEW, die Sozialistische Einheitspartei Westberlins, und die haben ihre Leute im Bildungssystem immer mehr in Position gebracht. An der Uni schafften sie das nicht, aber an unserer Fachhochschule. Ich wurde hinausgedrängt. Das ging ganz einfach, bei der Studentenberatung sagten sie, ich wäre ein RAF-Sympathisant. Und dann kam kein Student zu meinen Vorlesungen. Die ganzen Parteigründungen, die aus der Studentenbewegung entstanden, habe ich nie mitgemacht. Ich war ein Freigeist, ein Sponti. Einfach linke Politik wollte ich machen. Als ich an der Hochschule aufhörte, bin ich Taxi gefahren, in einem Kollektiv. Wir waren 12 junge Leute. Als Taxifahrer bekam ich immer den Auftrag, mit Ausländern nach Ostberlin zu fahren. Neben dem deutschen Pass, den ich 1958 bekam, als mein Vater wiedereingebürgert wurde, hatte ich nämlich auch einen englischen Pass und konnte ohne Schwierigkeit die Grenze passieren. Ich habe nie daran gedacht, meinen englischen Pass abzugeben. In den 70-er Jahren tauchten auch Juden auf, die nach Ostberlin, zum Friedhof in Weissensee wollten. Sie brauchten jemanden mit ausländischem Pass, der ein Auto hat, und womöglich noch Jude ist und sie begleitet. Sie fühlten sich auf diese Weise sicherer. Ich ging mit diesen Menschen auf den Friedhof, um die Gräber ihrer Verwandten zu suchen. In den 70-er Jahren war der Friedhof eine Ruine, aber mir hat es unheimlich gefallen. Ich fand ihn bewegend, auch den Verfall. Es war wie ein lebendes Holocaust-Mahnmal. Damals wusste ich noch nicht, dass auch meine Urgroßeltern dort liegen. Das habe ich erst nach der Wende erfahren. Als ich nach zwei Jahren mit dem berufsmäßigen Taxifahren aufhörte, kam ich zum Senat. Der Senat suchte Referenten auf Honorarbasis für die Schulklassen, die aus Westdeutschland und der westlichen Welt Berlin besuchten und ihre Reise subventioniert bekamen. Sie erhielten kostenlos einen Vortrag über Berlin, über die DDR und eine kostenlose Stadtrundfahrt, sowie einen finanziellen Zuschuss. Ich hielt dann Vorträge über Berlin, über die Alliierten, den Status von Deutschland. Später arbeitete ich für die Friedrich-Naumann-Stiftung als Experte für Berlin. Ich machte Rundfahrten in Ost- und Westberlin für sie, sehr politische Rundfahrten. Die letzten 10 Jahre habe ich dann im Rahmen der politischen Bildungsarbeit dieser Stiftung Seminare geleitet. Obwohl ich für die Naumann-Stiftung arbeite, bin ich nicht in der FDP. Ich habe eigentlich keine politische Heimat, keine Partei ist meine Heimat. Aber aus meiner Geschichte heraus bin ich ein typischer Grüner, ein radikaler Liberaler. Im letzteren Sinne ist die Naumann Stiftung von ihrer theoretischen Grundhaltung her, indem sie für die Freiheit des Individuums in einer liberalen Gesellschaft steht, meine geistige Heimat. Nach dem Libanonkrieg Israels im Jahre 1982 hat sich eine Gruppe linker Juden in Westberlin, die „Jüdische Gruppe Berlin” gegründet. Das war die erste linksliberale Gruppe, die sich bildete. Ich bin ihr beigetreten. Damals kam das Buch von Peter Sichrovsky, der jetzt bei Haiders Freiheitlichen Partei in Österreich ist, heraus, er hat Interviews mit jungen Juden in Österreich und Deutschland gemacht. Das hat mich dazu angeregt, der Geschichte meiner eigenen Familie nachzugehen. Meine Mutter und Vater waren damals schon tot. Ich begann, zu recherchieren. Beim Entschädigungsamt fand ich die Akte meines Vaters mit dem Gespräch, das der Gutachter mit ihm geführt hat. Ich wollte auch die Geschichte der ersten Frau meines Vaters aufspüren, was mir dann auch gelungen ist. Was sie für die Juden getan hat und wofür sie mit ihrem Leben bezahlt hat, fand ich beispielhaft. Ich brachte ein kleines Buch darüber heraus. Nach dem Fall der Mauer konnte ich dann endlich nach Polen fahren, nach Bydgoszcz (Bromberg). Ich wusste nur, dass mein Großvater väterlicherseits, die Goldlust-Familie, aus Bydgoszcz stammte. Mein Urgroßvater ist mit seinen Kindern kurz nach 1871 nach Deutschland gekommen. Ich fuhr auch nach Bytom (Beuthen), von wo meine Großmutter herkam. Dort habe ich auch die Unterlagen gefunden, und damit konnte ich die ganze Familiengeschichte rekonstruieren. Bei meiner Mutter kam ich nicht so weit. Um den Stammbaum wiederherzustellen, müsste ich noch viel forschen. Meine Mutters Familie hat seit vielen hundert Jahren immer in Südmähren gelebt. Als ich 1991 aus Beuthen zurückkam, suchte ich selbst Gräber auf dem Friedhof in Weissensee. Ich fand den Grabstein von meinem Urgroßvater, ließ ihn wiederherstellen und trug darauf die engsten Familienangehörigen meines Vaters ein, die von den Nazis ermordet worden sind. Als ich den Friedhof zum ersten Mal sah, dachte ich schon, der ist so schön, hier gehöre ich hin, hier möchte ich einmal begraben sein. Aber ich hatte keine Ahnung, dass meine Urgroßeltern hier lagen. Als ich das Grab fand, ging ich zum Büro und fragte, ob noch eine Stelle frei wäre und die Angestellte fand in der Nähe eine, obwohl es sehr ungewöhnlich war, dass dort noch niemand begraben worden ist. Das war jüdische Fügung. Ich wollte diese Stelle kaufen. Dann fragte mich diese Angestellte, ob ich Mitglied der Jüdischen Gemeinde wäre. Nein, sagte ich, unter der Führung von Heinz Galinski denke ich nicht daran, in diese Gemeinde einzutreten. Wenn man aber nicht Mitglied der Gemeinde war, kostete es viel mehr. Was für mich aber ausschlaggebend war: die Frau sagte, ich bin nicht verheiratet und wenn mir etwas zustößt, müssen die Leute, die mich gekannt haben, beweisen, dass ich jüdisch bin, ansonsten kann ich dort nicht begraben werden. Deshalb trat ich dann der Gemeinde bei. Ich sagte aber ausdrücklich, ich mache das nur, weil ich einen Grabstein in Weissensee haben möchte. Am Anfang hatte ich in der Gemeinde eine passive Haltung. Aber als ich hörte, dass es eine Opposition zu Galinski gäbe, die Demokratische Liste, die links von seinem Liberalen Block stand, ging ich hin. Eingetreten bin ich nicht, aber ich unterstützte sie bei den Wahlen. Vor zwei Jahren hat die Demokratische Liste die Mehrheit gewonnen. Als dann Andreas Nachama Vorsitzender der Gemeinde wurde, sagte ich mir, man soll nicht nur reden, sondern auch handeln. Wenn ich die ganzen Jahre über gegen Galinskis Politik war, muss ich jetzt aktiv werden, denn nur so können wir die Gemeinde verändern. Nur so können wir erreichen, dass sie progressiver, liberaler, toleranter wird. Jetzt bin ich Stellvertreter im Kulturausschuss, aber da nie alle Mitglieder bei den Sitzungen anwesend sind, heißt das, dass ich praktisch Vollmitglied bin, und Stimmrecht habe. Der Kulturausschuss kümmert sich um alles außerhalb der Synagoge: um die Jüdischen Kulturtage, das jüdische Filmfestival, die Volkshochschule, um Fotoausstellung und jüdische Musik oder um den Chanukkaball. Ich wollte, dass der Ball nicht im Hotel Intercontinental veranstaltet wird, sondern im Gemeindehaus und dass der Eintritt preiswert ist, erschwinglich nicht nur für die Elite. Letztes Jahr gab es den Ball auch zum ersten Mal in der Gemeinde. Meine Identität ist nicht religiös. Manchmal gehe ich zu Rosch Haschana in die Synagoge, aber es langweilt mich. Ich gehe hin, weil ich immer wieder denke, vielleicht wird es diesmal interessanter. Ich bin sehr gläubig, aber ich habe meinen eigenen Dialog mit Gott. Gläubig bin ich seitdem ich das Grab meines Urgroßvaters fand und ich wiederholt merkte, dass Sachen in meinem Leben passieren, die kein Zufall sind. Es ist mehr als Zufall oder Glück, es ist eine Fügung, ich spüre das. Es gibt eine Kraft, die mein Leben beschützt und führt. Aber ich muss dafür nicht einmal in der Woche in die Synagoge gehen, aus der Thora was vorgelesen hören und Gebete sprechen. Ich kann nicht Hebräisch, ich kann die Schrift auch nicht lesen. Mich faszinieren die Naturgesetze, wie sich alles fügt, die Tiere, die Wunder der Planeten, die Sternsysteme, das ganze Universum. Die Schöpfung ist phantastisch, bis ins letzte Detail. Der Gegensatz von Helligkeit und Dunkelheit, das ineinander Übergehen, das ist meine tiefe Religiosität. Mir bedeuten nicht nur die jüdischen, sondern grundsätzlich alle religiösen Riten nichts. Ich verstehe, respektiere sie, aber mich erreichen sie nicht. Zum Beispiel weiß ich, wann Chanukka ist, was es ist, aber es geht an mir vorbei. Ich hatte immer Nichtjüdinnen als Freundinnen, vier feste Beziehungen, die ich als eheähnlich bezeichnen würde. Kurze Liaisons hatte ich auch mit Jüdinnen, aber diese waren nicht tiefgreifend. Also muss ich es als schicksalhaft auffassen, dass es nicht sein sollte, dass ich einen jüdischen Partner finde. Ich hatte es mir mal gewünscht, weil es ein gewisses tiefliegendes Bedürfnis ist. Außerdem gibt es wahrscheinlich auch viele Übereinstimmungen, wenn man mit einer Jüdin zusammen ist. Die Lebensgeschichten sind zwar verschieden, aber die Ausgangssituation, eine jüdische Betrachtungsweise ist die gleiche. Dieser Wunsch war aber abstrakt, und es ergab sich nicht. Es ist auch ein Vorteil, wenn man nicht im gleichen Boot sitzt und sich ständig gegenseitig bestätigt, wie die Dinge aus jüdischer Sicht aussehen. Meine Frau ist Pfarrerin. Wir haben vor 4 Jahren geheiratet. Es gab gar keine Diskussion, wie die Kinder erzogen werden sollen. Als wir heirateten, musste sie, um Pfarrerin bleiben zu können, eine Genehmigung holen. Es gibt nur in Berlin und im Rheinland zwei Landeskirchen, die bereit sind, Ehen mit Juden zu tolerieren und zuzulassen, dass man weiterhin als Pfarrer bzw. Pfarrerin tätig ist. Die Jüdische Gemeinde würde nie einen Rabbiner akzeptieren, der eine nichtjüdische Ehefrau hat. Ich wurde gefragt, ob ich einverstanden bin, dass meine Kinder eine christliche Erziehung bekommen. Ich sagte, ich habe kein Problem damit. Meine Kinder, sie sind jetzt 3 und 11 Jahre alt sehen, dass ich viel im jüdischen Bereich arbeite, in der Gemeinde und auch für das American Jewish Committee. Aber ich werde ihnen keine Vorträge halten, ich werde warten, bis sie von selbst fragen. Sollten sie auch im Alter von 20 Jahren noch keine Fragen stellen, werde ich das Nötige tun. Jude zu sein bedeutet für mich 2000 Jahre Verfolgung durch Institutionen, wie die Kirche. Formal ist meine Frau Vertreterin der Kirche, aber als Mensch ist sie ganz anders. Ich weiß ja, was sie in ihrer Kirche macht, wie sie arbeitet, und ich weiß auch, dass ihre Gemeinde mich akzeptiert. Sie ist in einer sehr progressiven Gemeinde in Dahlem mit lauter linksliberalen deutschen Intellektuellen. In der Jüdischen Gemeinde gibt es für Leute, die nicht religiös sind, nicht genug Raum, in jüdischen Kreisen zu verkehren, ohne bedrängt zu werden. Wenn die Gemeinde eine Art Jugendzentrum wäre, ohne religiöse Manipulation und Indoktrination, ohne das Aufdrängen von Zionismus, indem man ständig Israel „verkaufen” will, dann könnten sich jüdische Menschen viel eher treffen und heiraten. In Amerika scheint es mit den „Mischehen” gut zu klappen. Wenn die Gemeinden anfangen, auszugrenzen, den interreligiösen Ehen gegenüber nicht offen und tolerant sind, werden sie nicht überleben. Das ist ihre Verantwortung, sie bestimmen ihre eigene Zukunft. Ich weiß nicht, wann sich die jüdische Gemeinden in Deutschland von Grund auf ändern werden. Toleranz kann nicht befohlen werden, sie muss aus dem Charakter und Willen ihrer Mitglieder kommen. Wie kann man im 21. Jahrhundert nach den Müttern und ihrem „genetischen Stoff” Juden definieren, aufgrund der Halacha vorgehen? Das ist meiner Meinung nach eine romantisch biblische Vorstellung, aber uns bringt es heute nicht weiter. Einfach aus der pragmatischer Wahrnehmung heraus, dass es viele jüdische Menschen gibt, die nur einen jüdischen Vater haben. Es ist nicht einsehbar, warum ein mystischer Text, der 2500 Jahre alt ist, bestimmen soll, ob sie jüdisch sind oder nicht. Das ist eine Anmaßung. Ich vermute, dass es in den 20-er Jahren, wo Berlin ein Hort des liberal-progressiven Judentums war, keine Schwierigkeit gab, wenn jemand, der nur einen jüdischen Vater hatte, in die Gemeinde kommen wollte. Unter Leo Baeck dürfte das nicht der einzig ausschlaggebende Punkt gewesen sein. Außerdem sehe ich, dass die Gemeinde heute ein Kind von einem jüdischen Vater und einer nichtjüdischen Mutter als Mitglied aufnimmt, wenn die Mutter erklärt, dass sie mit einer jüdischen Erziehung des Kindes einverstanden ist. Mein Sohn David wäre auch Mitglied der Gemeinde geworden, wenn meine Frau dieses Stück Papier unterschrieben hätte. Also ist die Halacha plötzlich doch nicht gültig. Die Gemeinde kann nicht anders handeln, weil es sehr viele „Mischehen” gibt. Die Schwierigkeit, sich der heutigen Welt anzupassen, ist auch damit zu erklären, dass die Nachkriegsgemeinde mit der Vorkriegsgemeinde herzlich wenig zu tun hat. Die Vorkriegsgemeinde bestand in ihrer Elite aus einer Unzahl von Akademikern, hochgebildeten, aufgeklärten deutschen Bürgern. Die Menschen aber, die die Gemeinde nach dem Krieg gründeten, waren Displaced Persons, die nicht in ihre Heimat zurückkehren konnten oder wollten. Sie waren arme, kleine, mittelständische oder Handwerkerfamilien, die religiösen osteuropäischen Familien entstammen. Durch das Trauma der Lagererlebnisse sind sie in tiefer Religiosität versunken, und die haben sie auch hier reproduziert. Heute aber, wo die Mehrzahl der Gemeinde nicht mehr orthodox ist, ändert sich auch die offizielle Linie, das Bestreben, der Außenwelt gegenüber darzustellen, dass man immer noch an den Wurzeln hängt. Die Mehrheit ist heute konservativ, nicht orthodox, und das Liberale kommt langsam auf. Mit Nachama ist zum ersten Mal ein Vertreter der zweiten Generation gewählt worden. In der Repräsentanz der Gemeinde sind kaum noch Überlebende zu finden, es sind Leute der zweiten Generation. Es entsteht wieder ein aufgeklärtes deutsches Judentum, auch wenn die Mehrheit jetzt Russen sind. Die verhalten sich ja sehr passiv, weil sie andere Probleme haben, sie müssen sich hier einfügen. Die Juden haben eine besondere Identität in der deutschen Gesellschaft, denn sie haben eine andere Geschichte in den Knochen. Ich schätze es sehr an dem Judentum, dass es sich erinnert. Es hängt von der Psyche des Einzelnen ab, wie er sich auf die Vergangenheit beruft. Wenn er nur darauf seine Identität als Jude aufbaut, ist es aber bedauerlich, denn man sollte sich aus den Charaktereigenschaften als Mensch aufbauen. Ich habe ein Stück Geschichte in mir, das sehr wichtig ist, mich bis heute prägt, mit dem ich klarkommen muss. Unter anderem damit, dass meine Familie nicht mehr da ist. Meine Frau hat eine normale Familienstruktur und ich nicht. Es ist jüdisches Schicksal nach Auschwitz. Ich finde es traurig, aber ich leide nicht darunter. Dass man sich immer wieder auf den Holocaust beruft, gehört zur jüdischen Identität, weil es noch zu nah ist. Ich verstehe aber gut, dass die jüngere Generation davon loskommen will. Sie sollte einen gesunden Abstand dazu bekommen, es in den richtigen Zusammenhang bringen. Es soll nicht mehr prägend für ihr Dasein sein. Mein Sohn hat jetzt vier Cousins und eine Cousine, dass heißt die Familienstruktur ist wieder da. Die Folgen von Auschwitz nehmen von Generation zu Generation ab. Auschwitz muss in Erinnerung gehalten werden, es ist wichtig zu wissen, dass Juden immer gefährdet sind, aber die Unmittelbarkeit der Gefährdung ist nicht mehr da. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland am schwersten ist, jüdische Identität zu bewahren. Ich finde, dass in Deutschland die Herausforderung schärft. Wenn ich in England geblieben wäre, glaube ich, würde ich kein Jude sein. Zwar würde ich wissen, dass ich jüdischer Abstammung bin, aber ich würde in keiner Gemeinde sein und nichts für das Jüdische tun. Ich bin für jede Möglichkeit jüdischen Lebens und für kulturelle Betätigung außerhalb der Synagoge. Nicht in Konkurrenz dazu, sondern neben der Synagoge. Ich möchte dazu beitragen, dass junge Menschen den Weg zu ihrem Judentum finden, auch wenn sie nicht in die Synagoge gehen. Was wir tun, ist eben doch anders, als das deutsche Kulturleben. Wir haben Probleme, die die Deutschen nicht, oder anders angehen. Meine Frau muss sich zum Beispiel mit Auschwitz ganz anders auseinander setzen, als ich. Wir werden die Rollen nie tauschen können. Wie die Juden heute in Deutschland gesehen werden, weiß ich nicht, denn ich bin zu sehr in der jüdischen Mischpoche drin. Mein Schwiegervater hatte auf jeden Fall Schwierigkeiten damit, dass seine Tochter einen Juden heiratet und das Kind einen jüdischen Namen bekommt. Das hat er auch gesagt. Es gibt aber auch Philosemitismus - ein dummer Gegensatz von Antisemitismus. Philosemiten wollen die Juden nicht richtig, in ihrer wahren Erscheinung sehen. Denn Juden können genauso schlechte Eigenschaften haben, wie alle anderen Menschen auch. Es gibt ein allgemeines Bewusstsein in Europa, dass Auschwitz eine schwere Hypothek ist. In Deutschland überschlägt sich das manchmal, wenn man mit der Vergangenheit umgeht. In manchen Fällen ist das Gedächtnis schon übertrieben. Die Deutschen sind in der Selbstreflexion viel weiter, als andere Länder. Ich finde schon gut, was sie machen, denn ich leide darunter, dass die Engländer ihre Kolonialgeschichte nicht aufarbeiten, sogar stolz auf sie sind. Aber manchmal wollen die Deutschen zu sehr von ihren schlechten Seiten wissen, und das ist ungesund. Wenn der Bundeskanzler Gerhard Schröder sagt, dass man jetzt endlich der Zukunft entgegenblicken müsse, verstehe ich das. Er ist Vertreter einer neuen Generation, in einer neuen Welt, in einem wiedervereinigten Land. Wir können doch nicht ewig in der Vergangenheit sitzen, das Land muss nach vorne gehen. Wir haben nur ein Leben, eine kurze Zeit auf diesem Planeten. Ich will doch auch das Leben genießen, etwas daraus machen, aber die Welt auch ein bisschen verändern. Mir hat es keine Angst eingeflößt, dass die Neonazis durch das Brandenburger Tor marschiert sind. Ich bin gegen Verbote, ich finde es wichtig, dass die Nazis zu sehen sind, damit man darüber reflektieren kann. Sie drücken mit ihrer extremen Position die Meinung einer kleinen Minderheit in der Bevölkerung aus. 600 Menschen, verglichen mit den 82 Millionen Deutschen sind eine Lappalie. Der Faschismus gehört zur europäischen Kultur. Faschistische Gedanken sind europäische Kulturgeschichte, auch amerikanische, sie gehören zur Kulturgeschichte der Menschheit. Wenn der Rechtsextremismus in Deutschland größer wird, muss es zu einem Diskussionspunkt werden. Aber wenn ich mir die Wahlergebnisse anschaue, habe ich keinen Grund anzunehmen, dass es in Deutschland einen Rechtsruck gibt. Man muss nur nach Österreich schauen, oder nach Frankreich. Ich habe hier keinen Grund zur Sorge. Der Predigt vom Zionismus macht mich allerdings wütend. Es ist doch die größte Selbstlüge des Judentums, dass Israel ein sicherer Hafen ist. Ich finde, es ist die mangelnde intellektuelle Kompetenz der Gemeindemitglieder, dass es so dargestellt wird. Die Leute, die Israel als den Garten Eden schildern, müssen sich doch fragen, wenn das so ist, warum leben sie dann selber nicht in Israel? Warum sind sie nicht ehrlich? Sie verdrängen einfach, dass es so gefährlich ist und dass man dieses Land auch nicht schön finden kann. Sie versuchen, was sie selber nicht getan haben, bei ihren Kindern zu erreichen. Die Zionisten, die hier in Deutschland leben, können ihr schlechtes Gewissen, dadurch beruhigen, wenn wenigstens ihre Kinder nach Israel gehen. Ich betone deshalb, ein europäischer Jude zu sein, weil ich es satt habe, mir von israelischen Zionisten erzählen zu lassen, dass ich nicht hier zu sein habe. Weil ich es nicht mehr hören kann, dass das wahre Judentum nur in Israel lebt, oder von Amerika, dass da das Judentum lebt. Wir sind in der Zwischenzeit wieder da, und wir sind wer in Europa. Wir müssen uns zusammentun und einen dritten Pfeiler des Judentums gründen. Wir haben eine eigene Kulturgeschichte, unser Lebensraum, unsere Lebenserfahrung ist nicht amerikanisch und auch nicht israelisch. Wir haben ein interessantes Problem. Der Osten Europas war immer tief religiös und arm und rückständig, und der Westen hochgebildet und entwickelt. Die „nichtintellektuellen” Juden kamen aus Afrika nach Frankreich, die Sephardim, und die ganzen Displaced Persons aus Osteuropa landeten nach dem zweiten Weltkrieg hier in Westeuropa. Deshalb ist hier die intellektuelle jüdische Identität heute nicht mehr prägend. Wir haben in Europa dadurch eigentlich einen Konflikt zwischen Finsternis und Aufklärung. Zwischen Stettl und Universität. Überall sind europäische jüdische Geschichten zerstört worden durch Auschwitz. Die Menschen in Europa leben darin. Unmittelbar, an den Orten und nicht nur in der Erinnerung. Es prägt unser Bewusstsein anders als in Israel und Amerika, wo es eine abgeleitete AuschwitzIdentität gibt. Auschwitz ist ein Produkt der europäischen Kulturgeschichte. Wenn man mich fragt, wie ich zu den Deutschen stehe, ist es, als ob man mich fragt, wie ich zu mir selbst stehe. Ich bin doch auch Deutscher. Seit den letzten zehn Jahren habe ich gar kein Problem damit, mich als Deutscher zu definieren. Ich bin Teil dieser Wirklichkeit geworden, ich habe den Rubikon überschritten. Zum Teil schaue ich aber durch eine englische Brille, da ich in dem „englischen Sumpf” aufgewachsen bin. Dadurch habe ich teilweise eine größere Objektivität den Deutschen gegenüber. Meiner Ansicht nach gibt es nur zwei miese Charaktereigenschaften der Deutschen. Erstens, das Selbstmitleid. Wenn man den Deutschen Geld wegnimmt, schreien sie, als ob sie sterben würden. Sie haben eine Art und Weise, das Problem zu verfehlen, irgendeine Kleinigkeit zu einem Riesending zu machen, und sich als Opfer schlechthin zu begreifen, anstatt ihr eigenes Problem in Verhältnis zu anderen zu setzen. Was mir an den Deutschen noch nicht gefällt, ist, dass sie zu sehr ihren Ellbogen benutzen. Es gibt hier nicht so einen angenehmen Alltag, wie in Holland, wo die Menschen einen gewissen netten Umgang miteinander haben. Ich könnte mir hier auch diese Freundlichkeit vorstellen. Meine kritische Einstellung mag von England geprägt zu sein, wo man auch höflicher ist. Aber dafür gibt es Sachen in England, die ich nicht ausstehen kann. Die englische Heuchelei ist unerträglich. Genauso ihre Selbstgerechtigkeit in ihrer Geschichte, ihre Arroganz, und der Glaube, sie seien besser als andere. Auf der anderen Seite sind die Engländer viel pragmatischer und können das Leben lockerer nehmen. Ich bin auch Engländer, meine Grundprägung ist englisch und nicht deutsch. Meine Muttersprache ist Englisch, ich rede nur englisch mit meinen Kindern. London ist mir zehnmal näher, als jede deutsche Stadt. Berlin ist mein Zuhause, London ist meine Heimat. Dort leben kann ich nicht mehr, aber es ist trotzdem meine Heimat. Ich bin geprägt von diesem Land und seiner Sprache, ich kenne die Menschen. In London fühle ich mich in einem ganz besonderen Fluidum, das ich mit Deutschland nicht vergleichen kann. Deutschland ist aber nicht total verschieden, es ist Europa. Ich bin ein Teil von dieser Wirklichkeit. Um es mit der Computersprache auszudrücken: mein Betriebssystem ist englisch, mein Programm ist deutsch. Ohne Betriebssystem funktionieren meine Programme nicht. Meines Judentums wegen habe ich nie negative Erfahrungen gemacht. Das Hochstilisieren von einzelnen Kränkungen ist meines Erachtens deutsches Selbstmitleid auf jüdisch. Ewig jammern, und keinen einzigen Schritt machen, um die Situation zu verbessern, die Verantwortung zu übernehmen, auch selber zu handeln, das kann ich nicht akzeptieren. Als Jude habe ich an bestimmten Punkten eine andere Betrachtungsweise, aber es gibt für mich keinen dichotomischen Gegensatz zwischen jüdisch sein und deutsch sein. Es gibt deutsche und jüdische Besonderheiten. Es ist ein Teil von dem Facettenreichtum der deutschen, der europäischen Gesellschaft, dass wir alle möglichen Identitäten in uns haben. Shlomo Tichauer „Ein Opfer denkt eben anders, als ein Verfolger und selbst die Nachkommen haben Schwierigkeiten” Shlomo Tichauer lebt seit 1957 in Deutschland. Zwar hatte er keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber seine Zurückhaltung gegenüber den Deutschen kann er nicht überwinden. Freundschaften schliesst er mit ihnen nicht. Unter Deutschen hat er immer noch das Gefühl, ein Fremder zu sein. Er baute hier seine Existenz auf, aber in Israel fühlt er sich viel besser. Das ist seine Heimat. Der 65jährige wollte eigentlich in Paris studieren, ist auch hingefahren, bekam dort aber ein Telegramm von seinem Vater, das ihm mitteilte, er habe ihn an der Technischen Universität in Berlin eingeschrieben. Als mein Vater mich - ohne vorher zu fragen - an der TU anmeldete, hat er es vor allem aus finanziellen Überlegungen getan. Man musste keine Studiengebühren bezahlen und ich erhielt sogar ein Stipendium. Meine Eltern bekamen in Deutschland Wiedergutmachung und mir wurde gleich die deutsche Staatsangehörigkeit zugesprochen. Die Eltern dachten, dass es mir auch der Sprache wegen leichter fallen würde, hier zu studieren. Sie hatten keine Bedenken. Für mich war es aber damals noch schwer vorstellbar, in Deutschland zu leben. Als ich noch klein war, gab es in Israel eine sehr starke antideutsche Stimmung. Es war nicht erwünscht, auf der Straße deutsch zu sprechen. Obwohl sie aus Deutschland vertrieben worden sind, waren die deutschen Juden in Palästina, später Israel weniger antideutsch eingestellt, als die anderen Flüchtlinge. Vor Hitler hatten die deutschen Juden eine relativ gute Zeit. Mein Vater erzählte mir, er habe sich als Deutscher gefühlt mit jüdischem Glauben. Er hatte viele nichtjüdische Freunde und wenn die zur Kirche gingen, ist er in die Synagoge gegangen. Er sang dort auch im Chor. In Tel Aviv, wo wir lebten, waren die deutschen Juden immer mit der deutschen Kultur verbunden, soweit ich es in Erinnerung habe. Das hatte auch damit zu tun, dass sie die Landessprache, Hebräisch nie richtig erlernt hatten. Sie freuten sich immer, wenn Künstler aus Deutschland kamen, obwohl das nach dem Krieg natürlich sehr schwierig war. Trotz der antideutschen Gefühle der Menschen gab es in Israel auch eine deutsche Zeitung. Zu Hause haben wir deutsch gesprochen, meine Eltern konnten nur wenig Hebräisch. Die Leute, mit denen sie verkehrten, waren meistens deutsche Juden. Mein Vater sagte auch, wer bei ihm etwas kaufen will, muss Deutsch können. Meine Eltern sind in Polen geboren. Mein Vater 1905 in Katowice, meine Mutter 1903 in Krakau. Sie sind 1933 von Deutschland nach Palästina ausgewandert. Mein Vater war 1917 von Katowice nach Berlin gekommen. Er war Vollwaise und hatte in Berlin einen Bruder, der ihn unter seine Fittiche nahm. Der Vater lernte hier den Beruf des Klempners. Das kam ihm später, als er nach Palästina auswanderte zugute, da damals mehr Handwerker als Akademiker gefragt waren. Von seinen 7 Brüdern lebte später einer in München und ein weiterer kam nach Berlin, der machte hier eine Apotheke auf. Während der Hitlerzeit ist er dann nach Uruguay ausgewandert. Von den anderen Geschwistern ging ein Bruder nach Argentinien, ein weiterer nach Palästina. Einer seiner Brüder hat meinen Vater 1936 in Palästina besucht, kehrte aber nach Polen zurück, wo er dann umgekommen ist. Der Bruder, der in München lebte, wurde als ausländischer Jude nach Polen abgeschoben und hat den Krieg auch nicht überlebt. Meine Mutter war 3 Jahre alt, als die Familie nach Kiel übersiedelte, um bessere Lebensbedingungen zu finden. Sie waren 11 Geschwister. Eine fromme Familie. 1929 zogen sie dann weiter nach Berlin. In Kiel gab es nämlich schon damals antisemitische Vorfälle. Die Mutter hat mir erzählt, schon 1923, als sie den Seder feierten, haben Deutsche das Fenster mit Steinen beworfen. Sie bekamen aber nicht nur den Antisemitismus zu spüren. Auch die deutschen Juden hatten die Ostjuden nicht angenommen. Für sie waren sie Fremdkörper. Eine Schwester meiner Mutter konnte zum Beispiel ihren Freund, der deutscher Jude war, nur heimlich treffen, weil dessen Familie die Beziehung strikt ablehnte. Die Familie meiner Mutter ging deshalb nach Berlin, weil sich die Eltern von der Großstadt, wo auch mehr Juden lebten, größere Sicherheit versprachen. Laut Verordnungen der Nazis mussten die Eltern nach Polen zurückkehren. Ein Bruder meiner Mutter ist mitgegangen. Sie kamen alle um. Einige der Geschwister waren in Deutschland bereits verheiratet und drei wanderten nach Argentinien aus. Eine Schwester, die ebenfalls nach Polen ging, ist nach Sibirien geflüchtet, und nach dem Krieg folgte sie den Familienmitgliedern nach Argentinien. Die vier jüngsten Geschwister sind im Rahmen der Jugendbewegung nach Palästina gekommen. Meine Eltern haben sich in Berlin in einer zionistischen Gruppe kennen gelernt. Mein Vater war Kommunist, also doppelt gefährdet. Jüdisch sah er eigentlich nicht aus. Er hatte geboxt und wurde an der Nase operiert. Einmal musste er einen alten Juden beruhigen, ihm erklären, dass er auch Jude sei. Als die SA marschierte, sind nämlich viele Juden, die den Hitlergruß nicht machen wollten in die Hauseingänge geflüchtet und taten so, als würden sie jemanden suchen. Mein Vater stand ebenfalls im Flur neben einem alten Juden, der sichtlich Angst vor ihm hatte, bis er ihm erklärte, er hätte keinen Grund dazu. Die Mitgliedschaft in der zionistischen Gruppe hätte meinen Eltern allein nicht geholfen, der Verfolgung zu entkommen. Da die Engländer nur Menschen mit landwirtschaftlicher Kenntnis nach Palästina einließen, machte mein Vater noch eine Agrarausbildung. Er hatte sein Zeugnis bekommen und durfte fahren. Meine Mutter konnte aber nicht mit, weil sie nicht verheiratet waren. Von Palästina aus hat er ihr dann geschrieben, sie solle unbedingt versuchen, nachzukommen. So hat die Mutter einen anderen Mann fiktiv geheiratet - als Ehepartner konnte man mit demselben Zertifikat auswandern. In Palästina ließ sie sich scheiden und heiratete meinen Vater. In Palästina hat mein Vater gleich in seinem Beruf, als Klempner gearbeitet. 1939 machte er sich dann selbständig. Er hatte eine Werkstatt, in der elektrische Warmwasserspeicher hergestellt wurden. Nach dem Abitur und dem Militärdienst habe ich ein Jahr lang bei ihm mitgearbeitet. Es war sein Wunsch, dass ich Maschinenbau studiere - ich hätte gern ein Humanfach, wie zum Beispiel Geschichte gewählt. Da ich aber an der Technischen Hochschule in Haifa nur Bauingenieur hätte studieren können, entschloss ich mich für ein Auslandstudium. Nachdem ich am französischen Konsulat Sprachkurse belegt hatte, fuhr ich 1957 nach Paris, um dort zu studieren. Alles kam aber dann anders. Meine Eltern waren besuchsweise nach Deutschland gereist; in Berlin erkundigte sich mein Vater nach den Studienmöglichkeiten und ließ mich gleich einschreiben. Ich bekam ein Telegramm, ich solle meine Sachen packen und kommen. Das passte zwar nicht in meine Vorstellung, aber ich tat immer, was mir meine Eltern sagten. Schon der Weg nach Deutschland war unangenehm. Im Zug von Paris nach Berlin sassen viele Kriegsinvaliden und ich überlegte, was sie wohl im Krieg gemacht hatten. Durch die schulische Erziehung war ich sehr antideutsch eingestellt. In Berlin war 1957 noch vieles zerstört. An jeder Ecke konnte man die Spuren sehen, die der Krieg hinterlassen hatte. Das Studium fiel mir sehr schwer, weil ich in Israel das humanistische Abitur gemacht hatte. Mir fehlte sehr viel Mathematik und Chemie. Ich wollte schon aufgeben. Aber dann kam meine Mutter für ein halbes Jahr nach Berlin - sie musste sich ärztlichen Untersuchungen unterziehen - und sie hat mich seelisch aufgebaut. Auch ein Freund half mir, er hatte in Israel das reale Abitur gemacht. Nach einem Semester fand ich dann den Anschluss. Das Studium machte mir aber keinen Spaß. Die Jugendlichen, die aus dem Nahen Osten kamen, hatten nicht den Kontakt zu Maschinen, wie die Kinder hier in Deutschland. In den praktischen Studien hatten wir sehr viele Schwierigkeiten, die theoretischen Fächer waren für uns einfacher. Als ich anfing zu studieren, waren an der TU nur 4 Israelis und paar hundert Araber. Nach der Suez-Krise sind sehr viele Araber, die früher nach England und Frankreich gingen, nach Berlin gekommen. Parallel zu den Vorlesungen gab es private Hilfskurse in Mathematik. Die Araber wollten uns nicht haben und für die Assistenten, die die Kurse hielten, war es klar, für wen sie sich entscheiden. Sie haben uns nicht deshalb ausgeschlossen, weil sie eine antiisraelische Haltung einnahmen, es ging ihnen einfach um ihr Einkommen. In Berlin habe ich mich schnell zurechtgefunden, weil ich gleich zur Gemeinde gegangen bin. Es gab dort eine Jugendgruppe und sie bot mir ein Zuhause. Als ich Kontakte suchte, war es klar für mich, dass es Juden sein mussten. Zu ihnen habe ich mich hingezogen gefühlt. Die Jugendgruppe half mir, mich hier einzuleben. An der Uni traf ich viele ausländische Studenten, die sich viel einsamer fühlten. Ich habe mich mit Jugenderziehung beschäftigt, von der Gemeinde bin ich oft in Jugendlager geschickt worden. Als ich das Vordiplom machte, war ich auf einem Rabbinerseminar in England zu Besuch. Ich überlegte, Rabbiner zu studieren. Aufgrund meiner Kenntnisse hätte ich gleich im vierten Studienjahr einsteigen können, weil jemand, der in Israel das humanistische Abitur gemacht hatte, sehr gutes Grundwissen mit sich brachte. Aber meine Eltern, die übrigens 1964 auch nach Berlin zurückgekommen sind, sagten mir, ich sollte zuerst das angefangene Studium beenden. Insgesamt studierte ich 9 Jahre an der Technischen Universität, weil ich zwischendurch noch vielen anderen Aktivitäten nachging. 1962 bin ich Religionslehrer geworden und diese Tätigkeit übte ich über Jahrzehnte aus. In der Studentengruppe fragte man, ob jemand bereit ist, eine Lehrerin zu ersetzen, die schwanger wurde und ich habe mich gemeldet. Die Lehrerin erwartete ein Kind von einem nichtjüdischen Mann und sie hatte dann Probleme damit, als Religionslehrerin weiterzumachen. So wurde ich gebeten, ihre Arbeit endgültig zu übernehmen. Die Kinder fingen mit 7 Jahren an und lernten bis zu ihrem 12. Lebensjahr Religionsgeschichte und Hebräisch. Später habe ich mich auch noch allein weitergebildet, um besser unterrichten zu können. Kurz nachdem ich mit dem Religionsunterricht angefangen hatte, kam ein Lehrer aus Australien, der eine Bar-Mizwa Klasse startete. Er bereitete ungefähr 20 Schüler auf ihren Bar-Mizwa vor. Nach einem Monat nahm er sich aber das Leben. Der damalige Vorsitzende der Gemeinde, Heinz Galinski rief mich an und sagte: „Ab morgen machst du weiter”. Um die Aufgabe ruhigen Herzens übernehmen zu können, musste ich auch die Melodien kennen: Einen Monat lang ging ich zu einem Kantor, um sie zu lernen und seitdem leite ich diese Vorbereitungskurse. Der Unterschied zwischen der einstigen und der heutigen Gemeinde ist gravierend. Damals haben wir Jugendliche, die aus Israel gekommen sind alle zusammengehalten. Wir waren eine sehr gute Jugendgruppe, mit interessanten Programmen, Tanzabenden, Sportaktivitäten und organisierten auch ein Winter- und ein Sommerlager. In die Gemeinde war ich sehr integriert und als Bar-Mizwa Lehrer wurde ich natürlich zu jeder Feier eingeladen. Die Atmosphäre änderte sich dann. Vielleicht habe ich das auch deshalb wahrgenommen, weil ich erwachsener wurde und nicht mehr so naiv war. Bis vor 20 Jahren zählte die Gemeinde 6000 Mitglieder. Die meisten lebten schon längere Zeit hier und bildeten eine mehr oder weniger geschlossene Gruppe. Als dann Anfang der 90-er Jahre die große Einwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion begann, ist die Gemeinde sehr gewachsen. Solange Galinski da war, hat er die Gemeinde sehr straff geführt, oft mit diktatorischen Mitteln. Damals war ich auch kein Freund davon, aber im nachhinein, wenn ich sehe, was jetzt los ist, denke ich, seine Methode hatte auch Vorteile. Die Gemeinde als Institution wurde respektiert, sie war gut organisiert und wenn es Probleme gab, sind sie nicht nach außen getreten. Nach dem Tod von Galinski fing der Streit um die Nachfolge an und die Gemeinde spaltete sich. Ein Teil der Neuankömmlinge aus den GUS-Staaten war zwar auf dem Papier Jude, hatte aber von den jüdischen Werten wenig Ahnung. Es ist bis heute schwer mit ihnen. Eine große Behinderung der Integration ist, dass sie eine andere Sprache, - Russisch - sprechen und andere Gewohnheiten haben. Wenn ich heute zum Beispiel zu einer Bar-Mizwa-Feier eingeladen bin, kann es passieren, dass ich unter den 200 Gästen der Einzige bin, der nicht Russisch spricht, und alle Reden werden in Russisch gehalten. Es ist kein schönes Gefühl, da zu sitzen, und nichts zu verstehen. Diejenigen, die schon seit 20 Jahren hier sind, sprechen zwar schon Deutsch. Aber sie haben eine andere Mentalität. Teilweise tätigten sie Geschäfte, kurzlebige Geschäfte, womit man schnell Geld verdient, die aber nicht immer sauber waren. Sie nutzten die Gemeinde aus, waren aber nicht bereit, der Gemeinde etwas zu geben. Das Gefühl der Solidarität haben sie nicht gelernt. Ich kenne viele Mitglieder, die als sie nicht mehr auf die Gemeinde angewiesen waren, ausgetreten sind. Vielleicht ist es auch wahr, dass die Neueingewanderten sich deshalb so verhalten, weil sie von der Gemeinde spüren, dass sie auf Distanz zu ihnen geht. Trotzdem glaube ich, das die Alteingesessenen sich mehr in ihren Rechten beschränkt sehen, als umgekehrt. Angeberei gab es immer in der Gemeinde. Man vergisst schnell, dass man auch vor nicht so langer Zeit gekommen ist. Die meisten Gemeindemitglieder sind osteuropäische Juden, die zum großen Teil nach dem Krieg als „Displaced Persons” nach Deutschland kamen und hierblieben. Wenn man einen gewissen Wohlstand erreicht, erinnert man sich oft nicht mehr an die Anfänge. Mit der Führung der Gemeinde bin ich ebenfalls unzufrieden. Das Problem ist, dass wir eine Einheitsgemeinde haben, mit den verschiedenen - orthodoxen, konservativen und liberalen Richtungen. Ich bin dafür, dass jede Gruppe sich nach ihrer Auffassung betätigen soll. Auch gegen Frauengottesdienste habe ich nichts. Die allgemeine Vereinheitlichung ist zwar nach außen hin politisch vernünftig, aber warum soll man in eine Gruppe gedrängt werden mit Leuten, mit denen man sich nichts zu sagen hat? Es ist folgende Situation eingetreten: der liberale Rabbiner Rothschild wurde fristlos entlassen und der orthodoxe Rabbiner Ehrenberg hat an Macht gewonnen. Dadurch hat sich alles in Richtung Orthodoxie verlagert; ich möchte aber nicht, dass hier die Orthodoxie das Sagen hat. In ganz Berlin gibt es vielleicht nur 50 orthodoxe Leute. Vom Vorstand der Synagoge bin ich zurückgetreten, weil man mit dem Rabbiner Rothschild so unfair umgegangen ist. In Deutschland hatte ich von Anfang an wenig nichtjüdische Freunde. Auch sie waren meistens Nichtdeutsche, zum Beispiel Griechen an der Universität. Wegen der Geschichte und meiner schulischen Erziehung konnte ich mich mit Deutschen nicht anfreunden. Nicht weil sie es nicht gewollt hätten, es war meine Zurückhaltung und das ist bis heute so geblieben. Beruflich habe ich viel mit Deutschen zu tun, aber privat verkehren wir nicht miteinander. Das Gefühl, das mich davon abhält, habe ich am Anfang mit der Shoah verbunden, und noch heute steckt in meinem Hinterkopf die Frage: Was waren wohl die Eltern der Deutschen, die ich treffe? Jetzt liegt der Grund für meine Reserviertheit aber mehr darin, dass ich genug jüdische Freunde habe. Ich bin Jude in Deutschland, als „deutschen Juden” würde ich mich auf keinen Fall bezeichnen. Als Deutscher fühle ich mich absolut nicht. Obwohl ich gern hier bin, könnte ich nicht in einer Stadt oder einem Dorf leben, wo es keine Juden gibt. Ich brauche eine jüdische Gesellschaft. Unter Deutschen komme ich mir immer wie ein Außenseiter vor, obwohl es in vieler Hinsicht nicht an ihnen liegt. Mehr als 20 Jahre lang habe ich an der Hochschule für Klimatechnik unterrichtet. Dort veranstalteten die Dozenten zu Weihnachten immer eine Feier. Meine Kollegen wussten, dass ich in Israel geboren bin, denn ich habe oft über das Land erzählt. Zu der Weihnachtsfeier ging ich natürlich hin, denn ich wollte mich nicht ausschließen. Weihnachten fällt mit Chanukka zusammen und die Kollegen waren so nett, auch ein jüdisches Thema einzubeziehen, zum Beispiel die Werke eines jüdischen Schriftstellers, oder ich musste über Chanukka erzählen. Sie haben sich wirklich sehr bemüht, aber ich bin nur aus Höflichkeit hingegangen. Es war nicht meine Welt. Ich hätte auch nie eine nichtjüdische Frau geheiratet. Meine Frau lernte ich in Argentinien kennen. Wir haben 1971 geheiratet. Zuvor hatte ich auch nichtjüdische Freundinnen, ich bin aber nicht zu ihnen nach Hause gegangen. Eine Wand baute ich selbst, damit ich erst gar nicht in die Versuchung gerate, die Beziehung zu vertiefen. Ich wollte auch keine falschen Erwartungen wecken. Mit jüdischen Freundinnen hatte ich viel mehr gemeinsam und ich musste nicht bei jedem Wort aufpassen, damit man einander nicht unabsichtlich verletzt. Auch meinen Söhnen - sie sind 27 und 24 Jahre alt - würde ich abraten, eine nichtjüdische Frau zu heiraten. Ich habe ihnen erklärt, dass ich nicht aus irgendwelchen mystischen Gründen dagegen bin, sondern weil Probleme, die mit der Vergangenheit zu tun haben, immer wieder auftreten. Ein Opfer denkt eben anders, als ein Verfolger und selbst die Nachkommen haben Schwierigkeiten. Nachdem meine Söhne das Abitur gemacht haben, waren sie beide für ein halbes Jahr in Israel. Der Ältere verbrachte diese Zeit in einem Kibbuz, lernte aber dort mehr Englisch, als Hebräisch, weil er sehr viele Jugendliche aus dem Ausland traf. Der Jüngere war in einer privaten Schule und hat dort sehr gut Hebräisch gelernt. Mit ihm spreche ich nur hebräisch. Von einem Juden, der hier geboren wurde, verlange ich nicht, dass er eine so starke Bindung zu Israel hat, wie ich, der ich in Israel aufgewachsen bin. Für einen deutschen Juden ist es natürlich schwieriger, dieses enge Zugehörigkeitsgefühl zu haben, weil er die Sprache nicht spricht und das Land hat ja nicht nur seine sonnigen Seiten. Mit dem Gemisch verschiedener Nationen ist es nicht leicht, umzugehen und in Israel gibt es nicht so eine Ordnung, wie hier. Wenn ich Kinder auf ihren Bar-Mizwa vorbereite, versuche ich, ihnen jüdische Identität beizubringen. Bisher habe ich mehr als 500 Schüler gehabt. Ich denke schon, wenn ein Junge in die Synagoge kommt und nach einem Jahr diese Feier mitmacht, bleibt bei ihm etwas hängen. Aber das ist nicht genug. Die beste Möglichkeit sehe ich darin, dass man einen starken Kontakt zu Israel pflegt und sich das jüdische Bewusstsein über Israel aneignet. Was jüdische Ideale betrifft, ist dort das geistige Zentrum. Während des Bar-Mizwa-Unterrichts möchte ich die Kinder zu einer bestimmten Verantwortung erziehen, ihnen vermitteln, dass jeder Jude durch sein Verhalten dazu beiträgt, ob vom Judentum ein positives oder negatives Bild geformt wird. Das heißt, man hat eine Verantwortung gegenüber anderen Mitjuden, denn wenn man sich schlecht verhält, leiden auch die anderen darunter. Es gibt den Spruch, dass im jüdischen Volk einer für den anderen verantwortlich ist. Wenn man in einer Minderheit lebt, ist der Sinn dieses Satzes noch viel wichtiger. In Deutschland sind wir eine Minderheit und jede negative Tat fällt nachteilig auf alle Juden zurück. Ich versuche den Kindern auch zu erklären, wie wichtig der Zusammenhalt ist und dass man sich nicht nur auf materielle Werte konzentrieren soll. Sie lernen die ethischen Werte, die in der Thora vorgegeben werden, kennen, und ich spreche darüber, wie wichtig soziale Gerechtigkeit ist. Allein durch die Religion, zumindest in Deutschland wird man es, glaube ich, nicht schaffen, eine starke jüdische Identität aufzubauen. Die meisten interessieren sich gar nicht für die Religion. Man kann die jüdische Geschichte nicht von der religiösen Geschichte trennen. Ich glaube an das Gute, dass die Menschen das Gute tun sollen, aber ich glaube nicht, das ein höheres Wesen Moses die 10 Gebote in die Hand gedrückt hat. Die Absicht, die Menschen zu veredeln, sehe ich als einen Vorteil der Religion an. In der Thora stehen die Gesetze für die zwischenmenschlichen Beziehungen und diese sind wichtig für mich. Zwar weiß ich, dass es zwischen Theorie und Praxis eine große Diskrepanz gibt, aber ich versuche, mich an die Theorie zu halten. Angst habe ich nicht, dass mich jemand bestrafen wird wenn ich etwas falsch mache. Ich denke einfach, man sollte das Gute tun, weil es das Richtige ist. Den Menschen messe ich nicht daran, was er glaubt, sondern daran, wie er sich im Leben verhält. Da die Religion das Wesen des Menschen beeinflussen will, meine ich, sie ist wichtig. Was ich glaube, ist aber uninteressant, es ist meine private Angelegenheit. Doch wenn jemand gläubig ist, respektiere ich es. Religion ist etwas sehr persönliches. In Israel wird die Erinnerung an den Holocaust sehr stark gepflegt. Der Holocaust wird Teil der Religion, eine Ersatzreligion. Da die Religion nicht mehr die Rolle spielt, wie früher, versucht man, andere integrierende Faktoren zu suchen, um das jüdische Selbstverständnis weiterzuführen. Es ist schon wichtig, dass man sich Fragen stellt, warum bin ich ein Jude, was bedeutet das Judentum? Aber auch Israel hat große Probleme damit. Viele Israelis haben sich von den Werten des Judentums entfernt. Das hängt damit zusammen, dass die Orthodoxie viel Schaden anrichtet, weil sie sich politisch zu sehr einmischt: es geht ihr mehr um Macht, als um echte Ideale. Auch in Israel muss eine Wiedergeburt der Werte erfolgen. Dort gibt es aber viel mehr Möglichkeiten, sich mit diesen Problemen zu befassen. In letzter Zeit kommt es nicht mehr so oft vor, dass ich erklären muss, warum ich in Deutschland lebe. Keinem bin ich aber böse, wenn er mich das fragt. Und ich sage dann auch, ich lebe nicht hier, weil Deutschland so phantastisch ist, sondern es hat sich so ergeben, dass ich hier studierte und hier zu arbeiten begann. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich lernen konnte, was ich gelernt habe. In erster Linie lebe ich hier, weil ich meine Existenz aufbaute und es mir gut geht. Aber in Israel fühle ich mich viel besser. Wenn ich nicht finanziell abhängig wäre, würde ich viel lieber in Israel leben. Mit dem halben Fuß bin ich auch immer dort. Ich habe da eine Wohnung und ich fahre alle zwei Monate hin. Wenn ich nicht mehr arbeiten werde, will ich die Hälfte des Jahres dort verbringen. Zur Zeit arbeite ich aber noch als Sachverständiger, Gutachter für das Gericht und für die Bauaufsichtsbehörde.Es scheint, dass die älteren Leute, die noch direkt vom Holocaust betroffen worden sind, stärkere Zusammengehörigkeitsgefühle haben, als die jüngeren. Wenn man die Organisationen, zum Beispiel „Keren Hayessod” nimmt, die für Israel Geld sammelt, gibt es für die älteren Menschen dort keinen Nachwuchs. Ich bin auch in der Zionistischen Organisation Berlin, bis vor kurzem war ich der Vorsitzende. Als 1991 der Golfkrieg ausbrach, haben wir eine Solidaritätsreise nach Israel unternommen. Bekannte von mir konnten es aber gar nicht verstehen, sie sagten, es wäre verrückt, hinzufahren, wenn Pershing-Raketen auf Israel abgefeuert werden. Die Identifizierung ist also nicht so stark. Ich kann verstehen, das sie selber nicht gefahren sind, aber dass sie mich als einen Idioten betrachtet haben... Auch meine Schwiegermutter rief mich an dem Vorabend meiner Abreise noch an, dass ich nicht fahren soll, meine Frau wollte das ebenfalls nicht, aber meine Kinder haben mich unterstützt. Es ist auch keine Heldentat gewesen, ich konnte auch nicht viel helfen, es war nur ein Gefühl, dort sein zu müssen. Delegationen aus der ganzen Welt kamen und es war schon eine moralische Hilfe, dass die Israelis sich nicht allein fühlen mussten. Bei vielen jungen Leuten ist die jüdische Identität schon stark ausgeprägt, aber ich sehe die Gefahr, dass sie nachlässt. Die jungen Leute denken heutzutage hauptsächlich nur an ihre Geschäfte, sie haben im allgemeinen wenig Idealismus. Im Jugendzentrum oder in der zionistischen Jugendbewegung sind sie noch empfänglich für idealistische Werte, dort kann man sie noch begeistern. Aber wenn sie schon im Berufsleben sind, haben sie meistens keine Zeit. Jüdische Leute sind auch stark erfolgsorientiert und die Konkurrenz ist überall sehr groß. Die Jüngeren scheinen noch mehr motiviert zu sein, als die mittlere Generation, im Alter von 30 bis 50 Jahren. Es geht ihnen einfach zu gut. Ich kenne Menschen, die kommen zur Synagoge, ihre Umwelt soll aber nicht wissen, dass sie Juden sind. Man muss versuchen, jeden zu verstehen, aber dieses Verhalten finde ich nicht gut. Ich habe mich immer dazu bekannt, dass ich Jude bin und damit habe ich die beste Erfahrung gemacht. Die Leute haben viel mehr Respekt vor dieser Verhaltensweise, als vor Menschen, die sich verstecken. Die, die sich verkriechen, glaube ich, haben viel mehr Probleme, vor allem mit sich selbst. Die Assimilierung halte ich nicht für richtig. Das jüdische Volk hat so viele Menschen verloren und durch die Assimilierung schrumpft es weiter. Wenn sich dieser Prozess fortsetzt, könnte sich das Judentum auflösen. Das Problem ist nicht nur in Deutschland groß, sondern auch in Amerika. Die „Mischehen” bergen auch viele Probleme in sich. Bei meinen Freunden, die in „Mischehen” leben, und die Frau übergetreten ist, habe ich beobachtet, dass sie immer beweisen müssen, die besseren Juden zu sein. Das ist darauf zurückzuführen, dass sie leider nicht vollständig akzeptiert werden. Wenn wir eine tolerante Welt hätten, wäre es kein Problem. In Mischehen, wo der Partner nicht übertrat, sieht es noch schwieriger aus. Auch die Kinder stehen unter Druck. Ich weiß nicht, ob die Zukunft der Juden in Deutschland die Assimilierung sein wird. Es hängt von der Umwelt ab. Je freundlicher die Umwelt ist, desto größer ist die Gefahr der Assimilierung. Aber in Deutschland kann das wahrscheinlich nicht eintreten, weil wir immer erinnert werden, dass wir hier Fremde sind. Obwohl es auch deutsche Juden gibt, die seit Generationen hier leben - wenige an der Zahl, aber es gibt sie. In den Augen der Deutschen sind wir meiner Meinung nach Fremde. Ausgesprochen wurde das mir gegenüber nie. Wenn man mir aber in politischen Diskussionen sagt, „dein Land”, als ob ich verantwortlich dafür wäre, was dort passiert, habe ich schon das Gefühl, dass man mich als einen Fremden betrachtet. Beleidigt bin ich nicht, weil ich mich wirklich Israel zugehörig fühle, aber für die deutschen Juden mag das anders sein. Damals, als Helmut Schmidt Waffen an Saudi-Arabien liefern wollte und deshalb mit Menachem Begin Auseinandersetzungen hatte, waren wir von der Hochschule gerade auf einer Tagung mit Dozenten aus anderen Städten Deutschlands. Am Rande der Konferenz führten wir natürlich auch politische Gespräche und dort hat man mich immer als einen Repräsentanten Israels genommen. Ich war auch stolz darauf. Aber wenn man das einem deutschen Juden sagt, ist das letztendlich Antisemitismus. Wenn er sich nämlich als Deutscher fühlt, ist es, als würde man ihm sagen „Du bist ein Fremder”. Diese Haltung kommt meines Erachtens daher, dass die Deutschen durch die Gegenwart der Juden ununterbrochen an ihre Geschichte erinnert werden. Ich versuche mich immer in die Deutschen hineinzuversetzen, wie ich das bei jedem Menschen tue: ich denke auch an die Nazis. Ich versuche mir vorzustellen, was ich gemacht hätte, wenn ich zur Nazizeit hier Jugendlicher gewesen wäre. Obwohl viele Deutsche die Juden schätzen und viel ehrliches Interesse für sie da ist, glaube ich schon, dass wir für die Deutschen hier eine Belastung bedeuten, weil wir so etwas, wie ein Kainszeichen sind. Sie sehen in den Juden die Kläger, auch wenn sie gar keinen Grund dazu haben. Mich stört diese Einstellung nicht besonders, weil ich mein jüdisches Bewusstsein habe, aber für einen Juden, der das nicht hat, muss es schlimm sein. Ich bin stolz darauf, Jude zu sein, weil ich weiß, was das Judentum der Welt geschenkt hat: ganz zu Anfang die Bibel, und später das Wirken der großen Sozialwissenschaftler, die sich um die Gerechtigkeit in der Gesellschaft bemüht hatten. Wenn Juden ihre Geschichte kennen, haben sie auch ihr Selbstwertgefühl - sie brauchen keine Angst zu haben oder zu denken, das andere besser sind. Für die jetzt lebenden Generationen, denke ich, kann es keine Verbrüderung mit den Deutschen geben. Wir sind viel zu sehr verstrickt in unsere Geschichte, und die Eltern geben das auch an die Kinder weiter. Als meine Kinder 10 Jahre alt waren, habe ich sie schon nach Theresienstadt und Auschwitz mitgenommen und sie wissen genau, was dort passiert ist. Sie haben zwar viele deutsche Freunde, aber auch sie identifizieren sich nicht mit Deutschland. Wenn in Israel dem Holocaust-Tag immer so viel Bedeutung beigemessen wird, reißt das Wunden auf. Ich habe Zweifel, ob man die Kinder weiterhin mit diesen schrecklichen Sachen belasten darf. Denn nur die erste Generation, die Überlebenden des Holocaust, haben vor ihren Kindern verschwiegen, was geschehen ist. Die zweite Generation spricht schon darüber. Aber es ergibt sich die Frage, ob es vorteilhaft ist, die Geschehnisse in allen Einzelheiten weiterzugeben, weil es ja nicht zur Verständigung führt. Es ist eine philosophische und psychologische Frage, soll man es den Kindern erzählen? Ich habe mir das oft überlegt. Für die eigene Identität ist die Weitergabe unbedingt wichtig, weil sie auch bedeutet, dass wir unserer Vorfahren gedenken wollen, die gelitten hatten. Es ist auch jüdische Tradition, Lebensauffassung, dass man die Vergangenheit nicht auslöschen kann. Aber ich bin nicht überzeugt, dass es für die zwischenmenschlichen Beziehungen, für die Zukunft gut ist. Andererseits bezweifle ich auch das Argument, dass man die Geschichte kennen muss, um das Üble nicht noch einmal zuzulassen. Wir sehen doch, dass die Menschen nicht aus der Geschichte lernen; sie können noch so viel Leid erfahren haben, trotzdem geschieht in der Welt weiter Gewalt. Auch wenn ich nicht daran glaube, dass man allein durch das Kennen der Geschichte gegen die Gefahren der Zukunft gewappnet ist, wird die Denkweise der Menschen doch durch Geschehnisse der Vergangenheit mitbestimmt. Wenn die Qual also weitererzählt wird, kann das dazu beitragen, dass es noch ein paar hundert Jahre lang Vorbehalte gegenüber den Deutschen gibt. Zur Wahrung der jüdischen Identität ist es aber unverzichtbar. Gegenwärtig sehe ich keinen Ausweg aus diesem Dilemma. M. M. „Ich denke, mit der Erinnerung geht man in Deutschland verkrampft um” Für M. M. ist es sehr wichtig, ihre Wurzeln zu kennen, aber sie hat Vorbehalte dagegen, ein Bekenntnis abzulegen. Ein Freund hält ihr bis heute vor, dass sie gesagt hat, „meine Mutter ist Jüdin” - als würde sie die Konsequenz für sich nicht ziehen wollen. Sie ist 1965 in Kanada geboren. Seit dem Alter von 5 Jahren lebt sie in Deutschland. Sie meint, dass sich ihr Wesen aus vielen verschiedenen Zeiten und Erinnerungen und aus Orten zusammensetzt, wo sie und ihre Familie gelebt haben. Es tut ihr leid, dass es ihr nicht vergönnt war, die jüdische Tradition lebendig zu erleben. Denn in Büchern, sagt sie, kann man das nicht nachholen. In meiner Familie habe ich die Aufgabe übernommen, das Schicksal meiner Angehörigen über Geburtsurkunde, Lebens- und Todesdaten zu rekonstruieren. Als Kind wusste ich zum Beispiel, dass meine Mutter früher Ilona Mermelstein geheißen hatte und dann andere Namen trug. Ich wollte die Dokumente sehen. Als 14jährige schrieb ich aus Deutschland nach Antwerpen, um die Geburtsurkunde meiner Mutter zu erhalten, die ich auch bekam. Mit meiner Mutter bin ich dann mehrmals in das Kloster in Kontich in der Nähe von Antwerpen gefahren, wo sie während der deutschen Besatzung von Nonnen versteckt worden war. 1996 befragte ich dort eine knapp hundertjährige Schwester, die sich noch an diese Zeit erinnern konnte und nahm das Gespräch auch aufs Tonband. In der Jüdischen Gemeinde in Antwerpen konnte ich in die Gestapo-Akten einsehen. Was ich über meine Großeltern weiß, stammt aus diesen Akten und aus den spärlichen Erzählungen einer Tante meiner Mutter, die heute am Rande von New York lebt. Die Eltern meiner Mutter kamen aus der Ukraine, sie hießen Mermelstein und Apfeldörfer. Sie sind 1936 aus einer orthodoxen Stadt namens Munkacs nach Antwerpen gekommen. Der Grund dafür war vermutlich der, dass die Frau 10 Jahre älter war als der Mann, und diese Ehe wurde in ihrer Heimatstadt schief angesehen. Der Vater war 24, die Mutter 34 Jahre alt. Vielleicht gab es auch wirtschaftliche Gründe für ihre Übersiedlung. Meine Mutter ist 1938, ihre Schwester zwei Jahre später geboren. Die Tante meiner Mutter mütterlicherseits hat im Jahre 1942 Verstecke für acht jüdische Kinder gesucht. Die anderen Erwachsenen standen damals wahrscheinlich kurz vor der Abholung oder wurden bereits von der Gestapo abgeholt. Alle acht Kinder hat die Tante nach und nach in dem Kloster von Kontich unterbringen können. Die Übergabe des ersten Kindes mit Namen Lea (die Cousine meiner Mutter) fand zwischen Tieren, im Zoo von Antwerpen statt. Das Kloster gehört einem kleinen kontemplativen Orden, der karitativ arbeitet. Als die Tante Kontakt zu dem Kloster aufnahm, hat die Vorsteherin sofort zugestimmt. Das Kloster widmete sich der Erziehung und führte ein Internat. Die christlichen Kinder wohnten das ganze Jahr über dort und gingen nur in den Ferien nach Hause. Die jüdischen Kinder hatten diese Möglichkeit natürlich nicht. Heute wissen die Nonnen nicht mehr genau, wann die Kinder kamen, nur dass es im Sommer 1942 war. Der Vater meiner Mutter ist im Juli 1942 abgeholt worden, die Großmutter im August. Die Nonnen haben erzählt, dass die Tante einmal, im Herbst noch zu Besuch kam. Meine Mutter hat eine vage Erinnerung daran. Sie hat lange gedacht (oder gehofft), dass es sich bei der Tante eigentlich um ihre Mutter handelte. Die Schwester meiner Mutter wurde sofort adoptiert. Die Eheleute, die sie adoptierten, waren verwandt mit einer der Nonnen. Sie wussten also, dass sie noch eine Schwester hatte. Ob es nur ökonomische Gründe waren, dass sie nicht beide Mädchen nehmen wollten, oder etwas anderes, weiß man nicht. Tatsache ist, dass die Schwester meiner Mutter große blaue Augen und blonde Locken hatte, meine Mutter aber braune Augen und braune Haare und sie sich auch ansonsten nicht ähnlich waren. Meine Mutter konnte schon sprechen, war weniger formbar. Ab und zu durfte meine Mutter ihre Schwester besuchen. Meine Mutter wollte immer dahin. Manchmal ist sie hingelaufen und hat sich vor die Tür gesetzt. Aber sie wurde immer nur für ein paar Stunden aufgenommen. Sie hatte eine sehr enge Beziehung zu ihrer Cousine, die zwar auch adoptiert wurde, aber weiter in diese Klosterschule ging. Sie ist mit 17 Jahren an einer nicht erkannten Lungenentzündung gestorben. Das hat meine Mutter kaum verkraftet - ihre Cousine stand ihr viel näher als ihre Schwester. Einmal hat diese Cousine viel zur Rettung der jüdischen Kinder beigetragen. Die Kinder wurden verraten. Die Gestapo kam. Das erste Mal konnte eine Nonne die jüdischen Kinder bei Nachbarn verstecken. Das zweite Mal ging es nicht mehr. Die Kinder wurden verhört. Manche Kinder waren noch zu klein, um zu reden, die Fürsprecherin war Lea, die Cousine meiner Mutter. Sie war sehr klug. Man fragte sie: „Wie heißt deine Mutter?” Sie sagte schlicht: „Mama”. Die Gestapo konnte nicht nachweisen, dass die Kinder jüdisch waren. Die Schwestern behaupteten, sie wären Waisenkinder aus dem Osten, und deshalb hätten sie auch keine Unterlagen. Sie hatten auch das Glück, dass der Bürgermeister dieser kleinen Ortschaft, der alles wusste, sie unterstützte. Er war auch beim Verhör anwesend und nahm die Kinder und die Nonnen in Schutz. Es gibt eine Legende, nach der Ausweise und Dokumente der Kinder im Klostergarten vergraben sind; an einem heiligen Ort, unter einer Reliquie. Man darf dort nur zu Notzeiten graben, also ist die Kassette, die dort angeblich mit den Dokumenten liegt, heute nicht zugänglich. 1944 waren in der Nähe des Klosters amerikanische Soldaten stationiert. Meine Mutter erzählte mir, als ein Soldat ihr eine Orange gab, hat sie einfach hineingebissen, weil sie bis dahin noch nie eine Orange gesehen hatte. Ende 1944 wurde der Ort wieder von Deutschen besetzt, und da wurden diese Soldaten zusammen mit den Kindern versteckt. Die Nonnen haben ein zweites Mal ein sehr großes Risiko auf sich genommen. Auch andere Kinder sind adoptiert worden, die meisten erst nach dem Krieg. Bei einem Mädchen kehrte die Tante zurück und holte sie ab. Bei meiner Mutter gab es auch zwei Adoptionsversuche, aber beide sind gescheitert. So ist sie die Einzige gewesen, die in dem Kloster blieb, bis sie volljährig war. Die Gefühle meiner Mutter den Nonnen gegenüber sind klar: sie weiß, das diese Menschen ihr das Leben gerettet haben, dass die Nonnen sie bekehren, ihr Jüdisch-Sein wegnehmen wollten, liegt für sie nicht auf der Hand und ist jedenfalls zweitrangig. Ich weiß nicht ab wann sie wusste, dass sie jüdisch ist, aber sie wusste es. Jedenfalls hat sie eine christliche Sozialisation erlebt. Nach dem Krieg gab es einige Prozesse zwischen der Jüdischen Gemeinde und dem Kloster, weil das Kloster die jüdischen Kinder nicht herausgeben wollte. Die Kinder hatten zum Teil nur entfernte Verwandte, und die Gemeinde wollte sie unbedingt wieder im Familienkreis haben. Die Nonnen sagten, die Kinder seien christlich sozialisiert, wurden zu ihrem eigenen Schutz getauft und umbenannt. Die Prozesse zogen sich lange hin. Am Rande dieser Prozesse hat die Tante von meiner Mutter väterlicherseits, die in New York lebte, eine Radiosendung über die ehemals versteckten Kinder und den Streit um sie gehört. Sie erfuhr es auf diese Weise, dass es eine Überlebende aus ihrer Familie gibt: nämlich meine Mutter. Die Tante in New York unternahm die notwendigen bürokratischen Schritte und holte meine Mutter zu sich. Sie hat damals bereits das Abitur gemacht. In New York kam meine Mutter in eine vollkommen jüdische Umgebung, und das war ein Schock für sie. Die Tante hat mit ihrem Mann zwei KZ-s überlebt. In Farmingdale, einem Vorort von New York versuchten sie, ein neues Leben zu beginnen, was sie nicht schafften. Sie nahmen meine Mutter auf, die weder mit dem Christentum, noch mit den Judentum zurechtkam. Die Tante hat die Taufe rückgängig machen lassen, und meine Mutter bekam ihren Namen wieder. Meine Mutter fühlte sich sehr unwohl. Am Anfang ist sie in die Kirche gegangen. Die Nonnen hatten sie nie überreden wollen, in den Orden einzutreten. Aber dort, in dieser New Yorker Kirche fragte man sie, ob sie nicht Nonne werden will. Sie war ganz empört. Später, als sie mir das erzählte, hat sie es so formuliert: „They insulted my intelligence”. Ich glaube, nach dieser zweifachen Konfrontation mit der christlichen und danach mit der jüdischen Welt wollte sie überhaupt keine Beziehung mehr zur Religion haben. Sie wollte sich einfach befreien. Irgendwann hat sie ihr Kreuz vom Handgelenk genommen, und mit der Kirche war es für sie vorbei. Sie war aber auch nicht bereit, jüdisch zu sein, zumindest nicht so, wie es ihre Tante gern haben wolle. Die Familie ihrer Tante ging jeden Freitag in die Synagoge, die Söhne hatten Bar-Mizwa. Sie waren alle zwar nicht orthodox, aber meine Mutter hat den Druck gespürt. Sie wusste, dass man sie zurückholen wollte. Man konnte aber die 12 Jahre, die sie in christlicher Umgebung verbracht hatte, nicht mit einem Schlag auslöschen. Die Nachbarschaft, in der die Familie der Tante lebte, war kleinbürgerlich, und meine Mutter tanzte aus der Reihe. Sie war ausgelassen und wollte es sich in ihrem Leben schön machen. Die Leute, die dort lebten, waren fast alle Überlebende. Bis heute atmet dieser Ort Angst und Trauer. Die Menschen schauen voller Angst und Misstrauen um sich herum. Ihre Vorhänge sind zugezogen Mit meiner Tante ist es auch sehr schwierig, über die Vergangenheit zu reden. Ich war 15, als meine Mutter mich zu ihren Verwandten nach New York mitnahm. Sofort wurden große Alben hervorgeholt, und das ganze Album war voll Toter. Lauter junge Leute, und es war klar, dass sie gewaltsam getötet worden sind. Als wir damals meine Tante darauf ansprachen, kamen dabei nur Bruchstücke und viel Weinen heraus. Sie lebte nach der Befreiung in einem DP-Lager in Bayern und hat dort ihren ersten Sohn bekommen. Im Hause der Tante lebte meine Mutter 2-3 Jahre lang. Das Studium konnte sie sich nicht leisten, so ist sie arbeiten gegangen: in eine Bank, wovor es ihr auch im nachhinein gruselt. Sie ist amathematisch, wenn sie Zahlen sieht, ist sie sofort verunsichert. Der Leiter der Bank merkte das natürlich sofort, aber er mochte sie und hat sie behalten. Meine Mutter hat dann einen jüdischen Mann aus Osteuropa kennen gelernt. Beide waren Anfang 20, als sie heirateten. Die Familie der Tante fand die Ehe nicht gut, weil der Mann Maler war und kein Geld hatte. Sie bekamen ein Kind: meine Schwester, die 4 Jahre älter ist als ich. Er und meine Mutter waren nicht sehr glücklich miteinander. Die Familie lebte von einem Tag auf den anderen. Auf einem Fest in Boston, das meine Mutter selbst veranstaltet hatte, lernte sie dann meinen Vater kennen. Wie sie mir erzählte, wussten die beiden sofort, dass sie zusammengehören. Meine Mutter packte ihr Kind und hat den Maler verlassen. Meine Schwester war damals 2 Jahre alt. Mein Vater war fertig mit seinem Studium. Er hat in Harvard Architektur studiert. Das Fest, wo er meine Mutter kennen gelernt hat, war wahrscheinlich das Einzige in seinem Leben, wo er hingegangen ist, denn er hasst solche Veranstaltungen. Mein Vater war ein so genannter Reichsdeutscher. Er ist zwar in Rom geboren, aber in Innsbruck aufgewachsen. Seine Eltern waren promovierte Kunsthistoriker. Der Vater hatte damals ein Stipendium in Rom erhalten, deshalb ist mein Vater dort geboren. Der Vater meines Vaters war ein Nazi. Er wurde eingezogen und hat als Offizier im Osten gedient. In den Briefen, die er seiner Familie schrieb, geht es auch öfter um Juden. Er ist nicht heimgekehrt, bei der Niederlage hat er sich erschossen. Er wurde von einem Bauern gefunden, der dann an meine Großmutter schrieb. Als sie vom Selbstmord erfuhr, hatte sie eine Totgeburt. Für die vier Kinder, die sie davor gebar, hatte sie das Mutterkreuz erhalten. Wie sein Vater gestorben war, wusste mein Vater lange Zeit nicht. Er redete immer so, wie jemand, der nie einen Vater hatte. Lange dachte er, sein Vater sei gefallen. Er redet darüber, aber es ist ihm sehr fremd. Als wäre es nicht sein Vater gewesen, der die Niederlage nicht ertragen konnte und deshalb Selbstmord beging. Wenn wir über Geschichte sprechen, verteidigt er immer den militärischen Widerstand. Ihm ist es sehr wichtig, dass es diesen Widerstand gab, aber wir streiten sehr viel um den Stellenwert. Wir haben unterschiedliche Begriffe von Widerstand. Mein Vater ist 1934 geboren. An den Nationalsozialismus kann er sich sehr gut erinnern. Er weiß auch, wie er immer den Hitlergruß machen sollte und ihn nicht machen wollte, weil er es lächerlich fand, sich in einer Reihe aufzustellen und auf Befehl den Gruß zu machen. 1945 musste mein Vater mit 11 Jahren als Ältester in der Familie die Vaterrolle übernehmen. Meine Oma war mit 36 Jahren allein mit vier Kindern. Sie hat nie wieder geheiratet. Mein Vater hat seine Mutter als sehr unerbittlich in Erinnerung. Die Familie hatte nichts zu essen. Die Kinder stahlen Mais von den Feldern, er musste jeden Tag Holz suchen, um heizen zu können. Der Vater war verwandt mit einer adeligen Familie, der Familie von Falkenhausen. Eine Persönlichkeit dieser Familie nahm am militärischen Widerstand teil. Diese Adeligen haben versucht, meiner Oma und den vier Kindern zu helfen. Aber sie lehnte es ab. Mein Vater redete auf sie ein, aber meine Oma hasste diese Barone und wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Als er volljährig wurde, wollte mein Vater unbedingt von zu Hause weg. Er begann sein Studium in München, und bekam dann mit Hilfe von Walter Gropius, den er kennen gelernt hatte, ein Stipendium nach Harvard. Nach dem Studium erhielt er eine Gastprofessur in Winnipeg/Kanada. Dort bin ich zur Welt gekommen und meine kleinere Schwester auch. Die zweite Heirat meiner Mutter wurde zu einem Problem. Die Tante meiner Mutter konnte schon die erste Ehe kaum verkraften. Jetzt hatte meine Mutter auch noch einen Deutschen geheiratet. Die Familie war völlig schockiert. Auch die Mutter meines Vaters war gegen diese Heirat. Als meine Eltern heirateten - das war 20 Jahre nach dem Krieg -, hat meine Oma kaum glaubliche antisemitische Briefe geschrieben. Sie schrieb meinem Vater wortwörtlich: „Die Juden haben in Europa ausgedient, wie kommst du dazu, dir eine Jüdin zu suchen?” Sie verwendete moralische Druckmittel, um ihn von der Heirat abzuhalten. Diese Briefe nahm aber mein Vater nicht ernst, deshalb änderten sie auch nichts an der Beziehung zu seiner Mutter. Diese Mutter war nur einmal in Kanada bei uns. Sie mochte uns alle nicht. Trotzdem hat sie sich bei meiner Mutter angebiedert, und das fand ich widerlich. Wahrscheinlich hatte sie Schuldgefühle und wollte deshalb erreichen, dass meine Mutter sie sympathisch fand. Wir Kinder mussten die Ferien bei ihr verbringen, und das war für uns sehr schlimm. Das können wir unseren Eltern kaum verzeihen. Sie haben Ferien gemacht, wollten ihre Ruhe haben, und deshalb schickten sie uns zu der Oma. Ich war nur krank bei ihr, obwohl ich ansonsten ein gesundes Kind gewesen bin. Sie brachte mich nie zum Arzt. Als ich Mittelohrentzündung hatte, musste ich mich in die Tür setzen, damit die Sonne mein Ohr heile. Sie meinte, dass wäre die beste Medizin. Das Haus an sich war ein Kinderparadies, aber die Oma hatte furchtbar rigide Erziehungsmethoden. Wenn wir Kinder in der Badewanne sassen und tobten, hat sie uns richtig gezüchtigt. Sie fand es wahrscheinlich sündig. Lara, meiner jüngeren Schwester haute sie mit dem Stock auf die Finger, weil sie eine Orange genommen hat. Mein Vater erzählte, einmal kam er mit meiner Mutter aus Italien zurück und wir wären völlig verwahrlost gewesen. Meine jüngere Schwester hätte Läuse gehabt und wir hätten an den Beinen - angeblich von den Ästen - Striemen und Schorf. Mein Vater war total geschockt. Wenn er das schon sagt, muss das wirklich schlimm gewesen sein. Mein Vater ist nämlich kein Mensch, der auf seine Kinder sehr viel Acht gibt. Wir waren sehr unglücklich bei der Oma. Einmal haben wir uns dann alle drei vor unsere Eltern gestellt und gesagt, das machen wir nie wieder, wir gehen nicht mehr zu der Oma. Damals war meine ältere Schwester schon 14 Jahre alt. Ab dann gingen wir, die Kleineren in Ferienlager, dort fühlten wir uns sehr wohl. Die Oma ist vor anderthalb Jahren gestorben. Als sie schon älter war, wurde sie religiös. Mein Vater meinte, sie wollte Abbitte leisten. Sie arbeitete in der Kirche mit. Aber uns hat das nicht interessiert. Meine Schwester, die drei Jahre jünger ist als ich, hat die Oma trotz der schlimmen Erinnerungen besucht. Nicht allein, sondern mit meinem Vater. Sie nahm nach dem Tod der Oma auch deren Schreibtisch. Das hätte ich nie gemacht, aber für sie ist Familie sehr wichtig. Für meine ältere Schwester vielleicht noch mehr. Ich bin die Ausnahme. Mir wurde oft vorgeworfen, dass ich nichts zur Familie beitragen würde. Ich war immer nach außen orientiert, ich habe mich an den neuen Schulen sehr schnell zurechtgefunden, obwohl ich sehr schüchtern war. Es gab immer Lehrer, an denen ich sehr hing, die Orientierungsfiguren für mich waren und die auch mich mochten. Ich habe auch sehr starke Beziehungen zu Mitschülern gehabt. Diese Freundschaften blieben bis heute bestehen. Die Familie war für mich anderswo. Es war meine Mutter, die den Wunsch hatte, nach Europa zu gehen. Auf sie trifft es glaube ich wirklich zu, dass sie Orte mit Tradition mag. Mit 27 Jahren hat sie angefangen englische Literatur zu studieren. Zwar hätte mein Vater als Gastprofessor noch in Kanada bleiben können, aber meine Mutter wollte aufbrechen. Mein Vater hat sich mehrmals um Stellen beworben, und es sah dann so aus, als würde er in München einen Lehrstuhl für Architekturgeschichte bekommen. So haben wir 1971 unsere Koffer gepackt. Aus dem Lehrstuhl wurde nichts. Wir standen ohne Geld da. Mein Vater wusste sich nicht anders zu helfen, als nach Kanada zurückzugehen und die Gastprofessur wieder aufzunehmen. Meine Mutter blieb mit uns in Deutschland. Sie hat von uns Deutsch gelernt. Es kam ihr zur Hilfe, dass sie das Studium, auch das Lehramt in Kanada abgeschlossen hatte, und so fing sie an, im Gymnasium, „im tiefsten Bayern” Englisch zu lehren. Wir wohnten außrhalb von München. Ich war 5 Jahre alt, als wir 1971 ankamen. Gleich wurde ich eingeschult. Für mich war es viel leichter, die Sprache zu erlernen als für meine ältere Schwester. Ich habe auch eine Affinität zur deutschen Sprache. Nach 3 Jahren erhielt mein Vater endlich eine Professur in Hessen. Er hat dort unterrichtet, und an Wochenenden kam er nach München. Umgezogen sind wir erst viel später nach Frankfurt, da war ich schon 13. Es war auch ein Versuch, die Ehe zu retten, aber nach 3-4 Jahren ging es nicht mehr. Bald zog ich dann aus. Als ich Abitur machte, lebte ich schon in einer eigenen Wohnung. Meine ältere Schwester ist früher weggegangen. Sie kam nicht mehr nach Frankfurt mit, weil sie ein sehr schlechtes Verhältnis zu meinem Vater hatte. Mein Vater ist ein sehr ungeduldiger Mensch. Eigentlich war er zu früh damit konfrontiert, ein Kind zu haben. Er ist verträumt. Die Kinder haben ihn dabei gestört, seine eigenen Sachen zu machen. Seit wir groß sind, liebt er uns heiß und innig. Wir erwidern das natürlich nicht in dem Masse, wie er das möchte, weil wir uns ganz genau an die langen Jahre erinnern, als er nicht sehr nett zu uns war. Er hatte sein Arbeitszimmer, und wenn er kam, hat er sich dahin zurückgezogen. Es war bei uns alles sehr ritualisiert. Das hatte mein Vater wahrscheinlich von seiner Mutter. Wir aßen Abendbrot, und dabei mussten wir erzählen, was in der Schule passiert ist. Wir lehnten uns aber auf, weil wir nicht einsahen, dass er genau abends um 7 etwas von uns hören wollte. Vielleicht hätten wir ihm gern etwas früher oder später erzählt. Also haben wir, als wir dazu aufgefordert wurden, geschwiegen. Heute habe ich auch einen Sohn und denke, dass drei Kinder wirklich Macht haben können. Als Kind spürt man nur die Macht der Erwachsenen, aber heute glaube ich schon, dass wir drei eine Front gegen meinen Vater bildeten. Wahrscheinlich schützte er sich über seine autoritäre Art auch vor uns. Trotz dieser Spannung hat er uns aber auch etwas gegeben. Die Reisen mit ihm waren zum Beispiel wunderschön. In Griechenland hat er uns alles erklärt, er wusste alles über Geschichte und Kunst. Aber man macht einmal im Jahr Ferien, und das konnte kein Gegengewicht zum Rest des Jahres bilden. Mein Vater verkörperte das Intellektuelle für mich, deshalb habe ich mich an ihm orientiert. Meine Mutter denkt assoziativ, sie ist sehr inspirierend. Sie ist überhaupt nicht ritualisiert, eher chaotisch. Das Verhältnis zu meiner Mutter ist aber mehr gespannt. Auf ihre Art hat sie sehr viel Druck ausgeübt. Sie war Lehrerin und entwickelte sehr früh eine große Leidenschaft für das Theater. Sie spielte mit ihren Schülern sehr viel Theater und hatte auch viel Erfolg. Zur Kunst hatte sie eine sehr starke Affinität, und ich glaube, ich war für sie immer ein Außenseiter: jemand, der keine künstlerische Veranlagung hat und dadurch ihrer Vorstellung nicht entspricht. Sie merkte sehr früh, dass ich andere Interessen herausbilde. Meine ältere Schwester wurde Schauspielerin, obwohl ich denke, dass es gar nicht ihre Berufung war. Sie war eine schlechte Schülerin. Mit ihren schwarzen Haaren, dicken schwarzen Augenbrauen sah sie sehr exotisch aus und hatte es, besonders in Bayern, nicht leicht. Es hieß immer, sie wäre türkisch. Bis heute passiert ihr auf der Straße, dass ihr gesagt wird: „Du nix verstehen?” Sie lebt jetzt in München. Sehr früh hat sie schon geheiratet, auch einen Schauspieler, der schnell Erfolg hatte. So wurde sie Mutter und Hausfrau. Meine jüngere Schwester ist auch Schauspielerin. Sie reist sehr viel. Ihren festen Wohnsitz hat sie in Berlin. Meine Mutter hat uns von ihrer Kindheit erzählt. Sie hat nicht geweint - sie weint fast nie -, aber man konnte ihr schon anmerken, dass sie sehr bewegt war. Als wir gemeinsam nach Belgien reisten, erzählte sie mir auch Dinge, über die sie früher nicht sprach. Als wir noch in Kanada waren und nicht viel Geld besaßen, hatte mein Vater von einem Anwalt in New York gehört, der dem belgischen Staat gegenüber eine Sammelklage vorbereitete, um Wiedergutmachung zu fordern. Mein Vater führte eine Korrespondenz mit diesem Anwalt. Meine Mutter wollte das nicht. Auch heute will sie keine Forderung erheben, denn sie ist der Meinung, dass man Tod und Verlust nicht wiedergutmachen kann. Damals aber brauchten sie Geld, sie wollten ein kleines Haus bauen. Sie haben dann den Gegenwert von Schmuck und anderem Habe, der den Eltern in Belgien weggenommen worden ist, bekommen. Nachdem wir von Kanada nach München zogen, hatte mein Vater versucht, ein Haus zu kaufen und lieh sich bei den adeligen Verwandten Geld. Einmal kam der Postbote und übergab einen Brief von dieser Familie. Darin stand, dass sie diese Summe von 40 000 Mark meiner Mutter schenken würden. Sie mochten meine Mutter. Das Geschenk war ganz eindeutig eine Geste der Wiedergutmachung. Meine Mutter sagte immer, die Deutschen wären nett zu ihr gewesen. Wir waren sehr arm, manchmal hatten wir kaum etwas zu essen. Ein Nachbar war Vertreter einer Eisfirma, er brachte uns abends öfter Eis. Das war dann unser Abendbrot. Wenn wir mal keine Versicherung hatten, behandelte uns der Hausarzt umsonst. Im Sommer wurden wir manchmal vom Roten Kreuz in Ferienlager geschickt. Als mein Vater das Haus in Kanada verkaufte, ging es uns besser. Außer diesen Menschen, die uns halfen, habe ich die Nachbarschaft als nicht sehr freundlich erlebt. Ich glaube aber, wir waren auffällig durch unseren Akzent, nicht als Juden. Wir sagten immer, wir kommen aus Kanada. Für uns war es so: unsere Mutter ist jüdisch, der Vater nichtjüdisch. Erst sehr spät erfuhr ich durch einen jüdischen Freund, der mir immer zum Vorwurf machte, dass ich nichts wüsste, dass wir Kinder nach jüdischem Gesetz auch jüdisch sind. Wir wussten nichts von Halacha, von den Traditionen. Schon sehr früh mochte ich nicht das Reden über das Jüdische. Auch nicht, wenn in der Familie so gesprochen wurde. Zuschreibungen, wie zum Beispiel „die Juden sind schlau”, oder wenn meine Mutter sagte: „Das ist das Jüdische, was ich bei ihm spüre”. Mir war das zu bedrohlich, weil man diese gefühlsmäßige Art, über Juden zu reden auch von Antisemiten kannte. Diese Sprechweise hörte ich schon in der Schule und dann ist mir bewusst geworden, dass ich zu ihnen gehörte. Ich fand es schade, dass meine Mutter nichts über Traditionen und Rituale wusste. Woher sollte sie auch? Das fehlende Wissen durch diese Bemerkungen zu ersetzen, glaube ich, war eine Art auszudrücken, dass sie sich zugehörig fühlte. Aber das war für mich zu wenig. Daher kam auch das Interesse an den Dokumenten, unter anderem an der Geburtsurkunde meiner Mutter. Immer wieder habe ich versucht, mir nachträglich das Wissen über das Judentum anzueignen. Ich holte Bücher aus der Stadtbücherei und probierte, auf diesem Wege mir die Tradition näher zu bringen. Aber das war für mich zu abstrakt, zu unlebendig. Auch jetzt gehe ich manchmal in die Synagoge, doch immer mit Freunden. Ich erlebe es sehr stark als eine Feierlichkeit, wo mir immer klar ist, ich bin Besucherin, nicht Teil dieser Feierlichkeit. Ich war in Israel, ich bildete mir ein, unbedingt Hebräisch lernen zu müssen. Damals war ich 27 Jahre alt und sass 8 Wochen lang in einem sehr harten Hebräischkurs mit pubertierenden jüdischen Amerikanerinnen. Der Wunsch, Hebräisch lesen und verstehen zu können, hing aber auch mit meiner Doktorarbeit zusammen. Ich habe angefangen, eine Doktorarbeit über die Figur des ewigen Juden zu schreiben. In der Bibliothek der Jüdischen Gemeinde gab es viele Zeitungen aus dem letzten Jahrhundert, auf hebräisch geschrieben. Eine hieß „Der ewige Jude”. Natürlich kannte ich diese Figur eher als ein judenfeindliches Stereotyp aus der Reformation und wunderte mich, warum jüdische Leute ihre Zeitung so nennen. Diese Quellen wollte ich miteinbeziehen. Um sie lesen zu können, nahm ich mir vor, Hebräisch zu lernen. In der Jüdischen Gemeinde habe ich schon Kurse mitgemacht, danach kam ich nach Israel. Als ich von zu Hause ausgezogen war, hatte ich eine eher schwere Zeit. Ich wohnte mit einer sehr guten Freundin zusammen, sie hat Kunst studiert, ich Germanistik. Das gefiel mir aber nicht, ich dachte, ich müsste mich auch der Kunst zuwenden. Jetzt erst recht, wo es mir keiner zutraut, müsste ich zeigen, dass ich es auch kann. Nach zwei Jahren habe ich die Schauspielprüfung gemacht, aber das war reiner Ehrgeiz. Ich kam in die nächste Runde, aber dann ließ ich es fallen. Heute weiß ich, dass Schauspielen nie etwas für mich gewesen wäre. Ich kam nach Berlin, um Psychologie zu studieren. Nach zwei Jahren merkte ich, dass das Psychologisieren mich überhaupt nicht anspricht. Mich interessieren zwar Menschen, aber nicht auf die Art, wie damit an der Universität umgegangen wurde. Als ich hinkam, haben alle schon Therapie gemacht, und ich war etwas verunsichert: müsste ich das nun auch? Ich überlegte lange, ob ich Judaistik studieren soll. In Berlin habe ich zwei Seminare im Institut für Judaistik an der Freien Universität besucht, einfach um Wissen zu akkumulieren, das systematische Wissen, was mir fehlte. Aber ich hörte nur Fakten, und niemand war da, der mir lebendig Tradition hätte vermitteln können. Die führenden Persönlichkeiten an diesem Institut haben sich einer positivistischen Wissenschaft verschrieben, und das war mir zu abstrakt. So kam ich zurück zur Literatur, zur Komparatistik: zur allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft. Das habe ich dann gezielt studiert. In diesem Studium lernte ich einen Mann kennen - er ist der Vater von meinem Kind. Er ist auch Literaturwissenschaftler, und er hat mir eine Welt eröffnet. Durch ihn verstand ich, wie man Wissenschaft betreiben, wie man auf eine kreative Art schreiben kann. Es hat mir sehr viel bedeutet, Literatur im Original, in der Sprache zu lesen, in der sie entstanden ist. Eine Übersetzung bleibt für mich immer ein Behelf. Ich übersetze aus dem Englischen ins Deutsche, aber umgekehrt würde ich es mich nie trauen. Zu Hause haben wir mit meinem Vater deutsch gesprochen. Mit meiner Mutter weiterhin nur englisch. Als sie schon Deutsch konnte, sprach sie zu uns englisch, und wir antworteten auf deutsch. Komparatistik zog mich auch deshalb an, weil ich bis dahin Literatur immer auf eine Weise studiert habe, die sozialwissenschaftlich war, also auf Eckdaten, auf der Entstehung des Werkes aufbaute. In Berlin wird aber vergleichende Literaturwissenschaft mehr schon als Philosophie betrieben. In der Figur des Ahasver, des ewigen Juden, ging es mir darum, wie man eine stigmatisierte Figur auch anders, dialektisch darstellen kann. Mich hat interessiert, was man dazu verwenden muss, eine Figur ihrer antisemitischen Konnotation zu entkleiden. Darüber wurde bisher nichts geschrieben. Ich kannte die Antisemitika, die von dieser Figur handeln. Aber in der Romantik gab es Autoren, die schafften, diese Figur nicht antijüdisch darzustellen, obwohl sie aus einem eindeutig antijüdischen Kontext kommt. In der englischen Romantik hat sich die Lake School mit diesem Wanderer, mit seiner Gebrochenheit identifiziert, und die der Figur eigene Ewigkeit und Unendlichkeit betont. Vor einem Jahr habe ich darüber promoviert,. Die Figur des ewigen Juden war für mich auch deshalb wichtig, weil ich dadurch Möglichkeit hatte, mich ein bisschen jüdischen Studien zuzuwenden. Es ist für mich sehr wichtig, meine Wurzeln zu kennen. Ich bin sehr unsicher, wie ich damit umgehe, auch in der Öffentlichkeit. Um sagen zu können, ich bin Jüdin, denke ich immer, müsste ich jüdischer sein, als ich es bin. Mehr darüber wissen, mehr in einer bestimmten Tradition verankert sein. Mit dem Vater meines Kindes - ich lebe nicht mehr mit ihm zusammen - war es immer sehr schwierig. Es hat ihn zwar interessiert, dass ich jüdisch bin, aber das war gleichzeitig die Quelle eines großen Konfliktes zwischen uns. Er kennt einige Leute, von denen er weiß, dass sie jüdisch sind und findet, dass sie damit hausieren. Diese Vorgangsweise nervt ihn. Er ist der Meinung, dass über Israel, verglichen damit wie klein das Land ist, viel zu viel geredet wird. Auf solche Sätze habe ich sehr stark reagiert. Es gab dann ein weiteres Problem, dass ich unseren Jungen Moritz, dem ich nach meinem Großvater als zweiten Namen Abraham gab, beschneiden lassen wollte. Erst einmal aus medizinischem Grund. Außerdem hatte ich auch das Gefühl, dass ich ihm damit auch etwas mitgeben möchte. Diesen Wunsch hatte ich nur thematisiert, aber der Vater meines Sohnes reagierte sehr heftig darauf und lehnte es von Grund auf ab. Ich war mir auch nicht sicher, ansonsten hätte ich es machen lassen. Es bedrückte mich sehr, dass er so schlecht mit dem jüdischen Thema umging, auch mit meiner Mutter. Zwar sagte er, seine Zurückhaltung hätte nur persönliche Gründe, aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie ihm sehr fremd war, etwas an ihr künstlich fand. Er meinte, meine Mutter wäre eine richtige jiddische Mame, die über ihre Kinder wacht. Heiraten wollte ich ihn nicht, weil wir wegen der anderen Lebensweisen, Lebensauffassungen auch viele Spannungen hatten. Ich bin sehr lebensfroh, er ist schwermütig. Wir haben es 6 Jahre probiert, aber es ging nicht. Ich habe nicht genug dafür getan, jüdisch zu sein. Aber ich denke immer noch, dass es nicht der richtige Weg ist, über Judentum Bücher zu lesen. Es ist nicht das Wissen, das man sich über Bücher aneignen kann. Mittlerweile glaube ich, vielleicht ist das das Jüdische an meiner Familie, dass wir so wenig über uns wissen, so wenig Daten haben und so wenig Verbundenheit. Es gibt sogar bei uns ein tiefes Misstrauen gegenüber jeder Form von Verbundenheit. Wir haben nämlich alle das Gefühl, dass wir schnell vereinnahmt werden. Das muss auch stark von meiner Mutter kommen, die lange Zeit die christliche Atmosphäre um sich hatte, dann in eine jüdische kam, und niemand fragte sie, ob sie zu ihnen gehören wollte. Es war Zwang. Deshalb hat sie großen Vorbehalt, ein Bekenntnis abzulegen, wir auch. Nicht wegen der Anforderungen, die man uns gegenüber stellen würde, sondern weil man dann alles hundertprozentig mögen müsste. Alles, was mit dem Jüdischen zusammenhängt. Das war auch der Grund dafür, dass wir nie in der Jüdischen Gemeinde waren. Schon von weitem habe ich so viel gesehen, was mich dort stören würde. Wie man zum Beispiel mit jüdischen Leuten aus dem Osten umgeht. Diese Arroganz, diese Maßregelung gefällt mir überhaupt nicht. Ich wollte nicht dazugehören, nicht bereit sein, alles mittragen zu müssen, auch was dort an Politik gemacht wird, zum Beispiel Israel gegenüber. Wenn Einem Gemeinschaften aufgezwungen werden, in dem man Unterschiede nivelliert, halte ich für unannehmbar. Ich stehe zu den Unterschieden von Mensch zu Mensch. Meiner Meinung nach kann ein Nichtjude von einem Juden befremdet sein, deswegen muss er ja kein Antisemit sein. Aber anstatt sich damit auseinanderzusetzen, kommt schnell der Vorwurf des Netzbeschmutzers. Gegenüber Bekenntnisse zu Gemeinschaften habe ich Misstrauen. Meine Heimat sind die Menschen, die ich mir suche, die mit mir mitgehen und mit denen ich mitgehe. Manchmal, wenn ich in Beziehungen sehr unglücklich war, hatte ich das Gefühl, vielleicht wäre es mit einem jüdischen Mann anders, aber in dem Moment wusste ich schon, dass es für mich, so wie ich bin und lebe, Unsinn ist. Ich hatte auch mehr Beziehungen zu nichtjüdischen, als zu jüdischen Männern. Bei letzteren bekam ich immer die Vorwürfe, wieso ich mich nicht mehr um meine Herkunft kümmern würde. Diese Männer kamen aber aus Elternhäusern, die zwar unter schwierigen Umständen überlebt hatten, aber intakter waren, als meine Familie. Für sie war es nicht so widersprüchlich wie für meine Eltern. Mein Vater, ein Kind von Nazieltern, der seinen Vater früh verlor und keine richtige Orientierung hatte. Und meine Mutter, die zwei Welten erlebte. Mich nur jüdisch zu fühlen, war ich auch nie bereit. Der anderen Seite der Familie war ich mir immer bewusst. Ich habe mich sehr dafür interessiert, wie meine Eltern mit diesen Fragen umgehen, was sie problematisieren Wenn jemand von mir als einer Deutschen spricht, interveniere ich zwar nie, aber innerlich fühle ich eine angenehme Distanz zum Deutschsein. Der Abstand ist deshalb kompliziert, weil ich in Deutschland lebe. Obwohl ich mich auch anders hätte entscheiden können, habe ich Berlin als meinen Wohnort gewählt. Ich habe einen deutschen Pass, aber auch einen kanadischen. Ich fühle mich nicht so sehr deutsch, aber ich lebe in Deutschland. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass ich mich aus vielen verschiedenen Zeiten, in denen ich lebte, zusammensetze. Aus Zeiten und Erinnerungen, und Orten, wo sowohl ich als auch meine Familie gelebt haben. Antwerpen wirkt zum Beispiel in uns allen sehr stark weiter. Wir sind oft dort. Meiner Mutter höre ich bis heute an, dass sie flämisch gesprochen hat. Sie hat einen deutlichen Akzent. Die Zeit, die ich in meinem Leben in Deutschland verbrachte, ist die längste. Ich bin jetzt 34, und ich habe nur die ersten fünf Jahre woanders gelebt. Aber ich spüre sehr deutlich, dass es einer Entscheidung meiner Eltern bedurfte, speziell nach Deutschland zu kommen. Besonders für meine Mutter durfte es kein alltäglicher Entschluss gewesen sein. Im nachhinein kann ich auch nicht verstehen, wieso sie damals gar keine Probleme damit hatte, nach Deutschland zu gehen. Mit 18 Jahren habe ich mir überlegt: „Will ich denn hier sein?” Diese Frage stellte ich mir immer wieder. Das war zu jener Zeit, wo ich mich so unwohl fühlte, weil in der Presse so feindselig über Asylanten gesprochen wurde. Mich haben die Metapher, die man im Zusammenhang mit Ausländern verwendet hatte, wie „Asylantenflut” und „-Strom” sehr gestört. Und dann sind die Asylantenheime in Brand gesteckt worden. Aber vielleicht fragen sich auch andere Deutsche, ob sie ihr Leben hier verbringen möchten. Ich weiß von meinen Freunden, das ihnen dieses Land mit seinen Ausgeburten manchmal auch fürchterlich vorkommt Wenn Juden- und Ausländerfeindlichkeit deutlich spürbar werden, denke ich komischerweise nicht an mich. Ich habe nie das Gefühl, dass ich mich schützen müsste, sondern dass ich für andere einspringen muss. Dieses Gefühl habe ich stärker für ausländische Menschen als für jüdische. Das Bekenntnis, deutsch zu sein, brauche ich nicht. Ich brauche überhaupt keine Zugehörigkeit. An das schwere Erbe der deutschen Vergangenheit fühle ich mich nicht gebunden. Ich halte nichts von der Rede über Mentalität, wie zum Beispiel: „Die Deutschen waren schon immer...” Genauso wenig würde ich so etwas über Amerikaner sagen. Selbstverständlich gibt es bestimmte Ausprägungen, und die sehe ich auch für Deutschland, aber ich würde ungern von der Mentalität von Menschen sprechen. Es gibt Traditionen, auch Ausprägungen und Affinitäten. Und es ist auch klar, dass es in Deutschland eine lange Geschichte der Judenfeindschaft gibt, das würde ich nicht leugnen. Aber ich akzeptiere nicht, dass es in die Psyche der Deutschen tief eingeritzt ist. Ich glaube schon, dass die ganz bestimmte Hass-Liebe, der Philo- und gleichzeitige Antisemitismus schon sehr deutsch ist: das permanente Hin- und Herschwanken, in Einem beide zu verkörpern, wie es bei meiner Oma der Fall war. Damals, als ich überlegte, ob ich bleiben sollte, spielte sicherlich eine große Rolle, dass ich diese Sprache sehr mochte und sie ungern wieder aufgegeben hätte. Ich hatte auch Angst, dass meine Entscheidung, anderswo hinzugehen, willkürlich gewesen wäre. Es liegt bei uns in der Familie, dass der Ort, wo man ist, nicht so sehr über das Leben entscheidet. Die Menschen sind wichtig, die einem an einem Ort begegnen, die man sich sucht. Die Freundschaften und die Feindschaften zählen. Sie stellen das Konstante, das eigentlich Wichtige dar, und nicht, wohin es einen verschlägt. Meinem Kind werde ich unbedingt erzählen, dass er jüdisch ist. Er ist jetzt 3 Jahre alt. Vielleicht gebe ich ihn in die jüdische Schule, eher weil ich dort eine sehr gute Lehrerin kenne. Ihm möchte ich die Chance geben, eine Tradition lebendiger zu erleben - das, was ich nicht tun konnte. Ich halte etwas von Behütetsein, das für mich nicht nachzuholen ist. Doch ich habe keine Sehnsucht danach. Aber für ihn stelle ich mir das schön vor. Seit 10 Jahren lese ich jetzt Erinnerungsliteratur. Neulich dachte ich, vielleicht tue ich das, um meine Großeltern darin wiederzufinden. Das Institut, wo ich eine Stelle habe, arbeitet mit einem Verlag zusammen, von dem Autobiographien von Holocaust-Überlebenden herausgegeben werden. Ich muss die Texte beurteilen. Als sich 1990 die Möglichkeit ergab, als Hilfskraft hierher zu kommen, habe ich sie sofort wahrgenommen. Ich wollte eine politische Arbeit machen, nicht nur akademisch studieren. Aber nach 10 Jahren kann ich nicht mehr. Diese Texte würgen mich. Die drei Bücher, die ich übersetzt habe, hatten auch dieses Thema. Ich halte mich für stark, und bisher hatte ich Mechanismen, um es abzuwehren, dass diese Geschichten zu nah an mich herangehen. Diese Überlebensberichte habe ich sehr stark unter dem Gesichtspunkt ihrer literarischen Qualität gelesen, und das ermöglichte mir auch, Distanz zu halten. Aber für mich hat sich sehr viel verändert, seitdem ich selber ein Kind habe. Ich bin viel empfindlicher geworden. Die Grenzen, die ich mir selbst errichtete, wurden durchlässig. Ich habe auch gemerkt, wie verletzlich das Leben ist. Das spüre ich besonders in letzter Zeit, auch durch Erlebnisse im Freundeskreis, die Begegnung mit dem Tod. Diese Sensibilität führt dazu, dass ich diese Texte kaum mehr als Texte begreife. Sie werden anschaulich. Innerhalb von 6 Jahren muss ich mich habilitieren. Ich würde gern etwas über Erinnerungsarchive schreiben. Das ist eine mehr wissenschaftsgeschichtliche Frage. Mich interessiert das Sammeln von Wissen, und wie aus Information Wissen wird. Ich möchte mir Archive und Bibliotheken anschauen und überlegen, wie man mit Vergangenheit, mit Erinnerung, mit Gegenständen aus der Vergangenheit, mit Texten umgeht. Es beschäftigt mich auch die Frage, wie das neue Jahrtausend diese Texte behandeln wird, denn es ist zu vermuten, dass sie ein Stück Literatur werden. Ich denke, mit der Erinnerung geht man in Deutschland verkrampft um. Eher so, als würde man sie am liebsten bannen. Als würde man vorziehen, dass jeder sich nur einmal erinnern muss und damit hat er schon seine Pflicht getan. Wenn es zum Beispiel zu einer Veröffentlichung kommt und man den Überlebenden einlädt, gibt es ein Forum, wo der Autor der Autobiographie liest. Es geschieht immer wieder, dass nachher Leute kommen, die das alles noch nie gehört haben und denen der Schock ins Gesicht geschrieben steht. Man merkt, irgendwas hat gegriffen. Aber das war es auch oft schon. Die Erinnerung ist immer noch nicht lebendig, man kann nicht sagen, dass es wichtiger Bestandteil der Gegenwart wäre. Für viele ist die Erinnerung eine moralische Pflicht, und daher kommt das Verkrampfte. Es ist für sie der Versuch der Abbitte, sie wollen sich bei den Zeitzeugen entschuldigen, und hoffen, dass die Entschuldigung angenommen wird. Ich glaube aber, dafür gibt es keine Entschuldigung. Man kann keinen davon freisprechen, egal, welcher Generation er angehört. Der Prozess des Erinnerns kann nur so vorangetrieben werden. Anstatt um Verzeihung zu bitten, sollte die junge Generation hellhörig sein. Nicht nur für das Jüdische. Ich möchte, dass es Bestandteil der Menschen wird, dass sie sich sensibilisieren, Unrecht mehr spüren. Ich glaube schon, dass die Anwesenheit der Juden stört, weil die Deutschen dadurch an die Vergangenheit erinnert werden. Die Deutschen stört, dass die Juden hier dauernd etwas zu beanstanden haben. Sie fragen dann, warum gehen die Juden nicht nach Israel, wenn sie hier alles unausstehlich finden? Es gibt schon eine große Irritation, und ich meine, es sind keine Entgleisungen, wenn sie sich ungeschlacht ausdrücken. Sie sind ja auch sehr vorsichtig, und wenn sie sich doch so artikulieren, merkt man schon, dass die Irritation sehr viel größer ist als die Selbsterkenntnis. Das trifft für mehrere Generationen zu. Die Erkenntnis ist nicht verschüttet, sie ist oft verstellt durch Vorsicht, durch zahlreiche Ängste. Mich stört der rhetorische Aufwand, mit dem Juden rechtfertigen, dass sie in Deutschland leben. Ich bin der Überzeugung, dass man mit der nötigen Vorsicht und Hellhörigkeit hier leben kann. Mir ist so viel Dummheit und Denkfaulheit anderswo begegnet, warum sollte ich in Frankreich oder in einem anderen Land besser leben? Die hochproblematische Vergangenheit, die die Deutschen haben, die nicht wegzureden und wegzudenken ist, und Tagesgespräch ist, bietet auch eine Form von Schutz, die man in anderen Ländern nicht hat. Für mich ist meine Mutter, die aufgeweckt und lebensfroh ist, der lebende Beweis dafür, dann man trotz der Vergangenheit intakt bleiben und in Deutschland leben kann. Dorit Schnapp „Ich fühle mich wohl hier, aber Deutschland ist nicht meine Heimat” Dorit Schnapp, geborene Freudenreich findet es nicht schlimm, dass sie keine Heimat hat. Die 42jährige beschreibt sich und ihre Familie als deutsche Juden, mit jüdischer Identität und Tradition. Sie lebt zwar seit 1968 in Deutschland, ein Zugehörigkeitsgefühl zu diesem Land hat sie aber nicht. Ihr Vater wollte bei ihr Hass gegenüber den Deutschen erwecken, aber als sie Israel fluchtartig verlassen mussten, brachte der Vater die Familie nach Deutschland. „Es ist noch nicht so weit, dass zwischen Deutschen und Juden eine Normalität hergestellt werden könnte”, sagt sie, und meint: „Es muss immer wieder befürchtet werden, dass die übertriebenen Bemühungen als Ausgleich für das schlechte Gewissen irgendwann zurückschlagen”. Als meine Mutter mich wieder zu sich nehmen wollte - und nach israelischem Gesetz hätte sie das auch tun können - beschloss mein Vater, Israel so schnell und unauffällig wie möglich zu verlassen. So sind wir im Dezember 1968 mit meiner Stiefmutter und meiner kleinen Halbschwester mit dem Schiff nach Italien gefahren und dann mit dem Zug nach München. Das war, glaube ich, meine schlimmste Zeit überhaupt. Wir haben ja alles stehen und liegen lassen, konnten uns von niemandem verabschieden. Mein Vater sagte: „Wir müssen gehen, damit du nicht zu deiner Mutter kommst.” Ich hatte Angst vor ihr. Er hat nie schlecht über meine Mutter gesprochen, aber sie war einfach nie da. Ich werde nie vergessen, als sie dann gekommen ist, um mich wiederzuhaben. Es klingelte, ich machte die Tür auf und ich dachte, du kennst doch diese Frau, sie sieht fast so aus, wie du. Gefragt habe ich nur: „Ima?” und sie sagte, ja. Für meinen Vater muss das der Weltuntergang gewesen sein. Meine Eltern haben sich in Israel kennen gelernt. Die Mutter kam mit ihrer Schwester in den 40-er Jahren als Volontär aus Frankreich nach Palästina. Ihre Eltern waren aus Marokko nach Frankreich eingewandert, wo sie mit ihren weiteren 12 Kindern auch blieben. Mein Großvater väterlicherseits war bis zuletzt ein deutscher Patriot. Er hat im ersten Weltkrieg gekämpft und die „Deutsch-jüdische Schlagende Verbindung”, eine Studentenvereinigung gegründet. Jüdische Studenten hatten einen Extraverein. Trotz seines Patriotismus muss aber der Großvater geahnt haben, was auf ihn und die Familie zukommt, denn er brachte seine Frau und die drei Kinder rechtzeitig nach Palästina. Ab 1936 haben sie dort gelebt, wobei der Großvater bis 1938 noch immer zwischen Palästina und Deutschland hinund hergependelte. Er war ein namhafter Rechtsanwalt in München. 1938 blieb dann auch er endgültig in Palästina. Viele haben das aus der Familie meines Vaters nicht geschafft: sie kamen um oder begingen Selbstmord. Meine Eltern haben 1957 geheiratet. Meine Mutter war erst 19 Jahre alt, als ich geboren wurde. Der Vater war auf Montage und ich war viel mit der Mutter allein. Sie hat mich sehr früh bekommen und dann wollte sie wieder das Leben genießen. Ich war kein umsorgtes Kind und dadurch ging die Ehe kaputt. Meine Eltern trennten sich als ich 3 Jahre alt war, und ich bin mit meinem Vater in einen Kibbuz in der Nähe von Haifa gezogen. Meine Mutter lebte weiter in Tel Aviv. Bei einer Scheidung bekommt auch in Israel - wenn nicht schwerstwiegende Gründe vorliegen -, grundsätzlich die Mutter das Kind. Mein Vater hat aber mit der Mutter eine mündliche Vereinbarung getroffen, dass er mich zu sich nimmt, sie mich aber besuchen kann, wann sie will, und auch einen monatlichen Unterhalt bekommt. All die Jahre hatte ich aber eigentlich gar keinen Kontakt zu meiner Mutter. Sie ist nur gekommen, wenn sie Geld brauchte. Mitgenommen für ein paar Stunden oder für das Wochenende hat sie mich nie. Aber es kam dann der Tag, als meine Mutter wahrscheinlich doch Sehnsucht nach mir hatte. Nachdem sie jahrelang schon nach mir suchte - wir lebten zwischendurch in Argentinien sagte ihr ein Verwandter, dass wir wieder in Israel sind und gab ihr auch unsere Adresse. So stand sie eines Tages vor der Tür. Da sie inzwischen wieder verheiratet war und auch einen Beruf nachweisen konnte, hat mein Vater Angst gehabt, dass ich wieder der Mutter zugesprochen werde. Das hätte er nicht ertragen. Deshalb kam es zu der Flucht. Nach Argentinien sind wir zuvor, 1964 deshalb ausgewandert, weil mein Vater außer Israel auch noch etwas anderes sehen und erleben wollte. Inzwischen hat er wieder geheiratet, meine Stiefmutter kam aus Argentinien. So lag es auf der Hand, dass wir in ihr Heimatland gingen. In Argentinien waren wir dreieinhalb Jahre lang. Dort lernte ich eine ganz andere Seite des jüdischen Lebens kennen und kam nur schwer zurecht damit. Die Familie meiner Stiefmutter war sehr wohlhabend und als Kibbutzmädchen hatte ich große Schwierigkeiten, mich an die neuen Lebensverhältnisse zu gewöhnen. Ich musste auch auf die jüdische Schule gehen und Jiddisch lernen. Wir jüdischen Kinder waren morgens auf einer jiddischen Schule und haben dort Jiddisch und Hebräisch gelernt. Nachmittags mussten sie zusätzlich auf eine staatliche Schule gehen. Die jiddische Schule war privat, die hat die jüdische Gemeinde in La Plata finanziert. Die erste Zeit bedeutete eine große Belastung für mich. Alles war neu: die Familie, die Sprachen, das Großstadtleben. Mein Vater hat dort in einer Baufirma der Familie gearbeitet. Die Stiefmutter war Hausfrau, später bekam sie ein eigenes Kind. Was den Wohlstand der Familie betraf, fühlte ich mich nicht als dazugehörig. Wenn wir mit meinem Vater unterwegs waren, bin ich immer zu den Armen gegangen und habe dort meine Kleider abgegeben. Ich spielte auch mit diesen Kindern, obwohl meine Stiefmutter sich darüber ärgerte. Sie sagte immer, das gehört sich nicht, dass ein Mädchen aus der Stadt mit den Indiokindern zusammen spielt. Das habe ich aber nie akzeptiert. 1968 gingen wir dann wieder nach Israel zurück, weil mein Vater sich in Argentinien nicht mehr wohl fühlte. Heute ist mir klar, er hatte dort nicht mehr die Sicherheit. Er war ein Mensch, der die Sicherheit brauchte, weil er sie selbst nie hatte. Aufgewachsen ist er in einem Kinderheim. 1941 starb zuerst seine Mutter an Krebs, dann sein Vater und die drei Kinder kamen in ein Kinderheim. Mein Vater war der Jüngste und er hat es sehr schwer gehabt, er war ein absolutes Mamakind. Er wurde in einem Heim untergebracht, wo nur deutsche Kinder waren. Das Heim wurde für jüdische Emigrantenkinder eingerichtet, die von den Eltern nach Palästina geschickt wurden. Mein Vater und seine Geschwister kamen aus einer sehr reichen Familie, waren sehr verwöhnt und plötzlich fanden sie sich in einem Kinderheim. Als junger Mann wollte mein Vater noch etwas anderes außer dem Kibbuz erleben, das war der Drang nach Südamerika. Ich denke, da hat er irgendwann mal festgestellt, dass er uns Kindern diese Sicherheit vielleicht nicht geben kann. In Argentinien errang das Militär immer mehr Macht und im Unterbewusstsein gab es immer Vorbehalte gegen die jüdische Bevölkerung. Auf den Straßen wurden massive Kontrollen durchgeführt. Wenn mehrere Leute in einem Auto sassen, wurden sie einfach angehalten, es wurde kontrolliert, und die Polizisten rissen die Insassen aus dem Wagen heraus. Diese Entwicklung war klar zu beobachten und es wurde immer gefährlicher für Menschen, die nicht dazugehörten. Ich denke, die Juden gehörten auch nicht dazu, denn es sind dann viele von unserer Verwandtschaft nach Israel ausgewandert. Mein Vater hat sicherlich auch den aufkommenden Antisemitismus wahrgenommen und das wollte er uns Kindern ersparen. Ich selbst habe das nicht gespürt. Aber die Polizei zerrte einmal meinen Onkel aus seiner Wohnung und nachdem man ihn misshandelte, wurde er ins Meer geworfen. Angler haben ihn gefunden, zum Glück lebte er noch. Mit seiner Familie siedelte er dann nach Israel um. Als wir wie gesagt Anfang 1968 wieder nach Israel zurückgingen, schien es beschlossene Sache zu sein, dass wir endgültig da bleiben. Meine Eltern wollten dort ein neues Leben beginnen. Meine Stiefmutter hat darunter gelitten, dass sie ihre Familie wieder zurücklassen musste. Aber aus Liebe zu meinem Vater ist sie mitgegangen. Ich hing sehr an Argentinien, ich habe meine Verwandten dort gern gehabt und ich war verwöhnt. Aber in der Nähe meines Vaters war mir eigentlich egal, wo ich mich aufhielt, wenn er da war, ging es mir immer gut. Bis heute habe ich eine sehr gute Beziehung zu ihm. In Israel waren wir eine Zeit lang in einem Kibbuz, der Neueinwanderer aufgenommen hat. Von dort aus zogen wir weiter nach Ashdod. Es war eine Großstadt, die neu aufgebaut wurde. Finanziell ging es uns gut, wir hatten noch Kapital, das wir aus Argentinien mitgebracht hatten. Aber als dann meine Mutter erschien, haben wir ihretwegen Israel verlassen. Wir fuhren nach München, weil die Großeltern von dort kamen. Außerdem lebte der Bruder meines Vaters dort. Er war mit 17 Jahren allein zurückgekehrt, und hat später jahrelang für die Süddeutsche Zeitung geschrieben. Aber die Hilfe, die mein Vater von seinem Bruder erhofft hatte, hat er nicht geleistet. Mein Vater fing an, bei Bayer zu arbeiten. 1969-70 suchte man mit vielen Anlockungen Gastarbeiter für Berlin. Mein Vater hat sich beworben und so kamen wir Anfang der 70-es Jahre nach Berlin. Die Deutschen stellte ich mir immer mit Lederhose und Dirndlkleid vor. Als Kind hatte ich ein Buch mit den Trachten der verschiedenen Länder und das fand ich immer sehr schön. Aber ich habe eigentlich nicht begriffen, dass mein Vater Deutscher ist. Das wurde mir erst relativ spät klar. Ich sprach mit ihm immer hebräisch und in Argentinien spanisch. Deutsch habe ich nur in Deutschland gelernt, mit großem Widerwillen. In Berlin sind wir nach Neukölln gezogen, wo es einen großen Anteil an Ausländern gab. Ich hatte es sehr schwer, ich fühlte mich sehr unwohl, obwohl ich nie die Erfahrung gemacht habe, als ausländisches Kind oder als Judenkind beschimpft zu werden. Man wusste auch nicht, wo wir herkamen. Mein Vater verbot es mir, zu sagen. Er hatte Angst, dass man mich beschimpfen könnte. In Deutschland meldete er uns als evangelisch an. Ich habe immer erzählt, ich bin in Argentinien geboren. Meine Geschwister erfuhren erst mit 14 Jahren, dass sie Juden sind. Die eine Schwester ist 11, die andere 13 Jahre jünger als ich. Wir lebten sehr tabuisiert, erzählten nichts über Israel. Wir hatten einen Weihnachtsbaum. In meinem Inneren wusste ich aber, ich bin Israeli, Jüdin. Ich wurde nie religiös erzogen, aber die hohen Feiertage haben wir in Israel natürlich gefeiert. Unsere Übersiedlung nach München war ein Bruch für die ganze Familie. Mein Vater hatte uns immer erzählt, dass seine Eltern in Auschwitz umgekommen waren. Aber das stimmte ja nicht. Sie sind eines natürlichen Todes gestorben. Er erzählte uns das, weil er uns Hass den Deutschen gegenüber erwecken wollte. Und trotzdem war sein einziger Fluchtweg Deutschland. Die Wahrheit über meine Großeltern habe ich erfahren, als ich 19 war. Mit meinem ersten selbstverdientem Geld hatte ich meinen Vater nach Israel eingeladen. Und da fragten mich Freunde, ob ich nicht das Grab meiner Großeltern besuchen wollte. Ich war verblüfft, aber sie versicherten, die Großeltern liegen auf dem Berg Karmel begraben. Da kam die ganz Geschichte heraus. Ich wusste gar nicht, wie ich mit meinem Vater darüber reden sollte. Mir war klar, wenn ich ihn darauf direkt anrede, geht er daran zugrunde, dass ich die Wahrheit erfahren hatte. Aber ich wusste auch nicht, wie ich das verarbeiten soll. Die Freundin meiner Tante hat mir dann erzählt, sie war sich dessen im klaren, dass mein Vater mich anlog. Sie sagte, dass mein Vater als Kind sehr gelitten hatte und er sich ein eigenes Scheinbild machte. Für den Tod seiner Eltern machte mein Vater die Deutschen verantwortlich, weil er dachte, wenn sie nicht nach Israel hätten auswandern müssen, wären die Eltern nicht gestorben. Als ich dann doch mit ihm darüber gesprochen habe, gab es einen bösen Streit. Er sagte, „Wenn du nicht sofort damit aufhörst, dann fahre ich nach Hause”. Er wollte einfach nicht darüber reden. Heute haben wir damit keine Probleme. Mein Vater hat sich in Deutschland nie wohl gefühlt. Israel kam aber für ihn nicht mehr in Frage, auch dann nicht, als ich schon volljährig war. Früher konnten wir ja nicht daran denken, zurückzugehen, denn wir wussten nicht, dass ein Jahr später, als wir Israel verlassen hatten, meine Mutter starb. Meine beiden Geschwister wurden zwar oft nach Israel geschickt, aber das Leben dort war sehr hart, und das wollte mein Vater uns nicht mehr zumuten. Finanziell ging es uns gut, wir gehörten zum Mittelstand. Israel wurde aber für ihn immer armseliger, die Kibbuzim waren seiner Meinung nach nur noch dem Geld hinterher. Wer hineinkommen wollte, musste viel Geld mit sich bringen. Er hatte früher zwei Anläufe gemacht, nach Australien auszuwandern. In den 70-er Jahren gab es eine große Auswanderungswelle nach Australien und wir haben uns zweimal darauf vorbereitet. Bei dem ersten Mal hatten wir sogar die Tickets. Aber dann machte mein Vater einen Rückzieher. Er dachte, das würde er nicht noch einmal schaffen, uns wieder in eine neue Welt zu bringen. Der zweite Anlauf wurde auch schnell gestoppt. Der Vater hatte einen Großonkel in Australien, der für uns die Bürgschaft übernommen hat. Er kam nach Berlin, um uns kennen zu lernen, aber die Stiefmutter fand ihn nicht sympathisch und sagte, sie würde niemals zu ihm, nach Australien gehen. Mein Vater ist ein labiler Mensch, obwohl ich ihn mir immer als sehr stark vorgestellt hatte. Erst später merkte ich, wie schwach er war und das ich für alles herhalten musste. Das Geld hat der Vater verdient, aber ansonsten machte ich alles andere, unter anderem den Behördenlauf. Er hatte die Zeit dafür nicht gehabt. Meine Stiefmutter lernte erst sehr spät Deutsch. Sie bekam 1973 noch meine jüngste Schwester und war auch sehr an das Kind gebunden. Sie fühlte sich hier nie wohl. Ich hatte keine gute Beziehung mehr zu ihr. Sie war eifersüchtig auf mich und sagte, mein Vater würde mich mehr lieben, als die beiden anderen Kinder. Es ist ein richtiger Hass daraus geworden. Mit 18 Jahren bin ich dann ausgezogen. In meiner Schulzeit war ich politisch sehr aktiv, ich war Schulsprecherin. Ich habe immer protestiert, wenn Ausländer beleidigt wurden, oder antisemitische Bemerkungen fielen. Wir hatten noch alte Lehrer, die die Naziideologie mit sich schleppten. Wir versuchten, zu erreichen, dass sie aus der Schule fliegen. Mein Schicksal gestaltete sich so, dass ich von einem Ort zum anderen gewandert bin. Ich habe nie mit einer Sprache und einer Schule angefangen und damit auch regulär aufgehört. Mein Wissen war wahrscheinlich hoch, aber es wurde nie ausgenutzt, weil es immer wieder blockiert wurde. In der Pubertät machte ich mir dann auch nicht mehr viel aus meinen Ambitionen. Wenn man von zu Hause nicht die Unterstützung bekommt, mehr zu wissen als andere, wird man Teil des normalen Trotts. Mein Vater hat einfach nicht die Zeit gehabt. Ich konnte nicht richtig Deutsch, ich konnte nicht fehlerfrei schreiben; den Nachhilfeunterricht kannte man damals noch nicht. Daher hat man mich von der Grundschule, Ende der 6. Klasse nicht auf eine Realschule, sondern auf eine Hauptschule geschickt. Nach der Beendigung der Hauptschule holte ich die mittlere Reife auf einer Berufsschule für Hauswirtschaftsleiterin nach. Da ich sehr sozial eingestellt bin, wollte ich Erzieherin werden. Es gab in Berlin nur zwei Schulen, die Aletteschule und das Oberlin-Seminar. Letzteres war aber evangelisch. Im Gegensatz zur Aletteschule hatte das Oberlin-Seminar einen sehr guten Ruf. Sie nahmen aber keine Juden auf. Der evangelische Religionsunterricht war dort obligatorisch. Auf der Hauptschule habe ich als Sprecherin einen sehr guten Kontakt gehabt zu Frau Suhr, der Frau von Otto Suhr, dem ehemaligen Bürgermeister von Berlin. Zum Ehrentag seines Todes musste ich mit ihr hingehen, um am Grab ihres Mannes Blumen niederzulegen. Dort sprach ich sie an und bat sie, mir zu helfen, damit ich auf das Seminar komme. Sie hat mit dem Direktor gesprochen und ich wurde aufgenommen. So habe ich meine Erzieherausbildung gemacht. Dann arbeitete ich an verschiedenen Stellen, im Jugendfreizeitheim, im Kinderheim und im jüdischen Kindergarten. Dadurch habe ich natürlich viele israelische Menschen kennen gelernt, auch Leute von der jüdischen Gemeinde. Ich bekam meine Wurzeln wieder. Eigentlich fing das aber schon früher an. Zu meinem Geburtsland, Israel habe ich immer gestanden. Etwa ab meinem 15. Lebensjahr sagte ich auch in der Schule, ich bin aus Israel. Bei mehreren jüdischen Familien arbeitete ich als Babysitter. Zu zwei zurückgekehrten Israelis hatte ich sehr guten Kontakt, sie waren wie große Brüder für mich. Gerade beendete ich das Seminar, als sich die Familie meiner Mutter aus Frankreich meldete. Sie wussten, dass ich in Deutschland lebe, sie suchten mich und schickten dann einen Bekannten zu mir, damit er mich zu Besuch nach Paris bringt. Ich bin hingefahren und wurde sehr herzlich aufgenommen. Es war sehr schön, meine Großeltern kennen zu lernen, damit hatte ich wieder eine große Familie gefunden. Ich fühlte mich ihnen sehr nah, auch wenn sie eine arabische Mentalität aus Marokko mitbrachten. Nach dieser einwöchigen Aufenthalt in Paris bin ich wieder nach Berlin zurückgekommen und ich wusste, ich möchte jetzt meine jüdischen Wurzeln intensiv verfolgen. Ich dachte immer, wenn ich eine Familie gründen werde, dann nur mit einem jüdischen Mann. Das Problem wollte ich nicht haben, dass mich mein Ehepartner vielleicht eines Tages im Streit als Jüdin beschimpft. Die Wurzeln des Judentums wollte ich für mich, für meine persönliche Zukunft zusammen behalten. Mit meinem Vater sprach ich nicht viel darüber. Aber er hatte mir immer gesagt: „Denk daran, du bist Jüdin und heirate nur einen jüdischen Mann.” Dazwischen sah es kurze Zeit so aus, als würde ich doch einen anderen Weg gehen. Ich habe mich in einen jungen Franzosen verliebt und dachte, ich gehe nach Frankreich. Aber daraus wurde nichts, das war eine kurze Verrücktheit von mir. Durch einen Bekannten habe ich dann 1980 meinen Mann kennen gelernt, der nach einer gescheiterten Ehe eine jüdische Frau suchte. Die erste Frau war Nichtjüdin, sie ist zwar übergetreten, aber die Ehe ging doch auseinander. Es hat nicht einmal ein Jahr gedauert und wir haben geheiratet. Die Eltern meines Mannes sind beide aus Auschwitz wiedergekommen. Der Schwiegervater war einer der ältesten Wiederkehrer mit Galinski und Nachama. Er war ein gebürtiger Berliner, ein Deutscher, der noch im ersten Weltkrieg kämpfte. Der Schwiegervater kannte die ganze Gemeinde in der Oranienburger Straße. Sein Vater und auch er selbst war der Schames der Oranienburger Synagoge. Mein Schwiegervater hat bis zum Abtransport noch alles gemacht, die Oberschule aufrechterhalten, damit die Kinder noch lernen konnten. Als er wiedergekommen ist, nahm er nicht am Schwarzgeschäft teil sondern ging wieder seiner Arbeit nach und versuchte, in das alltägliche Leben zurückzukehren. Mein Mann ist ein typischer deutscher Jude, der hier geboren wurde, hier gelernt, eine Karriere gemacht hat, aber sich nicht in den Vordergrund stellte. Jetzt ist er der Verwalter des Jüdischen Museums. Wir leben nicht zurückhaltend, sondern ein ganz normales Leben. Deutsche Juden, mit jüdischer Identität und Tradition. Als ich schon daran gedacht hatte, mir einen jüdischen Ehepartner zu suchen, wollte ich das nicht in Berlin tun. In der hiesigen jüdischen Gemeinde habe ich mich nie wohl gefühlt. Sie ist eine sehr arrogante, intolerante Gemeinde, die bekannt dafür ist, sehr zersplittert zu sein: es gibt nur arm und reich, dazwischen gar nichts. Und wenn man nicht zu den Reichen gehört, gehört man eigentlich nicht dazu. Es wurde immer gefragt, was bist du, was bringst du? Oder was bringen deine Eltern? Wenn du keinen Namen hattest, oder zu einem ganz bestimmten Milieu gehörtest, dann warst du nichts Besonderes. Das ist bis heute so geblieben. Es gibt einen Kreis, die gehören einfach zusammen und leiden an Größenwahn. Wenn du ein ganz normaler deutsch-jüdischer Bürger bist, und du dich nicht besonders profilieren willst, wirst du nicht aufgenommen. Aber ich möchte auch nicht zu ihnen gehören. Ich glaube, die wohlhabenden Juden bilden nicht die Mehrheit, aber sie sind stärker, und das fällt einfach auf. Es ist natürlich nicht gut, nach außen zu zeigen, damit zu prahlen, was man hat, aber ich denke, dass liegt in der Natur des Menschen. Meine zwei Söhne, die jetzt 17 und 15 Jahre alt sind, habe ich so erzogen, dass sie wussten, sie sind Juden. Von den nichtjüdischen Feiertagen hielt ich sie fern. Zu Weihnachten gab es keinen Weihnachtsbaum, aber ich erklärte ihnen auch den Grund dafür. Ich hatte nie große Schwierigkeiten, sie moserten nicht. Sie sind von klein auf mit Chanukka aufgewachsen und nicht mit Weihnachten, es gab bei uns auch keinen Nikolaus und keinen Osterhasen, es gab Pessach. Meine Kinder sind auf eine ganz normale staatliche Grundschule gegangen. Als für meinen älteren Sohn, David die Zeit der Oberschule kam, gab es schon die jüdische Oberschule in der Grossen Hamburger Straße. Wir haben überlegt, wir schicken ihn dahin, es ist eine kleine Schule, mit jüdischer Identität und Erziehung. Zusätzlich dazu, was er zu Hause bekommt, kann er in der Schule noch vieles dazulernen, auch über Geschichte und Religion. Ich war glücklich, dass endlich eine jüdische Oberschule existierte, die auch multikulturell war. Es wurden nicht nur jüdische Kinder aufgenommen. Aber die reichen Juden schicken ihre Kinder nicht nach Berlin Mitte, in die jüdische Oberschule im Osten. Sie schicken sie nach Grunewald, obwohl sie die Möglichkeit hätten, es den Kindern zu geben, dass wieder eine Generation zusammenkommt, die jüdische Jugend wieder eins wird. Das ist ihnen aber wahrscheinlich nicht niveauvoll genug. Wir zwingen unsere Kinder nicht, jedes Mal in die Synagoge mitzukommen. Die Kinder halten mit uns die höchsten Feiertage. Das ist es, was ich von David und Daniel erwarte, dass sie an den höchsten Feiertagen mit der Familie zusammenbleiben. Mein Mann hält Kaddisch für seinen Vater zu seinem Todestag. Aber bei und wird nichts überdimensioniert. Tradition heißt für mich, die Geschichte meines Glaubens weiterzugeben, was ich kann und weiß, an meine Kinder zu vermitteln. Ich finde es wichtig, eine gewisse gesunde Tradition aufrechtzuerhalten - nicht orthodox, nicht zu liberal oder zu reformiert. Zum Beispiel halte ich nicht für selbstverständlich, dass eine Frau die Thorarolle trägt. Es hat schon seine Gründe, warum es Frauen über Jahrtausende nicht tun sollten. Wenn wir Seder machen und die Haggada lesen, lesen wir sie als Geschichte und versuchen, den Kindern zu vermitteln, dass es so war. Unsere Jungen sagen, es sind Märchen und glauben nicht daran. Ich aber glaube, dass es so geschah, wie es beschrieben wurde. Für mich heißt religiös nicht, dass ich mich ganz und gar danach richte, dass ich einen koscheren Haushalt führe, nach den religiösen Regeln und Gebräuchen lebe. In dem Sinne bin ich nicht religiös. Ich glaube an Gott, aber ich verwende den Glauben so, dass es zu meiner Lebensart passt. Meine Großeltern mütterlicherseits in Paris sind religiös. Sie haben eine milchige Küche, eine fleischige Küche und mein Großvater verbietet jedem das Rauchen am Sabbat. Er geht in die Synagoge am morgen, am Mittag und am Abend. Wenn wir in die Synagoge gehen, ist es immer ein Bedürfnis. Wenn ich beten will, wenn ich mich mit jemandem freuen möchte, oder mit jemandem verabrede, gehe ich hin. Ich gehe nicht jeden Freitag abend in die Synagoge, um gesehen zu werden. Freunde von uns machen uns Vorwürfe, dass wir nicht mit unseren Kindern regelmäßig die Synagoge besuchen, nicht immer am Sabbat dort sind. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man versucht, uns mit drohendem Finger zu bekehren. Den Gottesdienst mache ich innerlich nicht immer mit. Bei meinem Mann ist es ganz anders. Er ist viel tiefer in den Gedanken. Ich stelle immer wieder fest, dass er vor den höchsten Feiertagen sehr nervös ist. Bei ihm ist die volle Identifizierung damit eine absolute Notwendigkeit. Nach der Wiederkehr aus Auschwitz sind seine Eltern religiöser geworden, sie haben sich strenger an die Regeln gehalten: mein Schwiegervater hat nicht mehr geraucht am Sabbat, man durfte auch kein Schweinefleisch essen. An den höchsten Feiertagen sitzen die Kinder in der Synagoge immer bei meinem Mann. Sie wissen auch, wie sie sich zu benehmen haben wenn sie reinkommen: einen Tallit umzulegen und ihn zu küssen. Das ist alles vom Papa abgeguckt. Mein großer Junge glaubt aber nicht an Gott. Er meint, es gibt so viel Schlimmes auf der Welt - die Kinder verhungern in Afrika, es werden Kriege geführt, die Menschen bringen sich gegenseitig um - es kann keinen Gott geben. Ich denke aber, dass Gott uns noch auf Probe setzt. Genauso, wie damals auch der Holocaust eine gewisse Probe war, weil die Juden sich assimiliert und sich immer weiter von sich entfernt hatten. Wenn ich mir diese Erklärung gebe, kann man möglicherweise das Schreckliche, was geschehen ist, mehr verkraften. Bevor ich nicht selber Mutter wurde, fühlte ich mich von der Shoah nicht so stark betroffen, weil ich keine unmittelbaren Angehörigen hatte, die umgekommen waren. Aber durch die Kinder habe ich mehr Verantwortung und wenn ich jetzt denke, das wäre mir alles passiert, weiß ich nicht, wie ich das ausgehalten hätte. Aber es fällt mir heute noch schwer, einen Film über die Nazizeit anzusehen. Mein Mann ist damit großgeworden, er kennt nichts anderes. Er ist eigentlich ein Auschwitzkind. Wir, die nicht verfolgt worden sind, sehen das als eine dramatische Geschichte. Aber man kann es nicht damit vergleichen, wie wenn jemand von morgens bis abends darüber hört, wo und wann die Leute abtransportiert worden sind. Die besondere Sensibilität dafür musste ich mir schon selber erarbeiten, in dem ich meinen Weg fand zu dem jüdischen Mann, und eine jüdische Familie aufbaute. Mit dem Holocaust intensiver konfrontiert wurde ich erst dadurch, dass ich meinen Mann kennen lernte. Ich wurde auch wissbegieriger, ich wollte alle Einzelheiten wissen. Aber das möchte ich meinen Kindern nicht zu sehr zumuten. Wenn sie wollen, können sie fragen. Sie sehen ja bei der Oma, dass sie eine Nummer am Arm trägt. Wir leben hier und ich möchte nicht, dass meine Kinder eine tiefe Abneigung gegenüber dem deutschen Volk haben. Sie haben schon Distanz, da bin ich mir sicher. Sie sind sehr hellhörig, wenn bestimmte Sprüche losgelassen werden. Der Kleinere ist immer noch im Fußballverein. Da wussten mittlerweile alle, dass David und Daniel Juden sind. Nach dem Training waren sie duschen und da hat einmal einer gesagt, es ist hier wie in der Gaskammer. Das hat mir Dani, der Kleinere erzählt. Ich habe den Trainer angerufen, die Schule dieses Kindes und fragte, was denn da los sei. Hat man vielleicht versäumt, etwas im Unterricht zu vermitteln? Die Mutter rief ich auch an. Die Krönung der Geschichte war, dass die Großmutter dieses Jungen Jüdin ist, hat es aber dem Kind nie erzählt. Der Junge entschuldigte sich dann tausendmal. Als meine Kinder älter wurden, kamen solche Sprüche in ihrer Gruppe wie: „du Nazisau”, „du Judensau” vor. Als sie mir das erzählt hatten, sagte ich immer: „So wird in unserer Familie nicht gesprochen”. Meine Kinder habe ich immer dazu erzogen, die Minderheiten zu tolerieren. Wenn sie nach Hause kamen, sauer waren, und einen dieser schlimmen Sprüche aufgenommen hatten, sagte ich, wir hätten schon darunter zu leiden, dass wir Ausländer und Juden sind. Ich möchte nicht, dass irgendeiner sie beleidigt. Aber sie dürften es anderen auch nicht antun. Meiner Meinung nach reicht es nicht aus, das Judentum politisch und kulturell weiterzutragen. Auch das religiöse Erbe ist wichtig, weil das Religiöse uns als Jude erhält. Kultur und Politik haben sich aber immer verändert. Das kulturelle Erbe kann irgendwann nur noch der Vergangenheit angehören. Wenn die Juden aber die Religion ganz ablehnen und ablegen, geht sie verloren. Und dann kommt die nächste Generation, die es nicht mehr mitbekam und nicht mehr die Wahl hat, was sie davon annehmen will. Wenn wir die osteuropäischen Juden nicht gehabt hätten, die das Judentum noch um die Jahrhundertwende in Deutschland wieder aufrüttelten, hätten sich die Juden völlig assimiliert. In den 20-er Jahren waren die Juden im hohen Maße assimiliert und sie hassten zum Beispiel die polnischen Juden. Heute gibt es immer noch Leute, die meinen, diese Unruhestifter waren daran schuld, dass es zum Holocaust kam; wenn sie sich nicht so abgesondert hätten, hätten die Nazis nichts gegen die Juden unternommen. Sie wollen es immer noch nicht wahrhaben, dass die Vernichtung sich gegen das Judentum richtete, und deren Auslöser weder die polnischen noch andere osteuropäischen Juden waren. Ich glaube auch, wenn zu den Zionisten, die in Palästina ein eigenes Land aufbauen wollten, nicht auch die Orthodoxen hinzugekommen wären, wäre Israel heute ein Land ohne Religion. Viele Israelis gehen heute gar nicht mehr in die Synagoge. An den hohen Feiertagen machen sie Picknick. Das kann sich Israel leisten, aber nicht die Juden in anderen Ländern. Man muss die Religion nicht engstirnig verfolgen, aber man muss sie weitervermitteln. Die Tradition zu halten, ist für mich kein Schutz, sondern es gehört zu meinem Leben. Meine Eltern leben überhaupt nicht religiös, oder nach der jüdischen Tradition. Aber manchmal bereut mein Vater schon, dass er die Tradition nicht weiter hielt, obwohl er aus einem frommen Haus kam. Auch wenn er heute in die Synagoge geht, legt er keinen Tallit um, weil er das als Kind machen musste. Es gehört sich nun mal, dass man am Sabbat einen Tallit umlegt, aber mein Vater würde das nie tun. Ich respektiere das, weil ich weiß, warum er das tut. Ein Außenstehender würde das vielleicht nicht tolerieren. Aber das sind Kleinigkeiten, kein Maßstab für die Religion. Man kann bei vielen Familien beobachten, wo die Eltern aus Auschwitz wiedergekommen sind und die Väter eine nichtjüdische Frau heirateten, dass sie ihren Kindern die Tradition nicht weitergeben konnten, weil sie es selber nicht lernten. Ich versuche etwas zu vermitteln, nicht streng, nicht autoritär - wenn die Kinder das aufnehmen, ist es gut. Wenn nicht, kann ich es nicht ändern. Wir sagen unseren Kindern immer, wir erziehen sie so, wie wir es für richtig halten, und was sie später daraus machen, liegt bei ihnen. David hat jetzt eine jüdische Freundin, das ist aber Zufall. Es ist für ihn nicht wichtig, aber ich denke, innerlich fühlt er sich wohler, weil er weiß, dass wir uns mehr freuen. Aber ich habe nie Druck auf ihn ausgeübt, dass er nur jüdische Mädchen mit nach Hause bringen darf. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn meine Kinder sich jüdische Ehepartner wählen würden, weil sie die Tradition und die Geschichte so mehr beibehalten könnten. Eigentlich kann ich gar nicht verstehen, dass meine Schwiegereltern nach Deutschland wiederkamen. Sie sagten aber, das war ihre Heimat, hier sind sie grossgeworden, das war ihre Muttersprache. Ich denke, wenn ich meinen Mann nicht kennengelernt hätte, wäre ich vielleicht gar nicht in Deutschland geblieben. Aber ich weiss, dass mein Mann der typische Deutsche ist, der hier geboren wurde und auch hier sterben wird. Er hat einmal gesagt, wenn hier was passiert, was Gott behüte, macht er als Letzter die Synagogentüren zu. Aber ich weiss, wenn es mal ganz dramatisch werden sollte, wenn wir gehen müssten, würde er nach Israel mitkommen. Für uns gibt es nur ein Land, wenn wir gehen müssten: Israel. Amerika und andere Länder haben einen so starken Einfluss auf Israel, dass man das Problem mit den Palästinenser schon längst hätte lösen können. Natürlich ist es schwer, weil der Hass auf beiden Seiten schon so groß ist, aber man merkt auch, dass eine Generation heranwächst, die sagt, wir wollen keine Kriege, keine Toten mehr. Vielleicht sollte endlich das Volk entscheiden, was passiert, und nicht die Politik. Um in Israel zu leben, muss man schon sehr patriotisch sein, mit dem Herzen für dieses Land sein. Wenn ich heute nach Israel gehen würde, was nicht passieren könnte, würde ich mich dort wieder wohl fühlen. Es wäre wieder ein neuer Anfang, aber ich bin ein Mensch, der sich einleben kann. Ich hätte keine Schwierigkeiten. Aber hingehören, das muss viel mehr bedeuten - unter anderem die Überzeugung, dass alles, was die Israelis machen, immer richtig ist. Das kann ich aber nicht sagen. Es ist schon korrekt, das dieses kleine Fleckchen Land verteidigt werden muss. In Israel fühle ich mich wohl, aber ich muss nicht dort leben. Natürlich ist es leichter, fast ausschliesslich mit Juden umgeben zu leben, aber das ist es nicht, was ich brauche. Dort zu leben, würde auch für mich die Angst bedeuten, dass ich vielleicht meine Kinder in den Krieg geben müsste und sie dort verlieren könnte. Deshalb bleibt man ja auch hier, damit man seine Kinder beschützt. Aber im Hintergrund haben wir immer den Gedanken, es gibt immer noch Israel, wenn was ist, gehen wir weg. Und das ist es vielleicht, was viele deutschen Juden noch so in Ruhe leben lässt. Ich fühle mich wohl hier, aber Deutschland ist nicht meine Heimat. Ich habe keine Heimat, aber das ist nicht schlimm. Wenn ich politische und soziale Meinungen vertrete, denke ich mit dem ersten Gedanken immer an das Judentum und dann an die Deutschen. Wenn es eine Konfliktsituation gibt, in der Juden gar nicht betroffen sind, ergreife ich trotzdem nicht für Deutschland, sondern für die andere Seite Partei. Wenn im Fernsehen Fußballweltmeisterschaft gezeigt wird und Deutschland gegen Italien spielt, und die Kinder für Deutschland sind, bin ich für Italien. Nicht um nur nicht an der Seite Deutschlands zu stehen, sondern ich empfinde kein Zugehörigkeitsgefühl zu diesem Land. Das müsste man bestimmt haben, um es den Deutschen Erfolgerlebnisse anderen Ländern gegenüber zu gönnen. Zwar empfinde ich keinen Hass den Deutschen gegenüber, aber ich habe nicht immer ein gutes Gefühl. Ich denke nämlich, dass die Geschichte hier nie richtig verarbeitet wurde und dass es immer noch Leute gibt, die eine gewisse Entschuldigung für das Geschehene finden. Wir haben auch nichtjüdische Freunde und ich weiß, mit welchen ich sehr offen sein kann, und mit welchen nicht. Die Geschichte wurde von der allgemeinen Schulbildung her, aber auch in bestimmten Familien nicht aufgearbeitet. Man kann ja sehen, was 10 Jahre nach der Wende wieder in Deutschland passiert, was für einen starken Rechtsextremismus wir wieder haben. Ich meine, dass kann nur entstehen, wenn man eine gewisse Aufklärung nicht richtig vollzogen hat und wenn das Volk und die Politik so etwas tolerieren. Rechtsextremismus gibt es natürlich überall, aber von Deutschlands Boden dürfte es nicht mehr kommen. Für mich kann es nicht angehen, dass eine Rechtsdemonstration durch das Brandenburger Tor zugelassen wird. Meinetwegen sollen sie demonstrieren, aber nicht auf diese Weise. Viele Deutsche sind, denke ich, latent antisemitisch. Ich muss feststellen, dass es für viele Wissenschaftler, die sich mit dem Judentum oder der Thematik des Holocaust beschäftigen, eine eigene Wiedergutmachung ist. Sie versuchen zu entschuldigen, was die Eltern oder Großeltern mit den Juden gemacht haben. In Zeiten, wo überall gespart wird - an der Deutschen Oper oder an den Universitäten -, werden viele Millionen Mark an das Jüdische Museum gegeben. Aber es wird wegen des schlechten Gewissens gemacht. Ist es aber das Richtige? Sollte das der Grund dafür sein? Wir wollen ein Haus aufbauen, um die deutsche jüdische Geschichte aufrechtzuerhalten. Denn dieses Museum besteht nicht nur aus der Geschichte des Holocaust, der wird nur ein ganz kleiner Teil. Es ist einfach jüdische Geschichte in Deutschland. Die existiert nicht mehr, und man versucht, sie in diesem Museum wiederherzustellen. Mein Mann ist zwar froh, dass er das Geld für das Museum bekommt, aber er ist der Meinung, man sollte dieses schlechte Gewissen, bzw. Gutmütigkeit nicht zu sehr ausnutzen, denn irgendwann schlägt es zurück. Der ganze Verzeihungswahn könnte einmal auch gefährlich werden. Man sieht das schon in der Diskussion um das Holocaust-Mahnmal. Ich bin der Meinung, wir brauchen kein Mahnmal, dieses 4 Fussballplätze grosse Mahnmal. Die Juden, die überlebt haben, brauchen es nicht und die, die tot sind, brauchen es erst recht nicht. Wem nützt ein Mahnmal, das durch Graffiti bemalt wird und wo Hunde ihre ... verrichten? Trotzdem wird dieses Mahnmal errichtet, aber es schürt nur Hass. Die Politiker sind immer noch nicht sensibel genug, diese Angelegenheit so in die Hand zu nehmen, dass es für beide Seiten beruhigend ist. Wenn jemand zum Beispiel sagt, es kann ja nicht sein, dass wir das ganze Geld ins Mahnmal stecken und dafür das Schulwesen zu leiden hat, mag er recht haben. Aber mit diesen Worten kann man das nicht formulieren. Deshalb kann ich mich nicht als deutsch empfinden. In Deutschland könnte ich es auch schaffen, nur unter Juden zu sein. Aber es ist nicht wichtig. Ich suche mir Freundschaften: ich mache mir einen jüdischen oder auch einen nichtjüdischen Kreis. Zu bestimmten Anlässen machen wir auch etwas gemeinsam. Wir haben zum Beispiel alle Feste, die Brit und die Bar-Mizwa unserer Jungen immer sehr familiär gefeiert und nicht in einem Hotel mit 1000 Gästen. Und wir luden auch nichtjüdische Menschen ein. Diese Leute kann ich zusammenbringen, weil sie die gleiche Sprache haben. Bei den nichtjüdischen Menschen bin ich mir allerdings dessen bewusst, wo bei ihnen die Grenzen liegen. Trotzdem weiß ich, wenn ich was sage, nehmen sie es auch an. Ich provoziere sie ständig. Aber über Sensibilitätsfragen könnte ich mit ihnen nicht reden. Ich bin der Meinung, dass man mit den Juden überhaupt nicht anders umgehen sollte, als mit anderen Menschen. Man soll die Juden weder in den Vordergrund, noch in den Hintergrund drängen. Die Überempfindlichkeit kann abgebaut werden, in dem man ganz normal lebt; in dem man sich nicht immer wieder sagt, darauf müssen wir Rücksicht nehmen. In Deutschland sind wir noch nicht so weit, dass diese Normalität wiederhergestellt werden könnte - 50 Jahre sind keine Zeit. Solange es noch Überlebende von beiden Seiten gibt, ist es sowieso sehr schwer. Und solange man gewisse Gefühle noch nicht richtig aussprechen kann, oder nicht auf die Art und Weise, wie man es gern wollte, können auch die Hemmungen nicht gelöst werden. Erica Fischer „Ich habe nie Zugehörigkeit erlebt” Zu sagen „Ich bin Jüdin” ist für Erica Fischer heute das Einzige, womit sie positive Gefühle verbindet. Sie hat die Entwurzelung ihrer Eltern weitergelebt. Das Bekenntnis zum Jüdischsein ist für die 57jährige Journalistin und Schriftstellerin ein Versuch, eine kleine Wurzel zu halten. Sie wurde in England geboren, aber den größten Teil ihres Lebens hat sie in Österreich verbracht. In Deutschland, wo sie seit 1988 lebt, fühlt sie sich immer noch als Ausländerin. Nachdem sie über Jahrzehnte politisch engagiert war, fehlt ihr diese Aktivität. Heute würde sie sich am liebsten gegen Rassismus einsetzen. Zur Zeit sucht sie noch nach Formen, wie sie das tun könnte. Das Jüdische hat für mich sehr lange keine Rolle gespielt. In den 60-er Jahren wurde viel über Imperialismus und Kolonialismus diskutiert, da setzte ich mich für die nationalen Befreiungsbewegungen in Afrika ein. Seit meiner Kinderzeit habe ich immer am 1. Mai demonstriert. Menschenrechte, Sozialismus, Gerechtigkeit - das waren meine Anliegen. Besonders haben mich Krieg und Frieden und Rassismus bewegt. Aber ich bezog das nie auf mich selbst und das Schicksal der Juden. Das änderte sich erst in den 80-er Jahren. Da meine Eltern nicht wussten, wie ihr Leben weitergehen würde, haben sie uns Kindern in England Namen gegeben, bei denen sie vermuteten, dass sie überall auf der Welt aussprechbar sind. Meinen Bruder nannten sie Peter, mich Erica. Als wir nach Österreich kamen, stellten sie fest, dass Erika, mit „k” ein sehr verbreiteter Naziname war. Deshalb ist es mir so wichtig, dass keiner meinen Namen mit „k” schreibt. Ich habe zwei Staatsbürgerschaften, die englische und die österreichische. Die englische Staatsbürgerschaft war mir immer sehr wichtig. Meisten bin ich auch mit dem englischen Pass gereist, weil ich mich in Österreich unglücklich fühlte und immer dachte, ich wäre ein glücklicherer Mensch geworden, wären meine Eltern in England geblieben. Dann müsste ich nicht so einsam sein, hätte Freundinnen, würde dazugehören. England war für mich immer so eine Art virtueller Heimat. Meine Einsamkeit habe ich nicht auf mein Wesen, sondern auf die Umstände zurückgeführt. Die Eltern waren eben sehr entwurzelt, die Mutter sowieso und der Vater hatte seine eigene Welt in der Arbeit. Aber auch er galt als entwurzelt, denn die Freunde, die sie vor dem Krieg hatten - Künstler, Kommunisten - blieben zum Teil in der Emigration, zum Teil wurden sie umgebracht und zum Teil sind sie nach dem Krieg gesellschaftlich aufgestiegen. Meine Eltern blieben auf der gleichen Stufe. Sie waren nicht ehrgeizig genug. Neue Freunde haben sie nach dem Krieg kaum gefunden. Wir Kinder waren Opfer dieser familiären Situation Ich wurde 1943 in England im Exil meiner Eltern geboren. Zuerst ging meine Mutter im Oktober 1938 mit Hilfe der Quäker von Wien nach England und bekam einen Job als Hausangestellte. Dann holte sie auch meinen Vater nach, der auch als Hausgestellter arbeitete. Meine Mutter ist Jüdin und kam in den späten 20-er Jahren von Warschau nach Wien, um an der Kunstgewerbeschule zu studieren. Sie ist 1911 geboren. In Wien hat sie meinen Vater kennen gelernt. Mein Vater wurde 1904 geboren. Meine Eltern waren beide links eingestellt, es war selbstverständlich, dass mein Vater mit meiner Mutter in die Emigration ging. Eigentlich hat sie sein Leben gerettet, denn mein Vater hätte den Krieg keinen Tag überlebt. Als ruhiger, sanfter Mensch war er völlig ungeeignet zum Kämpfen - und da er als Sozialdemokrat zu den politisch unzuverlässigen zählte, galt er als extrem gefährdet. Die Linken hat man ja sofort in die vorderste Front geschickt. Von London sind meine Eltern nach St. Albans, in eine Kleinstadt gezogen, weil meine Mutter Angst vor den Bombenangriffen auf London hatte. Sie war eine sehr nervöse Person und hat ihr Haar büschelweise verloren. Der Arzt riet ihnen, in eine ruhigere Stadt zu ziehen.1947 ist dort auch mein Bruder geboren. Mein Vater wurde als „enemy alien”, als feindlicher Fremder, 1941 nach Australien deportiert. Ein Jahr lang lebte er dort in einem Camp mitten in der Wildnis. Alle Männer wurden deportiert, obwohl die meisten Flüchtlinge Juden waren. Auf dem Schiff meines Vaters, der „Dunera”, befanden sich 2000 Männer, das andere Schiff wurde torpediert und ging unter. Die Australier wussten mit diesen Männern nichts anzufangen. Sie dachten, sie waren Nazis, merkten aber bald, dass das nicht stimmte. Mein Vater hat immer mit großem Vergnügen vom Camp gesprochen, wo die gesamte mitteleuropäische Intelligenz versammelt war. Es gab Vorträge, Konzerte, Kabarett. Humanitäre Organisationen brachten Instrumente ins Lager, es gab Jazz und ein Wiener Orchester, das Walzer spielte. Mein Vater hat dort als Buchhalter gearbeitet, das war seine Ausbildung.. Noch während des Krieges sind einige dieser deportierten Männer in die australische Armee eingetreten und dann auch im Land geblieben. Als die Deportation der Flüchtlinge in England ruchbar wurde, war das ein Skandal. Es kam zu einer Parlamentsdebatte, nach der sie freigelassen wurden und auch in die Armee konnten. Viele der Deportierten empfanden vor allem ihre Untätigkeit unerträglich. Unter ihnen gab es ja Atomphysiker, Chemiker und andere Wissenschaftler, die zum Krieg gegen Nazideutschland beitragen wollten. Mein Vater kam 1942 bei der ersten Gelegenheit zurück, wurde aber in England nochmals mehrere Monate auf der Isle of Man interniert. In der Zwischenzeit hatte meine Mutter Arbeit in einer Fabrik gefunden, in der Kriegsproduktion. Als mein Vater aus der Internierung entlassen wurde, bekam auch er dort Arbeit. Die Eltern der Mutter waren im Warschauer Ghetto und sind in Treblinka umgekommen. Meine Mutter hatte noch einen Halbbruder und eine Schwester. Die Schwester ist mit ihrem jüdischen Mann noch vor Ausbruch des Krieges nach Australien gegangen, der Bruder hat mit seiner Frau in Warschau überlebt. Er versteckte sich und seine jüdische Frau, die blond und blauäugig war, hat gearbeitet und für den Lebensunterhalt gesorgt. Nach dem Krieg sind sie auch nach Australien ausgewandert. Meine Mutter erfuhr erst nach dem Krieg, was mit ihren Eltern passiert ist, ihr Bruder hat es ihr geschrieben. Aber gedacht hat sie es sich schon. Ihre Mutter war im Sommer 1939, knapp vor Einmarsch der Deutschen in Polen, in London zu Besuch. Meine Eltern versuchten, sie zum Bleiben zu überreden, sie hätte dann versuchen können, ihren Mann nach England zu holen. Aber das war für sie alles unvorstellbar: der Mann in Warschau, der Sohn, die Schwiegertochter, die Wohnung, der Besitz... also ist sie zurückgefahren. Die Wiener Eltern meines Vaters waren Sozialdemokraten. Als mein Vater den Eltern sagte, dass er meine Mutter heiraten würde, hat sein Vater gefragt: „Aber wieso, das ist doch in Deutschland verboten?” Ein Angepasster auch er, meine Mutter hat ihm das nie verziehen. Meine Eltern sind 1948 nach Österreich zurückgekehrt. Meine Mutter wollte überhaupt nicht gehen, sie fühlte sehr glücklich in England, aber mein Vater war ein Wiener. Er hatte noch seinen Vater dort - die Mutter war schon gestorben - und zwei Brüder. Und die Brüder unterhielten immer eine sehr enge Beziehung zueinander. Mein Vater war eigentlich ein Intellektueller, ein Schreibtischmensch. Er hätte sicher eine andere Arbeit finden können als in einer Fabrik, er sprach ausgezeichnet englisch, aber er war nicht sehr unternehmenslustig. In Wien war er Beamter bei den Wiener Verkehrsbetrieben und konnte in seine alte Anstellung zurückkehren. Er hat das im voraus geklärt. Es war auch seine politische Überzeugung, er wollte am Aufbau eines neuen Österreichs mitwirken. Meine Mutter konnte sich aber sehr wohl an die Wiener Antisemiten erinnern. Sie hatte schlimme Erfahrungen gemacht, wie sich die Leute - auch Sozialdemokraten - von einem Tag auf den anderen gewandelt hatten. Der „Anschluss” war im März 1938, und sie hat das Land erst im Oktober verlassen. Da meine Mutter nicht nach Wien zurückgehen wollte, sprachen die Eltern wohl auch von Scheidung. Als das ältere Kind sollte ich mit dem Vater gehen, und meine Mutter hätte den Kleinen behalten. Aber dann ist sie doch mitgegangen. Sie war auch nicht besonders unternehmenslustig. Dieser Entschluss hat mein Leben und das meines Bruders wesentlich geprägt, weil meine Mutter in Wien sehr unglücklich war. Sie erzählte einmal einer Journalistin, dass sie im ersten Jahr mit niemandem sprach und eigentlich ihr ganzes Leben lang eine Aggression gegen ihr Umfeld gehabt hat. Sie hatte wenig Freunde. Die Ehe war nicht besonders gut, mein Vater hatte auch ein oder zwei Freundinnen. Zwar war meine Mutter ausgebildete Goldschmiedin, sie hat wunderschönen Schmuck gemacht, trotzdem blieb sie Hausfrau, und auch das bereitete ihr großen Kummer. Sie wünschte, dass wenigstens ich eine Madame Curie werden sollte, ich sollte Technik oder Chemie studieren und Frauenrechtlerin werden. Sie trat immer für die Freiheit der Abtreibung ein und war eine sehr energische Person. Aber auf der anderen Seite mutete sie sehr weiblich an, sehr passiv, hatte keine Kraft, etwas für sich selbst zu machen. Gearbeitet hat sie schon, sie machte Übersetzungen aus dem Polnischen, aber das geschah zu Hause, wo sie keinen Kontakt zu Menschen hatte. Sie war auch sehr abhängig von meinem Vater, weil ihr Deutsch nicht gut genug war. Ihre Rohübersetzungen wurden von meinem Vater korrigiert. Diese gemeinsame Arbeit hat beiden großen Spaß gemacht. Meine Mutter hatte nur jüdische Freunde. Mit der Familie meines Vaters kam sie nicht zurecht, obwohl die Brüder meines Vaters aufrechte Antifaschisten waren. Der eine Bruder ist als Wehrmachtsoldat in das Warschauer Ghetto gekommen und sprach noch mit meinen Großeltern, ob er nicht etwas für sie tun könnte. Der andere hat Silberpapier geschluckt, um sich einen kaputten Magen zu machen, damit er nicht in die Wehrmacht muss. Schon immer war meine Mutter eine schwierige Person und hielt Distanz zu ihrer Umgebung. Obwohl sie jüdische Freundinnen hatte, war sie so antijüdisch eingestellt, dass es schon an Antisemitismus grenzte. Sie verhielt sich militant antizionistisch. Israel war für sie das Letzte. So hat sie es in Polen von ihren Eltern gelernt. Sie kommt aus einer assimilierten, liberal bis sozialistisch orientierten Familie, die überzeugt war, dass die Juden sich in die polnische Gesellschaft integrieren müssten. Und obwohl meine Mutter ja sah, dass das nicht ging, übte das auf sie keinerlei Wirkung aus. Ich fand nie heraus, ob sie zu Hause irgendein Fest gefeiert haben, Chanukka oder Pessach. Aber sie hatten nur jüdische Freunde, sozialistische Intellektuelle, also waren sie in die polnische Gesellschaft nicht richtig integriert. Das war schon ein Widerspruch. Möglichst gut polnisch zu sprechen bildete die Garantie dafür, dass man sich gut integriert. Das Jiddische haben sie verachtet. Es ging so weit, dass sie den jiddisch sprechenden armen Juden eine Mitschuld am Antisemitismus gaben, weil sie sich absonderten und schlecht polnisch sprachen. Der Vater meiner Mutter betätigte sich im Bankgeschäft, ist aber gestorben, nachdem meine Mutter geboren wurde. Ihr Stiefvater arbeitete in der Textilbranche. Sie waren nicht reich, aber wohlhabend. Die Mutter meiner Mutter war eine sehr gebildete Frau, die mehrere Sprachen sprach, Deutsch, Russisch, Französisch, aber sie blieb Hausfrau. Zum Verhalten meiner Mutter kam noch hinzu, dass sie traumatisiert war von den Ereignissen und nicht wollte, dass wir Kinder darunter leiden. Deshalb hat sie uns alles verschwiegen. Das ich jüdisch bin, wusste ich natürlich, ich wusste ja, dass ich in England geboren bin und warum. Ich ging noch zur Grundschule, als ich eines Tages nach Hause kam und erzählte, dass eine meiner Klassenkameradinnen sagte: „Hitler war gar nicht so schlecht, denn er hat für Arbeitsplätze gesorgt.” Das hatte sie von ihrer Mutter gehört. Da bekam meine Mutter einen Wutausbruch, daran kann ich mich noch genau erinnern. Aber viel stärker als das Bewusstsein des jüdischen Hintergrunds, hatte ich das Bewusstsein, dass meine Eltern Sozialisten sind. Sie redeten auch viel darüber mit mir. In meiner Familie war auch Antiklerikalismus sehr stark ausgeprägt. Bei uns stand niemals in Frage, dass Religion „Opium für das Volk” sei. Ich ging nicht in den katholischen Religionsunterricht. Für mich verband sich das nie mit dem Jüdischen, sondern damit, dass meine Familie sozialistisch ist, also für Gerechtigkeit. Meine Mutter war vor dem Krieg Mitglied der Kommunistischen Partei. Mein Vater verhielt sich mehr moderat, er war Sozialdemokrat. Nach der Rückkehr wurde mein Vater Mitglied der SPÖ und wollte, dass meine Mutter auch eintritt, aber sie war dazu nicht bereit, weil sie immer mehr links stand. Als mein Vater, ohne sie zu fragen, sie doch eingeschrieben hat, gab es furchtbaren Krach. Das ließ sie sich doch nicht gefallen. In der Schule, die ich besuchte, war die Direktorin Sozialdemokratin. Obwohl wir ganz gute Lehrer hatten, war - rückblickend - unser Geographielehrer sicherlich ein Nazi, das habe ich schon bemerkt. Aber wenn ich jetzt darüber lese, was sich in den 50-er Jahren in Österreich abspielte, kann ich gar nicht fassen, dass ich nichts mitkriegte. Was ich weiß, ist, dass ich immer unglücklich war. Ich kann es nur im nachhinein interpretieren. Erstens gab es in den 50-er Jahren eine stickige Atmosphäre; es wurde alles unter dem Deckel gehalten. Es liefen ja überall die Nazis herum. Aber ich habe nur ein Gefühl von Dumpfheit und Verzweiflung in Erinnerung. Rebelliert habe ich auch, ich wollte nicht so werden wie meine Eltern, denn das fand ich ein schreckliches Leben: nur in der Familie zu bleiben, nur zu arbeiten. Diese geistige Enge hat mich sehr gestört. Das politische Engagement meiner Eltern stellte ich nie in Frage, aber das kam mehr in ihrer Haltung zum Ausdruck und nicht in der Praxis. Mein Vater war ein braver Beamter. Ich fühlte mich einsam. Die Eltern haben mich geistig gefördert, ich las sehr viel, aber in der Pubertät war ich sehr unglücklich. Alle anderen hatten schon Freunde, sie bildeten Cliquen und ich passte nirgendwo hinein - ich war unglaublich schüchtern. In einen Raum zu gehen, wo viele Leute waren, bedeutete für mich eine Qual. Ich hatte eine große Sehnsucht nach Engagement, aber es gab ja nichts, deshalb habe ich so sehr auf die Ostermarschbewegung gewartet, die aus England kam. 1962 gab es den ersten Ostermarsch in Wien gegen die Atombombe und da bin ich mitgegangen. Aber auch beim Ostermarsch war ich allein. Das wiederholte sich auch in der Studentenbewegung, ich ging zu Veranstaltungen, Demonstrationen, gegen den Vietnamkrieg, den Schah von Persien, aber ich habe mit niemandem gesprochen. Wenn ich zu einer Person reden musste, spürte ich kein Problem,. Aber ich hatte Schwierigkeiten in einer Gesellschaft, und es fiel mir sehr schwer, andere anzusprechen. 1965 gab es an der Universität antisemitische Umtriebe. An der Hochschule für Welthandel lehrte ein Professor, der in seinen Vorlesungen antisemitische Bemerkungen machte. Es ging um den Verfasser des österreichischen Grundgesetzes, der Kelsen hieß und Jude war. Gegen die rassistischen Äußerungen des Professors haben die Studenten demonstriert und das ist zu einer breiten Bewegung angewachsen. Bei einer Demonstration wurde ein alter Kommunist von einem Neonazi mit einer Kette erschlagen. Es gab einen riesigen Trauermarsch für ihn. An der Uni liefen die Rechten, Mitglieder des „Ringes freiheitlicher Studenten”, mit verbundenen Köpfen um und gaben vor, dass sie von den Kommunisten geschlagen wurden. Das hat mich sehr mitgenommen und ich bin für ein Jahr nach England geflüchtet. Als ich ging, sagte ich mir, ich komme nie wieder zurück. In England konnte ich aber nicht richtig Fuß fassen und bin dann zurückgekehrt. Ich habe mich beruhigt, außerdem musste ich auch noch mein Studium beenden. 1968 hatte ich dann meinen ersten ernsthaften Freund, mit dem ich auch zusammenlebte. Er war sehr engagiert und hat mich in den Friedensbewegung hineingezogen. Durch ihn bin ich mit Leuten in Kontakt gekommen, die sich mit der Frauenemanzipation beschäftigten und da habe ich die Schüchternheit verloren. In der Folge engagierte ich mich für verschiedene Gruppen: für die Frauen sowieso, für die Slowenen in Kärnten, gegen den Apartheid in Südafrika. Ich war mehrmals in Südafrika, schrieb Artikel und hielt Vorträge. In der Wiener Linken gab es viele Juden. Ich wusste es, aber es war nicht wichtig für mich. Im Herbst 1972 haben wir in Wien die autonome Frauenbewegung gegründet. Daran nahm ich sehr aktiv teil, ich war eine Führerin. Das betrachte ich als meine glücklichste Zeit. Die 70-er Jahre. Ich war eingebunden. Bei Demonstrationen hielt ich Reden und diskutierte auf Podien mit der Frauenministerin. Wir haben damals einen wesentlichen Beitrag zur Änderung der Behandlung der Frauenfrage geleistet. Völkerverständigung war für mich etwas ganz Wesentliches. Ich habe auch Sprachen studiert aus einer idealistischen Absicht heraus, weil ich völkerverbindend wirken wollte. Noch während meiner Schulzeit lernte ich Französisch und Italienisch. Dann studierte ich am Dolmetscherinstitut der Universität Wien. Damals konnte man nur eine Sprache wählen, also war es Englisch. Praktisch bin ich ja zweisprachig aufgewachsen. In England haben wir während des Krieges nicht deutsch gesprochen. Und nach der Rückkehr meiner Eltern nach Wien versuchten sie weiterhin, mit uns Kindern zu Hause englisch zu sprechen, ungefähr bis zu meinem 14. Lebensjahr. Außer Hauses haben wir deutsch gesprochen. England hatte in unserer Familie immer einen positiven Klang. Meine Mutter mochte Österreich nicht. Wenn wir in den 50-er Jahren in Urlaub gefahren sind, nach Jugoslawien und Italien, haben wir immer englisch gesprochen. Meine Eltern sagten uns, diese Länder hatten unter Deutschland gelitten und Deutsch sei eine Sprache, die die Menschen verletzen könnte. Eine solche Sensibilität habe ich hier in Deutschland noch nie angetroffen. Wenn ich nach England reise, ist es heute noch ein Gefühl von „nach Hause kommen”. Nach ganz langer Zeit bin ich vor zwei Jahren wieder nach London gefahren im Zusammenhang mit einem BBC Film, der über mein Buch „Aimée & Jaguar” gemacht wurde. Ich war die ganze Zeit so glücklich als ob ich schweben würde. Auch bei internationalen Konferenzen, wo ich als Dolmetscherin arbeitete, war ich immer mit den Engländern zusammen. Eigentlich wollte ich immer in England leben, aber es ist nie so gekommen. In den 70-er Jahren fühlte ich mich aber auch in Österreich zu Hause. Ich befand mich in der Opposition zur Gesellschaft, und als solche erlang ich auch Anerkennung. Die Feministinnen haben mir eine Geborgenheit gegeben. In den 80-er Jahren flaute die Frauenbewegung ab, weil unsere Analysen bereits in die Gesellschaft eingegangen waren. Es gab eine Frauenministerin und es gab Frauenhäuser. Über Gewalt gegen Frauen habe ich 1976 mit zwei anderen Frauen ein Buch geschrieben und kurz danach entstanden die ersten Frauenhäuser. Unsere Forderungen wurden von den Sozialdemokraten aufgegriffen und mich hat es dann nicht mehr so sehr interessiert. Durch die Frauenbewegung, durch die vielen Kontakte zu Journalisten, bin ich selber zum Journalismus gekommen. Den Journalismus habe ich immer als politische Aufgabe gesehen. In erster Linie arbeitete ich über Frauen. Es hat mir auch eine persönliche Befriedigung verschafft, weil ich durch das Mikrophon in der Hand Zugang zu Menschen fand. Was ich sonst nicht kann, konnte ich mit der Institution im Hintergrund. Die Neugierde auf andere Menschen ist für mich immer noch ein wesentlicher Antrieb zum Journalismus. Ich war immer freischaffend. Einer kurze Zeit war ich eingebunden in eine HörfunkRedaktion, die das „Magazin vom Brotverdiener” machte - ein Arbeitsweltmagazin. Da konnte ich mit Gewerkschaftern, mit Arbeiterinnen, mit ausländischen Arbeitsmigranten sprechen, zu denen ich als Normalbürgerin keinen Zugang gehabt hätte. Die Tatsache, dass ich durch die Frauenbewegung zu einer bekannten politischen Figur wurde, hat mir in der Karriere eher geschadet. Gern hätte ich eine Anstellung gehabt, aber als Feministin wurde ich nicht genommen, ich war nicht tragbar. Ich habe für die Grünen kandidiert, meine feministischen Inhalte wollte ich in eine institutionalisierte Partei einbringen. Aber es gab einen schlimmen Richtungsstreit zwischen Linken und Gemäßigten und ich war auf der Verliererseite. Unsere Fundiliste galt als sehr links und radikal. Eigentlich sollte ich ins Parlament, aber durch diesen Streit wurde nichts draus. Nachdem ich für die Grünen kandidierte, bemühte ich mich nochmals um eine Anstellung. Ich hätte sehr gern in der Auslandsredaktion des Österreichischen Rundfunks gearbeitet und bewarb mich. Die Stelle hat einer bekommen, der ebenfalls links war, aber eben kein Feminist noch dazu. So eine suspekte Person wie mich wollte man nicht haben. In diese Zeit fiel auch ein Interview, das ich nach meiner Rückkehr aus Mosambik dem ORF gab. Mein ehemaliger Freund war in Mosambik Entwicklungshelfer, ich hatte ihn besucht und auch darüber geschrieben. In dem Interview sagte ich, dass das Land so arm sei, dass eine Alphabetisierungskampagne wie in Kuba nicht möglich wäre. Aber im Österreichischen Rundfunk darf Kuba nicht als positives Beispiel dargestellt werden. Wenn man nicht in Institutionen eingebettet ist, kennt man die Regeln nicht. Eine Freundin hat das Interview gehört und zu mir gesagt: „Du bist verrückt, du bewirbst dich um einen Job beim ORF und dann sagst du solche Sachen!” Rückblickend kann ich sagen, dass meine besten Freundinnen immer Jüdinnen waren. Eine von ihnen hat genau die gleiche Familiengeschichte wie ich, nur ist sie in Frankreich geboren. Doch damals haben wir kaum darüber gesprochen. Ich kann mich aber erinnern, dass wir uns einmal zusammen mit ihrem Freund den Film „Das Boot ist voll” ansahen. Wir sind aus dem Kino rausgekommen und ihr Freund störte uns, weil er nicht wirklich begreifen konnte, was wir fühlten. Wir haben uns umarmt und weinten, wir spürten eine starke Verbundenheit, und dieser Mann hatte nichts damit zu tun. Er war ein Linker, aber eben nicht jüdisch, also hatte er eine ganz andere Geschichte. Aber die aktive Beschäftigung mit dem Jüdischen begann für mich erst in Deutschland. 1986 lernte ich meine große Liebe kennen, einen Österreicher mit faschistischer Familie. Ich habe ihn geheiratet und ging mit ihm 1988 nach Deutschland. Durch den Skandal um Waldheim kamen wieder antisemitische Töne hoch und wir wollten nicht weiter in Österreich leben. Meine Mutter, die mittlerweile schon ziemlich alt war, ist jeden Sonntag zu Diskussionen am Stephansplatz gegangen, die von der Anti-Waldheim Bewegung veranstaltet wurde, ich aber nahm kein einziges Mal daran teil. Obwohl ich gut diskutieren kann, hatte ich das Gefühl, über Antisemitismus nicht sprechen zu können. Ich wollte mich nicht damit konfrontieren, weil ich Angst hatte, dass es mich psychisch überfordern würde. So ergriff ich wieder die Flucht. Mein Mann war Komponist, politisch ein Linksradikaler. Ein charismatischer, aber - wie ich es von Anfang an wusste - äußerst problematischer Mensch. Aber mit ihm fühlte ich mich sehr glücklich. Nach der Heirat verbrachte ich einige Monate mit ihm in Frankreich, weil er dort mehrere Stipendien bekommen hatte. Er hat komponiert, ich habe Bücher übersetzt. Als die Stipendien abgelaufen waren, wollten wir endgültig weg aus Österreich. Wegen der Sprache kam eigentlich nur Deutschland in Frage. Englisch kann ich ja nicht schreiben. Im Grunde genommen war es mir auch egal, ich hatte nur den Wunsch, Österreich zu verlassen und mit meinem Mann zu leben. Andere Länder haben wir gar nicht erwogen. Für ihn wäre es egal gewesen, es war schon meinetwegen, dass wir Deutschland wählten. Seit 1975 habe ich für Kiepenheuer & Witsch gearbeitet. Mein erstes Buch „Gewalt gegen Frauen” ist dort erschienen. Auch meine späteren Bücher „Frauen um 40” und „Mannhaft Vernehmungen einer Feministin zum großen Unterschied” wurden von diesem Verlag herausgebracht. Das waren Sachbücher auf der Grundlage von Interviews mit autobiographischen Elementen. Ich vertrat immer die Meinung, dass Deutschland ein Land ist, das die Entnazifizierung wesentlich intensiver betrieb als Österreich und war auch der Überzeugung, dass Deutschland eine bürgerliche Öffentlichkeit hat und hier gewisse demokratische Grundprinzipien verankert sind. Wien dagegen ist ein Sumpf, wo alles mit allem verflochten ist. In Köln hatte ich es nicht leicht, weil ich in Österreich wer war und dort musste ich von Null anfangen. Ich arbeitete für den WDR, schrieb über Frauen und Ausländer und machte Kommentare für das „Kritische Tagebuch” des Senders. Außerdem übersetzte ich Bücher. Mein Mann war der schwierigere Fall, weil er mit seiner avantgardistischen Musik keine Chance hatte, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Außerdem überwarf er sich sofort mit allen. Dann kam „Aimée & Jaguar”. Diese Geschichte wurde Kiepenheuer & Witsch angeboten von einem Agenten dieser alten Frau, Lilly Wust, die ihre Geschichte veröffentlicht sehen wollte. Man fragte mich Ende 1990, ob ich das machen würde. Das war das Glück meines Lebens, dass ich ja sagte. Ich traf die Frau, recherchierte, dann habe ich das Buch geschrieben und es wurde ein großer Erfolg. Es erschien 1994, wurde in 13 Sprachen übersetzt und verfilmt und seither machen die Tantiemen den Großteil meines Einkommens aus. In der Zwischenzeit schrieb ich noch ein anderes Buch über ein Frauenprojekt in Bosnien, aber das war nur ein Verlust. Es hing sicherlich damit zusammen, dass die Leute vom Krieg schon genug hatten. 1988 war das Jahr, als sehr viel Aufarbeitung der Hitlerzeit gemacht wurde. Durch die Medien konnte ich mich diesen Fragen gar nicht entziehen. Da begann ich mich mit jüdischen Themen zu beschäftigen und dachte auch viel darüber nach, was mein Jüdischsein in meiner Biographie verursacht hat. Langsam begann ich, mich öffentlich als jüdische Autorin zu erklären. Ich bin dann zu einem Kongress jüdischer Feministinnen nach Jerusalem gefahren und habe darüber berichtet. Das war ein einschneidendes Erlebnis für mich. Auf diesem Kongress nahmen sehr unterschiedliche Frauen teil, die sich unter normalen Umständen eigentlich hätten zerfleischen müssen. Linksradikale Israelis, ganz bigotte orthodoxe Frauen, amerikanische Rabbinerinnen und völlig verklemmte deutsche und österreichische Jüdinnen. Dem Ganzen näherte ich mich mit dem Schutz und der Distanz des Mikrophons. Durch die Beschäftigung mit dem Thema als Journalistin wurde ich immer bewusster. 1994 ließ ich mich scheiden. Ich bin nach Berlin gezogen und habe gleich mit einer Therapie begonnen. Die Scheidung bedeutete die absolute Katastrophe in meinem Leben. Die Tragödie war, dass die Trennung mit dem Krieg in Bosnien zusammenhing. Wir waren beide sehr engagiert. In Wien habe ich im Herbst 1992 eine Podiumsdiskussion organisiert, zu der ich Frauen aus Kroatien und Serbien einlud. Viele Wiener nahmen Bosnier bei sich auf und da wollte mein Mann auch etwas unternehmen. Er hat eine Organisation aufgebaut, um bosnische Flüchtlinge nach Deutschland zu holen. Mit dieser Arbeit begann er Ende 1992 und danach war er immer mehr in Zagreb. In einem Film wurde der Begriff „Bosnian Syndrome” benutzt, und ich glaube, dass das auf ihn zutraf. Er konnte nur noch darüber reden, sich nur noch damit beschäftigen und war völlig außer Stande, mit mir zu sprechen. Die Diskrepanz schien umso größer, da wir vorher 6 Jahre lang in absoluter Symbiose lebten. Beide hatten wir wenige Freunde. Dass er plötzlich weg war, empfand ich schon als schlimm genug, und dann konnten wir auch nicht sprechen, wenn er vorübergehend zu Hause war. Ich wurde immer depressiver. Wir haben uns noch Fristen gegeben, trafen uns in Dubrovnik, in Wien, in Zagreb, aber wir konnten nicht mehr miteinander sprechen. Nach der Scheidung ging es mir aber noch viel schlechter. Seitdem bin ich in der Therapie und brauchte praktisch 6 Jahre, um wieder zu mir zu finden. Ich habe all die Jahre nachher immer versucht, ein Gespräch mit meinem Exmann zu führen, aber er hat sich geweigert. Da kam auch das Opfer-Täter Schema hoch: plötzlich sah ich ihn als Nazi. Zwar wusste ich, dass die Beschuldigung ungerecht war, aber ich fühlte mich als das Opfer, und er war der Nazi. Unsere Beziehung verstand ich auch so, dass er mich schützt, als Frau und als Jüdin. Das hat er mir auch zugesichert. Es war ausgesprochen, dass ich als Frau in der Gesellschaft der schwächere Part bin. Das Jüdische war nicht ausgesprochen, aber unsere unterschiedlichen Familiengeschichten waren immer da, das Gefühl, dass er als Sohn von Nazimitläufern etwas gut zu machen hatte. Als er überhaupt nicht bereit war, mich zu schützen, kam meine eigene Familiengeschichte hoch. Ich drohte, mich umzubringen, wenn er nicht mit mir spricht, und er hätte es in Kauf genommen, dessen bin ich mir sicher. Es haben sich vor mir zwei Frauen seinetwegen das Leben genommen. Das wusste ich, aber ich habe ihn geliebt. Er bindet die Menschen an sich, macht sie abhängig, aber wenn es ihm nicht mehr passt, geht er von einem Tag auf den anderen. Dass er mich so zerstören konnte, erkläre ich mir mit meiner jüdischen Familiengeschichte und mit meiner Beziehung zu meiner Mutter. Ich war so abhängig von Liebe, weil ich sie zu Hause nicht bekommen habe. Mein Mann hat mich mit diesem Übermaß an Liebe völlig vereinnahmt. Meine Mutter ist Anfang 1999 gestorben. Sie war eine sehr harte Person, die überhaupt nicht in der Lage war, Liebe zu geben. Sie musste ihre eigene Familiengeschichte unterdrücken. Über ihre Eltern hat sie sehr wenig gesprochen. Als ich wissen wollte, warum sie uns nichts an jüdischer Tradition vermittelt hat, war sie völlig hilflos. Sie fragte: „Was hätte ich euch denn vermitteln sollen? Zionistin bin ich nicht, religiös bin ich nicht, ich glaube nicht an das Judentum als Nation.” Sie war eine extrem dominante Mutter. Mich zog sie immer schön an, sie nähte mir wunderschöne Kleider, aber sie hat mir nicht die Liebe, die Zärtlichkeit gegeben, die ein Kind braucht, um eine stabile Identität zu entwickeln. Wir haben uns nie berührt, nie umarmt, oder geküsst, nicht einmal Hände geschüttelt, als gäbe es eine Wand zwischen uns. Ich wurde geprägt von dem, was ich gelernt hatte. Später war es mir ekelhaft, meine Mutter zu berühren, ich konnte auch meinen Bruder nicht berühren. Ich habe es nicht gelernt. Die Holocaust-Überlebenden sind eben nicht die normalen Juden. Meine Freundinnen haben alle kalte Eltern gehabt. Dadurch, dass sie etwas Schreckliches unterdrücken mussten, die Vorstellung, dass ihre eigenen Eltern im Gas erstickten, verdrängten sie auch ganz viele andere Gefühle. Meine Mutter war wie aus Stein. Ich mochte sie überhaupt nicht. Aber jedes Mal, wenn ich hinkam, nahm ich mir vor, mich mit ihr menschlich zu unterhalten. Das ging halt nicht. Es war eine Härte und Kälte zwischen uns. Als ich mich scheiden ließ, fragte sie mich kein einziges Mal danach, obwohl ich damals eine Mutter dringend gebraucht hätte. In der Pubertät hat meine Mutter nicht verstanden, dass meine Rebellion eine Phase der Entwicklung war, und wandte sich völlig von mir ab. Ich war die böse Tochter. Sie stürzte sich auf den Sohn und das wurde nach 1975, als mein Vater starb, nur noch schlimmer. Drei Wochen nach dem Tod meiner Mutter hat sich mein Bruder das Leben genommen. Er war völlig lebensunfähig. Sein Studium hat er nicht beendet, er arbeitete nie und hatte keinen einzigen Freund. Er las und meine Mutter ernährte ihn, sie haben zusammen gelebt. Mein Bruder hatte niemanden anderen auf der Welt als die Mutter. Als er schon 30 war, und ich mit meiner Mutter darüber sprach, dass mein Bruder doch eines Tages auf eigenen Füßen stehen müsste, war sie eiskalt. Sie sagte, es sei ihr egal. Sie sei allein auf der Welt und brauche ihn. Mein Bruder war sehr unglücklich. Er hat Zeichnungen gemacht, auf denen das seelische Leid offensichtlich ist. Meine Mutter meinte nur, diese Zeichnungen wären hässlich, sie verdrängte es wieder, dass aus den Graphiken das Elend spricht. Zu meinem Bruder hatte ich eine enge Beziehung, innerhalb der Grenzen dessen, wozu wir überhaupt fähig waren. Unsere Beziehung war intellektuell: Wenn ich kam, sprachen wir über Politik und Literatur, aber nie über etwas Persönliches. Wir setzten fort, was wir von unserer Mutter gelernt hatten. Natürlich versuchte ich, auf ihn einzureden, nicht dieses Leben zu führen, aber diesem Thema hat er sich verweigert. Er war furchtbar verschlossen und das wurde von Jahr zu Jahr schlimmer. Schon Jahrzehnte früher kündigte er an, dass er nicht alt werden wird. Er hatte keine Lebensenergie, die saugte ihm meine Mutter aus. Ich habe immer mit diesem Damoklesschwert gelebt, was sein wird, wenn meine Mutter stirbt. Da er sich zum Schluss viel um sie kümmerte, alles machte, wozu sie nicht mehr in der Lage war, hoffte ich, dass er es doch schaffen würde. Aber es war eine feste Entscheidung und mein Bruder hat es sehr gut organisiert. Er ist bis jetzt nicht gefunden worden. Offiziell ist er nicht tot, sondern bloß verschwunden. Er hat einen Brief hinterlassen, der aber nicht eindeutig ist - für mich schon. In dem Brief steht, dass die plötzliche Änderung seiner Lebensverhältnisse ihn zwingt, nach Übersee auszuwandern. Seine Schwester soll über die Wohnung verfügen. Für mich war klar, dass das ein Testament ist. Er hat nichts mitgenommen, keinen Pass, keine Kleidung, kein Geld. Was er tat, weiß ich nicht. Der einzige Kontakt, der sich entwickelte, als meine Mutter immer kränker wurde, war zu einer Cousine. Sie hatte auch einen ganz guten Draht zu meinem Bruder und ich hoffte auch deshalb, dass seine Psyche sich vielleicht stabilisieren würde. Vorwürfe mache ich mir schon, dass ich mich nicht um ihn gekümmert habe. Nachdem die Mutter gestorben ist, telefonierte ich nur einmal mit ihm. Ich war sehr gekränkt, aber darüber haben wir wieder nicht gesprochen. Am 1. Januar hatte ich Geburtstag, meine Mutter ist am 4. Januar gestorben. Damals war ich in Italien; das zeigt auch meine eigene Kälte, denn ich wusste, das sie sterben würde. Mein Bruder schickte mir eine Geburtstagkarte, so wie mir meine Mutter alle Jahre eine schrieb. Darüber aber, wie es meiner Mutter ging, hat er nichts erwähnt, als ob sie nicht auch meine Mutter wäre. Er sagte auch immer: „Du hast dich all die Jahre nicht um uns gekümmert, jetzt brauchst du dich auch nicht mehr einzumischen.” Diese Karte hat mich ungeheuer verletzt, aber ich konnte es ihm nicht sagen. Am Telefon sagte ich, ich würde im Februar kommen. Dann wollte ich mit ihm sprechen, so hatte ich es mir vorgenommen. Es gab auch kein Begräbnis für meine Mutter, weil sie ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellte. Mein Bruder meinte, wenn ich ein Begräbnis für die Mutter haben wollte, sollte ich das selber organisieren, für ihn sei das zu kompliziert. Das war mir dann auch zu umständlich, und so ließ ich die Sache laufen. Ich schrieb einen Text „Brief an meine tote Mutter” -, den ich im Familienkreis vorlesen wollte. Das tat ich auch, aber mein Bruder war nicht mehr dabei. Die Frage ist, wieweit unsere Geschichte eine Spätfolge des Holocaust ist, oder mit der Psychostruktur meiner Mutter zu tun hat. Es ist beides zusammen, denke ich. Mein Bruder hatte dieselbe Struktur wie ich, nur viel stärker ausgeprägt. Ich habe Glück, dass ich eine Frau bin, denn als hübsches Mädchen hatte ich Liebesaffären und konnte mich so der Familie entziehen. Ihn hat es voll getroffen. Meinen Ehemann habe ich sehr geliebt, aber auch ich bin schwierig. Dass ich nie in der Lage war, wie andere Menschen eine Familie aufzubauen, ist schon ein Zeichen, dass etwas bei mir nicht stimmt. Es war nicht so, dass ich keine Familie haben wollte, es ergab sich einfach so. Aber meine Mutter lebte mir natürlich vor, dass Familie nicht etwas Glückliches ist. Außerdem bin ich ein Kind von 1968, wo es um ganz andere Dinge ging. Die Entwurzelung meiner Eltern habe ich konsequent weitergelebt. Dass ich mich heute zum Jüdischsein bekenne, ist sicherlich ein Versuch, doch noch eine Verankerung zu finden. Mein Bruder machte eine ähnliche Entwicklung durch. Er las dieselben Bücher wie ich, und er interessierte sich sehr für jüdische Fragen. Dass es mir an Autonomie mangelte, hat auch mit dem Gefühl der Fremdheit im eigenen Land, in Österreich zu tun. Ich habe nie Zugehörigkeit erlebt. In Deutschland ist es kein Problem, weil ich Ausländerin bin, also doppelt fremd, auf diese Weise ist es nicht so schlimm. Hier kann ich leichter leben als in Wien, da geht mir das Fremdsein viel näher, weil es ja mein Land ist. Immerhin habe ich 40 Jahre dort verbracht. Wenn ich eine bestimmte Form vom Wiener Dialekt höre, bekomme ich Beklemmungen. Ich sehe dann sofort die Nazis, die zuschauen, wie die Juden den Bürgersteig mit der Zahnbürste säubern. Hier ist mir die Sprache - das „deutsche” Deutsch - sowieso fremd, das geht mir weit weniger unter die Haut. Die Leute sind hier auch etwas gesitteter. Obwohl sich das jetzt ändert, zumindest im Osten des Landes. Mit solchen Leuten komme ich zwar nicht zusammen, ich führe ein sehr isoliertes Leben, aber per e-mail erhalte ich immer die Informationen, wo es jetzt gerade wieder einen Anschlag gab, wo eine Synagoge angezündet wurde. Ich habe immer so abgesondert gelebt. Nur in der Frauenbewegung war ich integriert. Hier habe ich mehrere jüdische Freundinnen und eine jüdische Therapeutin. Es ist mir wichtig, jüdische Menschen zu kennen. Durch „Aimée & Jaguar” und die vielen Lesungen, die ich hatte, konnte ich schon ein bisschen tiefer in die deutsche Seele blicken und erleben, wie weit in Deutschland die Vergangenheit aufgearbeitet worden ist. Während des Bosnienkrieges erlebte ich, dass die Deutschen, besonders kirchliche Kreise, sehr engagiert waren und das hat mich beeindruckt. Mein Mann brachte 8000 Bosnier nach Deutschland. In den ersten zwei Jahren wurden sie nur von den Deutschen aufgenommen, zum Teil ganze Familien. Obwohl die Harmoniesucht, das Nette, das Freundliche der protestantischen Kreise mir ansonsten eher auf die Nerven geht, habe ich großen Respekt für ihre Opferbereitschaft. Ich finde, dass sie sehr wichtig sind für die deutsche politische Kultur. Auch in Bayern waren kleine Gemeinden sehr hilfsbereit. Was die Deutschen für die Bosnier taten, war einerseits aus schlechtem Gewissen, wegen des deutschen Schuldgefühls, andererseits haben viele Deutsche Fluchterfahrungen. Zum Beispiel diejenigen, deren Familie aus Schlesien kam. In Deutschland gibt es generell mehr Sensibilität dafür, was Krieg bedeutet. Während des Krieges lernte ich also die guten Deutschen kennen. Bei den Lesungen treffe ich zwei verschiedene Gruppen. Eine Generation, der die Vergangenheit sehr bewusst ist, und dann die ganz Jungen, die in erster Linie an der Liebesgeschichte interessiert sind. Dazu muss man aber wissen, dass ich im Nachwort sehr kritisch mit der nichtjüdischen Frau umgehe. Sie war Antisemitin. Für ihre Kinder hatte sie das Mutterkreuz erhalten, ihr Mann war in der Wehrmacht, ein überzeugter Nazi. Dann hat sie diese Jüdin kennen gelernt und verliebte sich in sie. Sie lebte zwei Monate mit ihr, bevor sie erfuhr, dass sie Jüdin ist. Danach machte sie eine Kehrtwendung. Sie wurde zur Philosemitin und versteckte nach der Deportation ihrer Freundin noch drei Jüdinnen bei sich. Als ich sie aber kennenlernte, stellte sie sich dar, als wäre sie immer schon Antifaschistin gewesen und erzählte immer nur von ihrer Familie, die tatsächlich antifaschistisch war. Ihr Bruder war Kommunist und ist im Spanischen Bürgerkrieg getötet worden. Aber ich habe nachgeforscht, und es stellte sich heraus, dass sie vor dieser Wende in ihrem Leben ganz anders dachte. Mein Vorwurf ihr gegenüber lautete nicht, dass sie damals mitlief, sondern dass sie damals und heute nicht bereit ist, darüber zu sprechen und sich als Opfer vorführt, dem die Nazis ihre Freundin nahmen. Die jungen Leute sagten aber bei den Lesungen, man darf nicht so streng, so unnachgiebig sein. „Wer weiß, wie wir uns damals verhalten hätten”, habe ich immer wieder gehört. Die Jungen wollen also scheinbar ihren Frieden schließen mit der Generation der Großeltern. Auf der anderen Seite begegnet mir, wenn es um den Holocaust und die Überlebenden geht, immer wieder eine Beklommenheit. Viele können gar nicht darüber reden oder sie werden salbungsvoll. Ein so dick aufgetragener Philosemitismus ist aber unangenehm. Eine offene, selbstbewusste Debatte ist schwierig. Was als Harmonie daherkommt, steht auf tönernen Füßen. Wenn man sich nicht als eine nette Jüdin benimmt, werden die Deutschen sofort beleidigt, oft auch böse. Es gibt noch immer keinen selbstverständlichen Umgang, wo man sagen könnte, ich bin Jüdin, ich habe die und die Geschichte und die Blicke der Zuhörer wären nicht sofort verwirrt. Mir ist es wichtig, ab und zu in einem jüdischen Umfeld zu sein. Neulich war ich zum Beispiel bei einem Seder. Das Ritual finde ich schön, die Texte interessant. Aber religiös bin ich nicht. Bei den Ritualen kann ich zwar mitmachen, aber es ist nicht Teil meines Lebens. Ein paar mal war ich schon in der Synagoge und ich habe zwei Semester Hebräisch gelernt. Wenn ich ein Essen zufällig am Freitag mache und Lea, meine jüdische Freundin, dabei ist, sprechen wir auch den Segen. Ich bin nicht mehr so abwehrend. Wenn sie mir vorspricht, spreche ich auch nach. Es ist für mich eine Tradition, die ich gerne gelebt hätte, wenn ich sie hätte leben können. Eine Tradition, die mich anbindet an die Vergangenheit und an meine Familie. Ich hätte es gerne gehabt, wenn meine Mutter sie mir mitgegeben hätte. Es wäre ein Gefühl der Zugehörigkeit, das ich nie gekannt habe. Jetzt kann ich selbstbewusst sagen, ich bin Jüdin. Wenn man mich fragt, was das heißt, wird es schon sehr vage. Aber ich finde, da ich aus einer Familie stamme, die verfolgt wurde, habe ich das Recht, mein Jüdischsein aus dieser Verfolgungsgeschichte zu beziehen und natürlich auch aus der Halacha, da meine Mutter jüdisch ist. Etwas anderes kann ich ja nicht sagen. Ich kann sagen, ich bin österreichische Staatsbürgerin, aber Österreich ist nicht mein Land. Es ist mir weiterhin fremd und weiterhin „Täterland”. In Deutschland bin ich nur Gastarbeiterin. Ich lebe hier. Ich kann sagen, ich bin englische Staatsbürgerin, aber das hat noch weniger mit mir zu tun. Das ist das Land, das meine Eltern gerettet hat, ich spreche die Sprache, aber lange habe ich dort nicht gelebt. Mit Deutschland verbindet mich mittlerweile der Alltag, das Mitverfolgen der Politik, die kleinen Ärgernisse darüber, was politisch passiert, und das zunehmende Bedürfnis, mich auch einzumischen. Aber das dauert sehr lange, weil ich eine andere Geschichte habe, und auch das Gefühl, dass es ja doch nicht mein Land ist. Eigentlich habe ich gar kein Recht, mich hier einzumischen; obwohl das andererseits Unsinn ist, ich weiß es. Als Journalistin und Autorin mischte ich mich schon längst ein. „Ich bin Jüdin” ist das Einzige, was ich sagen kann, das positive Gefühle auslöst. Durch das Weggehen aus Wien schnitt ich mich von meinen politischen Wurzeln ab. In Wien genoss ich politisches Ansehen. Allmählich bekomme ich auch hier eine Geschichte. Lange habe ich gebraucht, um die politischen Strukturen hier zu begreifen. Aber viele Namen und Zusammenhänge aus der deutschen Geschichte sind mir eben immer noch nicht bekannt. Das ist um so störender, weil ich aus Österreich komme und die Leute glauben, das wäre dasselbe. Es ist aber ein anderes Land, mit einer anderen Geschichte. Um meinen Ausländerstatus muss ich hier immer kämpfen. Von meinen nächsten Verwandten bin ich allein zurückgeblieben. Ich werde alt, ich werde keine Familie mehr haben. Zu meiner Cousine habe ich eine warme Beziehung; sie ist ein völlig anderer, harmonischer Mensch, weil sie dieses jüdische Erbe der Verfolgung nicht hat. Wenn ich zu ihr nach Wien fahre, trete ich in ihre Familie ein. Sonst bin ich hier, in dieser schönen Wohnung und schreibe meine Bücher über Liebesgeschichten anderer Menschen. Ich lebe ganz gut damit, aber in einer inneren Einsamkeit. Die Therapie hat mir geholfen, mit mir allein zurechtzukommen. Das Entwurzeltsein und die Heimatlosigkeit habe ich mir jetzt zu einer Lebensform gemacht. Für dieses Buch - „Jüdische Liebesgeschichten” - bin ich in den letzten anderthalb Jahren ununterbrochen unterwegs gewesen. 5 Wochen in den USA, 4 Wochen in Israel, 3 Wochen in Istanbul, 10 Tage in Sarajevo. Das sind wahre Geschichten, die ich anonymisiere und fiktionalisiere. An diesen Orten fühlte ich mich überall wohl. Ich dachte, dass ich dieses Erbe auch vorteilhaft umsetzen kann: dass ich die Freiheit habe, mich überall zu Hause zu fühlen und mich überall schnell einzuleben. Dass ich liebesfähiger bin als meine Mutter, glaube ich schon. Aber ich weiß auch viel mehr über mich als sie. Ich habe mich nicht gewehrt so wie sie, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Das ist anstrengend, aber es hilft. Und im Gegensatz zu ihr habe ich viele warme Freundschaften. Aber die physische Distanz hielt ich bei. Auch meine engsten Freundinnen kann ich nur schwer in den Arm nehmen, Wenn sie es tun, finde ich es zwar schön, aber ich erwidere es nur zögerlich. Das selbstzerstörerische Hineinfallen in falsche Liebesbeziehungen habe ich mein ganzes Leben lang praktiziert. Mich mehr zu schonen und zu wissen, was mir gefährlich werden kann, ist ja auch das Ziel meiner Therapie. Ob ich es wirklich gelernt habe, kann ich nicht sagen. Vorerst hat es jedenfalls den Effekt, dass ich Menschen überhaupt nicht zu nah an mich heranlasse, dass ich mich schone, indem ich allein lebe. Ich lebe jetzt seit 12 Jahren in Deutschland und bin immer noch nicht politisch engagiert. Dass ich diesbezüglich nichts tue, empfinde ich es als eine Leere. Wenn ich mich dazu entschließen könnte, mich wieder zu engagieren, würde ich Anti-Rassismus-Arbeit machen. Aber auf keinen Fall in einer homogen deutschen Gruppe, ich kann nur mit Ausländern zusammenarbeiten. Das ist heute allerdings nicht einfach, weil die Ausländer sich nach ethnischen Kriterien organisieren, glaube ich wenigstens. Mich beunruhigt die zunehmende Ethnisierung der Politik. In Deutschland ist es noch relativ moderat. Aber ich bin entsetzt wegen der Anschläge auf Dunkelhäutige und dass es keine starke Bewegung dagegen gibt. Schon Anfang der 90-er Jahre, als der Asylkompromiss ausgehandelt wurde, empfand ich als schockierend empfunden, dass es wenig Protest dagegen gab. Für mich ist es besorgniserregend, dass die Ausländerpolitik zunehmend verschärft wird, Asylbewerber menschenrechtswidrig behandelt werden, oder dass ein CDU-Politiker mit dem Spruch „Kinder statt Inder” für Stimmen wirbt. Aber gleicherweise bin ich entsetzt von Otto Schily, der meines Erachtens nur zufällig bei der SPD ist. In meinem feministischen Umkreis stelle ich eine Ignoranz gegenüber anderen Kulturen fest. Wenn man bisschen tiefer gräbt, merkt man schon, was für ein unglaublicher Eurozentrismus hier herrscht, auch unter ganz progressiven Menschen. Ich möchte mich gegen Rassismus engagieren, weil ich der Meinung bin, dass zur Zeit in Deutschland nicht der Antisemitismus, sondern der Rassismus das Problem ist. Was die Friedhofsschändungen betrifft, glaube ich, dass es unter Jugendlichen in Ostdeutschland ein bewusster Tabubruch ist, antisemitisch zu sein. Damit kommen sie am leichtesten an die Öffentlichkeit und schockieren die Leute. Wenn das aber immer üblicher wird, dann ist der Humus für Antisemitismus sicher da und solche Ideen können wieder ankommen. Mein Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus möchte ich generell immer nur in einem größeren Zusammenhang sehen. Ich lehne es ab, mich nur um jüdische Angelegenheiten zu kümmern. Deshalb bin ich auch nicht Mitglied der Jüdischen Gemeinde. Ich würde sofort Mitglied werden, wenn ich das Gefühl hätte, die Jüdische Gemeinde würde sich für Ausländer engagieren. Sie könnte meines Erachtens ganz viel machen, denn wenn die Juden etwas sagen, hat das Gewicht in diesem Land. Aber die Gemeinde ist nicht einmal fähig, die angekommenen Russen zu integrieren. Ich war zum Pessachkonzert in der Fasanenstraße, wo das Jüdische Kammerorchester spielte, das zu einem Großteil aus Russen besteht. Beim Konzert waren fast keine deutsche Juden anwesend. Das ist diese deutsche Arroganz, die man eben auch bei Juden findet. Mich hat in Deutschland schon immer gestört, dass das eine sehr homogene Gesellschaft ist. Immerhin sind 8,9 Prozent der Menschen Ausländer. Deutsche wollen anscheinend unter sich sein. In Gruppen, Gesellschaften, Institutionen, Parteien trifft man Menschen anderer Nationalitäten - in erster Linie natürlich Türken - kaum an. Dadurch fehlt die Offenheit, und das Verständnis füreinander kann auch nicht geweckt werden. Gerade deshalb könnte ich mir ein politisches Engagement nur in einer multikulturellen Gruppe vorstellen. Israela Jones „Wenn ich den Satz: »Ich kann nichts dafür« höre, werde ich sehr traurig” Für Israela Jones, geborene Vardi ist es wichtig zu betonen, dass sie jüdische Israeli ist. An erster Stelle fühlt sie sich mit dem Judentum verbunden, doch das jüdische Volk beinhaltet alle Juden in der Welt. Sie lebt seit 14 Jahren in Deutschland und ist dankbar für diese Zeit, denn ihre Perspektive ist erweitert worden. In Israel hätte sie solche Erfahrungen nicht sammeln können. Wenn man als Jude in Deutschland lebt, aus welchem Grund auch immer, soll man auch dazu stehen, sagt die 38jährige. Die fortdauernde Abgrenzung birgt Gefahren in sich. Es ist zwar nicht möglich, über die Geschichte hinwegzukommen, aber die Deutschen vereinen, wie alle Völker, Gutes und Schlechtes in sich. Und die Fähigkeit zum Guten sollte man ihnen unbedingt zubilligen. Ich bin nach einem Besuch aus einem einfachen Grund in Deutschland geblieben. Hier musste man keine Studiengebühren bezahlen. Nachdem ich meinen zweijährigen Militärdienst in Israel geleistet hatte, fing ich schon dort mit dem Studium an, brach es aber und suchte mir einen Job. Durch die Computerfirma, bei der ich arbeitete, wollte ich dann nach England versetzt werden, aber ich hätte keine Arbeitserlaubnis bekommen. Europa hat schon damals zugemacht. Ich lebte zwischendurch ein paar Monate in Frankreich, hatte aber auch dort keine Chance, längerfristig dazubleiben. Ende 1985 war ich ohne Arbeit, als ich eine Einladung nach Deutschland annahm. In Eilat verbrachte ich einen kurzen Urlaub und dort lernte ich einen Rechtsanwalt aus Berlin kennen. Etwas später rief er mich aus Deutschland an und fragte, ob ich nicht Lust hätte, Weihnachten und Sylvester bei ihm zu verbringen. Eigentlich wollte ich nicht, ich hatte Bedenken wegen Deutschland. Aber ein Bekannter riet mir zu, also bin ich gefahren. Wir trafen uns mit seinen Freunden auf Sylt, danach lud er mich nach Berlin ein. In Berlin habe ich erfahren, dass man in Deutschland studieren kann, ohne dafür Gebühren zu bezahlen. Auch Ausländer werden an die Universitäten angenommen, vorausgesetzt, dass sie Deutsch können. Ich wollte diese Gelegenheit wahrnehmen. Mein Touristenvisum war für drei Monate gültig, ich hatte also noch Zeit und fing an, in einem Schnellkurs Deutsch zu lernen. Als aber meine Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen ist, kam die Ausländerpolizei und ich musste das Land verlassen. Ich fuhr zurück nach Israel, um wieder ein Visum zu erhalten. Der Rechtsanwalt, mit dem ich in Berlin zusammenlebte, versuchte, für mich eine Verlängerung des Visums zu erlangen, dass ging aber nicht. Wir haben dann geheiratet, aber da wir uns nicht verstanden hatten, trennten wir uns nach anderthalb Jahren. Offiziell ließen wir uns erst 4 Jahre später scheiden. In der Zwischenzeit hatte ich schon die unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Bedenken wegen Deutschland hatte ich, bevor ich herkam. Mir war klar, wenn ich zurückgehe, muss ich erklären, wieso ich in dieses Land gereist bin. Ich habe ja ein Tabu gebrochen. Es gab damals noch viele Menschen in Israel, die Deutschland boykottierten. Sie wären auf keinen Fall hingefahren und kauften auch keine deutschen Produkte. In Israel lebt die Gesellschaft eng aneinander, man kann nichts machen, ohne dass die anderen Menschen etwas davon mitbekommen. Es war mir bewusst, dass ich in Israel über meinen Deutschlandaufenthalt Rechenschaft geben muss. Ich befürchtete, dass man meinen Grund, hier bei niedrigen Kosten studieren zu können, nicht verstehen wird und mich für eine Verräterin hält. Israels offizielle Politik war es, die Kinder so zu erziehen, dass sich das Muster des schwachen Juden nicht wiederholt. Die ganze Gesellschaft hat daran gearbeitet, starke Nachkommen zu erziehen. In den Schulen und beim Militär war man bestrebt, den Jugendlichen beizubringen, es könnte nie wieder passieren, dass die Menschen wie Schafe geschlachtet werden. Aus der Geschichte wurden die Helden und die Heldentaten hervorgehoben, die Partisanen, die gekämpft haben und die Menschen, die im Warschauer Ghetto aufgestanden sind. Vielleicht wurden in vielen Familien die eigenen Geschichten, die diesem Vorbild nicht entsprachen, auch deshalb nicht erzählt. Natürlich hat man aber in den Schulen das schreckliche Kapitel nicht verschwiegen. Mit dem Holocaust wurde ich zum ersten Mal konfrontiert, als uns in der Schule ein Film gezeigt wurde. Ich kann mich heute noch an alle Details erinnern, obwohl ich damals erst etwa 12 Jahre alt war. In dem Film wurde eine kleine Gruppe von Kindern von der SS gezwungen, in einen Lastwagen zu steigen. Die Soldaten hatten furchterregende Schäferhunde bei sich. Manche Hunde sprangen auch die Kinder an, die es nicht schafften, hochzuklettern. Danach wurde der Lastwagen zugemacht. Ein SS-Mann kam, nahm einen Schlauch, machte ihn an dem Auspuff fest und führte das andere Ende in das Innere des Lastwagens. Und der Motor lief. Das werde ich nie vergessen. Ich habe danach nächtelang nicht schlafen können. Mit meinen Eltern sprach ich wahrscheinlich deshalb nicht über dieses Thema, weil ich glaubte, unsere Familie war von dem Holocaust nicht betroffen. Ich nahm an, wenn unsere Familie auch daran gelitten hätte, hätten meine Eltern mir das sicherlich erzählt. Mit der Shoah hatte ich sowieso große Probleme, weil ich ein visueller Typ bin. Bestimmte Bücher ließ ich liegen, weil ich vor meinen Augen sah, was dort beschrieben wurde und das konnte ich nicht aushalten. Ich war schon über 30, als ich erfuhr, dass ein Bruder meiner Großmutter, der auf Rhodos blieb, mit 2000 anderen Juden verschleppt wurde und umgekommen ist. Die Eltern meiner Mutter sind in der Türkei geboren. Die Familie kam vor mehreren hundert Jahren ursprünglich aus Spanien. Meine Großmutter stammte aus einer sehr wohlhabenden Familie. Ihr Haus stand in der Nachbarschaft des armenischen Viertels und als die Türken 1915 die Armenier vertrieben, wurde es auch zerstört. Sie haben ihr ganzes Vermögen verloren. Die zwei Brüder meiner Großmutter sind nach Rhodos gegangen und nachdem sie dort ein kleines Geschäft aufgebaut hatten, holten sie die Familie nach. Die Familie meines Großvaters verließ die Türkei um 1914 wegen des Ersten Weltkrieges. Die Eltern des Großvaters hatten Angst, dass ihr Sohn eingezogen wird. Meine Großeltern heirateten dann auf Rhodos und dort sind drei Töchter geboren. Meine Mutter ist die Jüngste, sie wurde 1932 geboren. Die Insel gehörte damals zu Italien. Die relative Geborgenheit hielt nicht lange. Die Italiener - Verbündete der Nazis - teilten der Familie mit, dass sie nur die Töchter als italienische Staatsbürger betrachteten, die Eltern seien Türken und wenn etwas passiert, würde man sich ihnen gegenüber nicht verantwortlich fühlen. So haben die Großeltern die Sachen gepackt und sind in einem Frachtschiff nach Tanger, Marokko gekommen. Dort mussten sie 10 Jahre lang in einem Lager bleiben, ehe sie nach Palästina auswandern konnten. Meine Großeltern väterlicherseits sind in Polen geboren. Die Familie war sehr wohlhabend, sie hatten eine Fabrik für Textilfärberei. Bei orthodoxen Ashkenasi-Juden war es üblich, dass der erstgeborene Sohn in die Jeshiwa geschickt wurde um die Thora zu studieren. Mein Großvater war der Erstgeborene von 7 Kindern, so ging er in die Jeshiwa. Seine Brüder haben alle einen Beruf erlernt. Der zweite Bruder ist in die französische Fremdenlegion eingetreten. Dieser Bruder, der Legionär wurde, hat eine eigenartige Rolle in der Familiengeschichte gespielt. Die erste Ehe meines Großvaters musste nämlich seinetwegen rückgängig gemacht werden, aber das erfuhren die Kinder erst viel später, und nur durch einen Zufall: Die Schwester meines Vaters ließ sich in Tel Aviv von einem arabischen Wahrsager einmal aus der Hand lesen. Er sagte zu ihr: „Dein Vater hatte mal eine rothaarige Frau.” Überrascht lief sie nach Hause, und fragte ihre Eltern. Die mussten ihr dann erzählen, dass ihr Vater tatsächlich mit einer rothaarigen Frau verheiratet wurde. Zu der Heirat kam der gutaussehende Bruder, der in der Fremdenlegion war. Die Braut verliebte sich prompt in ihn, und obwohl die Heirat mit dem Großvater stattfand, weigerte sich dann die jung vermählte Frau, ihren ehelichen Pflichten nachzukommen. So wurde die Ehe geschieden. Somit hatte der Wahrsager wirklich recht, mein Großvater war zweimal verheiratet. Die zweite Frau, meine Großmutter guckte sich schon früher den Großvater aus und als er wieder frei wurde, hat sie die Chance genutzt. Einmal sind sie dann mit dem Zug gefahren. In ihrer Abteilung sass ein Jude, der Peies hatte. Plötzlich kamen vier Polen, packten ihn an Händen und Füßen und warfen ihn aus dem Zug. Das hat meiner Großmutter gereicht. Ohne ihrem Mann etwas zu sagen, hat sie langsam alles verkauft und als eines Tages der Großvater nach Hause kam, sass die Großmutter auf den Koffern und sagte: „Wir fahren nach Palästina”. Das war um 1920 herum. Als die Großeltern den Zug besteigen wollten, hat ein polnischer Soldat dem Großvater ins Gesicht gespuckt und ihm eine Ohrfeige verpasst. Das nahmen sie als letztes Andenken an Polen mit. In Palästina konnte mein Großvater als Religionslehrer nicht arbeiten und einen Beruf hatte er ja nicht erlernt. Die Großmutter arbeitete als Näherin, um die Familie zu ernähren. Später erfuhr sie, dass die Stadtverwaltung von Tel Aviv Lizenzen für Kioske vergibt. Da sie wusste, dass der Großvater ein sehr unpraktischer Mensch war, hat sie sich der Beschaffung dieser Lizenz angenommen und ist so lange herumgerannt, bis sie sie kriegen konnte. Danach hatten sie Zeitungen und Süßigkeiten verkauft. Mein Vater kam 1922 in Tel Aviv auf die Welt. Die Großmutter ist früh an Krebs verstorben, meinen Großvater habe ich auch nicht mehr gekannt, er starb kurz vor meiner Geburt. Außer dem vielwissenden Wahrsager gibt es in unserer Familienchronik noch mehr unglaubliche Geschichten. Eine davon handelt von dem jüngeren Bruder meines polnischen Großvaters. Er hat Uhrmacher gelernt und ist ziemlich früh nach Frankreich gegangen wo er in der Textilbranche sehr reich wurde. Nach der deutschen Besatzung wurde er nach Auschwitz deportiert. Sein Leben verdankte er seinem ursprünglichen Beruf. Bei der Ankunft in Auschwitz hat man gefragt, ob von den Deportierten jemand von Uhren etwas verstünde. Der Bruder trat vor und ein SS-Offizier nahm ihn an seine Seite. Er musste in ständiger Bereitschaft sein für den Fall, dass die Uhr des SS-Mannes einmal stehen bleibt. Der Offizier hatte aber einen Helfer, der die privilegierte Stellung des Häftlings sehr übel nahm und ihn eines Tages auf die Liste der Menschen setzte, die in die Gaskammer geschickt wurden. Der Bruder soll schon im „Duschraum” gewesen sein, als die Uhr des SS-Offiziers plötzlich stehen blieb. Er suchte den Uhrmacher und so musste der Helfer den Häftling aus der Gaskammer holen. Auf diese Weise konnte er dem schrecklichen Tod entkommen. Die anderen Familienmitglieder, die in Polen geblieben sind, wurden alle umgebracht. Mein Vater war 39, meine Mutter 28 Jahre alt, als sie heirateten. Sie haben hebräisch miteinander gesprochen, das war die gemeinsame Sprache, da bei meinem Vater zu Hause jiddisch, bei meiner Mutter ladino gesprochen wurde. Mein Vater arbeitete bei der Stadtverwaltung in Tel Aviv als Beauftragter für Hygiene. Er hat darauf geachtet, dass die Vorschriften in Restaurants und Geschäften eingehalten wurden. Die Mutter war Krankenschwester. Obwohl mein Großvater sehr religiös war, hat das mein Vater nicht von ihm übernommen. Auch meine Mutter war nicht religiös, erst später hat sie sich wieder der Religion zugewandt. Die Traditionen haben wir aber gehalten, an jüdischen Feiertagen gingen wir in die Synagoge. Ich hatte immer eine sehr gute Beziehung zu meinen Eltern. Sicherlich hatte ich Perioden, wo ich rebellierte. Meine Mutter war der „General” und mein Vater passte nicht zu dem Bild eines erfolgreichen Geschäftsmannes. Als ich ungefähr 15 Jahre alt war, kam ein Mädchen zu uns in die Klasse, die mit ihren Eltern aus Argentinien eingewandert ist. Ihr Vater leitete die Vertretung der argentinischen Fluglinie in Israel. Sie lud mich zu sich nach Hause ein: sie hatten eine wunderschöne Wohnung und man konnte sehen, dass sie sehr reich waren. Dieses Mädchen trug sehr teure Kleidung und hatte eine Cartier-Uhr. Als ich dann bei ihnen war, kam der Vater von der Arbeit nach Hause und fragte, welche Note die Tochter für eine schriftliche Arbeit erhielt. Die Note war sehr schlecht und da hat ihr der Vater vor meinen Augen eine verpasst und sagte, er würde ihr die Cartier-Uhr wegnehmen. Vielleicht ist mir erst damals richtig bewusst geworden, dass sich meine Eltern nie so zu mir verhielten. In der Schule war ich gut, aber auch sonst brauchte ich nie Angst davor zu haben, dass mir meine Eltern eine runterhauen, oder mir etwas wegnehmen. Ich hatte eine gute Kindheit auch wenn meine Eltern, die ungefähr 10 Jahre älter waren, als die Eltern meiner Klassenkameraden, manchmal weniger Geduld, oder Verständnis für die Macken ihrer Teenagertöchter aufwiesen. Mein Vater konnte es zum Beispiel schwer ertragen, wenn meine Schwester und ich ständig zu laut Musik hörten. Unsere Wohnung war sehr klein. Der Vater hatte viel Stress in der Arbeit - als er die gesundheitlichen Vorschriften durchsetzen wollte, kam es schon mal vor, dass die Laden- oder Standbesitzer mit dem Messer auf ihn losgingen. Er war also oft geschafft als er nach Hause kam, und dann musste er noch die „Dezibels” ertragen. Meiner Mutter hat es nicht gefallen, dass ich mir auch die Beziehung zu den Jungen frei gestaltete. Um weiteren Spannungen aus dem Wege zu gehen, kauften sich meine Eltern dann eine zweite Wohnung im selben Haus. So hatte ich mit meiner drei Jahre jüngeren Schwester ein prima Leben. Für Strom und Wasser mussten wir zwar selber aufkommen - wir haben beide neben der Schule gejobbt -, aber wir konnten bei den Eltern essen und auch sonst alle Vorteile ihrer Nähe genießen. Ich war 23 als ich nach Deutschland kam. Die großen Erfahrungen meines Lebens habe ich hier gemacht und ich bin dankbar dafür. Mein Leben hätte sich bestimmt nicht so entwickelt, wenn ich in Israel geblieben wäre. Menschen, die ich hier kennenlernte, öffneten mir Türe und meine Perspektiven haben sich erweitert. Obwohl mich die Möglichkeit des Studierens sehr reizte, brach ich dann das angefangene Anglistik-Studium ab. Die Literatur hat mich nicht interessiert. Ich erwarb bei der Industrieund Handelskammer ein Diplom und seitdem übersetze ich aus dem Hebräischen und Englischen ins Deutsche und umgekehrt für Geschäftszwecke. Meinen zweiten Mann, Alan Jones lernte ich vor 7 Jahren kennen, wir haben vor 3 Jahren geheiratet. Er ist Hornist im Deutschen Sinfonieorchester. Mein Mann ist britischer Staatsbürger. Als ich ihn kennenlernte, war ich dabei, meine Sache zu packen und für immer nach Israel zurückzukehren. Damals hatte ich eine Reihe von Beziehungen hinter mir, die alle fehlgeschlagen waren. Ich musste feststellen, dass die deutschen Männer mit meinem Temperament nicht zurechtkamen und ich wollte keinen deutschen Mann mehr haben. Ich bin ein richtiger israelischer Kaktus: ich sage gerade heraus, was ich denke und wenn es notwendig ist, gehe ich durch die Wand. Laut „europäischem Verständnis” kenne ich keine Hemmungen. Israelis sind im allgemeinen sowieso undiplomatisch, bei mir kommt noch dazu, dass ich ein sehr starkes Durchsetzungsvermögen habe. Da ich auch selbstbewusst bin, werden dadurch diese Eigenschaften noch mehr verstärkt. Das können viele Deutsche, insbesondere Männer, nicht verkraften. Als ich noch bei „Keren Hayessod”, der Organisation arbeitete, die Spenden für Israel sammelt, hat man versucht, mich mit reichen deutschen Juden zu verkuppeln. Die waren ziemlich hochmütig, sie dachten, mit ihrem Geld könnten sie Unterwürfigkeit kaufen. Mein Mann ist nichtjüdisch. Nach den missratenen Beziehungen bin ich zu dem Schluss gekommen, wichtiger als seine Herkunft ist mir, dass er mich akzeptiert, so, wie ich bin. Trotzdem sagte ich ihm sofort bei unserem ersten oder zweiten Treffen, sollten wir Kinder haben, würde ich darauf bestehen, sie jüdisch zu erziehen. Er muss das ziemlich merkwürdig gefunden haben. Ich aber wollte das schon im voraus klären, um späteren möglichen Problemen zuvorzukommen. Mein Mann lebt seit mehr als 26 Jahren in Deutschland. Gleich nach dem Studium bekam er einen Job in Passau angeboten und dort lernte er seine erste Frau kennen. Aus dieser Ehe hat er einen 23jährigen Sohn. Mit der Zeit wurde mir dann bewusst, dass es für alle Beteiligten besser ist, wenn ich mich von meinem Wunsch, eigene Kinder zu haben, verabschiede. Meine Mutter war schon damals, als ich noch zu Besuch nach Deutschland fuhr, sehr traurig. Noch weniger konnte sie es fassen, als ich beschloss, hier zu bleiben. Für meine Mutter ist es bis heute schwierig, zu verkraften, dass ich hier lebe, aber nun hat sie sich damit abgefunden. Meine Schwester verließ inzwischen auch Israel, sie hat geheiratet und lebt in Amerika. Heutzutage sind die Gefühle meiner Mutter mehr dadurch bestimmt, dass sie ihre Töchter vermisst. Vor ein paar Jahren luden wir meine Mutter ein. Sie meinte, sie würde kommen, aber hat dann die Reise immer aufgeschoben. Später gab sie zu, dass sie nicht nach Deutschland reisen möchte. Ich respektiere ihre Gefühle. Vielleicht hat mein Vater meinen Entschluss, hier zu bleiben, mehr verstanden, aber er äußerte sich nicht darüber. Er folgt dem Willen meiner Mutter. In Deutschland habe ich immer wieder seltsame Situationen erlebt. Als Menschen, die ich zufällig traf, erfuhren, dass ich jüdisch bin, versuchten sie unaufgefordert, mir zu erklären, sie seien nicht schuldig, „sie könnten nichts dafür”. Das fand ich völlig abwegig. Was erwarteten eigentlich von mir, wenn sie das sagten? Dass ich sie freispreche, für meine Familie oder für die anderen Leute, die ermordet worden sind? Wenn ich auf Partys Männer meines Alters treffe, würde ich nie annehmen, dass sie jemanden umgebracht hatten. Aber für sie war es wichtig zu betonen, dass sie keine Mörder waren. In den ersten Jahren habe ich auf solche Äußerungen gar nicht reagiert. Obwohl ich mir nicht richtig erklären konnte, warum, wusste ich innerlich, dass diese Aussagen nicht in Ordnung waren. Allmählich verstand ich die Situation. Es wurde mir klar, dass trotz der großen Mühe des deutschen Bildungswesens in all diesen Jahren seit Ende des Zweiten Weltkrieges nichts Wesentliches erreicht wurde. Die Reaktion des durchschnittlichen Deutschen beim Thema Holocaust ist verkrampft und meist unaufrichtig - vor allem will er damit möglichst wenig zu tun haben. Das finde ich schade. Irgendwie müssten die Deutschen verstehen, dass ein unaufgearbeitetes Kapitel ihrer Geschichte sie nie in Ruhe lässt. Sie sollten Interesse daran haben, dass Ganze zu verstehen, um damit besser umgehen zu können - um ihrer eigenen Ruhe willen. Statt dessen laufen sie aber vor diesem Thema weg. Wenn ich den Satz: „Ich kann nichts dafür” höre, werde ich sehr traurig. Es ist ein Armutszeugnis sowohl des Individuums als auch des Landes. Es zeigt, dass nach so vielen Jahren immer noch nichts verstanden wurde. Hier geht es um Kollektiv-Verantwortung. Das, was die Deutschen getan haben, wirkt auf die Gegenwart, aber auch auf die Zukunft eines jeden Deutschen aus. Kollektiv-Verantwortung ist eine schwere Last. Auch ich als Israeli trage Kollektiv-Verantwortung dem palästinensischen Volk gegenüber, obwohl ich keinen Palästinenser getötet habe. Die Juden, die damals nach Palästina zurückkehrten, nahmen den Palästinensern das Land nicht weg, sie haben das Land gekauft. Vertrieben wurden die Palästinenser auch nicht sie flohen, weil die Muftis der benachbarten arabischen Länder ihnen sagten, dass die Juden sie töten werden. Mein Volk hat keinen Massenmord an den Palästinensern begangen. Doch entstand so viel Leid. Und wenn ich einem Palästinenser begegne, tut es mir, wegen des Schicksals seines Volkes leid. Genau das versuche ich, ihm zu vermitteln. Mitgefühl dem Leidenden gegenüber zu zeigen, ist keineswegs abgedroschen. Das ist es, was ich bei vielen Deutschen vermisse. Von den vielen Leuten, die ich kennenlernte, habe ich nur wenige getroffen, die mit mir über dieses Thema hätten sprechen können. In Deutschland wurde ich nie als Jude beschimpft. Ein einziges Mal hat jemand in meiner Gegenwart abwertend über Juden gesprochen, aber diese Person wusste nicht, dass ich Jüdin bin. Später entschuldigte sie sich bei mir; was ich völlig unnötig fand, denn wenn sie so über Juden denkt, ist es eben ihre Meinung. Viele Menschen wundern sich, dass ich das Wort „Jude” ohne Probleme in den Mund nehme. Sie sind aber dankbar, wenn sie mit mir darüber sprechen können, ohne Beklemmungen zu haben. Gern erkläre ich ihnen, was der Unterschied zwischen meiner Staatsangehörigkeit und meiner Nationalität ist und auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen „jüdisch” als Zugehörigkeit zur Religion und „jüdisch” als Zugehörigkeit zur Nation. Ich kann nichtreligiös sein, aber desto mehr jüdisch-national. Ich bin jüdische Israeli. Israeli bin ich geographisch gesehen, jüdisch bin ich, weil ich zu dieser mehr als 5000 Jahre alten Nation gehöre. Das Land Israel ist ein Teil dieser Nation. Das jüdische Volk beinhaltet das israelische Volk. Es umfasst alle Juden in der Welt und ich fühle mich an erster Stelle mit dem Judentum verbunden, mit allen Juden, rückreichend bis Abraham. Unsere gemeinsame Geschichte ist für mich die Grundlage der Verbundenheit. Jüdisch zu sein ist für mich mehr geschichts- als religionsverbunden. Ich feiere Pessach zum Beispiel, aber ganz locker. Bei uns muss nicht die ganze Woche über aufs Brot verzichtet werden. Für mich ist die Symbolik wichtig. Religiös bin ich nicht, aber die Traditionen bedeuten mir sehr viel. Meines Erachtens wurde das Judentum nicht als Religion konzipiert. Gesetze und Vorschriften sind entstanden, um das Zusammenleben der jüdischen Menschen zu ermöglichen in einer Umwelt, die sich ganz anders benommen hat. Aber diese Gesetze wurden vor mehr als 2000 Jahren festgelegt, in der antiken Gesellschaft. Gesetze können und sollten den Umständen angepasst werden. Ich weiß, dass Maimonides und andere große Persönlichkeiten der jüdischen Religionsphilosophie es schon vor Jahrhunderten als ihre Pflicht angesehen haben, den Verstand zu benutzen und die Gebote und Glaubenssätze anzupassen. Ich möchte die Thora nicht verändern, aber alles, was wir als Religion kennen, ist nur eine Auslegung des Gesetzes und die Auslegung kann geändert werden. Das, was im Judentum im allgemeinen als Religion aufgefasst wird, ist für mich keine Religion, sondern ein Kodex für richtiges Verhalten unter Menschen, die sich mit diesem Kodex identifizieren. Die Auslegung, die in den Jahrhunderten erstanden ist, stellte ich immer in Frage. Ich erlaube mir meine eigene Interpretation. Wenn in der Bibel zum Beispiel steht, du sollst am Sabbat nicht arbeiten, erlaube ich mir, selbst zu entscheiden, was damit gemeint wurde. Nach meiner Interpretation bedeutet das, man muss nach einer bestimmten Zeit von der Arbeit einfach Ruhe haben. Aber nicht unbedingt am Sabbat, ich kann mir meinen Ruhetag auch am Dienstag nehmen. So mache ich das mit allen mir bekannten Gesetzen des Judentums. Und ich brauche keinen Rabbiner, der mir diktiert, wie ich mein Leben gestalten soll. Ich hatte das Glück, dass ich in Israel geboren wurde. Es hat mir sehr gefallen, die Geschichten der Bibel kennen zu lernen, weil ich sie als die Geschichte unseres Volkes betrachtete. Aber ich glaube, unabhängig davon, wo man lebt, sollten sich Menschen, die sich jüdisch fühlen, dafür sorgen, dass ihre Kinder die jüdische Geschichte lernen. Nur auf diese Weise können sie eine Beziehung zum Judentum haben. Das ist nicht weniger wichtig, als Sabbat zu feiern. Eltern sollten ihren Kindern erklären, woher wir kommen, wer der Patriarch war, warum das jüdische Volk in Ägypten lebte. Die Kinder sollen selbst erfahren, was diese Zugehörigkeit ausmacht und wenn sie ins entsprechende Alter kommen, können sie entscheiden, ob sie religiös werden wollen oder nicht. Ich habe in Deutschland ganz wenig jüdische Freunde. Sie sind nicht meine Welt. Die ganze Einstellung der Jüdischen Gemeinde finde ich nicht gesund. Die Gemeinde in Berlin hält sich sehr an die Orthodoxie-, und das finde ich falsch. Man sollte den Pluralismus im Judentum anerkennen. Anstatt dessen wird Erneuerern, wie dem Rabbiner Rothschild, die etwas bewegen wollen der Garaus gemacht. Endlich kommt ein Mensch, der versteht, dass er Religion und Symbolik anders präsentieren muss, damit er auch die junge Generation ansprechen kann, und dann wird er einfach verjagt. In der Gemeinde stört mich am meisten die Heuchelei: das Bestreben, nach außen hin ein schönes Gesicht zu zeigen. Über die Profilierungssucht wird die eigentliche Aufgabe vergessen. Deshalb bin ich kein Mitglied bei der Jüdischen Gemeinde. Wenn ich ein-zweimal im Jahr nach Israel fahre, fühle ich mich dort wohl. Aber ich finde, im Mittelmeerraum sind wir in mancher Hinsicht noch in der Steinzeit. In Europa hat man sich schon ein bisschen nach vorne bewegt, hier wurde es verstanden, dass man mit Diplomatie Probleme lösen kann. Natürlich war das Bestreben Ben Gurions und seiner Generation verständlich, den jungen Menschen ein starkes Nationalbewusstsein zu geben. Sie sollten stolz auf ihre Herkunft, auf ihr Land sein und immer bereit, es zu beschützen. In der feindlichen Umgebung war diese Einstellung absolut notwendig. Das Resultat ist die Eigenart der Israelis, alles, was in der Welt - vor allem aber in der Region - geschieht, viel zu oft nur durch die israelische Brille zu betrachten. Als ich hierher kam, habe ich auch unsinniges Zeug geredet, wie etwa: Israel kann sich leisten, sich so zu benehmen, wie es ihm passt. Diese Inselmentalität entspricht aber nicht den wirklichen Verhältnissen. Es gibt Konflikte, die in Israel ausgetragen werden, aber sie berühren andere Ecken der Welt. Man kann sich nicht auf ein Podest stellen und erklären, andere haben kein Recht mitzureden. In Deutschland stört mich, dass die Menschen so steif sind. Ich glaube, das deutsche Volk hat tief innen eine große Angst vor dem Unbekannten, vor dem Neuen, vor der Veränderung. Deshalb fürchten sie auch die Ausländer, weil sie für die Deutschen unbekannte Kulturen und Veränderungen verkörpern. Wenn die Ausländer zu viele werden, fühlen sich die Deutschen unsicher, weil sie mit der Situation nicht zurechtkommen. Anstatt zu erkennen, sie können etwas Neues lernen, ohne die eigene Identität zu verlieren, denken sie, sie müssten alles Fremde bekämpfen, um ihre eigene Existenz und Identität zu beschützen. Diese Attitüde spürt man als Fremde sofort in Deutschland. Als Individuen sind die Deutschen sehr nette Menschen, ich habe viele Freunde unter ihnen gefunden. Aber in dem Moment, wo sie glauben, dass das Fremde ihnen zu viel wird, werden sie aggressiv. Ich denke aber, dass jeder Mensch zwei Seiten hat: eine gute und eine schlechte. Und das bezieht sich genauso auf Völker und Kulturen. Wenn der Mensch sich bedroht fühlt, versucht er sich auf seine Weise zu verteidigen. Die Deutschen, die aus Angstgründen als Masse reagieren, können sich zu einem Ungeheuer verwandeln. Dass die Deutschen sich zu einer riesigen Vernichtungsmaschinerie zusammengetan haben, war etwas Einmaliges. Zwar gebe ich dem deutschen Volk keinen Freispruch, ich möchte es aber auch nicht verdammen. Viele Völker haben Kapitel in ihrer Geschichte, die Schandtaten verbergen. Wir sollten zum Beispiel nicht vergessen, dass die Amerikaner ihre Unabhängigkeit erlangten, wobei sie die Indianer auf bestialische Weise ermordet hatten. Seitdem ich in Deutschland lebe, ist mir Antisemitismus nicht begegnet. Aber in die neuen Bundesländer würde ich nicht gehen. Dort ist, glaube ich, der Angstzustand der einheimischen Bevölkerung so stark, dass ich schon Antisemitismus spüren würde. Die Menschen in der ehemaligen DDR kommen mit ihrem eigenen Leben noch nicht zurecht. Sie sind von den Wessis völlig überrumpelt worden, sie fühlen sich gekauft, noch dazu auf eine hinterlistige Art und Weise. Deshalb ist die Gefahr dort größer, dass einige über diejenigen herfallen, die in ihren Augen als die Schwächeren erscheinen. Diejenigen deutschen Juden, deren Familie seit mehreren Generationen in Deutschland lebt, haben, wie ich glaube, weniger Probleme damit zu sagen, dass sie deutsch-jüdisch oder jüdischdeutsch sind. Die Juden aber, die keine deutsche Wurzeln haben, sondern aus Osteuropa kommen und nach dem Krieg als „Displaced Persons” hiergeblieben sind, haben Schwierigkeiten mit ihrem Deutschsein. Sie sind sich dessen bewusst, dass sie in einem wohlhabenden Land leben, zugleich ist das aber die Grundlage ihrer Unsicherheit. Es ist ihnen peinlich, zuzugeben, dass sie des Wohlstandes wegen hier leben. Diese Menschen wollen nicht dazu stehen, was sie machen, obwohl das ja keine Schande ist. Es ist keine Schande, aus wirtschaftlichen, kulturellen oder aus sonstigen Gründen in Deutschland zu leben. Jeder hat das Recht, dort zu leben, wo es ihm passt, wo es ihm gut geht. Aber wenn sie hier leben, warum ist es ihnen unangenehm zu sagen, „ich bin Deutscher” bzw. „deutscher Jude”? Es würde zumindest zum Teil die Zugehörigkeit zu dieser Nation beinhalten. Sie meinen, in dem Moment wo sie das aussprechen, hätten sie sich mit den Nazis verbunden. Bei manchen verstehe ich diese Vorbehalte, dass sie das Wort „deutsch” einfach nicht über die Lippen bringen können, weil sie es seelisch nicht bewältigen können. Aber nur wenige können mich - insbesondere bei den Jüngeren - mit dieser Argumentation überzeugen. Auch dem deutschen Volk gegenüber würde ich es fairer finden, wenn die deutschen Juden sich auch so bezeichnen würden. Sie wollen ganz normal als Juden anerkannt werden, aber dann können sie sich nicht von der Gesellschaft distanzieren. In Israel würde man auch nicht akzeptieren, dass eine Gruppe von Menschen für sich Sonderbedingungen beansprucht. Ich finde es seltsam, einen deutschen Pass zu haben und sich trotzdem nicht als Deutsche zu bezeichnen. Ich bringe den Deutschen das Vertrauen entgegen, dass sie gut sein können. Von der Geschichte können wir uns zwar nicht lossagen, aber es ist möglich, mit ihr zu wachsen und damit auch die Veränderungen durchzumachen. Das jüdische Volk und das deutsche Volk bleiben durch den Holocaust für immer verbunden. Aber auf die Dauer kann es nicht gehen, dass die jüdische Gemeinschaft nur abweisende Signale an die Deutschen schickt. Die jüdischen Menschen leben hier nach ihrer eigenen Wahl, zugleich benehmen sie sich aber so, als würden sie mit ihrer Umgebung nichts zu tun haben. Einmal könnte es wieder explodieren und gerade das wollen wir doch vermeiden. Wir legen jetzt die Weichen für die Zukunft und dessen müssten wir uns im klaren sein. Gabriel Heimler „Ich wünschte, nach Deutschland zu kommen, um ein Mensch werden zu können, ich wollte nicht mehr Angst haben” Gabriel Heimler ist 1964 in Paris geboren und lebt seit dreizehn Jahren in Berlin. Sein kultureller Hintergrund ist deutsch-ungarisch-französisch. Auf seinen Bildern schauen die Figuren mit riesengrossen Augen in die Welt, seine Menschen überragen die Gebäude um das Vielfache. Heimler besitzt ungarische und französische Staatsbürgerschaft, einen deutschen Pass hat er sich nicht besorgt, „da, das, was die Deutschen angerichtet haben, noch zu nahe liegt”. In seiner Tiergartener Wohnung stopft er sich sorgsam eine Pfeife, während er erzählt. Seitdem ich zwölf Jahre alt war, habe ich mir immer gewünscht, nach Deutschland zu kommen, weil ich mich - genauso wie meine Mutter - als „Untermensch” fühlte. Trotzdem wollte ich nach Deutschland, weil die Familie von meinem Großvater aus Lübeck kommt, und er mir immer von den Soldaten von Friedrich II. erzählte. Er war stolz, dass er seinen Führerschein noch in der Monarchie, unter dem Kaiser erwarb. Hitler ist was ganz anderes als die deutsche Philosophie und Kultur, erklärte er mir jedesmal. Mit meiner Schwester haben wir immer Angst gehabt vor den bösen Deutschen, obwohl unsere Eltern uns so etwas nie sagten. Ich wünschte, nach Deutschland zu kommen, um ein Mensch werden zu können, ich wollte nicht mehr Angst haben. Den Deutschen wollte ich zeigen, dass wir existieren, dass sie nicht gewonnen haben, uns nicht überwältigen konnten. Der Krieg war, obwohl schon lange zu Ende, weiterhin in unserem Kopf. Ich erinnere mich, einmal sahen wir mit meinem Großvater einen russischen Kriegsfilm in Budapest, und er fing an zu weinen. Als ich ihn fragte, warum, sagte er, wir haben den Krieg verloren. Wieso, wollte ich wissen, die Russen, die Engländer, die Amerikaner, die Franzosen haben doch den Krieg gewonnen? Nein, deine Großmutter wurde sterilisiert, und die Deutschen haben Kinder geschaffen, erklärte er verzweifelt. Meine Großmutter wurde als 26jährige deportiert, sie hat ihre Tochter - meine Mutter - auf den Straßen von Budapest zurückgelassen. Sie kam nach Bergen-Belsen und andere Lager und hat überlebt. Ihre Brüder aber sind in Sachsenhausen gestorben. Infolge des Numerus clausus, der Begrenzung von Studiermöglichkeiten für Juden, sind die Brüder noch in den 20er Jahren nach Frankreich ausgewandert. Aber als Strafe für ihr Engagement im spanischen Bürgerkrieg wurden sie aus Frankreich ausgewiesen. Sie gehörten zu den Ersten, die deportiert wurden. Als auch meine Großmutter an die Reihe kam, ließ sie ihre vierjährige Tochter deshalb allein, weil sie vergeblich versucht hatte, das Kind dem Roten Kreuz zu übergeben. Die ungarischen Hakenkreuzler meinten, sie könne sich die Mühe sparen, die Kinder würden sowieso ermordet. Meine Mutter hat einen Gedächtnisschwund aus dieser Zeit. Was in diesem einen Jahr mit ihr geschehen ist, weiß man, auch nach langjähriger psychotherapeutischer Behandlung nicht. Die Ereignisse lassen sich nur nach diesem Jahr rekonstruieren. Ein Passant hat in ihrem Mantel den Namen und die Adresse von ihrer Großmutter - meiner Urgroßmutter - Mária Schiffer gefunden. Die im Mantel angeführte Adresse befand sich im Ghetto. Zuerst wollte der Mann, der meine Mutter fand, das Kind behalten, und sie adoptieren. Er versuchte, ihr beizubringen, dass sie Mária Kovács heißen würde und seine Tochter sei, aber meine Mutter fing an zu schreien, „ich heiße Judit Weiss, ich bin Jude und möchte sterben, wie meine Eltern”. Da es sehr gefährlich gewesen wäre, dieses Kind bei sich zu haben, ist dieser Mann ins Ghetto gegangen - was auch mit großen Risiken verbunden war hat die Großmutter gefunden und ihr die Enkelin übergeben. Meine Mutter hat hinterher im Ghetto miterlebt, wie die einbrechenden ungarischen Faschisten die Nachbarn ermordeten, und für sie ist Budapest voll von solchen Erinnerungen. Mein Großvater hat die Deportation auch überlebt. Zuerst musste er Arbeitsdienst leisten Juden wurden dafür eingesetzt, Minen aufzulesen oder Schutzgräben auszuheben -, danach kam er auch ins KZ. Vor dem Krieg war er der fünftgrößte Weinhändler Ungarns. Beim Arbeitsdienst hat er sich als Koch ausgegeben, um seine Überlebenschancen zu vergrößern. Nach dem Krieg versuchte mein Großvater, das Geld, das er christlichen Freunden zur Aufbewahrung übergeben hatte, zurückzubekommen, aber niemand wollte von den erhaltenen Werten etwas wissen. Die Russen hätten ihnen alles geklaut, sagten sie. Die Bauern, mit denen er vor dem Krieg zusammenarbeitete, wussten, dass er pünktlich zahlt, deshalb haben sie ihm ihren Wein zur Verwertung übergeben. In zwei, drei Jahren hatte er seine Weinhandlung wieder etabliert. Nach der Nationalisierung von 1948 bekam er aber in Budapest als Großbürger Arbeitsverbot. Inzwischen hat er schon seinen Namen von Weiss auf Virág geändert, weil er vermeiden wollte, dass man ihn seines deutschen Namens wegen des Landes verweist. (Die ungarische Regierung beschloss 1946, die deutsche Minderheit, die sich, wie offiziell behauptet wurde, mit wenigen Ausnahmen schuldig gemacht hatte, zur Aussiedlung zu zwingen.) Der Großvater war aufs Land gegangen, dort brauchte man Leute, die sich mit den Traktoren auskannten. Obwohl er keine technische Ausbildung hatte, war er an Motoren interessiert und kannte sich auch aus. Er bekam eine Stelle in einer tsz (LPG), einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Nach Stalins Tod haben sich die Zustände etwas gebessert, er konnte wieder nach Budapest kommen. Um seinen Weinhandel von neuem betreiben zu können, hat er die Polizei bestochen. Als es 1956 zur ungarischen Revolution kam, waren meine Großeltern zu Anfang enthusiastisch. Sie glaubten, endlich würde Freiheit herrschen, keine Beschränkungen, keine fortwährende Angst. Als Bürgerliche mussten sie im kommunistischen System viel durchmachen. Auch meine Mutter war hoffnungsvoll, weil sie die Nachteile wegen des Berufs ihres Vaters miterlebt hatte. Aber als rechtsradikale, antisemitische Töne zu hören waren, die Leute schrieen, „nach den Kommunisten hängen wir die Juden auf”, ist meine Mutter in Panik geraten und wollte weg aus diesem Land. Sie war 17 Jahre alt. Ihre Eltern haben einen Lokomotivführer bestochen, sie wurde unter der Kohle versteckt. Mein Großvater hatte damals schon seinen ersten Herzinfarkt hinter sich und dachte, er wäre mit 56 Jahren zu alt, um ein neues Leben beginnen zu können. Meine Mutter kam zuerst nach Österreich, danach nach Paris. Sie hatte beschlossen, nicht mehr Jüdin sein zu wollen, auch die ungarischen Wurzeln zu vergessen und gab vor, Katholikin zu sein. Einen jüdischen Partner wollte sie auf keinen Fall. Da sie ein sehr hübsches Mädchen war, waren in der Synagoge in Budapest, wohin mein Großvater sie oft mitnahm, viele Männer von ihr angetan. Aber, wie sie mir erzählte, wenn ein jüdischer Mann ihre Hand berührte, war es ihr übel, weil sie sich vor sich selbst ekelte. Durch die furchtbaren Erfahrungen dachte sie, sie wäre ein Untermensch, sie dachte, sie hätte Schuld daran, dass ihre Eltern sie während des Krieges verlassen mussten, und dieses Schuldgefühl hat sie in sich hineingefressen. Als sie Budapest verließ, traf sie im Zug meinen Vater, der fliehen musste, weil er in Budapest am Aufstand teilgenommen hatte. Sie haben sich verliebt. Als Tochter eines Bürgerlichen hätte meine Mutter in Budapest nicht studieren können, obwohl sie sich immer gewünscht hatte, Ärztin zu werden. Sie ist dann in Paris Kinderärztin geworden. Trotzdem, was richtiges Glück ist, konnte sie nicht erleben. Als Neunzehnjährige war sie ein Jahr lang in einer Nervenheilanstalt. Sie hatte ununterbrochen das Gefühl, nicht atmen zu können, als würde sie sich selbst erwürgen. Die Angst aus der Kriegszeit ist zum Vorschein gekommen, und sie konnte es auch nicht verwinden, ihre Eltern verlassen zu haben. Zehn Jahre lang war sie in psychotherapeutischer Behandlung, nahm auch lange Zeit Medikamente. Mein Vater wusste nicht, dass seine Verlobte Jüdin war, sein Bruder klärte ihn darüber auf. Als er ihm geschrieben hatte, er würde ein wunderschönes ungarisches Mädchen heiraten, mit glänzendem schwarzem Haar, und der Bruder sollte Papiere besorgen, bekam er die Antwort, „deine wunderschöne Braut ist eine schmutzige Jüdin, du darfst sie nicht heiraten”. Mein Vater, für den sein Bruder über viele Jahre ein Vorbild war, sagte daraufhin die Hochzeit ab. Aber die Liebe hat gesiegt, nach 4 Monaten haben sie dann 1960 doch geheiratet. Der Bruder änderte übrigens seine Ansichten nie, als mein zweites Kind geboren wurde, hat er nur angemerkt, wieder ein Jude mehr auf dieser Welt. Die Mutter meines Vaters hat von dieser Heirat nicht abgeraten. Sie hat immer betont, sie wäre eine adlige Ungarin, aber mir auch erzählt, wie schlimm es gewesen ist, als die Juden aus ihrem Dorf deportiert wurden. Es waren ja ihre Schulkameraden. Mein Vater vertrat rechtsradikale, chauvinistische Ansichten, er hat versucht, auch mich in diesem Sinne zu erziehen. „Steht auf ihr Ungarn, das Vaterland wartet auf Euch”, pflegte er zu sagen, die Gebietsverluste, die die Siegermächte nach dem zweiten Weltkrieg Ungarn wieder aufgebürdet haben, konnte er nicht verwinden. Als Vierjähriger musste ich meinem Vater versprechen, dass ich alles tun werde, um Transsylvanien zurückzuerobern. Es war ein langer Prozess, bis mein Vater aus einem rechtsradikalen Antisemiten ein liberal denkender Mensch, Freimaurer geworden ist. Er, ein protestantischer Kleinadeliger hat es über Jahre hinweg nicht akzeptieren können, dass sein Sohn so jüdisch ist. Als Kleinkind hat er mich deshalb auch oft geschlagen. Einmal nahm mich mein Vater zur Seite, wir müssen wie Mann zu Mann sprechen, sagte er, und ich war glücklich, dass er sich einmal mit mir ausspricht. Weißt du, sagte er, die Juden haben Jesus Christus gekreuzigt, deshalb habe ich deinem Großvater verboten, mit Euch zu beten. Dieser Druck von meinem Vater hat mein Interesse für das Jüdische nur noch verstärkt. Meine ältere Schwester reagierte anders: sie ist Katholikin geworden und hat in eine rechtsradikale französische Familie hineingeheiratet. Die kleine Schwester nahm einen jüdischen Mann zum Ehemann. Hiermit entsprach sie dem Wunsch meiner Mutter. Zwar hat sich mein Vater immer erträumt, dass seine Kinder gute Christen werden, aber meine Mutter schloss sich mit meiner kleinen Schwester ein und flehte sie an, wenn sie einmal heiratet, dürfe ihr Mann nur ein Jude sein. Ich habe eine nichtjüdische Frau geheiratet. Gewünscht habe ich nie, dass meine protestantische Frau übertritt, weil ich zu religiös dafür bin. Meiner Meinung nach hat man entweder eine jüdische Seele, oder man hat sie nicht. Damals, in Paris wurde ich, genauso wie meine zwei Geschwister, getauft. Meine Mutter dachte, auf diese Weise wären wir sicher, sollten wieder einmal die Nazis das Sagen haben. Obwohl meine Mutter nichts mit ihrem Judentum zu tun haben wollte, hat sie jeden Sabbat über uns gebetet. Mein Vater wusste das zwar, sagte aber nichts dagegen. Beide Eltern haben früh gelernt, von bestimmten Dingen nicht zu sprechen. Sie unterhielten sich über Poesie, Philosophie, das gesellschaftliche Leben, über tagtägliche Angelegenheiten der Familie, aber darüber, was sie in sich verborgen haben, sprachen sie nicht. Vielleicht ist das bei meinem Vater das protestantisch-adlige Erbe, seine Mutter hat es nie geschafft, zu ihrem Sohn zu sagen, ich liebe dich. Das religiöse Judentum, das meine Mutter mitgeprägt hat, spricht auch nicht alles aus. Ganz intime Sachen werden miteinander nicht beredet. Zum ersten Mal schickten mich meine Eltern mit anderthalb Jahren nach Ungarn, danach habe ich alle Ferien dort verbracht, vor allem bei den Eltern meiner Mutter. Meine Großeltern nahmen mich immer in die Synagoge mit. Die Ferien verbrachte ich deshalb regelmäßig in Ungarn, damit ich gut Ungarisch lerne. Mein Vater hat uns verboten, zu Hause französisch zu sprechen, wir hatten immer ungarische Kindermädchen bei uns. Meine Mutter wollte auch, dass ich die ungarische Jugendbewegung kennenlerne. Als Sechsjähriger kam ich in ein Ferienlager in Balatonlelle, das für Kinder von Auslandsungarn eingerichtet war. Die Lehrer fragten mich, ob ich Jude sei, weil ich so dunkle Haare hätte. Das war meine erste Konfrontation mit dem ungarischen Antisemitismus. Vielleicht dachten sie, sie könnten sich so etwas erlauben, weil wir aus dem Westen kamen, also Kinder von Verrätern waren. Wenn ich es meiner Mutter erzählt hätte, würde sie bestimmt die Lehrer angezeigt und ihnen sicher große Schwierigkeiten bereitet haben. Meine Antwort war damals, ich bin nicht Jude. Danach habe ich Alpträume gehabt, weil ich das Gefühl hatte, mich selbst verraten zu haben. Mit den Großeltern besprach ich, als ich noch sehr klein war, wir sagen den Nachbarn nicht, dass wir jüdisch sind. Aber sie wussten es, obwohl wir den Vorhang immer zuzogen, wenn wir Sabbat feierten. Die Kippas, die jüdische Kopfbedeckung setzten wir immer vor der Synagoge unter die Mütze oder den Hut auf. Trotz dieser Erfahrungen war ich immer traurig, wenn ich von Budapest nach Paris heimfuhr. Mein Vater war aggressiv zu mir. Bei den anderen Geschwistern war es kein Problem für ihn, aber dass gerade sein Sohn dem Aussehen nach so jüdisch ist, das war zu viel für ihn. Von meiner Mutter akzeptierte er alles, er hat sie geachtet wegen ihrer Bildung und war von ihrer Schönheit hingerissen. Zwar war er oft wütend auf sie, aber zugleich sehr verliebt in sie. Meine Mutter brauchte die ständige Angst, an die sie sich als Kind gewöhnt hatte. Vielleicht war das der Grund, dass sie einen Antisemiten geheiratet hat. Sie provozierte meinen Vater, damit sie um mich Angst haben musste, das gehörte zu ihrem Wohlbefinden. Erst sehr spät habe ich das verstanden, als ich schon seit Jahren nicht mehr zu Hause lebte. Vorher dachte ich, nur mein Vater hatte Schuld. Aber meine Eltern haben einen komplizierten Zusammenhalt. Wenn meine Mutter nicht da ist, habe ich heute einen guten Kontakt zu meinem Vater. Er ist Ingenieur, er wirkte am Bau der Pyramide des Louvre mit. Ich bin ein religiöser Jude, das heißt auch, wir müssen unsere Eltern respektieren, wir müssen sie nicht lieben, das ist etwas anderes, aber ich respektiere meinen Vater. Als ich beschloss, nach Deutschland überzusiedeln, war es wichtig für mich, zu zeigen, ich komme zurück, ich male hier. Die Augen auf meinen Bildern sind sehr groß, eine Typisierung vom Judentum, die Themen sind da, und die Deutschen können uns nicht vergessen. Noch vor der Wende bin ich nach Deutschland gekommen. Meine erste Verlobte lebte in der DDR, ich habe sie kennen gelernt, als ich sechzehn war, und durch unsere Verbindung war ich ständig in der DDR. Es war auch das Gefühl, ich könnte Rache üben, denn in der DDR war man geblendet von allem, was aus dem Westen kam. Ich habe den Bekannten erzählt, nichts von ihren Träumen würde stimmen, der Westen wäre noch schlimmer als die DDR. Sie konnten nicht reisen, deshalb haben sie geträumt, und ich nahm ihnen diese Träume. Wir leben auch in einer Art Totalitarismus, sagte ich ihnen, was ihr im Fernsehen seht, ist nur Propaganda. Mit der Verlobten habe ich eine Art Hass-Liebe gehabt, es regte mich ungemein an, dass sie aus einer preußischen Ritterfamilie stammte. In der DDR waren die Leute nicht entnazifiziert, - der Staat ja -, aber nicht die Menschen. Sie waren so stolz, Deutsche zu sein. Die jungen Westdeutschen wollten nichts von dem Krieg wissen, aber die Ostdeutschen waren stolz auf ihre Großeltern. Für mich war der Aufenthalt in der DDR, als würde ich das Schicksal meiner Großeltern dem ihrer Großeltern gegenüber stellen. Mit 23 Jahren erhielt ich die Aufenthaltsgenehmigung für die DDR. Ich wollte unbedingt in Berlin leben, dort hatte ja in Wirklichkeit der Nationalsozialismus angefangen. Von der deutschen Kultur fühle ich mich sehr angezogen, genauso wie von der französischen oder der ungarischen. Das ist mein europäisches Kulturerbe. Für mich ist zum Beispiel Moses Mendelssohn eine hervorragende Gestalt der deutschen Kultur. Die nicht jüdischen Kulturgrößen sind mir weniger interessant, aber ich finde auch die Literatur von Robert Musil wunderbar. Als Maler steht mir zum Beispiel die Wiener jüdische Schule auch emotional viel näher, als Caspar David Friedrich. Weil ich jüdisch bin und Kosmopolit, fühle ich mich vielleicht den Menschen, die diese Art von Kultur vertreten, viel näher. Als ich aus Paris wegging, hatte ich als Künstler schon einen Namen, und viele haben nicht verstanden, warum ich das Land verlasse. Aber ich musste etwas erleben, mich selbst finden, meine Identität, und dazu brauchte ich Deutschland. Ost-Berlin war für mich etwas, wo ich weder im Osten, noch im Westen war, etwas dazwischen. Seitdem ich erwachsen bin, weiß ich auch, ich bin immer zu Hause, in Budapest, in Berlin, in Paris, oder auch in Spanien, wo ich eine Wohnung habe, wo mir etwas gehört. Dass ich so religiös geworden bin, hing mit meinen Großeltern zusammen. Meine Großmutter wurde während des Krieges sterilisiert, so hat mein Großvater mir erklärt, ich sei sein einziger „Sohn”, und wenn er nicht mehr beten kann für seine Vorfahren, müsse ich es tun. Ich war zwölf, als er gestorben ist. Als ich es in Paris erfuhr, habe ich eine Kerze angezündet und versucht, mit den paar Brocken Hebräisch, die ich konnte, zu beten. Jetzt muss ich an seiner Stelle weitermachen, das wusste ich. In der Synagoge suchte ich einen Lehrer, damit ich das Notwendige lernen kann, ich war auch bei den Lubawitschern. Meine Eltern haben einen Schreck bekommen, als ich im Alter von 13 Jahren erklärte, von nun an esse ich koscher wie mein Großvater. Ich war 23, als ich von zu Hause wegging, besser gesagt, ich war hinausgeworfen worden. Leider hat das meine Mutter mitgetragen - auch darin zeigte sich, wie widersprüchlich ihre Persönlichkeit ist. Hundertprozentig wird sie nie gesund werden, denke ich, sie hat weiterhin Angstgefühle. Sie verdrängt viel, und glaubt, was ihr nicht gefällt, existiert nicht. Auch ich habe Probleme mit mir selbst, ich habe Schwierigkeiten, mich selbst zu ertragen, in diesem Sinne bin ich nicht viel anders als meine Mutter. Als Kind wünschte ich immer blond und blauäugig zu sein, ich ekelte mich vor meinem Aussehen. Heute akzeptiere ich mich. Ich bin, was ich bin. Vor allem, erwachsen. Das bedeutet auch Verantwortung für unsere Taten. Manche haben das Glück, eine jüdische Frau zu haben, die ein jüdisches Kind zur Welt bringt, andere müssen den schwierigeren Weg gehen. Meiner Meinung nach muss man die Sache verdienen, nicht einfach bekommen. Ich muss ein guter Vater sein, deshalb nehme ich mir sehr viel Zeit für meine Kinder. Mein Sohn ist zweieinhalb Jahre alt, meine Tochter wurde vor fünf Wochen geboren. Ich versuche, ihnen mein eigenes Erbe interessant zu machen, aber sie müssen über das Erbe selbst nachforschen, um selbst jüdisch zu werden, wenn sie das wollen. Dass sie einen anderen Weg gehen, kann ich mir auch vorstellen. Ich selbst habe Angst vor Gott, ich lese die Thora, beschäftige mich viel mit Religion. Meine Aufgabe ist es, etwas weiterzugeben. Ich besitze eine Thorarolle aus dem 14. Jahrhundert aus Lübeck, die ein Vorfahre vor dem Pogrom rettete, und sehr viele Bücher. Von meiner Urgroßmutter, Mária Schiffer, zu der meine Mutter im Ghetto gebracht wurde, habe ich viele deutsche Bücher geerbt, alle Seitenränder sind vergoldet. Die Schiffer-Familie waren deutsche Juden, sehr gebildet, wohlhabend, großbürgerlich. Die Schiffers sind auch heutzutage eine bekannte Familie in Ungarn. Ihr entstammt der namhafte Regisseur, Pál Schiffer und der Vizebürgermeister von Budapest, János Schiffer. Die Thorarolle und die Bücher gebe ich dem weiter, der sich mehr dafür interessiert, sei es mein Sohn oder der Sohn meiner Schwester, oder der von meiner Cousine. Selbstverständlich hoffe ich, dass es mein Sohn sein wird, der das Erbe weiterführt, aber wenn er nicht will, darf es keine Pflicht sein. Mit meiner deutschen Frau spreche ich nur französisch, so steht die deutsche Problematik nicht zwischen uns. Sie hat an der Sorbonne Französisch, Musik und Kunstgeschichte studiert. Wenn ich französisch denke, bin ich ein anderer Mensch, da jede Sprache ihre eigene Ebene hat. Wenn man mit mehreren Sprachen aufwächst, ist es, als hätte man verschiedene Gesichter. Die Gesichter, die wir in uns tragen, entfalten sich. Wenn ich französisch spreche, fühle ich mich ganz Franzose, aber wenn ich nur französisch spreche, kann ich einen Teil meines Lebens nicht erklären. Den ungarischen Teil meines Wesens zum Beispiel kann ich dann den Menschen, mit denen ich mich unterhalte, nicht vermitteln. Für mich war es sehr wichtig, dass meine Frau ungarisch lernt. Jetzt versteht sie die Sprache. Wenn man verliebt ist, ist es nicht das Wichtigste, ob der Partner jüdisch ist. Die Intelligenz war mir bedeutsamer als die Herkunft. Meine Frau ist sehr involviert in mein Judentum, sie geht mehr in die Synagoge als in die Kirche und unterstützt auch mein gesellschaftliches Engagement. Ich bin, genauso wie mein Großvater, neolog. Zwar lernte ich bei den Orthodoxen, den Lubawitschern, aber für mich waren sie zu sehr Christen. Sie haben überall das Bild von dem Rebbe, und es ist für mich störend, einen Menschen so zu ehren. Ich ehre nur den Ewigen. In Deutschland habe ich weniger Probleme wegen meiner Abstammung gehabt als in anderen Ländern, in Ungarn oder in Frankreich. In Ungarn sagte mir zum Beispiel vor sechs Jahren ein Taxifahrer, er nehme keinen Juden mit. Das Schweigen akzeptiere ich nicht in meinem eigenen Leben, wenn man die Probleme ausspricht, hat man eine größere Chance, sie zu lösen. Meine Kinder möchte ich lehren, sie selbst zu sein. Für Leute, die im Ausland leben, ist es immer schwierig, ihr kulturelles Erbe erhalten zu können, sie müssen viel mehr tun, um es auch ihren Kindern vermitteln zu können. In Paris bin ich in einer ungarischen Umgebung aufgewachsen, wir mussten uns mit dem Problem auseinander setzen, dass wir als Ausländer schlecht angesehen waren. Deshalb hat sich mein Vater abgesondert, sich nur mit Ungarn umgeben. In der Schule steckte man mich zum Beispiel in der Klasse in die letzte Reihe, als Ausländer, ebenso wie die Nordafrikaner. In Deutschland war es wichtig für mich, nicht dieses ghettoisierte Leben fortzuführen. Ich bin sehr aktiv in der Stadt Berlin, betätige mich als gewählter Kulturbeauftragter in meinem Stadtteil, dem Bezirk Tiergarten, ich arbeite in der Künstlergewerkschaft mit und bin aktiv in meinem Judentum. Das ist mir sehr wichtig, ich möchte das Land, wo ich lebe, nicht nur akzeptieren, sondern auch aktiv mitgestalten. Der innere Zwang einer politischen, aber auch künstlerischen Stellungnahme zu besorgniserregenden Ereignissen der Gegenwart, und zugleich der Versuch, neue Formen der Erinnerung zu finden, hat mich 1991 veranlasst, die Gruppe „Meshulash” zu gründen. Es war gleich nach den ersten rechtsradikalen Ausschreitungen in Deutschland, in Rostock. Als dort ein Ausländerheim angegriffen worden war, habe ich wieder angefangen, Angst zu haben. Ich sagte zu mir, wir können doch nicht wieder weggehen, wir müssen reagieren. Unsere Gruppe organisierte Kundgebungen, Plakataktionen und demonstrierte auch für die Spiegelwand in Steglitz, damit den Steglitzer Juden, die deportiert wurden, ein Denkmal errichtet wird. Es war eine Initiative von einigen Architekten und von den Grünen, aber sie waren in der Minderheit, die CDU und die Rechten in Steglitz wollten es verhindern. Meshulash hat 15 Mitglieder, sie müssen nicht jüdisch sein, nur an der jüdischen Sache interessiert sein. Aber nur, wenn das Interesse wirklich tief ist, mehr als eine vorübergehende Neugier. Die Gruppe besteht nicht nur aus Zuwanderern, auch deutsche Juden sind mit dabei. Ich glaube, die deutschen Juden haben mehr Angst, vielleicht brauchten sie die Impulse von außen. Vor 5 Jahren haben wir mit Meshulash die Besetzung der Neuen Wache organisiert, uns dort angekettet, um dagegen zu protestieren, dass das Mahnmal den Opfern und Tätern gleichermassen gewidmet werden soll. Wegen Landfriedensbruch hat man hat uns einen Prozess angehängt. Natürlich war es klar, das wir die neue Funktion des Gebäudes nicht verhindern können, aber wir wollten ein Zeichen setzen, zeigen, dass es nicht von allen Bürgern akzeptiert wird. Dieser Protest hatte auch etwas mit meiner Erziehung zu tun, etwas typisch Ungarisches: mein Vater sagte immer, die Ungarn sind nie so großartig, als wenn sie wissen, sie werden verlieren. So viel aber haben wir erreicht, dass andere Länder, wie Frankreich und Schweden, nicht ihre Kränze dort niederlegten. Beim Hotel Kempinski haben wir ein Jahr lang mit Transparenten ausgeharrt, um darauf aufmerksam zu machen, dass das Hotel nicht mehr ein jüdisches sondern ein arisiertes Hotel ist, es wurde der Familie nie zurückerstattet. Wir solidarisierten uns mit der Kempinski Familie, wir wollten erreichen, dass eine Tafel an das Gebäude angebracht wird, auf der steht, dass es keine jüdische Hotelkette ist. Denn man hat für das Hotel Reklame gemacht mit der Behauptung, es wäre eine alte, renommierte jüdische Kette; man veranstaltete jüdische Hochzeiten, um diesen Eindruck zu verstärken. Wir fanden es unerhört, dass die neuen Besitzer auch noch den Namen auszuschlachten versuchen. Jetzt sieht man endlich diese Tafel, 40 mal 30 cm groß, an der Ecke von Kempinski, auf der steht, das Hotel wurde zu den Nazizeiten arisiert. Die Hotelverwaltung musste nachgeben, ihr war es nämlich vor den Gästen sehr peinlich, dass wir dort jede Woche demonstrierten. Als das Asylgesetz geändert worden ist, haben wir Politikerköpfe aus der Zeitung ausgeschnitten, Plakate gemacht, und darauf gestempelt: Asylantrag abgelehnt. Und in Marzahn, Friedrichshain, im Märkischen Viertel, wo viele Rechtsradikale leben, klebten wir diese an. Einen deutschen Pass habe ich mir neben der französischen und der ungarischen Staatsbürgerschaft nie gewünscht. Was geschehen ist, liegt noch zu nah zu meiner Generation. Aber meine Kinder haben schon alle drei Staatsangehörigkeiten. Ich bin ein typisches europäisches Produkt, welches versucht, seine eigene, familiäre Geschichte klar zu sehen: wo ich stehe, was ich bin, wohin ich gehe. Wenn die Europäer in sich hineinschauen, werden die meisten, glaube ich, viele Seiten ihrer Herkunft entdecken wir sind nicht monolithisch. Obwohl ich noch in Paris in zionistischen Kreisen mitarbeitete, habe ich nie gewünscht, nach Israel zu gehen, da ich mich als Europäer fühle. Es gibt dort zu viele arabische Länder rundherum, und die muslimische Kultur ist zwar sehr interessant, aber Wien oder Rom, die Pinakothek oder der Prado ziehen mich mehr an, entsprechen mehr meinem eigenen Interesse. In Israel leiden Familienangehörige, die Musiker sind, darunter, dass es ringsum nicht so viele Opern gibt wie in der geographischen Umgebung von Budapest. Man kann in Prag, in Wien in die Oper gehen, oder in Bayreuth. Ich war in Israel, es ist wunderschön, es ist ein Stück Mitteleuropa in Westasien. Dort habe ich meine Familie getroffen, ungarisch gesprochen und sehr viel Gulasch gegessen, aber ich war nur kurz dort. Die Kunst ist uns deshalb so wichtig in Meshulash, weil es die einfachste Lösung ist, etwas zu vermitteln. Es ist effektiv, weil wir etwas versinnlichen. Dieses Jahr ist „Das jüdische Zentrallabyrinth” schon unsere zweite Ausstellung, die stattfindet. Wir versuchen den Menschen zu erklären, dass es in Deutschland eine Pluralität gibt. Die jüdische Art zu denken, bedeutet, man hat ein anderes Maß der Wahrnehmung. Die Christen, Moslems und jede Gruppe können die Welt vielfältig sehen, begreifen. Wir möchten zur Kenntnis bringen, dass hier ein Judentum existiert, mit anderen Bräuchen und mit einer anderen Art zu leben. Ihre Vertreter aber gehören genauso in dieses Land, wie alle Minderheiten und sie sollten akzeptiert werden. Mit meinen Bildern will ich nicht erklären, sondern ich probiere die Gefühle der Vielfalt zu vermitteln: dass die Menschen oft schrecklich, aber auch grossartig sind. Es gibt nichts Schöneres als die Schöpfung. Ich bewundere jeden Tag diese Vielfalt und bin glücklich, dass ich leben kann. Gaby Nonhoff „Erst als ich mich endgültig dafür entschied, in Deutschland zu bleiben, fing ich an, die Traditionen richtig zu leben” Gaby Nonhoff ist in Wien geboren und kam im Alter von vier Jahren nach Israel. Die Eltern fühlten sich auch im neuen Österreich nicht wohl und beschlossen, Familienmitgliedern die schon früher nach Israel auswanderten, zu folgen. Die heute 52jährige wuchs in einem kleinen Dorf auf. Die Welt eröffnete sich vor ihr erst als sie 20 wurde. Zu ihrem Geburtstag wurde ein Traum wahr: die Eltern schenkten ihr eine Reise nach Europa. Eigentlich wollte sie spätestens nach zwei Jahren nach Israel zurückkehren, aber in Berlin hat sie sich verliebt und geheiratet. Über zwei Jahrzehnte hinweg hegte sie den anderen großen Traum, wieder in Israel zu leben, aber ihr Mann hat sein Versprechen nicht gehalten. Sie hat eine schwere Zeit hinter sich. Ihre Wohnung ist ihre Heimat, dort fühlt sie sich sicher. Bis kurz vor dem Fall der Mauer habe ich in Berlin auf gepackten Koffern gelebt. Fast 20 Jahre lang. Nicht aus Angst oder Unsicherheit wegen der möglichen Entwicklungen in Deutschland, sondern weil ich unentwegt hoffte, mit Mann und Kindern nach Israel, zurück zu meinen Eltern ziehen zu können. Bevor wir heirateten, hatte mir das mein Mann fest versprochen. Seinem gegebenen Wort schenkte ich leider Glauben. Den Wunsch, den alten Kontinent kennen zu lernen, hegte ich lange, weil ich mich in Israel wie „auf einer Insel” eingeschlossen fühlte”. Rundherum gab es nur die arabischen „Feinde” und im Westen das Meer. Das war alles, was ich kannte. Ich stellte mir immer vor, wieder einmal nach Wien gehen zu können. Mein Vater hatte Sehnsucht nach Wien, von wo er ursprünglich herkam. Er erzählte oft vom Wiener Wald, aber auch ich hatte Erinnerungen aus den ersten vier Jahren meines Lebens, die ich dort verbrachte. Mit einem One-Way-Ticket und 200 Dollar in der Tasche machte mich also auf die Reise. Aber die Lust auf Abenteuer ist mir schnell vergangen. Kaum legte das Schiff ab, wollte ich schon zurück. Mir wurde bewusst, dass ich für zwei Jahre von zu Hause weg sein werde. Israel war meine Heimat und ich fühlte mich dort wohl. Natürlich kam es nicht in Frage, von Bord zu gehen. So landete ich nach einer langen Fahrt in Wien. Alles schien mir riesig, da ich aus einem kleinen Dorf kam. Ich besichtigte die Stadt, sah mir die umliegende Landschaft an, und suchte die Freunde meiner Eltern auf. Nach vier Wochen fuhr ich nach Berlin, wo ich eine Cousine hatte. Sofort wollte ich beginnen, zu arbeiten, aber dazu brauchte ich zuerst eine Aufenthaltsgenehmigung. Diese konnte man nur an einer Botschaft außerhalb Deutschlands beantragen. Nach einem Monat fuhr ich deshalb nach Brüssel. Zwar hätte ich den deutschen Behörden sagen können, dass ich Jüdin bin und meine Mutter in Deutschland geboren wurde, aber ich wollte meiner Herkunft wegen keine Bevorzugung. Ich hatte etwas dagegen, dass man mir den roten Teppich ausrollt. Die österreichische Staatsangehörigkeit, die ich besass, genügte mir. Später einmal, 1970 wollte ich doch den deutschen Pass bekommen. Beim Übergang in die DDR mussten die Westdeutschen, die Westberliner und die Ausländer jeweils eine andere Grenzstelle benutzen. Um mit meinem Mann zusammen gehen zu können, habe ich die deutsche Staatsangehörigkeit beantragt. Ich erhielt die Antwort: „Diese Tricks kennen wir. Erst heiraten, dann die Staatsangehörigkeit beantragen, um in Deutschland bleiben zu können.” Seitdem versuchte ich nie wieder, den deutschen Pass zu erhalten. Auch heute noch habe ich die österreichische Staatsangehörigkeit. In Berlin wollte ich deshalb so schnell anfangen zu arbeiten, weil ich vorhatte, auch noch nach Holland, Frankreich und England zu fahren und dafür brauchte ich Geld. Ich arbeitete in einem Blumenladen. Dann lernte ich meinen Mann kennen und mit den Träumen, Europa weiter zu entdecken, war es vorbei. Eigentlich wollte ich unsere Beziehung abbrechen. Ich sagte ihm, ich wollte einen jüdischen Mann heiraten und in Israel leben. Er versprach mir, zum Judentum überzutreten und nach Israel mitzukommen. Wir haben dann 1970 geheiratet. Aus seinen Versprechungen wurde aber nichts. Erst hörte mein Mann mit dem Unterricht auf, den man besuchen muss, um konvertieren zu können. Die Rückkehr nach Israel hat sich immer wieder verschoben. Ich aber wollte mich nicht hier in Berlin etablieren und hoffte im stillen immer noch, wir würden bald nach Israel ziehen. Meine Koffer packte ich erst 1988 aus, obwohl ich eigentlich schon früher zur Kenntnis nahm, dass wir in Berlin bleiben werden. Meinen Wünschen konnte ich nicht nachgeben, weil ich auf meine Kinder Rücksicht nehmen musste, die die ganze Zeit über in Deutschland gelebt hatten. 1971 ist mein Sohn geboren, drei Jahre später meine Tochter. Als ich nach Deutschland kam, kannte ich die Geschichte meiner Eltern noch nicht in allen Einzelheiten. Die Eltern sprachen nicht über ihre Kriegserlebnisse, sagten nur, dass unsere Nachbarn im Dorf viel mehr als sie gelitten hatten. Damals fragte ich nicht weiter, weil mir der Eindruck vermittelt wurde, dass unsere Familie glimpflich davon kam. Ich muss schon 30 gewesen sein, als ich über das Schicksal meiner Eltern erfuhr. Meine Mutter flüchtete mit ihrer Familie vor der Kristallnacht, im September 1938 aus Frankfurt zuerst nach Strassburg, danach in den Süden Frankreichs. Die Eltern meiner Mutter sind in Frankfurt großgeworden, kamen aber aus Polen: die Großmutter aus Oswiecim (Auschwitz). Meine Mutter, die 1923 geboren wurde, hatte noch eine Schwester und einen Bruder. Ihr Vater brachte die Familie in Frankreich in einem Sanatorium für Tuberkulosekranke unter, auf diese Weise konnten sie der Deportation entkommen. Die Eltern meines Vaters sind aus der Slowakei, aus Kúty nach Wien gezogen. Es gab acht Kinder in der Familie, vier Jungen und vier Mädchen. Mein Vater war Kommunist, er ging 1936 nach Spanien, um in den Internationalen Brigaden zu kämpfen. Da war er gerade 20 Jahre alt. Nach der Niederlage der Republikaner wurde für die Spanienkämpfer, die nach Frankreich flüchteten in Gurs ein Internierungslager eingerichtet. Aus dem Lager wurde mein Vater 1940, nach der Besetzung Frankreichs freigelassen, mit der Auflage, dass er sich täglich bei der Kommandantur der Deutschen in Paris zu melden hat. Er meldete sich einmal, dann ging er in den Untergrund. Ein großer Teil seiner Familie flüchtete nach dem Anschluss Österreichs aus Wien nach Brüssel, eine Schwester nach England. Von Brüssel aus wurden die drei Brüder auch nach Gurs gebracht, einer von ihnen starb an Typhus. Zwei Schwestern haben mit großem Glück in Brüssel überlebt, sie wechselten ständig die Wohnung. Aber die vierte Schwester wollte nicht mehr im Versteck leben und dachte, wenn die Juden zur Arbeit gebracht werden, kann es ja nicht so schlimm sein. Auf die Warnung von Familienmitgliedern hörte sie nicht und ging mit einem Transport nach Auschwitz mit. Sie wurde nie wieder gesehen. Nach dem Krieg arbeiteten meine Eltern beide in einem Waisenhaus von Rothschild bei Paris. Sie betreuten Kinder, die aus Konzentrationslagern kamen. Meine Mutter arbeitete als Krankenschwester, mein Vater als Sportlehrer. Sie lernten sich dort kennen. Meine Eltern haben 1946 geheiratet und gingen nach Wien, weil der Vater unbedingt am Aufbau des neuen Österreichs mitwirken wollte. Er war Mitglied der Kommunistischen Partei Österreichs und sass sogar für die Partei im Gefängnis. Der Handel, den er im Auftrag der österreichischen Kommunisten, unter Obhut der Russen mit Bulgarien betrieb, entlarvte sich nämlich als Betrug. Als ich 1948 geboren wurde, sass er für Bruch der Gesetze hinter Gittern. Mein Bruder kam ein Jahr früher auf die Welt. Die Freiheitsstrafe wäre aber für meinen Vater kein Grund dafür gewesen, Österreich zu verlassen. Es war der Willen meiner Mutter, die wieder Zeichen des Antisemitismus spürte. Als sie Geld für Keren Hayessod sammelte, die Organisation, die Israel unterstützte, fragte eine Frau: „Was, sie haben überlebt?” Zuerst dachte meine Mutter, diese Frau würde sie kennen, und fragte, woher. Da antwortete sie: „Man erkennt euch gleich wieder. Sie sind Jüdin.” Das war ein prägendes Erlebnis für sie. Da ihre Familie in Israel lebte, drängte sie meinen Vater dazu, ihnen zu folgen. So wanderten wir 1952 nach Israel aus. Meine Mutter war auch links eingestellt, aber nicht Kommunistin Sie war Mitglied der Mapam, der Partei, die links von der Arbeiterpartei stand. Der Vater wurde Mitglied der Kommunistischen Partei Israels, und blieb bis zum Prager Frühling darin. Eigentlich hätte er schon 1956, als es zum Aufstand in Ungarn kam, austreten müssen. Aber er war nicht genügend informiert. Aufgrund der deutschen Zeitung, die in Israel gedruckt wurde, konnte er sich kein richtiges Bild von den Ereignissen in Osteuropa bilden. Zweimal am Tage gab es zwar im Rundfunk Nachrichten in Französisch, aber im Dorf, wo wir lebten, bekamen wir erst 1957 Elektrizität. Als wir nach Israel gingen, wohnten wir zuerst mit den Großeltern, den Eltern meiner Mutter, und ihren Geschwistern in Jerusalem. Unserem Haus gegenüber konnten wir hinter Sandsäcken die jordanischen Soldaten sehen. Mein Vater arbeitete in einer Nervenheilanstalt als Pfleger, das war aber zu belastend für ihn, so beschloss er, in die Landwirtschaft zu gehen. In dem Dorf, Gea bei Ashkelon, wo wir hinzogen, gab es viele Tschechen, Slowaken aber auch deutschsprechende Bewohner, deshalb hat er sich diesen Ort ausgewählt. Vom Staat bekamen wir ein Haus von 24 Quadratmetern, eine Kuh, zwei Hühner und mit dem Nachbarn zusammen ein Pferd. Am Anfang war das alles, was wir hatten und wir kamen als vierköpfige Familie noch gut dabei weg. Einige Familien wohnten mit acht Kindern auf 24 Quadratmetern. Mein Vater arbeitete 7 Tage die Woche, von morgens bis spät abends. Ich glaube nicht, dass er sich als Landwirt sehr wohl fühlte, er war ein philosophischer Mensch, der gern und sehr witzig schrieb. Er war mein Gott. Immer ergriff ich Partei für ihn, wenn meine Mutter mit ihm schimpfte. Erst später wurde mir bewusst, dass meine Mutter die dominante Person war. Im nachhinein denke ich, das muss mit der Grund gewesen sein dafür, dass ich den Vater in Schutz nahm. Zu Hause haben wir nur deutsch gesprochen.. Bei uns im Dorf hat man alles gesprochen, nur nicht Hebräisch. Als ich zur Schule kam, konnte ich mich schon auf tschechisch und auf ungarisch verständigen. Hebräisch habe ich erst dort gelernt. Bis zur 7. Klasse gab es eine Dorfschule, dann wurden wir in eine Kreisstadt gebracht. Als die Zeit der weiterführenden Schule kam, hatte ich keine Wahl. Damals, im Pionierzeitalter Israels gab es die Regelung, dass Kinder, die auf dem Dorf wohnten, auf eine Agrarschule gehen mussten. Die Agrarschule habe ich aber nicht lange besucht. Noch in der ersten Klasse flog ich raus, da ich ein loses Mundwerk hatte. Mit dem Stoff kam ich nicht mit. Bis zur 8. Klasse hat - mit einer Ausnahme - kein Lehrer gemerkt, dass ich nicht lesen kann. Bis dahin konnte ich die halbe Bibel auswendig, ich verstand und speicherte alles. Dann wurde aber die Materie zu groß. Ich bin nämlich Legasthenikerin. Auch heute muss ich beim Lesen die Wörter mit dem Finger verfolgen, um sie nicht zu überspringen. Ich war in der 3. Klasse, als eine Lehrerin zu meiner Mutter sagte, sie müsste mit mir laut lesen. Sie setzte sich neben mich, konnte aber kein Hebräisch und ich las ihr irgendwelche Geschichten vor, die gar nicht im Buch standen. Als ich dann in der Agrarschule war und ein Lehrer mich aufforderte: „Wenn du nicht lesen willst, geh aus der Klasse”, sagte ich ihm meine Meinung. Fluchen konnte ich in verschiedenen Sprachen sehr gut, ich lernte es von den Nachbarkindern. Der Lehrer kam aber aus der gleichen Umgebung, verstand also alles. Keine andere Schule hat mich genommen. In Schreibmaschineschreiben und Jugendarbeit machte ich Kurse, hatte aber keine richtige Ausbildung. Arbeit finden konnte ich auch nicht, die 60-er Jahre waren eine schwere Zeit. Man sagte mir am Arbeitssamt, ich komme vom Land, dort gibt es genug Arbeit. So führte ich zu Hause den Haushalt, und meine Mutter half auf dem Feld mit. Das ging so bis zu meinem 20. Lebensjahr. Das Führen des Haushalts war auch in Berlin über 12 Jahre hinweg meine Aufgabe. Ich war immer zu Hause, ich bin nicht ins Kino oder ins Theater gekommen und das fehlte mir sehr. Mein Mann wollte die Kinder nicht allein lassen und auch keinen Babysitter nehmen. An den Wochenenden kam er auch nicht mit uns zum Schwimmen oder zum Picknick. Er sagte, nach der ganzen Woche Arbeit möchte er schlafen. So unternahmen wir alles zu dritt. Einmal sagte ich ihm, ich ziehe jetzt mit den Kindern nach Israel. Da meinte er, wenn ich das tue, würde er nichts mehr von uns wissen wollen. Druck ausüben konnte er immer sehr gut. Den Kindern wollte ich nicht zumuten, ihren Vater nicht mehr zu sehen. Ich beschloss also, in Berlin zu bleiben, wollte mich aber von ihm trennen. In dem Juweliergeschäft, wo ich anfing zu arbeiten, musste ich einen furchtbaren Schock erleben. Die Familie, der das Geschäft gehörte, beschuldigte mich, Schmuck gestohlen zu haben und erstattete eine Anzeige gegen mich. Wie gelähmt war ich, nicht in der Lage, dagegen anzukämpfen. Sie finden schon den Schmuck, dachte ich und werden sich entschuldigen. Aber anstatt der Entschuldigung kamen von der Anwaltschaft immer neue Schreiben. Ich fiel in eine Depression. Weder schlafen konnte ich noch mich richtig um die Kinder kümmern. Die Tochter dieser Juwelierfamilie war meine Freundin, aber sie nahm nicht mich, sondern ihre Eltern in Schutz. Sie war von den Eltern abhängig, bekam jeden Monat einen Scheck von ihnen. Diese Freundin entschuldigte sich erst nach 18 Jahren dafür, was ihre Eltern mir angetan hatten. Das Verfahren gegen mich wurde aus Mangel an Beweisen eingestellt. Obwohl ich sicherlich gewonnen hätte, fühlte ich mich nicht dazu fähig, zu einem Anwalt zu gehen und ihn beauftragen, eine Revision einzulegen. Es dauerte ein Jahr lang, bis ich mich davon einigermassen erholen konnte. Danach traute ich mich nicht, nach einer neuen Arbeit zu suchen. Die Einstellung des Verfahrens war ja kein richtiger Freispruch. Depression hatte ich schon früher, nach der Geburt meines Sohnes. Ich war berufstätig, mein Mann studierte noch. Damals arbeitete ich als Helferin im jüdischen Kindergarten. Ich fühlte mich überfordert: Ich war Mutter - plötzlich von zweien, weil mein Mann sich auch als Kind umsorgt sehen wollte. Von dieser Depression, denke ich, landete ich automatisch in der nächsten. Immer hatte ich Sehnsucht nach Israel, ich weinte, wollte nach Hause, in die Nähe meiner Eltern. Mein Mann sagte, wir werden das schon machen und ich glaubte ihm. Er hat immer so glaubwürdig gesprochen. Wir waren jedes Jahr in Israel, später bin ich meist allein gefahren. Die sechs Wochen, die ich dort verbrachte, versorgten mich zwar mit Energie, waren mir aber nicht genug. Ich fühlte mich enttäuscht von seinen Versprechungen, die nie gehalten worden sind. Mein Mann hat Angst vor seiner eigenen Courage. Er beschloss etwas, traute sich aber dann nicht, es zu verwirklichen. Die Pläne blieben immer Pläne. Sein erster gelernter Beruf war Uhrmacher und er wollte ein Geschäft eröffnen. Er erkundigte sich, wie man das macht, wo man die Ware herbekommt und fand auch einen Laden. Am nächsten Tag wollten wir uns treffen, um den Vertrag zu unterschreiben. Zwei Stunden vorher rief er mich an und sagte, er hätte es sich anders überlegt. Dieses Verhalten hat sich immer wiederholt. Wenn ich etwas durchsetzen wollte, warf er mir vor, wie meine Mutter zu sein. Ich wollte nicht die dominante Person abgeben, ich hätte mir gewünscht, dass wir die Entscheidungen gemeinsam treffen. Seine Arbeit hat ihn überfordert, er musste am Samstag regelmäßig arbeiten, weil er es nicht schaffte, seine Aufgaben in der Woche zu meistern. Er war Ingenieur im Computerwesen. Über seine Probleme bei der Arbeit sprach er immer, nur über uns beide konnten wir nicht sprechen. Ich habe versucht, mit ihm zu sprechen, aber dann sagte er: „Natürlich ist Papa schuld. Der Mülleimer ist offen, du kannst den ganzen Müll reinwerfen.” In Wirklichkeit konnte und wollte er nicht darüber reden, womit er mich gekränkt hatte. Als es mündlich nicht ging, schrieb ich alles auf. Manchmal gab ich es ihm zu lesen, er sagte aber: „Man kann es nicht lesen. Das ist furchtbar, was du schreibst. Ich muss ja ein schrecklicher Mensch sein.” Als ich mich selbst trösten wollte, sagte ich mir, er hat mich nie geschlagen. Aber ich sagte ihm, seine Worte können töten. Er konnte keine Gefühle zeigen. Seine Mutter ist eine sehr kalte Person, sie würde nie jemanden umarmen und ich denke, auch er wurde nie von seiner Mutter umarmt. Aus seiner Kindheit hat er nie etwas erzählt und das ist schon bedenklich. Er ist ein Kriegskind, 1944 geboren - vielleicht nicht gewollt, vielleicht auch gefühlt, dass er nicht gewollt war. Mein Mann war sehr geizig, das war schon krankhaft. Ich merkte zwar, dass er knauserig ist, aber ich dachte, er würde auch für das gemeinsame Ziel sparen, nach Israel zu gehen. Über viele Jahre hinweg legte ich Geld zurück, um in Israel eine Wohnung zu kaufen. 1986 fing ich wieder an, zu arbeiten, erst bei Wertheim, dann in der Sozialabteilung der Jüdischen Gemeinde, in der Altenpflege. Alte Leute begleitete ich zur Behörde und zu Ärzten oder ging mit ihnen einfach spazieren. Als ich von neuem arbeitete, sagte ich, was ich verdiene, ist mein Geld. Ich habe immer nur ein Viertel davon verdient, was er bekam. Mir blieb auch nicht viel übrig, weil ich meine Eltern finanziell unterstützte, meinen Kindern etwas mehr gönnte und auch für meinen Urlaub sparte, um öfter nach Israel fahren zu können. Dieser Entschluss gefiel meinem Mann überhaupt nicht. 1993 ließ er das gemeinsame Konto sperren und transferierte das Guthaben auf sein Konto. Von da an gab er mir als Haushaltsgeld jede Woche 100 Mark. Für eine vierköpfige Familie. Soll er doch damit einkaufen gehen, sagte ich ihm. Aber dann habe ich das gesparte Geld zugebuttert. Ich kochte nämlich sehr gern, schön und exklusiv und zum Sabbat lud ich immer Gäste ein. Darauf wollte ich nicht verzichten. Den Schmerz aber, dass er mich mit dem Sperren des Kontos für unmündig erklärte, schleppte ich ein halbes Jahr mit mir herum. Ich weinte lautlos und versuchte, meiner Arbeit nachzugehen. Wenn ich die alten Leute im Krankenhaus besuchte, bekam ich Schweißausbrüche. Im Bus konnte ich nicht mehr stehen, ich hatte das Gefühl zu ersticken. Aber ich tat alles, damit keiner merkt, wie schlecht es mir ging: ich machte mich fein und schminkte mich. Dann bekam ich einen Nervenzusammenbruch. In der Klinik, wo man mich behandelte, haben die Ärzte entschieden, dass das Beste für mich wäre nach Israel zu gehen. Erst nach einem Jahr fügte ich mich, ich wollte bleiben, damit ich meinen Mann nicht verliere. Letztendlich fuhr ich doch, auch deshalb, weil mein Vater mich brauchte. Er war pflegebedürftig. Schon als ich wegging, hatte mein Mann eine Freundin, aber als ich nicht mehr in Berlin war, lebten sie praktisch zusammen. Trotzdem versuchte er mich immer noch an der Nase herumzuführen. „Bau uns ein Haus in Israel, ich komme”, sagte er. Zum Glück glaubte ich ihm diesmal nicht. Ich stellte meinem Mann ein Ultimatum: entweder sie oder ich, aber wenn er sich für sie entscheidet, soll er die Wohnung verlassen. Das tat er. Jetzt leben wir getrennt, aber wir sind nicht geschieden. Wegen der Rente ist es günstiger, mich nicht scheiden zu lassen, da ich nicht genug gearbeitet habe. Zur Zeit bin ich selbstständig, verdiene aber noch nicht gut. Aus Israel kam ich nach drei Jahren deshalb zurück, weil ich mit meiner Mutter nicht in einer Wohnung zusammenleben konnte. Mein Vater starb nach anderthalb Jahren und ich hatte das Gefühl, dass meine Mutter mich wie eine Marionette behandelte. Sie gab mir dauernd Befehle. Fuß fassen konnte ich auch nicht. Ich hatte keine Freunde und wegen meines Mannes ging es mir seelisch sehr schlecht. Als ich die Rückkehr beschloss, hoffte ich noch, dass mein Mann sich für mich entscheidet. Ich wollte auch in meiner Wohnung sein, die ich selber einrichtete: das war meine Visitenkarte. Zu den Kindern hatte ich ein sehr gutes Verhältnis. Dadurch, dass wir uns mit meinem Mann trennten, hat sich das geändert, es ist schwierig geworden. In meinem Innersten ist etwas gestorben und das dauert noch sicherlich ein paar Jahre, bis ich aus diesem Zustand herauskomme. Vielleicht wird mir helfen, dass ich Oma werde: meine Tochter bekommt im Juli ein Kind. Mit ihr hatte ich sehr viele Auseinandersetzungen. Weniger mit meinem Sohn, der seit 1996 in Israel lebt, mich aber regelmäßig anruft. Er arbeitet in einer Niederlassung von Siemens. Von meiner Tochter bekam ich immer zu hören: „Aber er ist mein Papa und ich möchte zu ihm weiterhin eine gute Beziehung haben.” Sie warf mir auch vor, mich einzuigeln, drängte mich, wieder in der Frauengruppe der Jüdischen Gemeinde, bei WIZO (Women’s International Zionist Organization) mitzuarbeiten. Zur Zeit kann ich es aber nicht, obwohl WIZO über Jahre hindurch mein zweites Zuhause war. In der Frauengruppe wurde ich 1979 Mitglied. Ich hatte immer nach einer Aufgabe gesucht und sie dort gefunden. Um Geld zu sammeln, organisierten wir Feiern: große Bälle und Frühschoppen. Meist war ich für das Essen zuständig. Das Geld ging nach Israel. WIZO Deutschland hat ein großes Projekt, das Theodor-Heuss-Heim in Herzelya, wo Frauen mit vielen Kindern eine Woche verbringen können. Außerdem hat WIZO Berlin noch einige Tagesstätten, die sie unterstützt. In die Jüdische Gemeinde trat ich schon 1971 ein, als mein Sohn geboren wurde. Ich erkundigte mich, was ich wegen der Beschneidung, Brit Mila tun muss. Wenn in unserem Dorf in Israel ein Junge geboren wurde, gab es Brit Mila, damit bin ich großgeworden, es war also selbstverständlich für mich. Nur meines Sohnes wegen wurde ich Mitglied der Gemeinde. Heute hätte ich die Möglichkeit, zu sagen, ich trete aus, aber das tue ich nicht, weil es für mich wichtig ist, Jüdin zu sein. Ich frage mich selber, was das genau bedeutet. Als ich schon vor 1988 eine Depressionsphase hatte, fing ich an, in die Synagoge zu gehen. Ich suchte etwas, woran ich mich festhalten kann und das war damals die jüdische Religionsgemeinschaft. An Gott glaubte ich nicht. Zum erstenmal las ich die Bücher durch, die man am Freitag liest, erschrak aber nur, weil diese Welt für mich unverständlich war. Nicht die Religion, die Gemeinschaft war mir wichtig. Die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft, zum Judentum verkörpert für mich heute das Schicksal meiner Eltern, das Andenken an ihr Schicksal, an all das, was sie im zweiten Weltkrieg erlebten, nur weil sie Juden waren. Erst als ich mich endgültig dafür entschied, in Deutschland zu bleiben, fing ich an, die Traditionen richtig zu leben. Es war mein katholischer Mann, der mich dazu überredete. Als Junge war er Messdiener, bei ihnen wurde am Sonntag feierlich gegessen, und er fragte mich, warum ich nicht die jüdischen Feiertage begehe. Zu Hause in Israel feierten wir überhaupt keine Feiertage. Meine Mutter kommt aus einem orthodoxen Haus, aber sie sagte immer, mein Vater legte keinen Wert darauf, deshalb hätten wir sogar die hohen Feiertage nicht begangen. Sie sagte mir einmal: „Als ich Gott brauchte, war er nicht da.” Damals verstand ich noch nicht, was sie damit meinte. Für meinen Vater bedeutete Judentum nicht viel. In Wien ging er nie zur Synagoge, er hatte auch keinen Bar-Mizwa. Er war das jüngste Kind in der Familie, meine Großmutter war 46 Jahre alt, als sie ihn bekam. Die Feiern musste ich aber in Israel nicht entbehren. Bei den Nachbarn wurde ich immer eingeladen, wenn sie feierten. Wie wenig mir aber die Traditionen lange Zeit bedeuteten, ließ sich auch daran messen, dass ich einmal am Jom Kippur, wo ich im Kindergarten frei hatte, mit meinen Kindern in den Zirkus ging. 1984 habe ich am Jom Kippur das erste Mal gefastet. Das kannte ich aus der Schule. Später fragte ich meine Mutter und meine Großmutter, was man alles zu Pessach kocht. 1988 fing ich an, jeden Freitag abend Sabbat zu feiern. Heute tue ich es nicht mehr. Während der drei Jahre, die ich in Israel verbrachte, hat mich das Verhalten der Orthodoxen sehr gestört. Ich erlebte tagtäglich, wie die Menschen in ihren Rechten beschnitten werden und wie die Orthodoxen die Politik mitbestimmen. Früher war ich eine starke israelische Patriotin. Israel war selbstverständlich meine Heimat. Heute sage ich, meine Heimat ist dort, wo mein Zuhause ist. Und mein Zuhause ist in Deutschland. Heutzutage kann ich mich mit der deutschen Mentalität besser identifizieren als mit der israelischen. Ich bin keine Frau mit Ellenbogen, den braucht man aber zweifelsohne in Israel. Wenn ich hier meine Tür zumache, weiß niemand über mich weiter Bescheid. Das ist der Vorteil der Großstadt. Die Menschen sind zwar kühler, aber man kann trotzdem Freunde finden. Wenn ich mir Freunde suche, zählt es nicht, ob sie jüdisch sind. Egal wo ich arbeitete, hatte ich sofort alle Leute bei mir zu Hause eingeladen, damit wir uns kennen lernen. Und an allen Arbeitsplätzen konnte ich Freundschaften bauen. Zur Zeit brauche ich aber keine Freunde, ich komme allein zurecht, wenn ich die Möglichkeit habe, zu schreiben. Oft sind es nur Skizzen des Tages, die ich mache, aber ich schreibe auch an einem Kochbuch und bereite meine Menüpläne vor. Ich bin leidenschaftliche Köchin. Da ich in meinem Alter keine Arbeit mehr bekomme, beschloss ich, Partyservice zu machen. Seit Januar bin ich offiziell eingetragen, aber die Tätigkeit begann ich schon letztes Jahr. Früher machte ich schon Essen für Bar-Mizwas, nahm aber nie Geld dafür. Jetzt hoffe ich, mit der Zeit mit dem Partyservice ein ausreichendes Einkommen zu haben. Ich mietete mir eine Küche, dort koche und backe ich. Leider habe ich noch nicht genug Kunden, nur gerade so viel, dass ich meine Kosten decken kann. Die Kunden gewinne ich meistens durch Mundpropaganda. Von der Frauengruppe bekomme ich keine Bestellungen, obwohl sie alle wissen, dass das jetzt mein Broterwerb ist. Vielleicht kann ich nicht so schön garnieren, wie es KaDeWe oder Kempinski macht. Aber die Israelis werden schon bestellen. Es mag komisch klingen, aber man muss zwischen Israelis und Juden unterscheiden. Juden, die seit längerer Zeit in Deutschland leben - nach dem Krieg als Displaced Persons hierher gekommen sind -, verhalten sich viel intoleranter, als die Menschen, die aus Israel hierher zogen. Ein Israeli akzeptiert meistens, dass ich einen Nichtjuden heiratete. Die deutschen Juden tun sich damit sehr schwer. Als meine Tochter geboren wurde, erkundigte ich mich in der Gemeinde, ob es eine grössere Wohnung für uns gäbe. Wir hatten eine Zweizimmerwohnung. Man fragte mich, warum mein Mann denn kein Gemeindemitglied ist, will er etwa keine Gemeindesteuern zahlen? Doch, sagte ich, er würde die zahlen, aber er wird nicht als Gemeindemitglied genommen. „Ach, er ist nichtjüdisch? Sie sind so eine hübsche Frau, konnten sie keinen besseren kriegen?”, wurde ich gefragt. Diese Bemerkung fand ich empörend. Ich habe nicht die Religion geheiratet, sondern einen Menschen. Was dann kam, wusste ich natürlich nicht. Vielleicht wäre aber meine Ehe mit einem jüdischen Mann genauso katastrophal gelaufen. Meine Eltern unterstützten mich auch bei meiner Entscheidung Mein Vater sagte: „Es ist uns egal, ob dein Mann jüdisch oder nichtjüdisch ist, Hauptsache du liebst und verstehst ihn.” Mein nichtjüdischer Mann wurde in der Gemeinde die ganzen Jahre über nicht akzeptiert. Wenn zum Beispiel bei jemandem zu Hause gefeiert wurde, lud er nur Juden ein. Ich stand meistens nicht auf der Gästeliste. Einmal kaufte sich eine Bekannte ein Haus und veranstaltete eine Einweihungsfeier. Gott und die Welt waren eingeladen, nur wir nicht. An dem Tage schliefen drei Kinder bei mir, weil ihre Eltern zu dieser Party gingen. Als ich das einer Freundin erzählte, war ihre erste Reaktion, ich bilde mir etwas ein. Sie fragte dann auf meine Bitte nach, und ich hatte recht: mit einem nichtjüdischen Ehepartner gehörte ich nicht dazu. Bei den großn Feiern, wie Bar-Mizwa oder Hochzeiten war ich vielleicht insgesamt fünfmal eingeladen. Als mein Sohn Bar-Mizwa hatte, bot sich die Chance, einmal diese abweisenden Menschen nicht einzuladen. Die Kinder wollte ich nicht ausschließen, aber auf die Gesellschaft ihrer Eltern verzichtete ich. Trotzdem war dieses Verhalten in der Gemeinde kein Grund für mich, auszutreten. Seitdem ich in Deutschland lebe, hatte ich eine einzige schlechte Erfahrung wegen meines Jüdischseins. Ganz am Anfang, als ich im Blumenladen arbeitete, in der Tat im Schneckentempo - es war ja alles sehr neu für mich - fragte mich eine Kollegin: „Sind alle Juden so langsam wie Du?” Als die Mauer fiel, wollte ich nichts davon wissen. Ich legte mich schlafen, weil ich wütend war. Erstens, das passierte am 9. November, was für Deutschland ein jüdischer Trauertag und kein Feiertag sein sollte. Aber die Deutschen haben aus dem 9. November wieder einen Feiertag gemacht, dachte ich. Außerdem habe ich die Vereinigung den Deutschen noch nicht gegönnt. Ich war der Meinung, noch leben viel zu viel Leute, die den zweiten Weltkrieg miterlebten und noch haben die Deutschen kein Recht, vereinigt zu werden. Sie sollten sich noch nicht freuen können. Die Situation wurde seit der Vereinigung in Berlin schlechter: es gibt weniger Arbeit und mehr Ausländerfeindlichkeit. Meines Erachtens hat das schon mit dem Fall der Mauer zu tun, weil sich die Deutschen wieder stark fühlen. Sie sind wieder ein vereinigtes Volk und über bisherige Tabus spricht man nicht mehr hinter der Hand. Das Üble, was von Deutschland ausging, denke ich, kann wiederkommen und wird auch wiederkommen. Nicht von der Politik, sondern von der Bevölkerung. Vielleicht kann es durch die Medien noch früh genug gestoppt werden, das hoffe ich jedenfalls. Wenn ich aber daran denke, dass die Neonazis unter dem Brandenburger Tor marschieren durften und neulich die Demonstration der Rechtsextremen genehmigt, die linke Gegendemonstration dagegen verboten wurde, habe ich Bedenken. Im Westen wurde bis Ende der 60-er Jahre von der Vergangenheit nichts bewältigt. Angefangen hat es mit der 68-er Generation und auch die Holocaust-Fernsehserie brachte viel ins Rollen. Erst ab dieser Serie, die in den 70-er Jahren ausgestrahlt wurde, fing man eigentlich an, detailliert darüber zu sprechen, was im zweiten Weltkrieg passierte. Ich habe den Deutschen verziehen, obwohl ich nicht vergass, was sie angestellt hatten. Eigentlich hätte ich nicht verzeihen dürfen, weil ich ja selber kein Leidender war. Aber ich denke, der Hass führt nirgendwohin. Genausowenig ist die Ghettomentalität hilfreich, die von den jüdischen Menschen, die hier seit Kriegsende leben, mit sich gebracht und bewahrt wurde. Auf die Dauer kann der Widerspruch nicht bestehen, dass sie am Geschäftsleben teilnehmen, aber sich den Deutschen gegenüber nicht öffnen. Ich bin der Meinung, dass die Kinder und Enkelkinder der Täter, und die kommenden Generationen nicht dafür bestraft werden sollen, was sie nicht verbrochen haben. Toby Axelrod „Eine Normalisierung wird nur eintreten, wenn es nicht mehr wichtig ist, was man ist, Christ, Jude oder Moslem oder ganz was anderes” Toby Axelrod kam 1997 mit einem Fulbright-Stipendium nach Deutschland, um zu untersuchen, wie die Kinder und Enkel der Täter und Mitläufer sich mit der Vergangenheit auseinander setzen. Sie bewundert diejenigen Deutschen, die sich aus einem inneren Zwang ihrer Geschichte stellen. Die 44jährige Amerikanerin hat das Gefühl, dass Hitler in gewisser Weise auch jetzt Macht über ihr Leben ausübt, weil sie dem Thema des Holocaust nicht entkommen kann. In Deutschland, meint sie, wird es noch lange nicht selbstverständlich sein, Angehörige einer Minderheit als Teil der Gesellschaft zu betrachten. Mit Deutschland verband ich in meinem Kopf immer den Holocaust, ich konnte das Land nicht wie ein Urlaubsziel betrachten. Sehen musste ich es aber. 1979, als ich im Rahmen einer längeren Europareise das erste Mal nach Deutschland kam, hat mein erstes Erlebnis unangenehme Assoziationen hervorgerufen. Nachdem unser Zug die Grenze von Österreich nach Deutschland passierte, blieb er längere Zeit stehen. Es war mitten in der Nacht und auf dem Bahnhof rührte sich nicht viel. Auf dem Gleis gegenüber gab es einen Güterzug mit Rindern, die haben laut gemuht. Ein Güterzug, vollgepfercht mit Vieh, wahrscheinlich auf dem Weg zum Schlachthof. Bei mir kamen unheimliche Bilder auf. In den zwei Wochen, die ich damals in Deutschland verbrachte, war ich ab und zu nervös. Ich habe oft die Leute betrachtet, und bei älteren Menschen daran gedacht, was sie wohl in der Hitlerära getan oder gesehen hätten. Es beschäftigte mich dauernd, ob sie erkennen, dass ich Jüdin bin. Ich stellte mir vor, dass ich mich vor 40 Jahren nicht frei auf diesen Straßen hätte bewegen können. Orte, Museen und Gebäude in Deutschland zu besichtigen, war für mich etwas völlig anderes, als die Schlösser in Frankreich an der Loire zu besuchen, oder die Köstlichkeiten der italienischen Küche zu genießen. Nach Deutschland zu kommen, bedeutete die Konfrontation mit der Geschichte, aber die habe ich ja bewusst gewählt. Damals besuchte ich zum erstenmal Dachau. Zuvor hatte ich eine Diskussion mit einer nichtjüdischen Freundin, mit der ich die Reise gemeinsam machte. Sie meinte, das ehemalige KZ sollte nicht als Denkmal erhalten werden - alles müsste zerstört werden, was an diese schreckliche Zeit erinnert. Ich aber vertrat die Meinung, kein Zeitdokument darf vernichtet werden. Dachau muss als Erinnerungsstätte bestehenbleiben, weil es immer noch Menschen gibt, die gern vergessen wollen. Damals wusste ich noch nicht, dass die deutsche Vergangenheit mich für längere Zeit in dieses Land bringen würde. Über den Holocaust wurde in unserer Familie mehr indirekt gesprochen. Mitglieder der größeren Familie waren zwar davon betroffen, aber die Großeltern beiderseits verließen ihre Heimat viele Jahre noch bevor der zweite Weltkrieg begann. Die zwei Großväter erzählten mehr darüber, was sie noch als Kinder und Jugendliche zu Hause erlebten. Der Schmerz aber, Eltern und Geschwister verloren zu haben, war aus den Worten meines Großvaters väterlicherseits immer herauszuhören. Meine Mutter wurde 1926 in den USA geboren, ihr Vater ist um 1910 aus Litauen in die Vereinigten Staaten eingewandert. Ihre Mutter wurde schon in den USA geboren, die Eltern der Mutter wiederum kamen aus Russland. Auf der Seite meiner Mutter wissen wir nicht, was mit den Verwandten, die in Litauen blieben, geschah, weil sie den Kontakt zu ihnen verloren hatten. Mein Großvater mütterlicherseits war mit seinen Brüdern in der Bekleidungsindustrie tätig. Sie importierten Stoffe aus Frankreich, fertigten Kleider für reiche Frauen an und waren bis zur großen Weltwirtschaftskrise erfolgreich. Danach mussten sie ihren Betrieb einstellen. Nach der Depression konnte man sehr billig Land kaufen. Die Großmutter, die mutig war, und einen guten Sinn fürs Geschäft hatte, nutzte die Chance, überredete den Großvater und erwarben ein großes Stück Land neben einem kleinen See, wo sie ein Sommerlager für Kinder einrichteten. Die Großmutter arbeitetete nämlich in ihrer Jugend oft in Sommerlagern, hatte viel Freude daran und als sich die Möglichkeit bot, ergriff sie es, um eine eigene Ferienanlage aufzubauen. Das Kinderlager befand sich im Norden von Massachusetts, in der Nähe einer kleinen Gemeinde. Dort arbeitete mein Großvater väterlicherseits als Rabbiner und dort haben sich auch meine Eltern kennen gelernt. Mein Vater ist 1923 in Lubomil geboren. Heute ist das in der Ukraine, damals gehörte es zu Polen. Die Geschichte unserer Familie in Polen können wir bis zum frühen 19. Jahrhundert zurückführen, wo sie vorher herkamen, wissen wir nicht. Es gibt mehrere Erklärungen für die Herkunft des Namens „Axelrod”. Eine davon ist, dass es seine Wurzeln in Deutschland hat. Der Vater meines Vaters kam im Jahre 1925 allein nach Amerika und holte später die Familie nach. Mein Großvater war Rabbiner, und er konnte auch koscher schlachten - in der kleinen Gemeinde in Massachusetts, wo er angestellt wurde, brauchte man beides. In der Familie meines Großvaters sind viele während des Holocaust umgekommen. Seine Eltern wurden ermordet und auch von seinen 5 Geschwistern hat nur einer überlebt. Im Sommer 1941 wurde ihr Dorf, Lubomil von den Deutschen besetzt. Zunächst pressten sie aus den Einwohnern, die zu 80 Prozent Juden waren, alles heraus, was zu holen war: Dorfbewohner wurden festgenommen und die Besatzer gaben sie nur gegen eine bestimmte Summe, Schmuck oder andere Wertsachen frei. Als die Leute nichts mehr hatten, wurden sie - drei- bis viertausend Menschen - im Oktober 1942 erschossen. Einem Bruder meines Großvaters und einem Neffen gelang es, in den Osten zu entkommen. Der eine ist mit einem Traktor geflüchtet, der andere trat der Roten Armee bei. Einige Mitglieder ihrer Familien wohnen heute in Kasachstan. Ein Bruder meiner Großmutter väterlicherseits versuchte vergeblich, in die USA einzuwandern. Er kam in den 20-er Jahren in Ellis Island an, aber die Behörden schickten ihn zurück, weil sie meinten, er sähe krank aus. Er hat den Krieg nicht überlebt. Leider wurde noch jemand in der Familie nach Europa zurückgeschickt: ein Cousin meiner Mutter wollte aus Frankreich emigrieren, war schon auf amerikanischem Boden, musste aber das Land - auch aus gesundheitlichen Gründen - wieder verlassen. Er starb in Auschwitz. In unserer Stadt auf Long Island, wo ich mit meiner Schwester und meinem Bruder groß wurde, gab es mehrheitlich Juden, Italiener und sehr wenige schwarze Familien. Jüdin zu sein, war von Anfang an ein wichtiger Teil meines Lebens. Es bereitete mir großen Spaß, an den Feiertagen mit der Familie zusammenzusein. Der andere Großvater, der Rabbiner war ein gewiefter Erzähler. Wir Kinder hörten von ihm sowohl lustige als auch traurige Geschichten. Er erzählte von seinem Leben in Lubomil und erinnerte sich daran, wie seine Mutter ihm auf dem Bahnhof auf Wiedersehen sagte, als er nach Amerika ging: „Ich weiß nicht, ob ich dich je wiedersehe”, sagte sie und der Großvater meinte, er würde diese Worte immer noch hören. Über den Holocaust sprach er aber nicht, nur darüber, was er selber erlebte. Jüdisch zu sein bedeutet für mich vor allem Familie und Geschichten. Der jüdische Glaube ist auch ein Glaube von Erzählungen: man erzählt an den Feiertagen, was vor mehreren tausend Jahren passierte. Der Großvater legte Wert darauf, nicht nur Geschichten aus der Bibel, sondern auch seine persönlichen Geschichten uns so zu erzählen, dass er oft eine moralische Lehre mitgab. Ich wurde religiös erzogen, nicht orthodox, sondern traditionell. Wir hielten alle Feiertage, gingen fast jeden Samstag in die Synagoge und aßen koscher. Meine Mutter hielt sich meinem Vater zuliebe an die Traditionen, denn zu Hause hat sie das nicht erlebt. Ihre Familie war ziemlich assimiliert. Von klein auf ging ich zum Hebräisch- und Bibelunterricht. Im Alter von 13 Jahren, nach meinem Bat-Mizwa hätte ich mit dem Unterricht aufhören können, aber mir hat es gefallen, und ich setzte es fort. Als ich 5 oder 6 Jahre alt war, wollte eine Freundin, Patty, die evangelische Eltern hatte, von mir wissen ob ich an Jesus glaube. Da ich keine Ahnung hatte, wer das sei, fragte ich meine Eltern. Sie haben es mir erklärt und hinzugefügt, warum Juden nicht an Jesus als Messias glauben. Natürlich erzählte ich das meiner Freundin; sie sagte, wenn ich nicht an Jesus glaube, würde ich in die Hölle kommen und wir könnten auch nicht mehr miteinander sprechen. Ich verstand das nicht. Die Eltern haben aber alles geregelt. Es stellte sich heraus, dass die Sache mit den Ungläubigen und der Hölle Patty in der Sonntagsschule beigebracht wurde, aber auch ihre Eltern glaubten nicht daran. Patty wurde zu uns zu einem Sabbatessen eingeladen und sie erklärte mir später die Geschichte Jesu aus einem Kinderbuch mit vielen Bildern. In meiner Jugend hatte ich eine sehr gute Freundin, deren Mutter katholisch und ihr Vater protestantisch war; sie erzählte mir, dass die Eltern heimlich heiraten mussten, weil ihre Familien ihre Beziehung nicht akzeptierten. Bis dahin dachte ich nicht daran, dass es zwischen Katholiken und Protestanten so scharfe Trennlinien geben könnte. Zu meiner Mutter hatte ich immer ein gutes Verhältnis, ich bin nach ihr geraten. Die Beziehung zu meinem Vater war nicht problemlos. Als ich im Alter zwischen 10-15 Jahren war, wurde seine Stelle unsicher. Als Ingenieur für Aeronautik arbeitete er für Firmen, die mit der NASA in Verbindung standen, aber auch mit der Air Force. Obwohl er über das Ende des Vietnamkrieges sehr froh war, konnte er seine Stellung nicht mehr sicher wissen. Deshalb machte er eine zweite Magisterarbeit, um Mathematik unterrichten zu können. Aber während er sich weiterbildete, hat er mit uns Kindern nicht viel geredet. Wahrscheinlich war er sehr deprimiert. Als Jugendliche hatte ich das Gefühl, das er sich nicht um uns kümmerte, wenig Interesse an uns Kindern hatte. Mit meiner Mutter dagegen konnte ich über alles sprechen. Vor uns haben sich meine Eltern fast nie gestritten. Aber mein Vater war eindeutig der Boss. Heute denke ich, dass meine Mutter ihm über viele Jahre hinweg gehorchte und da sie mein Vorbild war, wirkte sich das auch auf mich aus. Ich dachte, ich müsste meine eigene Meinung unterdrücken und ich hatte auch Schwierigkeiten, mich durchzusetzen. Nachdem ich erwachsen wurde, änderte sich auch zu Hause viel. Meine Mutter hat ihre Meinung meinem Vater gegenüber stärker vertreten und ihr gewachsenes Selbstbewusstsein schlug sich wiederum bei mir nieder. Als ich mein eigenes Leben hatte, an die Universität ging und von den Eltern getrennt wohnte, war mein Vater mehr bereit, meine Entscheidungen zu akzeptieren. Aber bis dahin versuchte er, auch Kontrolle über meinen Freundeskreis aufrechtzuerhalten und meine Beziehung zum Judentum zu bestimmen. In unserer Familie wurde darüber gesprochen, was aus dem Holocaust für uns folgte, zum Beispiel, dass man unbedingt einen Juden heiraten sollte. Bei der Argumentation wurde auch aufgeführt, dass Hitler uns alle vernichten wollte und wenn wir nicht dafür Sorge tragen, dass die Juden als Volk weiterbestehen, helfen wir eigentlich Hitler bei der Verwirklichung seines Willens. Diese Art von Reden hörte ich auch oft in der Synagoge: Nachdem so viele von uns ermordet worden sind, würde die nächste Gefahr die „Mischehe” darstellen. Für meinen Vater war es ausschlaggebend, dass ich einen Juden heirate. Als ich schon an der Universität war, wo ich ja mehr Möglichkeiten hatte, Männer kennen zu lernen, sagte er mir das eindeutig. Wir kamen in eine heftige Diskussion, weil ich damals einen Freund hatte, dessen Vater zwar Jude war, aber die Mutter Nichtjüdin und er wurde evangelisch erzogen. Mein Vater sah diese Beziehung schief an. Er hat aber nicht über meinen Freund gesprochen, sondern allgemein gesagt, dass man nicht Hitlers Arbeit vollenden dürfte. Wenn ich doch einen Nichtjuden heirate, sagte er, will er für mich die Trauerzeit halten, als wäre ich gestorben und ich könnte nicht mehr in sein Haus kommen. Ich versuchte ihm zu erklären, dass es auch für mich wichtig ist, einen jüdischen Mann zu heiraten. Zwar könnte ich mir auch einen nichtjüdischen Ehepartner vorstellen, aber nur, wenn er zustimmt, dass die Kinder jüdisch erzogen werden und er Interesse für das Judentum hat. Das war aber mein Wunsch und hatte wenig mit den Vorgaben meines Vaters zu tun. Ich betonte, dass ich meine individuellen Entscheidungen treffen wollte. Mein Vater war aber der Meinung, dass ich in diesem Bezug kein Individuum, sondern Mitglied einer Gemeinschaft wäre und das respektieren müsste. Erzogen wurde ich in einem liberalen Geist, mir wurde beigebracht, alle Menschen sind gleich. Diese Lehre konnte ich nicht damit in Einklang bringen, mich auf keinen Fall in einen Mann zu verlieben, der Nichtjude ist. Unsere Familie war sehr offen, aber bei diesem Thema verhielt sie sich in Widerspruch zu ihren Prinzipien. Später verstand ich besser, dass dies nicht nur mein Problem, sondern das Problem von vielen in unserer Generation war. Ich habe genauso wie meine Mutter englische Literatur studiert. Nach dem Studium ging ich nach New York und arbeitete für eine Publikation für Reisebüros. In einem Jahr sparte ich genug, um nach Europa gehen zu können. Sechs Monate lang war ich dann unterwegs, auch in Deutschland. Als ich aus Europa zurückkam, begann ich, für eine jüdische Zeitung, die auf jiddisch und englisch erschien, zu schreiben. Ich habe über meine Reiseerlebnisse berichtet und beschloss, ein einjähriges Ergänzungsstudium in Journalismus zu machen. In der Folge arbeitete ich bei verschiedenen Zeitschriften und bin die Leiter hochgeklettert. Bei einer großen jüdischen Zeitung blieb ich dann neuneinhalb Jahre lang. Zwar erhielt ich fast jedes Jahr Preise für mein Schreiben, aber ich sah dort keine neuen Herausforderungen mehr. So bewarb ich mich für ein Fulbright-Stipendium, das ich auch erhielt und kam 1997 nach Deutschland. Ursprünglich war das Stipendium auf 10 Monate bemessen, aber es wurde verlängert auf 13 Monate. Das Forschungsthema, das ich mir auswählte, hatte noch mit meinem Praktikum zu tun, das ich nach dem Journalismusstudium bei einer Rundfunkanstalt verbrachte. Das Radio wollte aus Anlass des 40. Jahrestages der Beendigung des Zweiten Weltkrieges eine Sendung über die Befreiung von einem KZ machen. Ich sollte die Vorarbeiten machen und fand einen Ort in Bayern, wo es mehrere Außenlager von Dachau gab. Mein Auftrag lautete, einen Überlebenden und einen Befreier zu finden. Der Journalist, der für die Sendung verantwortlich war, sollte hinfahren, um an Ort und Stelle Interviews zu führen. Aber er stellte einen zu großen Kostenvoranschlag auf, und seine Vorgesetzten stimmten dem nicht zu. Nachdem ich die Untersuchungen für die geplante Sendung betrieb, bin ich auf den Bericht gestoßen, dass Schüler dabei waren, die Geschichte ihres eigenen Ortes, Landsberg zu erforschen. Ich las darüber, wie schwer es für sie war, Informationen zu bekommen, und ich wollte unbedingt über diese Schüler mehr wissen. So bin ich 1985 auf eigene Kosten nach Deutschland gefahren, machte eine Reportage daraus, die dann von diesem Rundfunk gesendet wurde. Ich war sehr berührt davon, was diese jungen Leute taten, um ihre eigene Geschichte aufzudecken. Als ich mich für das Fulbright-Stipendium bewarb, wollte ich dieses Thema weitermachen: untersuchen, wie sich die deutschen Nachkriegsgenerationen, Nachkommen von Tätern und Mitläufern mit ihrer Geschichte auseinander setzen. Es interessierte mich, wie sie erleben, was ihre Eltern gemacht haben oder auch nicht machten, „nur” zusahen. Ich wollte wissen, was sie tun, um die Geschichte ihrer Familie und die Geschehnisse in ihrem Wohnort herauszufinden. Eigentlich hatte ich es vor nur solange hier zu bleiben, bis mein Buch fertig ist. Dann wurde ich aber Korrespondentin einer jüdischen Presseagentur in Amerika, und seit März dieses Jahres arbeite ich für eine jüdisch-amerikanische Organisation in Deutschland. Für mich ist Deutschland nicht ein Ort, wo ich leben könnte, ohne daran zu denken, was hier passierte. In irgendeiner Hinsicht ist es für mich jeden Tag ein Thema, sei es aus offiziellen Anlässen, wo man sich an die Vergangenheit erinnert oder durch die Tätigkeit der Neonazis und das Problem der Fremdenfeindlichkeit. Ohne damit beschäftigt zu sein, kann ich hier nicht leben, andererseits möchte ich nicht immer damit konfrontiert sein. Wenn ich mich aber verlieben würde, einen Partner fände, mit dem ich mein Leben vorstellen kann, könnte ich bleiben, denn ich glaube, wo man Familie und Freunde hat, ist man zu Hause. In Deutschland hatte ich ein paar schlechte Erfahrungen. Bedroht fühlte ich mich zwar nicht, aber unbehaglich. Einmal fuhr ich nach München, um von einer Preisübergabe einer jüdischen Organisation zu berichten. Beim Empfang sprach mich ein Publizist an, er wollte wissen, wie er formulierte „warum die Juden so geschlossen sind” - sie würden nie einen Nichtjuden bei sich zu Hause einladen, um einen Feiertag mitzuerleben. Feiertage sind keine Touristenattraktionen, sagte ich ihm und fragte, warum er nicht zu Lesungen geht, wo jüdische Schriftsteller aus ihren Werken vorlesen oder in die Synagoge, dort könnte er Bekanntschaften anknüpfen. Er aber bestand darauf, dass er eingeladen werden wollte. Ein weiteres unangenehmes Erlebnis hatte ich, als in einem Zug zwischen Berlin und Erfurt ein Mann um die 40 mich fragte, woher ich kommen würde und was ich von Beruf sei. Ich sagte, aus New York und ich bin Journalistin. Er wollte auch wissen, für welches Medium ich arbeite und als ich antwortete, für eine jüdische Nachrichtenagentur, meinte er: „Ich hätte es wissen sollen”. Dann setzte er die Fragerei fort, warum Netanjahu so eine Politik betreibe, als ob ich für die israelische Politik verantwortlich wäre. Er sagte, was die Juden den Palästinensern antun, kann man mit Auschwitz vergleichen. Ich versuchte, ihm zu erklären, dass man zwar kritisieren könne, was die Israelis tun, ich finde manches auch nicht richtig, aber so ein Vergleich wäre absurd. Auch das habe ich zu hören bekommen, dass die Juden immer nur Geld wollen. Mit einem Freund war ich in einer Bar, wo ein Betrunkener ihn fragte, womit er sich beschäftigen würde. Er sagte, er schreibt eine Doktorarbeit beim „Zentrum für Antisemitismusforschung”. Da schoss er los: „Ich will wissen, warum die Juden immer mehr Geld haben wollen. Bekommen sie nicht genug Entschädigung?” Er meinte auch, die russischen Juden kommen nach Deutschland und nicht nach Israel, weil sie wissen, dass sie hier Geld erhalten und dann nicht arbeiten brauchen. „Juden wollen nie arbeiten”, fügte er hinzu. Es gibt viele alte Vorurteile gegen Juden, die weiterleben. Als ich über das HolocaustMahnmal schreiben wollte, war ich am geplanten Ort und redete mit ein paar Menschen, um zu erfahren, wie sie über das Mahnmal denken. Ein Ehepaar, mit dem ich sprach, war der Meinung, es soll ein Mahnmal geben, aber nicht so groß. Die Frau sagte, die Juden wollen dieses Mahnmal nicht, sie brauchen es nicht. Ich fragte, was sie zu Hause von ihren Eltern über die Hitlerzeit hörte, ob zum Beispiel ihre Mutter ihr über die Kristallnacht erzählte? Ihre Mutter wohnte in einem kleinen Dorf, da gab es keine Juden, meinte sie. Aber die Mutter erzählte ihr über die so genannten Wucherer. Da ich das Wort nicht kannte, erklärte sie mir, das waren Juden, die den Bauern Geld liehen, mit hohen Zinsen. Manchmal konnten die Bauern den Kredit nicht zurückzahlen und begingen deshalb Selbstmord. Das alte Vorurteil war die Antwort auf meine Frage, ob die Eltern über die Judenverfolgung erzählten. Die Frau drehte die Frage um und sprach über ein altes Stereotyp. Ich schrieb dann eine Geschichte darüber, wie ich das Wort „Wucherer” kennenlernte. Gegen andere Minderheiten hörte ich schlimmere Sprüche, auch was ich sah, war besorgniserregend. Als neulich eine afrikanische Frau in die Straßenbahn einstieg, ahmte ein junger Mann einen Affen nach, mit lauten Tönen, und er machte alle Fenster auf. Die Fahrgäste sagten nichts. Etwas zu sagen fürchtete ich mich, weil sobald ich den Mund aufmache, hört man sofort, dass ich auch Ausländerin bin. Wenn hier eine Minderheit bedroht wird, stellt das, glaube ich für alle anderen eine Gefahr dar. Solche Vorfälle gibt es auch anderswo, einmal hatte ich auch in New York ein schlechtes Erlebnis. Aber wenn man sieht, dass es in Deutschland politische Parteien gibt, die eine negative Botschaft gegen Ausländer ausstrahlen, und das als fast selbstverständlich ankommt, macht man sich Gedanken. Anderswo in Europa, in Frankreich oder Belgien würde ich diese Erscheinungen genauso mit der Vergangenheit verbinden, aber ich bin hier, und verstehen tue ich die Sprache sehr gut. Ich denke, Deutschland hat eine besondere Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzugehen, gegen solche Erscheinungen anzukämpfen. Die offizielle Politik tritt, glaube ich, manchmal nur halbherzig dagegen auf. Wenn man sieht, dass die Stimmung der Wähler gegen Ausländer gerichtet ist, beeinflusst das alle Parteien. Wenn Ausländer angegriffen werden, fallen heutzutage die Strafen zwar höher aus, aber es ist schwer, die Täter zu finden. Manchmal höre ich, dass die Polizei in bestimmten Gegenden ausländerfeindlich eingestellt ist und nicht entschieden genug gegen Ausschreitungen von rechtsextremen Jugendlichen auftritt. In den Vereinigten Staaten muss man sich wahrscheinlich nicht unentwegt auf den Holocaust berufen, um eine starke jüdische Identität zu haben. Zwar wird die Geschichte des Holocaust in allen jüdischen Gemeinden in Amerika erzählt, aber ich zum Beispiel muss nicht an die Verfolgung denken, um mich jüdisch zu fühlen, da ich zu Hause in Bezug auf das Judentum laute positive Erlebnisse hatte. Hier in Deutschland neigen viele Nichtjuden dazu, auf Juden nur im Zusammenhang mit dem Holocaust zu schauen. Sie betrachten sie wie Relikte und wollen zu ihnen Kontakt oft nur deshalb haben, weil die Shoah geschehen ist. Es ist schwer zu sagen, ob bei den deutschen Juden die starke Bindung ihrer Identität an den Holocaust von innen kommt, oder mehr durch die Gesellschaft aufgezwungen wird. In Deutschland müssen sie sich natürlich mit der Frage auseinander setzen, warum sie, trotz der Geschichte, hier geblieben sind. Natürlich ist es ganz anders als Jude in Amerika, oder in Deutschland, Österreich bzw. Polen zu leben, wo man auch mit den Orten des Schreckens konfrontiert wird. Um die deutsch-jüdische Problematik lösen zu können, müssten erstens einmal die Juden, die hier wohnen, als Deutsche beschrieben werden. Heute spricht man aber immer noch von Deutschen und Juden. Wenn ein Nichtjude jemanden als Juden bezeichnet, bedeutet das, dass er ihn als nichtintegriert ansieht. Zu den Klischees über Juden gehört auch, dass man denkt, ein Jude sei immer erkennbar. Ein Bekannter sagte mir einmal, er würde es schade finden, dass in der Schule seines Sohnes keine Juden gibt, und der Junge auf diese Weise keine jüdischen Kinder kennen lernen kann. Ich frage mich, wie er sich das vorstellte: wäre es die Aufgabe der Kinder, sich zu melden, sie seien jüdisch? Eine Normalisierung wird nur eintreten, wenn es nicht mehr wichtig ist, was man ist, Christ, Jude oder Moslem oder ganz was anderes. Es wird aber, glaube ich, noch Generationen dauern, bis das möglich ist, und ich weiß nicht, ob diese Zeit überhaupt kommen wird. Auch wegen dieser ständigen Gegenüberstellung fühle ich mich als Fremde hier, sowohl als Amerikanerin als auch als Jüdin. Ich habe deutsche Freunde, aber meistens solche, die wirklich gut Englisch sprechen. Wenn ich nämlich Deutsch sprechen muss, nimmt das viel Energie in Anspruch und ich kann mich nicht so gut ausdrücken, wie ich es gern möchte. Das ist mit ein Grund, weshalb ich mich hier nicht richtig zu Hause fühle. Für manche Deutschen sehe ich fremd aus - ich könnte türkisch sein, oder aus dem Mittelmeerraum kommen. In den 30-er Jahren wurden die Menschen hier erzogen, Fremde zu erkennen und zu hassen. Es gibt Reflexe, die schwer zu beseitigen sind, deshalb denke ich noch immer oft daran, ob man mich als Jüdin, bzw. als eine Fremde ansieht, und bisschen Angst habe ich schon. Deutschland ist für mich ein Forschungsort, und kein Ort, wo es für mich einfach ist, zu leben. Vorbehalte habe ich wegen der Geschichte, und weil hier Angehörige von Minderheiten angepöbelt und angegriffen werden. Antisemitismus gibt es zwar auch in New York, aber dort gehöre ich nicht einer Minderheit an, wie hier. Der Grund, hier zu sein ist für mich meine Arbeit, aber es hat wahrscheinlich eine tiefere Ursache, warum ich dieses Thema wählte, warum es mir so wichtig ist, zu wissen, wie die Deutschen mit ihrer Vergangenheit umgehen. Manchmal habe ich den Eindruck gehabt, dass Hitler irgendwie noch Macht über mein Leben hat. Judentum bedeutet mir eine Reihe von Bindungen, von angenehmen Gefühlen, ein Selbstbewusstsein, und trotzdem kann ich es nicht lassen, mich mit diesem schwarzen Kapitel der deutschen Vergangenheit zu beschäftigen. Ich gehe oft in die Synagoge in der Oranienburger Strasse, ich erlebe das lebendige Judentum, die Gemeinschaft und für bestimmte Feiertage fahre ich nach Amerika, weil ich mit meiner Familie zusammen sein möchte. Und trotzdem zieht mich etwas in die Vergangenheit zurück. Es ist eine zwiespältige Empfindung. Ich möchte nicht damit konfrontiert werden, aber ich kann mich von diesem Thema nicht losreißen. Vielleicht, weil ich so gern vieles verstehen würde, was eigentlich gar nicht zu begreifen ist. Meiner Meinung nach muss sich jeder Deutsche mit der Hitlerzeit auseinander setzen. Manche haben sich entschieden, überhaupt nicht darüber zu sprechen; manche fragten die Eltern, oder die Großeltern einmal, und wenn sie nicht darüber sprechen wollten, gingen sie nicht weiter. Manche haben Eltern, die sehr offen sind. Aber es gibt nur sehr wenige, die diesem Thema wirklich viel Zeit und Energie widmen. Die Bereitschaft ist bei der zweiten und dritten Generation meines Erachtens größer. Die jüngeren Leute, die jetzt zwischen 30 und 50 sind und in den späten 60-er Jahren begannen, mit den Eltern und Großeltern zu sprechen, hatten noch eine Chance, die Ansichten dieser Generation zu erfahren. Durch ihr Alter haben sie auch den Vorteil, dass sie sich nicht schuldig fühlen müssen. Ich lernte aber auch solche Menschen kenne, die der Überzeugung waren, dass die Schuld der Großeltern auch sie treffen würde. Am meisten bewundere ich diejenigen, die einen Teil der Aufarbeitung der Vergangenheit auf sich nehmen, weil das Gefühl haben, es tun zu müssen. Ruth Fruchtman „Alle Deutsche haben Probleme mit der Vergangenheit, denke ich” Ruth Fruchtman ist während des Krieges in London geboren und in England aufgewachsen. Heute schreibt sie auf deutsch. In ihrem Leben war es maßgebend, dass ihre Mutter das Deutsch liebte. Sie war Deutschlehrerin gewesen und hat Deutschland vor der Hitlerzeit sehr gut gekannt. Die jüdische Literatur nimmt unter Ruths Büchern in ihrer Berliner Wohnung im Prenzlauer Berg einen vornehmen Platz ein. Ich bin Jüdin, mit meiner Geschichte. Das ist das Leben, das ich für mich ausgesucht hatte und zu dem ich stehe, sagt sie und fügt nachdenklich hinzu: „Vielleicht brauche ich die Zerrissenheit zum Leben”. Die deutsche Sprache hatte für mich eine verhängnisvolle Anziehung, eigentlich war das meine Muttersprache, obwohl ich erst mit 14 Jahren anfing, sie systematisch zu erlernen. Es war meine Mutter, die entschied, dass ich in der Schule diese Sprache wählen sollte. Aber schon sehr viel früher, als ich noch ein kleines Kind war, hat sie mir deutsche Gedichte rezitiert, und deutsche Lieder gesungen. Meine Mutter lernte erst mit sechs Jahren Englisch, ihre Muttersprache war Jiddisch, aber sie sprach perfekt, und akzentfrei englisch. Ihr Doktorat hat sie in Germanistik gemacht, sie war Philologin. Sie las nur deutsche Bücher, und tat das Englische irgendwie immer ab. Sie war eine frustrierte Frau, weil sie nicht das machen konnte, was sie wollte. Nach dem sie geheiratet hatte, durfte sie nicht lehren. Es gab eine Regelung in England, die es den verheirateten Frauen nicht ermöglichte, als Lehrer tätig zu sein. Und nach dem Krieg wollte es mein Vater nicht, dass sie arbeitet. Meine Mutter ist in England geboren, aber ihre Familie kam aus Litauen Anfang des Jahrhunderts. Erst kurz vor ihrem Tod habe ich erfahren, dass die Familie, nachdem sie in England schon mal eingewandert war, wieder wegging nach Litauen, und dann nach 6 Jahren nach England zurückkam. Der Grund dafür war, dass die Großeltern in der englisch-jüdischen Umgebung nicht richtig ihren Platz fanden. Als aber der russisch-japanische Krieg ausbrach, wollte mein Großvater nicht in die russische Armee. Mein Großvater war orthodox, sehr arm, hat aber viel studiert. Man sagte immer, er hätte Rabbiner werden sollen. Er war auch der Einzige, der nach England kommen wollte, weil er einen Freund dort hatte. Die meisten Mitglieder seiner Familie gingen nach Amerika. Auch in seinem hohen Alter sprach er kaum englisch. Ich war neun, als ich verstand, wie zwiespältig meine Mutter war. Als sie merkte, dass auch ich begann, die deutsche Sprache zu lieben, sagte sie, Deutsch sei hässlich, Jiddisch genauso. Das Hebräische dagegen sei schön. Wahrscheinlich hat sie damals Angst gehabt, dass ich die deutsche Sprache zu sehr mögen würde. Sie meinte, es würde zu kompliziert sein, und man müsste jetzt einen Strich ziehen. Meine Mutter war sehr lieb zu mir, so lange ich dachte, was sie dachte, und alles tat, was sie wollte. Aber sobald ich versuchte, ein eigenes Leben zu entwickeln, wurde es problematisch. Sie war nicht so romantisch wie ich, viel lebenspraktischer, aber ich wollte nicht so eng leben. Es gibt diese Doppelbindung: komm mir nah, aber wehe, du kommst mir zu nah. Bei meiner Mutter kam so etwas herüber zu mir, heirate einen Juden und wenn du einen Juden heiratest, dann wirst du so unglücklich wie ich. Erst viel später, als ich schon verheiratet war, meinte sie, wenn ich einen Nichtjuden geheiratet hätte, hätte sie Verständnis dafür gehabt. Meine Beziehung zu meinem Vater besserte sich erst, als ich schon in Frankreich lebte. Meine Mutter äußerte sich sehr negativ über meinen Vater und daher hatte ich ein sehr schlechtes Männerbild. Ihr gefiel es nicht, dass er zu sehr an seiner Familie, an seiner Mutter hing. Als sie wieder merkte, sie ist zu weit gegangen, versuchte sie, es herunterzuspielen. Dann sagte sie, dein Vater ist ein guter Mensch. Er war zehn Jahre jünger als sie. Die Familie meines Vaters kam aus Polen, sie sind auch am Anfang des Jahrhunderts in England eingewandert. Der Großvater kam aus Galizien, Südostpolen, über Wien nach England. Ich habe jetzt seinen Namen übernommen, anstatt Freeman. Er wechselte seinen Namen in England. Der Name war von Geheimnissen umwoben, ich durfte nicht wissen, wie die Familie vorher geheißen hatte. Meine Eltern erzählten nicht viel. Die Großmutter kam auch aus Polen, sie ist als junges Mädchen eingewandert. Der Cousin, der mit meinem Großvater von Polen nach Wien ging, blieb in Wien. Meinen Großvater, der 1952 an Knochenkrebs gestorben ist, muss es sehr mitgenommen haben, dass er zwar 1938 dem Sohn und der Tochter des Cousins geholfen hat aus Wien zu fliehen, aber dem Cousin selbst und dessen Frau nicht mehr. Er musste eine finanzielle Bürgschaft geben und er war nicht sehr reich. Die Papiere, Visa für den Cousin und seiner Frau besass er bereits, aber hatte ein bisschen Angst, weil er auch für sie bürgen musste, und hat gewartet. Und dann kam der Krieg, und es war zu spät, sie wurden deportiert und sind nie wiedergekommen. Aber keiner hat über seine Gefühle gesprochen. 1985, als ich das erste Mal nach Polen fuhr und das Haus meiner Urgroßmutter in Südostpolen, in Jaroslav besuchte, sagte mein Vater, dass sie 1936 gestorben sei und die Großtante, die Schwester meines Großvaters während des Krieges verschwand. Dass heißt, sie wurde ermordet. In England sind wir in der Schule bei der mittleren Reife - dem Vorabitur - in Geschichte nur bis 1918 gekommen, also über die Nazizeit lernten wir noch nichts. Meine Klassenkameraden fuhr ich aber mehrmals an, weil sie so fürchterlich locker mit Auschwitz umgingen. Ich hatte eine einzige Freundin, eine Nichtjüdin, der bewusst war, was passiert ist. Auch heutzutage habe ich den Eindruck, wenn die Engländer die Deutschen nicht mögen, hängt das mit dem Krieg zusammen, aber nicht mit den Juden. Das ist ihnen gleichgültig. Sie wissen nichts darüber und es gibt auch ein großes Maß an Gleichgültigkeit. Darüber, was geschehen ist, habe ich aus den Kindergeschichten, aus der Literatur für jüdische Jugendliche in den 50-er Jahren erfahren. Ich bin mit einer Angst aufgewachsen. Aber auch meine Mutter sagte, dass Deutsche furchtbare Sachen getan haben. Außerdem gab es in meiner Umgebung immer jemanden, der mir das erzählte, bei jüdischen Hochzeiten, oder beim Jom Kippur in der Synagoge. Meine Eltern waren sehr traditionsgebunden. Bei Jiskor sagte meine Mutter, es ist besser, du gehst raus, es gibt hier Leute, die haben jemanden verloren, und weinen. Wahrscheinlich merkte ich mit der Zeit, das waren keine normalen Todesfälle, aber das war auf einer unterbewussten Ebene, es wurde nicht detailliert ausgesprochen. Es gab die Kriegsfilme, die Engländer drehten sehr viele Kriegsfilme, und wenn Deutschland bombardiert wurde, habe ich mich damals sehr gefreut. Als ich 11 oder 12 Jahre war, sind wir zum ersten Mal auf den Kontinent gefahren, nach Frankreich und die Schweiz. Nordfrankreich sah damals sehr schlecht aus. Mein Vater sagte, dass in Frankreich sehr viel bombardiert worden ist, nicht von den Deutschen, sondern von den Engländern, um die Deutschen zu treffen, die sich in den Häusern aufhielten. In der Schweiz haben wir in einem sehr schönen Hotel gewohnt. Als meine Mutter etwas gegen die Deutschen sagte, wurde der Hotelbesitzer plötzlich sehr kalt. Mein Vater, der Anwalt war, wollte jahrelang nicht reisen, den Urlaub hätte er gern immer in England verbracht, aber da war das Wetter immer sehr schlecht, und meine Mutter schwärmte dauernd von Europa. Irgendeinmal haben sie sich aufgemacht, sind hingefahren und danach wollte mein Vater gar nicht mehr damit aufhören. Er hatte dann eine Reise für uns drei gebucht, aber mein Großvater ist gestorben, und mein Vater konnte wegen der Shiva, der Trauer, nicht mitfahren. Meine Mutter und ich sind mit einem Bus gefahren, zum erstenmal durch Deutschland. Ich hatte keinen eigenen Pass, sondern wurde in den Pass meines Vaters eingetragen. Als wir in der Nacht zur Grenze kamen, wurden die Pässe eingesammelt. Danach kam der Grenzbeamte in den Bus, und begann, die Pässe zurückzugeben. Mein Vater war aber nicht da, und als meine Mutter ihm das zu erklären versuchte, starrte er uns an, und es wurde ungemütlich. Er sagte, wir schicken sie zurück. Die Engländer guckten ganz feindselig auf mich, weil ich sie aufhielt. Das war für mich ein bleibender Eindruck von den Engländern, ich fühlte mich dort nicht sehr wohl. Es stellte sich dann heraus, das der Grenzbeamte nur Spaß machte, wir durften weiterfahren, den Rhein entlang. Deutschland war ein einziger Trümmerhaufen und düster, meine Mutter war schockiert. Was wirklich geschehen war, erfuhr ich als ich 14 oder 15 war, ich habe es im englischen Radio gehört. Ein Engländer, der Kriegsgefangener in Deutschland war und etwas verbrochen hatte, wurde nach Auschwitz geschickt, und er erzählte, was dort passierte. Wahrscheinlich hatte ich schon früher von Gaskammern gehört, konnte nur noch nicht so vorstellen, wie das war. Der Engländer hat es für mich „bildhaft” gemacht. Es bedeutete für mich die Ernüchterung. Bis dahin hatte ich nur Fragmente gehört. Ich gehöre zu den Menschen, die sich grundsätzlich ausgeschlossen fühlen. Meistens war ich das einzige jüdische Kind in der Klasse. An den jüdischen Feiertagen ging ich als Einzige nicht zur Schule. Ich hatte dunkle Haare, dunkle Augen, ich sah nicht aus wie eine Engländerin. Jahrelang musste ich sagen, wo ich herkam. In meiner zweiten Schule gab es Gottesdienst, wo ich nicht hinknien durfte. Meine Mutter hat es mir verboten. In der Schule ging ich nur zum Religionsunterricht, wenn es sich um das Alte Testament handelte. Im nachhinein fand ich es sehr schlecht, dass ich die Geschichten des Neuen Testaments auf diese Weise nicht hören konnte. Es war für mich schon auf dem Gymnasium wichtig, dass ich jüdisch bin. Wahrscheinlich war ich auch eitel, ich dachte, etwas Besonderes zu sein. In der Grundschule hat die Lehrerin sehr nett gesagt, die Juden seien das auserwählte Volk. Nachdem der Staat Israel gegründet wurde, gab es viel Antisemitismus in England, auch weil sehr viele englische Soldaten in Palästina von Menachem Begin und seiner Gruppe getötet wurden. Selbst eine sehr gute Freundin von mir, die ich später, als wir erwachsen waren, traf, sagte mir, sie könnte Begin nie vergeben, weil er das Hotel King David in die Luft gesprengt hatte. Kaschrut, die jüdischen Speiseregeln wurden bei uns zu Hause streng befolgt. Aber als ich nicht immer in die Synagoge gehen und nicht Hebräisch lernen wollte, wurde ich nicht dazu gezwungen. Mein Vater sagte jedoch, wenn du nicht in die Synagoge gehst, weißt du nicht, wie das alles läuft, und dann wirst du dich fremd fühlen. In England habe ich Germanistik und Französisch studiert. In der Studienzeit verbrachte ich ein Semester in Wien und lernte deutsche Studenten kennen. Damit wurde die deutsche Problematik für mich viel akuter. Ich habe mich in einen deutschen Studenten verliebt. Er setzte sich mit seiner deutschen Geschichte auseinander, ich mich mit dem Problem der guten und schlechten Deutschen. Gern wäre ich mit diesem Mann zusammengeblieben, aber weil er Deutscher und kein Jude war, war die Sache sehr kompliziert und das hat mich dann davon abgehalten. Ich habe versucht, mit meiner Mutter darüber zu sprechen, aber sie lachte mich aus. Sie fand es absurd, dass ich mich für diesen Mann überhaupt interessieren konnte. Nach dem Studium bin ich ein Dreivierteljahr in Israel gewesen. In meiner Jugend war ich in zionistischen Organisationen, ohne wirklich daran zu glauben. Aber ich wollte wissen, was es mit Israel auf sich hat. Ich fühlte mich in England auch sehr eingeengt. Vor allem wollte ich von meiner Mutter loskommen. Als ich nach England zurückkehrte, hatte ich das Gefühl, dass ich wieder nach Europa gehen sollte, eventuell nach Deutschland, obwohl ich auch Hass gegenüber Deutschland fühlte. Aber ich war dem Land gegenüber sehr emotionell eingestellt. Ich hatte diesen Freund dort, mit dem ich die Verbindung gelöst hatte, weil ich dachte, ich müsste wie eine Jüdin leben, mich der jüdischen Identität fügen. Nach einem Jahr lernte ich dann einen jüdischen Engländer kennen. Wir haben geheiratet, obwohl wir uns kaum kannten. Nach einigen Jahren spürte ich wieder die Unruhe, ob ich in dieser Ehe bleiben sollte. Ich dachte, einen großen Fehler begangen zu haben, ich hatte das Gefühl, nicht hierher zu gehören, keine Engländerin zu sein. Ich wollte schreiben, aber es ging nicht, ich hatte ständig Schreibblockaden. Mit 11 Jahren fing ich an zu schreiben, und als ich 17 Jahre alt wurde, hatte ich bereits 5 Romane geschrieben. Die taugten aber nichts, sie waren Nachahmungen von Sachen, die ich gelesen hatte. In England arbeitete ich zuerst bei einem Verlag als Lektoratsassistentin, aber als wir heirateten, sind wir nach Schottland gezogen, weil mein Mann dort an der Universität eine Stelle bekam. Immer noch hatte ich die deutsche Besessenheit. Einmal waren wir mit meinem Ehemann in Berlin und trafen meinen alten Freund aus meiner Studienzeit. Die Ehe ist durch diese Begegnung wackelig geworden. Trotzdem sind wir später nach Strasbourg gegangen, wo wir uns dann trennten. Wahrscheinlich kannte ich mich nicht gut genug, als ich mich für diese Ehe entschied, und zwang mich, in eine Richtung zu gehen, in die ich eigentlich nicht gehen sollte - in das Angepasste. Vielleicht hatte ich Angst davor, mich in Europa allein durchschlagen zu müssen. So bin ich den leichtesten Weg gegangen, oder aber den schwersten. Meine Familie war gegen die Scheidung, gegen das Austreten aus diesem respektablen englisch-jüdischen Hintergrund. Eine Zeit lang habe ich mich für jüdische Sachen gar nicht interessiert. In der Gemeinde in Strasbourg wusste niemand, dass ich da war. Das war eine Trotzreaktion. Zuerst gab ich auf der Universität audiovisuellen Englischunterricht, danach habe ich 4 Jahre lang am britischen Generalkonsulat die Bibliothek betreut und Informationsarbeit gemacht. Die deutsche Sprache hat mich auch in der Zeit angezogen, als ich in Frankreich war. Ich versuchte, ein wenig französisch zu schreiben, aber es ging nicht, es war nicht meine Sprache. Ich habe eine Psychoanalyse gemacht. In England hatte ich nämlich Depressionen und begann Beruhigungsmittel zu nehmen. In Frankreich fühlte ich mich viel besser, obwohl es dort für mich, auch als Ausländerin, sehr schwer war. Trotzdem konnte ich mich durchsetzen. Von Frankreich nach Deutschland bin ich nur gekommen, weil ich anfing, mich für die Anthroposophie zu interessieren. Adam, mein Sohn, war noch sehr klein, und eine Engländerin hat mir vorgeschlagen, ihn in die Rudolf Steiner Schule in Strasbourg zu geben. Das habe ich auch getan, ich gab ihn in den Kindergarten dieser Schule. Die Schule war außerhalb des französischen Schulsystems. Anthroposophie, die pantheistische Einstellung zum Leben, interessierte mich, ohne dass ich wirklich wusste, was es ist. Durch das Zusammenspiel von Denken, Fühlen, Wollen, sowie Leib, Seele und Geist fühlte ich mich angezogen. Vielleicht habe ich diesen Ausgleich gesucht. Viele hielten mich für verrückt, als ich beschloss, nach Deutschland zu gehen, um ein anthroposophisches Studienseminar mitzumachen. Wieso würde ich diese sichere Stelle, meine spätere Rente aufgeben? Zuerst wollte ich dieses Seminar in der Schweiz machen, aber es ging nicht wegen der Schule von Adam. Dann sind wir auf Stuttgart gekommen, man hat es mir empfohlen, weil dort auch ein Zentrum der Anthroposophie ist. Mit Adams Vater hatten wir ein Haus in England. Mein Anteil wurde abgekauft und mit diesem Geld konnten wir ein Jahr leben. So sind wir 1976 in eine Souterrainwohnung gezogen - anderthalb Zimmer, 25 Quadratmeter -, und dort haben wir drei Jahre gelebt. Das Seminar hat mir sehr viel gebracht, es war anregend, die geistigen Vorstellungen von der Welt, die Rudolf Steiner hatte, kennen zu lernen. Dass man von dem Geist ausgehen soll, anstatt der Materie, war eine sehr gute Brücke für mich zur Philosophie, mit der ich mich früher beschäftigt hatte. Ich fing wieder an zu malen. In der Kindheit habe ich auch gemalt. Ich schrieb dann einen ersten Artikel auf deutsch, er wurde veröffentlicht in der Zeitschrift der anthroposophischen Gesellschaft „Die Drei”. Nach dem Studium erhielt ich eine Stelle bei dem anthroposophischen Verlag „Freies Geistesleben”, und blieb dort zehn Jahre. Für die Zeitschrift schrieb ich Buchbesprechungen zur deutsch-jüdischen Thematik und konnte mich auf diese Weise auch über die Geschichte der Juden in Deutschland informieren. Nach zwei Jahren habe ich gezögert, ob ich wieder nach Frankreich zurückgehen soll. Unter den Anthroposophen gab es auch alte Nazis, aber sehr viele waren jüdischer Herkunft. Die Anthroposophen nahm ich immer in Schutz, wenn behauptet wurde, dass sie antisemitisch seien, aber am Rande gab es wirklich einige esoterische Grüppchen mit einigen alten Nazis, die furchtbare Artikel veröffentlicht haben, zum Beispiel über die Auschwitz-Lüge. In dem ersten Jahr hatte ich überhaupt keine schlechten Gefühle in Deutschland. Als ich nach Deutschland kam, dachte ich, alles für mich gelöst zu haben: Die jungen Deutschen, die erste Nachkriegsgeneration waren nicht schuld, nur die Eltern, und sie sterben sowieso. Aber als ich dann Rezensionen über anthroposophische Bücher, sowie Bücher mit literarischer Thematik für diese Zeitschrift schrieb, und das Buch, „Der gelbe Stern” las, wurde es für mich sehr problematisch. Die Gesichter dieser Frauen, die Aufseherinnen in Auschwitz gewesen sind und abgebildet wurden, kamen plötzlich auf mich zu, parallel damit, dass ich jetzt dort wohne, wo das alles passiert ist. Irgendwie hatte ich das verdrängt, und obwohl ich stark ins Schwanken kam, auch wegen einer Beziehung zu einem französischen Mann, wieder wegzugehen, bin ich dann geblieben, weil ich spürte, dass es mit Deutschland für mich nicht zu Ende war. Ich glaube, ich brauche diese Konfliktsituation. Mein Sohn bevorzugt es, englisch zu sprechen, ich antworte ihm auf deutsch. Seine Frau ist eine Deutsche, die zum Judentum übergetreten ist. Er will keine deutsche Identität haben. Adam hatte eine frühere Freundin, mit der ich mich besser verstand, als mit meiner Schwiegertochter - ich kannte sie auch viel besser. Ihr Großvater war sehr antisemitisch und ich sagte ihr, ich würde ihm trotzdem eine Chance geben. Da sagte sie: „Das ist der Unterschied, er gibt dir keine.” Bei Bettina, meiner Schwiegertochter, weiß man zum Beispiel nicht, was der Großvater eigentlich im Krieg getan hat. Er war Assessor irgendwo im Osten. Diese Geschichten, die nicht gelüftet werden, finde ich sehr problematisch. Über die Anthroposophie bin ich dann langsam zum Judentum zurückgekommen. Ich hatte das allgemeine religiöse Gefühl, und war von dem Christusimpuls der Anthroposophie sehr angetan. Steiner nennt Jesus den Menschheitsrepräsentanten. Im Seminar haben wir Teile der Bibel analysiert, die Gespräche zwischen Moses und dem brennenden Dornbusch, weil es für die Anthroposophie auch grundsätzlich ist, dass die Stimme Gottes sagt, „ich bin der, der ich sein werde”. Zum Judentum bin ich auch deshalb zurückgekommen, weil mein Sohn Bar-Mizwa machen musste. Er musste, weil mein Vater es ansonsten nicht verkraftet hätte. Ich hatte auch das Gefühl, ich habe nicht das Recht, meinem Sohn das Jüdische vorzuenthalten. Ich sollte es ihm zeigen, und wenn er es später nicht wollte, könnte er selbst entscheiden. Adam konnte überhaupt kein Hebräisch, so habe ich vor seinem Bar-Mizva bei der Jüdischen Gemeinde angerufen und wir sind jeden Freitag abend hingegangen und holten ein bisschen nach. Seinen Bar-Mizwa hat er dann in England gemacht. Durch die Gemeinde, die Leute, die ich dort kannte, aber auch durch die Anthroposophie, begann ich dann, mich für die jüdische Mystik, Martin Buber, den Chassidismus zu interessieren. In der Gemeinde leitete ich einen Arbeitskreis über Bubers Buch „Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre”. In der Gemeinde hatte ich Konflikte wegen der Beurteilung der Geschehnisse im Nahen Osten, im Zusammenhang mit dem Libanonkrieg Anfang der 80-er Jahre. Nach dem israelischen Einmarsch, dem Massaker in Sabra und Shatila im Jahre 1982 regte ich in der Gemeinde eine Diskussion an. Danach gründete ich einen Arbeitkreis, und ich nahm Kontakt auf zu der jüdischen Gruppe in Frankfurt, die ein Treffen von Gruppen organisierte, die außerhalb der Gemeinden tätig waren. Diese bildeten sich während des Libanonkrieges, sie haben den Krieg und die israelische Politik kritisiert. Die deutsch-jüdische Problematik kam dann auch deshalb verstärkt auf mich zu, weil ich nach sieben Jahren jemanden kennenlernte, den Mann, mit dem ich kurz verheiratet war. Das war eine katastrophale Beziehung und das bestimmte auch mein Verhältnis zu Deutschland. Ende 1986 bin ich nach Berlin gezogen. Mein zweiter Mann war Verleger gewesen. Ich dachte, in der Zwischenzeit wüsste ich schon, wie die Deutschen sind. Mein Mann kam aus einer Nazifamilie, aber er konnte mir glaubhaft machen, dass er das Opfer seines Vaters war. Heute weiß ich - es ist ein bekanntes psychologisches Phänomen unter Deutschen der ersten und wahrscheinlich auch der zweiten Nachkriegsgeneration - dass die Kinder, deren Eltern Nazis waren, sich immer für die Opfer ihrer Eltern halten und dramatisieren, wie viel sie gelitten haben. Dieser Mann stellte es auch so dar: er wollte mit den Juden sympathisieren, weil sie die Opfer waren, aber er stellte sich auch als Opfer - Opfer seines Vaters dar. Er fühlte sich angeblich von mir bedroht, an allem, was nicht ging, war ich schuld. Später sagte mir eine Psychotherapeutin, zu der sowohl ich, als auch er ging, dass er durch mich seine Beziehung zu seinem Vater abgearbeitet hätte. Ich wollte mich von ihm nicht trennen, wahrscheinlich wegen der ersten Scheidung. Es war mir wichtig zu zeigen, dass ich doch eine Beziehung haben kann die gutgeht. Deshalb haben wir dann geheiratet, obwohl wir uns sehr viel stritten. Die Probleme, die zwischen uns bestanden, und die ich in der Ehe zu lösen gedachte, blieben weiterhin bestehen. Diese Heirat war also ein Fehler. Dann war er es, der die Scheidung 1992 beantragte. Die Scheidung bedeutete für mich das Ausgestoßensein, ich hatte das Gefühl, heimatlos zu sein. Wie seit meiner Kindheit, hatte ich auch nach dieser Beziehung Schuldgefühle, das überhaupt alles meine Schuld ist, wenn etwas schiefgeht. Ich habe die Schlussfolgerung gezogen, dass es manchmal sehr kompliziert ist, eine Beziehung zu einem nichtjüdischen Deutschen zu haben. Alle Deutsche haben Probleme mit der Vergangenheit, denke ich. Wie sie dieses Problem lösen, ist ihre Sache, aber sie sollen es versuchen, sie zu lösen. Es muss nicht unbedingt mit der Hilfe von Juden sein. Zwar gibt es immer wieder eine gute Ehe zwischen Deutschen und Juden, ich selber bin aber sehr skeptisch. Das heißt nicht, dass ich nichts mit Deutschen zu tun haben möchte, ich habe sehr viele Freundschaften. Aber nach dieser Ehe ist meine Naivität, die ich Jahre lang hatte, weg. Ich bin viel unerbittlicher geworden. Adams Vater hat mich damals auch gefragt, als er in Frankreich darauf bestehen wollte, dass sein Sohn englisch erzogen wird, was ich nun bin, wie ich mich sehe. Ich sagte ihm, ich bin ich. Er lachte ironisch, meine Antwort war ihm unverständlich. Ich bin Jüdin, und das ist das Leben, das ich für mich ausgesucht hatte und zu dem ich stehe. Und ich schreibe auf deutsch. In Gesprächen mit Freundinnen, insbesondere mit einer, habe ich das Gefühl, ich quäle sie mit der Geschichte und den halb ausgesprochenen Vorwürfen gegen die Deutschen. Einmal fragte ich sie, ob sie sich mit meinen Bemerkungen schwertut, und sie sagte, sie könne damit leben. Diese Zerrissenheit erlebe ich sicher. Vielleicht brauche ich das zum Schreiben. Ich schreibe jetzt meinen zweiten Roman. Im ersten, „Die Rubinenfrau”, geht es um England, um jüdische Identität und Sprache. Der zweite Roman beschäftigt sich mit Deutschland, die Erfahrungen des Landes und seiner Leute. Ich bin hier, weil ich es zu einfach finde in England zu leben. Als ich in Frankreich lebte, war es dort teilweise auch oberflächlich. In Israel würde ich wahrscheinlich in genauso einer Spannung leben, wie in Deutschland, weil ich mich dort für die Palästinenser einsetzen würde, und das wäre noch problematischer. Vielleicht lebe ich in Deutschland, weil ich zu feige bin, um nach Israel zu gehen. Aber ich gehe nicht nach Israel, weil ich nicht nur mit Juden zusammenleben möchte. Offensichtlich geht es mir um diese „deutsch-jüdische” Spannung, die ich in mir spüre. Jedem Menschen sollte es, glaube ich wichtig sein, das eigene aggressive Potential zu erforschen. Ich habe mich auch gefragt, und frage mich heute noch, wozu wäre ich eigentlich fähig. Oft frage ich mich, ob ich sadistisch genug gewesen wäre, jemanden zu töten oder zu foltern, oder ob ich bürokratisch genug und feige genug gewesen wäre, einfach Befehle auszuführen. Die meisten Deutschen setzen sich nicht mit der eigenen Aggressivität auseinander und es wird immer auf andere Gruppen projiziert, ob es die Ausländer sind, oder die Juden. Es ist ein grundsätzliches Problem, dass jeder Mensch die eigenen Schattenseiten erkennen soll. Wahrscheinlich hat mir die deutsche Erfahrung geholfen, meine Schattenseiten zu erkennen und damit zu leben. Offensichtlich habe ich Probleme damit, mich in einer Gruppe festzulegen. Ich bin nicht Gemeindemitglied hier, weil ich mit dem Gedanken gespielt habe, in Polen Mitglied der Gemeinde zu werden. Für Polen interessiere ich mich sehr, ich möchte dort mehr Zeit verbringen. Von der deutsch-jüdischen Problematik bin ich auch zur polnisch-jüdischen Problematik übergegangen. Das Interesse kommt daher, dass mein Großvater Fruchtman damals aus Polen kam. Und nachdem ich viel Böses in meiner Jugend über Polen gehört habe, nach dem ich 1985 endlich nach Polen fuhr, lernte ich sehr sympathische Polen kennen. Ich schreibe Features über Polen für den Rundfunk, vor zwei Jahren schrieb ich das erste, über zwei auserwählte Völker, Juden und Polen. Das zweite heißt jetzt Verletzungen der Geschichte Juden, Polen, Kommunisten. England ist nicht mein Land, obwohl ich einen englischen Pass habe. Ich behielt den Pass, damit, wie ich ironisch sagte, die Deutschen nicht die Genugtuung haben sollen, mir die deutsche Staatsbürgeschaft wieder abzusprechen. Zur Zeit finde ich es nämlich ziemlich unheilvoll hier. Die hundert umgekippten Grabsteine in Weissensee, die Erfahrung meiner Freundin, die von 10 jungen Männern „Judenschwein” genannt worden ist, und die Weigerung des regierenden Bürgermeisters von Berlin, zur symbolischen Grundsteinlegung des HolocaustDenkmals hinzugehen, das sind alles gefährliche Zeichen. Als ich in Deutschland ankam, dachte ich, die Deutschen würden nie wieder so etwas zustande bringen wie Auschwitz. Aber heute bin ich anderer Meinung. Viele neigen dazu, zu denken, wenn man nicht Deutsche ist, ist man kein Mensch. Trotz allem Positiven, was sie machen, gibt es eine Abgrenzung gegen die Nichtdeutschen. Man muss sich nicht immer auf den Holocaust berufen, um sich definieren zu können. Aber man ist ja schließlich in Deutschland. In meiner Kindheit hatte ich immer Alpträume, ich träumte, man ist hinter mir her. Im Traum habe ich mich immer in Dachkammern versteckt. Teilweise kam das bestimmt von der Lektüre, aber teilweise von einer Angst, die auf mich irgendwie übertragen worden ist. Andere hatten auch diese Träume, die Überlebenden auf jeden Fall, und noch viel schlimmere. Das kann man einfach nicht ignorieren, und ich glaube, es ist noch nicht zu Ende. Es geht nicht um die Selbstdefinition, aber es gehört zur Geschichte. Man fragt sich, wie ist das normale Leben in diesem Land heute möglich? Denn das Leben hier ist normal, aber was hier in der Vergangenheit passiert ist, ist nicht normal. Es ist wahrscheinlich in jedem Land nach einem Verbrechen so. Wenn man nach Polen fährt, hat man das Gefühl, es ist ein grosser Friedhof, mit Polen und Juden, und Russen, wer auch immer da war. In Deutschland ist es anders, es gibt Fassaden, Masken. In Berlin ist es offener, aber in Stuttgart war alles weißgetüncht und zugepinselt. Ich habe erst nach Jahren herausbekommen, dass in Killesberg das Sammellager war. Bis man die Geschichte in allen Einzelheiten erfährt, verstreicht sehr viel Zeit. Ich muss herausfinden, wie das hier ist. Vielleicht bleibe ich deshalb in Deutschland. Auch mein berufliches Leben habe ich hier mühsam aufgebaut - ich schreibe nur auf deutsch. Vielleicht ist meine Heimat in der Sprache - in der deutschen Sprache. Heidi Stern „Die Bemerkung, die ich oft höre: »Was erwartest du schon von Deutschen?« finde ich falsch” Heidi Stern ist 1957 in Havanna geboren. Sie kam nach der kubanischen Revolution nach Israel, da war sie gerade 3 Jahre alt. Durch die Anregung von zwei Professoren an der Hochschule für bildende Künste in Tel Aviv setzte sie sich in den Kopf, in Deutschland weiter zu studieren. Sie hat nur eine Hin-Fahrkarte gelöst. Seit 1984 lebt sie in Berlin, unter sehr bescheidenen Verhältnissen. In ihrer Wohnung ist das eine Zimmer als Atelier eingerichtet. Die „heilige Unordnung” bezeugt, dass hier eine Künstlerseele haust. Deutschland war zwar für mich das Land des Teufels, aber ich wollte es kennen lernen. Vielleicht weil ich dachte, dass ich mir dort vieles erklären könnte. Obwohl ich in Kuba geboren bin, hat mich alles nach Europa gezogen. Ich war sehr neugierig darauf. Und Europa war für mich Deutschland. Wohin sollte man auch in Europa gehen, wenn nicht nach Deutschland? Man geht nicht nach Paris, wo es schön ist. Man geht zum Teufel, um ihn zu treffen. In Israel gibt es im Zusammenhang mit Deutschland und dem Holocaust keine Fragen, nur endgültige Antworten. Ich wollte sehen, was dieser Hass und diese Angst ist. Wenn man mit einem Namen wie Heidi Stern nach Deutschland kommt, ist es sozusagen ideal. Bevor ich meinen Mund aufmache, denken alle, ich wäre Deutsche, oder wenigstens Europäer. Mir wurden zwei Namen gegeben, Heidi Sarah. Als ich geboren wurde, hat meine Schwester das schweizerische Kinderbuch „Heidi von den Bergen” gelesen, und sie wollte unbedingt, dass man mich so nennt. Es ist zwar sonderbar, dass meine Eltern nach dem, was sie durchgemacht haben, mir einen deutschen Namen gaben, aber wahrscheinlich war das für sie eben ein Schweizer Name. Was mit meinen Eltern zur Zeit des Holocaust passiert war, wusste ich immer. Vielleicht schon von Geburt an. Natürlich ist das Unsinn, aber ich glaube, wenn man zu Hause nicht darüber redet, weiß man als Kind schon, dass die Familienmitglieder nicht eines natürlichen Todes gestorben sind. Eine Szene habe ich in Erinnerung, da war ich noch im Kindergarten. Um sieben Uhr abends gab es im israelischen Radio ein Programm, wo Überlebende und Verwandte gesucht worden sind. Ein Sprecher nannte Namen, „der und der wird gesucht, von seiner Schwester, seinem Bruder” usw. Ich sass auf dem Boden und spielte ganz ruhig. Mein Vater lief hin und her, völlig nervös um das Radio herum. Meine Mutter sagte nur: „Ach, die finden sowieso niemanden, alle sind tot”. Mein Vater wandte sich ihr kurz zu: „Pst!”, er wollte nämlich alle Details weiterverfolgen. Ich wusste, dass auch bei uns viele Familienmitglieder fehlten, aber gesprochen haben meine Eltern darüber nie. Auch unter sich nicht. Darüber, was im zweiten Weltkrieg geschah, habe ich mir viel den Kopf zerbrochen, Es bestimmte ja auch mein Leben. Aber ich sprach darüber auch mit meiner Schwester nicht. Meine Mutter hatte oft Alpträume in der Nacht. Ich wachte auf davon, dass sie weinte, oder schrie. Als ich größer war, fragte ich sie ab und zu, was sie geträumt hat. Wenn sie noch nicht ganz bei sich war, sagte sie es, ansonsten nur: „Geh schlafen, es ist nichts”. Ich habe es noch in Erinnerung, dass ich dachte, man erzählte mir über den Holocaust in der Schule, obwohl wir ihn in der Familie erlebt hatten. Mit einem Herzklopfen fragte ich meine Mutter: „Woher weißt du, dass sie alle tot sind?” Sie sagte, das ist doch klar. Ich ließ nicht locker. „Woher weißt du, hast du es gesehen?” Ja, war die Antwort. „Aber was hast du gesehen?” Meine Mutter wiederholte nur: „Sie sind tot”. Auf Kinder in meiner Klasse, die aus Nordafrika kamen, war ich sehr neidisch, weil sie ihre ganze Familie hatten. Eine ganz große Familie, mit Großeltern, Tanten und Cousins. Meine Mutter kommt aus der Tschechoslowakei, aus Munkacs, was heute zur Ukraine gehört. Mein Vater kommt aus Transsylvanien, aus Oradea. Beide konnten sehr gut ungarisch und auch deutsch. Der Vater meiner Mutter ist 1939 an einer Krankheit gestorben, ihre Mutter in Auschwitz. Meine Mutter war zuerst im Ghetto, wurde dann Anfang 1943 mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern nach Auschwitz deportiert. Sie war damals 21 Jahre alt. Eine ihrer Schwestern war die ganze Zeit über mit ihr. Obwohl meine Mutter fast nie darüber sprach, wie ich es rekonstruieren konnte, hat meiner Mutter die Sorge um ihre um ein Jahr ältere Schwester Kraft verliehen. Sie dachte, nur ihre Schwester wäre ihr aus der Familie geblieben. Aber aus den 7 Geschwistern haben insgesamt vier überlebt. Mein Vater überlebte den Krieg, indem er sich versteckte. Er hat nie genau erzählt wo und wie, nur, dass er mit drei Freunden während der ganzen Zeit zusammen blieb. Sie versteckten sich in irgendeinem Loch und sind von Leuten, die Mitleid mit ihnen hatten, versorgt worden. Mein Vater hat Angst vor dem Eingeschlossensein und das stammt wahrscheinlich aus dieser Zeit. Diese drei Männer, über die mein Vater erzählte, lebten später alle in Israel. Ein Bruder von meinem Vater und zwei Schwestern waren auch in Auschwitz, sie haben überlebt, aber seine Mutter wurde dort ermordet. Meine Mutter und mein Vater sind 1947 nach Belgien gegangen. Sie lernten sich dort kennen. Dort sammelte sich eine große Gruppe von jungen Überlebenden an, die die Absicht hatten, nach Palästina zu gehen. Meine Mutter gehörte zu „Hashomer Hazair”, „Der junge Wächter”, einer jüdischen sozialistischen Organisation. Die ältere Schwester meiner Mutter sollte noch vor dem Krieg gezwungen werden, einen älteren tief religiösen Mann zu heiraten. Das wollte sie aber auf keinen Fall und ist bis nach Kuba geflohen. Sie wusste überhaupt nicht, was mit ihrer Familie während des Krieges geschah. Durch jüdische Organisationen in New York versuchte sie das herauszufinden und erfuhr, dass zwei Schwestern überlebt haben und in Belgien sind. Sie schickte zwei Fahrkarten für das Schiff, um sie noch zu sehen, bevor sie nach Palästina auswandern. Da antwortete ihr meine Muter, dass sie eine dritte Karte brauchen würden, in der Zwischenzeit hatte sie nämlich in Belgien meinen Vater geheiratet. Sie wollten nur ein paar Wochen in Kuba verbringen, daraus sind dann 13 Jahre geworden. Mein Vater wurde Bauarbeiter. Außerdem, da er Hebräisch konnte, hat er in Kuba Kinder zu ihrem Bar-Mizwa vorbereitet. Obwohl meine Eltern beide in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen sind, sind ich und meine Schwester überhaupt nicht religiös erzogen worden. Meine Mutter hat nur anerkennend über die Kubaner gesprochen. Sie war für die Ideen Castros, aber nach der Revolution hatte sie Angst vor dem Wirrwarr, vor der Unstabilität. Sie meinte, sie würde es seelisch nicht mehr verkraften, wenn etwas Schlimmes passiere. Sie wollte nach Hause, nach Israel. Meine Mutter war sehr zionistisch. Ihre Freunde, die den Holocaust auch überlebt hatten, lebten alle in Israel in einem Kibbuz. Meinen Vater hat es nicht so sehr nach Israel getrieben. Er kann sich den Umständen mehr anpassen, er wollte immer dort sein, wo es bequem ist. Aber der Wunsch meiner Mutter hat gesiegt, wir sind nach Israel übersiedelt. In Israel gingen wir in den Kibbuz Haogen neben Haifa, wo die Freunde meiner Mutter lebten. Wir blieben aber nur 9 Monate lang, weil mein Vater das dortige System überhaupt nicht gut fand. Anfang der 60-er Jahre war es noch in allen Kibbuzen sehr streng. Die Kinder wohnten nicht bei ihren Eltern, sonder in einem gemeinsamen Heim. Ich war 3 Jahre alt und habe jede Nacht geweint. Meine Schwester, die 6 Jahre älter war, fand das Kibbuzleben wunderbar. Eines Tages hielt es mein Vater in dem Kibbuz nicht mehr aus. Er ging weg, um Arbeit zu suchen. Das ist ihm auch gelungen am Toten Meer, wo die Anlagen zur Herausnahme von Salz gebaut wurden. Er wurde Bauarbeiter. Meine Mutter aber wollte unbedingt im Kibbuz bleiben. Sie sagte, sie wäre auch bereit, sich von meinem Vater scheiden zu lassen. Ihre Beziehung war schon in Kuba nicht sehr gut. Aber im Kibbuz wollte man eine Frau mit zwei Kindern, ohne Ehemann nicht haben, deshalb musste sie weg. Wir sind nach Beer Sheva gegangen und ich wurde dann in dieser trostlosen Stadt groß. Mein Vater kam nur an den Wochenenden nach Hause, aber das war besser so, weil meine Mutter ihn nicht ertragen konnte. Unter einander haben sie spanisch gesprochen- mit uns hebräisch - und wenn sie sich ganz stark stritten, wechselten sie ins Ungarische über. Als ich 10 Jahre alt war, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Mein Vater wollte das nicht, aber es ging nicht weiter. Meine Mutter sagte mir später, er war der erste Mann, der sie nach dem Krieg umarmt hatte, und ohne lang zu überlegen, hat sie ihn geheiratet. Sie mochte nicht, dass er andauernd Dinge erzählte, von denen nur ein Bruchteil wahr war. Mein Vater ist eben ein Träumer. Die Scheidung nahm ihn sehr mit. Dass sich meine Eltern getrennt hatten, erfuhr ich erst zwei Jahre später, dann hat es mir meine Mutter gesagt. Es war schwer für uns. Da sich meine Mutter hat scheiden lassen, konnte laut rabbinischem Gesetz mein Vater entscheiden, wie viel Geld er als Unterhalt zahlt. Um meine Mutter zu bestrafen, wählte er die niedrigst mögliche Summe. Das war sehr wenig, und wir hatten große Schwierigkeiten, um damit auszukommen. Meine Mutter nähte auch ab und zu, um Geld zu verdienen. Zu meinem Vater hatte ich keine gute Beziehung, das war aber die Schuld meiner Mutter, weil sie schlecht über ihn sprach. Er ist auch heute ein schwieriger Mensch. Mittlerweile war er ein zweites Mal verheiratet. Seine Frau ist vor einem Jahr gestorben und jetzt ist er wieder allein. Nachdem sich meine Eltern geschieden hatten, sah ich meinen Vater kaum noch, ich war mit meiner Mutter immer allein. Meine Schwester ist in den Kibbuz Negba gegangen. Es gab ein Programm, Kinder aus ärmlichen Verhältnissen im Kibbuz aufzunehmen. Sie hat das Gymnasium dort besucht. Die Beziehung zu meiner Mutter war auch sehr schwierig. Sie war unbeholfen und bedrückt, wie gelähmt. Es ist brutal zu sagen: als Kind hat mich das genervt. Obwohl ich tiefe Gefühle für sie empfand, zeigte ich ihr das nie. In der 10. Klasse bin ich einfach vom Gymnasium weggegangen. Ich hatte keine Lust mehr. Obwohl ich wusste, dass ich mir dadurch vieles verbaue, wollte ich nicht in die Schule. Was ich aber will, wusste ich nicht genau,. Ich habe immer gezeichnet. Als ich dann von der Schule ging, fing ich an, sehr viel zu zeichnen und unentwegt zu lesen, alles, was es gab: Literatur, Geschichte,... einfach alles. In der Schule war ich sehr gut in Geschichte und Literatur, in Mathematik dagegen sehr schlecht. Als ich von der Schule ging, habe ich ab und zu gearbeitet, an einer Tankstelle, oder auf Kinder aufgepasst. So ging es, bis ich mit 19 Jahren zur Armee kam. In der Zwischenzeit versuchte ich, Abitur zu machen. Aber all die Lehrer vom Gymnasium, mit denen ich Probleme hatte, lehrten auch an der Abendschule. Sie waren zu diesem Zweitjob gezwungen, weil die Lehrer sehr schlecht bezahlt wurden. Über das Alte Testament und in hebräischer Grammatik legte ich die Prüfung ab, den Rest wollte ich nach dem Militärdienst machen. Aber dann hatte ich keine Lust mehr. Die zwei Jahre, die ich bei der Armee verbracht hatte, waren verlorene Zeit. Mehr will ich darüber nicht sagen. 1979 ist meine Mutter gestorben. Sie hatte Wasser in der Lunge, das das Herz traf. Es war eine Zeit, die ich gern vergessen möchte. Es blieben so viele Fragen unbeantwortet. Mit meinem Vater hatte ich nach wie vor keinen guten Kontakt. Mit meiner Schwester schon, aber wir sind sehr verschieden. Eigentlich wollte ich Geschichte studieren, aber dann dachte ich, das wäre nichts für mich, in einem Keller zu hocken und Akten zu studieren. Ich erinnerte mich, dass ich sehr gern zeichne - immer Gesichter. Das war so selbstverständlich für mich, dass ich gar nicht daran dachte, das als Beruf auszuüben. Aber dann kam die Idee, doch Kunst zu studieren. In Beer Sheva gibt es eine Kunstschule, an die ich aufgenommen worden bin. Die Zukunft der Hochschule schien aber unsicher. Es war die Rede davon, dass sie eventuell geschlossen wird, deshalb entschied ich mich dafür, an die Hochschule in Tel Aviv zu gehen. Endlich hatte ich das Gefühl, meinen Platz gefunden zu haben. Alles stimmte, die Menschen und meine Berufung. Ein Professor kam zurück aus Hamburg, wo er sich weiterbildete. Er bekam einen Lehrauftrag an meiner Schule, in meiner Klasse. Ich betrachte das als schicksalhaft, als einen Moment der Gnade. Er hat große Anforderungen an mich gestellt. Irgendwann sagte er mir: „Heidi, du solltest nach Deutschland gehen, das wird dir gut tun”. Im zweiten Studienjahr kam auch eine Kunstlehrerin aus Österreich zurück. Sie hat mir auch so viel erzählt, und bei mir den gesäten Samen weiter gepflegt. Wenn meine Mutter gelebt hätte, wäre ich nie nach Deutschland gegangen. Ins Ausland zu gehen war für mich ein Traum, woran ich nicht allzu oft denken durfte. Geld hatte ich nämlich nicht. Tel Aviv ist eine wunderbare Stadt. Dort konnte ich viel freie Luft atmen, und davon habe ich Lust bekommen, noch mehr frische Luft zu schnappen. Israel ist ja so eng und bedrückend. Unsere Hochschule lag fast an der Küste. Wir gingen hin, ich sah mir das Meer an und dachte, da ist die weite Welt, dorthin wollte ich. Die zwei Professoren haben erzählt, wie offen es da wäre, wie viele Möglichkeiten es dort gäbe. So habe ich beschlossen, nach Deutschland zu gehen. In Tel Aviv arbeitete ich in einem Buchladen als Putzfrau und legte, so viel ich konnte, auf die hohe Kante. Ich bin ins Goethe Institut gegangen, ich wollte Deutsch lernen. Die Begegnung dort mit meiner Deutschlehrerin war auch sehr wichtig für mich. Sie kam aus Berlin, war sehr nett und eine gute Lehrerin. Als sie hörte, dass ich nach Deutschland wollte, sagte sie, dann gehe nur nach Berlin, denn in Deutschland gibt es nur eine Stadt: Berlin. Das habe ich auch akzeptiert, obwohl mein Professor überhaupt nicht verstehen konnte, wie man auf die Idee kommt, aus Israel in eine Stadt zu gehen, die durch eine Mauer geteilt ist. Als ich an der Hochschule mein Diplom erhielt, ging ich zur deutschen Botschaft. Der Kulturattaché schien nicht sehr begeistert zu sein, als ich sagte, ich würde gern mein Studium in Deutschland fortsetzen. Sie sagte, nach Frankfurt könnte ich nicht, dort gäbe es zu viele Juden und überreichte mir Prospekte von Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Koblenz, aber nicht von Frankfurt. Ich schrieb nach Berlin und sicherheitshalber auch nach Düsseldorf, an Gerhard Richter, dass ich dort studieren möchte. Richter antwortete mir, zwar sei seine Klasse voll, aber ich sollte kommen. Von der Berliner Hochschule antwortete man, gerne, aber ich müsste eine Aufnahmeprüfung machen. Da fing das Problem mit den deutschen Behörden an. Wenn man nicht als Tourist nach Deutschland gehen will, muss man ein Visum haben. Aber um ein Visum zu bekommen, muss man schon an der Universität eingeschrieben sein. Weil ich aber unbedingt hin wollte, kümmerte ich mich nicht um die Formalitäten. Mittlerweile hatte ich 2000 Mark zusammengespart. Um ein Ticket zu kaufen, ging ich ins Reisebüro. Man fragte, hin und zurück? Ich sagte, nur hin. Es durfte einfach nicht passieren, dass ich mich in Deutschland nicht wohl fühle und zurück will. In meinem Kopf war: ich muss da studieren, und das mache ich um jeden Preis. Dann fuhr ich noch vorher für eine Woche nach Amsterdam, wo ich eine Freundin hatte und nahm im Dezember 1984 den Zug nach Berlin. Es war ein grauer Tag. Aus Amsterdam fuhr ich um 9 Uhr ab und ich kann mich erinnern, ich guckte in den Himmel und dachte, dass erträgst du nicht. Wo ist die Sonne, warum geht die Sonne nicht auf? Mit zusammengerollten Bildern kam ich an. Obwohl ich eigentlich ein gutes Gedächtnis habe, kann ich mich an die zwei Jahre, die daran folgten nicht so gut erinnern. Sie waren sehr schwer. Ich suchte mir Wohnung, und besuchte Deutschkurse. Bald hat sich herausgestellt, dass diese 2000 Mark überhaupt nicht viel sind. Die andere Mentalität, die ich hier vorfand, hat mich schockiert. Du kommst in ein fremdes Land, und du musst alles lernen. Es kommt dir vor, als wärest du auf einem anderen Planeten. Aus Naivität habe ich auch sehr viele Fehler gemacht. Ich kannte niemanden mit Ausnahme der Frau, in deren Wohnung ich die erste Zeit über bleiben konnte. Damals war ich jung und mutig. Heute könnte das nicht noch einmal machen. Beim Deutschkurs lernte ich einen Israeli kennen, wir wurden Freunde. Auch mit einigen Spaniern habe ich Bekanntschaften geschlossen. Ich konnte bei ihnen dieselbe Mentalität entdecken. Auch Palästinenser nahmen am Kurs teil. Am Anfang verhielten sie sich sehr distanziert, aber dann verstanden wir uns sehr gut. An der Hochschule musste ich die Prüfung dreimal machen, ehe ich aufgenommen wurde. Die Schwierigkeiten, die ich damit hatte, an die Hochschule zu kommen, sind charakteristisch für das Schicksal meiner Kunst. Meine Kunst ist schwer zu akzeptieren. Ich male regelmäßig seit ich 23 Jahre alt bin, aber die Galerien wollen meine Bilder nicht. Eine Galerienbesitzerin meinte, meine Bilder wären zu kompromisslos. Dieses Urteil finde ich sehr positiv, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass meine Kunst nicht gemocht wird. Nur ab und zu kommt es vor, dass jemand meine Bilder bei Ausstellungen sieht und sie kaufen will. Nach zwei Jahren bin ich mit einem Bekannten nach Holland gefahren, um in meinen Pass einen Stempel zu bekommen. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich ohne Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland gelebt. Als ich schon Student war, musste ich zurück nach Israel, um ein Visum zu beantragen. Es hat drei Monate gedauert. Ich war sehr unglücklich, denn ich wollte Israel nicht mehr sehen. An der Hochschule studierte ich von 1986 bis 1989, das war sehr schön. Da mein Visum auch Erwerbstätigkeit zugelassen hatte, konnte ich arbeiten. Durch die TUSMA bekam ich Arbeit und habe hier und da gejobbt. Dann fand ich eine Stelle in einem Krankenhaus als Aushilfekraft. Ich verteile an die Patienten das Essen. Davon lebe ich bis heute. Entgegen den Vorstellungen, die man in Israel über Deutschland hat, machte ich hier als Jüdin keine schlechten Erfahrungen. Es war mir nicht wichtig, in Deutschland jüdische Freunde zu haben. Gesucht habe ich nicht, was kam, das kam. Am Anfang beobachtete ich die Deutschen wie eine Außenseiterin. Aber mittlerweile ist es für mich klargeworden, Menschen sind Menschen, überall dieselben, auch in Deutschland. Zuerst spürte ich keine grundlegenden Trennlinien. Später verstand ich, dass es doch Unterschiede gibt: im Denken und in Wahrnehmungen. Ich bekam zum Beispiel ein Stipendium, keine finanzielle Unterstützung, aber ich konnte an einer Weiterbildung teilnehmen mit 15 Frauen, an einem Projekt, das „Goldrausch” genannt wird. Wir waren paar Monate zusammen. Nach vielen Jahren hatte ich erstmals das Gefühl, dass ich absolut fremd bin. Mir kam vor, ich rede eine andere Sprache. Ich wurde noch nie so missverstanden, wie dort. Einmal meinte ich, man kann aufgrund des Materials, was die Künstler in einem Land benutzen, beurteilen, ob das Land arm oder reich ist. Nicht unbedingt, weil die armen Künstler billigeres Material benutzen, denn es kann ja auch gerade umgekehrt sein: der Ausdruck eines Trotzes. Meine Kolleginnen reagierten darauf, als ob ich sie beleidigt hätte. Ich habe nicht verstanden, woher das kommt. Das war wahrscheinlich ihre Macke, weil sie sich reich fühlen aber als arm erscheinen wollen. Ob ich mir vorstellen kann, für immer hier zu bleiben, weiß ich nicht. Aber wegen des Kindes muss ich bleiben. Das Kind meiner Freundin möchte ich mit ihr gemeinsam aufziehen. Ich hänge sehr an ihm. Und ich weiß auch nicht, ob ich nochmal anderswo anfangen könnte. Es müsste etwas ganz Starkes sein, das mich dazu bewegt. Die vielen Freunde halten mich hier, aber auch Gewohnheit. Israel betrachte ich immer noch als meine Heimat. Dort ist meine Familie. Jedes Jahr fahre ich hin, um sie zu besuchen. Obwohl mich Israel anzieht, habe ich unheimliche Schwierigkeiten damit. Aus der Entfernung verfüge ich über einen anderen Blickwinkel. Ich bin sehr kritisch geworden. Mit dem Patriotismus, besser gesagt mit dem Militarismus, der dort herrscht, komme ich nicht zurecht. Mit der Vergangenheit werde ich mich bis zu meinem Lebensende beschäftigen, denn die hat bestimmt, was ich bin. Aber ich glaube, man sollte weitergehen. Dieser Hass den Deutschen gegenüber, die Überzeugung, die viele Juden hier oder in Israel haben, dass alle Deutschen Nazis sind, ist meiner Meinung nach widersinnig. Die Bemerkung, die ich oft höre: „Was erwartest du schon von Deutschen?” finde ich falsch. Ich erwarte nämlich ziemlich viel. Ich bin nicht nach Deutschland gekommen, um die Deutschen zu hassen, sondern um sie kennen zu lernen. Die Menschen, die ich hier fand, verbinde ich nicht mit dem Holocaust. Es gibt Deutsche, die bereit sind, in die Vergangenheit zu schauen, und auch solche, die dazu nicht bereit sind. Meine Freunde muss ich eben wählen. Aber man kann sie nicht pauschal beurteilen. Ich mag Leute nicht, die fixiert auf den Holocaust sind. Mir scheint, sie können ohne das Gefühl, dass man sich hier vor den Nazis fürchten muss, nicht leben. Dafür verurteile ich sie. Sie sehen die Welt nur durch dieses Prisma. Das tut auch die Jüdische Gemeinde. Man sieht die Juden in England, Frankreich und den USA, das sind lebendige Menschen. Hier in Deutschland kommt es einem vor, als wären sie Fossilien. Es scheint, als würde das Leben der Jüdischen Gemeinde in Deutschland auf dem Tod basieren. Viele Juden in Deutschland haben einen Komplex, da man sie vielerorts, zum Beispiel in Israel verurteilt, weil sie in Deutschland leben. Anstatt sich überhaupt nicht darum zu kümmern und zu sagen, wir sind Juden in Deutschland, wir leben, verkriechen sie sich und beschäftigen sich mit den Nazis. Zu Veranstaltungen der Gemeinde gehe ich überhaupt nicht. Den Volkstanz, der dort von einigen Israelis vorgeführt wird, mag ich nicht. Jede Begegnung, die ich mit Vertretern der Jüdischen Gemeinde hatte, war für mich unangenehm. Sie betrachten sich hier als Fremde und in der Außenwelt sehen sie einen Feind. In den Menschen steckt auch viel Böses drin. In mir auch. Die Gesichter auf meinen Bildern drücken aber nicht das Böse, sondern Kummer aus. Vielleicht sind sie unglücklich, vielleicht nur schwierig. Sie sind vom Leben gezeichnet. Wie ich meine Gesichter beobachte, habe ich oft das Gefühl, sie sehen wie Debile aus. Aber sie haben etwas Ursprüngliches, sie sind schlaue Debile. Erklären kann ich nicht, warum ich mich auf Gesichter konzentriere. Sehr viele Gesichter habe ich im Kopf, sie stecken in mir. Ich schnappe sie mir, und wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, ist das eine tiefe Zufriedenheit. Wenn ich mit meinen Bildern fertig bin, ist mir egal, was die Leute darüber denken. Jeder Mensch, den ich male, bin ich. Ich male leidenschaftlich. Ich lebe nicht im Wohlstand, habe keine schöne Wohnung, kein Auto. Man kann nicht alles haben. Was mich bedrückt, ist, dass ich langsam älter werde und ohne Erfolg bin. Ich male und male, und keiner sieht das. Aber mit meiner Seele lebe ich in Frieden. Andrew Roth „Als Jude in Deutschland zu leben war und bleibt immer interessant und ein wenig bedenklich” Andrew Roth hat 1992 die Liebe aus New York nach Berlin gebracht. Er hat es nicht bereut, einer deutschen Partnerin - seiner heutigen Frau - hierher gefolgt zu sein, trotzdem plant er, in einigen Jahren mit seiner Familie wieder in die Vereinigten Staaten zurückzugehen. Zum Teil, weil seine Eltern und seine Brüder dort leben, aber auch deshalb, weil er als Schriftsteller in seiner Muttersprache besser zurechtkommt. Außerdem zieht ihn die amerikanische Kultur mit ihrer Dynamik und ihrem Optimismus mehr an. Seinen Kindern möchte der 42jährige eine jüdische Erziehung geben, „damit sie ihn, aber auch die Welt besser verstehen”. Zum ersten Mal bin ich 1991 zu einem kurzen Besuch nach Deutschland gekommen. Ein Jahr davor traf ich meine jetzige Frau in New York. Zwei Jahre lang sind wir zwischen New York und Berlin hin- und hergeflogen. 1992 entschied ich dann, hierher zu ziehen. Meine Frau, die in der Filmindustrie arbeitet, Filme schneidet, konnte damals keine Arbeit in New York finden. Es gab einen großen Streik, weil die Gewerkschaft eine bessere Bezahlung erreichen wollte. Zeitweilig wurden überhaupt keine Filme gedreht. Eigentlich habe ich keine Befürchtungen gehabt, nach Deutschland zu kommen. Ich muss zugeben, es war schon ein bisschen seltsam, aber ich hatte keine großen Probleme damit. Als Jude in Deutschland zu leben war und bleibt immer interessant und ein wenig bedenklich. Ich habe unentwegt die Geschichte im Kopf, ich denke oft daran, was passiert ist. Aber auf der anderen Seite ist meine Familie hier, auch meine Arbeit und das Alltagsleben. Letzteres ist auch sehr wichtig, denn wenn ich meine Kinder vom Kindergarten abholen oder einkaufen gehen muss, kümmere ich mich um diese Aufgaben. Der mehr theoretische Teil, die Geschichte ist dann in den Hintergrund gedrängt. Als Schriftsteller beschäftige ich mich mit der jüdischen Geschichte von Berlin, oder mit den verschiedenen Formen jüdischen Lebens hier. Bevor ich beschloss, nach Berlin zu ziehen, habe ich mich nur in einer sehr ungenauen Weise informiert, wie es mit der Situation der Juden hier aussieht. Eigentlich wusste ich gar nicht von dem hiesigen jüdischen Lebens. Ich glaubte, es gäbe überhaupt keines. Ich hatte die Vorstellung, dass es vielleicht nur eine alte Synagoge geben würde, die immer dunkel bleibt und vielleicht ein paar alte Männer, und das wäre auch alles. Auch über die politische Situation informierte ich mich nicht genau. Ich habe ein paar Bücher über Deutschland gelesen, aber ich war inmitten dieser Liebesbeziehung, und die war es, die wirklich zählte. Mein Hauptmotiv war, dorthin zu gehen, wo meine Partnerin lebt. Ich bin Journalist und Schriftsteller. Der Stadtführer „Das jüdische Berlin heute” ist mein viertes Buch. Ich habe es auf englisch geschrieben. Da amerikanische Verlage der Meinung waren, der Markt wäre nicht groß genug für dieses Buch, habe ich meinen eigenen Verlag gegründet und es 1998 selber herausgegeben. Ich wollte damit die englischsprachigen Touristen ansprechen. Danach verkaufte ich die Rechte an einen deutschen Verlag, auf diese Weise kam der Stadtführer im letzten Herbst in deutscher Sprache heraus. In Berlin habe ich ein wenig als freiberuflicher Journalist gearbeitet. Es gab eine englischsprachige Monatszeitschrift, die zuerst „Checkpoint”, dann „Metropolis” hieß und sich hauptsächlich mit Kultur beschäftigt hat. Sie existiert nicht mehr. Zur Zeit bin ich Hausmann. Ich schreibe aber weiterhin. Jetzt fange ich ein neues Buch an über den Widerstandskämpfer Helmut Hirsch. Er ist wenig bekannt: er war ein jüdischer Student, der 1936 einen Bombenanschlag gegen Julius Streicher, den Herausgeber von „Der Stürmer” geplant hat. Das Attentat schlug fehl und er ist 1937 hingerichtet worden. Ich bin noch ganz am Anfang, ich sammle Materialien. Das Buch ist für einen amerikanischen Verlag gedacht, der dann entscheiden kann, ob er die Rechte auch an einen deutschen Verlag verkauft. Meine ersten zwei Bücher haben von Rechtsanwälten gehandelt. Das waren Bücher über Witze, die über Rechtsanwälte und Richter entstanden. Das erste beinhaltet berühmte Zitate, das zweite eine Sammlung von Geschichten, Märchen, Witzen und Liedern über das Rechtswesen. Das dritte Buch war eine Geschichte über die Kriminalität in New York. Die Idee, das Buch über das jüdische Leben in Berlin zu schreiben, kam daher, dass ein Redakteur dieser Zeitschrift „Checkpoint” mich fragte, ob ich einen Artikel über das sich neu entfaltende jüdische Leben in Berlin schreiben würde. Das war um 1994 herum. Damals gab es nur die orthodoxe Addas-Jisroel-Gemeinde mit dem Beth Café und dem Kolbo Laden, und die jüdische Galerie in der Oranienburger Strasse. Die Neue Synagoge war noch nicht fertig. Am Anfang sagte ich bei der Zeitung, ich glaubte, es wäre nicht so interessant, es passierte nicht so viel. Aber dann habe ich überlegt, herumgeschaut und gefragt und entdeckte, es lohnt sich schon, darüber zu berichten. Ich schrieb den Artikel, er ist zwar nicht so gut gelungen, aber das war der erste Schritt. Dann dachte ich, wenn ich nichts von dieser jüdischen Gemeinde wüsste, würden es andere englischsprachige Leute vielleicht auch nicht tun. Ich habe einen Entwurf für ein Buch geschrieben und ihn an einige amerikanische Verleger geschickt. Es gab aber kein Interesse dafür, das Thema schien zu speziell zu sein. Wahrscheinlich dachten die Verleger auch, der Markt wäre zu klein dafür. Danach habe ich meinen eigenen Verlag gegründet und mit Michael Frajman zusammen das Buch geschrieben. Ich bin Mitglied der Jüdischen Gemeinde. Ich habe viel Hilfe von der Gemeinde bekommen, deshalb wollte ich sie auch unterstützen. Von der Arroganz habe ich viel gehört, mit der man in der Gemeinde und auch außerhalb die Neuankömmlinge aus der ehemaligen Sowjetunion behandelt, obwohl die Mehrzahl der in Deutschland lebenden Juden auch nicht „urwüchsig” sind. Man erwähnt sehr oft, dass viele Leute, die aus Russland kommen und sich für Juden ausgeben, die Papiere gefälscht oder gekauft haben. Angeblich soll das auch einer der Ursachen dafür sein, weshalb man sich so abweisend ihnen gegenüber verhält. Das ist eine komplizierte Geschichte, ich hatte keinen Platz in meinem Buch, um ausführlich darüber zu schreiben. Meine Familie war nicht unmittelbar vom Holocaust betroffen. Mein Vater ist Amerikaner, meine Mutter Engländerin, beide sind jüdisch. Die Familie meines Vaters stammt aus Felsõregmec, einem kleinen Dorf in Ungarn. Die Familie meiner Mutter stammt aus Polen. Mein Urgroßvater ist zwischen 1880-85 aus Ungarn nach New York gekommen. Mein Großvater war in New York geboren, mein Vater in Colorado. In der Familie meines Urgroßvaters gab es 8 Brüder und Schwestern, 7 sind in die Vereinigten Staaten eingewandert. Ein Bruder ist in Ungarn geblieben und einige seiner Nachkommen wurden von den Nazis ermordet. Die Familie meiner Mutter ist auch Ende des 19. Jahrhunderts von Polen nach England emigriert. Die Mutter meiner Mutter ist bereits in London geboren und ihre ganze Familie konnte sich retten. Mein Vater war Soldat im Zweiten Weltkrieg in Deutschland, zuletzt in Heidelberg. Er kämpfte bei den amerikanischen Truppen, die Heidelberg befreiten. Auf seinem Heimweg hat er in London übernachtet und dort traf er meine Mutter. Sie haben 1948 geheiratet. Ich bin nicht orthodox, sondern reformiert erzogen worden. Die großen Feiertage haben wir gefeiert, aber wir aßen nicht koscher. Wir arbeiteten am Samstag und sind nicht regelmäßig in die Synagoge gegangen, nur an den Feiertagen. Ich ging zur Sonntagsschule, um Religionsunterricht zu erhalten und hatte Bar-Mizwa. Religiös bin ich nicht, meine Eltern auch nicht. Für mich hat das Judentum mit Tradition, mit Kultur zu tun. Mit meiner nichtjüdischen Frau und meinen Kindern feiern wir Weihnachten und Chanukka gleichermassen. Am Freitag versuche ich - wenn auch nicht regelmäßig -,die Kerzen anzuzünden und die Gebete zu sprechen. Wir feiern auch Pessach. Ein Pessachfest ist immer eine große Freude. Meine Frau ist am jüdischen Leben, an jüdischer Kultur interessiert. Beim Aussuchen meiner Freunde ist es nicht wichtig für mich, dass sie jüdisch sein sollen. Ich habe viele nichtjüdische Freunde, und ich bin sehr zufrieden damit. Ich möchte mich nicht eingrenzen. Es hat eine große Bedeutung für mich, dass meine Kinder über ihre Herkunft Bescheid wissen sollen. Ich möchte meinen Kindern - sie sind jetzt anderthalb und vier Jahre alt - eine jüdische Erziehung geben. Auf diese Weise können sie mich, aber auch die Welt besser verstehen. Das ist ein Teil von der Familiengeschichte, aber auch von der Geschichte an sich. Im Judentum ist eine bedeutende Spaltung zu bemerken. Die Tradition besagt, dass die jüdische Linie immer durch die Mutter weitergegeben wird. Aber in den letzten 10-15-20 Jahren haben die Reform- und konservativen Bewegungen die Entscheidung getroffen, dass sie auch durch die väterliche Seite fortgesetzt werden kann. In Berlin zählen meine Kinder für Nichtjuden, aber wenn wir in Kalifornien wohnen würden, wären sie Juden. Ich glaube, dass die Gemeinde in Deutschland erhalten bleiben und wachsen wird. Es ist wichtig, dass die jüdischen Leute hier die Möglichkeit haben, ihre Religion und Kultur auszuüben. Ich glaube auch, dass das jüdische Leben erstarken wird mit mehreren unabhängigen Gruppen, mit Leuten, die mehr kulturell als an Religion interessiert sind. Über viele Jahre hinweg gab es nur die Einheitsgemeinde. Jetzt gibt es bereits mehrere jüdische Gruppen und verschiedene Projekte. Für jüdische Menschen ist es sicherlich schwerer, in Deutschland zu leben wenn sie ihre Identität bewahren wollen. Auch für die Deutschen ist es nicht einfach, mit der Last der Vergangenheit fertig zu werden. Die jüngere Generation hat so viel über die Nazis, über den Holocaust gehört und wenn sie dann einen echten Juden treffen, gibt es den Augenblick, wo sie mit der Geschichte konfrontiert werden und direkt gezwungen sind, über das Geschehene sich Gedanken zu machen. Viele denken, dass die Juden ihnen das Gefühl von Schuld geben. Das wird durch den Spruch veranschaulicht, den Henryk M. Broder geprägt hat: „Die Deutschen werden den Juden nie für Auschwitz vergeben.” In Deutschland gibt es, glaube ich, nicht viel echten Antisemitismus. Es kommen antisemitische Erscheinungen vor, zum Beispiel wenn Leute über die Macht des Judentums sprechen und behaupten, dass alle Medien von Juden kontrolliert werden. Ich habe auch gehört, dass sich Leute über jüdische Immobilienbesitzer und Vermieter beschweren. In Berlin wird zum Beispiel gesagt, dass alle Gebäude in Mitte Juden gehören und sie die Mieten in die Höhe treiben wollen. Das hat nichts mit der Wahrheit zu tun, trotzdem wird so etwas verbreitet. Meine Wahl, nach Deutschland zu kommen, hat gute und schlechte Seiten, aber ich bin überzeugt, dass ich damals eine sehr gute Entscheidung getroffen habe. Ich fühle mich wohl hier, aber wir gehen trotzdem zurück. Es ist besser in den Vereinigten Staaten. Vor allem, Englisch ist meine Muttersprache und als Schriftsteller und Journalist ist es mir besonders wichtig, dass ich die Sprache, in der ich schreibe, vollständig beherrsche. Meine Frau spricht fliessend Englisch. In der Filmbranche, wo sie arbeitet, gibt es in Kalifornien viel Arbeit. Ich bin auch der Meinung, dass die Kultur in den Staaten besser ist. Sie ist multikulturell und offen, dynamischer und optimistisch. Meines Erachtens ist die deutsche Kultur sehr pessimistisch. Einerseits, weil sie viel zu sehr nach innen schaut, andererseits, weil die Gesellschaft sehr hierarchisch aufgebaut ist. Die Deutschen haben eine Beziehung zum Staat und nicht zueinander. Deshalb sind sie mehr pessimistisch eingestellt. Die Ursache dafür ist die, dass die Menschen auf sich gestellt sind, alleingelassen mit dem Staat und sie können sich nicht aufeinander stützen. Natürlich kann der Staat für sie sorgen und wenn alles gut geht, ist es wunderbar. Der Staat ist die große Mutter. Aber die Abhängigkeit vom Staat ist auch sehr gefährlich. Zum Beispiel bekommen deutsche Regisseure, die Dokumentarfilme machen, das Geld dazu vom Staat. Sie können sich nicht vorstellen, dass es auch anders gehen könnte. Zur Zeit gibt es aber kein bzw. weniger staatliche Mittel und die Filmemacher haben riesige Probleme, sie wissen nicht, was sie tun könnten. In den Vereinigten Staaten wird vom Staat kein Geld gewährt, um die Produktion von Dokumentarfilmen zu unterstützen. Die Regisseure müssen sich die finanziellen Mittel anderswo besorgen. Die Deutschen scheinen überzeugt zu sein, dass Optimismus oberflächlich und ein unernstes Gefühl ist. Wie sie glauben, ist Pessimismus dagegen echter und tiefer. Sie glauben auch, sie sind sehr klug, wenn sie sich pessimistisch anstellen. Ich finde das lächerlich. Sicherlich habe ich als Amerikaner Vorurteile. Für mich bedeutet Europa irgendwie die Vergangenheit. Der Höhepunkt europäischer Kultur liegt 100-200 Jahre zurück, damals kamen die bedeutendsten Schriftsteller, Musiker, Künstler aus Europa. Aber heutzutage spricht man ja vom amerikanischen Jahrhundert. In den letzten 100 Jahren ist es die amerikanische Kultur, die die Welt eroberte, zum guten oder schlechten. Die großen Künstler kommen aus den Staaten. Natürlich spreche ich sehr allgemein. In Amerika gibt es das dynamische Element - in Deutschland hat man, glaube ich, diese dynamische Qualität nicht. Ich glaube, das hat etwas mit dieser obrigkeitsbezogenen Beziehung zum Staat zu tun. Für die führende Rolle der jetzigen amerikanischen Kultur ist der Film das prägnante Beispiel. Es mag wahr sein, dass die Filme, die in Hollywood gemacht werden, zwar professionell, aber selten gut sind. Trotzdem sind sie beliebt und es ist Tatsache, dass in Deutschland viel mehr amerikanische Filme gezeigt werden, als deutsche Filme in den Vereinigten Staaten oder in anderen Ländern. Die europäischen Filme machen in den USA weniger als 5 Prozent des Marktes aus, während umgekehrt die amerikanischen Filme mehr als 60 Prozent des europäischen Marktes bestimmen. Wir wollen in 2-3 Jahren in die Vereinigten Staaten zurückgehen. Auch deshalb, weil meine Eltern und zwei Brüder dort leben, in der Nähe von San Francisco. Für die Kinder ist es sehr wichtig, eine große Familie zu haben und meine Eltern sind alt. Wir haben vor, nach San Francisco ziehen. Die Stadt hat zwar nur eine Bevölkerungszahl von einer Dreiviertelmillion, aber sie strahlt die Atmosphäre einer Großstadt aus, mit viel Kultur, mit vielen Vertretern anderer Kulturen und man spürt die Offenheit. Die Offenheit und Dynamik, die ich in Deutschland vermisse. Adriana Marin Grez „Die dritte Generation lebt und arbeitet für ein lebendiges jüdisches Leben heute und in der Zukunft” Adriana Marin Grez war dabei, die Geschichte ihrer Familie zu erforschen, als sie mit 17 Jahren von ihrer jüdischen Herkunft erfuhr. Sie ist 1969 in Argentinien geboren und kam im Alter von 9 Jahren nach Deutschland. Für den jüdischen Ursprung der Familie interessiert sie sich als Einzige und findet es bedauerlich, dass ihr dieser Teil des Erbes nicht vollständig mitgegeben worden ist. Das Wissen, das sie heute über das Judentum besitzt, musste sie sich selber aneignen. Sie hält den Austausch unter Kulturen für sehr wichtig, denn, wie sie formuliert, „nur so kommt man zu einem gegenseitigen Verständnis”. Als ich 16 war - ich schrieb damals schon gern -, sagte mein Vater zu mir: „Ich habe eine Idee. Wieso schreibst Du nicht eine Familienchronik?” Den Vorschlag fand ich gut. Mein Vater versprach auch, mich dabei finanziell zu unterstützen und ich malte mir das schon aus. Dass meine Großmutter Russin war, wusste ich ja, sehr schön, dachte ich, dann kann ich zum Beispiel nach Russland fahren und auch nach Spanien, da ein Teil der Familie aus Spanien stammt. Damals kannte ich meine jüdischen Wurzeln noch nicht. Ich fing an, Familienmitgliedern Fragen zu stellen, bekam aber nicht sehr viele Antworten. Sowohl auf der Seite meines Vaters, als auch der meiner Mutter gab es jeweils nur einen Großonkel, der sich mit der Geschichte unserer Familie beschäftigt hatte. Aber die meisten sagten nicht viel. Daraus, was ich später herausbekam, verstand ich, dass man auf der Seite der Familie meiner Mutter nicht über den jüdischen Hintergrund sprechen wollte. Während meiner Forschungen muss ich dann auf eine Geschichte gestoßen sein, die ich mir nicht erklären konnte. Ich weiß noch, ich sass mit meinen Eltern in einem italienischen Restaurant, und das schien die beste Gelegenheit zu sein, mit ihnen zu sprechen. Ich hatte mich darüber beklagt, dass sie mir nichts erzählten, mir auswichen. „Wie soll ich denn so eine Familienchronik zusammenstellen?”, fragte ich aufgebracht. Sie erzählten mir nämlich immer nette Anekdoten aus ihrer Kindheit, aber nichts, was weiter zurückging. In dem Zusammenhang hat, glaube ich, meine Mutter gesagt, „Da gibt es etwas, dass ich dir erzählen muss”, und dann, „Weißt du, die Familie meiner Mutter war jüdisch”. Und so war es auf einmal auf dem Tisch. Meiner Mutter war das sichtlich unangenehm. Da ich zum größten Teil in Deutschland aufgewachsen bin und auch hier zur Schule ging, wusste meine Mutter nicht, wie ich das aufnehmen würde. Für mich war das etwas ganz Faszinierendes und ich wollte einfach mehr darüber wissen. Ihre Ängste, ich könnte über meine jüdische Herkunft nicht erfreut sein, waren völlig ungerechtfertigt. Für mich bedeutete das etwas Angenehmes, Schönes, was ich von meiner Mutter erfuhr, auch deswegen, weil ich jemand bin, der immer dazu neigt, die schwächeren Glieder der Gesellschaft zu verteidigen. Als Kind habe ich Basare veranstaltet, um Geld für SOS Kinderdörfer zu sammeln, oder für Indianer, die in Reservaten lebten. Mit dieser neu erfahrenen Herkunft konnte ich mich nun identifizieren. In Deutschland waren jüdische Mitmenschen in der Geschichte ja nicht gerade gut behandelt worden. In der Schule haben wir diese Wochenschaubilder gesehen, wo die Deutschen jüdische Menschen zwangen, ihre eigenen Gräber zu schaufeln und sie dann einfach so würdelos über eine Rutsche ins Massengrab warfen. Eine Klassenkameradin von mir sagte: „Ich kann diese Bilder nicht mehr ertragen”. Daraufhin antwortete ich ihr: „Es gibt Menschen, die haben erleben müssen, was Du nicht sehen willst. Das mindeste, was wir da tun können, ist es, sie uns anzusehen. Noch dazu, wenn man aus der Kultur kommt, die diesen Leuten das angetan hat.” Meine Eltern sind beide Ärzte. Zu dem Zeitpunkt, als ich geboren wurde, haben sie beide noch studiert. Mein Vater ist nichtjüdisch. Er hält nichts von Religion, alles, was man wissenschaftlich nicht erklären kann, lehnt er ab. Trotzdem setzt er sich aber mit Religion auseinander. Meine Mutter dagegen weist Religion strikt zurück. Wir sind mit meinem Bruder „nach wissenschaftlichen Prinzipien” erzogen worden, mit linken Moralbegriffen. Es galt immer, benutze zuerst deinen Kopf. Wenn man so aufwächst, spielt Religion natürlich gar keine Rolle. Auch unsere Tanten und Onkel kennen wir als atheistisch. Meine Großmutter mütterlicherseits kommt aus einer europäischen jüdischen Familie. Sie hat, genauso wie meine Mutter, einen Nichtjuden geheiratet. Ich habe gehört, dass die Familie meiner Großmutter säkular orientiert war. Meine Großmutter hat meinen Großvater 1940 auf einer politischen Versammlung in Argentinien kennen gelernt. Dort ging es darum, wie man helfen könnte, die Juden aus Europa nach Argentinien zu holen. Argentinien war während der Shoah das einzige Land, das Flüchtlinge unbegrenzt und ohne Bedingung aufnahm. Durch die politischen Veränderungen haben mittlerweile viele jüdische Menschen bzw. ihre Nachfahren Argentinien wieder verlassen und sind nach Europa zurückgekehrt, aber in den 50-er und 60-er Jahren hatte Argentinien die drittgrößte jüdische Bevölkerung nach den Vereinigten Staaten und Israel. Mein Großvater war sehr engagiert in der kommunistischen Partei. Meine Urgroßeltern mütterlicherseits sind 1925 nach Argentinien ausgewandert. Sie kamen aus Galizien. Sie sind in der Gegend von Lemberg (Lwow) aufgewachsen. Mein Urgroßvater geriet im ersten Weltkrieg in russische Gefangenschaft und musste in einer Streichholzfabrik am Asowschen Meer arbeiten. Seine zwei Schwestern wohnten dort, und so ist meine Urgroßmutter mit ihrem 5jährigen Sohn hingezogen. Der Urgroßvater konnte sich damals schon relativ frei bewegen. Die Großmutter ist 1920 dort geboren, in Mariupol, was später Schdanov hieß. Von da aus ging die Familie nach Polen, dann zogen sie weiter nach Wien, und 1925 nahmen sie von Frankreich aus ein Schiff nach Argentinien. Die zwei Schwestern von meinem Urgroßvater sind spurlos verschwunden. Die Kosaken sind in Mariupol eingefallen, es gab ein Pogrom, und seitdem ist jede Spur von ihnen verloren. Der älteste Bruder meines Urgroßvaters ist mit seiner Familie von den Deutschen umgebracht worden. Wir wissen teilweise nicht, was mit den Anderen passiert ist. Meine Urgroßmutter hatte noch einen Bruder und wir gehen davon aus, dass er mit seiner Familie in einem Konzentrationslager starb. Jede Spur ist von ihnen verschwunden. Es ist nur bekannt, dass die Tochter dieses Bruders in Russland überlebte. Sie hat meiner Familie geschrieben, aber sie konnte nicht nach Argentinien geholt werden. Zur Zeit suche ich die Spur der verschwundenen Verwandtschaft, mit Hilfe des Internet. Die Einstellung meiner Eltern zur Religion hängt mit ihrer Erziehung zusammen. Meiner Urgroßmutter gefiel es gar nicht, dass ihre Tochter, meine Großmutter, einen Nichtjuden heiratete. Ihrem Schwiegersohn hat sie auf Lebenszeit den Krieg erklärt. Mein Großvater nahm den Fehdehandschuh auf. Er war jemand, der einem guten Streit nie aus dem Weg ging. Als Folge von diesem Streit hat er durchgesetzt, dass meine Mutter und ihre 4 Geschwister nichtjüdisch erzogen werden. Er meinte, wenn meine Urgroßmutter ihm das Leben unmöglich macht, bekommen die Kinder im Gegenzug keine jüdische Erziehung. Es wurde nie über Religion gesprochen. Meine Mutter ist die dritte von den Schwestern, sie ist 1947 geboren. Nach ihr wurden noch zwei Jungen geboren. Mein Vater kam 1944 in Chile auf die Welt. Er studierte in Argentinien und ist meiner Mutter an der Universität begegnet. Die Familie meines Vaters zog oft um. Aus beruflichen Gründen haben meine Eltern zwischendurch in den USA und der Schweiz gewohnt. Ich ging in der Schweiz in den Kindergarten. Eingeschult wurde ich in Argentinien, in Mendoza. Von Mendoza sind wir während der Militärdiktatur nach Buenos Aires geflüchtet, da mein Vater auf einer schwarzen Liste stand, genauso, wie meine Mutter. Sie wegen ihres Vaters, da er Kommunist war, und mein Vater deshalb, weil er sich während seiner Studentenzeit als Studentensprecher betätigte. Er war politisch links engagiert. 1976, als das Militär die Macht in Argentinien übernahm, bekam jede Armeegattung eine Provinz zugewiesen. Mein Vater arbeitete an der Universität, meine Mutter studierte noch. Ihr Vater stand auf der schwarzen Liste einer anderen Waffengattung, als die für Mendoza zuständig war. Ein Kollege meines Vaters, der Beziehung zum Militär hatte, warnte ihn eines Tages, er soll seine gesamten Forschungsunterlagen mitnehmen, denn am nächsten Tag würden sie ihn nicht mehr an seinen Arbeitsplatz lassen. Das Militär bestimmte an der Absperrung vor der Universität, wer hinein durfte. Mein Vater ist dem Rat gefolgt, er nahm alles mit nach Hause. Am nächsten Tag fuhr er wie normal zur Arbeit und tatsächlich, er durfte nicht aufs Universitätsgelände. Das bedeutete zur gleichen Zeit, dass er seinen Job los war. Der Kollege meines Vaters fragte beim Militär nach und erfuhr, dass mein Vater sich noch glücklich schätzen konnte, nur seine Stelle verloren zu haben. Das Militär hatte nämlich von oberster Stelle die Anweisung bekommen, uns Kinder festzunehmen und so lange zu foltern, bis mein Vater alles sagte, was er wusste. Aber das war natürlich Unsinn, weil die studentischen Aktivitäten meines Vaters schon lange zurücklagen. Die Anweisung der Kommandoführung wurde deshalb nicht befolgt, weil die Soldaten, die die Universität seit längerer Zeit bewachten, meinen Vater mochten. Als der Kollege erfahren hat, was eigentlich gegen uns geplant war, kam er in unser Haus, und sagte zu meinem Vater: „Geh mit deiner Familie sofort weg”. Es war ja schon damals klar, was mit den verschwundenen Personen geschieht. Wir sind dann bei Nacht und Nebel nach Buenos Aires gefahren. In der Hauptstadt stand zwar mein Großvater auf der schwarzen Liste, aber mein Vater nicht. Wenn man Wohnungen mietet, wird man erfasst, die Behörden wissen wer, wo wohnt. Aber wenn man den Trick verwendet, die Wohnung von jemandem zu mieten, der im Ausland lebt, gibt es über den Mieter keine Unterlagen. Wir haben die Wohnung von einem Studienkollegen meines Vaters übernommen, dessen Familie nach den USA auswanderte. Auch der Besitzer des Hauses verließ schon früher Argentinien, und die Miete wurde ihm ins Ausland überwiesen. Auf diese Weise war es nicht nachzuvollziehen, wo wir uns aufhielten. Obwohl mein Vater eigentlich eine persona non grata war, arbeitete er eine Zeit lang für das Militär. Argentinien stand nämlich damals kurz vor einem Krieg mit Chile. Die Armee hat alle Leute, die in Krankenhäusern beschäftigt waren, sozusagen zwangseingezogen, um darauf vorbereitet zu sein, die eventuellen Verletzten zu behandeln. Mein Vater arbeitete in einem Krankenhaus als praktischer Arzt, einer seiner Studenten hat ihm diesen Job verschafft. Aber mein Vater ist kein praktischer Arzt. Er war zeitlebens in der Forschung tätig. Deshalb hat er sich für ein Forschungstipendium der Humboldt-Stiftung beworben und es auch erhalten. So sind wir Anfang 1979 nach Deutschland gekommen. Bevor wir nach Heidelberg gingen, waren wir zuerst für ein paar Monate in Göttingen, wo es ein Goethe-Institut gibt. Die ausländischen Stipendiaten kommen dahin, weil sie dort Deutsch lernen können und es bei diesem Institut auch Unterkünfte für Stipendiaten eingerichtet sind. Bis zur 8. Klasse hatte ich auch Nachhilfe in Deutsch. Zu Hause haben wir aber spanisch gesprochen, das ist bis heute so. Meine Eltern fühlen sich recht wohl hier. Meine Mutter hatte überhaupt keine Bedenken, nach Deutschland zu gehen. Mein Bruder findet sich in Deutschland auch gut zurecht. Für mich ist Argentinien als Bezugspunkt meiner Identität viel wichtiger als für meinen Bruder. Mittlerweile habe ich eine doppelte Staatsangehörigkeit, aber ich definiere meine Identität viel stärker über Argentinien, als über Deutschland. Seitdem mein Bruder einen Sohn hat, ist ihm die spanische Sprache auch wichtiger geworden, weil er seinem Sohn etwas von seiner Herkunft mitgeben möchte. Ich denke, für meine Mutter ist ihre jüdische Herkunft nicht von Belang. Langsam findet sie sich damit ab, dass ich ein jüdisches Leben führe, obwohl sie immer wieder versucht, mir davon abzuraten. Als ich ihr zum Beispiel sagte, ich stehe früh auf, weil ich in die Synagoge gehe, war sie völlig entsetzt. Wahrscheinlich hat sie, wie sehr viele ihrer Generation ein sehr gespaltenes Gefühl zu dem jüdischen Erbe. Sie hat bestimmt auch die Kämpfe mitbekommen, die zwischen ihrer Großmutter und ihrem Vater vor sich gingen. Als Kind wird man schon dadurch verunsichert. Wie viel meine Mutter über die jüdische Tradition weiß, kann ich nicht genau beurteilen. Als ich das erste Mal auf einem Bat-Mizwa eingeladen war, erzählte ich es ihr. Ich sagte, ich wollte das kennen lernen. Darauf fragte meine Mutter: „Bad, was für ein Bad?” Mein Vater aber wusste sofort, worum es ging. Er war mal in Israel auf einen Kongress und während seiner Studentenzeit hatte er jüdische Freunde. Meine Mutter vertritt die Position, dass sie selber Nichtjüdin ist. Sie pflegt es so auszudrücken, sie ist ein Mensch, wie jeder andere auch. Den Ursprung der Familie leugnet sie nicht, aber er spielt einfach keine Rolle für sie. Dieses Land liebe ich nicht, aber ich lebe nun mal hier. Ich finde es wichtig, dass die Ansichten derjenigen, die heute hier leben anerkannt und respektiert werden. Leute aus Amerika, die für ein oder zwei Jahre hierher kommen wollten, um hier zu arbeiten, erzählten mir, man sagte ihnen in ihren jüdischen Gemeinden: „Was wollt ihr denn in Deutschland, es gibt doch gar keine Juden dort?” Es mag nicht so viele Juden in Deutschland geben, wie vor dem Krieg, aber es gibt welche und ich finde, sie verdienen Respekt, gerade weil sie hier leben, was gar nicht so einfach ist, unter dem Druck der Geschichte. Ich glaube, sie verdienen auch, dass man sie anhört, warum sie hier leben und dass man anerkennt, dass sie Juden sind. Gerade aus diesem Grund kann ich Israel nicht ausstehen. Als man mich dort fragte, woher ich komme und ich sagte, aus Deutschland, haben sie mir den Rücken zugewandt. Man behandelte mich, als wäre ich ein Nazi. Ich kam gar nicht dazu, zu sagen, ich bin jüdisch. Und weil mich das so geärgert hat, wollte ich auch nichts weiter erklären. Das habe ich das letzte Mal vor einem Jahr erlebt. Israel, das eigentlich meine religiöse, kulturelle Heimat sein sollte, ist das einzige Land, wo ich miserabel behandelt wurde. Die Ablehnung von Juden, die in Deutschland leben, erfährt man noch mehr in den USA. Die Menschen haben von Deutschland immer noch ein Bild, das mit Hitler festgefroren ist. Sie nehmen gar nicht wahr, dass das hier heute eine ganz andere Gesellschaft ist. Diese Zurückweisung hat aber damit zu tun, dass das amerikanische Erziehungssystem sehr schlecht ist. Einmal sprach ich in einer Schule vor schwangeren Minderjährigen. Die Lehrerin, die Sozialkunde unterrichtete, hat mich gebeten, von den Zuständen vor und nach dem Mauerfall zu erzählen. Man fragte mich danach, woher ich komme. Ich sagte, aus Argentinien. Ach ja, meinte die Lehrerin, das ist das Land, wo dieser Diktator herstammt, den sie in England festgesetzt haben. Natürlich konnte ich sie vor ihren Schülern nicht beschämen, obwohl man erwarten könnte, dass eine Lehrerin weiß, Pinochet kommt aus Chile und nicht aus Argentinien. In den letzten zwei Jahren lernte ich immer mehr jüdische Menschen kennen. Auch dadurch, dass ich beruflich sehr viel über jüdische Themen berichtete, bin ich wenig mit anderen Leuten in Kontakt getreten. Gerade vor ein paar Wochen dachte ich, ich habe nur noch jüdische Freunde und das ist nicht gut, das ist zu eingeschränkt. Meine Kommunikation hat sich verändert. Ich verwende auch andere Wörter. Vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, „im zweiten Weltkrieg”, jetzt sage ich „während der Shoah”. Wenn ich „zweiter Weltkrieg” sage, schaut mich jemand, der jüdisch ist, erstaunt an, wenn ich „während der Shoah” sage, dann fragen Nichtjuden, was ist Scho..? Man könnte eigentlich erwarten, dass sie hier wenigstens den Begriff schon mal gehört haben. Aber was will man schon von Leuten erwarten, wenn in einem Land, wo viele Millionen Muslime leben, in den Geschäften jedem Kunden frohe Ostern oder frohe Weihnachten gewünscht wird? Als wenn es nichts anderes auf der Welt gäbe. Bei bestimmten Sachen, die ich erzähle, gibt es relativ wenig Menschen, die diesem Gespräch folgen können, wenn ich es ihnen nicht erkläre. Wenn ich einen jüdischen Witz erzähle, muss ich ihn unter nichtjüdischen Leuten erklären, und das macht auch nicht unbedingt Sinn. In diesem Zusammenhang ist es angenehmer, unter Juden zu sein. Aber andererseits ist mein Hintergrund ein multikultureller. Ich habe Ethnologie studiert und für mich ist der Austausch unter Kulturen sehr wichtig. Nur wenn man ganz unterschiedliche Kulturen kennen lernt, kommt man zu einem Verständnis, denke ich. Vorurteile hat jeder, ich auch. Jeder ist auf seine Art ein bisschen rassistisch. Gerade deshalb ist es wichtig, verschiedene Freunde zu haben. Mir ist bewusst geworden, dass sich das bei mir eingeengt hat. Dadurch, dass ich ein jüdisches Leben führe, aber eine nichtreligiöse Familie habe, muss ich mich immer wieder mit diesen Gegebenheiten auseinander setzen. Ich muss mich bemühen, dass meine Familie akzeptiert, wie ich lebe. Aber ich muss genauso offen sein. Mein Bruder zum Beispiel, der auch nicht religiös ist, ist mit einer katholischen Deutschen verheiratet. Sie feiern Weihnachten. Dann gehe ich eben, und feiere Weihnachten mit. Natürlich komme ich unter Umständen bei meiner jüdischen Umgebung unter Druck, erklären zu müssen, wieso ich Weihnachten feiere. Aber ich lasse mich dadurch nicht stören. Familie ist Familie. Die Jüdische Gemeinde hier hat den Drang, sich immer mehr einzumauern und es ist sehr schwierig, wenn man von außen kommt, integriert zu werden. Wenn einer nicht schon in den jüdischen Kindergarten gegangen ist, wenn man von außerhalb hier hinzuzieht, macht man die Erfahrung, abgelehnt zu werden. Das erklärt sich aus der Geschichte. In diesem Land sind die Leute sehr misstrauisch, und es dauert sehr lange, bis man integriert wird. Mitglied der Gemeinde wurde ich, weil ich mein Bat-Mizwa nachholen wollte. In Argentinien ist der 15. Geburtstag eines Mädchens sehr wichtig. Das kommt daher, dass die Mädchen früher mit 15 Jahren heiratsfähig waren und das wird heute noch groß gefeiert. Ich habe eine solche Feier nicht bekommen, weil wir zu dem Zeitpunkt schon in Deutschland lebten. Meine Mutter meinte, das ist hier nicht üblich, also auch nicht notwendig. Für mich war das aber sehr wichtig und das hat meine Mutter nicht erkannt. Mir fehlte es immer, dass ich diesen Übergangsritus ins Erwachsenenalter nicht hatte. Einmal hörte ich von einem Rabbiner, dass man einen Bat-Mizwa auch nachholen kann und im letzten Jahr begann man in der Synagoge, das für mich zu organisieren. Es wurde mir aber gesagt, ich könnte das nicht machen, wenn ich nicht Mitglied der Gemeinde wäre. Das war der einzige Grund für meinen Eintritt. Relativ schnell, nachdem ich über meine Herkunft erfahren habe, wollte ich alles über das Judentum lernen. Ich fand es sehr bedauerlich, dass mir dieses Stück meiner Herkunft von meiner Familie nicht mitgegeben wurde. Wenn ich später Kinder habe, wollte ich ihnen wie ein Büffet das Katholische, das Russische, das Französische, das Italienische, das Jüdische in der Familie anbieten. Die Kinder sollten auswählen können, was sie davon essen wollten. Mir hat man diese Wahlmöglichkeit versperrt. Ich dachte aber auch, dass ich das nicht mehr nachholen kann, weil ich ganz anders erzogen worden bin, und könnte nicht mehr wirklich jüdisch werden. Meine Mutter war mit einer Familie befreundet, die aus Rumänien oder Bulgarien kam. Auf das Kind dieser Familie habe ich aufgepasst. Mich faszinierten ihre Bücher, der Talmud usw., und ich nahm der Frau das Versprechen ab, dass sie mir etwas beibringt. Aber das ist dann nicht geschehen, denn sie hat mein Interesse nicht ernst genommen. Paar Jahre später ist diese Familie nach Australien ausgewandert. Die Frau wusste von der jüdischen Herkunft meiner Mutter und versuchte, ihr etwas zu vermitteln. Aber da war sie auf dem Holzweg. Meine Mutter ist ein verlorener Fall. Das ist auch mit dem Schicksal der Sederplatte zu belegen, die sie meiner Mutter geschenkt hat. Als ich einmal von Berlin zu Besuch nach Hause kam, war meine Mutter gerade dabei, unbrauchbare Gegenstände auszusortieren. Diese schöne alte, kupferne Sederplatte habe ich in dem Stapel für den Müll gefunden. Daraus war die Bedeutung solcher Gegenstände für meine Mutter ganz ersichtlich. Ich nahm die Platte natürlich an mich. Hilfe bekam ich also nicht, um etwas über das Judentum zu erfahren. So las ich dann Einiges, aber das nützt nicht viel, wenn man nicht jemanden hat, der einen anleitet. Nach dem Abitur bin ich nach Berlin gekommen. In der Bibliothek der Berliner Gemeinde sagte die Bibliothekarin zu mir, ich sollte am besten mit Rabbiner Stein sprechen und gab mir seine Telefonnummer. Über 3 Monate habe ich versucht, ihn anzurufen, aber umsonst. Er war nicht da, das Telefon war besetzt, er rief nicht zurück und dann hatte ich genug davon. Ich dachte, wenn man mich nicht haben will, ich habe 20 Jahre lang völlig glücklich gelebt, ohne etwas mit dem Judentum zu tun zu haben. Das kann ich auch für den Rest meines Lebens tun. Damit war die Sache für mich abgeschlossen. Dann traf ich bei einem Gymnastikkurs eine Frau, und es stellte sich heraus, dass sie auch aus Argentinien kam. Wir haben uns fürs Theater verabredet, danach sind wir essen gegangen und im Gespräch erwähnte sie, sie ist Jüdin. In Argentinien kann man das auch ruhig sagen. Es ist nicht so wie hier, bei Deutschen würde das nicht als erstes Thema auftauchen. Sie nahm es auf sich, mich in die Synagoge mitzunehmen, mich Leuten vorzustellen. Einmal gingen wir zusammen zum Seder im jüdischen Kulturverein, wo ich mich wohl fühlte, weil es dort auch viele Menschen gab, die wenig Ahnung hatten und weil sie auch sehr bemüht waren, Leuten, die nichts wussten, etwas beizubringen. Zwei Jahre später, als ich in Westdeutschland die Ausbildung zur Hörfunk- und Fernsehredakteurin machte und wir - als Abschluss des Hörfunkteils - die Aufgabe hatten, ein Interview zu machen, sprach ich Irene Runge, die Vorsitzende des Jüdischen Kulturvereins an. Ich wollte ein Feature über das jüdische Leben im Scheunenviertel und seiner nächsten Umgebung machen. Nachdem sie mir das Interview gab, meinte sie, ich müsste mit einer jüdischen Familie zusammen leben, denn wenn man allein ist, lernt man über das praktische Judentum nichts. Sie kannte eine jüdische Familie in London mit 12 Kindern, wo drei Generationen zusammenleben. Als ich ein halbes Jahr später Ferien hatte, und einen Freund in London besuchen wollte, hat es Irene Runge mit Hilfe eines Rabbiners, eines Lubawitschers arrangiert, dass ich bei einer anderen Lubawitscher Rabbinerfamilie unterkomme. Das war zu Pessach. Den Seder machte ich mit, aber nach 24 Stunden bin ich geflohen. Ich hatte hohes Fieber und dachte, da die Familie so religiös war, hätte ich auch am zweiten Abend mit ihnen am Tisch sitzen müssen und dazu fühlte ich mich nicht in der Lage. Als Ausrede führte ich diesen Freund an, dass er mich erwartete. 1997 kam ich beruflich nach Dortmund. Das war der erste Teil meines Volontariats. In Dortmund kannte ich außer meinen Arbeitskollegen niemanden. Die Kollegen hatten ihre Familien, und so konnte ich nach Feierabend und an Wochenenden nichts mit ihnen unternehmen. 1-2 Monate lang habe ich meine Freizeit vor dem Fernseher verbracht. Das war aber zu öde. Ich wollte eine Frau aufsuchen, deren Namen mir Irene Runge gegeben hatte. Am Tag vor meinen Besuch ist sie aber nach Israel geflogen. Man schickte mich in das Sekretariat, wo ich erfahren könnte, wann diese Frau wiederkommt. Dort traf ich den Rabbiner der Gemeinde, Rabbiner Brandt. Er hat mich ausgefragt, und ich erzählte ihm, wie man mich in der Berliner Gemeinde behandelte. Ich habe ihm über das Ausgrenzen, das ständige Misstrauen erzählt. Der Rabbiner lud mich am Freitag zum Gottesdienst ein. Er sagte, ich solle sofort zu ihm kommen, wenn ich solche Erfahrungen in seiner Gemeinde mache, denn bei ihnen gäbe es so etwas grundsätzlich nicht. Es war eine große Ehre, vom Rabbiner eingeladen worden zu sein, also ging ich hin. Als ich nach dem Gottesdienst unschlüssig vor der Synagoge herumstand, sagte jemand zu mir: „Wir haben da drüben den Kiddusch, du kommst doch mit?” Ich hatte keine Ahnung, was ein Kiddusch ist, aber es wäre sehr peinlich gewesen, das zuzugeben. So sagte ich ja. Es waren nur wenig Leute meines Alters da, aber sie hatten großes Interesse, wollten wissen, wer ich bin, wo ich herkomme. Das waren Israelis oder Deutsche, die konvertiert waren. Letztere sind, da sie auch erst alles selber hatten lernen müssen, mit mir ganz anders umgegangen. Für den nächsten Tag luden sie mich auch zu einem Bat-Mizwa ein. Natürlich mussten sie mir zuerst erklären, was das überhaupt sei. Das war ein sehr eindrucksvolles Erlebnis für mich und aus diesem Tag bezog sich auch mein Wunsch, einmal einen eigenen Bat-Mizwa nachzuholen. Ich lernte eine Israeli kennen. Sie wollte unbedingt, dass ich mich mit ihrer Tochter anfreunde. Aber die Tochter interessierte sich überhaupt nicht für mich. Mit der Mutter verstand ich mich ausgezeichnet. Sie hat mich überall mitgenommen; sie war verwitwet und fing gerade an, wieder auszugehen. In einer Pizzeria wollte ich gerade eine Pizza mit Schrimps bestellen. Sie war entrüstet: „Das kannst du nicht”. Wieso, fragte ich, „Das ist nicht koscher”, lautete die Antwort. Mit ihrer Hilfe habe ich gelernt, was koscher heißt und auch die anderen Regeln. Dass ich mich nicht an alle Vorschriften halte - ich fahre zum Beispiel Auto am Sabbat, ich telefoniere und schreibe am Sabbat, ist meine Lebensart. Ich bin liberal. Aber ich respektiere es, wenn Leute ein orthodoxes Leben führen wollen. Jeden Freitag bin ich in die Synagoge gegangen. Vor allem, weil ich so jeden Freitag abend etwas vorhatte. Und dann lud mich unweigerlich jemand zum Sabbat-Essen ein, und es ergab sich irgendein Programm für das gesamte Wochenende. Ich war sozial eingebunden. Nach Berlin kam ich 1998 zurück und arbeitete bei einem Fernsehsender. Ich rief diese argentinische Frau an, die ich von früher kannte, zu der ich aber in der Zwischenzeit den Kontakt verloren hatte. Sie sagte mir, hier gibt es jetzt eine neue Synagogengemeinde. Die andere hat mich ja nicht interessiert, weil ich die Leute so unsympathisch fand. Ich bin zu der neuen Synagoge hingegangen und es war in der Tat sehr nett. Wenn man regelmäßig hingeht, wird man immer mehr eingebunden. Die jüdische Gemeinschaft gibt mir eine unendliche Bannbreite an Unterhaltung. Es gibt selten etwas, was unterhaltsamer ist, als eine jüdische Gemeinschaft. Die Leute lieben, streiten und hassen sich. Manche Szenen sind grotesk, man muss viel Humor und Geduld haben, aber ich fühle mich sehr wohl in dieser Gemeinschaft. Verheiratet bin ich nicht. Vor anderthalb Jahren bin ich zu dem Schluss gekommen, deutsche Männer haben keine gute Manieren. Ich dachte, ich schaue mir mal an, ob jüdische Männer da besser abschneiden. So fing ich an, per Internet Partner zu suchen. Von dieser Möglichkeit hat mir noch eine Frau in Dortmund erzählt. Durch das Internet wandte ich mich an ein jüdisches Netzwerk und fing an, mit jungen jüdischen Männern aus aller Welt per e-mail zu schreiben. Sie gaben mir eine Selbstsicherheit, so dass ich jetzt sagen kann, ich bin Jüdin, ich stehe dazu: mit all den Fehlern, mit all den Geboten, die ich einhalte oder auch nicht einhalte. Bis dahin dachte ich, jeder wirkliche Jude lebt auch so, wie es im Gesetz steht. Aber dass es im wirklichen Leben anders aussieht, habe ich von ihnen gelernt. Heute will ich nicht mehr für meine zukünftigen Kinder über das Judentum lernen, sondern ich mache das für mich selbst. Ich führe heute ein jüdisches Leben. Kein orthodox-jüdisches Leben, aber sehr wohl ein jüdisches Leben. Freitags und samstags gehe ich in die Synagoge, und dort übernehme ich immer mehr Pflichten. Hebräisch lernte ich lesen, und ich lerne hebräisch sprechen. Zu Hause esse ich seit einem Jahr koscher. Ich habe einen jüdischen Freund. Ich schreibe für jüdische Zeitungen über jüdische Themen. Über den Holocaust berichte ich nie. Das ist mein Grundsatz, weil ich von dem Holocaust nicht so viel weiß und es genug Leute in Deutschland gibt, die sich darauf spezialisiert haben. Aber ich kann vom heutigen jüdischen Leben berichten, hier, oder in England und in Amerika. Ich schreibe über das heutige Leben und die Zukunft, dahin richtet sich mein Blick, wie überhaupt der Blick der dritten Generation. Es ist wichtig für mich, einen jüdischen Ehepartner zu finden. Viele von diesen Männern, die ich per e-mail kennen lernte, traf ich auch. Als ich dann eine Beziehung zu einem jüdischen Mann hatte, erlebte ich etwas, was ich in nichtjüdischen Partnerschaften nie erfuhr: eine Rücksichtnahme, einen Respekt für mich als Frau. Nach jüdischem Ermessen bin ich auch deshalb wertvoll, weil ich eine halachisch-jüdische Frau bin. Von den Müttern jüdischer Männer bin ich wunderbar behandelt worden. In jüdischen Familien gibt es eine Art Matriarchat. Frauen haben sehr viel zu sagen und das macht sich auch im alltäglichen Leben bemerkbar: die Frau wird gefragt, es ist eine richtige Partnerschaft. Dagegen war meine Erfahrung bei deutschen Männern, dass ich wie ein exotisches Spielzeug behandelt worden war. Den Eltern, den Müttern bin ich teilweise nicht vorgestellt worden. Und wenn doch, dann war ich immer noch eine Ausländerin für sie. In einer Beziehung findet man ein Zuhause. In Deutschland ist es so, das man sehr spät heiratet. Wenn man eine Freundin hat, ist man nicht unbedingt an einer Heirat interessiert. Ein jüdischer Mann aber ist daran interessiert, denn wenn er eine jüdische Frau sucht, will er eine jüdische Familie. Seine Kinder sind nur jüdisch, wenn die Frau jüdisch ist. Deshalb hat die Frau eine ganz andere Rolle, sie hat eine Machtposition. Wenn man eine Partnerin sucht für das Leben, geht man mit ihr ehrlicher um. Dass es in Deutschland so viele „Mischehen” gibt, ist meines Erachtens zum Teil damit zu erklären, dass Frauen, die jüdisch erzogen wurden, sich auch wie „Jewish Princesses” benehmen, und auch so behandelt werden wollen. Das bedeutet womöglich, dass sie dem Mann nicht unbedingt Respekt gewähren. Diejenigen Männer aber, die es bevorzugen, wenn man zu ihnen hochschaut, finden das bestimmt viel leichter bei einer Frau mit deutschem Hintergrund. Die deutsche Frau ist in einem Patriarchat aufgewachsen. Die Möglichkeiten der Partnerwahl werden auch dadurch bestimmt, dass es nur seit etwa 5 Jahren mehr Juden in Deutschland gibt. Aber unter den deutschen Juden gibt es ganz klar eine Trennlinie, mit der ich mich überhaupt nicht identifizieren kann: die „alteingesessenen” Juden wollen mit den Neuankömmlingen aus Russland nichts zu tun haben. Und somit schließt man potentielle Partner wieder aus. Seit dem Holocaust ist die jüdische Gemeinde enger zusammengewachsen. Leute, die früher nie religiös waren, haben sich sehr auf die Religion zurückbesonnen. Sie sind jetzt bewusst jüdisch. Das ist aber eine Generationsfrage. Meine Generation beruft sich wieder mehr auf die jüdische Identität, was bei der zweiten Generation nicht unbedingt der Fall ist. Es gibt sehr viele Leute, die, wie ich, zum Judentum zurückkommen. In meiner Familie bin ich die Einzige, die sich für das jüdische Erbe interessiert. Die jüngere Generation definiert sich viel mehr religiös und kulturell als ihre Elterngeneration. Die Leute, die nach den 60-er Jahren geboren sind, finden viel eher zu den Wurzeln zurück. Das Problem zwischen den Generationen liegt darin, dass die zweite Generation keine eigene Identität hat. Die Kinder der Holocaust-Überlebenden sind in die Welt gesetzt worden mit der Erwartung, dass sie die umgebrachte Familie ersetzen sollen und das ist ein immenser Druck. Auch nach dem Tod ihrer Eltern empfinden sie das. In manchen Familien wurde sehr viel darüber geredet, was passiert ist, aber es gibt welche, wo gar nicht darüber gesprochen wurde. Die Mitglieder der zweiten Generation wissen oft wenig über ihre Herkunft und sie wissen oft sehr wenig Praktisches. Es ist in den Familien häufig so, dass die Eltern ursprünglich säkular waren und sie haben sich aufs Judentum nach ihren Erfahrungen in Auschwitz zurückbesonnen. Aber sie hatten selber ja gar keine jüdische Erziehung, also gar nichts weiterzugeben an ihre Kinder. Oder sie gaben teilweise auch bewusst nichts weiter, weil sie meinten, je weniger die Kinder wissen, desto besser können sie sich in der Gesellschaft zurechtfinden. Ich gehöre aber der dritten Generation an. Die dritte Generation sagt, wir wissen, was damals passiert ist, aber wir lernen wieder die religiöse Komponente, so dass wir ein religiöses jüdisches Leben führen können. Zwischen der zweiten und der dritten Generation gibt es auch den Unterschied, dass die zweite Generation sehr auf die Vergangenheit fixiert ist, auf das, was ihren Eltern widerfuhr. Die dritte Generation lebt und arbeitet für ein lebendiges jüdisches Leben heute und in der Zukunft. Die Mitglieder der zweiten Generation definieren sich entweder eher religiös oder kulturell, aber sie definieren sich auch immer gegeneinander. Also Reformierte gegen Orthodoxe. Die dritte Generation ist anders: es ist wichtig, dass man eine Synagoge hat, wo man hingehen kann, aber was das für eine ist, ist völlig egal. Ich kann abwechselnd in eine orthodoxe, liberale oder Reformsynagoge, bzw. in eine konservative gehen. Wir können miteinander reden, gemeinsam Projekte ausarbeiten und einander respektieren. Das liegt auch daran, dass wir mehr Berührungspunkte haben mit anderen Schichten der Gesellschaft und mit anderen Kulturen. Und zwar deshalb, weil wir gereist sind, weil wir auch andere Kulturen kennen lernten und weil sehr viele von uns eine jüdische Mutter und einen nichtjüdischen Vater haben oder umgekehrt. Das heißt, man ist sowieso in einem Mix aufgewachsen und hat sich selbst entdeckt. Man wohnt in Deutschland, kommt aber aus Amerika oder Russland und bildet Freundschaften. Wenn man sich darüber Gedanken macht, ob es wichtig ist, auch eine religiöse Identität zu haben und es nicht ausreicht, nur das kulturelle Erbe weiterzugeben, muss man, glaube ich, einfach zur Kenntnis nehmen und respektieren, dass es viele Strömungen gibt. In den USA zum Beispiel eine, die sich darauf beruft, dass Judentum nur kulturelle Geschichte sein kann. Aber es gibt so viele Variationen, und jedem soll es überlassen sein, welche er probieren will. Dass ich koscher esse und zur Synagoge gehe, bedeutet noch lange nicht, dass ich alles glaube, was in der Thora steht. Oder dass mein Gottesbild mit dem der Thora übereinstimmt. Ich bin tief religiös, aber mein Gottesbild stimmt nicht mit dem anderer Leute überein. Jeder hat sein eigenes Gottesbild. Das ist genau die gleiche Frage wie: „Bist du orthodox, bist du reformiert oder etwas anderes?” Philosemitismus finde ich nervend. Das ist eines der Hauptgründe, warum heute Leute nicht sagen, „ich bin jüdisch”. Sie werden dann nämlich ständig in Diskussionen eingebunden, und das geht auf die Nerven, weil man ein normales Leben führen möchte, wie jeder andere Mensch auch. Es ist sehr störend, wenn ich dauernd erklären muss, was ich warum mache. Der Rechtfertigungszwang kann auf die Dauer sehr störend sein. Auf der anderen Seite verdiene ich einen Großteil meines Geldes durch den Philosemitismus. Sie sagen: „Du bist jüdisch, dann kannst du ja wunderbar über jüdische Themen berichten”. Und das tue ich auch. Dadurch aber, dass ich Argentinierin bin und 5 Monate auch in Westafrika lebte, um Materialien für meine Magisterarbeit zu sammeln, habe ich auch bei meiner Arbeit Ausweichmöglichkeiten in andere Richtungen. In Deutschland fühle ich mich im großen und ganzen nicht sehr wohl. Es ist eine Gesellschaft, in der die Leute nicht sehr herzlich sind. Es fängt schon damit an, wie man sich begrüßt: man reicht jemandem auf drei Meter Entfernung die Hand. Wenn man sich nach einer Weile näher kennen gelernt hat, würde man denken, dass auch eine gewisse Nähe entsteht. Aber wie man die Menschen auch körperlich auf Distanz hält, zeigt, dass die ganze Gesellschaft eine Art Kühle hat. „Man geht durch die Straßen, und kein Mensch lächelt”, sagte mein Vater einmal. „Geh in ein Land, wo es den Menschen wirklich schlecht geht,” fügte er hinzu, „aber sie haben sich wenigstens ihre gute Laune, ihren Humor, das Lachen bewahrt.” Wenn man aus einem Land kommt, wo Spontaneität entstehen kann, wo Feste so ausgelassen gefeiert werden, ist das schon schwierig, sich mit dieser Einstellung zurechtzufinden. Hier habe ich mir eine gewisse Existenz aufgebaut. Ich bin hier zur Schule gegangen, studierte hier und fing hier an, zu arbeiten. Dass ich hier lebe, ist zum einen eine Frage des Berufs. Zum anderen, ich könnte nicht zurückgehen, wo ich herkomme, weil man sich mit der Zeit von seiner Heimat entfernt. Man wird anders, ich habe ein anderes Bewusstsein. Es gibt Dinge, die ich dort liebe, andere irritieren mich, weil ich mittlerweile auch sehr deutsch geworden bin. Zum Beispiel bin ich zwar generell unpünktlich - etwas Charakteristisches für Latein-Amerikaner -, aber das bewegt sich bei mir innerhalb des Rahmens einer halben Stunde. Wenn man sich in Argentinien mit jemandem für 14 Uhr verabredet, taucht er, falls man Glück hat, um 17 Uhr auf. Das könnte ich nicht mehr ertragen. In dem einen Land bin ich nicht glücklich, weil mir einige Elemente fehlen, für das andere trifft das aber genauso zu. Die einzige Möglichkeit wäre, ein Drittland als Wohnort zu wählen. Ich arbeite auch daran, aber bisher hat es sich nicht ergeben. Wenn ich weiterhin meinen Beruf ausüben möchte, muss ich auch in Betracht ziehen, dass man als Journalist nur in Länder gehen kann, wo man sich perfekt verständigen und arbeiten kann. Raymond Wolff „Direkt wurde ich sehr selten mit dem Jüdischsein konfrontiert, aber Leute benehmen sich anders gegenüber jüdischen Menschen” Obwohl Raymond Wolff in den Vereinigten Staaten geboren wurde und erst mit 23 Jahren nach Deutschland kam, hat er die USA nie als seine Heimat betrachtet. Den für ihn wichtigsten Teil seiner Erziehung erhielt er von seinen Großeltern, die ihm die deutsche Sprache und viele Volkslieder beibrachten und meistens nur von dem guten Deutschland sprachen. Der 53jährige Wolff sagt, ohne zu zögern: „Ich bin deutscher Jude.” Durch seine Schallplattensammlung, meint er, hat er einen Teil der jüdisch-deutschen Kultur gerettet. Ich liebe es, hier zu leben. Vielleicht bin ich nach Deutschland gekommen, um (allerdings unbewusst) meine Eltern zu ärgern, aber ich fühlte mich vom ersten Augenblick an wohl. Von meinen Eltern, von meiner Kindheit komme ich nicht los, egal ob die Eltern in der Nähe sind oder nicht. Mein Vater lebt nicht mehr, er ist vor zwei Jahren gestorben. Zu ihm habe ich, so sonderbar es klingen mag, keine Beziehung gehabt. Mein Vater zeigte sein ganzes Leben lang, dass er keine Kinder haben wollte. Er kümmerte sich überhaupt nicht um die Familie, weil er seine Eltern verloren hatte und einer neuen Familie nicht zu nahe sein wollte. Das ist natürlich meine Interpretation. Meine Mutter hat zwar durchgesetzt, Kinder zu haben, aber sie war der Auffassung, sie wäre für das Mädchen zuständig, mein Vater für den Jungen. Sie hat sich um meine jüngere Schwester gekümmert - sie hatte eine innige Beziehung zu ihr, aus der ich immer ausgeschlossen war. Zu meiner Mutter habe ich ein sehr schwieriges Verhältnis. In meiner Kindheit hat sie mich geschlagen. Sie ist jetzt älter, besitzt nicht mehr die Kraft von früher, trotzdem ist sie, ich muß es leider so sagen, ein Biest. Auch neulich hat sie Unterlagen aus der Familiengeschichte weggeworfen, die für mich sehr wichtig waren. Oft, wenn sie weiß, daß mich etwas interessiert, wirft sie es weg. Wenn meine Schwester sie darum gebeten hätte, das für sie aufzuheben, wäre sie damit sehr achtsam umgegangen. Ich glaube, es gibt eine Tendenz unter den Frauen in meiner Familie, Männer nicht zu mögen. Es waren starke Frauen da, die zusammenhielten. Immer noch habe ich es im Ohr, als sie alle zusammenkamen, sich anguckten und nur sagten „men” - mit einer Verachtung, die viel verriet. Der Mann war schon das schlechte Wesen an sich. Meine Eltern waren sehr verschieden. Meine Mutter war die dominante Person. Mein Vater hat unter meiner Mutter sehr gelitten. Sie hat ihm das Rückgrat gebrochen. Er war eigentlich kein Mann, sondern eine Gemüsesorte. Er guckte Fernsehen, las ein bisschen die Zeitung, aber er hatte keine Interessen, keine Hobbys. Meine Mutter war für ihn eine Ersatzmutter. Sie hat gekocht, die Wäsche gewaschen, und kümmerte sich um die Kinder - oder zumindest um meine Schwester. Meine Schwester ist sehr einfach, sozusagen pflegeleicht. Ich bin für meine Mutter zu kompliziert gewesen. Sie hat mich wahrscheinlich gehasst, weil sie alles, was mit Deutschland zusammenhing, vergessen wollte. Ich war aber ein Stück Deutschland. Ich sprach deutsch und bin dann auch nach Deutschland gegangen. Mein Vater ist 1937, meine Mutter 1938 aus Deutschland in die Vereinigten Staaten emigriert. Die Eltern meines Vaters sind höchstwahrscheinlich in dem polnischen Ghetto Piaski, in der Nähe von Lublin, umgekommen. Auch viele andere Verwandten sind ermordet worden und das hat meine Kindheit mitgeprägt. Es wurde immer wieder darüber gesprochen, und nach Verwandten gesucht. Vaters Großmutter, meine Urgroßmutter, hatte vier Brüder in Amerika, die schon in den 60-er Jahren des 19. Jahrhunderts auswanderten und zur Nazizeit schon längst tot waren. Die Familie in Deutschland hatte keinen Kontakt mit den Nachkommen der Brüder in Amerika und es war sehr schwierig, diese Leute zu finden. Es ist aber gelungen, und obwohl es „wildfremde” Menschen waren, nahmen sie die Bürgschaft für meinen Vater und seinen Bruder über. Nur so konnten sie in die USA einwandern. Aber für die Eltern war es schon zu spät. Die Eltern meines Vaters wurden aus Mainz deportiert. Nach dem Krieg, als mein Vater von Deutschland Wiedergutmachung bekommen sollte, fand man in den Ruinen der Dresdner Bank Kontoauszüge von meinen Großeltern. Sie konnten vom Ghetto her noch Geld abheben. Ich weiß nicht, wie das ging, aber laut Kontoauszüge war das möglich. Von den Sperrkonten konnte man jeden Monat eine gewisse Summe abheben. Auf einem Auszug stand die Unterschrift meiner Großmutter, und dahinter: „Witwe.” Wahrscheinlich wollte sie damit der Familie mitteilen, falls irgendwann jemand diese Kontozüge sehen sollte, dass der Großvater nicht mehr am Leben war. Meine Mutter konnte mit ihren Eltern und ihrer Schwester auswandern. Mein Großvater Scheuer, der Vater meiner Mutter, hatte zwei Brüder in Amerika, die vor dem ersten Weltkrieg ausgewandert waren. Sie wiederum hatten zwei Onkel, die im 19. Jahrhundert nach Texas gingen, und dort die ersten großen Kaufhäuser aufbauten. Die Brüder gingen dorthin, um in den Kaufhäusern zu arbeiten. Ein Bruder gab die Bürgschaft für meinen Großvater, der andere für seine Schwester, und so konnte die ganze Familie den Nazis entkommen. Mein Vater hat in Deutschland Weinkaufmann gelernt. Dafür gab es aber in Amerika keinen Bedarf, man trank damals keinen Wein. Zuerst arbeitete er in einem Hemdengeschäft, im Empire State Building, später in einer Uhrenfabrik - er hatte inzwischen Feinmechanik gelernt. 1946 kaufte er eine Hühnerfarm - dort bin ich aufgewachsen. Dann ging die Farm nicht mehr und er verdiente sich das Geld als Haus- und Versicherungsmakler. Meine Mutter hat in einer Schule Kuchen gebacken. Meine erste Sprache war Deutsch wegen der Großeltern. Sie waren schon zu alt dazu, gut Englisch zu lernen. Sie wohnten ganz in der Nähe. Meine Eltern haben nur deutsch gesprochen, wenn die Großeltern da waren, untereinander aber, soweit ich mich erinnern kann, sprachen sie mehr englisch. Zum Glück hatte ich meine Großeltern, meine Eltern waren ja für mich nicht da. Sie waren wunderbare Menschen. Ich bin mehr oder weniger als Deutscher aufgewachsen, weil ich mit meinen Großeltern immer deutsch sprach und immer wissen wollte, wie das Leben in Deutschland war. Meine Schwester wollte nichts davon wissen. Sie hasst auch heute noch alle Deutschen, sie nennt sie „animals”. Ich weiß nicht, ob sie es von meiner Mutter gehört hatte, dass die Deutschen schlimm wären, aber ich gehe davon aus. Dass meine Mutter so antideutsch eingestellt war, ist eine Generationsfrage. Es gab einen sehr großen Unterschied zwischen der Generation meiner Großeltern und der meiner Mutter. Meine Großeltern waren erwachsene Menschen, als Hitler an die Macht kam. Sie haben Deutschland aus der früheren Zeit gekannt und da sie erwachsen waren, konnten sie auch mit Hitlers Machtergreifung anders umgehen, sie waren nicht voller Hass. Meine Mutter aber war 17 Jahre alt, als sie Deutschland verließ und sie konnte sich nur an die schlechten Zeiten erinnern. Sie gehört auch zu der Generation, die meint, es ist ihnen etwas vorenthalten worden. Sie haben ihre Kultur verloren, die Sprache, ihr Hab und Gut, ihr Erbe und sie sind verbittert. Meine Mutter wollte trotzdem meiner Schwester Linda ihren Heimatort zeigen. Sie waren in mehreren Ländern, zuerst in Israel, dann kamen sie auch nach Deutschland. Das war 1968, meine Schwester war damals 19 Jahre alt. Über die Reise führte meine Mutter ein Tagebuch, das ich mal gefunden habe. Im Tagebuch stand: „Linda ist sehr krank. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist, sie kann nichts essen, sie muß sich immer übergeben.” Sie brachen ihren Aufenthalt in Deutschland frühzeitig ab, und fuhren nach Amsterdam. Sofort war meine Schwester wieder gesund. Ich denke, sie konnte es nicht ertragen, in Deutschland zu sein. Über Deutschland sprach ich mit meiner Mutter nicht. Meine Eltern hatten mit Deutschland nichts zu tun, außer, dass sie die Schecks - die Wiedergutmachung - jeden Monat bekamen. Meine Großeltern aber haben mit ein paar Leuten aus ihrem Dorf korrespondiert. Wenn ich mit meinem Vater über seine Eltern sprechen wollte, weinte er immer. Er konnte nicht darüber reden. Ich kann mich auch nur an ein-, zwei Gelegenheiten erinnern, wo mein Vater und ich gemeinsam etwas unternommen haben. Einmal waren wir im Zoo, nur wir beide, aber nur, weil meine Mutter darauf bestand. Ein anderes Mal sind wir angeln gegangen und er beschäftigte sich noch ein wenig mit mir, als ich bei den Pfadfindern war. Das war aber auch alles. Schon als Kind hatte ich eine Liebe zu Deutschland, deshalb wurde ich auch in der Schule zusammengeschlagen. Als ich in die Schule kam, sprach ich noch kein Englisch, oder zumindest nur schwach. Wir hatten noch ein Kind in der Klasse, das Wladimir hieß und auch nicht Englisch konnte. Wir beide waren die furchtbaren Kinder. Es war auch befremdend für meine Schulkameraden, dass ich auf dem Pausenhof um den Zaun herum ging und „Du, Du liegst mir im Herzen” und andere deutsche Volkslieder sang. Ich lernte sie von meiner Großmutter, die immer sehr gerne Lieder sang. Als ich nach Deutschland kam, hat sich herausgestellt, dass ich Lieder konnte, die meine Generation hier überhaupt nicht gelernt hatte, da deutsche Volkslieder nach dem Kriege verpönt waren. Das fand ich schon merkwürdig: ich als Jude habe diese Lieder gelernt, die Deutschen aber nicht. In der Schule wurde ich verprügelt, weil ich anders war. Heute mögen die Kinder mich, aber ich kenne Kinder zu gut, um sie zu lieben. Kinder sind schlechter als Erwachsene. Wenn sie jemanden hassen, schlagen sie einfach zu. Die Erwachsenen machen das anders, sie versuchen, ihren Kopf zu benutzen, oder kommen von hinten. Ich habe eine sehr schlechte Schulzeit erlebt, zwei Jahre waren besonders schlimm. Wo wir wohnten - eine Stunde von New York City entfernt - gab es viele Kinder italienischer Abstammung und sie waren brutal. Ich war ein braver preußischer Junge, einsam und schwach. Das hat man in der Klasse natürlich gemerkt und ging auf mich los. Jeden Tag war ich voll mit blauen Flecken. Meine Eltern mussten mich von dieser Schule nehmen und ich ging dann auf eine Privatschule. Fahrrad fahren habe ich nie gelernt und wir wohnten auf einer Farm. Ich hatte nur ein Nachbarmädchen als Spielkameradin. Meine Eltern fuhren mich nicht zu Schulkameraden zum Spielen hin. Das kam vielleicht zwei-, dreimal vor, ansonsten nicht. Wenn meine Großeltern über Deutschland sprachen, erzählten sie meistens über ihre Verwandtschaft. Sie hatten sehr viele Vettern und Cousinen, sie sprachen darüber, wo sie gewohnt, was sie gemacht haben, und auch über ihre Kinder erfuhr ich viel. Schon als Achtjähriger schrieb ich mir das auf. Die Großeltern hatten Sehnsucht nach Deutschland. Meine Großmutter war 12 Jahre jünger als mein Großvater. Die Großmutter hat mich dreimal in Deutschland besucht, wir waren dort, wo sie aufgewachsen ist, wo sie geheiratet hat und wo meine Mutter geboren wurde. Dort, in Staudernheim an der Nahe, passierte etwas, was mich sehr bewegte. Wir waren bei Leuten untergebracht, die einen Bauernhof hatten, Kühe und Hühner. Als wir hinkamen, stellte meine Großmutter den Koffer ab, legte sich eine Schürze um, und ging sofort in den Hof, um die Hühner zu füttern. Sie war glücklich. Ich habe sie vielleicht nie so glücklich gesehen. Sie war in Amerika nie zu Hause, mein Großvater auch nicht. Nach dieser Szene sprach ich mit meiner Großmutter darüber, warum sie nicht nach Deutschland zurückkommt. Fast glaube ich, sie hätte das gemacht. Der Großvater lebte zu der Zeit nicht mehr. Aber die zwei Töchter waren in Amerika, auch meine Schwester, und in Deutschland hätte sie nur mich gehabt. Und ich kann nicht auf dem Land leben. Sie wäre allein gewesen. Außerdem hätte sie dort, an Ort und Stelle, immer im Kopf gehabt, wer was getan hatte, und hätte diesen Menschen auch ständig begegnen müssen. Meine Mutter hat mir erst in den letzten Jahren erzählt, dass mein Großvater ein herzloser Mensch gewesen ist. Als Kind war sie tagelang im dunkeln Keller eingesperrt. Ich kann mich erinnern, als ich noch ein kleines Kind war, schloss sich mein Großvater manchmal in sein Zimmer ein und ist mit dem Kopf gegen die Wand gerannt, bis es geblutet hat. Er war nicht sehr nett zu meiner Großmutter: es war, wie damals üblich, keine Liebesheirat, ein Heiratsvermittler brachte die beiden zusammen. Aber als mein Großvater alt wurde, war er ein sehr lieber Opa. Wir wohnten etwa 10 Kilometer von meinen Großeltern entfernt und wenn mein Großvater wegen irgendeiner Kleinigkeit einen Wutanfall hatte, sagte er nur: „Ich gehe auf die Farm.” Er ist dann zu Fuß losgegangen. Meine Großmutter rief uns an und sagte: „Opa hat die Tour.” Das hieß, er war unterwegs. Dann ist ihm meine Mutter meistens mit dem Auto entgegen gefahren und nahm ihn zu uns mit. Ich glaube schon, dass mein Großvater nicht gut zu meiner Mutter war. Psychologisch gesehen ist es bemerkenswert, dass in unserer Familie meine Schwester die Prinzessin war und ich der böse Bub, und bei meinen Großeltern die Schwester meiner Mutter das verwöhnte Kind und meine Mutter als zweitrangig galt (sie nannte sich selbst Aschenputtel). Den Grund dafür kenne ich nicht. Auch als meine Mutter schon verheiratet war, blieb es so. Meine Tante lebte in New York. Sie hatte die besten Kleider und führte sich wie ein Lady auf, was sie eigentlich nicht sein konnte, denn so viel ich weiß, stammen keine Ladys aus Staudernheim. Aber meine Großeltern hatten auch später mehr Freude an ihr als an meiner Mutter, obwohl sie immer sehr gut zu ihren Eltern war, auch zu ihrem Vater. Zu mir war der Großvater immer gut. Es spielte wahrscheinlich auch eine Rolle, dass ich ein Junge war. Ich weiß nicht, ob meine Großeltern je mit meiner Mutter darüber gesprochen hatten, warum sie mich so behandelte. Jedenfalls hat meine Mutter, die mich oft schlug, immer damit gewartet, bis meine Großeltern nicht mehr im Hause, in Sichtweite waren. Aber wenn ich meinem Vater zurief: „Wieso erlaubst du, dass sie mich schlägt, hilf mir doch!”, meinte er nur: „Es geht mich nichts an.” Unter anderem hat mich meine Mutter bestraft, weil meine Schwester sich beklagte - auch wenn es nicht immer wahr war - dass ich sie geschlagen hätte, oder dass ich nicht mit ihr spielen wollte, nur mit dem Nachbarmädchen. Sie war das Kind meiner Mutter, ich war mehr oder weniger das Kind meiner Großeltern. Mein Vater hatte eigentlich keine Kinder. Wir sind in die Synagoge gegangen, die Traditionen haben wir aber nur locker gehalten. Ich hatte 10 Jahre lang Religionsunterricht, den ich hasste, weil ich ihn langweilig fand. Die Schule musste man besuchen, das wusste ich, aber warum sollte ich in die „hebrew school” gehen? Man brachte mich hin und holte mich ab, es gab keine Widerrede. Wenn wir zusammen sassen und die hohen Feiertage feierten, war das nicht wichtig für mich, ich fand es auch nicht interessant. Mein Großvater kannte alle Gebetbücher auswendig, seine Eltern waren orthodox. Er hat aber nicht versucht, mir Gebete beizubringen. Ich glaube, die Religiosität meiner Großeltern änderte sich auch ein wenig nach der Nazizeit. Meine Großmutter sagte einige Male: „Wo war denn Gott?” Die Religionsgesetze haben sie dann nicht mehr so streng eingehalten. In Deutschland gingen sie noch jeden Samstag in die Synagoge, die nicht in ihrem Dorf war. Die Privatschule, die ich besuchte, war ein Internat. Bis zum Alter von 17 Jahren war ich dort. Auch danach wohnte ich nicht mehr zu Hause, sondern fing mit dem Studium an. Ich habe Musik studiert, das hat mich immer interessiert. Diese Wahl war aber ein Fehler von mir, weil ich nicht gut genug war. Nach zwei Jahren bin ich rausgeflogen. Damals war es noch nicht möglich, Musikgeschichte zu studieren, vielmehr mußte man ein Instrument spielen, und den Abschluss darin machen. Ich habe Klavier gespielt. Aber wenn man kein Talent hat, schafft man es auch durch das Üben nicht, und das war leider ein sehr gutes Konservatorium. Es war furchtbar für mich, dass ich dieses Studium nicht weitermachen konnte. Dann habe ich deutsche Literatur studiert, und dieses Studium in Deutschland fortgesetzt. Ich war 23, als ich nach Deutschland kam. Der Grund dafür war, dass ich inmitten des Vietnamkriegs eingezogen werden sollte. Das wollte ich unbedingt vermeiden. Nach Kanada, England oder Schweden hätte ich auch gehen können - dies waren die Länder, welche die Leute wählten, die nicht in den Krieg wollten, aber auch keine Lust hatten, im Gefängnis zu landen. Aber diese Länder zogen mich nicht an. Ich sprach deutsch, ich war immer interessiert an Deutschland und fühlte mich in den USA nie zu Hause. Ich fühlte mich nicht als Amerikaner. Zwar bin ich in dem Land aufgewachsen, aber nicht in dessen Kultur. Bedenken hatte ich überhaupt keine wegen der deutschen Vergangenheit, aber ich dachte auch nicht sehr viel darüber nach. Vielleicht wollte ich auch meine Eltern unbewusst ärgern, ich weiß es nicht. Sie haben damals gesagt, sie sind gegen den Vietnamkrieg und würden mich unterstützen, wenn ich weggehe, nur nicht nach Deutschland. Allerdings war ich schon drei Jahre zuvor einen Sommer lang in Deutschland. Die amerikanische Universität, an der ich studiert hatte, bot so ein Programm an. Damals fühlte ich mich auch schon wohl. Als ich 1970 hierher zog, dachte ich, diesmal würde das genauso sein. Ich dachte nicht darüber nach, ob das ein Zuzug für immer war. In Deutschland studierte ich ein Jahr in Hamburg, den Rest in Berlin. In Berlin fühlte ich mich besonders wohl. Es war meine Sprache, und diese Kultur habe ich auch als meine eigene betrachtet. Ich habe ja auch Germanistik studiert. Durch mein Musikstudium kannte ich auch die deutsche klassische Musik gut, schon bevor ich nach Deutschland kam. Englisch sprach ich zwar besser als deutsch, aber was man als seine Sprache betrachtet, ist ein Gefühl der Seele. Nach dem Studium war ich in einer Art Schockzustand. Die Universität ist eine Welt für sich, sie gehört nicht zur realen Welt. Es ist, als würde man noch in der Gebärmutter stecken. In Amerika habe ich sechs Jahre lang studiert, in Deutschland weitere sechs Jahre. Mein Abschluss von Amerika wurde hier nicht voll anerkannt. Ich hatte es auch nicht eilig, ich bin nicht sehr ehrgeizig. Wenn man dann von der Universität kommt, wird man plötzlich mit der Realität konfrontiert, bis dahin hat ja die Universität für einen gesorgt. Ich habe Bafög erhalten, konnte aber auch Geld dazu verdienen. Nun wurde ich aber in die Kälte hinaus gestoßen und musste mich erst daran gewöhnen. Einen richtigen Job bekam ich nicht, ich habe nur über ABM, die Arbeitsbeschaffenden Maßnahmen, Stellen erhalten. Germanistik studierte ich, weil es mir gefiel, aber ich dachte nie darüber nach, ob ich damit etwas anfangen könnte. Den Abschluss, den man zum Unterrichten braucht, hatte ich nicht, aber ich wollte auch nicht in die Schule. Mit meinem Diplom hätte ich vielleicht bei einem Verlag als Lektor arbeiten können, aber dafür war mein Deutsch nicht perfekt genug. Unter anderem war ich Gartenbauarbeiter und arbeitete in der Bibliothek der Technischen Universität. Ich habe mindestens 10 Stellen gehabt, die ich bis zum letzten Jahr immer durch ABM bekam. Das Interesse an Musikgeschichte hatte ich immer. Vor etwa 15 Jahren fing ich an, Schallplatten zu sammeln. Vor allem konzentrierte ich mich auf den Beitrag der Juden zur Unterhaltungsmusik im deutschsprachigen Raum. Auch Walzen besitze ich noch, und meine Schallplatten sind teilweise fast 100 Jahre alt. Ich habe auch sehr viele Platten mit jüdischliturgischer Musik, auch jiddische Platten, und ich bin sehr stolz auf meine Sammlung. Geschichte habe ich zwar nie studiert, aber ich wurde Historiker. Die letzte Schellackplatte mit 78 Umdrehungen wurde in Deutschland etwa 1960 hergestellt. Von diesen Platten sind sehr viele durch den Krieg zerstört worden, und die meisten Juden, die entkommen konnten, nahmen ihre Schallplatten natürlich nicht mit. Einige Platten wurden von deren Besitzern in Deutschland versteckt, da man keine jüdischen Platten haben durfte. Ich habe Platten, wo einiges auf dem Label ausgekratzt ist, der dem Besitzer Schwierigkeit bereitet hätte. Auf einer meiner Platten, die „Das Herz einer Mutter” heißt, steht unter diesem Titel in Klammern „Meine jiddische Mame”. Dieselbe Platte habe ich aber auch in der Form, wo der Titel in Klammern ausgekratzt wurde. Das ist auch Geschichte. Mit dieser Sammlung habe ich, wie ich glaube, einen Teil der jüdisch-deutschen Kultur gerettet. In Deutschland gibt es außer mir nur noch eine Person, die so etwas sammelt. Musik hat auch einen soziologischen Aspekt. Wenn es um Gesang geht, ändern sich die Themen mit der Zeit, nicht nur der Stil der Musik, sondern auch die Worte. Man kann über die Schallplatten auch etwas über die Geschichte der Juden lernen. Auch über den jüdischen Selbsthass. Es gab Juden, die sehr merkwürdige Texte sangen. Auch viele Humorschallplatten befinden sich in meinem Besitz; Humor, der in kleinen „Etablissements” vorgetragen wurde. Daraus kann man erfahren, worüber man früher lachte. Man lachte über Juden, mit ihnen oder gegen sie. Von diesen Platten lernt man sehr viel über die Beziehung der Mehrheitsgesellschaft zu den Juden. Warum ich anfing, mich mit dem jüdischen Thema zu beschäftigen, weiß ich nicht. Als ich in Amerika lebte, interessierte es mich überhaupt nicht dass ich jüdisch war. Dort war es weder für mich, noch für meine Umwelt erwähnenswert. In Amerika ist es selbstverständlich, dass alle Länder, Sprachen und Religionen vertreten sind. Aber in Deutschland ist es nicht so. Ich kam hierher und plötzlich war ich der Jude. Auch wenn niemand was sagte, auch wenn sie versuchten, zu mir normal zu sein. Aber als ich für die Außenwelt Jude wurde, habe ich diese Identität auch angenommen. Direkt wurde ich sehr selten mit dem Jüdischsein konfrontiert, aber Leute benehmen sich anders gegenüber jüdischen Menschen. Sie sind weniger kritisch. Die meisten Menschen sind nicht antisemitisch, manche sind sogar philosemitisch. Ich habe viel mehr Probleme mit Philosemiten als mit Antisemiten. Ich bin dabei, in Deutschland eine Synagoge restaurieren zu lassen und ein Museum dort einzurichten, und zwar in Staudernheim, dem Ort, wo meine Mutter herkommt. Dort habe ich so viele schlimme Sachen erlebt - gerade mit Leuten, die dafür bekannt sind, dass sie so viel für das Erinnern an die Juden machen. Und das sind die Menschen, die mich dort nicht haben möchten. Sie versuchen, aus irgendwelchen Gründen, - vielleicht war der Großvater ein Nazi, oder sie waren selbst in der Hitlerjugend -, viel für die Juden zu tun, für die Erinnerung zu sorgen. Nur darf kein lebendiger Jude in der Nähe sein. Mit anderen Leuten zusammen gründete ich einen Verein, um die Synagoge zu restaurieren. Eins von den Mitgliedern war ein Philosemit. Als wir so weit waren, dass wir die Synagoge kaufen wollten, bat ich ihn - da er in der Nähe wohnt -, die Verhandlungen zu führen. Es hat sich dann herausgestellt, dass er die Synagoge für sich kaufte. In einer Vereinssitzung gab er das plötzlich bekannt. Diese Synagoge wurde im Jahre 1896 eingeweiht, meine Ururgroßeltern, meine Urgroßeltern und mein Großvater waren dabei, aber ich sollte nichts damit zu tun haben. Diese Person verkaufte die Synagoge an einen anderen Verein weiter, der vorher schon eine andere Synagoge gekauft und restauriert hatte, um ein „Haus der Begegnung” einzurichten. Und diese Menschen finden es merkwürdig, wenn ich frage, wer begegnet eigentlich wem? Die Juden die Nichtjuden? Wo aber sind die Juden? Um diese Synagoge habe ich gekämpft und letztendlich schaffte ich es, unser Verein konnte sie kaufen. Mit dem Wiederaufbau sind wir fast zur Hälfte fertig. Das Landesamt für Denkmalpflege half uns sehr dabei. Im Moment haben wir aber kein Geld mehr. In der Synagoge wird es eine kleine Ausstellung zur Geschichte der jüdischen Gemeinde geben. Ich habe über 200 Photos und auch einige Gegenstände, die noch meine Großeltern nach Amerika mitnahmen. In der Synagoge sollen auch kleinere Kulturveranstaltungen stattfinden. Aus der Geschichte weiß ich, dass die Leute, die es mit dem Dritten Reich am schwersten hatten, solche Menschen waren, die früher zum Christentum konvertierten und plötzlich durch die Gesetzgebung wieder zu Juden gemacht wurden. Mir wird das nicht passieren, das habe ich beschlossen. Ich weiß, dass ich Jude bin, und ich werde das für mich positiv verarbeiten. Zwar finde ich, man sollte alle Religionen abschaffen, weil sie nur eine weitere Trennung unter den Menschen verursachen, und weil es sowohl unter den Christen als auch den Juden immer Streit gibt. Aber wenn schon eine Religion, dann ist die jüdische meiner Meinung nach nicht die Schlechteste. Praktizieren tue ich sie aber nicht. Manchmal gehe ich zu einem Seder, aber das ist auch alles. Ich bin mir dessen bewusst, dass Juden - wie zum Beispiel Einstein oder Mendelssohn - sehr viel für die Entwicklung der Menschheit taten und bin stolz darauf. Wenn ich die Wahl hätte, entweder Nachkomme von Opfern oder von Tätern zu sein, dann lieber Opfer. Aber im Moment fühle ich mich überhaupt nicht als Opfer. Es ist bekannt, dass ich Jude bin. Oft genug bin ich in der Zeitung, ich habe in mehr als 250 Schulklassen eine Ausstellung über die Juden in Neukölln präsentiert. Aber mir ist fast nie was passiert. Einen Drohbrief oder einen bösen Anruf habe ich nie erhalten. Im Telefonbuch stehe ich unter meinem richtigen Namen. In den 30 Jahren, die ich in Deutschland lebe, habe ich nur 3 antisemitische Vorfälle erlitten. Und ich bin mir nicht sicher, dass ich in Amerika nicht mehr solche Fälle erlebt hätte. Über meine nichtjüdischen „Mitbürgern” kann ich mich also nicht beschweren. Einer der antisemitischen Vorfälle war aber damals für mich sehr schlimm. Ich arbeitete zu der Zeit in der Bibliothek der Technischen Universität, eigentlich im Archiv der Bibliothek. Eine Mitarbeiterin, die perfekt polnisch sprach, ich glaube, sie kam aus Oberschlesien, war ein ausgesprochene Antisemitin. Sie gab das oftmals zu verstehen. Wenn ich in der Nähe war, hat sie zu den Anderen immer wieder gesagt, „schau mal, der Moishe da”, oder, „der Jude dahinten”. Das ging mir auf die Nerven. Ich habe mich natürlich beim Leiter der Bibliothek beklagt. Es gibt heute Gesetze gegen solche Leute, sagte ich ihm, und ich würde es mir nicht weiter gefallen lassen. Die Frau wurde nicht entlassen, ich kam aber woanders hin, wo ich ihr nicht begegnen mußte. So war es auch in Ordnung. Die anderen Vorkommnisse sind eigentlich kaum der Rede wert. Wenn ich über beleidigende Anrufe lese, denke ich immer, merkwürdig, wo passiert denn das? Für meine Person muß ich sagen, die Deutschen sind nicht besser oder schlechter als Menschen anderer Nationen. Ich bin ein deutscher Jude. Als Amerikaner möchte ich nicht angesehen werden. Deutschland betrachte ich als meine Heimat und ich fühle mich wohl hier. Einige meiner Freunde wären vielleicht nicht meine Freunde, wenn ich nicht jüdisch wäre. Aber ich habe sehr wenig jüdische Freunde. Ich komme oftmals mit Juden nicht gut zurecht. Mitglied der Jüdischen Gemeinde bin ich nicht, weil ich dort wiederholt nicht gut behandelt worden bin. Die Leute benehmen sich dort oft wie Kleinbeamte, die ein bisschen Macht haben und sie anderen gegenüber ausüben wollen. Sie sind teilweise kleinkariert und bösartig. In Deutschland gibt es einen hohen Prozentsatz an Juden, vielleicht mehr, als in anderen Ländern, die nicht Mitglied einer Jüdischen Gemeinde sind. Aus dem gleichen Grund: weil sie nicht gut behandelt worden sind. Ich muß sagen, die jüdischen Leute, die mir gefallen, sind fast alle nicht in der Jüdischen Gemeinde. Viele sind meiner Meinung nach damals wegen Heinz Galinski aus- oder gar nicht eingetreten. Und trotzdem gibt es heute noch die Legende von dem liebenswürdigen Galinski. Erstaunlicherweise sagen das auch Leute, die ihn kannten und ganz genau wissen, dass das nicht der Wahrheit entspricht. In der Gemeinde gibt es viel Unredlichkeit und Heuchelei, und das will ich nicht mitmachen. In den Jahren, in denen ich über die jüdische Geschichte gearbeitet habe, stellte ich fest, dass ich viel leichter mit Leuten zusammenarbeiten kann, die nicht jüdisch sind. Das erste Problem ist das Desinteresse der Juden an der eigenen Geschichte. Mich schmerzt es sehr, dass die Juden in Deutschland nicht deutsche Juden sind. Sie sind es zwar aufgrund ihres Passes, aber nicht so wie es vor 1933 die deutschen Juden gewesen sind. Sie kommen von woanders, meistens aus dem Osten, das ist ihre Kultur. Dafür können sie selbstverständlich nicht. Aber wenn sie schon freiwillig entscheiden, in Deutschland zu leben, dann könnten sie auch entscheiden, sehen zu wollen, was das deutsche Judentum ehemals war. Dann würden sie sich nicht, was im großen und ganzen der Fall ist, nur für das Jiddische und für den Klezmer interessieren, wobei Klezmer nicht deutsch-jüdische Musik ist. Für meine Arbeit war es hinderlich, dass das Interesse der Juden an der deutsch-jüdischen Geschichte gering ist. Die Jüdische Gemeinde veranstaltet die Jüdischen Kulturtage. Jedes Jahr haben die Kulturtage ein Thema und interessanterweise ist die Klezmer-Gruppe genauso dabei, wenn es um Südkalifornien geht, oder wenn das Thema Wien oder Odessa ist. Im Jüdischen Museum bin ich teilweise für Musik zuständig und wenn ich dort was zu sagen haben sollte, wird in diesem Museum kein Klezmer gespielt. Die Deutschen glauben langsam, das wäre die jüdische Musik. Sie wissen nicht, dass das keine Musik ist, die hier vor 1933 groß gespielt worden wäre, und dass diese Musik herzlich wenig mit der deutschen Musikgeschichte zu tun hat. Klezmer war eine Hochzeitsmusik, die in Osteuropa gespielt wurde. Unter den alten Schallplattenaufnahmen ist mir keine einzige Klezmeraufnahme, die von einer deutschen Gruppe vor der Nazizeit eingespielt worden wäre, bekannt. Vielleicht gibt es keinen einzigen Ort auf der Welt, wo heute so viele Klezmergruppen spielen, wie in Berlin. Ich denke, es ist reine Geldmacherei, man reitet auf einer Welle. Durch ABM Stellen arbeite ich sehr lange schon im Museumswesen. Ich liebe die Musik und ich fand immer, dass in Ausstellungen zu wenig davon geboten wird. Wenn man etwas zeigt, was alt ist, aber tot, ist es da, man schaut es sich an, und geht zum nächsten Objekt. So etwas muß es natürlich geben. Aber wenn man auf einer Platte eine Stimme hört, die 70 oder 90 Jahre alt ist, und aus der Vergangenheit zu einem spricht, ist das eine andere Qualität. Musik ist etwas Besonderes, ganz anders, als alles andere in der Kultur. Gemälde sieht man, ein Buch sieht man, aber Musik schwirrt in der Luft herum und kommt zu einem, kommt ins Ohr und ins Gehirn. Das Sammeln von Schallplatten bedeutet für mich Kulturgeschichte sammeln. Die Änderungen, Entwicklungen, manchmal auch Rückentwicklungen in der Geschichte interessieren mich sehr, auch, wie sich der Mensch benimmt. Heute denke ich weniger gut über die Menschen als früher. Ich habe sehr bittere Erfahrungen gemacht. Es ist so schwer herauszufinden, ob jemand ehrlich ist. Früher vertraute ich den Worten, dann merkte ich oft nach Jahren, dass sich Menschen plötzlich ganz anders verhalten, dass sie anders sind als das, wofür sie sich ausgeben. Ich habe CDs produziert: eine CD habe ich über die Musik in Neukölln gemacht. Jedes Musikstück hat mit Neukölln zu tun. Dann stellte ich eine CD von den Platten meiner eigenen Sammlung zusammen, mit jüdischer liturgischer Musik aus Berliner Synagogen von 1909 bis 1937. Was ich damit verdiene, geht voll an den Wiederaufbau der Synagoge in Staudernheim. Ich hielt es auch für spannend, wie die Deutschen die Türken in der Musik wahrnehmen, was sie über die Türken singen - daraus habe ich auch eine CD produziert. Im Jüdischen Museum sagte ich von vornherein, ich möchte nicht das Zeitalter der Naziherrschaft bearbeiten, denn ich habe schon genug darüber gemacht und es ist belastend. Früher hatte ich an einem kirchlichen Institut evangelischen Religionslehrern jüdische Geschichte unterrichtet, besonders zum Thema Antisemitismus. Da ich die Musik so liebe, ist das auch ein Ausgleich für mich. Wie Menschen sich nur mit dem Thema des Holocaust, des Dritten Reiches beschäftigen können, verstehe ich nicht. Ich könnte es nicht aushalten. Auch wenn es manchmal nicht danach aussieht, hat sich in der Beziehung von jüdischen und nichtjüdischen Deutschen meines Erachtens vieles zum Besseren gewendet, seitdem ich in Deutschland wohne. Das bringt die Zeit mit sich. Unter Juden gibt es Selbstverständlichkeiten, Dinge, die man nicht erklären muß. Wenn ich im Museum Führungen zur jüdischen Geschichte gab, und die Besucher Juden waren, musste ich nur die Hälfte dessen erklären, was ich sonst zu erklären hatte. Manchmal sind die Fragen, die von Nichtjuden kommen verblüffend, aber ich habe nichts dagegen, wenn sie die stellen. Ich bin froh, wenn die Menschen neugierig sind. Auch in diesen Führungen musste ich erleben, dass Nichtjuden manchmal mehr Interesse haben als Juden, was eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich ist. A. S. „Natürlich muss man gerade in Deutschland den Holocaust in die Betrachtung der gesellschaftlichen Entwicklung miteinbeziehen, aber Politik sollte damit nicht getrieben werden” A. S. kam zum erstenmal im Alter von sechseinhalb Jahren nach Deutschland, kehrte aber acht Jahre später mit ihren Eltern wieder nach Israel zurück. Dort fühlte sie sich eingeengt, nicht angenommen und konnte sich mit dem Gedanken nicht identifizieren, für das Land Israel zu leben und zu kämpfen. 1972 reiste sie wieder nach Europa und blieb dann in Deutschland um zu studieren. Sie sei dreigeteilt, sagt die 47jährige, Deutsche, Jüdin und Israeli und diese Mischung würde ihr gut tun. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit als Psychotherapeutin ist die Beschäftigung mit Überlebenden des Holocaust und ihren Kindern und Enkelkindern. Oft kommen Patienten mit „alltäglichen” neurotischen Problemen, jedoch stellt es sich heraus, dass sie die Last der zweiten und dritten Generation in sich tragen. Seit ich mich erinnern kann, wollte mein Vater immer lernen. Da er 1939 aus Deutschland fliehen musste, hatte er keine Ausbildung, später kämpfte er jahrelang als britischer Soldat der Jüdischen Brigade gegen die Deutschen, und in Israel hatte er keine Möglichkeit zu lernen. Er wollte nicht sein Leben lang als Hilfsarbeiter oder Taxifahrer sein Geld verdienen, so beschloss er 1960 mit der Familie nach Deutschland zu gehen, um dort zu studieren. Die Sprache konnte er, ihm wurde die deutsche Staatsangehörigkeit zugesprochen und er bekam „Wiedergutmachung”. Meiner Schwester und mir sagte er, die Shoah dürften wir nicht vergessen, nicht verzeihen, aber das ist ein neues, demokratisches Deutschland, und man muss diesem Land auch die Chance des Neuanfangs zuerkennen. Mein Vater ist vorausgegangen nach Krefeld, wo er noch Leute aus der Zeit kannte, als er sich dort als britischer Soldat aufhielt. Wir, mit meiner Mutter und meiner Schwester, folgten ihm ein paar Monate später. In Krefeld begann mein Vater, an der Abendschule Maschinenkonstrukteur zu lernen und tagsüber verdiente er sein Einkommen. Deutsch konnten wir Kinder nicht, so kamen wir in eine Waldorf-Schule. Meine Schwester besuchte später eine Berufsschule für Graphik, machte dann eine Lehre in Photographie weiter und ging 1967 nach Israel zurück, um den Militärdienst zu machen. Es galt bei uns immer als selbstverständlich, dass die ganze Familie nach Israel zurückkehrt. Obwohl sich meine Eltern in Deutschland einen großen Freundeskreis aufgebaut haben, war es klar, dass Israel ihre Heimat ist und sie dort hingehörten. In Deutschland war es mir bewusst, dass ich Jüdin bin und ich war auch stolz darauf. Wir haben Chanukka gefeiert und dazu viele Freunde - Deutsche und Ausländer - eingeladen. Meine Eltern legten großen Wert darauf, Teil einer multikulturelle Gruppierung zu sein und die Gewohnheiten, Denkweisen anderer kennen zu lernen. Toleranz galt für meinen Vater als das oberste Gebot und diesen Gedanken gab er auch mir auf den Weg mit. Er hatte auch viele deutsche Freunde, die zum Teil während des Krieges in der Wehrmacht kämpften, aber sich mit ihrer Geschichte auseinandersetzten. Nicht Philosemitismus, sondern richtiges Verständnis war es, glaube ich, was sie verband. Aber in Israel hatten die Eltern ja auch Freunde, die auf sie warteten. Meinen Vater befragte ich im Verlauf meiner Familientherapie-Ausbildung darüber, was mit seinen Eltern und Geschwistern während der Shoah geschehen ist. Zur Zeit eines Besuches der Eltern in Deutschland fuhren wir zusammen nach Bonn; ich wollte die Umgebung sehen, wo mein Vater vor dem Krieg lebte. Vor allem wollte ich Erzählungen und Geschichten über unsere Familie hören. Als ich mich jedoch seinen Emotionen näherte, ist er ausgewichen. An dieser Stelle schien eine Lücke zwischen uns zu sein. Durch mein Psychologiestudium und die Ausbildung zur Familientherapie verstand ich, dass es Dinge gibt, die er nicht erzählen will, die ihm gehören, seine Geschichte bilden. Er wollte oder konnte nicht in die Tiefe greifen, da es ihn schmerzte. Obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, dass seine Geschichte auch meine ist, begriff ich, da gehöre ich vielleicht nicht hinein. Erst nach seinem Tod fing ich an, die Einzelheiten zu suchen, über die ich von ihm nichts erfahren habe. Diese Suche ist noch nicht abgeschlossen, ich weiß zum Beispiel immer noch nicht, wann und wohin die Eltern meines Vaters deportiert wurden und wo sie umgekommen sind. Vorerst bleiben die Vermutungen. Die Eltern meines Vaters kommen aus Warschau. Der Großvater war Schreiner, die Großmutter hatte die 4 Kinder erzogen - 2 Mädchen und 2 Jungen, eine sehr religiöse Familie. Mein Vater wurde 1920 bereits in Deutschland geboren. Damals hat eine umfangreiche Emigration stattgefunden, viele polnische Handwerker wurden nach Deutschland, ins Rheinland geholt. Meine Großeltern gingen nach Bonn. Mein Vater war bei „Hashomer Hazair”, einer jüdischen Jugendorganisation, bei der die Jugendlichen für die Emigration nach Palästina vorbereitet wurden. Man hat ihnen unter anderem landwirtschaftliche Kenntnisse vermittelt. 1936 sind die beiden Schwestern meines Vaters nach Palästina ausgewandert. Nach der Pogromnacht im November 1938 wurde sein Vater verhaftet, kam aber frei, und ging nach Bonn zurück. Kurze Zeit später war er wieder verhaftet worden, diesmal ist er aber verschwunden. Wahrscheinlich wurde er deportiert. Als im Frühjahr 1939 mein Vater sich bei der SS melden sollte, haben ihm seine Freunde geholfen, das Land sofort zu verlassen. Seine Mutter ließ es nicht zu, den jüngeren Bruder nach Palästina mitzunehmen. Er war 17 und die Mutter meinte, noch viel zu jung. Die Mutter wollte nicht mitfahren, da sie auf den Vater hoffte, und auf ihn wartete; die Familie hatte ja keine Nachricht von ihm. Sie hatte vor, mit ihrem Mann und dem 17jährigen Sohn nachzukommen. Mein Vater erreichte über Rotterdam und dann, wie er erzählte, in einem „Nussschalenschiffchen”, über Gibraltar illegal Palästina. Er kam dort am 12. August 1939 an, dieses Datum bezeichnete er immer als seinen „zweiten Geburtstag”. Für die Mutter und den Bruder war es aber zu spät, er konnte sie nicht mehr aus Deutschland herausholen. Es ist unklar, wo sie hingekommen sind. Aus Bonn habe ich die Listen besorgt über die letzten Juden, die von dort deportiert worden sind, aber sie waren nicht darauf. Mein Vater nahm an, dass sie ins Warschauer Ghetto kamen und von da aus deportiert und umgebracht wurden. Ich versuche es, herauszufinden. Mein Vater ist 1993 gestorben, bis dahin respektierte ich seinen Willen, dass er es im Einzelnen nicht wissen wollte. Die Eltern meiner Mutter stammen aus Breslau (Wroclaw). Sie waren Zionisten und sind 1924 nach Palästina emigriert, um das Land aufzubauen. Zuvor lebte die Familie noch in Berlin, die ältere Schwester meiner Mutter wurde 1920 dort geboren. Meine Mutter kam 1924 bereits in Palästina zur Welt. Dann trennten sich ihre Eltern, der Vater ging nach Berlin zurück, und versuchte in einer Gruppe, möglichst viele Menschen von der zionistischen Idee zu überzeugen. Von 1933 an ist er zwischen Berlin und Palästina hin- und hergependelt, und bemühte sich Verfolgte herauszuholen. Als es dann nicht mehr ging, blieb er in Palästina. Die Mutter hat ein zweites Mal geheiratet und noch eine Tochter bekommen. Sie war aber eine Bohemienfrau, die sich damit schwer tat, um die Kinder zu kümmern, zu sehr war sie mit ihren eigenen Sachen beschäftigt. Schon in Berlin lebte sie in Künstlerkreisen und in Palästina fand sie keine Zeit für die Kinder. Die große Tochter wurde bei Pflegeeltern untergebracht, zum Teil beim Vater, der erneut geheiratet hat. Meine Mutter wurde von ihrem 7. Lebensjahr an bis zu der Zeit, als sie zum englischen Militär ging, in verschiedenen Heimen und bei Pflegeeltern erzogen. Sie hatte ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter, sie fühlte sich ja immer ungeliebt. Eigentlich war ihre Mutter eine recht warme, lebendige, spannende Frau, sie erwies sich einfach nicht reif genug, um Kinder großzuziehen. Sie kannte auch in Palästina - später Israel - viele aus dem Künstlerbereich. Mit dem zweiten Mann baute sie eine Keramikwerkstatt auf, später verdienten sie mit Raffiamatten ihr Geld. 1939, als mein Vater nach Palästina kam, arbeitete erst einmal in einem Kibbuz. Meine Eltern lernten sich in der Jüdischen Brigade des englischen Militärs kennen. Der Vater kämpfte ab 1943 als britischer Soldat in Italien. Nach Kriegsende ist er nach Bonn gefahren und hat seine Eltern gesucht, aber keine Spur von ihnen gefunden. So kam er nach Palästina zurück und heiratete 1946 meine Mutter. Meine Schwester ist 1947 geboren, ich 1953. Wir lebten in Tiv’on in der Nähe von Haifa. Als wir nach dem achtjährigen Aufenthalt in Deutschland 1968 nach Israel zurückgingen, wurde ich mit vierzehneinhalb Jahren aus meiner Umgebung wieder herausgerissen. Ich konnte Hebräisch nur sprechen - das war unsere Familiensprache -, das Lesen und Schreiben brachte mir meine Mutter bei, als wir nach Israel zurückkehrten. In die Schule habe ich mich überhaupt nicht integriert. Der Stoff war sehr schwer für mich. Die Eltern nahmen mich aus dieser Schule wieder heraus und schrieben mich in eine Berufsfachschule, eine Graphikschule ein. Ich malte sehr gern, das ist bis heute erhalten geblieben. Die Graphikgrundausbildung brach ich aber ab und kam in eine Drogenszene. Heute kann ich es damit erklären, dass ich mich nicht zurechtfand, keine wirkliche Orientierung hatte. Durch die Umzüge der Familie von einem Land ins andere hat man mich zweimal, in den entscheidenden Phasen eines Kindes, im Alter von 6 bzw. 14 Jahren aus meiner Sozialisation herausgerissen. Meine Eltern wussten natürlich nicht, welche Folgen das haben würde, ich weiß es heute aufgrund meines Studiums. Aus einer deutsch-israelischen Gemeinschaft kam ich nach Israel, wo es selbstverständlich war, dass man für dieses Land lebt. Das geschah noch dazu kurz nach dem Sechstagekrieg. Aber ich konnte mir diese starke Identifizierung nicht aneignen; ich fand zwar neue Freunde, aber sie hatten eine andere Geschichte, die ich nicht direkt erlebte, sondern nur vermittelt bekam. 1970 ging ich nach Tel Aviv und zog mit der israelischen Gruppe Hair von Konzert zu Konzert. Ich nahm Drogen aller Art, doch gespritzt habe ich nicht. Um Geld zu haben, jobbte ich immer wieder, mal in einem Sandwichklub, mal bei einem Anwalt, wo ich Botengänge machte. Natürlich erzählte ich meinen Eltern nicht, was ich machte, aber sie hatten riesengroße Angst um mich. Als studierte Psychologin empfinde ich es im nachhinein besonders klug, wie sie reagierten: sie sagten, die Tür unseres Hauses steht dir immer offen. Diese Ausschweifung hat bei mir mehr als ein Jahr gedauert. Genau weiß ich es nicht, wieso ich damit aufhörte. Nach einem Jahr kam ich zurück. Die Bitte meiner Mutter, nach Hause zurück zu kommen, gab nur den letzten Anstoß zu meinem Entschluss. Die richtige Ursache mag darin gelegen haben, dass ich mich eigentlich nicht der Drogenszene zugehörig fühlte. In Haifa arbeitete ich dann in einem Graphikbüro als Reinzeichnerin, aber ich wünschte mir, zurück, nach Europa zu gehen. Zwar habe ich auch israelische Kultur aufgesogen, aber dort leben wollte ich nicht, weil ich mich eingeengt und nicht angenommen fühlte. Noch in Tel Aviv hatte ich einen Motorradunfall und ich bekam Schmerzensgeld von der Versicherung, von dem ich mir ein Flugticket kaufte. In Europa wollte ich Graphik studieren. In der Schweiz hatten wir einen Freund der Familie, der eigentlich beabsichtigte, sich in Israel niederzulassen und in einem Kibbuz arbeitete. Danach ging er aber in die Schweiz zurück. Er verliebte sich in mich; heute weiß ich nicht mehr genau, was ich für ihn empfunden habe, vielleicht sah ich in dieser Beziehung nur die Möglichkeit, aus Israel rauszukommen. Meine Eltern und Freunde dachten, ich würde mich in Europa austoben und dann nach Israel zurückkehren. Ich lehnte es ab, zur israelischen Armee zu gehen, ich erzählte den Ärzten - die unter Schweigepflicht standen -, ich nehme Drogen und könnte nur Militärdienst leisten, wenn sie mir diese Aufpuschmittel gäben. Dies stimmte zwar damals nicht mehr, ich wollte aber auf keinen Fall zum Militär. Im September 1972 fuhr ich zu diesem Freund in die Schweiz. Dort blieb ich nicht lange, da dieser Freund mich nach zwei Wochen heiraten wollte und das für mich überhaupt nicht in Frage kam. Erst wollte ich das glitzernde Europa erleben. Aus der Schweiz bin ich nach Krefeld gefahren, wo ich noch Freundinnen hatte. Mit einer großen Mappe von Arbeiten ging ich an die dortige Fachhochschule für Design und man nahm mich an. Von der Graphik bin ich in die Photographie übergewechselt und schloss diese Ausbildung nach 4 Jahren ab. Meine Selbstständigkeit war und ist immer noch sehr wichtig für mich. Ich wollte für mich sorgen und selbst entscheiden, was ich tue. Wahrscheinlich hatte das deshalb eine so große Bedeutung für mich, weil bis dahin so viel über mich bestimmt wurde. Als zum Beispiel mein Vater mich 1973 besuchte und mir sagte, ich müsste wissen, dass sie sich freuen würden, wenn ich einen Israeli oder zumindest einen Juden heiraten würde, war ich ziemlich schroff. „Eher würde ich den Kontakt zu ihnen (meinen Eltern) aufgeben, als den zu einem Mann, mit dem ich zusammen sein wolle, sei er ein Palästinenser, ein Iraner, Mexikaner oder Deutscher”, meinte ich. Diese Aussprache störte die Beziehung zu meinen Eltern nicht, sie besuchten mich regelmäßig und einmal im Jahr fuhr ich auch nach Israel. Nach meinem Abschluss habe ich Photoausstellungen gehabt, wusste aber, dass ich die kommerzielle Photographie nicht betreiben wollte. Ich photographierte unscheinbare Objekte, wie zum Beispiel eine Türklinke oder den Ausschnitt einer abgerissenen Plakatwand. Natürlich war es mir klar, dass ich von dieser Art Photographie nicht leben kann. Auf den Wunsch, Psychologie zu studieren, kam ich deshalb, weil ich mit Kinderzeichnungen arbeiten wollte. Mich hat es interessiert, den Hintergrund der Zeichnungen zu verstehen. Mein großes Ziel war, zu beweisen, dass ich es schaffe, angenommen zu werden. Es galt nämlich als sehr schwer, in Psychologie einen Studienplatz zu bekommen und alle belächelten mich, als ich von meinen Plänen erzählte. Zuerst wurde ich abgewiesen, habe aber dann in Braunschweig, später in Bochum einen Platz erworben. Dort war ich von 1977-80, in der Folge ging ich nach Berlin, um das Studium fortzusetzen, da ich die Ausbildung in Bochum viel zu theoretisch fand. In Berlin war das Studium stärker praxisorientiert. Neben einem Darlehensstipendium finanzierte ich mich selbst, in dem ich als Einzelfallhelferin arbeitete, Familien oder einzelne psychisch kranke Personen betreute. 1983 beendete ich mit das Studium und arbeitete danach als Psychologin und machte parallel dazu die Ausbildung in Familientherapie. Für psychisch Kranke richtete ich eine Tagesstätte ein. Später sprach mich die Jüdische Gemeinde an, ob ich bei ihnen als Psychologin arbeiten will. 1990 begann ich dort meine Arbeit, die Therapie mit Überlebenden des Holocaust aufzubauen. Ich spezialisierte mich in Psychotherapien mit der zweiten und dritten Generation. Obwohl meine Arbeit geschätzt wurde, habe ich mich mit dem Vorstand der Jüdischen Gemeinde zerstritten, verließ die Gemeinde Ende 1994 und eröffnete meine eigene Praxis. Meine Tochter wurde 1985 geboren und ich wurde alleinerziehende Mutter. Der Vater von ihr war seit längerer Zeit mit einer Frau zusammen und wollte sich nicht von ihr trennen, so beschloss ich, das Kind zu behalten. Es war kein Zufall, denke ich, dass ich mir einen Mann „aussuchte”, bei dem ich eigentlich wusste, dass wir kein herkömmliches Familienleben leben werden. Aber ich habe ihn geliebt, und meine Tochter sieht ihn regelmäßig. Als Muttersprache brachte ich ihr Deutsch bei. Leider konnte ich mit ihr nicht Hebräisch reden, da eine Person ein Kind nicht zweisprachig heranziehen kann. Irritationen wären sonst unvermeidlich. Heute sie versteht Hebräisch und fährt einmal im Jahr nach Israel. Erst 1988, zum 50. Jahrestag der Pogromnacht bin ich in die Jüdische Gemeinde eingetreten. Der Entschluss hängt mit Erich Fried, dem Dichter zusammen. Ich habe sehr viel mit ihm gesprochen, schon während ich meine Diplomarbeit schrieb. In der Arbeit versuchte ich, auf die Zusammenhänge zwischen der Situation von Juden, die von 1933 bis 1939 aus Deutschland emigriert sind, und der Fluchtsituation der Palästinenser in Israel hinzuweisen, die kein eigenes Land haben, aber es sich wünschen. Was ich wissen wollte, war, in wieweit die jüdischen Menschen die Lage der Palästinenser nachvollziehen können. Dieses Thema habe ich mir gewählt, weil ich eigentlich nur in Deutschland die Situation der Palästinenser kennen- und verstehen lernte. In Israel sprach man von ihnen nur als „Terroristen”, den Begriff „Palästinenser” gab es damals noch nicht. Mit meinem Vater hatte ich deshalb heftige Diskussionen, er redete auch nur von Terroristen und änderte erst später, während des Libanonkrieges von 1982 seine Meinung. Er nahm auch an den Demonstrationen gegen den Libanonfeldzug und die Massaker in Sabra und Shatila teil. Damals war es noch sehr selten, dass ein Jude, wie mein Freund Fried sich mit Israel kritisch auseinandersetzte. Durch ihn bin ich in diese Thematik mehr und mehr hinein gedrungen. Wir sprachen viel über jüdische Identifikation und auch darüber, was ich meiner Tochter vermitteln würde. Ich wollte sie mit dem Bewusstsein großziehen, Jüdin zu sein - nicht religiös, sondern traditionell. Als ich noch studierte, hielt ich die Traditionen überhaupt nicht. Einige Male bin ich zwar zu Pessach zu meinen Eltern gefahren, aber bei mir zu Hause beging ich die Feier nicht. Doch der 9. November und der 19. April - der Tag des Warschauer Ghettoaufstandes - waren und sind nach wie vor wichtig für mich. An diesen Tagen gehe ich nicht auf Feste, sondern nehme sie mir als meine „persönlichen Gedenktage”. Es war mir also klar, dass ich meiner Tochter ein jüdisches Bewusstsein vermitteln wollte. Ich feierte mit ihr Chanukka. In ihrem Kinderladen wurde Weihnachten, aber auch andere nicht christliche Feiertage gefeiert, so auch Chanukka. Zu Hause beschenkte ich sie 8 Tage lang mit kleinen Geschenken. Meine Tochter besuchte in Berlin die jüdische Grundschule. Zuvor überlegte ich mir, in welchem Land sie zur Schule gehen soll. Sie sollte ihre Schulzeit dort beenden können, wo sie sie beginnt. Es gab Überlegungen, nach Israel zu gehen. Ich beschloss aber, in Berlin zu bleiben, zum Teil wegen meiner Arbeit, zum anderen sollte sie Kontakt zu ihrem Vater aufrechterhalten können. Zu dem Zeitpunkt, als ich mir überlegte nach Israel zu gehen, habe ich auch über die Werte nachgedacht, die dort vermittelt werden. Den übertrieben Nationalismus wollte ich mir nicht zu eigen machen und meine Tochter sollte nicht in der damaligen politischen Situation groß werden. Die Tatsache, dass ich nicht nach Israel zurückkehren und dort leben wollte, verkraftete mein Vater, der Zionist, der Israel mit aufbaute sehr schwer. Er verzichtete auf vieles, damit es der nächsten Generation besser ginge, und war enttäuscht, dass ich Israel nicht als mein Land, in dem ich leben wollte, verstand. Seitdem Rabin sich für den Frieden einsetzte, und Verhandlungen mit den Palästinensern einging, haben sich einige meiner Ansichten geändert. Die Vorstellung dort alt zu werden, liegt mir nicht fern. Ich verfolge die Entwicklungen in Israel. Heute bauen sie wieder neue jüdische Siedlungen und die Verhandlungen mit Syrien sind wieder gestoppt. Ich kann mir den Luxus erlauben, die Dinge von weitem anzuschauen. Wie es in 10-15-20 Jahren aussehen wird, weiß ich nicht, und wie ich mich dann entscheide, lasse ich offen. Als Alternative zu einer Schule in Israel entschied ich für meine Tochter die jüdische Grundschule. Trotz meiner Vorbehalte hielt ich es für richtig, dass meine Tochter dort das jüdische Grundwissen erlangt, das ich ihr als Alleinerziehende in einer deutschen Umgebung nicht hätte geben können. In traditioneller Art zünden wir am Freitagabend die Kerzen an. Als religiös verstehe ich mich nicht, sondern versuche, meiner Tochter das Wissen über die jüdische Kultur weiterzugeben. Es ist mir wichtig, dass sie auch die Geschichte der Juden hier in Deutschland kennt, die Periode der Emanzipation und die Zeit des Nationalsozialismus, als den Illusionen ein jähes Ende gesetzt worden sind. Nur jüdische Therapeuten können meiner Meinung nach mit Überlebenden des Holocaust und ihren Kindern und Enkelkindern arbeiten. Damals, als ich mit dieser Arbeit begann, galt das als etwas Neues und Unverständliches. In der Jüdischen Gemeinde gab es sehr viele Überlebende, die noch nie über ihre Geschichte gesprochen hatten. Man wusste sehr wenig über diese Menschen. Ich habe mich dafür entschieden, weil das auch meine Geschichte ist. Bei Angehörigen der ersten Generation bot ich an, mit ihnen zu sprechen, wenn sie darüber reden möchten, was ihnen widerfahren ist. Die Erfahrungen, die diese Generation hatte, kann man, denke ich, nicht therapieren. Wenn solche Erinnerungen wach wurden, war es mir nur möglich, diese Leute zu begleiten. Wir konnten darüber reden, wie sie damit heute leben können. Diese Menschen sind nicht krank, sondern traumatisiert. Man kann nicht Therapie machen für etwas, was vor 50 Jahren stattfand. Wenn die Alpträume wiederkommen, kann ich versuchen, das Leid zu lindern, aber die Alpträume selbst kann ich nicht verhindern. Als die Neonazis 1992 Asylheime anzündeten, wurden einige meiner Patienten der ersten Generation, die bei mir im Gespräch waren, von neuem traumatisiert. Diese aktuelle Situation konnte bearbeitet werden. Eine dunkelhaarige Patientin erschien zum Beispiel eines Tages blondgefärbt mit der Befürchtung, man würde sie sonst als Jüdin erkennen. Bei vielen Leuten der ersten Generation schien lange Zeit alles „in Ordnung” zu sein. Sie konnten eine Familie aufbauen, haben einen Beruf erlernt, in ihrem Leben „funktionierte” alles. Erst als sie aus dem Berufsleben ausschieden, oder der Partner verstarb, oder die Kinder aus dem Hause gingen, als sie eine neue Trauer, einen neuen Verlust erfahren mussten, kam die Vergangenheit wieder auf. Natürlich trägt die zweite Generation auch viel von der Last der Eltern mit sich, obwohl sie das Grauen nicht selber erlebt hatte. Meistens sagen die Menschen, die mich aufsuchen sie haben Schwierigkeiten mit den Eltern oder mit ihrem Freund - sie kommen also mit Problemen, mit denen man „normalerweise” zum Therapeuten geht. Erst später, während der Gespräche stellt es sich heraus, dass ihre psychischen Störungen mit der zweiten GenerationProblematik zusammenhängen. Wie die zweite Generation die Traumata der Eltern erlebte, ist sehr verschieden. Wenn die Kinder die Eltern trösten und beruhigen mussten, ist das eine ganz andere Erfahrung, als wenn ihnen die Eltern nichts erzählt hatten, die Kinder aber trotzdem spürten, da muss was Schreckliches passiert sein. Es gibt viele, die von ihren Eltern gar nichts vernahmen, aber auch welche, die sagen: „Ich kann es nicht mehr hören.” In Deutschland hat es aus der Geschichte heraus schon eine Besonderheit, mit jüdischem Bewusstsein hier zu leben. Es gibt Situationen, wo ich es klar artikuliere, dass ich Jüdin bin. Neulich war ich auf einem Kongress, der die Probleme der zweiten und dritten Generation zum Thema hatte und zu den geladenen Gästen gehörten sowohl jüdische als auch nichtjüdische Leute. Dort sagte ich, als Jüdin sehe ich es folgendermaßen... Ich verdecke es nicht, dass ich Jüdin bin. Wenn man mich fragt, woher mein Vorname kommt, sage ich, es ist ein israelischer Name. Aber ich würde mich hüten, meiner Herkunft wegen eine besondere Behandlungsweise zu beanspruchen. Dass man in der Jüdischen Gemeinde immer moralisch argumentiert, kann ich zum Beispiel nicht befürworten. Wenn die Leute dort nicht weiterwissen, berufen sie sich auf die Shoah. Natürlich muss man gerade in Deutschland den Holocaust in die Betrachtung der gesellschaftlichen Entwicklung miteinbeziehen, aber Politik sollte damit nicht getrieben werden. Bei Freunden ist es mir überhaupt nicht wichtig, ob sie Juden sind oder nicht. Ich habe sogar mehr nichtjüdische, als jüdische Freunde. Der Vater meiner Tochter ist nichtjüdisch, genauso, wie mein Mann, von dem ich seit kurzem getrennt lebe. Ich habe ihn 1989 kennen gelernt und wir haben 1993 geheiratet. Im nachhinein meine ich, unsere Ehe hat sehr darunter gelitten, dass uns auch die Geschichte auseinanderriss. Sein Vater war während des Krieges Soldat, er war auch ein Nazi. Mehrmals erklärte er, mit der bekannten Begründung, warum damals die Bevölkerung so reagiert hatte: „Wir konnten uns nicht wehren, wir haben nur gemacht, was uns gesagt wurde”. Es hätte mir ausgereicht, wenn er sein Handeln von damals heute als einen großen Fehler beschrieben hätte. Aber so etwas sagte er nie und das habe ich ihm nicht verziehen. Immer wieder fragte ich ihn, wie er das heute sieht, aber er ist ausgewichen. Mein Mann hat zwar die Einstellung seines Vaters abgelehnt, aber von seinem autoritären Vater wurde ihm anerzogen, nie auf seine eigenen Gefühle, sondern auf die Vorgaben zu achten. Als Kind hatte er den Mund zu halten und auszuführen, was ihm gesagt wurde. Dadurch entwickelte sich eine bedrückende Pedanterie bei ihm, Spontaneität war ihm absolut fremd und das hat unser Zusammenleben schwierig gemacht. Für mich war ein Familien-Motto, mich nicht kritiklos zu fügen, sondern eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen, wenn nötig, auch im Widerstand zu anderen Haltungen. Ein ganz entscheidender Grund für das Scheitern meiner Ehe war, glaube ich, dass wir sehr verschiedene Lebensgeschichten als zweite Generation-Problematik haben. Bei uns in der Familie gab es die Möglichkeit des Widerstandes. Mein Vater ließ zu, dass ich ihn kritisierte; wenn ich meinte, dass er einen Fehler gemacht hat, konnte ich ihn davon überzeugen. Bei meinem Mann durfte nicht widersprochen werden. Dadurch, dass ich schon so lange in Deutschland bin und mehrere Identitäten habe, fällt es mir schwer, mich zu definieren. Vielleicht kommt es der Wahrheit am nächsten, wenn ich sage: ich bin eine in Israel geborene, und in Berlin lebende Frau. Mein Jüdischsein ist verbunden mit Tradition und Kultur, mein Israelischsein mit Spontaneität, Lebendigkeit und Kraft und mein Deutschsein mit Verlässlichkeit, Sicherheit und Ordnungsliebe. Ich bin froh, dass ich beide Staatsangehörigkeiten habe, die israelische und die deutsche. Diese Vermischung von beiden, sowohl Israeli als auch Deutsche zu sein, tut mir sehr gut. Sowohl die leichte, spontane Art der Israelis, als auch die ordnungsliebende, zurückhaltende Art der Deutschen lebe ich. Wenn ich in Deutschland bin, fehlt mir die Spontaneität und Leichtigkeit, in Israel die Verlässlichkeit. Ich fühle mich in Deutschland, oder besser gesagt in Berlin sehr wohl, aber nicht ohne Bedenken. Mich hat es sehr betroffen, als ich feststellen musste, wie oft es in Deutschland an Sensibilität mangelt. Sommersemester wird zum Beispiel weiterhin mit „SS” abgekürzt. Bei den grossen Demonstrationen der 70-er Jahren, wo es um die Erleichterung der Haftbedingungen für RAFLeute ging, schrieben sich viele Teilnehmer die Telefonnummern der Anwälte auf die Innenfläche ihres Unterarms. Es berührte mich nicht nur deshalb so unangenehm, weil ich Jüdin bin, sondern es erschreckte mich, dass diese Menschen, die sich als sehr links und fortschrittlich betrachteten, sich mit ihrer Geschichte in diesen Punkten anscheinend nicht auseinander gesetzt haben. Die Politik brachte schon ausführlich zum Ausdruck, dass es Deutschland „leid tut”, was damals passiert ist, aber es geht um den Einzelnen. Es gibt viele, die noch nicht gewillt sind, die Verantwortung anzuerkennen und nicht hinter den offiziellen Stellungnahmen stehen. Gerade weil es auch unter den Jüngeren viele gibt, die die Verantwortung nicht übernehmen wollen, ist es wichtig, das Geschehene zu thematisieren. Wenn Juden weiterhin hier leben, meine ich, ist das eine Garantie dafür, dass über die Vergangenheit und ihre Lehren auch immer wieder gesprochen wird. Meiner Meinung nach ist es möglich, als Jude in Deutschland zu leben, aber ich denke auch, dass das Bewusstsein der Deutschen etwas mehr Impulse bekommen müsste. Das können wir Juden aber nicht forcieren. Von Integration möchte ich nicht sprechen, denn das Wort beinhaltet, dass wir ausgeschlossen sind, sonst müsste man nicht integriert werden. Ich fühle mich als Teil dieser Gesellschaft und übernehme auch einen Teil der gesellschaftlichen Verantwortung. Die Juden werden aber zur Zeit nicht als Teil der Gesellschaft betrachtet, weil hier immer noch keine Bearbeitung stattgefunden hat. Trotz der 55 Jahre, die seit Kriegsende vergangen sind, heißt es immer noch „die Juden” und „die Deutschen”. Es gibt zwar deutsche Juden, trotzdem werden sie nicht so benannt. Für uns gilt es aber genauso, dass diese Distanz nicht ewig aufrechterhalten werden kann. Solange wir uns weiterhin als Außenstehende begreifen, werden wir nie ein Teil dieses Landes, obwohl es in meiner Sicht wichtig wäre, denn wir leben hier, zahlen unsere Steuern hier, beteiligen uns am hiesigen kulturellen Leben. Sollten wir ausgeschlossen werden, was von einigen praktiziert wird, gilt es, unsere Partner, die fortschrittlichen Menschen zu mobilisieren. Assimilierung darf aber nicht unser Ziel sein, denn dies würde bedeuten, dass wir unser Judentum nicht mehr zum Vorschein bringen. Wir können als Juden in Deutschland leben, meine ich, so wie es in Deutschland auch Italiener, Bosnier oder Türken gibt. Mein Ideal ist ein multikulturelles Deutschland. Dazu gehören auch deutsche Roma, deutsche Juden und Türken, die hier geboren sind. Es sollte nicht nur toleriert, sondern auch respektiert werden, dass es unterschiedliche Kulturen gibt und es sollte der Versuch unternommen werden, diese Kulturen gemeinsam zu leben. A. B. „Deutschland hat die demokratischen Institutionen fest verankert, trotzdem gibt es destabilisierende Elemente, die mich beunruhigen” A. B. ist in Amerika aufgewachsen, aber schaut mit europäischen Augen auf die Welt. Die europäische Sensibilität hat er von seinen Eltern, die aus der Slowakei stammen. Auch für ihn ist es nicht leicht, ein Kind von Holocaust-Überlebenden zu sein, die das psychologische Trauma in sich tragen. Ich brauche viel Kraft, um ein glücklicher Mensch und ein guter Vater zu sein, meint der 45jährige, der mit einer deutschen Ärztin verheiratet ist und seit 11 Jahren in Berlin lebt. Er schätzt viele Seiten der hiesigen Lebensweise, doch will er in etwa 15 Jahren mit seiner Familie in seine Heimat zurückzukehren. Man kann einen Menschen aus einem Land herausnehmen, aber nicht das Land aus einem, das sein Wesen bestimmt hat, sagt er. Da ich meiner Familie wegen mitteleuropäische Wurzeln habe, war es angenehm für mich, hier in Deutschland auf ein mitteleuropäisches Land zu treffen. Ich kam eigentlich hierher, um eine deutsch-jüdische Konferenz zu organisieren, aber der Fall der Mauer hat diese Idee mit sich gerissen. Trotzdem bin ich geblieben, weil sich andere interessante Herausforderungen boten und ich dann auch meine große Liebe kennenlernte. An diese Kultur konnte ich mich viel schneller gewöhnen, da meine Eltern ja aus der Slowakei stammen. Berlin ist eine multikulturelle Stadt und viele Menschen sprechen Englisch. Durch die einstige amerikanische Besetzung von einem Teil Berlins gibt es eine starke Beziehung zu den Vereinigten Staaten. Ich bin in einem Land aufgewachsen, das sehr stolz darauf war, die Welt vor dem Faschismus und später vor dem Kommunismus gerettet zu haben. Als Amerikaner kam ich also mit viel Selbstvertrauen nach Deutschland, anders, als die Ost-Europäer, die als Flüchtlinge oder Emigranten kommen und ihrer selbst unsicher sind. Richtigen Antisemitismus habe ich hier nie erlebt. Einmal ging ich mit einem orthodoxen Rabbiner ins Europa-Center, er trug Peies, und ältere Leute haben ihn ziemlich auffällig angestarrt. Aber das muss man nicht unbedingt als antijüdisch interpretieren. Der Rabbiner war wohl für diese Menschen ein verschrobener Mann und diesem Gefühl gaben sie freien Ausdruck. Es ist auch schon mal passiert, dass ich mit einer stereotypen Haltung konfrontiert wurde, die aber nicht gegen mich gerichtet war: das Haus, in dem ich lebte, gehörte einem jüdischen Besitzer. Einige Reparaturen wären längst fällig gewesen und ein Arbeiter machte einmal eine Bemerkung: „Diese jüdischen Leute wollen eben kein Geld ausgeben.” Das war aber alles, was ich in 11 Jahren in dieser Hinsicht in Berlin erfahren habe. Ich bin natürlich nicht naiv, ich weiß, dass es in anderen Teilen Deutschlands vielleicht nicht so harmlos aussehen würde. Nach dem Krieg gab es das Argument, wenn jüdische Menschen Deutschland ganz verlassen hätten, hätte Hitler gesiegt, weil es ihm gelungen wäre, alle Juden zu vertreiben und zu vernichten. Aber die Tatsache, dass sie hier blieben, ist der Beweis dafür, dass er sein Vorhaben nicht verwirklichen konnte. Selbstverständlich trage ich nicht auf einem Schild vor mich hin, dass ich Jude bin, aber wenn ich Menschen treffe, die noch nie mit einem Juden gesprochen haben, aber an dem Thema interessiert sind, freue ich mich, mich darüber äußern zu können. Der größte Teil der Familie meiner Mutter wurde während des Holocaust umgebracht. Meine Mutter wurde von der Gestapo in Budapest verhaftet und nach Ravensbrück und BergenBelsen gebracht. Sie verlor zwei Brüder und eine Schwester mit zwei kleinen Kindern. Ihr Vater hat zwar Auschwitz und Dachau überlebt, aber nachdem er durch die Amerikaner befreit wurde, ist er bei seiner Rückkehr nach seiner Heimatstadt Kosice im Zug gestorben und niemand weiß, wo er begraben ist. Er war ein sehr religiöser, orthodoxer Mensch, er hatte 10 Kinder - meine Mutter war die Jüngste. Sie ist 1930 geboren. Zwischen dem ältesten und dem jüngsten Kind bestand eine Altersdifferenz von 21 Jahren. Als die Deutschen 1944 das tschechoslowakische Kosice, das damals zu Ungarn gehörte, besetzt hatten, kaufte die Familie zwei Kindern - meiner Mutter und einer ihrer Schwestern falsche Papiere. Das konnte schon deshalb kein leichtes Unterfangen gewesen sein, weil die Familie ziemlich arm war. Mein Großvater verbrachte immer mehr Zeit mit dem Studium der Thora als mit Arbeit. Laut ihrer Papiere war meine Mutter 18 Jahre alt, in Wirklichkeit aber nur 14. Sie sah aber auch älter aus, als sie war, nicht nur nach ihrer Körpergröße, sondern auch der Statur nach. Beides halfen ihr, die Konzentrationslager zu überleben. Die Mutter und ihre Schwester wurden in Budapest vom Hausmeister verraten: er hat Verdacht geschöpft, dass sie sich hinter falschen Papieren versteckten. Als sie von der Gestapo geholt wurden, standen Hausbewohner auf den Gängen, und sie beschimpften und bewarfen die Mädchen. Die Deutschen dachten, dass sie jugoslawische Spione wären. Nachdem sie monatelang im Gefängnis gehalten wurden, schickte man sie zuerst nach Dortmund, wo sie als Zwangsarbeiterinnen bei der Herstellung von V 2 Raketen eingesetzt wurden, dann nach Ravensbrück und Bergen-Belsen. Eine andere Schwester meiner Mutter war mit einem erfolgreichen Geschäftsmann verheiratet. Sie hatten eine Tagesmutter für ihr Kind, die einen Wehrmacht-Offizier kennenlernte, und ihm erzählte, dass sie bei einer jüdischen Familie arbeitet. Die ganze Familie wurde nach Auschwitz deportiert und ermordet. Als meine Mutter befreit wurde, befand sie sich in einem sehr schlechten Zustand, sie hatte Typhus. Nachdem sie diese Krankheit überstanden hatte, wurde sie mit ihrer Schwester vom Roten Kreuz nach Schweden geschickt. Ihre Schwester, die 5 Jahre älter war, konnte sich nicht erholen, 6 Monate später ist sie gestorben. Meine Mutter blieb 2 Jahre lang in Schweden und lernte Krankenschwester. Sie wurde einem Krankenhaus zugeteilt, wo sie laute sehr kranke, sterbende Menschen um sich hatte und diese seelische Belastung konnte sie nach all dem Leid, was sie in den KZ-s erfuhr, nicht ertragen. Zwei ihrer Brüder, die sich in Paris niedergelassen hatten, reisten nach Schweden und überredeten sie, mit ihnen zu gehen. Sie hatte nur noch diese Brüder und eine Schwester - ihre Mutter ist schon vor dem Krieg an Leukämie gestorben. Sechs Monate später ist meine Mutter in die Vereinigten Staaten emigriert. Europa war zerstört und sie wollte ein neues Leben beginnen. Sie war böse auf Gott, denn sie fragte sich, wie ist es möglich, dass ihr Vater, der sein Leben Gott gewidmet hatte, von ihm im Stich gelassen wurde? Auch mit dem Tod ihrer Schwester, die wie eine Mutter zu ihr war, wurde ein Stück ihres Lebens ihr weggenommen. Mich hat meine Mutter nicht Ungarisch gelehrt. Sie wollte, dass ich englisch spreche, aber zur gleichen Zeit sind ihre besten Freunde bis heute ungarische Juden. Mit ihnen und den Brüdern, die später auch nach Amerika kamen, sprach sie immer ungarisch Hass empfand sie nur den Deutschen gegenüber. Budapest besuchte sie mehrere Male, und nur im Umgang mit älteren Menschen hatte sie ein unwohles Gefühl, da sie nicht wusste, was sich in ihrer Vergangenheit verbarg. Die amerikanische Kultur war für die Mutter völlig fremd. Sogar in der jüdischen Gemeinde verstanden die Leute nicht ganz, was in den Konzentrationslagern geschah. Die jungen Männer, mit denen sie ausging, hatten keine Ahnung, was sie alles durchmachen musste. Sie hatte den Eindruck, dass es zwischen ihr und diesen jüdischen Amerikanern nicht nur eine kulturelle, sondern auch eine emotionelle Barriere gab. Deshalb suchte sie sich Menschen, die auch aus Europa kamen und die gleichen bitteren Erfahrungen mit sich brachten. Mein Vater ist noch 1938 aus der Slowakei, aus Michalovce in die USA emigriert, er hatte in New York einen Onkel. Im Krieg diente er in der amerikanischen Armee, auf Übersee setzte man ihn aber nicht ein. Sein jüngerer Bruder starb in Theresienstadt. Zwei weitere Geschwister haben das Konzentrationslager überlebt, gingen zurück in die Slowakei und wurden Kommunisten. Der ältere Bruder hatte eine wichtige Position in einer städtischen Verwaltung. Sie verschwiegen ihre jüdische Abstammung und änderten auch ihren Namen. Meine Eltern trafen sich 1953 in Los Angeles. Die Ehe hat aber nur anderthalb Jahre gedauert. Die Menschen, die es schafften, die Gräuel zu überleben, sind im allgemeinen sehr starke Persönlichkeiten. Der Groll, den meine Mutter in sich trug, hatte den Vorteil, dass er unter schwierigen Umständen ihr die nötige Kraft verlieh. Häufig aber konnte diese Bitterkeit auch zerstörend sein, zum Beispiel in der Beziehung zu anderen Personen. Das war in der Beziehung zu meinem Vater der Fall. Die Eltern waren sehr verschieden. Da mein Vater schon mehrere Jahre früher in die Vereinigten Staaten gekommen war, wurde er amerikanisiert: er hing sehr an materiellen Werten und konnte sich mit meiner Mutter, die aus einer Kleinstadt, einer orthodox-religiösen Familie kam, nicht verstehen. Das war eine Zeit, als in Amerika der Zusammenhalt der Familie als äußerst wichtig empfunden wurde. Geschiedene Frauen hat man verachtet, meine Mutter war „stigmatisiert”. Trotzdem konnte sie unter diesen schwierigen Verhältnissen ein erfolgreiches Geschäft etablieren. Sie hat in Los Angeles Friseuse gelernt und in den 50-er Jahren machte sie ihren eigenen Friseurladen auf. Als ich sieben Jahre alt war, hat meine Muter wieder geheiratet: einen jüdischen Amerikaner, dessen Großvater aus Rumänien kam. Seine Herkunft bedeutete ihm aber überhaupt nichts. Meine Mutter bekam dann ein Mädchen von ihm. Mein Vater heiratete auch wieder, eine ungarische Frau. Aus dieser Ehe habe ich einen Halbbruder. Die zweite Frau hat vor dem gemeinsamen Kind verschwiegen, dass mein Vater schon einmal verheiratet war. 25 Jahre lang wusste dieser Halbbruder das nicht. Deshalb konnte ich meinen Vater nie in seinem Hause besuchen. In meiner Kindheit fehlte mir mein richtiger Vater sehr. Zum Glück hatte ich die Onkels, die von Paris übersiedelt waren und sich in Los Angeles niederließen. Meine Mutter gehört zu den vielleicht 10 Prozent der Holocaust-Überlebenden, die das, was ihnen widerfahren ist, nicht in sich verschlossen. Sie sprach ununterbrochen über diese schlimmen Erlebnisse, auch mit den Brüdern und der Schwester und auch mit mir. Sicherlich versuchte sie auf diese Weise, damit irgendwie zurechtzukommen. Sie hat sehr viel geweint. Als kleines Kind sah ich das, hörte zu, und auch wenn ich vieles nicht verstand, begann ich mir schon solche Fragen zu stellen, wie: warum sind Menschen gut der böse, oder warum werden Juden bestraft? Die Jahre vergingen, aber meine Mutter hat den Groll Gott gegenüber beibehalten. Sie lehnte nicht nur die kirchlichen Institutionen ab, sie war auch den religiösen Werten gegenüber skeptisch. An den hohen Feiertagen sind wir trotzdem in die Synagoge gegangen und den Sederabend haben wir gefeiert. Als ich 9 Jahre alt wurde, schickte mich meine Mutter zum Religionsunterricht in eine reformierte Synagoge. Ich lernte auch hebräisch lesen und schreiben, um mich auf meinen Bar-Mizwa vorzubereiten. Ich ging in eine Schule, die Kinder von jüdischen und nichtjüdischen, japanischen und chinesischen Amerikanern und von Afroamerikanern besucht hatten. So bin ich in einer multikulturellen Umgebung aufgewachsen. Möglicherweise war ich 9 oder 10 Jahre alt, als Kinder in unsere Klasse kamen, die ein Kreuz trugen und ich dachte, sie sind anders, als ich. Vielleicht weil meine Familie verfolgt wurde, fragte ich mich, wie sie sich wohl zu mir verhalten würden, wenn sie wüssten, dass ich Jude bin. Das war sehr irrational, denn ich hatte nie mit ihnen darüber gesprochen, ob sie Juden mögen oder nicht. Einige Jahre später war es schon zu beobachten, dass die jüdischen Kinder mehr zusammenkamen, Freundschaften schlossen. Ob bewusst oder unbewusst, der gleiche Hintergrund muss dabei schon eine Rolle gespielt haben. Nach meinem Bar-Mizwa wurde mir meine Herkunft eindeutig wichtiger. 1970 sind wir mit meiner Familie nach Toronto gezogen, weil mein Stiefvater dort einen guten Job erhielt. Diese Umgebung war sehr verschieden von der in Los Angeles: viel konservativer und kulturell geteilter. So etwas habe bis dahin nicht erlebt: sogar Katholiken und Protestanten hielten sich voneinander fern. Auch die vielen Nationalitäten - Ukrainer, ungarische Juden, Schotten - lebten in geschlossenen Gemeinschaften. In dem Gymnasium, das ich besuchte, gab es einige sehr reiche jüdische Kinder und man konnte den Neid ihrer Klassenkameraden spüren. Offenen Antisemitismus erlebte man in Toronto nicht, aber die Juden wurden als eine Minderheit betrachtet und nicht gleich behandelt. Ab und zu hörte meine Mutter antisemitische Bemerkungen oder Witze über Juden. Zu der Zeit habe ich schon sehr viel gelesen. An Religionen war ich sehr interessiert, in der Schule lernten wir auch etwas über Buddhismus, Hinduismus und über die verschiedenen protestantischen Kirchen. Ich war 18, als ein israelischer Geschäftspartner meines Stiefvaters nach Toronto kam. Wir haben ihn zu uns eingeladen. Er konnte es nicht fassen, dass ich als jüdischer Junge noch nie in Israel war. Da ich sowieso schon lange hinfahren wollte, auch weil mich die Geschichte von Ägypten und Palästina interessierte, nahm ich die Gelegenheit wahr und bin, auf seine Einladung hin nach Israel gefahren. Im Sommer 1973 war ich also in Israel, in einem Kibbuz, wo ich Juden aus der ganzen Welt traf. Ich fühlte mich sehr wohl, das Solidaritätsgefühl war stark, auch wenn mir die kulturellen Unterschiede zwischen Ashkenasim und Sephardim schon damals bewusst wurden. Über das Judentum erfuhr ich sehr viel neues. Ein paar Tage lebte ich auch mit einer orthodoxen Familie zusammen, die mich in eine Jeschiwa mitnahmen. Der Aufenthalt in Israel hat mir eine Welt eröffnet. Als ich nach Toronto zurückkam, um mein letztes Schuljahr vor dem Abitur zu beginnen, brach kurz darauf der Jom Kippur-Krieg aus. Während der ersten zwei Tage hat Israel, das von dem Angriff überrascht wurde, sehr starke Verluste erlitten, die Araber sind weit vorgedrungen. Wie kann ich als junger Jude in Toronto sitzen, während Israel in großer Schwierigkeit ist, dachte ich, und als erstes fing ich an, Geld zu sammeln. Mit Freunden organisierten wir ein Konzert, womit wir 1000 Dollar zusammen bekamen. Damals war das viel Geld. Dann habe ich beschlossen, dass mein Platz in Israel ist. Obwohl meine Mutter sehr wütend war, brach ich die Schule ab, und arbeitete in einem Warenhaus, damit ich genug Geld habe, nach Israel zurückzugehen. Ich war sehr naiv. In Israel habe ich dann erkannt, dass man keine 18jährige, sondern erfahrene, ausgebildete Leute brauchte. Jedenfalls blieb ich 6 Monate lang dort, lernte Hebräisch und arbeitete in einem Hotel. Auch mit Juden aus Indien und aus Süd-Afrika, die ich dort traf, empfand ich die kulturellen Bande und hatte das Gefühl, in einer Familie zu leben. Meine Mutter hat mich besucht, sie wollte unbedingt, dass ich zurückkomme, sie hatte große Angst um mich. Die israelische Regierung bot auch damals sehr viele Möglichkeiten für ausländische Jugendliche an. Ich hätte umsonst studieren können. Ursprünglich wollte ich nur für eine kurze Zeit nach Hause, um wieder Leute zu mobilisieren und Geld zu sammeln für Israel, aber dann dachte ich, wenn ich mich jetzt festlege, das Studium dort mache und auch dort bleibe, werde ich es vielleicht bereuen. Also ging ich mit den Eltern zurück nach Los Angeles. Die Erfahrungen in Israel haben mich aber grundlegend geformt. Ich war in verschiedenen jüdischen Gruppen aktiv. In einer konservativen Synagoge lernte ich einen Rabbiner kennen, einen außerordentlichen Menschen, der mich mitriss, weil er die Traditionen mit der Kultur verbunden konnte, in der er lebte. Er liebte nicht nur Sport, sondern war selber Athlet. An der Yale hat er biblische Literatur studiert und da er auch ein brillanter Redner war, begann ich, öfter in die Synagoge zu gehen und viele Programme in der Synagoge mit zu organisieren. Man hat mich mehrmals gebeten, in der Gruppe der Second Generation - Kinder von Holocaust-Überlebenden - mitzuarbeiten. Zuerst habe ich gezögert, weil ich der Meinung war, das Ziel wäre mehr die psychologische Heilung, als das Zusammensein und die Organisierung von kulturellen Veranstaltungen. Dann machte ich doch mit. Ich habe zum Beispiel einen Abend über Raoul Wallenbergs Tätigkeit in Budapest zusammengestellt. 1988 hatte die Regierung der Bundesrepublik 6 junge Amerikaner eingeladen, damit sie sehen können, wie sich Deutschland mit dem Holocaust befasste, was alles in den letzten 40 Jahren geschah. Da ich in der jüdischen Gemeinde von Los Angeles sehr aktiv war, konnte ich in dieser Gruppe mitfahren. Das war eine 10-Tage-Reise. Wir führten auch Gespräche mit Leuten der Second Generation. In Köln hatten wir eine bleibende Begegnung mit einer Frau, deren Vater in der Hitlerzeit Chefarzt in dieser Stadt war, er führte an Menschen - auch an Kindern - Versuche durch. Die Tochter lebte mit furchtbaren Gewissenbissen. In Ost-Berlin hatten wir Gelegenheit, mit jungen Juden zu sprechen. Am Ende der Deutschlandreise schöpfte ich die Idee, eine deutsch-jüdische Konferenz in Berlin zu organisieren und habe diesen Vorschlag der Friedrich-Naumann-Stiftung unterbreitet. Sie war sofort dafür. Zu dieser Zeit hatte ich eine Arbeit in den Vereinigten Staaten, die ich überhaupt nicht mochte. Mit meinem Diplom in englischer Literatur, mit Spezialisierung auf Shakespeare konnte ich nicht viel anfangen. Da beide Eltern im Geschäftsleben tätig waren, hatte ich schon von zu Hause Erfahrungen mitgebracht, so arbeitete ich zuerst in der Plastikindustrie, dann als Geschäftsführer einer Baufirma, aber das hat mir keinen Spaß gemacht. So freute ich mich sehr über diese Chance, nach Berlin zu kommen. Anfang 1989 reiste ich an. Ich wohnte bei einer Familie in Dahlem und um Deutsch zu lernen, besuchte ich das Goethe-Institut. Mit der Organisierung der deutsch-jüdischen Konferenz hatte ich große Probleme. Ich habe nie schwierigere Menschen getroffen, als die von der Jüdischen Gemeinde in Berlin. Ich weiß, dass viele von ihnen polnische Juden sind, die als Überlebende von Konzentrationslagern nach Deutschland kamen. Von Anfang an erlebte ich, dass sie nicht offen sind, dass sie sich in vieler Hinsicht wie in einem Stettl von Ost-Europa verhalten. Viele trauen den Leuten, die von außen kommen auch dann nicht, wenn sie Juden sind. Diese Situation bedeutete für mich einen großen Unterschied zu den Umständen in Los Angeles. Dort hatten wir ein kunterbuntes Gemisch von orthodoxen, konservativen und reformierten Juden, sogar von Gruppen, die zwar sehr säkular waren, aber gewisse Elemente der Religion beibehielten und gut miteinander auskamen. Hier in Berlin dagegen erlebte ich, dass sehr stark Machtpolitik betrieben wurde, man kämpfte um Positionen, üble Nachrede und Streitigkeiten waren an der Tagesordnung. In zwischenmenschlichen Kontakten gibt es natürlich immer Probleme, aber hier sind sie viel gravierender als was ich in Israel oder in Amerika erlebte. Das ist meines Erachtens sehr ungesund. Als die Mauer fiel, hat dieses Land enorme Veränderungen erlebt. Jüdische Menschen wurden sehr nervös, sie wussten nicht, was die Vereinigung für sie wohl bedeuten würde. Vielleicht einen neuen deutschen Nationalismus? Eine deutsch-jüdische Konferenz wurde zweitrangig, verglichen mit den viel größeren Ängsten, die die Juden in Deutschland gequält hatten. Damals habe ich Berlin schon gemocht. Ich fand es eine interessante Stadt und ich beschloss, hier zu bleiben und anstatt die Konferenz zu organisieren eine Zeitschrift zu starten. Es sollte ein Stadtmagazin werden, wie heute „Tip” oder „Zitty”. Ein englischsprachiges Magazin hielt ich für vielversprechend, weil ich dachte, Menschen aus aller Welt, die nicht Deutsch können, werden in diese lebendige Stadt kommen. In Amerika wird als zweite Fremdsprache Spanisch oder Französisch genommen. Ich ging also davon aus, dass viele Leute, die hierher kommen kein Deutsch sprechen. Die Zeitschrift erschien 5 Monate lang; ich habe gehofft, sie durch Annoncen und staatliche Unterstützung aufrechtzuerhalten. Aber nach der Vereinigung wurde die Hilfe, die aus dem Bundesetat für Westberlin gewährleistet wurde, gestoppt. Das Magazin verkaufte sich nicht gut und ich musste es einstellen. Ich bin aber nicht jemand, der etwas leicht aufgibt. Als ich gerade dabei war, Kontakte zu der englischsprachigen Geschäftswelt in Berlin zu finden, traf ich meine zukünftige Frau. Ich schrieb meiner Mutter, dass ich die große Liebe fand: ein nichtjüdisches deutsches Mädchen. Sie war entrüstet. Sie hegte immer noch Hass gegen die Deutschen. Die deutsche Literatur hatte sie zwar sehr gern, und als Kind in Kosice war ihre dritte Sprache Deutsch, aber nach dem Krieg wurde sie sehr nervös, wenn sie jemanden deutsch sprechen hörte. Als ich ihr nun schrieb, dass ich mich verliebt habe, kam eine sehr aufgebrachte Antwort. Wie könnte ich es ihr antun, fragte sie in ihrem Brief. Ihr Widerstand konnte aber an meinem Entschluss nichts ändern. Im Dezember 1992 nahm ich meine zukünftige Frau nach Kalifornien mit, um ihr mein Land zu zeigen. Sie kommt aus der ehemaligen DDR, wo sie mit antiamerikanischen Stereotypen vollgestopft wurde und ich wollte, dass sie sich selber ein Bild verschafft. Gerade bevor wir abreisten, kam ein Brief von meiner Mutter: sie schrieb, dass sie meine Freundin nicht sehen wollte. Trotz dieser Warnung gingen wir zum Haus meiner Eltern, das an der Küste liegt. Da niemand zu Hause war, schrieb ich meiner Mutter einen Zettel, wir sind auf dem Strand, wenn sie will, findet sie uns dort. Dann kam die glückliche Wende. Nach zwei Stunden erschien sie und verstand sich vom ersten Augenblick an ausgezeichnet mit meiner Freundin. Auch mit meinem Onkel und seiner Frau verband sie sofort eine gegenseitige Sympathie. Seitdem ist meine Frau als vollwertiges Familienmitglied akzeptiert. Wenn eine jüdische und eine nichtjüdische Person heiraten, taucht selbstverständlich die Frage der Religion auf: wie werden die Kinder erzogen? Ich wollte auf keinen Fall Druck auf meine Frau ausüben, damit sie konvertiert. Bevor wir heirateten, sind wir einige Male nach Kalifornien gefahren und ich stellte sie meinen jüdischen Freunden, auch dem Rabbiner den ich so sehr schätzte, vor. Sie hatte sehr angenehme Erfahrungen, auch in Israel, wohin wir gemeinsam eine Reise unternahmen. Sie selbst hat beschlossen, zu konvertieren, bevor unsere Kinder geboren wurden. Seit der Zeit, als ich in Los Angeles mit dem Leben in der Synagoge so eng verbunden war, versuchte ich, als ich gebetet habe, die Präsenz Gottes zu spüren. Es ist mir aber nie gelungen. Die religiösen Werte üben einen intellektuellen Einfluss auf mich aus, ich verstehe, was sie verkörpern. Da wir durch verschiedene Phasen in unserem Leben gehen, kann es passieren, dass wenn ich älter werde, Religion für mich an Bedeutung gewinnt. Seitdem unsere Kinder geboren sind, gehen wir nur selten in die Synagoge. Meine Frau ist dort zwar akzeptiert - in Berlin gibt es ja sehr viele „Mischehen”, in denen die Frauen offiziell oder nichtoffiziell konvertiert sind - aber sie kommt mit den Cliquen und oft auch mit der Einstellung der Leute nicht zurecht. Manchmal zünden wir am Freitag die Kerze an und sprechen die Gebete, aber mit den kleinen Kindern ist es schwierig. Meine Frau möchte eine liberale religiöse Struktur in unserem Leben haben, Sabbat und die hohen Feiertage wollen wir halten. Es fällt mir sehr schwer, Anschluss an diese Gemeinde hier in Berlin zu finden und die Gemeinschaft in Los Angeles fehlt mir. Jüdisches Leben ist eben ein Leben in der Gemeinschaft. Die Menschen kommen zusammen, um zu beten und um zu feiern. Wenn man sich als einen Juden bezeichnen will, muss man Kontakt zu anderen Juden haben. An dem jüdischen Leben in Los Angeles habe ich sehr aktiv teilgenommen. Wir hatten viele interessante kulturelle Programme und an der Universität für jüdische Studien konnte ich regelmäßig zu Vorlesungen gehen, wo berühmte Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern zu hören waren. Vielleicht wird sich aber in den nächsten 10 Jahren diese stärk zentralisierte Ordnung der Berliner Gemeinde ändern: vielleicht können Gemeinschaften ihre eigene Synagoge haben, mit eigenem Geld, und müssen sich nicht auf die Gemeinde stützen. Denn wir wollen noch mindestens 15 Jahre hier bleiben, das haben wir beschlossen. Ich bin sehr stolz darauf Jude zu sein, stolz auf unsere Tradition. Das heißt nicht, dass ich denken würde, die jüdische Religion sei den anderen überlegen; ich habe ja auch über sie viel gelernt. Die philosophische Annährung zum Leben ist bei allen beeindruckend. Wenn man versteht, was die hebräischen Gebete auszudrücken versuchen, begreift man, dass sie auch Weisheit enthalten. Ich habe eine intellektuelle Achtung davor. Wir nähern uns der Religion auf eine rationale und zugleich irrationale Weise. Für mich fand ich noch nicht alle Antworten. Wenn ich nie wieder in Synagoge ginge, würde ich Verrat und auch Leere verspüren, weil ich die Tradition nicht fortgesetzt habe und den Anschluss an das Judentum von mehreren tausend Jahren verlor. Auch dann würde ich mich sehr unwohl fühlen, wenn meine Kinder den Kontakt zum Judentum verlieren würden. Joshua ist jetzt fünfeinhalb Jahre alt, Joel ist 3. Ich will keinen Druck auf sie ausüben, sondern ihnen die jüdischen Traditionen interessant gestalten. Ich möchte, dass meine Kinder mit den kulturellen Traditionen erzogen werden, das sie die Bedeutung der hohen Feiertage verstehen. Es ist wichtig für mich, dass sie eine Beziehung zu Israel haben - wir möchten einmal im Jahr oder alle zwei Jahre hinfahren - und Hebräisch als vierte Fremdsprache erlernen. Mein älterer Sohn ist bereits zweisprachig aufgewachsen, als dritte Sprache möchte ich, dass er Spanisch lernt, da wir nach Kalifornien zurückgehen werden. Als vierte käme dann Hebräisch. Die Lebensqualität ist eigentlich auch der Grund, warum ich hier bin. Es gibt vieles, was ich in der amerikanischen Lebensweise ablehne. Zum Beispiel, dass man viel zu viel arbeitet und nicht genug Zeit für die Familie hat. Da ich in meiner Kindheit meinen Vater so vermisst habe, ist es mir besonders wichtig, viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Aber ich bin eben doch sehr amerikanisch. Wenn ich hier in Berlin Amerikaner treffe, ist ein Kontakt vorhanden, den ich mit den Deutschen nicht teilen kann. Es gibt Einiges, was mir fehlt: zum Beispiel die Nähe des Ozeans. Ich würde gern den salzigen Geruch riechen können. Das warme Wetter vermisse ich auch. In Berlin verstreichen oft Wochen so, dass man nur den grauen Himmel sieht. Ich komme aus Südkalifornien, wo wir insgesamt 20 Regentage im Jahr haben, ansonsten nur Sonnenschein. Hier in Deutschland ist es oft auch im Sommer kalt. Deshalb möchte ich zurück nach Kalifornien. Wir bleiben aber noch für längere Zeit hier, auch weil meine Frau ihren Beruf sehr mag. Sie ist Kieferorthopädin. Sie hat die Praxis von ihrem Vater übernommen. Als wir vor 7 Jahren heirateten, wollte ich eigentlich nach Kalifornien zurückgehen. Aber ich sah ein, wenn ich sie, die eigentlich aus Ost-Europa kam, nach Los Angeles, nah zu Beverly Hills gebracht hätte, wo in erster Reihe das Geld zählt, wäre für sie der kulturelle Schock furchtbar gewesen. Der Anpassungszwang hätte möglicherweise unsere Beziehung zerstört. Ich musste auch in Betracht ziehen, wie lange sie studiert und wie viel klinische Arbeit sie geleistet hat, um ihren Beruf ausüben zu können. Auf all das zu verzichten und alles von vorne beginnen zu müssen, in einer Fremdsprache - das wollte ich ihr nicht zumuten. Die Erziehung unserer Kinder ist zusätzlich ein wesentlicher Gesichtspunkt dafür, dass wir vorerst hier bleiben. Mein älterer Sohn besucht eine ausgezeichnete Schule; dieses Niveau könnte man in Amerika nur in einer privaten Lehranstalt finden. Als freischaffender Journalist habe ich in Deutschland viel mehr Möglichkeiten als in Amerika. Nachdem ich das englischsprachige Magazin einstellte, habe ich für amerikanische Rundfunk- und Fernsehanstalten gearbeitet. Ich bin hier einer breiten Welt ausgesetzt, was mein Leben intellektuell sehr interessant gestaltet. Die Struktur des europäischen Journalismus unterscheidet sich in vieler Hinsicht von der des amerikanischen. In den Vereinigten Staaten gibt es andere Spielregeln, die Medienwelt ist viel mehr wettbewerbsorientiert. In Kalifornien könnte ich, glaube ich, die journalistische Arbeit nicht fortsetzen. Es kommt hinzu, dass es nur sehr wenige schaffen, als freiberufliche Journalisten ein stabiles Einkommen zu haben. In das Geschäftsleben könnte ich zurückgehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das will: es geht dort zu hart zu. Noch habe ich aber viel Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. In Deutschland fühle ich mich wohl, aber es gibt Dinge, die mich befremden und mit Sorge erfüllen. Vor 10 Jahren wollte man zum Beispiel in Rostock den 50. Jahrestag der Entwicklung der V2 Rakete begehen. Die Leute, die diese Idee hatten, sagten, es wäre nichts schlimmes daran, denn dieses Projekt trug letzten Endes zur Entwicklung der ganzen Raketentechnologie nach dem Krieg bei. Für mich gibt es Anlass zur Sorge, ob in dieser Gesellschaft auch viele andere so denken. Auch das fand ich schockierend, als Helmut Kohl, der Geschichte studiert hat, 1995 Ronald Reagan nach Bitburg brachte, wo auch Soldaten der Waffen-SS begraben wurden. Mit dem größeren Abstand zum Kriegsende wächst auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Krieg nur noch Geschichte wird und sogar uminterpretiert werden kann. Schon damals, als ich nach Deutschland kam, war der Geschichtsrevisionismus in Deutschland vorhanden: man versuchte, Hitlers Taten zum Teil damit zu rechtfertigen, dass er den Kommunismus bekämpfte. Ich glaube, diese Ansichten haben bereits tiefe Wurzeln. Bekannte von mir nahmen an Konferenzen teil und waren verblüfft, wie einige der deutschen Wissenschaftler denken. Institutionen, die Geschichtsrevisionismus betreiben und behaupten, dass der Holocaust überhaupt nicht stattgefunden hat, gibt es natürlich überall - eine auch nicht weit von dem Ort, wo meine Eltern leben. Alles hängt davon ab, in wieweit sich diese Thesen verbreiten können. Vor ein paar Jahren wurden in Deutschland Asylheime angezündet, auch Synagogen, zuletzt in Erfurt. Das ist beunruhigend. In der ehemaligen DDR ist die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen sehr hoch und viele von ihnen werden durch rechtsextreme Gruppen angezogen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Deutschen mehr auf linksextreme Erscheinungen reagieren, als auf Phänomene des Rechtsextremismus. Ich frage mich, wie stark das ultrakonservative Element in der deutschen Gesellschaft, in der Kultur ist und wie es weitergegeben wird. Nach dem Krieg wollten viele verstehen, was die Deutschen dazu bewog, sich so entsetzlich zu verhalten. Es gab viele Theorien in der Psychiatrie von den starken deutschen Vätern, die strikt zu ihren Kindern waren, worauf sie eine Aggressivität in sich entwickelten. Diese Aggressivität haben die Kinder später als Wachmänner von Konzentrationslagern ausgelebt, wo sie die Grausamkeiten begingen oder denen zumindest zusahen. Die politisch-gesellschaftlichen Umbrüche sicherten hoffentlich die Grundlage dafür, dass sich so etwas nicht wiederholen kann. Aber das Risiko besteht immer, dass das zivilisierte Zusammenleben auseinanderbricht. Deutschland hat die demokratischen Institutionen fest verankert, trotzdem gibt es destabilisierende Elemente, die mich beunruhigen. Ich denke, wenn das Land nicht so reich wäre, wenn es hier eine in ihren Ausmaßen wesentlich größere Massenarbeitslosigkeit gäbe, würden die Minderheiten, wie in allen Gesellschaften, wieder die Leidtragenden sein. Die meisten meiner Freunde sind nichtjüdische Deutsche. Es ist wahrscheinlich von Mensch zu Mensch verschieden, wie sie mit der Vergangenheit zurechtkommen. Was mich überrascht, ist, dass viele Jugendliche immer noch nicht mit ihren Eltern oder Großeltern über den Holocaust gesprochen haben. Ich habe auch die Argumentation gehört, dass viele schon von diesem Thema genug hätten. Meine Mutter und andere Überlebende würden es möglicherweise bevorzugen, wenn man sich noch mehr damit beschäftigte - auch die jungen Menschen, die keine Kriegserfahrung haben und keine Beteiligung an der Schuld der Älteren. Ich erwarte nicht, dass man die jungen Leute zwingt, jede Woche der Vergangenheit zu gedenken, aber ich will, dass sie die historischen Fakten verstehen. Sie müssen nicht alle Schlachten kennen, nicht wissen, wo überall Konzentrationslager waren, aber sie sollen verstehen, wie es zu dem Krieg kam und was er verursachte. Einige Male im Jahr, wie zum Beispiel am Jom Hashoah, an dem Gedenktag des Holocaust könnten sie sich auch die Zeit nehmen, über die Vergangenheit nachzudenken. Ich glaube, das hilft dabei, gute Menschen und verantwortliche Staatsbürger zu werden. Zum Teil ist es verständlich, dass die Deutschen einen neuen Anfang wollen. Aber es muss Menschen geben, die sagen, vom Punkt Null an kann man nicht beginnen, man muss sich mit der Vergangenheit auseinander setzen und die Verantwortung dafür akzeptieren. Immer wieder werde ich gefragt, warum ich in Berlin lebe. Auch in Kalifornien stellt man mir diese Frage. Zwei Freunde habe ich verloren - sie haben mich verstoßen, weil ich beschloss, hier zu leben. Für viele amerikanische Juden ist es auch 60 Jahre nach Beginn des Krieges ausgesprochen geschmacklos, wenn jüdische Menschen sich für ein Leben in Deutschland entscheiden. Aber wenn man mich fragt, antworte ich immer, es ist ein vielversprechendes, wenn auch nicht risikofreies Abenteuer. Ich komme aus einem mitteleuropäischen Umfeld und ich fühle mich sehr wohl hier. Mein Herz gehört aber Amerika, meine Heimat ist dort. Es gibt viele Menschen in der Welt, die in einem anderen Land leben, als wo sie geboren wurden, aber am Ende ihres Lebens gehen sie heim. So wird wahrscheinlich auch mein Weg aussehen. Shelly Kupferberg „Diese Einstellung, in einem Land zu leben, aber sich bewusst von der Umgebung abzugrenzen, fand ich schlecht...” Shelly Kupferberg muss sich immer mehr zugestehen, dass sie deutsche Jüdin ist, oder viel mehr noch: Berliner Jüdin. Sie fühlt sich in dieser Stadt verwurzelt, auch deshalb, weil ihre Großeltern zum Teil von hier kommen. Die 25jährige war nicht einmal ein Jahre alt, als ihre Eltern sie aus Israel nach Deutschland mitnahmen. Der deutschen Sprache und Kultur ist die Radiojournalistin sehr verbunden und findet es gut, dass Deutschland sich mit der Geschichte intensiv auseinandersetzt. Zwar sieht sie in dieser Auseinandersetzung mehrere Punkte, die nicht zufriedenstellend sind, aber „wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, ist wenigstens die Bemühung da”. Sie mag die Art und Weise, wie man heute in Deutschland leben kann. Noch schwanke ich zu sagen, deutsche Jüdin zu sein, weil ich nicht weiß, ob ich mich deutsch fühle. Eigentlich merke ich nur im Ausland, wie sehr ich „deutsch” bin, was meine Mentalität betrifft, wie ich mich benehme. Zum Beispiel indem ich mich zurückhalte und sehr überlege, wann ich etwas zu einem angesprochenen Thema sagen muss. In Israel spüre ich es am meisten. Allerdings ist meine Mentalität auch jüdisch gefärbt und Israel ein ganz wichtiger Teil von mir. Ich habe beide Staatsangehörigkeiten. Eigentlich glaube ich mehr, dass ich Berliner Jüdin bin. Berlin finde ich eine großartige Stadt, eine multikulturelle, freie Stadt. Ich bin dankbar dafür, wie ich hier aufwuchs, und ich lebe hier sehr gern. Es ist natürlich immer wieder eine Konfrontation, in diesem Land, in dieser Stadt zu leben, und es ist nicht immer einfach, das Ganze positiv zu sehen. Gerade Berlin ist eine Stadt, wo man an jeder Ecke merkt, was hier passierte, dass viel Schlimmes von hier ausging, Geschichte schwebt in der Luft und klebt an den Häusern. Wenn man durch Berlin fährt, kommt man an so vielen historischen Orten vorbei, wo so bedeutende und auch schreckliche Dinge geschahen. Unterwegs in Berlin, assoziiere ich oft etwas, was mit der Zeit zwischen 1920 und 1945 zu tun hat. In den 20-er Jahren lebten meine Großeltern in Deutschland, diese Zeit war auch spannend für Berlin, für die deutsche Kultur, und hing eng mit der jüdischer Kultur in Deutschland zusammen. „Die goldenen Zwanziger” üben auf mich eine Faszination aus, ich beschäftige mich mit dieser Periode auch in meinem Studium der Theaterwissenschaften. Aber auch mit dem Schrecken des zweiten Weltkriegs, des Holocaust bin ich irgendwie tagtäglich konfrontiert. Manchmal ist es belastend und dann probiere ich, Abstand davon zu bekommen. Anregend ist es auf jeden Fall. Meine Eltern sind wegen der politischen Situation aus Israel weggegangen. Sie waren schon in Israel geboren, 1945 und 1949, wuchsen dort auf und gingen zum Militär. Mein Vater kämpfte im Sechstagekrieg und im Jom-Kippur-Krieg mit. Als er aus letzterem wiederkam, hatte er große Schwierigkeiten mit dem Land und seiner Politik. Die Unsicherheit, ob es wieder Kriege geben wird, bedrückte ihn sehr. Auch meine Mutter war der israelischen Politik gegenüber kritisch eingestellt. 1975 befand sich mein Vater immer noch im Reservedienst und meine Eltern sahen keine guten Perspektiven in Israel. Sie dachten, sie sind jung, sie haben ein kleines Baby, sie wollen versuchen, ein Jahr anderswo zu leben, um so Abstand zu gewinnen. Danach würden sie sehen, wie es weitergeht. Zuerst gingen wir in die Schweiz. Meinem Vater, der Kfz-Mechaniker war, boten Freunde dort an, in ihrer Autowerkstatt zu arbeiten. In der Schweiz wurde aber damals gerade das Ausländergesetz verschärft, unsere Familie hätte nicht bleiben können, so zogen wir weiter nach Berlin. Mein Großvater, der Vater meiner Mutter hielt zu dieser Zeit gerade Vorträge in Berlin und er schlug meinen Eltern vor, dorthin zu kommen, wo er auch viele Freunde hatte. Mein Vater besass neben seinem israelischen Pass auch den deutschen. Seine Eltern nutzten nach der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel die Möglichkeit, die deutschen Pässe wiederzubekommen. Zuerst wollten meine Eltern nur ein Jahr bleiben. Daraus wurden zwei, drei, vier Jahre, dann dachten sie, wenn ich das Schulalter erreicht habe, gehen sie zurück. Aber es hat ihnen hier so gut gefallen, dass sie geblieben sind. Mein Vater ist zweisprachig aufgewachsen, mit Hebräisch und Deutsch. Meine Mutter hat zwar Deutsch zu Hause gehört, aber die Eltern sprachen mit den Kindern hebräisch. Nach dem Abitur verbrachte sie aber ein halbes Jahr in Deutschland und lernte im Goethe-Institut die Sprache. Meinen Eltern wurde kein Hass auf Deutschland beigebracht. Natürlich haben ihnen die Eltern ihre Skepsis vermittelt, aber auch die Meinung, dass trotz dessen was in Deutschland passierte, ein Land sich verändern kann. Schon sehr früh fingen die Eltern meines Vaters an, nach Europa zu reisen, auch nach Deutschland, so war das meinem Vater überhaupt nicht fremd. Die Mentalität seiner Eltern ist sehr deutsch. Bei den Eltern meiner Mutter ist das zwar nicht so stark ausgeprägt, aber sie haben auch fast ausschließlich deutsche Bücher in ihren Regalen. Sie sind mit der deutschen Kultur aufgewachsen, die einen zentralen Punkt für sie bildet, obwohl sie weltoffen eingestellt sind. Meine Großeltern mütterlicherseits stammen aus Wien und Berlin. Die Eltern der Berliner Großmutter kamen aus Galizien Anfang der 20-er Jahre. Sie ist zwei Wochen vor der Reichspogromnacht nach Palästina ausgewandert, ihre Eltern blieben hier, sie meinten, es würde ihnen schon nichts passieren. Sie fuhren zu Verwandten nach Lemberg (Lvov), kamen aber wahrscheinlich schnell in ein Ghetto und sind dort ermordet worden. Die Großmutter erhielt bis 1941 Briefe von ihnen. Die Familie des Großvaters, der aus Wien stammt, kommt aus der Tschechoslowakei, sie hatten eine kleine Lederfabrik. Der Großvater ist in Wien geboren. Kurz nach dem Anschluss Österreichs ging die Familie nach Palästina. Bei meinen Großeltern väterlicherseits kommt die Großmutter aus Hildesheim, bei Hannover, mein Großvater aus einer alten Berliner Familie. Sie verließen Deutschland bereits 1934 bzw. 1936 und wanderten nach Palästina aus. Die Großmutter mit ihrer Großmutter, die sie erzogen hat, weil die Eltern früh verstarben, der Großvater zusammen mit seinen Eltern. Außer den Eltern der Berliner Großmutter gibt es weitere Leidensgeschichten in der Familie. Brüder und Schwestern von meinen Großeltern kamen ins KZ und nicht alle haben überlebt. Die es schafften, wanderten nach Ende des Krieges nach den USA aus. Alle Großeltern lernten sich in Palästina kennen. Die Eltern meiner Mutter waren sehr links eingestellt, sie haben die Kommunistische Partei in Israel mit begründet. Sie sind Intellektuelle. Zu Anfang hatte mein Großvater, Walter Grab große Schwierigkeiten in seiner neuen Heimat. Er konnte mit Palästina nichts anfangen, ihm kam das alles zu orientalisch vor. In Wien war er ein wohlbehütetes bürgerliches Kind, der die Kaffeehäuser wunderbar fand, jede Premiere im Burgtheater sah und plötzlich in der Wüste sass. Er begann Taschen zu verkaufen, in dem er von Haus zu Haus ging. In Wien hatte nämlich die Familie in ihrer Lederfabrik Taschen hergestellt und der Großvater nahm die Schnitte mit nach Palästina, wo er mit seinen Eltern die Taschen selber anfertigte. Später machte er einen kleinen Laden in Tel Aviv auf, und verkaufte dort die Lederwaren. Aber wenn er von der Arbeit nach Hause kam, hat er immer gelesen, dann fühlte er sich wohl. Er war schon Ende 30, als er anfing zu studieren. Danach machte er schnell eine steile Karriere, er wurde ein bekannter Historiker und hat Ende der 60-er Jahre das Institut für deutsche Geschichte in Tel Aviv gegründet und bis 1986 geleitet. Wegen seiner sehr linken Ansichten galt er als umstritten. Er beschäftigte sich mit der Französischen Revolution und den Jakobinern sowie der deutschen Revolution von 1848, den demokratischen Aufbrüchen in Deutschland. Da er Marxist ist, hat er in Deutschland viele Feinde, aber auch viele Verehrer. Eigentlich war fast sein ganzer Freundeskreis hier in Deutschland. Er hielt sich sehr oft in Deutschland auf, er promovierte in Hamburg, wo er zwei Jahre verbrachte und bekam Lehraufträge an verschiedenen Universitäten. Nach seiner Emeritierung reiste er viel in der Welt herum und hielt Vorträge. Der Zusammenbruch der Sowjetunion bedeutete für ihn ein Desaster, er sagte, das Land sei verkauft worden. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands vertrat er die Meinung, es ist ein Anschluss gewesen. Er meinte, Deutschland brauche keine Panzer mehr, um nach Wladiwostok zu kommen, dazu reiche die D-Mark. Viele waren entsetzt, als er so etwas sagte. Er ist eine sehr wichtige Person für meine jüngere Schwester Jael und mich. Wir haben aber auch eine sehr enge Beziehung zu den anderen Großeltern, die heute noch lieber deutsch als hebräisch lesen. Als wir nach Deutschland übersiedelten, tat es ihnen sehr weh, aber nicht wegen des gewählten Landes, sondern weil die Familie dadurch getrennt wurde. In Berlin hat meine Mutter zuerst nicht gearbeitet. Sie ist Fremdsprachensekretärin in Englisch und Französisch, blieb aber mit uns zu Hause und unterrichtete privat Hebräisch. Als wir schon allein aus der Schule nach Hause kommen konnten, fing sie an zu arbeiten, bei der Steuerberatung und in einem Reisebüro. Sie machte dann eine Umschulung als Erzieherin und begann an der jüdischen Grundschule Hebräisch zu unterrichten. Mein Vater arbeitete weiter in der Autobranche, war aber sehr unglücklich, weil er nie Automechaniker werden wollte. Er wurde in der Werkstatt seines Vaters als Lehrling angelernt und es schien vorbestimmt zu sein, dass er die Werkstatt auch übernimmt. Vor einigen Jahren wechselte er in die Jüdische Gemeinde, wo er für die Arbeitssicherheit an den jüdischen Institutionen verantwortlich ist: er muss dafür sorgen, dass die Feuerwege stimmen, dass die Leute gute Arbeitsbedingungen haben, und an erste Hilfe-Kursen teilnehmen. Bei uns gab es immer wieder Überlegungen, nach Israel zurückzugehen, vor allem, weil die Großeltern uns sehr fehlten. Wir sahen uns relativ oft, als sie noch gesund waren, kamen sie zweimal im Jahr nach Deutschland, wir reisten einmal im Jahr nach Israel. Aber es wäre doch schöner gewesen, die ganze Zeit über zusammen zu sein. Natürlich hatten meine Eltern auch Sehnsüchte nach dem Meer in Tel Aviv, der Landschaft und der Mentalität. Auch weil mein Vater mit seiner Arbeit lange sehr unzufrieden war, überlegten sich die Eltern, es vielleicht doch noch einmal in Israel zu versuchen. Sie sind aber hier geblieben, weil sie sich letztendlich hier wohl fühlten. Durch meinen Großvater bekamen sie schnell einen ausgedehnten Freundeskreis. Meine Eltern sind keine Zionisten. Mit den politischen Umständen ihrer Heimat kamen sie zwar nicht klar, aber sie haben eine sehr klare Identität: sie sind Israelis - immer noch. Sie fühlen sich sehr wohl in Berlin, sie sind auch Berliner, aber sie würden sich nie als Deutsche bezeichnen, auch nicht als deutsche Juden. Sie sprechen untereinander hebräisch, aber mit meiner Schwester und mir deutsch. Als ich klein war, sprachen sie mit mir nur hebräisch, aber dann kam ich in den Kindergarten und wollte nicht mehr. Ich habe mich dafür geschämt, dass die anderen Kinder nicht verstehen konnten, was meine Eltern zu mir sagten. Deshalb bat ich sie, mit mir deutsch zu reden, wenn andere dabei sind. Sie gaben nach, weil sie nicht wollten, dass ich deswegen Schwierigkeiten habe, mich zu integrieren. Meine Schwester und ich beherrschen Hebräisch ganz gut, aber nicht perfekt. Wir sind mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass wir aus Israel kommen und Juden sind. Schon relativ früh, vielleicht mit 6-7 Jahren wussten wir, was hier passierte, dass es Hitler gab. Als ich 9 war, bekam ich Anne Franks Tagebuch geschenkt, und meine Eltern nahmen mich auch nach Yad Vashem mit. Danach wollte ich sehr viel darüber erfahren, auch von den Großeltern. Bei uns war das Thema nie Tabu. Wir fragen die Großeltern auch heute noch und sie erzählen so ausführlich, wie sie können. Da meine Eltern wollten, dass wir ganz normal aufwachsen, nicht abgeschottet, gingen wir nicht in den jüdischen Kindergarten. Sie meinten, das Judentum kriegen wir sowieso von zu Hause mit. In die Jüdische Gemeinde traten meine Eltern vor 12 Jahren nur ein, als meine Mutter anfing, in der jüdischen Schule zu arbeiten. Wir Kinder wurden auch Mitglieder. Heute könnte ich schon austreten, aber wahrscheinlich bleibe ich dort, weil ich glaube, es ist eine wichtige Institution, die unter anderem das jüdische Altersheim, und Krankenhaus aufrechterhält. Ich bleibe also wegen des gesellschaftlichen Engagements der Gemeinde. Für die Eltern war die Gemeinde immer zu konservativ, aber ich glaube, mit der Zeit haben meine Eltern wieder mehr die Verbindung zu dem jüdischen Umfeld gesucht. Der „jiddische Pubik” (Bauchnabel) ist bei ihnen zum Vorschein gekommen. Sie merkten, je länger sie in Deutschland waren, desto fremder wurde ihnen die israelische Gesellschaft, die sich ja auch sehr veränderte. Sie haben kaum noch Freunde in Israel - viele Freunde distanzierten sich, als meine Eltern beschlossen, nach Deutschland zu gehen. Damals hat man noch besonders empfindlich darauf reagiert. Die Wiederentdeckung des Jüdischen, auch durch die Mitgliedschaft in der Gemeinde, gab meinen Eltern doch eine Art von Geborgenheit. Meine Eltern sind sehr areligiös, sie wurden auch so erzogen. Die Feiertage haben wir sehr säkular gefeiert, so wie wahrscheinlich die meisten Deutschen Weihnachten feiern. An Tradition gebunden feierten wir Chanukka und Pessach und ganz selten gab es auch Sabbat mit Freunden, die genauso säkular und links waren, wie meine Eltern. Wir sangen Lieder, aber es gab keine Gebete. Zweimal machte ich eine Jugendreise mit, die von der Zentralen Wohlfahrtstelle für Juden in Deutschland organisiert wurde. Ich habe die Reise nach Portugal, Spanien und Israel sehr genossen, und dort kam ich das erste Mal mit Religiosität, mit den Gebeten in Berührung. Es hat mich fasziniert. Als ich nach Hause kam, machte ich meinen Eltern Vorwürfe, warum wir nie richtig Sabbat feiern. Sie versuchten mir klar zu machen, dass ihnen keine Religiosität vermittelt wurde und daher sie es auch nicht weitergeben können und wollen. Da gab es einen kleinen Konflikt, weil ich dachte, ich müsste das jetzt intensiver leben. Aber dieses Gefühl ließ ganz schnell wieder nach. Schnell habe ich gemerkt, dass die Religion nicht wirklich meine Welt ist. Es ist ein Teil meiner Geschichte, meiner Kultur, aber nicht so dominant als dass ich mich darin sehr wohl fühlen würde. Wahrscheinlich war das eine typisch pubertäre Auseinandersetzung: ich dachte damals, mit 15-16 Jahren darüber nach, bin ich nun religiös, glaube ich an Gott? Ich stellte fest, ich glaube an irgend etwas, aber ob das nun Gott ist? Mit den Regeln der Religion kann ich mich auch heute nicht identifizieren. Über die Wissenschaft oder Kultur darauf zu gucken, ist interessant für mich, aber nicht mehr. Ich möchte das leben, was ich für richtig halte, und das muss nicht unbedingt mit jüdischer Religion zu tun haben. Oder überhaupt mit Religion. Warum sollte ich Gott unentwegt würdigen, wenn ich das nicht empfinde? Feste zu feiern, sich kulturell und traditionell daran erinnern, was in der jüdischen Geschichte geschah, finde ich schön und wichtig. Im Unterschied zu meinen Eltern würde ich meinen Kindern gern mehr davon weitergeben, als ich zu Hause bekam. Vielleicht öfter Sabbat feiern oder mit meinen Kindern öfter in die Synagoge gehen. Ich finde das ein schönes Ritual, mir gefällt das soziale Element dabei, dass die Synagoge auch ein Treffpunkt ist. Wenn ich mit meiner Mutter und meiner Schwester zwei-dreimal im Jahr in die Synagoge gehe, dann in die Pestalozzistraße. Ich meine, es ist gut, dass es den gemischten Gottesdienst in der Synagoge der Oranienburger Straße gibt, aber ich glaube nicht, dass ich als Frau Kippa und Tallit tragen muss. Das ist mir schon wieder zu religiös, es erscheint mir esoterisch. Als Betreuerin nahm ich an einer Jugendreise für jüdische Kinder in Deutschland und auch in Israel teil. Die Fahrten gaben mir sehr viel, weil ich auch über Israel noch reichlich lernte. Ich fuhr zu Jugendkongressen, die einmal im Jahr veranstaltet werden: die Auseinandersetzung mit Judentum, mit jüdisch sein in Deutschland und in Israel fand ich sehr interessant. Heimisch fühlte ich mich bei diesen Treffen nie, weil die Jugendliche, die daran teilnahmen aus einer sehr verschiedenen Umgebung kamen. Diese Kinder sind in den jüdischen Kindergarten gegangen, in die jüdische Schule, und blieben immer unter sich. Deutsche waren für sie Gojim, sie sprachen von ihnen mit einer Überheblichkeit, als wären sie, die Juden etwas besseres. Damit konnte ich mich nicht identifizieren, weil ich fast immer nur nichtjüdische Freunde hatte, die mir sehr nahe standen. Diese Einstellung, in einem Land zu leben, aber sich bewusst von der Umgebung abzugrenzen, fand ich schlecht und ich hatte viele Diskussionen darüber. Manche sagten mir, sie würden beneiden, dass meine Eltern mir erlauben, mit nichtjüdischen Menschen Umgang zu haben. Bei ihnen dürften nichtjüdische Freunde gar nicht ins Haus kommen. Manche sagten aber, es interessiere sie nicht, was ihr nichtjüdisches Umfeld macht. Sie leben hier, weil es bequem ist in Deutschland zu leben, weil man hier mit Samthandschuhen angefasst und manchmal auch privilegiert wird. Dies ist ein falscher Weg, glaube ich, der nur Vorurteile und Antisemitismus schürt. Mir scheint es verlogen, wenn Leute sagen, existentiell geht es uns gut, aber unser Umfeld ist feindlich. Wenn sie dieses Gefühl haben, können sie ja gehen. Ein paar mal habe ich mir überlegt, für ein-zwei Jahre in Israel zu leben, aber ich glaube, der Gedanke rückt immer weiter in die Ferne. Leider habe ich in Israel keine Freunde in meinem Alter. Es ist schwierig, dort Kontakt zu der jungen Generation aufzunehmen. Wir sind auch nur zwei-dreimal im Jahr da. Es ist eine ganz andere Jugend, sehr amerikanisiert und durch den Militärdienst stark geprägt. Wenn man letzteren nicht mitgemacht hat, ist es schon schwierig, in dieses Gefüge hineinzupassen In ihrer und meiner Erziehung gibt es schon große Unterschiede. Viele Israelis sind sehr stolz auf ihr Land. Ich kann das verstehen, aber manchmal grenzt das an einen Patriotismus, dem ich nicht gewachsen bin. Wenn es um Araber geht, höre ich Sprüche, die ich nicht mag - viele reden schäbig über Araber und das ist eindeutig Rassismus. Natürlich hat das mit der politischen Situation zu tun, mit dem Hass, der über Jahrzehnte hinweg genährt worden ist, aber ich finde das schrecklich und sage auch etwas dagegen. Wenn ich aber in solchen Fällen meine Meinung geäußert habe, wurde ich zurückgepfiffen mit der Bemerkung: „Du misch dich da nicht ein, du lebst anderswo - noch dazu in Deutschland.” Es ist auch hart, in Israel zu leben, es ist ein ganz anderer Alltag, man spürt den politischen Druck. Die Leute sind manchmal sehr forsch und aggressiv. Andererseits sind sie viel offener und warmherziger als in Deutschland; ich mag ihre Mentalität, ihren Witz. Ich bin sehr gern in Israel, es ist mein zweites Zuhause, auch, weil meine Großeltern dort leben. Allein aus meiner Geschichte heraus bin ich anderen Kulturen gegenüber offen. Ich bin Jüdin, meiner Familie wurde viel angetan, schon deshalb kann ich und will ich nur offen sein, ich möchte keinen anderen Menschen ausgrenzen, weil er ein anderes Herkunftsland, Kultur oder Hautfarbe hat. Auch deshalb bin ich meinen Eltern dankbar: Sie sagten immer, es kommt nicht darauf an, woher jemand stammt, welche Hautfarbe er hat, sondern ob er ein guter Mensch ist. Meine Eltern sind absolut weltoffene Menschen, sehr gute Menschen, denen ich eine schöne Kindheit und Jugend verdanke. Grundsätzlich ist es nicht wichtig für mich, jüdische Freunde zu haben. Es gibt viele Juden, die mir absolut unsympathisch sind, genauso wie Deutsche. Leider traf ich bisher wenig Juden, mit denen ich eine tiefe Freundschaft hätte entwickeln können. Aber wenn man mit Juden über einige Themen redet, geht manches leichter, man braucht nichts zu erklären, ein Grundverständnis ist da, wobei bei Nichtjuden erst eine Sensibilität geweckt werden muss. Von Nichtjuden hört man manchmal einen blöden Satz, der zwar nicht böse gemeint, aber einfach irgendwo aufgeschnappt worden ist. Ein Vorurteil, das von diesen Menschen gar nicht als Vorurteil wahrgenommen wird. Dann fragt man, weißt du eigentlich, was du gesagt hast? Wenn man versucht, die Sache zu klären, kommt es schon vor, dass man an kleine Grenzen gerät - an Barrieren, die nicht leicht zu überwinden sind. Der Sprachgebrauch zeugt manchmal davon, dass die Sensibilität absolut fehlt. Wenn ich zum Beispiel höre: „Da musste ich arbeiten bis zum Vergasen”, „den kannst du in der Pfeife rauchen” werde ich sehr wütend und da schalte ich mich sofort ein. Mit Philosemitismus habe ich öfter zu tun als mit Antisemitismus. Neulich ist mir etwas passiert, was mich sehr aufbrachte und wo ich dachte, das ist typisch Deutschland. Ich arbeitete bei den Jüdischen Kulturtagen mit, leitete das künstlerische Betriebsbüro und die Pressearbeit. Unter den Besuchern hatten wir „Stammkunden”, von denen viele philosemitisch waren. Vor kurzem nahm ich auf einer Geburtstagsfeier teil, wo ich Querflöte spielte; da kam eine Frau auf mich zu und sagte: „Wir kennen uns doch von den Jüdischen Kulturtagen”. Sie fragte mich, ob ich schon in der Ausstellung „Juden in Berlin zwischen 1938 und 1945” im Centrum Judaicum gewesen bin. Als ich es verneinte, fing sie an, mit großem Elan: „Ach, Sie müssen das sehen, es ist großartig. Da kommen einem nur die Tränen, wenn einem wieder klar wird, was die Deutschen getan haben”. Und sie wollte damit nicht aufhören, in allen Einzelheiten zu erzählen, was in der Ausstellung gezeigt wird. Ich unterbrach sie und meinte, das ist schön, dass sie sich so dafür interessiert, aber ich kenne diese Geschichten. Sie sollte das lieber Leuten erzählen, die keine Ahnung davon haben. Wenn Juden als Abfalleimer für das schlechte Gewissen mancher Deutschen benutzt werden, kann ich es nicht ausstehen. Man soll normal über die Vergangenheit reden. Manchmal sagen Freunde von mir, sie haben einen Film gesehen, zum Beispiel „Das Leben ist schön” oder „Der Zug des Lebens” und würden gern mit mir darüber sprechen, wie ich das empfinde. Dazu bin ich gern bereit, mir ist es aber wichtig, nicht mit Berührungsängsten an dieses Thema heranzugehen, oder wenn die Ängste da sind, sie auch ruhig zu benennen, sich ehrlich damit auseinanderzusetzen. Eigentlich wollte ich Musikerin werden - seit 15 Jahren spiele ich Querflöte - entschied mich aber doch anders. Es gibt so viele gute Querflötisten, deshalb landet man womöglich in irgendeinem kleinen Orchester, man muss 8 Stunden am Tag üben und immer das Gleiche spielen. Nein, dachte ich, so ein Typ bin ich nicht. Ich möchte spielen, wenn ich Lust habe. Nach dem Abitur habe ich 1994 Praktikum beim RIAS, dem Westberliner Radio gemacht, das dann mit dem Deutschlandsender aus dem Osten zu Deutschlandradio Berlin fusioniert worden ist. Die vier Monate, die ich dort verbrachte gefielen mir so gut, dass ich als freie Mitarbeiterin dort blieb. Als Sprecherin und als Kinderfunkmoderatorin fing ich an und langsam ließ man mich auch kleine Sendungen machen. Auch heute bin ich dort. Nebenbei begann ich ein Studium der Publizistik und der Theaterwissenschaften, aber ehrlich gesagt studiere ich nur das Wichtigste, weil ich sehr viel arbeite und das macht mir wesentlich mehr Spaß. Mit dem Studium bin ich aber mittlerweile fast fertig und ich werde es auf jeden Fall beenden, weil mir sehr wichtig ist, einen Abschluss zu haben. Neben den Kindersendungen „Kakadu”, mache ich hauptsächlich kulturelle und gesellschaftliche Beiträge, ich berichte über Festivals, Konzerte, Theater, Ausstellungen - auch OffKultur -, über Großstadtthemen und jüdische Themen. Mit jüdischen Themen beschäftige ich mich, seitdem ein Redakteur mich fragte, ob ich nicht die jüdische Schule, wo ja meine Mutter arbeitet, vorstellen wollte. Der Sender hatte nämlich eine Serie über verschiedene Schulen. Meinen Beitrag hat ein Redakteur vom Deutschlandfunk gehört, der eine jüdische Sendung betreut und bot mir an, auch für ihn zu arbeiten. Deutschlandradio Berlin ist meines Erachtens ein seriöser Sender, der sich fundiert mit Themen beschäftigt. Meine Arbeit wird als gut empfunden, aber ich habe bemerkt, dass die Tatsache, dass ich Jüdin bin, auch eine Rolle spielt. Das Durchschnittsalter ist dort Ende 40, also man hat es mit der klassischen zweiten Generation zu tun und ab und zu werden Entscheidungen auch durch das schlechte Gewissen gesteuert. Ich sage nicht, dass ich Jüdin bin, weil ich denke, die Menschen sollen mich unvoreingenommen kennen lernen. Früher stellte sich das aber ganz schnell heraus. Leute fragten mich, was ist das für ein Name „Shelly”? Ein englischer, sagte ich. „Ach, ihre Eltern kommen aus England?” „Nein.” „Dann sind sie Deutsche?” Nicht ganz, meinte ich und so kam man schnell darauf. Heutzutage vermeide ich lieber, mich auf solche Fragerei einzulassen, ich sage, wir leben in Deutschland und manchmal ist das Thema damit abgetan. Es ist mir überhaupt nicht peinlich zuzugeben, dass ich Jüdin bin, nur möchte ich, dass die Leute sachlich an mich herantreten. Ich will wegen meines Wesens akzeptiert werden und nicht wegen meiner Herkunft. Beim Sender nimmt man mich bei jüdischen Themen gern, weil ich kritisch bin. Viele Nichtjuden halten sich bei der Behandlung von jüdischen Themen mit der Kritik zurück. Als von der Jüdischen Gemeinde vor der Einstellung des Rabbiners Rothschild ganz dringend ein Rabbiner gesucht wurde und keiner nach Berlin wollte, habe ich über dieses Thema berichtet. Bei der Schilderung des Problems sagte ich ganz klar, dass es auch ausgenutzt wird, um die Gehälter hochzudrücken. Viele Juden waren entsetzt, sie wandten ein: „Das kannst du nicht machen, was sollen die Gojim denken?” Nachdem Andreas Nachama Vorsitzender der Berliner Gemeinde wurde, machte ich ein langes Interview mit ihm und stellte auch die Streitigkeiten dar. Viele würden dieses Thema gar nicht anrühren. Mir ist es aber ein großes Bedürfnis, die Gegebenheiten nicht zu verschönern, ich möchte ehrlich darüber berichten und auch zeigen, dass es auch eine Form von Normalität ist. Normalität ist immer das große Stichwort. Kann es eine Normalität geben? Ich denke, man muss alles dafür tun, dass es sie wieder gibt. Vielleicht werden meine Kinder oder Enkelkinder einigermaßen darüber sprechen können. Im Verhältnis zur Anzahl der Juden, die in Deutschland leben, beschäftigen sich die Medien viel mit jüdischen Themen. Sicherlich will man auf diese Weise etwas gutmachen. Dass die Proportion nicht stimmt, zeigt auch, wie lange es dauert, die Geschichte auch innerlich zu verarbeiten. Andererseits ist es erschreckend, wie lange manches verdrängt und verschwiegen wurde, und dass Mythen erst nach 50 Jahren zerbröckeln, wie zum Beispiel die von der reinen und guten Schweiz. 50 Jahre sind eigentlich nicht viel, trotzdem erstaunt es mich, was alles jetzt noch hoch geschwemmt wird: die Suche nach geraubten Kunstschätzen und Entschädigungszahlungen, die erst jetzt geleistet werden sollen. Was ich auf der ganzen Welt verlogen finde, insbesondere in Deutschland, immer wieder zu gedenken, aber nicht die Konsequenzen ziehen zu wollen. Die Shoah wird immer als einmaliges Ereignis dargestellt, das war es sicherlich auch, aber Völkermord passiert bis heute auf der ganzen Welt, Vertreibung und Ungerechtigkeiten werden akzeptiert, sogar unterstützt. Wenn gesagt wird, man möchte aus der Geschichte lernen, ist die Frage für mich, wie geht man damit heute um, wie verhält man sich heute? Man kann noch so viele Mahnmäler bauen, wichtig ist, welche Politik verfolgt wird. Warum muss Deutschland an die Türkei Panzern liefern und wie können Giftgasanlagen in den Irak verkauft werden? Wenn das geschehen kann, macht es für mich keinen Sinn, zu gedenken und Mahnmäler zu bauen. Meiner Meinung nach müssten moralische Instanzen hier in Deutschland viel betonter auftreten. Als Anfang der 90-er Jahre die schrecklichen Anschläge auf Asylantenheime in Mölln und Solingen verübt worden sind, hätte sich der Bundeskanzler von damals an die Spitze einer großen Demonstration stellen müssen. So, wie es in Frankreich Mitterrand tat. Es ist bequem zu sagen, es tut uns so leid, aber die Ehrlichkeit kann daran gemessen werden, ob man auch etwas dagegen macht in unserer heutigen Welt. Für viele Nichtjuden sind, glaube ich, Juden in Deutschland irgendwo suspekt und fremd - es gibt ja so wenige. Die meisten Deutschen kennen persönlich gar keine Juden. Wenn man Leute kennt, sind das wie Michael Friedman oder früher Ignatz Bubis, herausragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich immer wieder zu jüdischen Fragen äußern. Es ist auch wichtig, dass sie das Wort erheben. Manchmal habe ich aber Angst, dass man aufgrund ihrer Fähigkeiten und Verhaltensweisen stigmatisiert wird. Wenn bei ihnen einem etwas nicht gefällt, nimmt er das auch bei allen Juden an. Viele Deutsche wissen sehr wenig über Juden und verbinden ganz merkwürdige Vorstellungen mit ihnen - das finde ich schade. Gerade nach der Wende, als über Besitzansprüche, Grundstücke, Entschädigungen verhandelt worden ist und Jewish Claims Conference mit der Bundesregierung Gespräche führte, waren ganz miese Töne zu hören und die gibt es heute noch: „Jetzt kommen sie wieder und wollen haben, was eigentlich uns gehört. Da hat man es wieder. Die Juden wollen immer nur Geld.” Aber es gibt auch andere, die sagen, es ist richtig, sie sollen ihr Recht bekommen, es wurde ihnen weggenommen, sie sollen es auch zurückhaben. Letztere sind aber wahrscheinlich eher in der Minderheit. Andererseits kann ich verstehen, wenn Leute so verunsichert sind und nicht wissen, wie man sich eigentlich Juden gegenüber verhalten soll. Allein das Wort „Jude” - viele Deutsche trauen sich nicht, das zu sagen, anstatt dessen sagen sie „jüdische Mitbürger”, „jüdische Nachbarn”, jüdische Menschen”. „Jude” oder „Jüdin” zu sagen, ist Tabu. Für mich wäre das überhaupt nicht beleidigend, obwohl es natürlich auf den Ton ankommt. Wenn man es ganz normal ausspricht, sehe ich darin kein Problem. Es wäre wichtig, über diese Hemmungen offen reden zu können. Fremd fühle ich mich hier nicht, ich habe das Glück, mich in einem Umfeld zu bewegen, wo die Menschen aufgeschlossener sind. Ausserdem lebe ich in einer Grossstadt, wo die Menschen gewöhnt sind, Leute anderer Kulturen zu treffen. Bisher habe ich noch keinen Juden kennegelernt, den ich gern als Partner hätte. Aber nicht nur bei den Freunden, auch bei dem Ehepartner zählt es für mich nicht, ob er jüdisch ist. Manchmal denke ich darüber nach, wie es wird, wenn ich Kinder habe. Ich möchte schon, dass sie säkular jüdisch erzogen werden und dafür brauche einen Partner, der damit einverstanden ist. Seit vier Jahren habe ich eine Beziehung. Mein Freund ist grundsätzlich damit einverstanden, wie ich die Erziehung der Kinder mir vorstelle, aber viele sind das bestimmt nicht. Das wird bei meiner Partnerwahl ein Kriterium sein, denke ich. Der Partner darf sich aber nicht überrannt fühlen, die Erziehung der Kinder muss auf beiderseitigem Verständnis beruhen. Zum Judentum fühle ich mich schon sehr zugehörig. Mit den Juden teile ich eine sehr lange Geschichte, eine Tradition, die Kultur, ein Erbe, den Humor. Was ich so schön finde an meiner Situation, dass ich mich sowohl in der deutschen als auch der israelischen Kultur und Mentalität heimisch fühle, und das ist eine Bereicherung. Und weil ich unterschiedliche Wurzeln habe, kann ich dadurch auch eine Distanz zu mir selbst erlangen. Jüdisch zu sein beinhaltet für mich dieses Verschiedene. Das ist aber nur meine Interpretation, für viele Juden gilt es nicht. Speziell in Amerika haben die meisten Juden Probleme damit, dass man in Deutschland lebt, man wird richtig angefeindet. Ich habe es satt, mich zu rechtfertigen. Heutzutage, wenn man das Glück hat, Ausbildung und Arbeit zu haben, sich selbst ernähren zu können, kann man frei entscheiden, wo man leben möchte. Das ist der Vorteil unserer Zeit. Deswegen möchte ich mir nicht vorwerfen lassen, dass ich hier lebe. Jeder hat das Recht zu fragen, warum lebst du da, wie machst du das; dann sage ich auch gern etwas dazu, weil es natürlich eine interessante Frage ist, gerade für Juden, die nicht in Deutschland leben. Aber ich möchte deshalb nicht Feindseligkeit erleben müssen. Für mich ist Diaspora ein veraltetes Wort. Die Verpflichtung, die damit im ursprünglichen Sinne verbunden ist, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Viele gebrauchen das Wort, ohne richtig darüber nachzudenken, denn wenn man es konsequent weiterdenkt, würde es bedeuten, dass man nach Israel geht. Werden aber diese Menschen gefragt, würdest du das tun, verneinen sie es. Es wäre auch schrecklich, wenn alle Juden in Israel leben würden. In jedem Land gibt es Probleme. In Deutschland kommt die spezifische Geschichte noch dazu und die hat viel mit Juden zu schaffen. Aber das ist für mich kein Grund, nicht hier zu bleiben. Ich finde Deutschland sehr lebenswert. Uns allen geht es hier verdammt gut. GLOSSAR Anthroposophie die von Rudolf Steiner begründete Weltanschauungslehre, nach der der Mensch höhere seelische Fähigkeiten entwickeln und dadurch übersinnliche Erkenntnisse erlangen kann. Auf pädagogischem Gebiet übt die Anthroposophie Einfluss durch die Waldorfschulen aus. Aschkenasim (Einzahl: Aschkenas) Bezeichnung für die Juden in Mittel- und Osteuropa mit eigener Tradition und Sprache (Jiddisch). Aschkenas war im Mittelalter der hebräische Name Deutschlands. Bar-Mizwa (aramäisch und hebräisch „Sohn des Gebots”) Zulassungsfeier der Jungen im Alter von 13 Jahren zum Gottesdienst der Erwachsenen. Bat-Mizwa (hebräisch „Tochter des Gebots”) Das weibliche Pendant zum Bar-Mizwa. Mädchen werden im Alter von 12 Jahren mündig. Brit Mila (hebr. „Bund der Beschneidung”) Ritus der Beschneidung, durch den jüdische Knaben im Alter von acht Tagen offiziell in den Bund Abrahams aufgenommen werden. Männer, die sich zum Judentum bekehren, müssen ebenfalls beschnitten werden. Chanukka (hebräisch „Einweihung”) achttägiges Lichterfest. Es beginnt am 25. Tag des jüdischen Monats Kislev (im Monat Dezember des gregorianischen Kalenders). Mit Chanukka wird daran erinnert, wie der Tempel in Jerusalem von Judas Makkabäus 165 v. Chr. neu geweiht wurde, nachdem er von dem syrischen König Antiochos IV. Epiphanes entweiht worden war. Chassidismus (hebr. „Chassid”: „der Fromme”) im 18. Jahrhundert entstandene religiöse Bewegung des osteuropäischen Judentums. Ihre Anhänger betonten die Liebe Gottes und strebten eine Verinnerlichung des religiösen Lebens an, der starren Gesetzeslehre setzten sie eine lebendige Frömmigkeit entgegen. Kennzeichnend ist die enge persönliche Bindung an einen Meister (Rebbe) als „Lebendigen Gotteslehrer”. Diaspora (griechisch „Zerstreuung”) im allgemeinen die Bezeichnung für eine religiöse oder nationale oder ethnische Minderheit und ihre Lebensbedingungen außerhalb ihrer Heimat. Im besonderen wird der Begriff auf die jüdischen Gemeinden außerhalb Israels, das so genannte Diasporajudentum bezogen. Displaced Persons (DP) nach Ende des 2. Weltkriegs Bezeichnung für ehemalige Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und Häftlinge aus Konzentrationslagern, die gezwungen waren, außerhalb ihres Heimatlandes zu leben. Die von den Deutschen und ihren Verbündeten in das deutsche Reichsgebiet verschleppten DPs wurden nach dem Krieg nur allmählich und bei weitem nicht vollständig repatriiert. Goi (Mehrzahl: Gojim) jüdische Bezeichnung für Nichtjude Haggada (hebräisch „Erzählung”) das Ritual für die Verlesung des biblischen Berichts vom Auszug aus Ägypten und die Erklärung seiner Bedeutung im Rahmen der Familienfeier am Vorabend des Pessachfestes. Halacha (hebräisch „Wandel”) das jüdische Religionsgesetz Holocaust (von griechisch holokaustos „völlig verbrannt”, übertragen „Brandopfer”, „Massenvernichtung”) aus der englischen Bibelsprache ins Deutsche übernommener Begriff, der speziell auf die Ermordung der europäischen Juden durch die Nationalsozialisten im Rahmen der so genannten „Endlösung” übertragen wurde. In Deutschland wurde der Begriff in den achtziger Jahren anhand einer amerikanischen Fernsehserie eingeführt. Wegen der begrifflichen Implikation des „Geopfertwerdens” ist die Bezeichnung Holocaust allerdings nicht unumstritten; viele Angehörige des Judentums bevorzugen das hebräische Wort Shoah. Jeschiwa (hebräisch „Sitz”) Eine höhere Lehranstalt, in der die Gesetze und religiöse Überlieferungen des nachbiblischen Judentums gelehrt werden. Jewish Claims Conference amerikanische Organisation, die sich um Wiedergutmachungsforderungen von HolocaustOpfern sorgt. Jiskor Gedenkgebet für die Toten Jom Hashoah Holocaustgedenktag, israelischer Gedenktag, der seit 1951 alljährlich nach dem jüdischen Pessach-Fest abgehalten wird. An diesem Tag gedenkt man mit Schweigeminuten und Gedenkfeiern der rund sechs Millionen Juden, die während der Zeit des Nationalsozialismus in Europa getötet wurden. Jom Kippur (hebr. „Tag der Sühne”) Fastentag, höchster und heiligster Tag im jüdischen Jahr. Es ist der Abschluss und Höhepunkt der zehn Bußtage, die mit Rosch Haschana, dem Neujahrsfest beginnen. Jom Kippur und Rosch Haschana werden im September oder in der ersten Oktoberhälfte gefeiert. Jom-Kippur-Krieg vierter bewaffneter Konflikt 1973 zwischen Israel und den benachbarten arabischen Staaten. Ägypten und Syrien begannen den Krieg gegen Israel an dem jüdischen Feiertag Jom Kippur. Kaschrut jüdische Speiseregeln, die den Verzehr von bestimmten Lebensmitteln verbieten und vorschreiben, wie andere zubereitet werden müssen. Siehe auch koscher. Kibbuz Gemeinschaftssiedlung auf kollektivistischer Grundlage in Israel Kiddusch (hebräisch „Heiligung”) jüdisches Gebet, das am Sabbat, an religiösen Feiertagen und am Neujahrsfest (Rosch Haschana) gesprochen wird. Vor dem Festmahl am Vorabend des Sabbats oder Feiertages spricht der Hausherr das Kiddusch über einem Becher Wein. Kippa Kopfbedeckung für jüdische Männer. Als Zeichen des Respekts vor Gott bedecken die Juden ihren Kopf während des Gebets mit einem Gebetskäppchen oder einem Hut Kohen (Mehrzahl: Kohanim, hebr. „Priester”) die Nachkommen des Hohenpriesters Aaron Koscher (hebr. kascher „einwandfrei”) nach den jüdischen Speiseregeln rituell rein. Nur der Genuss von bestimmten Fleisch ist erlaubt, die rituell geschlachtet werden müssen. Milch und Fleisch dürfen nicht zusammen gekocht und gegessen werden, für beides ist der Gebrauch von verschiedenem Geschirr und Besteck sowie von verschiedenen Handtüchern und Spülen vorgesehen. Levit (nach dem jüdischen Stamm Levi) die Nachkommen von Levi. Im Tempel waren sie Diener und Musiker. Lubawitscher eine mystisch-chassidische Sekte mit 200 000 Anhängern nach dem Ort Ljubavicsi in Russland, wo es eine berühmte Schule des Chassidismus gab. Heute ist ihr Sitz in Brooklyn. Magen David (hebr. „Schild Davids”) Davidstern Neolog im Gegensatz zu: orthodox: religiöse Neuerungen akzeptierend Orthodox (griechisch orthodoxos „rechtgläubig”) Bezeichnung für gesetzestreue Juden Patriarch biblischer Erzvater Peies (jiddisch, aus hebr. „Pejot”) Schläfenlocken Pessach (Passah) jüdisches Fest zum Gedenken an den Auszug der Juden aus Ägypten und ihre Flucht durch das Rote Meer. Das Fest beginnt am 14. Tag des Nisan, dem ersten Monat des jüdischen Kalenders, und dauert in Israel sieben und in der Diaspora acht Tage. Das Fest wird auch als „Fest der ungesäuerten Brote” (Matzen) bezeichnet. Sowohl das christliche Abendmahl als auch das Osterfest gehen geschichtlich auf das Passahfest zurück. Pogrom (russisch) der Begriff bezeichnete ursprünglich die im zaristischen Russland, in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts, verbreiteten Übergriffe gegen jüdische Siedlungen. Heute wird der Ausdruck für gewaltsame Ausschreitungen gegen nationale, religiöse oder ethnische Minderheiten - unter anderem gegen Juden - verwendet. Rosch Haschana (hebr. „Kopf des Jahres”) zweitägiges jüdisches Neujahrsfest am 1. und 2. Tischri (September/Oktober) Sabbat (hebräisch Shabbat, abgeleitet vom Verb savat „ausruhen, aufhören”) der wöchentliche Ruhetag (Samstag) zur Erinnerung an die Schöpfung. Sabra und Shatila palästinensische Flüchtlingslager im Libanon, deren Bewohner von christlichen Falangisten 1982 ermordeten wurden. Das israelische Militär, das die Aufsicht über die Lager hatte, beteiligte sich zwar nicht an der Gräueltat, sah aber dem Morden zu, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Schammes (jiddisch von hebr. Schamasch „Diener”) Synagogendiener Sechstagekrieg bewaffneter Konflikt im Juni 1967 zwischen Israel und Ägypten, Jordanien und Syrien, die vom Irak, von Kuwait, Saudi-Arabien, dem Sudan und Algerien unterstützt wurden. Israel schlug in sechs Tagen die arabischen Armeen und besetzte die gesamte Sinai-Halbinsel, das Westjordanland, Ost-Jerusalem sowie die Golanhöhen. Seder das rituelle Mahl beim jüdischen Pessachfest. Während des Festes wird aus der PessachHaggada gelesen. Sephardim die auf der iberischen Halbinsel und in Nordafrika lebenden Juden und ihre Nachkommen; ihre Sprache ist Ladino. Shiva (von hebr. „sieben”) 7 tägiges Trauerritual für die Verstorbenen in der Familie Shoah (hebr. „Vernichtung”, „Katastrophe”) in der jüdischen Welt wird dieser Begriff für den Holocaust, die Ermordung europäischer Juden benutzt. Stettl Jiddischer Begriff für Dörfer und Kleinstädte in Osteuropa vor dem Krieg, in denen überwiegend Juden lebten Tallit jüdischer Gebetsschal, Gebetsmantel. Er wird während des Gottesdienstes über der Kleidung getragen. Talmud (hebräisch „Lehre”) Sammlung der Gesetze und religiöser Überlieferungen des nachbiblischen Judentums. Thora (hebräisch „Weisung”) ist die jüdische Bezeichnung für die fünf Bücher Mose, die in der Synagoge in Form einer Pergamentrolle aufbewahrt und aus der während des Gottesdienstes am Sabbat vorgelesen wird. Yad Vashem Gedenk- und Forschungsstätte in Jerusalem zur Erinnerung an die Opfer des Holocaust. Zionismus im späten 19. Jahrhundert entstandene, auf die Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina gerichtete religiös-politische Bewegung. Theodor Herzl, der Begründer des Zionismus entwarf in seinem Werk Der Judenstaat die Vision einer Heimstätte für die überall in der Welt lebenden Juden. Die Autorin: Katalin Karcagi wurde 1955 in Budapest geboren, studierte Kulturwissenschaften, Medienforschung und Germanistik. Arbeitete 17 Jahre als außenpolitische Redakteurin und Ressortleiterin von „Magyar Hírlap”, einer der renommierten Tageszeitungen Ungarns. Schwerpunkte: Fragen der europäischen Integration, Verflechtung von Geschichte und Gegenwart in der Politik. Sie lebt als freie Journalistin in Budapest. Das Buch: Können sich Kinder und Enkelkinder von Verfolgten Deutschland zugehörig fühlen? Zweiteund Dritte Generation-Juden, die aus dem Westen nach Deutschland kamen, erzählen ihre Lebensgeschichten. Sie haben zum Teil deutsche Wurzeln oder eine andere Verknüpfung mit Deutschland. Was hat die Rückkehrer getrieben und wie nehmen sie sich und ihre Umgebung heute wahr? Wie sind sie mit den inneren Zerreißproben fertig geworden? Warum gibt es immer noch die Gegenüberstellung - „Wir Juden”, und „Sie, die Deutschen?” Besteht die Chance, dass Bedenken und Ängste auf der einen und Beklemmungen auf der anderen Seite je überwunden werden? Das Buch sucht nach Antworten.