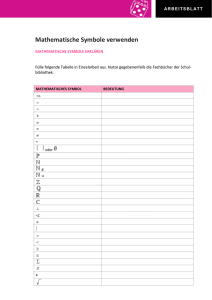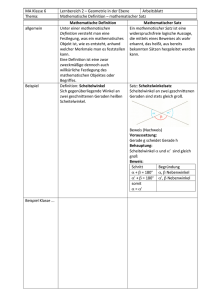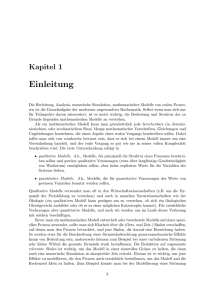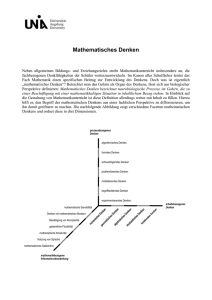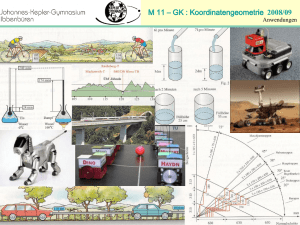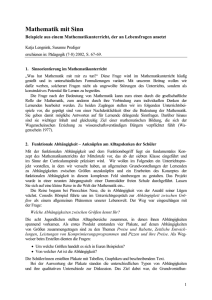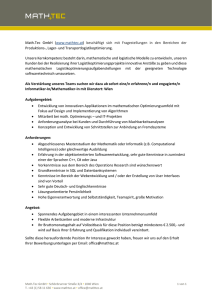Ist Wille Realist oder Anti-Realist oder ist das egal - RPI
Werbung
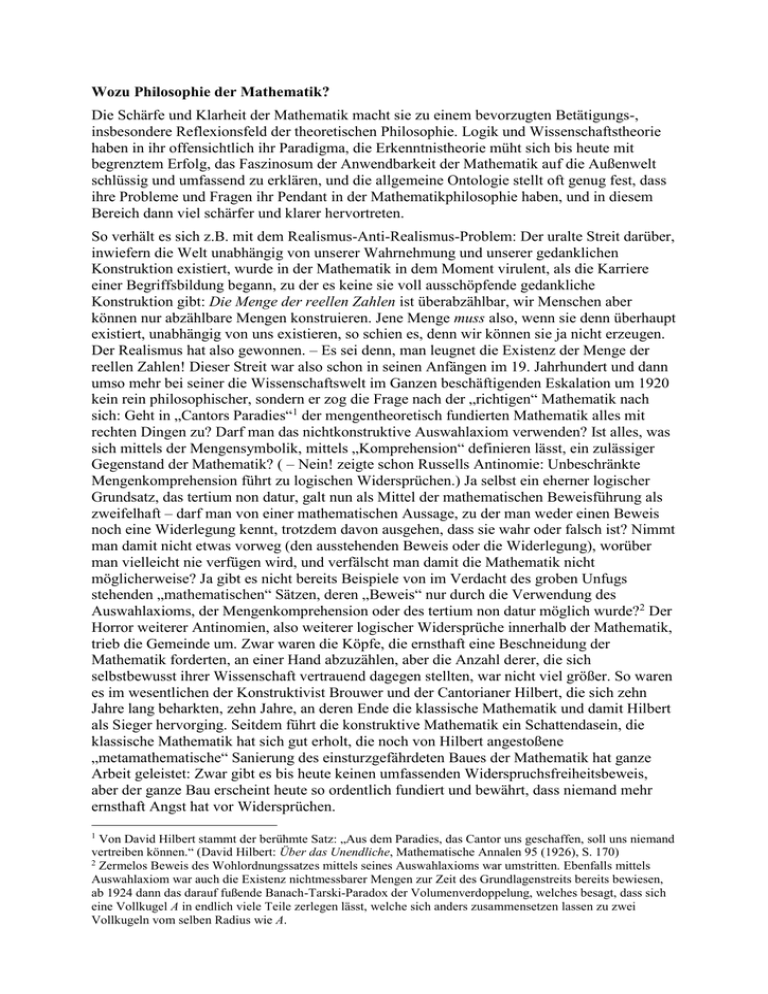
Wozu Philosophie der Mathematik? Die Schärfe und Klarheit der Mathematik macht sie zu einem bevorzugten Betätigungs-, insbesondere Reflexionsfeld der theoretischen Philosophie. Logik und Wissenschaftstheorie haben in ihr offensichtlich ihr Paradigma, die Erkenntnistheorie müht sich bis heute mit begrenztem Erfolg, das Faszinosum der Anwendbarkeit der Mathematik auf die Außenwelt schlüssig und umfassend zu erklären, und die allgemeine Ontologie stellt oft genug fest, dass ihre Probleme und Fragen ihr Pendant in der Mathematikphilosophie haben, und in diesem Bereich dann viel schärfer und klarer hervortreten. So verhält es sich z.B. mit dem Realismus-Anti-Realismus-Problem: Der uralte Streit darüber, inwiefern die Welt unabhängig von unserer Wahrnehmung und unserer gedanklichen Konstruktion existiert, wurde in der Mathematik in dem Moment virulent, als die Karriere einer Begriffsbildung begann, zu der es keine sie voll ausschöpfende gedankliche Konstruktion gibt: Die Menge der reellen Zahlen ist überabzählbar, wir Menschen aber können nur abzählbare Mengen konstruieren. Jene Menge muss also, wenn sie denn überhaupt existiert, unabhängig von uns existieren, so schien es, denn wir können sie ja nicht erzeugen. Der Realismus hat also gewonnen. – Es sei denn, man leugnet die Existenz der Menge der reellen Zahlen! Dieser Streit war also schon in seinen Anfängen im 19. Jahrhundert und dann umso mehr bei seiner die Wissenschaftswelt im Ganzen beschäftigenden Eskalation um 1920 kein rein philosophischer, sondern er zog die Frage nach der „richtigen“ Mathematik nach sich: Geht in „Cantors Paradies“1 der mengentheoretisch fundierten Mathematik alles mit rechten Dingen zu? Darf man das nichtkonstruktive Auswahlaxiom verwenden? Ist alles, was sich mittels der Mengensymbolik, mittels „Komprehension“ definieren lässt, ein zulässiger Gegenstand der Mathematik? ( – Nein! zeigte schon Russells Antinomie: Unbeschränkte Mengenkomprehension führt zu logischen Widersprüchen.) Ja selbst ein eherner logischer Grundsatz, das tertium non datur, galt nun als Mittel der mathematischen Beweisführung als zweifelhaft – darf man von einer mathematischen Aussage, zu der man weder einen Beweis noch eine Widerlegung kennt, trotzdem davon ausgehen, dass sie wahr oder falsch ist? Nimmt man damit nicht etwas vorweg (den ausstehenden Beweis oder die Widerlegung), worüber man vielleicht nie verfügen wird, und verfälscht man damit die Mathematik nicht möglicherweise? Ja gibt es nicht bereits Beispiele von im Verdacht des groben Unfugs stehenden „mathematischen“ Sätzen, deren „Beweis“ nur durch die Verwendung des Auswahlaxioms, der Mengenkomprehension oder des tertium non datur möglich wurde?2 Der Horror weiterer Antinomien, also weiterer logischer Widersprüche innerhalb der Mathematik, trieb die Gemeinde um. Zwar waren die Köpfe, die ernsthaft eine Beschneidung der Mathematik forderten, an einer Hand abzuzählen, aber die Anzahl derer, die sich selbstbewusst ihrer Wissenschaft vertrauend dagegen stellten, war nicht viel größer. So waren es im wesentlichen der Konstruktivist Brouwer und der Cantorianer Hilbert, die sich zehn Jahre lang beharkten, zehn Jahre, an deren Ende die klassische Mathematik und damit Hilbert als Sieger hervorging. Seitdem führt die konstruktive Mathematik ein Schattendasein, die klassische Mathematik hat sich gut erholt, die noch von Hilbert angestoßene „metamathematische“ Sanierung des einsturzgefährdeten Baues der Mathematik hat ganze Arbeit geleistet: Zwar gibt es bis heute keinen umfassenden Widerspruchsfreiheitsbeweis, aber der ganze Bau erscheint heute so ordentlich fundiert und bewährt, dass niemand mehr ernsthaft Angst hat vor Widersprüchen. Von David Hilbert stammt der berühmte Satz: „Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können.“ (David Hilbert: Über das Unendliche, Mathematische Annalen 95 (1926), S. 170) 2 Zermelos Beweis des Wohlordnungssatzes mittels seines Auswahlaxioms war umstritten. Ebenfalls mittels Auswahlaxiom war auch die Existenz nichtmessbarer Mengen zur Zeit des Grundlagenstreits bereits bewiesen, ab 1924 dann das darauf fußende Banach-Tarski-Paradox der Volumenverdoppelung, welches besagt, dass sich eine Vollkugel A in endlich viele Teile zerlegen lässt, welche sich anders zusammensetzen lassen zu zwei Vollkugeln vom selben Radius wie A. 1 Nun sagen einige Beweistheoretiker, wie sich die Metamathematiker heute lieber nennen, sogar, sie hätten während der Sanierung festgestellt, dass die Statik des Baues es mittlerweile zulasse, einen großen Teil des Fundaments einfach wegzuhauen, unter anderem all jenes, was früher die vom Einsturz bedrohten Teile getragen habe. Diese Teile und damit die gesamte Mathematik ruhten inzwischen ganz solide auf dem wahren Fundament, und dieses werde gebildet durch eine erstaunlich sparsame Theorie, einer Erweiterung der elementaren Arithmetik, welche aber noch „prädikativ“3 sei, d.h. auch für Konstruktivisten akzeptabel. Der alte Schein, nur Realisten dürften die Menge der reellen Zahlen benutzen, scheint widerlegt. Das Dumme ist allerdings, dass die Statik des Baues, von der die Beweistheoretiker diese wundersamen Dinge behaupten, so kompliziert ist, dass deren Behauptungen kaum jemand nachvollziehen kann, die meisten Mathematiker und Mathematikphilosophen stehen schlicht vor der Wahl: Glauben oder nicht Glauben.4 Und da macht es sich nicht so gut, dass die Beweistheoretiker – was in gewisser Weise für ihre wissenschaftliche Redlichkeit spricht – gelegentlich Unsicherheit in ihren Formulierungen zeigen, ob denn wirklich alles durch ihr Restfundament gehalten wird; ob sich wirklich jeder mathematische Satz aus jener prädikativen Theorie beweisen lässt.5 Doch auch, wenn noch nicht vollauf erwiesen ist, dass sich alles Wichtige auf einer schmalen prädikativen Basis beweisen lässt, gebührt den Leistungen der Beweistheoretiker große Anerkennung; schließlich ist offenbar auch kein wichtiger mathematischer Satz bekannt, von dem erwiesen wäre, dass er sich nicht auf dieser Basis beweisen lässt. Wer hier die Beweislast trägt – die Prädikativisten oder ihre Kritiker –, ist ungeklärt. Die Beweistheoretiker liefern damit gute Argumente, wenn auch noch keinen Beweis dafür, dass die gesamte Mathematik prädikativ begründbar, also auch für Anti-Realisten akzeptabel ist. Es hätte demnach keine Konsequenzen für die mathematische Praxis, ob man nun Realist oder Anti-Realist ist. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Die beweistheoretischen Argumente selbst sind in ihren philosophischen Voraussetzungen auch sehr sparsam, sie können als philosophisch „neutral“ gelten. Die Mathematikphilosophie ist damit Privatsache des Mathematikers, auf seine Berufsausübung hat sie keinen Einfluss. Merkwürdig wäre aber, wenn ein Mathematikphilosoph kein Wort dazu sagen würde, welcher Seite er angehört. Man müsste ihn dann fragen, ob die Debatte es aus seiner Sicht gar nicht wert sei, daran teilzunehmen. Konkreter: War der Gedanke, dass es besonders lohnend ist, ein philosophisches Problem in seiner die Mathematik betreffenden Variante zu studieren, ein Irrtum? Oder ist das (Anti-)Realismus-Problem im Ganzen überflüssig, nur ein 3 Prädikative System schränken die Anwendung der Mengenkomprehension in einer Weise ein, so dass die Bildung sogenannter „imprädikativer Begriffsbildungen“ unmöglich wird. Letztere wurden schon um 1900 herum von konstruktivistischer Seite kritisiert, weil sie zwar nicht logisch zirkulär, aber sozusagen ontologisch zirkulär sind: Sie setzen typischerweise zur Definition eines mathematischen Objekts A ein anderes Objekt B voraus, welches das Objekt A bereits als Element enthalten soll oder es in anderer Weise voraussetzt. 4 Wäre hingegen ein einfaches prädikatives Basissystem bereitgestellt, so hätte es – wie vor knapp 100 Jahren die ZFC – zunächst zwar rein formalen Charakter, wäre kaum mehr als ein abstrakter Symbolismus. Es wäre aus meiner Sicht aber durchaus vorstellbar, dass sich die Mathematiker damit anfreundeten, indem sie den Axiomen, insbesondere den enthaltenen Grenzziehungen einen intuitiven Sinn gäben, und dass damit die ZFC abgelöst würde – deren Axiome im übrigen einen solchen intuitiven Sinn durchaus haben, was m.E. einen wichtigen Teil des Erfolgs der ZFC ausmacht. Dann wäre das System der „beste Vorschlag“ zur Begründung der Mathematik, und zwar nicht nur geltungstheoretisch, sondern auch im Sinne der Eleganz und der Attraktivität. 5 Vgl. hierzu Wille 2007, S. 54f. Der Verfasser hat in seiner Dissertation aber auch schon selbst erfahren müssen, was für einen formulatorischen Eiertanz es bedeutet, wenn man in einer wissenschaftlichen Arbeit die Tragweite jener beweistheoretischen Errungenschaften referieren und damit argumentieren möchte. Das grässlich Wörtchen „weitgehend“ oder noch schlimmer „weitestgehend“ muss da immer wieder herhalten. Glücklicherweise beruhte in meinem Fall die wissenschaftliche Gesamtaussage letztlich nicht auf der Beweistheorie, sondern auf einer eigenen davon unabhängigen Rechtfertigungsstrategie. Scheinproblem? Letzteres wird kaum ein Philosoph behaupten wollen. Und ich glaube auch, dass die mathematikphilosophische Variante sehr wohl die gut 100 Jahre gelohnt hat, die man sich darüber bereits den Kopf zerbrochen hat. Die Frage nach der richtigen Mathematik war vor 100 Jahren eine sehr ernste Sache, die Russellsche Antinomie hatte in der Tat etwas Bedrohliches. Die Versuche von Zermelo und Hilbert auf der Seite der Realisten, Brouwer und später Lorenzen auf der anderen Seite, eine Grundlegung der Mathematik bereitzustellen, hatten u. a. zwei Dinge gemeinsam: - Sie waren alle philosophisch fundiert, - Sie hatten das Ziel, den Grundlagenstreit zu beenden mit dem Sieg der eigenen Seite. Gewonnen hat Hilbert, allerdings nur die Mathematik betreffend, nicht jedoch in philosophischer Hinsicht, also nicht für den Realismus. Wie eigentlich immer in philosophischen Auseinandersetzungen hat sich auch hier keine der Seiten endgültig durchgesetzt. Es hat vielmehr eine Annäherung stattgefunden, die sich recht gut mit den Vokabeln des Universalienstreits des Mittelalters charakterisieren lässt: Ausgangspunkt des Konvergenzprozesses waren die Extrem-Positionen von Platonismus und Nominalismus bezüglich mathematischer Gegenstände. Nach ersterem bilden diese einen Teil der Ideenwelt, die unabhängig vom Menschen, ja sogar unabhängig von Zeit und Raum existiert; der Mensch kann lediglich, indem er sich zum Mathematiker ausbilden lässt, an den mathematischen Ideen „teilhaben“. Diese Auffassung entspricht den meisten Mathematikern, weil in ihr die Erfahrung der absoluten Objektivität und Unbedingtheit der Mathematik Ausdruck findet. Laut Nominalismus gibt es mathematische Gegenstände eigentlich überhaupt nicht; es gibt nur die Gegenstände der empirischen Außenwelt. In unserem Erfassen der Außenwelt benutzen wir Sprache, und diese enthält u.a. auch Wörter für mathematische Eigenschaften der Gegenstände. Der Nominalist gesteht bestenfalls zu, dass mathematische Gegenstände existieren, insofern wir sie benennen. In der ersten Runde der Auseinandersetzung um 1880 vertrat Cantor eine platonistische, Kronecker eine im Bezug auf die reellen Zahlen nominalistische Auffassung.6 Die Extrempositionen waren in der Hauptrunde des Streits schon deutlich näher zusammengerückt: Brouwer vertrat mit seinem Intuitionismus (in der Sprache des Universalienstreits) einen „Konzeptualismus“, dem zufolge mathematische Gegenstände zwar nicht unabhängig vom Menschen existieren, aber immerhin eine geistige, von der Sprache unabhängige Realität besitzen. Hilbert war zwar bezüglich mathematischer Gegenstände Realist, kam aber auf die raffinierte Idee, dies auf einer Metaebene mittels wiederum mathematischer Methoden zu rechtfertigen – z. B. durch Widerspruchsfreiheitsbeweise –, und auf dieser Metaebene eine strikt nominalistische, also antirealistische Position zu vertreten. Einen weiteren Annäherungsschritt tat Lorenzen, der den Konzeptualismus Brouwers sprachlich wendete und mit den Rechtfertigungsstrategie Hilberts verband. Er kam damit der klassischen Mathematik nochmals erheblich näher als seine antirealistischen Vorgänger. Auf realistischer Seite haben Vertreter der Unverzichtbarkeitsargumente mit der Rede vom „besten Vorschlag“ pragmatische und darin gar ästhetische Kriterien eingearbeitet und damit im Hinblick auf die (Un-)Abhängigkeit der Mathematik vom Menschen durchaus Zugeständnisse gemacht. Außerdem haben sie mit der Bindung an Anwendungsrelevanz einen großen Schritt in Richtung Empirie unternommen. Der Realismus in der Mathematikphilosophie hat sich damit vom Rationalismus in Richtung Empirismus bewegt, der Anti-Realismus in entgegengesetzter, d,h, entgegenkommender Richtung: Während der Von Kronecker ist das Bon Mot überliefert: „Die natürlichen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk.“ 6 frühe Anti-Realismus im Empirismus wurzelte7, war Brouwer bereits entschiedener Rationalist. Schließlich hat die philosophisch neutrale Beweistheorie den Eindruck verstärkt, den schon Lorenzen vermittelt hat, dass die Auswirkungen des philosophischen Standpunkts auf die Mathematik weit weniger groß sind, als zunächst angenommen. Der Rechtfertigungsversuch der klassischen Mathematik, d.h. der Zermelo-Fraenkelschen Mengenlehre mit Auswahlaxiom ZFC, den der Verfasser in seiner Dissertation unternommen hat, ist vom antirealistischen Ufer ausgegangen und hat ebenfalls gezeigt, dass der Graben überwunden werden kann. Der Unterschied – so zeigt sich hier – besteht nur darin, dass die Anti-Realisten erkenntnistheoretische Grenzen ernster nehmen, was man innerhalb mathematischer Formalismen auch auszudrücken versuchen könnte. Solche erkenntnistheoretischen Elemente wären dann aber ein Ausdruck für das Mathematik-betreibende Subjekt, und dies läuft dem gängigen Verständnis von Mathematik als objektiver Wissenschaft zuwider. So stellt sich aus heutiger Sicht der Eindruck eines eklatanten Gegensatzes zwischen mathematischem Realismus und Anti-Realismus als Irrtum heraus, der überwunden worden ist. Es wäre jedoch völlig verfehlt, den Streitpunkt deshalb als bloßes „Scheinproblem“ abzutun, denn der lange Streit hat sich als außerordentlich fruchtbar erwiesen. Es musste sehr viel Arbeit während der allmählichen Annäherung geleistet werden, um nun schließlich bei der Erkenntnis zu landen, dass alle Philosophen gleichermaßen die reellen Zahlen verwenden können, ihre jeweilige Verwendungsweise eben nur manchmal etwas unterschiedlich interpretieren müssen. Diese unterschiedlichen Interpretationen werden auf eine Frage wie die, ob es undefinierbare reelle Zahlen gibt, vermutlich immer unterschiedliche Antworten nach sich ziehen, aber diese Frage ist vielleicht wirklich ein Scheinproblem ganz im Sinne Wittgensteins: Wovon man nicht sprechen kann [was undefinierbar ist], darüber muss man schweigen. Letztlich sollte sich herausstellen, dass sich die ganze Grundlagendebatte auf die Frage reduziert, ob man sich mehr auf die Seite des (mathematischen) Objekts oder die des (mathematischen) Subjekts stellt. Beides sind die Seiten ein und derselben Medaille, genannt „Erkenntnis“. In dem Gang der Annäherung, den man „dialektisch“ nennen kann, wenn man möchte, hat das sich Reiben der beiden Lager aneinander die Widersprüche allmählich aufgelöst. Wie beim Schleifen zweier Körper aneinander ist am Ende, wenn alle Widerstände abgeschliffen sind, der eine schlicht das Negativ des anderen. Dieses Prinzip für den Grundlagenstreit, ja vielleicht die Philosophie allgemein als „Bewegungsprinzip“ anzuerkennen, und damit letztlich über das alte Lagerdenken hinauszukommen, ist noch nicht vollbracht. Noch immer hat man in der philosophischen Landschaft häufig das Gefühl, man befinde sich inmitten eines erbittert geführten Stellungskrieges, in dem kaum Bewegung herrscht, aber die einzige Hoffnung auf ein Ende des Krieges nur darin bestehen kann, dass eine der Seiten die andere besiegt. Dass man sich nicht bekriegt, sondern aneinander reibt, um dadurch letztlich zur Auflösung von Widersprüchen und damit zum wissenschaftlichen Fortschritt zu gelangen, bedeutet, dass man einander bedarf. Diese Einsicht zum breiten Konsens werden zu lassen, ist eine Frage der Gewohnheit, vielleicht auch des philosophischen Stils. Während Beweistheoretiker und mathematische Logiker als Angehörige der mathematischen Fakultät in ihren Beiträgen zur Grundlagendebatte natürlich keine philosophische Position 7 So benennt Paul DuBois-Reymond in einem Dialog innerhalb seiner Allgemeinen Functionentheorie aus dem Jahr 1882 den Anti-Realisten als „Empirist“ und seinen Opponent als „Idealist“. In den mathematikphilosophischen Diskussionen hundert Jahre später wird als Idealist üblicherweise der Anti-Realist bezeichnet, weil für diesen die mathematischen Gegenstände nur im menschlichen Geist als „Ideen“ existieren, für den „Realist“ hingegen in einer vom Menschen unabhängigen Realität. beziehen müssen, sondern sich damit begnügen können, Fakten zu liefern, hat ein Philosoph immer eine Position und sollte diese auch klarstellen, quasi als Index zu seinen Ausführung, als Orientierung für den Leser – nicht, um ihn einem der Lager zuordnen zu können und ihn damit je nachdem entweder von vorneherein abzulehnen oder sich mit ihm zu identifizieren, sondern um einordnen zu können, von welcher Seite des gemeinsamen Projekts da gerade geschliffen wird. Literatur: - Emrich, Johannes: Die Logik des Unendlichen. Dissertation. Logos-Verlag, Berlin 2004. - Wille, Matthias: Unverzichtbarkeitsargumente im Lichte der modernen Beweistheorie. Der Mathematikunterricht 53, Heft 5, 2007, S. 41-58.